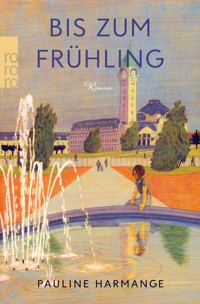
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In Anaïs' Leben läuft nichts rund. Ihr Freund hat sie verlassen, den Job hat sie verloren. Eigentlich hält Anaïs nichts mehr auf dieser Welt. Sie reist nach Limoges, angeblich ein guter Ort zum Sterben, und findet dort Unterkunft bei einer älteren Italienerin: Tiziana Conti bietet ihr an, in ihrem Palazzo zu wohnen, wenn sie dafür für sie kocht. Anaïs stimmt zu. Sie lernt Tizianas Freundinnen kennen und wird Teil einer großen Familie. Kann es sein, dass das Leben Schöneres für sie bereithält als bisher angenommen? Sie beginnt, sich selbst zu mögen. Nur als der Sohn von Tizianas bester Freundin auf den Plan tritt, ist Anaïs nicht begeistert. Aber der lässt sich davon nicht abschrecken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Pauline Harmange
Bis zum Frühling
Roman
Über dieses Buch
Limoges: ein schöner Ort zum Sterben - oder zum Lieben?
In Anaïs′ Leben läuft nichts rund. Ihr Freund hat sie verlassen, ihren Job hat sie verloren. Eigentlich hält Anaïs nichts mehr auf dieser Welt. Sie reist nach Limoges, angeblich ein guter Ort zum Sterben, und findet dort zunächst Unterkunft bei einer älteren Italienerin. Tiziana Conti bietet ihr an, in ihrem Palazzo zu wohnen, wenn sie dafür für sie kocht. Anaïs stimmt zu, sie lernt Tizianas Freundinnen kennen und wird Teil einer großen Familie. Kann es sein, dass das Leben Schöneres für sie bereithält, als bisher angenommen?
Nur als Hämon, der Sohn von Tizianas bester Freundin, auf den Plan tritt, ist Anaïs nicht begeistert. Aber der lässt sich davon nicht abschrecken ...
Vita
Pauline Harmange ist Autorin und Feministin. Ihr Skandalbuch «Ich hasse Männer» wurde in 18 Sprachen übersetzt. Harmange glaubt fest daran, dass Literatur einen entscheidenden Einfluss auf unser Verständnis von Rollenbildern hat. «Bis zum Frühling» ist ihr erster Roman.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel «Aux endroits brisés» bei Éditions Fayard, Paris.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2022
Copyright © 2022 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«Aux endroits brisés» Copyright © 2021 by Pauline Harmange
Redaktion Heike Brillmann-Ede
Covergestaltung Cordula Schmidt Design, Hamburg
Coverabbildung Julia Hoße
ISBN 978-3-644-01167-0
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Das Tattoo
(vorher)
Ich fuhr in einem klapprigen Clio mit einem klapprigen alten Paar, das sich auf den Weg an die Loire gemacht hatte, um einige Dinge wieder in Ordnung zu bringen, vielleicht auch nur, um der Karosserie eine neue Lackschicht zu verpassen. Ich musste Bruchstücke aus meinem Leben mit ihnen teilen, aber vor allem teilten sie welche aus ihrem Leben mit mir. Nach fünfzig Kilometern hatten sie die Tragweite des Problems erkannt: Ich rede nicht gern.
Als ich in Tours ankam, schien die Sonne. Es war Sommer, ein sich unverschämt einschmeichelnder Sommer. Mir war zu warm, und ich schwitzte am ganzen Körper – wegen der hohen Temperaturen und der in mir aufsteigenden Angst, die mich jeden Moment zu überwältigen drohte. Das alte Paar hatte mich, schonungslos liebenswürdig, wie es war, direkt vor dem Studio abgesetzt, das sich, zehn Minuten von der Loire und vom Stadtzentrum entfernt, dezent in einer Gasse mit Kopfsteinpflaster versteckte. Ein prächtiger Baum blühte dort, aber kein Schwein war zu sehen – ein Mensch übrigens auch nicht. Ich wartete. Wie verhielt man sich in so einer Situation? Sollte ich reingehen und sagen, dass ich schon da war? Doch ich blieb wie bestellt und nicht abgeholt nervös draußen stehen, bis irgendwann die Glocke im nahe gelegenen Kirchturm läutete. Am liebsten wäre ich auf der Stelle weggerannt. Um mich in der Loire zu ertränken. Doch es war zu spät, es gab kein Zurück mehr.
Ich betrat das Studio, in dem drei Bartträger an Architektentischen zeichneten. Meine verhuschte Gestalt und mein verlorener Blick schienen sie nicht zu überraschen.
«Ich suche Yvain …»
Meine Stimme klang falsch, was außer mir aber niemand merkte. Einer von ihnen deutete in Richtung Treppe, die spiralförmig so steil in die Tiefe führte, dass meine Mutter mir verboten hätte, sie zu benutzen. Doch ich war nicht bis nach Tours gefahren, um mich von der schrillen halluzinatorischen Stimme meiner Mutter tyrannisieren zu lassen.
Der Tätowierer erwartete mich bereits. Er lächelte und sah ziemlich gut aus, wie ich fand. Genau mein Typ würde ich ihn später meiner Schwester gegenüber beschreiben. Er hatte dunkles Haar, und wenn er lächelte, bildete sich auf seiner linken Wange ein Grübchen. Er lächelte viel.
«Ich warte auf Anaïs, bist du das?»
Mit einem kurzen, aber kontrollierten Kopfnicken bestätigte ich: Ja, ich bin Anaïs.
Yvain gefiel mir auf Anhieb. Lange hatte ich mit mir gerungen, ob ich mich wirklich über mehrere Stunden mit einem Unbekannten in einem Keller aufhalten wollte, in dem es bestimmt keinen Netzempfang gab, aber als ich vor ihm stand, war ich plötzlich ganz ruhig. Es ging mir gut.
Die Schablone war fertig. Als der Tätowierer sie mir seitlich auf die Rippen legte, stellte sich jedes einzelne Haar an meinem Körper auf. Er zog das Papier ab und die violetten Umrisse der Daphne hoben sich von meiner milchigen Haut ab, ich erschauderte. So eine war ich also? Oder könnte ich sein, wenn ich es mir erlaubte? Mir fiel es schwer, daran zu glauben. Insgeheim flehte ich Yvain an, endlich anzufangen. Ich war entschlossen, mich zu verwandeln.
Der Wunsch nach einem Tattoo hat etwas Masochistisches, leicht Wahnsinniges. Ich wusste genau, dass es tierisch wehtun würde. Ich wusste auch, dass ich den Schmerz klaglos ertragen würde. Der Grund für diese Wette mit mir selbst war der hauchfeine, aber hartnäckige Wille, ihn, den Schmerz, zu kontrollieren. Denn meinem Körper geht es alles andere als gut, ihn plagen alle möglichen Beschwerden, von denen ich natürlich keine zu kontrollieren imstande bin – selbst meine Ohren wurden in einem so zarten Alter durchstochen, dass es nicht freiwillig geschehen sein konnte. Eine bleierne Müdigkeit, verbunden mit einer unterschwelligen Wut, hatte mich, eine junge Frau von untadeligem Ruf, dazu gebracht, mich nun bewusst den mit einem Tattoo verbundenen Schmerzen auszusetzen.
Sobald ich mit sorgfältig ausgewählter Musik recht bequem lag, schloss ich die Augen und erwartete ihn. Das Tätowiergerät fing dumpf an zu brummen. Als Yvains Hände, über die er schwarze Handschuhe gestreift hatte, meine Haut berührten, musste ich mich beherrschen, nicht zusammenzuzucken, ehe mich der samtige Jazz aus den im Gebälk verborgenen Boxen in einen Trancezustand versetzte. Jenseits von Zeit und Raum trieb ich dahin, in diesem Moment und in den folgenden Stunden war ich zu einem unvollkommenen Marmorblock geworden, in den ein Schicksal eingemeißelt wurde, das nicht mehr mein eigenes war.
Unter meinen geschlossenen Lidern sah ich das Gesicht des Tätowierers mit dem Grübchenlächeln vor mir, während sich seine nach Gelegenheitsraucher klingende, tiefe und ein wenig raue Stimme in meinem Ohr mit Chet Bakers Trompete vermischte.
Seine Berührungen waren sanft. Wie er wohl als Liebhaber war? Eine dumme Frage, wenn es so etwas gibt, aber frei von jeglichem Verlangen. Eigentlich war es reine Neugier, die sich im Wesentlichen aufs Körperliche bezog, immerhin drückte er gerade die gespannte Haut meines Brustkorbs zusammen, und zwar so feinfühlig, wie man es Männern und ihrer Männlichkeit nur selten zuschreibt. Wenn er mit einer Fremden so achtsam umging, wie behandelte er dann erst eine Frau, die er liebte? Ich dachte an die wenigen Männer, deren Hände mich berührt hatten, an die eisige Kälte, die meine Haut hatte blau werden lassen, an meine abgekauten Nägel. Die Hände des Tätowierers ritzten unter den Panzer, der meinen Körper umgab, Fragmente der Ewigkeit, mit meinen Schwächen verziert. Einen Moment lang stand ich schwankend am Rande des Abgrunds, als mir klar wurde, dass die Tätowierung mein Bewusstsein überleben wird. Wenn ich zum allerletzten Mal die Augen schließe, wird die Daphne, die Yvain dicht über meinen Knochen einfräste, für immer weiter in die Ferne blicken.
Die Geschichte der Daphne ist tragisch und steht für die antike Faszination der erzwungenen Liebe. Eros, Gott der Kupplerinnen und der Liebe auf den ersten Blick, schießt mit einem Pfeil auf Apollon, den man sich gemeinhin nicht gerade hässlich und klumpfüßig vorstellt, worauf sich dieser Hals über Kopf in Daphne verliebt. Was zur göttlichsten aller romantischen Komödien hätte werden können, nimmt schnell eine bittere Wendung, da Eros nicht auf Spaß, sondern auf Rache aus war. Daphne trifft er ebenfalls mit einem Pfeil, was in ihrem Fall bewirkt, dass sie sich für immer von der Liebe abwendet. Apollon, dem es wie jedem Gott und vielleicht jedem Mann schwerfällt, ein Nein zu akzeptieren, bedrängt sie stürmisch. Erschöpft von der Flucht über Berg und Tal, um ihrem Stalker zu entkommen, bittet Daphne ihren Vater um Hilfe. Der Kerl hätte alle Möglichkeiten gehabt – kaum etwas kann ihn aufhalten, schließlich ist er selbst ein Gott –, doch er beschließt, seine eigene Tochter in einen Baum zu verwandeln. In einen Lorbeerbaum, damit sie stets einen angenehmen Duft verströmt. Man könnte meinen, die bis hierhin schon wenig erfreuliche Geschichte würde damit enden. Jedes normal entwickelte und wohlerzogene Wesen würde seine Eroberungsversuche einstellen, sobald sich das Objekt der Begierde in grünes Laubwerk verwandelt hätte. Nicht so Apollon. Als guter griechischer Gott beschließt er angesichts des monumentalen Neins der wurzelschlagenden Daphne, den Lorbeer zu seinem Lieblingsbaum und zum Symbol des Triumphs zu machen. Des Triumphs. Ein besseres Schnippchen kann man niemandem schlagen.
Liebesgeschichten und deren Ausgang faszinieren mich. Geschichten von Frauen, die Nein sagten und daraufhin zu hören kriegten, «deine Meinung zählt nicht», machen mich wütend und regen mich auf. Als ich auf die Zeichnung und die dazugehörige Geschichte stieß, musste ich an all die Mythen denken, in denen Frauen vorkommen, die verscherbelt, verschoben, verschleppt und verfolgt werden, und sagte mir – Drama im Drama –, dieser Mythos steht den anderen in nichts nach und soll zu meinem werden.
Während ich in meine inneren Gespräche vertieft war, verwandelte Yvain meinen Körper. Halten sich Tätowierer eigentlich für Pygmalions? Mir würde es zu Kopf steigen, wenn die Leute vor meiner Tür Schlange stünden, weil sie meine Werke auf ihren Körpern tragen wollen. Mein Tätowierer (ein wenig ist er in dem Moment zu meinem geworden, in dem ich bereitwillig vor ihm meine Kleidung abgelegt habe) macht eigentlich einen recht bodenständigen Eindruck.
Nach einer Weile waren wir uns einig, dass Zeit für eine Pause war. Er bot mir Kaffee an und war so nett, nicht zum Rauchen rauszugehen, sodass ich nicht einsam und fröstelnd in dem Kellerraum mit der niedrigen Decke zurückbleiben musste. Ich war müde, und auch unter seinen dunklen Augen hatten sich violette Ringe gebildet. Ich weiß nicht mehr, worüber wir redeten, aber sehr wohl noch, dass ich überrascht war, wie leicht es mir fiel, mich mit ihm zu unterhalten – mir, die ich sonst immer herumstammele, die sich verhaspelt und zu lange nach den richtigen Worten sucht. Unser Verhältnis war von einer ergreifenden Schlichtheit – flüchtig und unvergänglich zugleich. Die ohne Handschuhe eleganten und kräftigen Hände des Tätowierers umfassten die Kaffeetasse wie eine Boje. Ich stellte mir vor, wie er nachts um Schlaf kämpfte. Er kaute nicht an den Nägeln. Sie waren sorgfältig sehr kurz gefeilt, und die Glieder seiner Finger waren mit unzähligen Kreisen aus Tinte ohne erkennbares Muster beringt. Von unserem Gespräch blieb mir nichts Greifbares im Gedächtnis, kein längerer Dialog, den ich mir im Nachhinein hätte notieren können, nur einen einzigen Satz behielt ich, der sich mir dafür aber einprägte, als hätte er ihn mir in den Haaransatz tätowiert.
«Limoges ist eine Stadt zum Sterben.»
Er sagte ihn in dem schleppenden Tonfall seines gutmütigen Humors und wollte damit wohl zum Ausdruck bringen, dass Limoges hässlich und tot war und nur klapprige Alte freiwillig in Limoges haltmachen und die Stadt nie wieder verlassen wollen, es sei denn mit den Füßen zuerst. Weder er noch ich hatten Limoges jemals gesehen.
Er tätowierte weiter, und bald brachten die andauernden Vibrationen auf meinen Rippen meinen Willen, hart zu bleiben, gehörig ins Wanken. Ich fühlte mich gegerbt wie altes Leder, denn einen verrenkten Rücken, einen verstimmten Magen und ziehende Brüste war ich gewohnt, aber nun kamen noch geschickt gesetzte Nadeln hinzu und damit ein neuer, bisher unbekannter Schmerz. Ich biss die Zähne zusammen, als er aber die leeren Flächen mit schwarzer Tinte aufzufüllen begann, hatte ich große Lust, alles zu beenden. Ich litt wie ein Hund, selbst wenn es nichts war im Vergleich zu vielen anderen Qualen, ich hätte immerhin die Möglichkeit, Stopp zu sagen, auf Halt zu drücken. Zwar wäre es total blöd gewesen, mit einer halben Daphne zu gehen, die Hälfte des Muts aufgebracht zu haben, aber möglich war es, und die Vorstellung berauschte mich. Kurz spielte ich mit dem Gedanken, die andere Hälfte des Muts, die weniger ruhmreiche, nicht aufzubringen und halb verwandelt nach Hause zu gehen. Die Versuchung war groß.
Ich entspannte den Kiefer.
«Dauert nicht mehr lang, versprochen», sagte Yvain mit besorgter Miene.
Ich lächelte tapfer und atmete tief, aber sehr vorsichtig ein, damit sich mein Brustkorb nicht allzu stark hob. Der epidermale Schmerz war interessant und anders, weshalb ich ihm eingehender nachspürte. So wie es nicht nur eine Geschichte der Gewalt gibt, nicht nur eine Geschichte Frankreichs und nicht nur eine Geschichte der Welt, fertigte ich im Kopf Bilder an, eine Geschichte des Schmerzes, ich stufte ein und kartografierte Territorien, die mir immer vertrauter wurden. Und mit diesem Wahnsinn, zu dem ich mich bekenne und der mich bis hierher gebracht hatte, wuchs auch die Neugier, neue Landschaften zu entdecken und mit neuen Reliefs zu experimentieren.
Es dauerte tatsächlich nicht mehr lange, bis der Kunsthandwerker sein Werk beendet hatte und der Künstler das Ergebnis bewunderte, während er es gewissenhaft abtupfte. Jeder Quadratzentimeter Haut, den er berührte, war empfindlich, jedes Wischen mit dem in Lotion getränkten Tuch Qual und Segen zugleich. Mein Körper war äußerlich verletzt, ich hatte auf einer Länge von fünfzehn Zentimetern kleine offene Wunden, aus denen Lymphe und Blut sickerten und die Yvain jetzt unverzüglich in blasslila Frischhaltefolie wickelte. Ich freute mich, fühlte mich wie lebendig gehäutet.
Er schüttelte mir ruhig und fest die Hand, bedankte sich, und jetzt fehlten mir die Worte, die kraftvoll und schön genug gewesen wären, um zum Ausdruck zu bringen, was er für mich getan hatte. Danke, dass du mich verwandelt hast, hätte ich gern zu ihm gesagt. Tätowierer sind keine Psychiater, dachte ich bei mir. Wenn er gewollt hätte, dass ich ihm Ursprünge und Umstände erläutere, die zu diesem zugleich innerlichen wie äußerlichen Akt geführt haben, hätte er danach gefragt. Schlagartig wird mir bewusst, wie seltsam die Situation war: auf der einen Seite ich, verwandelt, nach wie vor dieselbe und doch ganz neu, und auf der anderen Seite er, für den es ein ganz normaler Arbeitstag war – vielleicht hatte er sich sogar zwingen müssen herzukommen.
Ich bezahlte, ich lächelte, ich bedankte mich, und dann ging ich, wie ich gekommen war. Es war 19:00 Uhr, und mir blieb eine halbe Stunde, um den Ort zu finden, an dem mich eine andere Klapperkiste einsammeln sollte, die mich in mein normales Leben zurückzubringen würde. Das Leben von Anaïs Nollet, Topf- und Küchenmaschinenverkäuferin, eine kleine unbedeutende Frau mit verblassten Träumen und begrenzten Ambitionen, die ständig aus dem letzten Loch pfiff. Beim Gehen dachte ich über mögliche Reaktionen von anderen nach, die in Filmen und Serien das Handeln der Helden befeuern oder durchkreuzen. Und über den verdutzten Blick meines Freundes – von dem ich anfangs dachte, er wäre mein Typ, der nun aber sein Leben mit mir teilte –, als ich ihm von diesem Vorhaben erzählte. Ich fragte mich, wie lange das flüchtige Gefühl, etwas Besonderes erlebt zu haben, das mich umgab wie verdunstender Alkohol, wohl anhalten würde.
Ein Ereignis hat nur so viel Bedeutung, wie man ihm beimisst. Von diesem Nachmittag blieben mir eine Lorbeerfrau, die sich an mich schmiegte, und, wenn ich sie betrachtete, die gelegentliche Einbildung, nach wie vor Yvains mit Gummi überzogene Finger zu spüren, wie sie meine Haut straff zogen, ehe er in sie hineinstach. Außerdem dieser eine Satz, der mich nicht mehr losließ: Limoges ist eine Stadt zum Sterben. Wie ein albernes Mantra, das mich daran erinnerte, wie stark mein heimlicher Todeswunsch war.
Es sind schon dümmere Dinge für weniger als diese kurzen Worte getan worden.
Familie
Ich gebe auf. Der Tag hat gerade erst angefangen, aber ich gebe bereits auf, ich werde niemals fertig. Immer liegt noch irgendwo ein Spielzeug herum und ein angekautes Stück Karotte klebt unter dem Tischchen des Hochstuhls. Ich hole tief Luft und lasse den Blick durch das Zimmer schweifen, in dem ich steif und erschöpft stehe. Mit dem Ausatmen versuche ich, den Stress, der mich seit dem Aufstehen lähmt, aus mir herausströmen zu lassen. Meine Tochter zieht an meiner Hose und holt mich damit aus der geistesabwesenden Starre, ein schriller Schrei durchdringt die Stille. Als ich Mutter wurde, musste ich lernen, dass nicht jeder schrille Schrei Gefahr bedeutet, ich habe sogar gelernt, es manchmal zu genießen, wenn mein Trommelfell wegen eines lautstarken Freudengeheuls vibriert. Ich bücke mich und pflücke mein Töchterchen vom Boden, das noch nicht genug Kraft hat, um sich meinen erdrückenden Liebesbekundungen zu entziehen. Die Kleine riecht nach Milch, Schlaf und Baby. Sie ist ein Jahr alt.
Meiner Ninon ist es schnurz, ob noch Wollmäuse unter dem Sofa liegen und dass meine Bluse nicht gebügelt ist. Mit der Faust im Mund, neben der ihr der Speichel übers Kinn läuft, sieht sie mich aus großen noch blauen Augen an. Wir wissen beide genau, sie und ich, dass sie in einigen Stunden von oben bis unten mit Essen beschmiert sein wird und alle es entzückend finden werden. Ich beruhige mich – ein bisschen zumindest. Ich senke die Schultern, und mein Gesicht entspannt sich, ich drücke sie an mich und atme abermals ihren Duft der Sorglosigkeit ein.
Von einer Last befreit, dringt mir der Geruch des bevorstehenden Mittagessens in die Nase und die Melodie ins Ohr, die Marc mit seiner tiefen Stimme in der Küche summt. Hier und jetzt. Mit unserem Kind im Arm gehe ich zu ihm und küsse ihn auf die frisch rasierte Wange, er riecht nach Aftershave und unterschwellig nach Seife.
«Es wird schon laufen, Camille», sagt er ruhig und zuversichtlich wie immer.
Tapfer nicke ich. Ninon lacht, und in dem Moment klingelt es.
Ich muss mich mit aller Kraft zusammenreißen, um nicht einen letzten Blick in den Spiegel zu werfen – ich hätte nur Falten, fettige Haare und einen schiefen Kragen gesehen –, bevor ich die Wohnungstür öffne.
Axel klopft lächelnd im Rhythmus des Popsongs, der den Innenraum des Autos erfüllt, mit den Fingern aufs Lenkrad. Die Heizung ist zu warm, mir ist übel, ich habe Bauchschmerzen und würde am liebsten umdrehen. Ich seufze.
«Es wird schon laufen», sagt er, und seine Stimme ahmt die Tonschwankungen des Liedes nach. Ich gebe ein nicht überzeugtes Murren von mir. Jetzt ist es an ihm zu seufzen.
«Aber gib dir wenigstens ein bisschen Mühe», schiebt er etwas ungeduldig hinterher.
Ah ja. Ich soll mir also Mühe geben. Es stimmt, dass mir diese Gabe oft fehlt – versöhnlich zu sein, im richtigen Moment zu lächeln, klein beizugeben. Dennoch verkneife ich mir, trocken zu erwidern, dass er gut reden hat. Schließlich ist er nicht die Tochter meiner Mutter. Er kann in aller Ruhe atmen, ohne befürchten zu müssen, dass man ihm den Sauerstoff unter der Nase wegsaugt.
Ich bringe mich nicht in die beste Ausgangslage, das gebe ich zu. Schweigend beobachte ich, wie die Stadtlandschaft an den Fenstern vorbeirauscht. Es ist mehr als nur eine schlechte Phase.
Irgendwann bremst Axel und parkt ein. Mit klopfendem Herzen schlage ich die Tür zu. Unter meinen Achseln bilden sich Schweißflecken, meine Hände werden feucht. Eigentlich sollte man vor einem Familientreffen besser drauf sein als vor einem Vorstellungsgespräch. Plötzlich ruft mich jemand von hinten.
«Anaïs, hallo!»
Ich bleibe so abrupt stehen, dass ich fast gestolpert wäre, und halte mich an Axels Arm fest, der sich gerade umdreht und bereits ein strahlendes Lächeln aufgesetzt hat. Er braucht sich nicht einmal zu bemühen, echt unfair. Er schiebt seine Hand in meine, ich klammere mich daran und nehme all meinen Mut zusammen. Meine Eltern sind da. Mein Vater, die Hände in den Taschen und den Blick in die Ferne gerichtet, tut er so, als würde es ihn nicht geben. Er nickt und sagt keinen Ton. Auch er hat wahrscheinlich schon genug davon, hier zu sein. Meine Mutter trägt zu ihrer blonden fest gesprayten Helmfrisur ein korallenfarbiges Seidentuch, das elegant um ihren nahezu faltenlosen Hals geknotet ist, und mustert mich von oben bis unten und von unten bis oben. Schulterzuckend drückt sie ihre Wange an meine.
«Hast du etwa deine Mutter nicht wiedererkannt?»
«Ich wusste nicht, dass ihr schon da seid. Seid ihr zusammen gekommen?», frage ich scheinheilig.
Die von Mascara beschwerten Wimpern flattern träge. Sie weiß, dass ich nach ihrem zweiten Mann Ausschau halte, der nie zu den bei meiner Schwester stattfindenden Familienessen erscheint, weil «sich das nicht gehört». Sie lässt sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen und antwortet gut gelaunt: «Dein Vater hat mich abgeholt. Du weißt ja, er ist und bleibt ein Gentleman.»
Dieser lacht vielsagend hinter ihr. Das ist meine Mutter: seit fünfzehn Jahren geschieden, sorgt sich aber immer noch, was wohl die Nachbarn sagen – und nicht einmal ihre eigenen. Immerhin kann man meinen Eltern nicht vorwerfen, einen Rosenkrieg veranstaltet zu haben. Sie hakt sich bei meinem Vater unter, der sich ein wenig gerader hinstellt, nach wie vor stolz, eine so schöne Frau an seiner Seite zu haben. Sie gehen los und lassen uns stehen. Aus mir entweicht die Luft wie aus einem Ballon, der Knoten, der sich in meinem Bauch gebildet hatte, lockert sich ein wenig. Axel schiebt seine Finger zwischen meine, um mir zu zeigen, dass er mich unterstützt. Vielleicht wird es dieses Mal gar nicht so schlimm.
Es läuft. Nicht unbedingt gut, aber zumindest ohne Zwischenfälle. Vielleicht sind wir wegen des Geburtstags unseres gemeinsamen kleinen Lieblingsmenschen alle drei entschlossen, nicht diejenige zu sein, die den fragilen Status unseres Waffenstillstands zerstört. Unsere Mutter ritt nicht auf der Unordnung herum, die ich zu verbergen versuchte, Anaïs seufzte nicht, als Axel langatmig die Eleganz eines japanischen Drucks, der im Flur hängt, pries und dabei sein Wissen über Hokusai zum Besten gab, und ich widerstand der Versuchung, sie zur Seite zu nehmen, um sie zu bitten, uns die Anwesenheit ihres Freundes in Zukunft zu ersparen.
Solange Ninon im Mittelpunkt steht, habe ich meine Ruhe. Da sich alle nur für sie interessieren und niemand dafür, was Marc und ich mit ihr machen, erlaube ich mir, meinen Gin Tonic zu genießen und dann den Wein, während ich mit leerem Blick das Stimmengewirr wahrnehme. Beim Aperitif fiel mir auf, dass Axel seine riesige Pranke auf Anaïs’ Knie gelegt hatte. Er fühlte sich sichtlich wohl in seiner Haut und freute sich dazuzugehören. Er machte unserer Mutter Komplimente, woraufhin diese entzückt gluckste. Als meine Schwester ihren Kopf auf Axels Schulter legte, wandte ich mich irritiert ab, weil ich das Gefühl hatte, Zeuge einer Verletzlichkeit zu sein, die ich nicht sehen sollte. Intimität ist Privatsache.
Das Essen neigt sich glatt wie ein Babypopo in der Frühlingssonne dem Ende zu. Während die Gäste noch mit ihrem Stück Käse beschäftigt sind, ehe wir gleich zum Dessert übergehen, zu dem Kuchen mit der einen Kerze, die Ninon mit ihrer kleinen Lunge nicht wird auspusten können, betrachte ich jeden Einzelnen und sage mir: Eine Familie zu sein, bedeutet auch, bewusst die Harmonie über die Spannungen zu stellen, die außerhalb dieser Klammer auf dem Verhältnis lasten. Wenn wir alle zusammen sind, versuchen wir, weniger grob und verbittert miteinander umzugehen. Wie mühsam das allerdings für uns ist, lässt mich nachdenklich werden. Nicht zum ersten Mal frage ich mich, ob es bei allen Familien unter der glatten Oberfläche brodelt.
Axels Anwesenheit erlaubt mir, mich zurückzuziehen. Ihm fällt es überhaupt nicht schwer, meinen Platz einzunehmen, die Leere auszufüllen und das Schweigen zu überbrücken. Ich verschwinde hinter seiner Stimme, mache mich ganz klein und verkrieche mich tief in mir selbst. Ich weiß nicht, wie ich es sonst machen soll, schlimmer noch, ich verstecke mich gern auf diese Weise und freue mich, dass sich die prüfenden, erwartungsvollen Blicke im Laufe der Mahlzeit von mir abwenden. Er erfüllt die Erwartungen für mich. Er redet gut und weiß, sich zu bewegen, ohne Ecken und Kanten. Wenn er da ist, hat meine Mutter nur Augen für ihn und verzeiht mir alles, sogar meine Farblosigkeit. Ich habe nicht viel erreicht, bin weder eine bekannte Violinistin noch Architektin geworden, habe aber wenigstens eine gute Partie gemacht.
Er ist meine Entschuldigung, mein Fels in der Brandung. Auf ihm, seiner Ausdrucksfähigkeit und seinen Manieren, kann ich mich ausruhen. Den Kopf auf seine Schulter gelegt, seufze ich fast zufrieden. Es läuft. Gut.
Ninon schiebt sich ein kleines Stück Kuchen mit dem Löffel in den Mund, dann noch eins. «Jamm, jamm!», ruft sie. Es ist eine üppige Biskuittorte mit einer Ganache, Sahne und ihrem Namen darauf. Die Kerze auszupusten, ist ihr nicht gelungen, aber das war auch besser so, weil sich auf diese Weise ein perfekt komponiertes Bild in meinem Gedächtnis einprägen konnte: das blond gelockte Kind und sein Vater mit leuchtenden grünen Augen und wirrem Haar, beide mit aufgeblasenen Backen über die spiegelglatte Glasur gebeugt. Das Licht der kleinen Flamme verleiht ihnen einen goldenen Glanz. Gold ist die Farbe der Liebe.
Anschließend wurde der Kuchen verteilt, und so, wie Ninon ihr Stück verschlingt, sieht sie aus wie ein gefräßiges Huhn. Erst als sie ihr drittes Geschenk auspackt – unglaublich, wie viele neue Spielzeuge ein so kleiner Mensch auf einmal bekommen kann –, nimmt das Drama lautstark seinen Lauf. Unvermittelt hält die Kleine in der Bewegung inne und fasst sich auf das kugelrunde Bäuchlein. Sie beginnt zu wimmern, hat Schmerzen, ihr Gesicht ist gerötet und die Stirn feucht. Im nächsten Augenblick übergibt sie sich auf den Teppich.
Plötzlich hat sie nichts mehr von dem vergnügt brabbelnden Baby, das sie eben noch war. Auf einmal habe ich ein gequältes, brüllendes Wesen vor mir, das sich in seinem eigenen kaum verdauten Essen wälzt. Meine Mutter starrt Ninon mit weit aufgerissenen Augen an – und tut was? Dem kranken Kind zu Hilfe eilen, wie es der Instinkt der beschützenden Großmutter verlangt? Oder versucht sie, so viel Distanz wie möglich zwischen sich und die übel riechende dickflüssige Masse zu bringen, die sich nun schon zum zweiten Mal wie ein Schwall aus dem noch fast zahnlosen Kindermund ergießt? Ninon schluchzt. Ninon weint. Die Überraschung über die Wendung, die die Feier genommen hat, ist schnell verflogen, ich springe auf, der Alkohol in meinem Blut spielt keine Rolle mehr, Adrenalin und Cortisol haben ihn weggeschwemmt. Marc ist ebenfalls aufgestanden, und gemeinsam nehmen wir uns, gut funktionierende Eltern, wie wir sind, der Sache an. Wortlos verlassen wir den Raum, das besudelte Kind an das feine bestickte Hemd seines Vaters gedrückt.
«Sie hätte nicht so viel Kuchen essen dürfen», sagt meine Mutter missbilligend in die Stille hinein.
«Es ist ihr Geburtstag, Mama», erwidere ich so sachlich wie möglich.
«Zum Glück habe ich nicht zugelassen, dass ihr euch an euren Geburtstagen hemmungslos vollstopft, kann ich dazu nur sagen.»
Ich hebe den Blick gen Zimmerdecke und mein Hinterteil im selben Moment vom Sofa, weil die toxische Nähe meiner Mutter plötzlich nicht mehr von Axels unerschütterlicher Präsenz neutralisiert wird. Er wirkt angespannt und starrt angewidert auf den orangen stinkenden Fleck, der bereits zu trocknen beginnt und auf dem Teppich eine Kruste bildet. Er mag Kinder nicht besonders, das habe ich ziemlich schnell kapiert. Zu laut, zu dreckig, und die Batterien lassen sich nicht rausnehmen, wenn man keine Lust mehr auf sie hat. Bei Ninon hat er immer versucht, es zu verbergen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Camille ihn durchschaut. Er hätte sich die Feier des ersten Geburtstags eines Kindes, das ihm egal ist, nicht antun müssen, doch das hätte nicht zu seinem Bestreben gepasst – das ein bisschen auch das meine ist –, in den Augen meiner Eltern absolut fehlerlos zu sein.
Mein Vater seufzt und verkündet dann: «Gut, ich geh dann mal eine rauchen.» Matt und schwer lässt er die Hände auf seine Oberschenkel klatschen. Nur allzu gern würde ich ihn begleiten. Wir könnten gemeinsam unter dem Vorbau rauchen und dabei vielleicht sogar mehr als zwei Worte wechseln. Doch ich bemerke den wütenden, enttäuschten Blick meiner Mutter in Richtung des Rückens meines Vaters, während dieser das Päckchen Zigaretten aus der Tasche seiner Jeans angelt. Mit Sicherheit spürt er diesen Blick, ignoriert ihn aber einfach. Das ist die Freiheit, die er sich mit der Scheidung erkauft hat. Würde ich ihm folgen, ließe mich meine Mutter für den doppelten Abgang büßen, und ich müsste mir Vorwürfe anhören, die sie gern ihrem Ex-Mann gemacht hätte, der nie mit dem Rauchen aufhören wollte, der ihre gemeinsame Tochter mit seiner ordinären Sucht angesteckt hat und der sich das Recht anmaßte, dass es ihm egal war. Von seiner Mutter kann man sich nicht scheiden lassen. Also beherrsche ich mich. Die Stille wird immer drückender, aus der oberen Etage dringen gedämpft Ninons kaum nachlassendes Wimmern und die hilflosen Floskeln ihrer Eltern nach unten, die versuchen, ruhig zu bleiben, aber gleichzeitig fieberhaft herausfinden wollen, was los ist.
Während ich an die mehr als verdiente Zigarette denke, die mich zu Hause erwartet, und gedankenverloren durch das Fenster in den Garten schaue, reibe ich mir die Seite, weil es dort juckt.
«Anaïs, hör auf, dich zu kratzen», fährt Axel mich an.
Ich halte inne. Er hat recht. Ich will mein Tattoo nicht beschädigen, das gerade dick eingecremt unter dem Baumwollstoff meiner Bluse vernarbt. Sofort ergreift meine Mutter die Gelegenheit für ein Gespräch.
«Was hast du denn, Liebes? Immer noch Neurodermitis?»
«Ich habe schon seit zehn Jahren keine Neurodermitis mehr, Mama …»
«Solche Sachen verschwinden nie ganz …», erwidert sie.
Ich drehe mich um, und als ich ihre wie Akzente hochgezogenen Augenbrauen sehe, muss ich lächeln. Ich öffne den Mund, um sie zu beruhigen, aber Axel kommt mir zuvor.
«Das ist keine Neurodermitis, Catherine, das ist ihr frisch gestochenes Tattoo!»
Ich erstarre zur Salzsäule. Die sorgfältig geschminkten Lippen meiner Mutter bilden ein von kleinen Fältchen umgebenes O – ihre Züge verzerren sich zu einer Maske des Grauens.
Axel setzt eine verlegene Miene auf. «Oh, habe ich jetzt was verraten?»
Ich schließe gerade den Body meiner Tochter, als Marc die Zimmertür öffnet und hereinstürmt. Kurz höre ich laute aufgebrachte Stimmen, ehe der Lärm wieder ausgesperrt wird. Ninon ist erschöpft eingeschlafen, ihr kleiner fiebriger Körper wird immer wieder von einem gespenstischen Schluchzen geschüttelt.
«Zwei Dinge», verkündet Marc mit ruhiger Stimme, das Handy noch in der Hand. Ich nicke und hebe vorsichtig meine Tochter hoch, um sie in ihr Bettchen zu legen.
«Erstens, wir können gleich morgen früh mit der Kleinen zum Arzt kommen …»
«… ich habe morgen Vormittag Probe», werfe ich bedauernd ein.
Marc sieht mich an und scheint nicht zu verstehen, was ich damit sagen will.
«Ich kann die Probe nicht versäumen, Schatz.»
«Aber Camille, ich kann doch mit ihr zum Arzt gehen.»
Erstaunt, dass ich darauf nicht selbst gekommen bin, zucke ich zusammen. Ich nicke wieder, um zu sagen, ja klar, wie dumm von mir.
«Zweitens», fährt er unbeirrt fort, «proben deine Schwester und deine Mutter im Wohnzimmer gerade den Kalten Krieg, das klingt wie die Invasion in der Schweinebucht.»
Axel weicht meinem giftigen Blick krampfhaft aus. Könnte er unschuldig pfeifen wie in einem Cartoon, täte er es. Mein Vater hatte nur kurz den Kopf ins Wohnzimmer gestreckt und sich dann gleich wieder zurückgezogen, unter dem Vorwand, dringend aufs Klo zu müssen. Ich versuchte, cool zu bleiben, aber es funktionierte nicht.
«Du hast mir nicht gesagt, dass es ein Geheimnis ist!», verteidigt sich der Verräter an meiner Seite und lacht, ohne zu bemerken, dass sich mein Teint immer röter verfärbt.
Meine Mutter blickt entgeistert zwischen uns hin und her. Schließlich findet sie ihre Worte wieder. «Ein Tattoo, in deinem Alter.»
Hätte ich wetten müssen, auf diese Reaktion hätte ich mein Vermögen nicht gesetzt. Ich fühle mich überrumpelt. Der offen spöttische Ton ist eine kühne Entscheidung.
«Welches Alter wäre denn passender, Mama?»
«So was wie siebzehn, wenn Jugendliche typischerweise in der Krise stecken. Aber stimmt, da steckst du ja noch immer mittendrin.»
Axel gibt einen Laut von sich, der sich zu einem wenig überzeugenden Husten entwickelt. Ich glaube fast, er hat gelacht.
«Hätte ich mich mit siebzehn tätowieren lassen, hättest du vielleicht einen Herzinfarkt erlitten. Die Chance habe ich eindeutig verpasst.»
Sie nimmt einen empörten Gesichtsausdruck an, und ich verdrehe die Augen. Nachdem mein Vater festgestellt hat, dass bislang niemand die Messer gezogen hat, wagt er sich vorsichtig wieder in den Raum.
«Deine Tochter hat sich tätowieren lassen, Philippe.»
Einen Moment lang sagt er gar nichts, scheint seine Entscheidung zurückzukommen aber bereits zu bereuen, jedenfalls wendet er den Blick in Richtung Garten, wo unter dem Vorbau der Aschenbecher steht.
«Sie ist volljährig, Catherine …»
«Ah, danke!», rufe ich triumphierend.
Langsam nervt mich Axels Miene. Man könnte meinen, für ihn gäbe es nichts Unterhaltsameres als diesen Streit, der sich vor seinen Augen abspielt.
«Na ja, es gibt intelligentere Arten, sein Geld auszugeben, meinst du nicht?», setzt mein Vater nach.
Einmal mehr bin ich überrascht ob des gewählten Angriffswinkels. Meine Mutter nickt zustimmend mit fast königlicher Verachtung.
Mir fehlen die Worte. «Ich … aber hä, was?»
Als meine beiden Eltern gerade wieder loslegen wollen, naht Rettung in letzter Minute. Camille und Marc betreten den Raum und schließen unendlich behutsam die Tür hinter sich.
«Pssst …» Marc legt den Zeigefinger auf den Mund, um seine lautmalerische Aussage noch zu unterstreichen. «Ninon schläft jetzt.»
Meine Schwester kocht vor Wut, unsere Mutter ist empört, unser Vater stellt seine typisch herablassende Haltung zur Schau, die er immer annimmt, wenn es um Geld geht. Axel mimt den Unbeteiligten, die von außen kommende neutrale Person, die mit alldem nichts zu tun hat und betrübt ist, Zeuge dieser schamlosen Offenlegung zu sein. Er wirft mir einen übertrieben entschuldigenden Blick zu. Ohne auf ihn einzugehen, wende ich mich fassungslos Anaïs zu.
«Was ist hier los?»
«Ich, äh … habe erwähnt, dass Anaïs ein Tattoo hat», funkt Axel dazwischen. «Ein kleiner Schnitzer meinerseits, ich wusste nicht, dass das so ein heikles Thema ist.»
Ich kehre ihm jetzt demonstrativ den Rücken zu. Ich hatte nicht mit ihm gesprochen.
«Die wollen mir hier alle den Kopf abreißen, das ist los», bricht es verzweifelt aus Anaïs heraus. Unsere Mutter gibt einen entrüsteten Laut von sich.
«Anaïs, jetzt hör aber auf!», murrt unser Vater.
Mir reicht’s. Ich stemme die Hände in die Hüften und herrsche meine Verwandtschaft unwillkürlich in dem gleichen Tonfall an, in dem ich mit Ninon schimpfe: «Eure Streitigkeiten könnt ihr später und woanders regeln. Unter meinem Dach reißt niemand dem anderen den Kopf ab und am Geburtstag meiner Tochter schon gar nicht.»
«Aber …», beginnt meine Schwester.
Ich sehe sie eindringlich und flehend an. Ich kann nicht mehr, ich sorge mich um Ninon, und es ist mir vollkommen egal, ob sie beleidigt ist, dass ihr albernes kleines Geheimnis gelüftet wurde.
«Anaïs», sage ich nur.
Ich begreife es. Ich begreife, dass die Zeit, als meine Schwester bei meinen jugendlichen Streitigkeiten mit unseren Eltern für mich Partei ergriffen hat, lange vorbei ist. Als ich nach besonders heftigen Auseinandersetzungen in ihr Zimmer kommen und all meinen Frust bei ihr loswerden konnte, als sie mich während meiner Schimpftiraden mit einem «Das verstehe ich» bestätigte, was mich jedes Mal ein bisschen ruhiger werden ließ. Sie war die Lieblingstochter, perfekt in jeglicher Hinsicht, aber sie war meine Verbündete.
Diese Verbündete habe ich verloren, als Camille Mutter wurde. Plötzlich wurde ihr Ruhe sehr wichtig. Damit sich die Kleine nicht ängstigt; um die Kleine nicht aufzuwecken; um bei ihr keine Migräne auszulösen. Seitdem darf man unter keinen Umständen auch nur ein bisschen lauter werden.
Ich verstehe das, ja natürlich. Ich kann mir vorstellen, dass es normal ist. Doch kaum dass mich meine Schwester mit ihrer vollen und autoritären Stimme angewiesen hat, den Mund zu halten, und ich denselben gehorsam geschlossen habe, war sie meinem Blick ausgewichen. Deshalb durchzuckt mich unweigerlich und ein wenig bösartig der Gedanke, dass Camille, seit sie selbst Mutter ist, angefangen hat, wie unsere Mutter zu denken, und plötzlich auch meint, dass ich es immer zu weit treibe.
Ich schweige. Axel kommt zu mir und will einen Arm um mich legen – ich wehre ihn mit der Schulter ab. Er bläst hörbar Luft aus und murmelt etwas. Ich übertreibe.
Meine Mutter räuspert sich und dann ändert sich ihr Gesichtsausdruck, formt sich neu wie weiches Wachs. Auf einmal gibt sie sich versöhnlich. Ja natürlich, wie dumm, wir sind hier, um zu feiern und nicht um zu streiten! Ich beiße die Zähne zusammen. Mein Vater tritt einen Schritt zur Seite, entschlossen, noch einmal aufs Geld zurückzukommen, doch Marc kann ihn gerade noch rechtzeitig auf ein weniger heikles Thema umlenken und zwinkert mir zu.
Nachdem Camille den Fleck auf dem Teppich begutachtet und entschieden hat, sich später darum zu kümmern, tritt sie zu mir und flüstert: «Echt jetzt … ein Tattoo?»
Ich entferne mich schulterzuckend. Ich werde meine Zigarette doch jetzt rauchen.
Neustart
Als heute Morgen der Wecker klingelte, war ich noch schläfrig und ungekämmt, aber ich hatte eine Arbeit. Heute Abend habe ich trotz eines noch ordentlich gebundenen Pferdeschwanzes keine mehr. Wie ungerecht das alles ist, war noch gar nicht richtig zu mir durchgedrungen. Genauso wenig wie die Tatsache, dass ich es hätte kommen sehen können.
Es gibt interessante und weniger interessante Jobs. Einige Leute fühlen sich zu etwas berufen, und die Arbeit gibt ihrem Leben einen Sinn, und dann gibt es andere, wie mich, die arbeiten, um Geld zu verdienen, damit sie einigermaßen vernünftig leben und sich ein paar Luftschlösser bauen können – ohne sich dann dafür einzusetzen, sie wahr werden zu lassen. Ich mag meine Arbeit nicht besonders. Sparschäler und Kuchenrollen verkauft man nicht aus Leidenschaft. Man muss kein besonders guter Mensch sein, um das zu tun, und vielleicht habe ich mir die Arbeit genau deswegen ausgesucht – oder sie hat sich mich ausgesucht.
Dennoch war heute Morgen noch alles in Ordnung. Als mein Wecker klingelte, war Axel bereits aufgestanden, und der Duft von frischem Kaffee drang mir in die Nase. Wir haben eine stille Übereinkunft, dass vor acht Uhr niemand den Mund öffnet. Es war sieben Uhr achtundvierzig, vor mir lagen also noch zwölf Minuten wunderbarer und vollkommener Stille, genug, um meinen Kaffee und die Zigarette zu genießen, die ich mir jeden Morgen am Wohnzimmerfenster genehmige.
«Drinnen rauche ich nie», behaupte ich gegenüber jedem, der es hören will, als würde allein durch das Aussprechen aufgehoben werden, dass es hemmungslos gelogen ist. Ich rauche jeden Morgen drinnen am Wohnzimmerfenster. Ob es regnet, stürmt oder schneit, ich bin zu faul – sowohl auf die Straße runterzugehen als auch mit dem Rauchen aufzuhören. Axel hat drei-, vielleicht auch zehnmal gemeckert, es dann aber aufgegeben. Jetzt meidet er das Wohnzimmer morgens vor acht Uhr.
Bevor ich gegangen bin, haben wir uns kurz umarmt. Ich war angenehm überrascht, weil es selten geworden ist. Ich glaube, man nennt das Beziehungsprobleme.
Ich habe mich in letzter Zeit keineswegs vorbildlich verhalten. Die Endometriose, die in meinem Unterleib ihr Unwesen trieb, war wieder aufgeflammt. Ich war nicht in der Lage gewesen, das Bett zu verlassen, geschweige denn, mich auf den Beinen zu halten. Ich ließ mich krankschreiben. Es war nicht das erste Mal, bei Weitem nicht. Mir war durchaus bewusst, dass ich ziemlich häufig bei der Arbeit fehlte und mir den Luxus nicht mehr oft leisten konnte. Gern sagen sich die Leute, danach ist Schluss, das ist die letzte Zigarette, das letzte Glas Wein, die letzte Line Koks … Mein Laster sind Krankschreibungen. Mein Arzt, ein gutmütiger Kerl, sieht mich jedes Mal ein wenig bedauernd an, dass er sonst nichts für mich tun kann. Dann füllt er das Formular aus, ohne auch nur eine Sekunde darüber nachzudenken, er merkt, wie viel Überwindung es mich gekostet hat, mich in seine schäbige Praxis zu bewegen. Mein Chef ist ein anderes Kaliber, und ich kann ihn verstehen.
Außerdem erhöhen die ständigen Krisen die Spannung zwischen Axel und mir. Neuerdings wirft er mir vor, dass ich mich nicht genug bemühe, was ich mir nicht gern sagen lasse, weil ich mich frage, wie ich mehr tun könnte. Von seiner Beziehung kann man sich nicht krankschreiben lassen.
Den ganzen Tag lang war ich die Angestellte, die ich zu sein imstande bin. Ich lächelte viel, habe verkauft, so viel ich konnte, und mit Feingefühl eine Menge Haushaltsunfälle verhindert – es war nicht der allerbeste Tag, und ich war nicht die allerbeste Verkäuferin, aber ich habe mein Bestes gegeben.
Am Nachmittag, als ich mich kurz in den Hinterhof zurückzog, um in Ruhe eine Zigarette zu rauchen, kam eine Kollegin zu mir. Leise und ohne mir in die Augen zu sehen, teilte sie mir mit, dass ich ins Büro des Chefs kommen solle. Sofort wurde mir klar, dass etwas im Busch war. Wie scharfsinnig von mir.
«Monsieur Collard, Sie wollten mich sprechen?»
Vor dem Eintreten habe ich mir den Rock glatt gestrichen, den Pferdeschwanz neu gebunden und ein anderes Lächeln aufgesetzt als das, was ich Kunden gegenüber zeige. Es ist zurückhaltender, es weiß, wem es gilt, weshalb es nicht so tut, als wüsste es mehr als er, um sein Ego nicht zu verletzen. Edouard Collard ist ein Mann in den Vierzigern mit einem Bauchansatz, Geheimratsecken und dicker Brille. Außerdem ist er ein wenig schmierig, und kaum dass ich mich in seinem stickigen Büro befinde, dessen Wände mit beigem Teppichboden ausgekleidet sind, wird mir übel.
«Setzen Sie sich, Mademoiselle Nollet. Ich habe leider keine guten Nachrichten für Sie.»
Mein Lächeln geriet ins Wanken, es hing an einem dünnen Faden ohne Sicherheitsnetz. Gehorsam setzte ich mich.
«Sie wissen ja selbst, dass Sie immer häufiger fehlen», begann er in künstlich betrübtem Tonfall.
«Es tut mir leid, Monsieur Collard. Ist mit den Attesten etwas nicht in Ordnung?»
Er hüstelte, als wäre ihm die Sache unangenehm.
«Nein, das passt schon, Anaïs.» (Ich hasse es, wenn er mich mit meinem Vornamen anspricht.) «Aber ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Sie nicht länger für uns arbeiten werden.»
Es dauerte einen Moment, bis mir klar wurde, was er gerade gesagt hatte.
«Entschuldigung, aber warum?», fragte ich mit dünner, zitternder Stimme.
«Ihre gesundheitlichen Probleme sind mit der Tätigkeit hier nicht vereinbar», erklärte er sachlich. «Sie können nicht lange stehen, Sie fallen immer wieder aus … Sie sehen sicherlich ein, dass ich es mir nicht leisten kann, noch länger eine Verkäuferin zu beschäftigen, die nichts verkauft.»
Unerträglich langsam nickte ich. Er hat nicht unrecht, hätten mein Vater, mein Freund und jeder andere gesagt, der halbwegs in der Geschäftswelt zu Hause ist.
«Ich muss die Bilanz der Firma verbessern. Sie wissen, dass die Situation für uns im Moment nicht einfach ist … Und Sie können derzeit weder das Unternehmen angemessen repräsentieren noch Ihre Aufgaben vernünftig erfüllen.»
Mir lag alles Mögliche auf der Zunge, aber ich hielt den Mund, wild entschlossen, nicht noch weiter mein eigenes Grab zu schaufeln.
«Das kann jetzt für Sie eigentlich nicht überraschend kommen, Mademoiselle Nollet», schob Collard noch hinterher und zog missbilligend die Augenbrauen zusammen.
Ich habe schon verstanden: Du taugst nichts, und das müsstest du selbst am besten wissen, Dummerchen. Die Ohrfeige hat gesessen.
«Ich verstehe ja, dass Sie das jetzt ein bisschen mitnimmt. Ich wollte es Ihnen auch schon früher sagen, aber entweder Sie fehlten, oder ich war unterwegs … Die Entlassung gilt jedenfalls ab Dienstschluss. Heute Abend.»
Er erhob sich und knöpfte das Sakko seines anthrazitfarbenen Anzugs zu, um seinen Bauch zu verstecken. Dann streckte er mir seine feuchte Hand entgegen, die ich nur sehr ungern ergriff.
«Marjolaine geht dann den Rest mit Ihnen durch.»





























