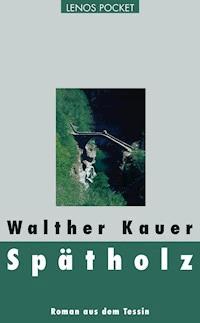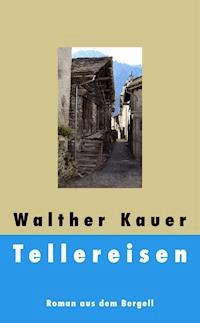13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lenos
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gerson Mittler ist ein Schriftsteller, der sich hinter Pseudonymen versteckt. Er ist in so viele Figuren hineingeschlüpft, hat unzähligen Leuten so viele Lebensgeschichten erzählt, dass er am Ende nicht mehr weiss, wer er wirklich ist und was er selbst glaubt. Er resigniert in seiner Unfähigkeit, zwischen der Realität und den Scheinwelten zu unterscheiden, die er um sich aufgebaut hat. Seine zweite Frau betrügt ihn mit einem Jugendfreund und amüsiert sich über seine Lebenskrise. Auch ihr gegenüber kann er sich nicht behaupten. Verängstigt zieht er sich immer mehr hinter seine Masken zurück. Dann lernt er beim Recherchieren über die Geschichte des Salzbergbaus durch Zufall eine Frau kennen. Auf einer gemeinsamen Radtour zu Stätten seiner Vergangenheit lernt sie begreifen, was ihn umtreibt und verunsichert. Dank ihrer Offenheit und ihres Vertrauens findet er zu sich selbst zurück. Mittler weicht nicht länger aus - auch der eigenen Ehefrau nicht. Er nimmt die Herausforderung an, die neuen Schwierigkeiten zu meistern, und beginnt zu kämpfen. Aus den Lebensjahren, die ihm verbleiben, will er für sich und andere etwas von Bestand machen. Was ihm auf überraschende Weise gelingt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Der Autor
Walther Kauer (1935–1987) wuchs in Bern auf. Ausbildung zum Heilpädagogen in Aberdeen und Berlin. Kauer übte verschiedenste Tätigkeiten aus. Neben journalistischen Arbeiten veröffentlichte er Romane, Erzählungen, Hörspiele und Dramen. Mit den Romanen Schachteltraum und Spätholz gelang ihm der Durchbruch. Für sein literarisches Werk wurde er mehrfach ausgezeichnet.
E-Book-Ausgabe 2015
Copyright © by Patrick Kauer
Alle Rechte vorbehalten
Erstmals erschienen 1984
Cover: Anne Hoffmann Graphic Design, Zürich
Coverfoto: Keystone / Martin Ruetschi
www.lenos.ch
ISBN 978 3 85787 917 3 (EPUB)
ISBN 978 3 85787 918 0 (Mobipocket)
Für Nell
Wenn du aber gar nichts hast,
Ach, so lasse dich begraben.
Denn ein Recht zum Leben, Lump,
Haben nur, die etwas haben …
Heinrich Heine
«Bittersalz: Salz von bitterem Geschmack. Kohlensaures Magnesium, für industriellen Gebrauch. Nebenprodukt bei der Salzgewinnung in Salzbergwerken.»
I
1
Er lag da, mit geschlossenen Augen. Das Licht schmerzte ihn, wenn er sie öffnete. Er konnte sich nicht rühren, nicht sprechen, nicht einmal die Hände konnte er benutzen, um sich verständlich zu machen. Wahrscheinlich dachten alle andern, er sei immer noch ohne Bewusstsein – er konnte sie an seinem Bett miteinander sprechen hören. Sie sprachen über ihn wie über einen Toten, und insgeheim packte ihn die wahnsinnige Angst, sie möchten ihn so begraben, wie er jetzt war – lebendig und doch beinahe tot. Er tröstete sich damit, dass es ihm ja gleichgültig sein konnte, ob er hier in diesem Bett regungslos liegen musste, überall Verbände und Gips und Schienen, die ihn einschnürten, oder in einem Sarg. Bloss – er war nicht tot. Er konnte noch denken, ganz klar denken konnte er, er hörte alles um sich herum ganz deutlich, er konnte die Blumen riechen, die man ihm ins Zimmer gebracht hatte, Ruth oder Dorothea oder sonstwer. Manchmal kamen sie jetzt sogar zusammen, um ihn zu besuchen, an seinem Bett zu sitzen, sie sprachen auch miteinander, wiederum über ihn, über den furchtbaren Unfall und ob er wohl jemals wieder …
Er hätte schreien mögen, sie sollten damit aufhören, er könne alles deutlich hören, er könne Ruths Parfüm von jenem von Dorothea unterscheiden und diese wiederum von jenen der verschiedenen Schwestern, die in seinem Zimmer Dienst taten. Sie wechselten sich wöchentlich des Tags und des Nachts ab, es waren fünf verschiedene Gerüche, die er unterschied, und dann noch die Ausdünstungen der Ärzte und des Professors, er konnte auch die Hände fühlen, die an seinem Körper herumtasteten, alles konnte er fühlen, riechen, erschnüffeln. Er musste daran denken, dass er den Krankenschwestern sogar jedesmal hätte sagen können, wenn sie mit einem Mann geschlafen hatten. So deutlich umgab ihn diese Welt von Geräuschen, Gerüchen und Gefühlen, und das Licht schmerzte ihn in diesen Augen, die doch nichts mehr sehen konnten, weil auch der Sehnerv – so hatte er den Professor sagen gehört – geschädigt oder gar zerstört war, irgendwo in seinem Kopf drin waren die Drähte durchschnitten, nichts stimmte mehr: er wollte seine Muskeln bewegen, sein Gehirn gab den Befehl dazu, aber die Kabel waren gekappt oder zerquetscht, und der betreffende Muskel tat, als hätte er nie im Leben einen Befehl von diesem Gehirn bekommen, und streikte, versagte seinen Dienst. Er konnte sich nicht rühren, nur das Gehör funktionierte ausgezeichnet und sein Gedächtnis auch, zumindest teilweise. Abends bekam er Morphium, obschon er seine Schmerzen gar nicht hätte hinausschreien können. Die mussten das offenbar einfach wissen, dass er Schmerzen litt, grässliche Schmerzen und dazu die Fragen, die sich ihm stellten: Wieso kann Licht mich noch schmerzen in diesen Augen, ist es doch vielleicht noch nicht zu Ende mit mir? Sein Gedächtnis versuchte zu arbeiten, es war seine einzige Beschäftigung, bloss – das Morphium brachte sein Gedächtnis durcheinander, verwirrte Wachsein und Traum, er konnte nichts mehr ordnen, einreihen. Früher war er sehr methodisch vorgegangen, aber früher, da konnte man lesen und vor allem schreiben – jetzt musste er nur noch denken, und er fragte sich, ob dieser Zustand, dieses machtlose Sich-mit-sich-selbst-Beschäftigen, wohl das sein sollte, wovon früher die Erzieher und die Theologen gesprochen hatten: das läuternde Fegefeuer, das die Seele aufnahmebereit machen sollte für das ewige Leben. Musste er sich deshalb mit allen seinen Fehlern, Sünden, Lügen, seinen Schurkereien, Freuden, Abenteuern auseinandersetzen, ohne einem einzigen Menschen auch nur etwas davon mitteilen zu können? Ohne sich seine Angst von der Seele reden zu können, weil er nicht mehr sprechen konnte?
2
Er brauchte sich auch nicht mehr schlaflos hin- und herzuwälzen, weil er sich nicht mehr wälzen konnte. An seinen Armen spürte er die Kanülen – gefühllos war sein Körper nicht, was ihn masslos erstaunte. Warum können diese zerstörten und kaputten Nerven wohl den Schmerz, aber keine Befehle mehr transportieren? Er merkte, dass das Fenster seines Zimmers weit geöffnet sein musste, es war Frühling, er unterschied jetzt vereinzelte Vogelstimmen, die er früher einfach als ein Ganzes, als ein bei seiner Arbeit eher lästiges Gezwitscher gehört hatte. Irgendwo läuteten Kirchenglocken, es war nicht das feierliche sonntägliche Gesamtgeläute des Glockenchorals: es war nur das Wimmern einer einzelnen Glocke. Aber vielleicht war da einer glücklicher gewesen als er selbst und war gestorben, mitten aus dem Leben hinausgestorben, ohne zuerst noch bewegungslos, seiner Sinne nicht mehr mächtig, daliegen zu müssen und Fegefeuer abzuhalten. Er werde künstlich ernährt, hatte der Professor den beiden Frauen an seinem Bett erklärt und: der Möglichkeiten gebe es viele, es bestehe vorläufig noch gar kein Grund zur Aufgabe sämtlicher Hoffnungen. Das alles hatte er sich anhören müssen, den genauen Befund dazu, soweit er dem Professor überhaupt vorlag. Noch seien nicht alle Tests durchgeführt und einige würden, wegen Zweifeln im Resultat, sogar wiederholt. Ausserdem werde man wohl Genaueres erst sagen können, wenn auch die unbestreitbar noch vorhandene Schockwirkung nachgelassen habe. Dies, meine Damen, lässt doch noch etwelche Hoffnungen offen, man soll nie aufgeben. Zudem geben wir ihm Morphium, obschon er nicht ansprechbar ist und auch keinerlei Reflexe zeigt, darum ist es nicht ausgeschlossen, dass er sehr starke Schmerzen zu verspüren vermag.
Der Professor schien ein alter Hase zu sein, einer, der sich durchaus vorstellen konnte, dass Gerson eben hören und fühlen könnte, also nicht einfach ein lebendiger Leichnam war. Wenn jetzt Frühjahr war, folgerte Gerson, dann musste er bereits seit einem halben Jahr im Krankenhaus liegen. Der Unfall war im letzten Sommer geschehen – aber wer weiss, vielleicht auch im vorletzten oder im Sommer vor sechs Jahren –, er konnte es nicht wissen, und aus den Gesprächen der andern hatte er bisher nicht den kleinsten Hinweis ableiten können.
Immer wieder tauchte aber die absurde Szene vor seinem Geist auf, die ihn von einem normalen Leben in diese Einsamkeit geschleudert hatte, ohne ihm eine Möglichkeit zur Gegenwehr zu lassen. Gewiss, er war oft schon einsam gewesen, überhaupt in seinem ganzen Leben einsam, das hatte schon in seiner Kindheit begonnen und weiter nichts zu sagen. Er hatte immer wieder ausbrechen, sich unter Menschen begeben, anderes als seine Einsamkeit suchen können. Aber so? Gefangen und gefesselt, alleingelassen mit seinen eigenen Gedanken – das war ihm noch nie geschehen! Ein schwerer Unfall in seiner Kindheit, gewiss, auch da war er lange Zeit wieder ein Säugling gewesen, der nochmals sprechen und gehen lernen musste. Auch im Gefängnis war er sehr einsam gewesen, aber da hatte er den Geist bewusst auf Einsamkeit trainiert, um dem Sadismus, dem Dreck und der Gemeinheit einigermassen unbeschadet entgehen zu können. Gott, was für ein Leben hatte er doch geführt und wie viel hätte er jetzt darum gegeben, einen neuen Anfang machen zu dürfen! Aber damit war es wohl vorbei, diese Chance erhält keiner zweimal! Er hatte die seinige dreimal erhalten und jedesmal vertan und war sich dennoch keiner Schuld bewusst – vermutlich hätte er alles nochmals getan, und zwar genauso, wie er es getan hatte, ohne zu zögern, weil er es für recht gehalten hatte und für richtig.
Auch Dorothea und Ruth hatten dem Professor keine Auskunft geben können, woher die vielen Narben stammen könnten. Kunststück, dachte Gerson: er hatte es ihnen ja nie gesagt, sie mussten nicht alles wissen.
Kochsalzlösung wurde ihm aus dem einen Tropf zugeführt, das hatte er von der Nachtschwester gehört, von jener mit dem starken Geruch nach starken schwarzen Zigaretten. Entweder hatte sie einen Mann oder Freund, der viel rauchte, oder sie war es selbst, die solches Kraut paffte. Kochsalz. Wenn die auch nur ahnten, dass dieses unschuldige Kochsalz schuldig war an allem, was ihm jetzt hier widerfuhr! Aber wie hätten sie das wissen sollen, vielleicht mit Ausnahme von Ruth. Aber die tat in ihren Gesprächen mit Dorothea an seinem Bett immer so, als wisse sie von nichts, und Dorothea wiederum spielte das unsinnige Spiel mit und gab vor, ihrerseits von nichts zu wissen. Die beiden hatten ja auch allen Grund, einander in die Schürzentaschen zu lügen. Nicht einmal an seinem Halbtotenlager konnten sie es lassen, und er musste wie ein Idiot daliegen, ohne dazwischenfahren und kräftige Ohrfeigen austeilen zu können – denn die hatten sie verdient, und nichts weniger!
Verdammt nochmal, wie oft hatte er in seinem Leben schon den dummen Ausspruch getan, lieber gleich tot als noch lebenslang ein Krüppel zu sein, womöglich im Rollstuhl. Und jetzt war er nicht einmal in einem Rollstuhl, er war noch viel weniger; er war einfach noch ein Stück denkendes Gehirn, dem man nur die Steckdose hätte herauszuziehen brauchen – dann wäre das Gehirn dem bereits toten Körper nachgefolgt. Aber dazu würde sich natürlich niemand hergeben; eher jammerten sie noch jahrelang an seinem Lager bis zum endgültigen Aus! Doch das Leben ging weiter. Gerson hatte das oft genug gesagt und auch selbst erlebt. Er kannte damals Kameraden, im Militärknast, die noch die ersten paar Monate lang besucht wurden, und dann kam der Frühling, und die Säfte stiegen, und plötzlich kamen die Besuche nicht mehr und liessen stammelnde und auch tobende Idioten in ihren feuchten Kasematten zurück. Idioten, die mit dem Schädel gegen die Wände rannten, die aus feuchtem Urgestein bestanden – oder die einem Wachsoldaten an die Gurgel gingen in der Hoffnung, mit dem Bajonett aufgespiesst zu werden, oder die sinnlose Fluchtversuche unternahmen in derselben sinnlosen Hoffnung, auf der Flucht erschossen zu werden. Diesen Schmerz meinten sie nicht mehr ertragen zu können – Idioten, die auch in Freiheit nicht begriffen, dass das Jahr vier unterschiedliche Jahreszeiten hat. Wie erst sollten sie es im Dunkel einer Kasematte begreifen?
Hätte es ihm jetzt genützt, wenn er auch noch hätte sehen können und nicht bloss hören? Oder sprechen? Wozu? Hätte man dann nicht vielleicht von ihm noch verlangt, er solle seine Memoiren diktieren, und wäre er dann nicht abermals dazu gezwungen oder verdammt gewesen, zu manipulieren, zu fälschen, zu lügen, um nicht vollends alles an die Neugier der andern auszuliefern? War es so nicht viel bequemer und behaglicher? Er konnte nachdenken, logisch und ehrlich, ohne dass irgend jemand etwas davon erfahren würde, er konnte diese Generalbeichte lediglich sich selbst ablegen. Und er war neugierig, ob es ihm unter solchen Umständen auch gelingen würde, sie zu analysieren, seinen Handlungen vielleicht nachträglich einen Sinn zu geben, den er damals noch nicht hatte erkennen können?
Beinahe hätte er sich darauf gefreut.
II
3
Obschon sie an seinem Krankenlager so redeten, als sei der Unfall nichts weiter gewesen als eben ein Unfall und somit eine jener Aneinanderreihungen von bösen Zufällen, die es nun einmal geben kann im Leben – wusste er es besser. Genaues Nachdenken war ihm schon immer ein Bedürfnis gewesen, und so war wohl nur ihm allein klar, wann der Unfall begonnen hatte, wann er sozusagen eingeleitet wurde. Nicht von einem blind zuschlagenden Schicksal, das keine Rücksichten nimmt und jedem vorgegeben sein soll – nein. Aber die beiden dachten wohl genauso oberflächlich wie immer. Dass ein Unglück, wenn es einen dann endlich trifft, nur noch die Klimax einer ganzen Reihe von Umständen – angefangen von der Gedankenlosigkeit bis hin zur schlichten Dummheit – sein kann, daran hatten jene beiden Frauen noch nie gedacht, die jetzt an seinem Bett gegenseitig auftrumpften mit Mitgefühl füreinander und für ihn. Obschon sie ihn vermutlich und sich selber gegenseitig ganz sicher am liebsten ohne Besteck und Senf aufgefressen hätten. Wiederum das Kochsalz!
Er hatte an einer Arbeit über dieses unscheinbare und doch so lebenswichtige Gewürz – wenn es bei diesem Ausdruck denn bleiben sollte – geschrieben. Das war nicht verwunderlich, weil die ganze Eidgenossenschaft mit ihrer Viehwirtschaft früher keine eigenen Salinen oder Salzbergwerke besessen hatte, Salz also damals jene Rolle im Spiel der Mächte spielen konnte wie heutzutage das Erdöl. Nicht umsonst waren denn auch die «Salzherren», die das Salz aus den angrenzenden Ländern herbeischafften, fast ebenso reich geworden wie heute die Ölmagnaten. Dass dabei das Burgund ein Hauptlieferant war und ausgerechnet mit diesem Burgund dann ein fürchterlicher Krieg ausbrach, der mit der totalen Vernichtung Burgunds als eigenem Staatswesen endete, machte die Geschichte nur noch interessanter für Gerson. Aber richtig ursächlich schuld an der Katastrophe war nicht das Salz und seine Geschichte, sondern ein Fahrrad …
4
Wie immer bei solchen Geschichten, Gerson wusste das nun infolge seines schmerzhaften Denkzwangs ganz genau, war aber auch das Fahrrad mehr Wirkung denn Ursache.
Binnen drei Tagen hatte er damals Dorotheas Haus verlassen müssen: sie hatte ihn einfach hinausgeworfen. Er hatte darauf verzichtet, sie durch Einspruch eines Anwalts oder gar vor Gericht zur Vernunft zu bringen. Es war ja auch nicht der erste Umzug in seinem Leben gewesen; er hatte nicht nur oft umziehen müssen, nein – er hatte schon oft in andere, neue Identitäten schlüpfen müssen, dass ihm die Tatsache allein nicht sonderlich zu schaffen gemacht hatte. Dieselbe Dorothea, die jetzt zusammen mit Ruth an seinem Lager Mutmassungen über sein Fortkommen anstellte – hätte er noch laut zu lachen vermocht, er hätte es jetzt getan.
Am Hause selbst hing er damals nicht sonderlich. Zu sehr trug es in jeder Einzelheit den Stempel von Dorotheas persönlichem und – für Gersons Geschmack – nicht besonders stilsicherem Wesen. Die Umgegend und vor allem die Nachbarn hatten ihm ebenfalls nicht gefehlt. Er hatte sie nie gemocht. Sie waren neureiche Snobs und demzufolge für ihn recht unbedeutend. Häuser, Kinder, Hunde und Autos glichen sich allesamt, die Gardenparties und die Swimmingpools ebenfalls. Auch das Geschwätz stammte aus derselben Konservendose, aus denselben halbgebildeten Magazinen und Shows, alles drehte sich um denselben Stumpfsinn. Dies wäre mit Leichtigkeit zu verschmerzen gewesen. Schlimmer war es, dass er weder vermögend noch auch nur gut situiert gewesen war. Das mochte mit seiner Arbeit zusammengehangen haben. Er hatte es auch immer abgelehnt, von Dorothea oder deren Eltern Geld anzunehmen. Er bestritt die nicht geringen Haushaltskosten aus seinem eigenen Einkommen, während Dorothea mit ihren Honoraren als Textilentwerferin aus dem vollen schöpfen konnte. Es hatte ihn nicht geringe Mühe gekostet, eine den Verhältnissen angepasste Wohnung zu finden. Dorothea hatte das nicht gekümmert, sondern sie hatte ihm zynisch vorgeschlagen, er solle ins Altersheim ziehen. Reif dafür sei er ohnehin. Dabei war er damals kaum sechzig Jahre alt gewesen.
Es gelang ihm dann mit viel Mühe, in einer kleinen Familienpension unterzukommen, obschon sich alles in ihm dagegen gesträubt hatte. Er war seiner Lebtag gewohnt, für sich selber zu sorgen. Daran hatten auch Dorothea und vor ihr etliche andere und nach ihr auch Ruth nichts zu ändern vermocht. Zu gerne stand er in der Küche und bereitete für sich allein oder für sie beide, wenn Dorothea zu Hause war – was selten vorkam –, eine Mahlzeit, und noch lieber kochte er für seine vielen Freunde. Dabei pflegte er zur allgemeinen Freude und zum allgemeinen Wohlbehagen Rezepte zu verwenden, die er schon als Knabe seiner Grossmutter abgeguckt hatte. Aus diesen Gründen hielt er auch nichts von Gasthöfen und Pensionen mit ihren sich wöchentlich wiederholenden Menüplänen.
Er fühlte sich damals weder alt noch krank und hätte das alles noch gut und gerne zehn Jahre geschafft, wenn auch mit der Zeit alles ein bisschen beschwerlicher geworden wäre. Am Ende bleibt eben schliesslich keiner der, der er einmal war – da hatte er keine Ausnahme gemacht, und von seinem jetzigen Zustand und Geschick hätte er sich nicht im Traum etwas einfallen lassen.
Damit, dass die Freunde, die man früher besass, weniger wurden, hatte er sich abgefunden gehabt. Mehr fiel dagegen ins Gewicht, dass sie anders wurden: Sie reisten nicht mehr so gerne wie früher, zum Teil sassen sie auch schon irgendwo in Spanien oder auf den Inseln in ihren zusammengesparten Alterssitzen, oder sie verzehrten zum mindesten in einem der vielen Rentner-Hotels, die es dort gab, ihre ansehnlichen Renten. Es waren eben Leute darunter, die es im Leben zu mehr gebracht hatten als er. Zu mehr als einem kleinen Ende flüchtigen Ruhms oder zu einem Stückchen noch viel unsichererer Unsterblichkeit, von der niemand leben konnte und die ausserdem ohnehin erst den Tod voraussetzte.
Er hätte es genauso machen können wie die anderen. Aber die blosse Vorstellung, am Ende seiner Tage in einem Zinksarg nach Hause gebracht zu werden, hatte ihm nicht sonderlich behagt.
Und nun war alles noch viel schlimmer gekommen. Statt in einem Zinksarg lag er jetzt unbeweglich in einem Spitalbett, musste sich ohnmächtig das dumme Geschwätz anhören, das falsche Bedauern, das auf nichts fussende Mitleid. Er hätte darüber nicht einmal kotzen können!
Damals musste er seinen gesamten Krempel aus dem Hause schaffen, und zwar – darauf hatte Dorothea bestanden – ebenfalls innerhalb der gesetzten Frist von drei Tagen. Andernfalls, so sagte sie, würde sie alles dem Sperrmüll übergeben.
Er hatte seine Habe in drei Haufen geteilt, die in chaotischer Unordnung auf dem blauen Nadelfilz des Wohnzimmerfussbodens lagen. Dorothea war irgendwo an einer Modeschau, als Designerin hatte sie öfters an solchen Veranstaltungen zu tun. Aber sie hatte ihn schärfstens darauf aufmerksam gemacht, dass sie bei ihrer Rückkehr weder ihn noch die geringste Spur von ihm im Hause anzutreffen wünsche. Dabei trug sie Schmuck am Leibe und an den Fingern, der mehrere tausend Franken wert war und den er ihr im Laufe der Jahre geschenkt hatte, doch damals mochte er sich nicht mehr mit solchen Kleinigkeiten abgeben. So hatte er seine Habe eingeteilt: unbedingt mitnehmen, bedingt mitnehmen, fortwerfen.
Der erste Haufen würde sich nach dem Platz richten, der ihm in Zukunft noch zur Verfügung stehen würde, die Grösse des zweiten und dritten Haufens danach, ob er in der Zwischenzeit irgendwo einen Raum finden würde, die Sachen einzulagern. Vielleicht, dachte Gerson, vielleicht ist einer ja wirklich nur ein sentimentaler Narr, der sich solche Gedanken macht. Am Ende kann es einem Leichnam ja wohl gleichgültig sein, wie und wo man ihn verbuddelt.
Auf Denkmäler, die auf ihn zumeist geschmacklos wirkten, legte er keinen Wert, dann schon mehr auf die Denkmäler, die da vor ihm auf dem blauen Nadelfilzteppich lagen: Erinnerungsstücke, deren jedes einzelne ihm eine Geschichte zu erzählen, eine Erinnerung heraufzubeschwören vermochte.
5
Das Schlimmste an der Familienpension war für ihn, dass nicht ein Zehntel von dem, was sich da auf dem Teppich auftürmte, was sich im Laufe der Jahrzehnte unstrukturiert und ohne erkennbares System – genau wie sein Leben selbst – angesammelt und manchmal auch bloss angehäuft hatte, in dem im Vergleich zu einem ganzen Haus winzigen Zimmer Platz finden würde, in dem er würde leben müssen. Mit Ausnahme von Ruth wüsste er auch niemanden, dem er das alles hätte übereignen mögen. Aber Ruth sass selbst im kleinsten Zimmer dieser Familienpension, und es hatte Gerson Mühe genug gekostet, der Frau Wackernagel zu verschweigen, dass er in ihrem Hause jemanden kenne, dazu noch eine weibliche Person, und ihr auch zu verschweigen, dass er nicht bis an sein Lebensende bei ihr zu bleiben gedachte. Denn darauf schien diese Wirtin grössten Wert zu legen.
Der dritte Haufen würde also der grösste werden – er würde unerbittlich aussortieren müssen, und dabei wurde er das Gefühl nicht los, damit sein Leben fortwerfen zu müssen. Immerhin hatte Frau Wackernagel, eine resolute Matrone mit einem dreifachen Köchinnenkinn (an sich kein schlechtes Vorzeichen), ihm erlaubt, seine Katze mitzubringen. Aber das schien das Äusserste zu sein, was sie sich würde abhandeln lassen, und das auch nur, weil sein Zimmer zu ebener Erde lag und sich nach hinten in den grossen Garten hinaus öffnete. Sollte aber die Katze, so erklärte die Wirtin, darauf kommen, im Garten, der im übrigen allen Pensionsgästen zur Verfügung stehen sollte, Jagd auf Vögel zu machen, oder wenn sie, was beinahe noch schlimmer wäre, die Blumenrabatten und die Rosenbeete verunreinigen würde, dann müsste sie auf die gegebene Erlaubnis zurückkommen, und das unwiderruflich. Gerson wusste beim besten Willen nicht, ob seine gescheckte Mieze sich an dieses Ultimatum halten würde. Bisher hatte sie im Hause und auf dem Balkon gelebt und von da aus die Vögel nur beobachtet, die sich in den Bäumen vor dem Balkon lärmend bemerkbar machten. Immerhin war eine Katze doch ein Raubtier, das mit seinen Instinkten ausgestattet war, und es schien Gerson absurd, einem Tier nun plötzlich irgendwelche Moralbegriffe zuzumuten, von denen es keine Ahnung haben konnte. Zum Problem mit der Katze gesellte sich noch der Umstand, dass er anlässlich seines Antrittsbesuches in der Pension (Ruth hatte ihr Zimmer einen Tag früher gemietet) mit Ausnahme einer sehr alten Frau, die unter einem riesigen Häkeltuch im Lehnstuhl in der Sonne sass und eine sehr spitze Nase in die Gartenluft spiesste, keinen der übrigen Pensionsgäste zu Gesicht bekommen hatte. Er konnte also nicht wissen, mit wem er es zu tun bekommen würde, ob mit älteren oder auch jüngeren Menschen, mit Männern oder mit Frauen. Danach zu fragen, dazu hatte er nach dem eingehenden Verhör, das Frau Wackernagel mit ihm angestellt hatte, keinerlei Lust und wohl auch keinen Mut mehr gehabt. Sie sah ausserdem genauso aus, als wäre Klatsch neben Küche und Haushalt ihr Lebensinhalt: neugierige kleine Augen, die ihm die Taschen zu entleeren schienen. Schon deshalb würde es wohl nicht sehr ratsam sein, auch nur das geringste herumliegen zu haben, das Frau Wackernagels Neugier hätte herausfordern können.
Sonst allerdings hatte das Ganze einen recht guten Eindruck gemacht, wenn Gerson von einer gewissen Solidität absah, jener penetranten Solidität, die einem Menschen das Leben zur Hölle machen kann. Im grossen Speisezimmer gab es, ausser einem grossen elliptischen Tisch mit vierzehn Stühlen und ebenso vielen in Ringe gerollten Servietten mit Karomuster, auch noch kleine Einer- und Zweiertische in den Fensternischen. Die Fenster waren hoch und breit und liessen durch Tagvorhänge mit gerüschtem Spitzenbesatz den Blick in den Garten frei. Abends wurden dicke Vorhänge aus senffarbigem Chintz vorgezogen. An diesen kleinen Tischen durfte man also offenbar, je nach Veranlagung und Laune, auch für sich allein speisen oder doch zu zweit, so gut das in einer Familienpension überhaupt möglich war. In einer Ecke des Wohnzimmers stand auf einer rollenden Konsole ein Fernsehgerät und auf der Ablage der Konsole häuften sich Fernsehzeitschriften. Der Bildschirm hingegen war mit einem Rollo verschlossen wie ein alter Schreibtisch, und das Rollo war mit einem Schloss zugesperrt. Auf einem kleinen Beistelltischchen stand ein altväterisches Radio mit einem Zeitungsständer daneben. Das Telefon befand sich im Flur zwischen Küche und Anrichte an der Wand. In der entfernteren Ecke des Speisezimmers war sogar ein Klavier, Krompholz & Co. stand in Goldlettern auf dem nussbaumgebeizten Deckel, und auf dem Klangkörper stand eine kitschig anmutende Beethovenbüste – vermutlich marmorierter Gips. Die Blumen auf den Tischen – die Vasen sahen aus wie böhmisches Kristall, und gerade deshalb waren sie es wohl nicht – schienen auf Anhieb echt, aber Gerson war bekannt, dass man heutzutage künstliche Blumen herstellte, die erst bei sehr genauem Hinsehen als solche zu erkennen waren. Sogar mit Duftstoffen gab es die Dinger, aber die Bilder an den Wänden, das hatte er als Kenner sofort bemerkt, waren ohne Ausnahme echt: schöne, alte, handkolorierte Stiche, welche die Stadt Bern und ihre Menschen in allen nur möglichen Epochen zeigten. Allerdings handelte es sich bei den Menschen meist um Soldaten und Offiziere in Uniform, Tschakos auf den Köpfen und mit hochgezwirbelten, gewichsten Schnauzbärten.
In den Zimmern der Pensionäre hingen keine Bilder, zumindest nicht in dem Zimmer, das Frau Wackernagel Gerson gezeigt hatte. Die meisten Menschen, die hierherkommen, hatte sie gesagt, bringen ja doch ihre eigenen Bilder mit, die sie aufhängen möchten, und dagegen sei ja auch nichts einzuwenden. Man weiss ja – dabei seufzte sie tief und ausdauernd –, wie alte Menschen an so etwas hängen können, nicht wahr? Aber ausbitten müsse sie sich, dass das Aufhängen der Bilder durch ihren Hausknecht und gleichzeitig ihr Faktotum, den alten Jean, besorgt werde. Sie schätze es nicht, ihre Tapeten ruiniert zu sehen. Und so ging es weiter und weiter …
In Gersons Zimmer – so Frau Wackernagel laut, ihn aus seinem Brüten aufschreckend – habe dermals der Herr Pfarrer Z. gewohnt. Und als er verstorben sei, hätten ihm die Erben, die Grosskinder, den letzten Wunsch erfüllt und die Möbel ihr, der Frau Wackernagel, überlassen, um ein Billiges natürlich! Sonst hielte sie ja darauf, dass ihre Mieter keine eigenen Möbel anschleppen. Das mache nur jedesmal Umstände und Umtriebe, besonders, wenn die Herrschaften dann verstürben und sich niemand finde, der das Gerümpel wieder ausräumen wolle und dann alles an ihr und Jean hängenbleibe. Nun ja, bei einem Pfarrherrn, da hätte sie eben eine Ausnahme gemacht, die bekanntlich die Regel bestätige. Sie habe ihm gestattet, sein Studierzimmer mit herzubringen, und hier sei es nun geblieben. Massiv und schön sei es ja und für einen Herrn wie ihn, Gerson, doch geradezu ideal geeignet. Einer Dame hätte sie es gewiss nicht vermieten mögen.
Und dann hatte Gerson gefragt, ob es ihm wohl gestattet sein würde, in seinem Zimmer zu arbeiten. Frau Wackernagel hatte ihre Stirn gerunzelt. Arbeiten? So hatte sie nachgefragt, und das in einem Ton, als hätte sie dieses Wort noch nie gehört und ekle sich davor, zumindest im Zusammenhang mit ihren Pensionsgästen. Um welcherart Arbeit es sich da handle, denn das müsse sie gleich vorweg sagen, damit habe sie eigentlich nicht gerechnet, und Lärm oder etwa gar Gestank – nein, das sei in ihrer Hausordnung nicht vorgesehen. Apropos Gestank, ob er etwa rauche? Dabei sah sie ihn wieder mit dem drohenden Ausdruck an, den er an ihr nun bereits gut kannte. Und sie wiederholte, als er nicht gleich antwortete, ob er rauche? Nun, ja – eine Zigarre oder eine Pfeife hatte er bisher nie verschmäht, wenn er auch nicht das war, was man einen starken Raucher hätte nennen können – was früher freilich anders gewesen war, wie so vieles andere auch. Dies teilte er ihr denn auch mit: dass er kaum mehr rauche, bloss so ab und zu. Und Frau Wackernagel antwortete wie aus der Pistole geschossen (die Antwort war offenbar von langer Hand vorbereitet und gehörte zum ständigen Repertoire), aber nicht hier im Zimmer, die Vorhänge! gab sie zu bedenken. Dann aber auch nicht im Speisezimmer und schon gar nicht im Flur zur Küche hin! Fast hätte Gerson fragen mögen, ob er vielleicht wie ein flaumbärtiger Primaner auf dem Lokus rauchen solle. Da meinte sie herablassend, wer es unbedingt nicht lassen könne – was ihr allerdings das allerliebste wäre –, es gebe ein kleines Herrenzimmer gleich neben dem Treppenaufgang zur ersten Etage, und auch im Garten sei es so lange gestattet, als sich niemand belästigt fühle. Belästigungen jeder Art seien hier zu vermeiden, gab sie zu bedenken, die übrigen Gäste seien ja gerade aus dem Grunde bei ihr, weil sie die Ruhe schätzten und weil sie ihren Lebensabend geniessen wollten. Gerson versicherte ihr, er gedenke keineswegs, diese Ruhe zu stören, es handle sich lediglich um Schreibarbeit, und seine Schreibmaschine (Frau Wackernagel zuckte bei dem Wort zusammen) sei eines der allerneuesten Modelle, die überhaupt keinen Lärm mehr machten. Jaja, sagte Frau Wackernagel so, als müsse sie etwas Unanständiges schnell hinter sich bringen, jaja, auf Zusehen hin – und das aber auf keinen Fall nach zehn Uhr abends. Die meisten Gäste hier gingen früh zu Bett, etwas, das sie nur empfehlen könne. Alle Ärzte schwörten ja hierauf, besonders bei älteren Leuten, darum gebe es ja auch bereits um sechs Uhr Abendessen, meist etwas Leichtes. Ältere Menschen vertrügen es auf die Nacht schlecht, üppig zu speisen, und dann habe sie den Ärger, wenn sie nicht schlafen könnten. Dann, mit unverhohlener Neugier wieder auf die Arbeit zurückkommend, was er denn da zu schreiben hätte? Wohl noch in Geschäften, wie? Und Gerson nickte ergeben, jawohl, Frau Wackernagel, in meinen Geschäften. Darauf die Wackernagel recht spitz, ihre übrigen Gäste lebten, mit Ausnahme einer Studentin, die in der Bodenkammer hause und ihr Examen machen wolle, eben im Ruhestand, hätten es nicht mehr nötig zu arbeiten.
Wenn Gerson noch etwas hätte sagen wollen, dann verschlug ihm jetzt der Preis, den er für das alles zu bezahlen haben würde, die Sprache. Nein, er würde nicht daran denken, sich hier einmauern zu lassen. Dafür war, wenn überhaupt, in zwanzig Jahren immer noch Zeit, schliesslich suchte er eine vorübergehende Unterkunft, und nicht einen endgültigen Sarg.
Auf der vorläufig positiven Seite der Bilanz befanden sich Schreibmaschine, Bücher und Katze, und damit würde er nun in drei Tagen in die Familienpension – die gutbürgerliche – der Frau Wackernagel einziehen.
III
6
Abschied nehmen, fortgehen, verlassen, weggehen– das heisst immer auch ein bisschen sterben. Einer vertraut gewordenen Gegend, einer Umgebung, einem Menschen den Rücken zu kehren, fällt auch dann nicht leicht, wenn man in dieser Beziehung schon so abgebrüht war wie Gerson. Auch dann nicht, wenn man solches eigentlich ein Leben lang immer wieder tun musste. Er gehörte zu jenen Menschen, die sich nie lange am selben Ort aufhalten können, ohne das Gefühl zu bekommen, sich begraben zu haben, träge geworden zu sein: eine Trägheit, die schon eher einer Leichenstarre gleichkam und aus der man sich ruckweise wieder hochziehen musste, wie aus einem zähflüssigen Teig. So wirst du, hatte seine Mutter einmal zu ihm gesagt, nie Fett ansetzen, wirst nie mehr auf dem Leibe tragen, als du gerade besitzt. Ein Stein, der dauernd rollt, ständig in Bewegung ist, setzt kein Moos an. Dabei, Mutter, so hatte er geantwortet, ist auch die Erde in ständiger Bewegung und hat doch schon recht ordentlich Moos angesetzt, die alte Dame!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!