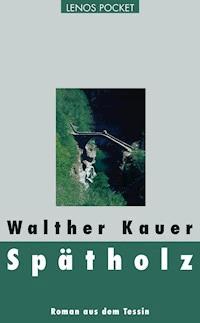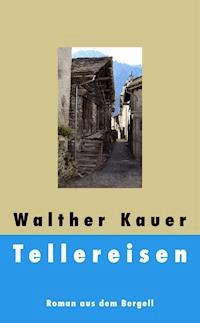
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lenos Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Tellereisen" erzählt die Geschichte des Schriftstellers Martial, der im Auftrag des Rundfunks die Ereignisse im Bergell zur Zeit des Dreissigjährigen Kriegs recherchiert. Von den Einheimischen als Fremdling abgelehnt und von seiner Frau verlassen, gerät er zunehmend in den Bann der Vergangenheit - seiner eigenen und derjenigen des Graubündner Tals.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 319
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
www.lenos.ch
Walther Kauer
Tellereisen
Roman aus dem Bergell
Der Autor
Walther Kauer (1935–1987) wuchs in Bern auf. Ausbildung zum Heilpädagogen in Aberdeen und Berlin. Er übte verschiedenste Tätigkeiten aus. Neben journalistischen Arbeiten veröffentlichte er Romane, Erzählungen, Hörspiele und Dramen.
Mit den Romanen Schachteltraum und Spätholz gelang ihm der Durchbruch. Für sein literarisches Werk wurde er mehrfach ausgezeichnet. Für den Roman Tellereisen erhielt er 1980 den Buchpreis der Stadt Bern.
E-Book-Ausgabe 2017Copyright © by Patrick KauerAlle Rechte vorbehaltenErstmals erschienen 1979Cover: Anne Hoffmann Graphic Design, BaselCoverfoto: Soglio im Bergell (privat)eISBN 978 3 85787 961 6
www.lenos.ch
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Kapitel 80
Tellereisen:
Mörderisches Jagdgerät, das aus zwei halbmondförmigen, scharf gezähnten Bügeln aus gehärtetem Stahl besteht. Als Auslöser dient eine tellerförmige Metallplatte. Berührt ein Tier mit seiner Pfote diesen Auslöser, um an den ausgelegten Köder zu gelangen, dann schnellen die Bügel hoch. Das Tier sitzt in der Falle, bis es vom Fallensteller von seinen Qualen erlöst wird.
Hin und wieder gelingt einem gefangenen Tier die Flucht aus dieser Falle: wenn es sich selber die Pfote abfrisst.
Ein solches Tier gilt dann im Volksmund als besonders schlau und gefährlich.
1
Vom Campanile im Unterdorf läutete es Mittag. Es war Juni. Die Sonne stand senkrecht über dem Einschnitt zwischen dem Pizzo dei Vanni und der Cima di Codera.
In der heißen Mittagsluft konnte Martial den Duft des ersten Heus riechen, das seine Nachbarn von den steilen Wiesenhängen des Tales einbrachten. Er saß an einem selbstgezimmerten Tisch in einem Garten, der von einer hohen Bruchsteinmauer umschlossen war, die ihn den neugierigen Blicken der Nachbarn entzog. Der große Tisch war bedeckt mit Stapeln von Papier, mit Notizbüchern und Heften in blauen Umschlägen. Eines der Hefte lag aufgeschlagen vor Martial. Seine Seiten waren eng beschrieben in einer winzigen, gestochen scharfen Handschrift.
In einer Korrespondenzschachtel, wie man sie früher in Kanzleien verwendet hatte, lagen alte Handschriften, geschrieben mit einer beinahe vollständig verblaßten Tinte, das Papier war gelblich und brüchig, zerknittert, aber das war in Anbetracht der Tatsache, daß Martial diese Papiere hinter einem Wandtäfer seines Hauses gefunden hatte, nicht weiter verwunderlich. Das Haus stammte teilweise aus dem 15. Jahrhundert, war mehrmals umgebaut worden, die Papiere trugen Daten aus dem 17. Jahrhundert, und es war nicht festzustellen, ob diese Dokumente absichtlich oder nur zufällig hinter das Wandtäfer geraten waren.
Die Menschen, die diese Papiere mit der verblaßten Schrift bedeckt und die sich mit den schwungvollen Anfangsbuchstaben jedes Abschnitts solche Mühe gegeben hatten, waren tot. Sogar ihre Gräber mußten längst aufgehoben worden sein. Lediglich zwei Namen waren Martial auf den alten verwitterten Grabplatten in der Mauer der kleinen Kapelle wieder begegnet.
Der erste – ein gewisser Luzi de Crana de Bregazzi – mußte das Haus während des Spaniereinfalls 1621 besessen haben und es später, nach der Zerstörung, teilweise auf den alten Grundmauern wieder errichtet haben. Der andere, ein Mastro Antonio de Spargnapani, war der Besitzer der Walkmühle am Fluß unten gewesen und schien verantwortlich für den zweiten und dritten, deutlich feststellbaren Umbau gewesen zu sein. Sogar die alten Bauabrechnungen hatte Martial gefunden. All dies hatte er nachträglich in Archiven und Registern zu überprüfen versucht. Von den so «erbeuteten» Dokumenten lagen vor ihm auf dem Tisch die Fotokopien.
Weiter hinten auf dem Tisch stand eine bauchige Korbflasche, ein sogenannter «fiascho», in der es rot funkelte, wenn sich vereinzelte Sonnenstrahlen durch das Ästegewirr des Pflaumenbaumes getastet hatten, der neben dem rohen Brettertisch stand.
Ein halbgeleertes Glas stand neben der Flasche, und eine Fliege versuchte an den Wein im Glas heranzukommen. Sie verursachte ein hohes, sirrendes Geräusch, als sie, wohl vom Weindunst betäubt, endlich in das Glas fiel.
Martial blickte von den Papieren auf. Das vor ihm liegende Manuskriptblatt war über und über bedeckt mit Anmerkungen, mit Streichungen, kräftigen und dezidierten, aber auch mit zaghafteren, kaum angedeuteten. Martial seufzte. Durch die Äste des Pflaumenbaumes und des weiter unten im Garten stehenden Kirschbaumes sah er die Glocke im offenen Glockenstuhl des Campanile hin- und herschwingen.
Aus den Kaminen der Häuser im Dorf stieg Rauch. Die Bauersfrauen kochten ihre Mittagssuppe, und ein leises Knurren im Magen erinnerte Martial daran, daß auch er eigentlich Hunger hatte. Er versuchte, nicht daran zu denken.
Am anderen Ende des Tisches, der Flasche genau gegenüber, stand eine Schreibmaschine, in die ein leeres Blatt Papier eingespannt war.
Langsam wanderte die Sonne am Pflaumenbaum vorbei, der Schatten wurde immer kleiner, bis das Licht voll auf den Tisch, auf Martial, auf die Flasche und das Glas mit der Fliege darin fiel. Die Fliege rührte sich nicht mehr. Im grellen Licht begann das weiße Papier in der Schreibmaschine Martial zu blenden.
Er dachte nach.
Früher war er beim ersten Glockenton des Mittagsläutens aufgestanden, hatte seine Arbeit auf dem Tisch liegen gelassen, dem unter dem Apfelbaum im hohen Gras hechelnden, kleinen schwarzen Hund gepfiffen und war die Rosenallee entlang, die er vor drei Jahren selber angelegt hatte, zum Gartentor mit dem schweren Eisenschloß geschritten. Manchmal hatte er noch für Hannah zarten, milchig stengligen Pflücksalat oder Küchenkräuter aus dem großen Kräutergarten zwischen den Rosenbäumchen und der Himbeerpflanzung geerntet, ehe er durch die verwinkelten Gäßchen des Dorfes, über kleine Treppchen hinauf und hinunter zu seinem Haus gegangen war, das etwas oberhalb der alten Kapelle von San Gian Battista stand und aussah wie ein mittelalterlicher Wohnturm, der die umliegenden Häuser überragte. Wenn Martial in dem engen Kirchgäßchen stand, mußte er den Kopf in den Nacken legen, wenn er das Dach seines Hauses sehen wollte. Bereits auf der Steintreppe, die zur im Sommer weitgeöffneten schweren Haustür mit dem handgeschmiedeten Gitter führte, hatte er die Minestra gerochen, die auf dem Herd in der Küche vor sich hin köchelte.
Hannah hatte jeweils schon den großen Stubentisch mit dem geblümten Bauerngeschirr gedeckt, und am unteren Ende des Tisches hatte die kleine Sarah hinter den Schulaufgaben gesessen, um den Nachmittag zum Herumtoben mit den Dorfkindern und mit dem kleinen schwarzen Hund nutzen zu können.
Martial hatte sich in der Küche die Hände gewaschen, nachdem er seinen Salat oder seine Küchenkräuter abgeliefert hatte. Zuweilen waren es auch zartrote Radieschen oder sonnenwarme Tomaten, er hatte Hannah geküßt oder auch nur – besonders in der letzten Zeit – mit einem Zuruf begrüßt, das Radio eingeschaltet, und dann gab es Essen, ein einfaches, aber deftiges Essen, dazu ertönte aus dem Radio die Stimme des Nachrichtensprechers, und sämtliche Katastrophenmeldungen vermochten ihren Frieden nicht zu stören.
Damals …
Martial hinter seinem Arbeitstisch seufzte. Der kleine Hund lag unter dem Apfelbaum und hatte beim ersten Glockenton erwartungsvoll seinen Kopf mit den klugen Augen gehoben. Die Macht alter Gewohnheit, sein kleines Hundehirn begriff nicht, daß Martial nun allein war.
Als Martial nicht reagierte, stand der Hund auf, streckte sich, wedelte mit dem Schwanz, rannte ein paar Schritte die Rosenallee hinunter, blieb stehen mit zurückgewandtem Kopf, sah, daß sein Herr ihm nicht folgte, kehrte wieder um, stellte sich vor Martial hin, erwartungsvoll wedelnd und auf einmal kläglich win selnd.
Martial wies den Hund mit ein paar beruhigenden Worten zurecht. Das Tier winselte noch einmal ganz leise. Dann trollte es sich wieder an seinen Platz unter dem Apfelbaum, legte den Kopf zwischen die Vorderpfoten und begann gelangweilt an einem unreifen, grasgrünen Apfel zu nagen.
Martial blickte weg.
Kein gemeinsamer Heimweg mehr mit dem Hund, kein Minestrageruch mehr durch die geöffnete Haustür – alles das war früher gewesen. Jetzt war er allein, und in dem leer zurückgebliebenen Haus starrten nur die Erinnerungen von den Wänden, schlugen mit Fäusten nach ihm, daß es schmerzte. Martial vermied es immer mehr, in das Haus zurückzukehren. Lediglich am Abend, wenn er eine gehörige Dosis Alkohol im Leib hatte, wagte er es, sich seinen Erinnerungen zu stellen. Er tat dann einfach, als würde er nichts davon merken, und wenn sie zu brüllen begannen, drehte er das Radio laut und stellte sich taub.
Er gab dem Hund sein Futter; er kochte sich eine Kleinigkeit, das Essen war ihm zuwider, meistens war es etwas aus irgendeiner Dose, das er sich bloß aufzuwärmen brauchte – und das passierte ihm, Martial, der bei seinen Freunden als ausgesprochener Feinschmecker und raffinierter Koch gegolten hatte. Nach dem Essen beeilte er sich, in sein Bett oben im Turmzimmer des Hauses unmittelbar unter den schweren Dachbalken zu kommen, obschon für ihn seit einiger Zeit an so etwas wie einen gesunden, erfrischenden Schlaf nicht mehr zu denken war.
Im Gegenteil.
In diesen Nachtstunden begann sich das Haus zu füllen. Martial bekam Gesellschaft, wilde, verwegene Gesellschaft, und er hatte sich schon oft darüber gewundert, daß seinen Nachbarn noch nichts Außergewöhnliches aufgefallen war. Aber dann erinnerte er sich, daß er im Mitteldorf beinahe der einzige Bewohner aus Fleisch und Blut war und daß hinter den verschlossenen Fensterläden der Häuser nur noch die Geister der Vergangenheit ihr Unwesen trieben.
Martial pflegte dann, zerschlagen und erschöpft, der Unruhe in seinem Haus mittels eines Schlafmittels ein dumpfes Ende zu bereiten.
2
Martial hatte seit einiger Zeit keinen Grund mehr, damit Zeit zu verlieren, über Mittag nach Hause zu gehen. Im Schuppen des Klostergartens – den Garten hatte noch Hannah so getauft, und der Name war diesem Grundstück seither geblieben – hatte er einen alten Schrank aufgestellt, in dem er während der warmen Jahreszeit sein Arbeitsmaterial versorgen konnte. Nur die alten Urkunden, die er in seinem Haus gefunden hatte, pflegte er allabendlich in einer Mappe mit heimzunehmen. Er fürchtete nicht zu Unrecht, sie könnten ihm gestohlen werden. Mehr als einmal hatte er am Morgen, wenn er in den Klostergarten kam, festgestellt, daß sich während der Nacht offenbar jemand an seinem Schrank zu schaffen gemacht hatte. Gewöhnliche Diebe waren es sicherlich nicht gewesen; die hätten sich bestimmt den Vorrat an Wein und Schnaps, den er im Gartenhaus offen aufbewahrte, nicht entgehen lassen.
Wenn es regnete, und das kam im Sommer öfter vor, weil sich in einem Gebirgstal wie dem Bergell das Wetter fast von einer Stunde auf die andere ändert, dann freilich mußte er in seinem Haus bleiben, Martial schauderte schon beim Gedanken daran: Es war jeweils kaum auszuhalten.
Martial hatte sich angewöhnt, einfach eine Flasche Wein und eine Dose Sardinen mitzunehmen, wenn er am Vormittag in den Klostergarten ging. Gläser, Besteck und Geschirr bewahrte er ebenfalls in dem kleinen Schrank im Gartenhaus auf, und auf dem Fenstersims standen die Flaschen mit dem würzigen Grappa und mit dem scharfen italienischen Cognac stets griffbereit.
Kleine, scharfe Zwiebelchen, die er in Ringe geschnitten zu den Ölsardinen essen konnte, wuchsen im Gemüsegarten gleich hinter der oberen Umfassungsmauer; er brauchte sie nur auszuziehen und am Brunnen beim Nachbargarten zu waschen. Ebenso wuchs in einer Ecke beim Gartenhaus Meerrettich, dessen grobe Wurzeln er mit seinem Taschenmesser fein schaben konnte, wobei ihm die Tränen in die Augen traten.
Die Glocken vom Campanile verstummten. Aus den geöffneten Fenstern der Nachbarhäuser drang das Klappern von Bestecken und Geschirr. Martials Nachbarn saßen beim Essen.
Es wurde so mittäglich still im Garten, daß Martial deutlich das Summen der Bienen hörte, die vom Bienenhaus des sciùr Giovanni, seines Nachbarn zur Linken, emsig zu seinem ummauerten Klostergarten flogen. Die Himbeeren und Johannisbeeren standen in voller Blüte, ebenso der Holunderbusch bei der Mauer. Seine riesigen Dolden hoben sich weiß vom blauen Himmel ab und schaukelten im sanften Mittagswind.
Früher hätte Martial sich darüber gefreut. Er hätte im Kopf überschlagen, wie viele Pfunde dunkelroter, samtiger Himbeeren, durchsichtig roter Johannisbeeren und glänzendschwarzen Holunders er Hannah hätte nach Hause bringen können, wie viele Gläser Marmelade und wie viele Flaschen Sirup sie daraus hergestellt hätte, diesen Sirup, den die kleine Sarah so gerne mochte und der in nichts dem Sirup zu vergleichen war, den man im kleinen Lebensmittelladen der Donna Antonia zu kaufen bekam.
Martial dachte auch an den scharfen Himbeerschnaps, den er aus einem Teil der Früchte zu brennen pflegte und den seine Freunde soffen, als wäre es Sirup.
Seit einem Jahr allerdings wußte Martial kaum mehr, was er mit den reifen Früchten anfangen sollte. Er hatte damit angefangen, sie an die großen Hotels im Engadin zu verkaufen oder an das kleine Krankenhaus von Flin zu verschenken.
Martial wandte sich wieder seinem Manuskript zu. Eine Zeitlang arbeitete er konzentriert weiter, aber in seinem Rücken wanderte die Sonne gegen Westen, sie brannte auf seinen Nacken, so daß er fürchtete, Kopfschmerzen zu bekommen. Er würde sich endlich ein Sonnendach machen müssen. Er schob die Papiere, die er redigiert hatte, vom Tischrand zurück und überdachte die Angelegenheit. Zunächst einmal müßte er sich nach geeigneten Materialien umsehen.
Martial stand auf und begann in der kleinen Rosenallee auf und ab zu gehen, wie er das immer zu tun pflegte, wenn er konzentriert nachdachte.
Die Rosenbäumchen waren noch nicht voll erblüht, aber am Ansatz der Knospen konnte Martial erkennen, daß der strenge, für Castasegna ungewöhnlich schneereiche Winter seinen Bäumchen nichts hatte anhaben können. Einige der Knospen öffneten sich schon; in ein paar Tagen würde Martial in einem Blumenmeer auf und ab gehen können.
Ich hätte natürlich, überlegte Martial, den Tisch und die beiden Bänke dort aufstellen sollen, wo sie im Sommer auch während der größten Mittagshitze im Schatten gestanden hätten, unter dem Apfelbaum etwa, oder vielleicht auch nur näher beim Pflaumenbaum. In der Regel wehte zwar immer ein leichter Wind im Tal, des Morgens talaufwärts und des Abends talabwärts. So konnte die Hitze nicht allzu schlimm werden, auch wenn sich der blaue Himmel blank gefegt von einer Dreitausenderkette zur andern quer über das Tal spannte und die Firnfelder in der Sonne gleißten, daß Martial die Augen schmerzten.
Aber eben – Martials Klostergarten war von einer hohen Bruchsteinmauer umgeben. Diese Mauer mußte bereits einige Jahrhunderte alt sein. Sie schützte seinen Garten vor jedem Luftzug, besonders vor dem rauhen Nordwind, der im Winter vom Gipfel des Piz Duan eisig kalt ins Tal hinunterfegte.
In seinem Garten blieb die sommerheiße Luft beinahe stehen, was den Vorteil mit sich brachte, daß Martial anpflanzen konnte, was immer er mochte: es gedieh.
Da rankte sich hinten an der Mauer die blaue Weinrebe empor und wuchs mit einigen Trieben bereits in sciùr Giovannis Garten hinüber. Aber Martial verstand sich mit seinem Nachbarn gut, und so waren ihm die paar süßen Trauben, die auf seine Seite hinüberhingen, wohl zu gönnen. Unmittelbar vor der Rebe, in der schwarzkrümeligen Erde, die Martial mit verrottetem Holz und mit Lauberde, vermischt mit Sand und Kompost vom großen Komposthaufen in der hintersten Gartenecke, geduldig verbessert hatte, stengelte würziger Grünspargel und standen ein paar malvenfarbig blühende Stauden Virginiatabak.
Beim Aufundabgehen bemerkte Martial plötzlich, daß die Tabakstengel entlang kleine rote Ameisen emsig hinauf- und hinunterkletterten und es furchtbar eilig hatten. Er besah sich die Bescherung aus der Nähe, und richtig: auf den grob gerippten, dickfleischigen Blättern glänzten klebrige Tröpfchen, und auf den Blattunterseiten saßen in dichten Kolonien die schwarzen Blattläuse, die da für die Ameisen zu arbeiten hatten.
Martial verfolgte die Spur der Ameisen und entdeckte deren Bau hinter dem Granit der Beeteinfassung. Er setzte seine Wanderung fort und nahm sich vor, am Abend, sobald die Sonne verschwunden war und die Ameisen in ihrem Nest saßen, bei Donna Maffei einen Eimer heißes Wasser zu holen und den Bau damit auszugießen.
Dann befaßte er sich wieder mit dem Sonnendach, und allmählich begann die Konstruktion in seinem Kopf Gestalt anzunehmen.
Er ging zum Schuppen hinüber und suchte dort nach einer Rolle Draht, nach dem schweren Vorbrucheisen und dem großen Eisenschlegel; dann nach geeigneten Nägeln, Agraffen, Hammer und Zange. Er bohrte auf jeder Schmalseite des Tisches mit dem Brecheisen zwei tiefe Löcher in den steinigen Grund, schlug die Pfähle ein, verkeilte sie mit kleinen Granitstücken, die er in die Löcher versenkte und mit dem Maurerhammer festschlug. Befriedigt betrachtete er die vier Pfosten, die so fest saßen, als wären sie für alle Ewigkeit da eingeschlagen.
Bei seiner Arbeit war er ins Schwitzen gekommen. Er hatte zuerst sein Hemd, dann das Unterhemd ausgezogen und beides über den Busch mit schwarzen Johannisbeeren gehängt, der gleich neben dem Eingang zum Schuppen wucherte. Der kleine schwarze Hund sah ihm die ganze Zeit über neugierig zu, verfolgte jede seiner Handbewegungen, als frage er sich, was Martial vorhabe. Dann blinzelte er und wandte sich wieder seinem unreifen Apfel zu. Ab und zu hob er seinen hübschen Kopf, wie um sich zu vergewissern, daß sein Herr noch da war.
3
Über der Tür des Schuppens hing an einem Nagel ein altes Ochseneisen, das Martial damals gefunden hatte, als er – wie lange war das nun schon her – den Klostergarten gerodet und wieder urbar gemacht hatte. Er hatte damals ein Schmirgeltuch genommen, das Eisen blank geputzt, den Nagel in den Querbalken des Türsturzes eingeschlagen, in seinem Innersten davon überzeugt, daß es ihm Glück bringen würde trotz allem, was vorher gewesen war. Er hatte geglaubt, daß ihm nun nichts mehr würde fehlgehen können, daß er das Glück endlich auf seine Seite gezwungen hatte. Denn wer findet heute schon bei seiner Arbeit ein Hufeisen, ein Ochseneisen noch dazu, das hundert Jahre und älter sein mußte.
Martial jedenfalls hatte an das Eisen geglaubt, alle die Jahre hindurch hatte er das getan, so wie er an vieles glaubte, Dinge, die ihm hier im Tal nicht nur Spott, sondern auch Mißtrauen, Angst, ja sogar Haß eingetragen hatten. Wahrscheinlich, so hatte sich Martial getröstet, wahrscheinlich bin ich den Menschen einfach unheimlich, wahrscheinlich war ich auch Hannah unheimlich, denn die, welche das Wissen nicht haben, die haben dafür die Angst.
Sie haben Angst vor dem, was sich hinter dem Wissen und damit hinter dem Wissenden verbirgt. Sie spüren das unbewußt, sie zeigen ihre Angst, und hat man sie einmal bei dieser Angst ertappt, dann beginnen sie einen zu hassen und einem gefährlich zu werden.
Es war auch für Martial nicht einfach gewesen, mit diesem Wissen zu leben, und wahrscheinlich war er deshalb jetzt auch allein, allein in diesem Klostergarten unter einer vom Himmel herabstürzenden Sonne, die ihn zu versengen drohte. Er warf einen Blick auf die Papiere, die er auf dem Tisch ausgebreitet hatte und auf die jetzt das blendende Sonnenlicht fiel. Fast zuviel hatte er sich da vorgenommen, und plötzlich widerte ihn die ganze Arbeit an: Wozu und für wen tat er das eigentlich? Er hörte seinen Rundfunkredakteur schon wieder mäkeln: Das hast du dir doch bloß aus den Fingern gesogen. Prozeß des Elia Tomasin? Wozu? Was soll das?
Mißmutig hob Martial den Kopf. Zu seiner Verblüffung bemerkte er eine riesige Kreuzspinne mit einer wunderschönen Zeichnung auf dem Hinterleib und dem samtig weich behaarten Rücken. Die Spinne schickte sich an, zwischen den Pfosten, die er eben erst eingesetzt hatte, ihre Fäden zu spannen und ein Netz zu weben.
Wenn die Spinne so weitermacht, dachte Martial, wird daraus ein Riesennetz. Dann wird endlich auch die Fliegen- und Mückenplage an diesem Arbeitstisch aufhören. Er beschloß, das Netz zu behüten und die große Kreuzspinne als seine Freundin zu betrachten. Hannah, die sich vor Spinnen, Taranteln und Skorpionen geekelt hatte, war nicht mehr da. Sonst hätte sie wohl das Netz mit dem Besen zerstört …
Martial seufzte. Er schlug eine Agraffe in den einen Pfosten, nicht ohne vorher die plötzlich reglos verharrende Spinne um Verzeihung gebeten zu haben: Diese eine Störung war nun einmal notwendig. Er griff zur Drahtrolle, maß mit den Augen den Abstand zwischen den Pfosten und der Schuppenwand, rollte dann ein Stück Draht ab, nahm die Zange und kniff das abgerollte Drahtstück ab. Er zog das eine Ende des Drahtes durch die Öse der Agraffe, bog es zu einer Schlaufe und hämmerte die Agraffe fest in den Pfosten.
Bei dieser Arbeit fiel sein Blick auf das Weinglas mit der toten Fliege darin. Er murmelte eine Verwünschung, griff nach dem Glas und schüttete den Weinrest in einem glitzernden, im Sonnenlicht rot aufleuchtenden Bogen hinter sich in das Gras unter dem Pflaumenbaum. Er zog den Korken aus der Korbflasche und schenkte nach, der Wein gluckerte in das Glas, und als er es zum Mund führte, bereute er sogleich, daß er die Flasche nicht in den Schatten des Holunderstrauches an der Mauer gestellt hatte. Der Wein war lauwarm und hinterließ in seinem Mund einen likörigen Geschmack. Er leerte das Glas trotzdem; er gierte danach, die Wärme des Alkohols zu spüren, die sich langsam von seinem Magen her im Körper ausbreitete.
Er spannte den an den Pfosten befestigten Draht mit der Flachzange und schickte sich an, neben dem Nagel mit dem Ochseneisen eine Agraffe in den Querbalken der Türfüllung zu schlagen. Nach dem dritten energischen Hammerschlag klirrte es über seinem Kopf, das schwere Ochseneisen löste sich von seinem Nagel und fiel herab. Es gab ein Geräusch, als hätte jemand eine Nuß geknackt. Martial verlor das Bewußtsein.
4
Er kam wieder zu sich, als die Sonne schon weit im Westen über den Misoxerbergen stand. Der kleine Hund lag an seiner Seite und leckte ihm von Zeit zu Zeit die Hand.
Martials Kopf schmerzte, und als er mit der Hand zum Kopf langte, spürte er das verkrustete Blut, das seine dichten, dunklen Haare verklebte. Drei Stunden mußte er da gelegen haben, und dennoch war ihm, als hätte er nochmals die ganzen Jahre durchlebt, die hinter ihm lagen. Aus seiner Bewußtlosigkeit, die der Schlag des Ochseneisens verursacht hatte, mußte er langsam in einen schweren Schlaf geglitten sein.
Er versuchte mühsam aufzustehen, sich am Pfosten seines unvollendeten Sonnendaches hochzuziehen. Der Hund wich nicht von seiner Seite. Endlich gelang es Martial, sich gegen den Türrahmen zu stützen, er keuchte, die Äste des Pflaumenbaumes über ihm drehten sich, in seinem Kopf dröhnte es, und hinter den schweren Augenlidern bewegten sich die letzten Traumbilder wie ein verlangsamt laufender Film.
Er schüttelte versuchsweise den Kopf, ein rasender Schmerz, dann zog er fluchend sein Taschentuch aus der Hosentasche und taumelte zum Nachbargarten hinüber, um das Taschentuch am Brunnen zu befeuchten. Der Hund lief dicht neben ihm her, sah immer wieder zu ihm auf. Martial versuchte das Blut aus den verklebten Haaren zu waschen, das Wasser im Brunnentrog aus weißem Granit färbte sich hellrot, als er das Taschentuch auswrang, es wieder benetzte und damit fortfuhr, bis die Wunde halbwegs sauber war. Kurz tauchte in seinem Kopf der Gedanke auf, einen Arzt aufzusuchen, um sich eine Tetanusspritze geben zu lassen, man konnte nie wissen, und der Rost am Eisen …
Aber er gab den Gedanken sofort wieder auf: Spielte es eine Rolle, woran man zugrunde ging? Er knotete sich das nasse, rote Tuch wie einen Turban um den Kopf und wollte eben in seinen Klostergarten zurückkehren, als ihn eine weibliche Stimme anrief.
«Um Gottes willen, was haben Sie denn gemacht, sciùr Martial?»
Die Stimme schien irgendwie aus dem Himmel zu kommen. Martial hob mühsam den Kopf und versuchte festzustellen, woher die Stimme ihn da anrief.
Auf einer der hölzernen Lauben hoch oben an einem Stall entdeckte er endlich sciùra Bianchi, die dort ihre Wäsche aufgehängt hatte, sich jetzt aber weit über die Laubenbrüstung hinauslehnte. Sie musterte ihn und wiederholte ihre Frage.
«Mir ist ein Ochseneisen auf den Kopf gefallen!» rief Martial unfreundlich zurück. Er hörte oben auf der Loggia ein empörtes Schnauben, dann zog sich die Nachbarin hinter die Wäsche zurück. Vermutlich, dachte Martial, glaubte sie, ich hätte sie auf den Arm nehmen wollen.
Er stolperte in seinen Klostergarten zurück und stülpte sich die an einem Pfosten hängende Baskenmütze über den improvisierten Verband.
Als nächstes griff er zur Weinflasche. Er hoffte, der Alkohol werde die Schmerzen erträglicher machen. Seine Knie zitterten, er mußte sich auf die Bank setzen, und dabei fiel sein Blick auf die Blätter, die vor ihm lagen. Aber die Schrift verschwamm vor seinen Augen, er konnte nichts von dem lesen, was er am Morgen geschrieben hatte.
Er schüttelte wieder den Kopf. Eine ganze Weile starrte er vor sich hin und fragte sich, woher wohl der Rauch kommen mochte, der in dichten Schwaden durch den Garten strich. Allmählich wurde ihm besser, und er stellte fest, daß überhaupt kein Rauch im Garten war. Sein Blick fiel auf das verdammte Ochseneisen. Er stand auf und hängte es wieder an seinen Platz. Plötzlich fiel es ihm ein, wo er schon einmal auf ein solches Ochseneisen gestoßen war. Er ging zum Tisch zurück und blätterte aufgeregt in seinen Papieren.
5
Endlich fand er, beinahe zuunterst in einem der Stapel, das Dokument, nach dem er suchte. Er hielt ein mehrseitiges fotokopiertes Gerichtsprotokoll in der Hand, auf dessen Titelblatt in der verschnörkelten Kanzleischrift des 17. Jahrhunderts geschrieben stand:
«Prozeß des Elia Tomasin
Wohnhaft gewesen in Foppa di Coltura sopra Porta, angeklagt der Straßenräuberei, der Hexenmeisterei, der Unzucht etc., pp., vom Leben zum Tode gebracht laut Urteil des Hohen Gerichts am 26. September 1655 in Vicosoprano am gewohnten Orte der Justiz unter der forca im Bosc da Cudin. Im Namen Gottes des Allmächtigen.»
In diesem Stapel blätterte Martial, bis er die Stelle fand, die so plötzlich in seiner Erinnerung aufgetaucht war, als er das vermaledeite Ochseneisen wieder an seinen Platz gehängt hatte. Im Verhörprotokoll, gewissenhaft niedergeschrieben vom damaligen Gerichtskanzler Hubertus von Salis, konnte Martial auf der vierten Seite – beim zweiten oder dritten Verhör auf der Folter – nachlesen:
«Den siebenten erschlugen sie im Stall oberhalb der Ciasa Grande in Promontogno mit einem schweren Ochseneisen, das bei diesem Stalle gerade zur Hand war. Sie fanden rheinische £12 sowie ein paar Handschuhe und einen Degen. War ein deutscher Landsknecht. Wurde unterhalb der Brücke in die Maira geworfen.»
Martial betrachtete entsetzt das Ochseneisen. In der Tat, ein solches Eisen mußte in der Hand eines starken Mannes zu einer furchtbaren Waffe werden.
6
Ihm hatte das Eisen den Schädel zwar nicht zertrümmert, aber er fühlte sich, als hätte der Schlag, den ihm das verdammte Ding versetzt hatte, die allerschlimmsten Erinnerungen freigesetzt, die er in einer Art Selbsthilfe fest in einem Winkel seines Gehirns eingekapselt hatte. Er starrte eine ganze Weile das Drahtgeflecht über seinem Kopf an, das aussah wie ein weggeworfener, stoffloser Regenschirm in einer Abfallgrube, und erst allmählich dämmerte ihm wieder, wozu er dieses Gestell fabriziert hatte: er mußte das Sonnendach fertigstellen.
Plötzlich verspürte er Hunger. Er beschloß, zuerst seine Sardinen zu essen. Während er mit dem Büchsenöffner seines Taschenmessers die Sardinendose öffnete, fiel ihm ein, er könnte eigentlich, wenn er schon einmal dabei sei, nicht nur ein Sonnendach, sondern gleich ein wetterfestes Dach bauen. Es regnete viel im Tal, und bisher war er bei Regen dazu verdammt gewesen, in dem verödeten Haus herumzusitzen, allein mit seinen Erinnerungen. Er holte sich im Schuppen einen Teller, pflückte sich Perlzwiebelchen und Meerrettich und spülte Teller, Zwiebeln und Meerrettich unter dem Wasserstrahl des Brunnens im Nachbargarten, dabei mißtrauisch zur Loggia hinaufschielend. Aber außer den ungeheuren Unterhosen, die dort zum Trocknen hingen, war von der neugierigen und zuweilen auch geschwätzigen sciùra Bianchi nichts zu sehen.
Mechanisch, wie in Trance, tat Martial seine Arbeit. Als er den Teller aus dem ausgedienten Biedermeierschränkchen geholt hatte, war sein Blick an den übrigen Tellern und Tassen, Gläsern und Bestecken hängengeblieben: Im Schränkchen befand sich das Gedeck für drei Personen … Martial begann diesen Tag zu verwünschen, an dem ihn offenbar alles an die Vergangenheit erinnerte – es war wie verhext: Was er anfaßte, bekam sofort einen Zusammenhang und geriet ihm zur bitteren Erinnerung …
Er würgte den aufsteigenden Zorn und den Kummer, der ihm die Kehle zuschnürte, hinunter und gab sich einen Ruck. Er schichtete die Sardinen auf den Teller, schnitt die Zwiebeln darüber, stellte dem Hund, der aufmerksam wedelte, die leere Dose zum Auslecken hin, und begann seinen Meerrettich zu schaben. Dabei kamen ihm die Tränen, flossen über die mageren, eingefallenen Wangen in den weichen Kinnbart – aber immerhin konnte Martial jetzt dem Meerrettich die Schuld an den Tränen geben …
Aus dem mitgebrachten Henkelkorb nahm er den Brotlaib, schnitt das Brot an und warf das erste Stück, das in der Gartenhitze bereits hart und trocken geworden war, dem kleinen Hund zu, und als dieser das Brot gefressen hatte und weiter mit sehnsüchtigen Augen seine Bewegungen verfolgte, vergaß er alle hundepädagogischen Erwägungen und gab dem Hund auch eine Sardine.
Zum Teufel mit allen Prinzipien!
Martial begann zu essen. Dabei fiel sein Blick auf den kleinen Stall am andern Ende des Gartens. Dort stand ein hoher, gerade gewachsener Kirschbaum, und in der Wiese unter jenem Kirschbaum hatte früher immer Hannah gelegen, wenn sie sich im Garten aufgehalten hatte. Am ersten Ast des Kirschbaumes hatte Martial jeweils eine Gießkanne mit kaltem Brunnenwasser befestigt. Vom Henkel der Gießkanne baumelte eine Schnur, und mehr als einmal hatte Martial Hannah als Bademeister gedient und an der Schnur gezogen, wenn Hannah sich unter dieser improvisierten Gießkannenbrause duschte.
Obwohl Martial sich mehrmals verblüfft über die Augen fuhr, konnte er das Bild nicht verscheuchen: Dort unter dem Kirschbaum lag Hannah in ihrem verwaschenen blauen Bikini. Das knappe Höschen spannte sich über dem Schambein und ließ am oberen Rand und dort, wo die kräftigen Schenkel sich berührten, den goldfarbenen Flaum ihrer Schamhaare aufglänzen. Der Schatten des breitkrempigen Strohhutes, den sie über ihre hochgeknoteten langen Blondhaare mit dem rötlichen Hennaschimmer gestülpt hatte, fiel auf ihre hohe Stirn mit dem leichten Anflug von Sommersprossen und ließ ihre hellgrünen Augen dunkel erscheinen. Martial schloß die Augen, aber es nützte nichts: das Bild ließ sich nicht verscheuchen. Aber da war noch etwas, was ihm einfiel. Richtig: unter dem Kirschbaum hatte Hannah jeweils das große Stück gelben Schaumgummis ausgebreitet … Natürlich, der Schaumgummi! Martial stand auf und sah auf dem Estrich des kleinen Schuppens nach.
Da lag das große Stück Schaumgummi noch, auf dem Hannah ihr Sonnenbad genommen und das ihnen früher sogar als Ehebett gedient hatte, damals, als sie von der Sonneninsel Ischia mit ihrem erotischen Klima zurückkamen und nichts besaßen, nicht einmal ein Bett, sie waren arm wie die Kirchenmäuse, als er Lisa verlassen hatte, mein Gott, auch dies eine Reise, die er am liebsten vergessen hätte, eine Qual für alle, und dann noch Lisas Tränen …
Martial verspürte plötzlich Ekel vor dem Rest Sardinen. Er verfütterte sie dem Hund und dachte mit grimmigem Spott daran, was wohl Hannah mit ihren klugscheißerischen Hundekenntnissen dazu gesagt hätte. Er machte sich, seinen rasenden Kopfschmerzen zum Trotz, wieder an die Arbeit, nachdem er nochmals ein großes Glas Wein in einem einzigen Zug geleert hatte.
Er zerrte den schweren Schaumgummi aus dem Estrich des Schuppens und hätte sich dabei auf der wackligen Leiter, die zur Estrichöffnung hinaufführte, schier den Hals gebrochen. Endlich hatte er das Ding durch den Garten geschleppt und nach einer kurzen Verschnaufpause auf das fertiggestellte Drahtgerüst gehievt. Dann begann er, in kurzen Abständen Drahtstücke durch den Schaumgummi zu bohren und diesen mit dem Drahtgestell zu verbinden. Eigenartigerweise verspürte er jedesmal, wenn er den Draht in den Schaumgummi bohrte, ein wildes Gefühl der Befriedigung, das mit fortschreitender Arbeit fast orgiastische Ausmaße annahm. Endlich war das Dach so festgezurrt, daß ihm auch die Frühjahrs- und Herbststürme im Tal nichts anhaben konnten. Martial setzte sich auf die Bank und besah sich sein Werk von unten. Er schenkte sich ein Glas ein und wollte es an die Lippen führen, da fiel ihm wieder ein, was dieses Stück Schaumstoff einmal bedeutet hatte, und der Kummer stieg in ihm auf, würgend und beklemmend.
Und jetzt war Hannah weg, Gott mochte wissen, wo sie sich befand, und der Schaumgummi, der ihnen in längst vergangenen guten Zeiten als Ehebett gedient hatte, endete als Wetterdach über seinem Arbeitsplatz im Klostergarten.
Deutlich konnte er sich noch an den Tag erinnern, an dem die Möbelpacker den Schaumgummi aus dem großen Möbelwagen in ihre erste richtige Wohnung im Tal getragen hatten und so Martials Zweifel über die Dauer des Aufenthalts im Bergell beendeten. Vermutlich hatten sich schon damals die Dorfbewohner, die diesem Umzug neugierig zugesehen hatten, ihr Teil gedacht: ein Stück gelben Schaumgummis als Bett …
Der Hund berührte mit seiner feuchten Schnauze Martials Hand; der war ihm noch geblieben, der kleine Hund war als einziger an seiner Seite geblieben, obwohl er drei Tage und drei Nächte geweint hatte, richtiggehend geweint wie ein Mensch, damals, als Hannah und Sarah plötzlich weg waren. Der Hund war ihm geblieben, das Haus und die verfluchten Erinnerungen …
7
Martial kam zu sich, als Hannah ihn leicht anstieß. Er war eingeschlafen: kein Wunder nach den Aufregungen der letzten Tage und der langen Reise. Die schwere Müdigkeit war von seinem Kopf ausgegangen und hatte zunächst nur die dünne Haut an den Schläfen dermaßen angespannt, daß es schmerzte. Von dort aus hatte sie sich über den Körper ausgebreitet, in schweren Wellen sein ganzes Wesen erfaßt. Langsam, kaum merklich hatte sich die Müdigkeit ausgebreitet, wie Öllachen sich auf einer Wasserpfütze ausbreiten: fettschlierig in sich windenden Farbbogen, die ineinander fließen, die schillern und sich knäueln.
Und nun war er davon erwacht, daß Hannah ihn mit der Hand leicht in die Seite gestoßen hatte.
Immer noch – seit nunmehr fast einer Stunde, wie sich Martial mit einem raschen Blick auf die Uhr an seinem Handgelenk vergewisserte – brummte der Motor des gelben Postbusses, ließ auf eine fast widerliche Weise verhaltene Potenz spüren und hatte Martial dennoch eingeschläfert.
Er richtete sich aus dem Sitz auf und versuchte benommen festzustellen, was Hannah veranlaßt haben könnte, ihn aus dem Schlaf zu reißen und damit wieder in das Gefängnis seiner Gedanken zurückzustoßen, dem er im Dahindämmern für kurze Zeit entronnen war.
Von Martials Kinn tropfte Speichel. Er mußte mit offenem Mund geschlafen haben. Womöglich hatte er sogar geschnarcht, etwas, das Hannah – nebst vielem anderem – nicht ausstehen konnte. Er zog hastig sein Taschentuch hervor und wischte damit über sein Kinn.
Das Postauto verließ eben die letzten Häuser des Dorfes Malögia, und nun begriff er, was Hannah dermaßen erregt hatte, daß sie – ganz entgegen ihrer üblichen Gelassenheit – auf ihrem Sitz hin und her rutschte, sich halb aufrichtete, sich umdrehte, um das hinter ihnen sitzende, kleine blonde Mädchen aufzufordern, hinabzublicken durch das talseitige Fenster des Postbusses in die dunkle Tiefe des Talgrundes. Martial hätte darüber gerne gelächelt, trotz der Müdigkeit, die ihn immer noch zähledrig einhüllte und die er nicht abzustreifen vermochte, weil sie auf ihm saß wie eine zweite Haut.
Ihm war der Anblick, der diese Aufregung ausgelöst hatte, vertraut. Er hatte in der letzten Zeit einige Male im Tal zu tun gehabt, erst im Vorjahr war er mit einem Übertragungswagen des Rundfunks bis in die letzten Winkel des Tals gefahren, und dennoch – sogar für ihn war dieser Augenblick ein Erlebnis.
Plötzlich versank der Erdboden, der Postwagen schien geradewegs in den leuchtenden Himmel hineinzustoßen, der wie in Stahl oder Silber gehämmert schien. Dieses Licht, dachte Martial, dieses Licht ist nicht wirklich, konnte es gar nicht sein, so etwas hatte er nicht einmal hoch im Norden, in den schottischen Highlands, erlebt, wo doch die Sonne im Sommer Tag und Nacht ihren flachen Glanz vom Himmel schüttete. So viel Licht konnte es gar nicht geben, wie hier auf jeden einstürmt, der auf der ersten Stufe jener Treppe steht, die vom Engadin nach Italien hinunterführt. Martial schloß geblendet die Augen.
Hinter ihm jubelte Sarah auf. Sie hatte offensichtlich in der Tiefe des Talgrundes, viele hundert Meter weiter unten, die weidenden Herden entdeckt, dazwischen die verwitterten Ställe und Heugaden. Alles das wirkte von der Höhe des Passes aus wie ein aufgeschlagenes Bilderbuch. Sarah jauchzte vor Freude.
Der Chauffeur des Postbusses krallte seine Arme um das große Lenkrad und ließ sein Fahrzeug in die sechzehn engen Haarnadelkurven des Passes hineinfallen, talwärts fallen, dem Gesetz der Schwerkraft folgend. Sechzehn Stufen zum Paradies …
Unter den Armen, in den Achselhöhlen, war das Hemd des Chauffeurs naß. Er schwitzte. Martial hatte das alles durch den Schleier seiner Müdigkeit hindurch wahrgenommen, und er hatte auch bemerkt, daß der kleine schwarze Hund hinter ihnen hechelte. Ihm mußte ebenfalls heiß geworden sein und wohl auch langweilig: Er war damals noch viel zu klein gewesen, um aus dem Fenster sehen zu können.
8
Der kleine Hund schob seine Schnauze in Martials Hand, dessen Kopf auf den Tisch gesunken war. Es dauerte eine ganze Weile, bis Martial begriff, daß er in seinem Klostergarten saß und geträumt haben mußte. Der Zeiger der Turmuhr an der Kirche stand auf kurz nach fünf.
Immer noch benommen, musterte Martial die Papiere vor ihm auf dem Tisch, zuoberst lag noch das Gerichtsprotokoll über den Prozeß des Elia Tomasin aus dem Jahre 1655, und Martials Blick glitt unwillkürlich zum Ochseneisen, das an seinem alten Platz hing.
Auf dem Teller neben dem Protokoll lagen ein paar ölverschmierte Zwiebelchen, und plötzlich ekelte ihn vor all dem. Warum mußten ihn die Erinnerungen nun auch in der friedlichen Stille seines Klostergartens heimsuchen? Sein Kopf schmerzte, der Verband war getrocknet und kühlte die Wunde nicht mehr.
Er ging zum Brunnen, befeuchtete seinen Turban und fühlte sich wieder ein bißchen besser. Dann nahm er den Henkelkorb und begann in seinem Kräutergarten Kräuter zum Trocknen zu schneiden. Gestern war die schriftliche Bestellung eines Kunden eingetroffen. Viele schätzten die Kräutermischung, die Martial in seinem Garten anbaute und die er aus fünfzehn verschiedenen Kräutern komponiert hatte. Eigentlich handelte es sich, je nach Zusammensetzung, um mehrere Mischungen. Da gab es eine für Fleischgerichte. Eine für Fisch. Für Salatsaucen – er liebte diese Arbeit. Freilich, früher hatte das Hannah besorgt, erinnerte sich Martial, während er ein paar Blätter Zitronenmelisse abschnitt und sich damit die Stirnhaut massierte, um etwas gegen seine rasenden Kopfschmerzen zu tun.
Hannah hatte es geliebt, Kräuter zu schneiden und dann an ihren Händen zu riechen. Manchmal hatte sie sich von hinten an Martial herangeschlichen, wenn er an seiner Schreibmaschine im Klostergarten saß und arbeitete, und ihm die nach Kräutern duftenden Hände unter die Nase gehalten. Martial hielt in seiner Arbeit inne. Gedankenverloren kauerte er auf den Fersen und starrte zum Bienenhaus von Messer Giovanni hinüber.
Der alte Giovanni rannte mit seiner Frau im Obstgarten herum, beide mit Gazemasken und Schutzhandschuhen angetan. Sie versuchten, einen Schwarm Bienen vom Birnbaum herunterzuholen, der dort an einem dicken Ast hing wie eine riesige Weintraube.