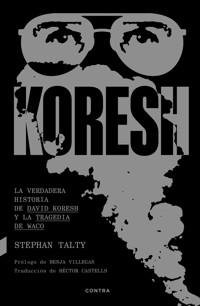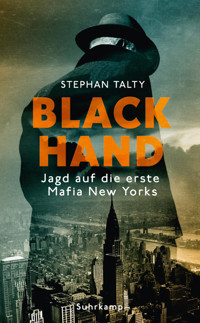
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Mit den italienischen Einwanderern sind Kriminelle in die Stadt gekommen, und im Sommer 1903 versinkt New York im Verbrechen: Entführungen, Bombenanschläge, Erpressungen – in großem Stil, verantwortet von einer Organisation: der Black Hand. Gegen sie zieht Joseph Petrosino in den Kampf, er ist der erste italienische Detective New Yorks, seine Methoden knallhart … Stephan Talty erzählt von den Anfängen der amerikanischen Mafia, und dem ersten Mann, der sich ihr entgegenstellt – eine wahre, eine umwerfende Heldengeschichte.
Als Kind wandert Joseph Petrosino zusammen mit seiner Familie aus Süditalien nach Amerika aus, Jugend in Little Italy, Prügeleien, Hunger, Jobs als Schuhputzer, Straßenfeger, Kadaverräumer. Doch Petrosino ist fleißig und er will nach oben. Schließlich bekommt er seine Chance bei der Polizei, und als die Black Hand ganz New York mit Terror überzieht, soll er die Stadt retten. Er stellt eine eigene Einheit aus Italienern zusammen, er perfektioniert Verkleidungen, er verdrischt Mafiagrößen auf offener Straße, er kennt keine Furcht. Spektakuläre Festnahmen folgen, darauf der Ruhm des Boulevards und Morddrohungen jeden Tag … Black Hand erzählt die Geschichte eines sagenhaften Mannes, dem am Ende eines Lebens im Kampf gegen das Verbrechen 250.000 Menschen das letzte Geleit geben werden quer durch Manhattan.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 443
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Stephan Talty
Black Hand
Jagd auf die erste Mafia New Yorks
Aus dem amerikanischen Englisch von Jan Schönherr
Suhrkamp
Zum Gedenken an meinen Vater, den Einwanderer
Non so come si può vivere in questo fuoco!
(Ich weiß nicht, wie man in diesem Feuer leben soll!)
Ein italienischer Einwanderer beim ersten Blick auf New York City
Inhalt
Prolog »Ein gewaltiges, alles verzehrendes Grauen«
Die Black Hand
1 »Diese Hauptstadt für die halbe Welt«
2 Der Menschenjäger
3 »In Todesangst«
4 Die geheimnisvollen Sechs
5 »Ein allgemeiner Aufstand«
6 »Eine füchterliche Explosion«
7 Die Welle
8 Der General
9 »Der Schrecken böser Menschen«
10 Einmal geboren werden, einmal sterben
11 »Schonungsloser Krieg«
12 Der Gegenschlag
13 Ein Geheimdienst
14 Der Gentleman
15 In Sizilien
16 Schwarze Pferde
17 Das Abstellgleis
18 Eine Wiederkehr
Danksagung
Anmerkung zu den Quellen
Anmerkungen
Prolog
»Ein gewaltiges, alles verzehrendes Grauen«
Am Nachmittag des 21. September 1906 spielte ein fröhlicher Junge namens Willie Labarbera auf der Straße vor dem Laden des Obstgeschäfts seiner Familie in New York City, zwei Blocks vom glitzernden East River entfernt. Johlend sausten der Fünfjährige und seine Freunde einander hinterher und rollten Holzreifen über den Bürgersteig, lachten, wenn die Ringe auf der gepflasterten Straße umkippten. Schließlich wuselten sie zwischen Bankern, Arbeitern und jungen Frauen mit Straußenfederhüten hindurch nach Hause oder in eins der italienischen Restaurants des Viertels. In jedem neuen Schub Passanten verloren Willie und seine Freunde einander für ein, zwei Sekunden aus den Augen und fanden sich dahinter wieder. Dutzende Male war das an jenem Nachmittag bereits geschehen.
Immer mehr Menschen gingen vorüber, zu Hunderten. Dann, als das Funkeln auf dem Fluss langsam verblasste, wetzte Willie noch einmal um eine Ecke und verschwand in einer Gruppe Arbeiter. Diesmal aber tauchte er nicht wieder dahinter auf. Das fahle Abendlicht beschien nur einen leeren Bürgersteig.
Seine Freunde bemerkten das nicht gleich. Erst als ihre Mägen knurrten, drehten sie sich um und blickten auf das kleine Stückchen Pflaster, auf dem sie den Nachmittag verbracht hatten. Inmitten der wachsenden Schatten hielten sie Ausschau nach Willie. Umsonst.
Willie war ein eigensinniges Kerlchen. Schon einmal hatte er geprahlt, er sei zum Spaß von zuhause weggelaufen, sodass die anderen Jungs womöglich zögerten, ehe sie in den Laden seiner Eltern gingen und berichteten, dass etwas nicht stimmte. Früher oder später mussten sie den Erwachsenen aber doch Bescheid geben. Kurz darauf stürzten William und Caterina, Willies Eltern, aus dem Geschäft und suchten die umliegenden Straßen nach ihrem Kind ab, fragten die Besitzer von Naschbuden und Lebensmittelläden, ob sie den Jungen gesehen hätten. Hatten sie nicht. Willie war verschwunden.
Da geschah etwas Eigenartiges, fast Telepathisches. Noch bevor jemand die Polizei rief oder einen einzigen Hinweis fand, ging Willies Freunden und Angehörigen unabhängig voneinander auf, was dem Jungen zugestoßen war. Und auch in Chicago, St. Louis, New Orleans, Pittsburgh oder den unbedeutenden Städtchen dazwischen wären die Mütter und Väter vermisster Kinder, von denen es im Herbst des Jahres 1906 so ungewöhnlich viele gab, zu demselben Schluss gelangt. Wer ihr Kind hatte? Ganz bestimmt La Mano Nera, wie die Italiener sagten. Der Bund der Schwarzen Hand, die Black Hand.
Die Black Hand war eine berüchtigte Verbrecherorganisation — eine »teuflische, arglistige, finstere Bande« —, die in großem Stil erpresste, mordete, Kinder entführte und Bomben legte. Zwei Jahre zuvor war sie landesweit bekannt geworden, als sie in einem entlegenen Winkel von Brooklyn einen Drohbrief bei einem in Amerika zu Geld gekommenen Handwerker eingeworfen hatte. Seither tauchten die mit Zeichnungen von Särgen, Kreuzen und Dolchen verzierten Briefe des Geheimbunds in der ganzen Stadt auf, gefolgt von grausigen Taten, die einem Beobachter zufolge »in den vergangenen zehn Jahren für eine in der Geschichte zivilisierter Länder in Friedenszeiten unerhörten Verbrechensbilanz« gesorgt hatten. Lediglich der Ku-Klux-Klan sollte zu Beginn des Jahrhunderts die Massen in noch größeren Schrecken versetzen als die Black Hand. »Sie fürchten sie aus tiefstem Herzen«, schrieb ein Reporter über die italienischen Einwanderer, »ein gewaltiges, alles verzehrendes Grauen.« Auch vielen anderen Amerikanern ging das im Herbst 1906 nicht anders.
Als der erste Brief bei den Labarberas einging, wurden ihre Befürchtungen bestätigt. Die Entführer verlangten $ 5 000, für die Familie eine astronomisch hohe Summe. Der genaue Wortlaut ist nicht bekannt, doch enthielten solche Briefe häufig Sätze wie »Ihr Sohn ist bei uns« und »Zeigen Sie diesen Brief nicht der Polizei, sonst, bei der Mutter Gottes, ist Ihr Kind tot.« Ein paar Zeichnungen am Ende unterstrichen diese Botschaft: drei plumpe Tintenkreuze, dazu ein Schädel mit gekreuzten Knochen. Die Markenzeichen der Black Hand.
Manche behaupteten, der Bund und ähnliche Organisationen seien nicht nur verantwortlich für ein bis dato unerhörtes Ausmaß an Mord und Erpressung in Amerika, für ein finsteres Zeitalter unbeschreiblicher Gewalt, sondern agierten obendrein als eine Art fünfte Kolonne, die den Staat für ihre Zwecke untergrub. Dieser Meinung verdankten die Einwanderer aus Italien schon seit mindestens einem Jahrzehnt allerhand Schwierigkeiten. »Viele sind der Ansicht«, sagte Henry Cabot Lodge, Senator aus Massachusetts, über eine angebliche italienische Geheimgesellschaft, »sie breite sich ständig aus, schüchtere Geschworene ein und bringe Schritt für Schritt die Regierungen von Staat und Städten unter ihre Kontrolle.« Skeptiker wie der italienische Botschafter, den schon die bloße Erwähnung des Geheimbunds verärgerte, entgegneten, die Gruppe existiere gar nicht, sei nur ein Märchen, mit dem die »Weißen« die Italiener verunglimpften, zumal sie diese sowieso am liebsten wieder aus dem Land jagen wollten. Ein anderer Italiener witzelte über den Bund: »Seine ganze Existenz beschränkt sich eigentlich auf eine dichterische Phrase.«
Doch wenn die Black Hand ein Hirngespinst war, wer hatte dann Willie?
Die Labarberas zeigten die Entführung bei der Polizei an, und kurz darauf klopfte ein Detective an ihre Tür in der Second Avenue, Hausnummer 837. Joseph Petrosino, der Leiter des berühmten »Italian Squad« der Polizei, war ein kleiner, stämmiger Mann mit der Statur eines Hafenarbeiters. Seine Augen — die manche als dunkelgrau, andere als schwarz wie Kohle beschrieben — waren kühl und taxierend. Er hatte breite Schultern und »Muskeln wie Stahlseile«. Ein Rohling war er jedoch nicht, im Gegenteil. Er sprach gern über ästhetische Fragen, liebte die Oper, besonders die italienischen Komponisten, und war ein guter Geigenspieler. »Joe Petrosino«, schrieb die New York Sun, »konnte eine Fidel zum Sprechen bringen.« Seine wahre Berufung allerdings war die Aufklärung von Verbrechen. Petrosino war der »größte italienische Detective der Welt«, wie die New York Times fand, ja, der »italienische Sherlock Holmes«, wie man sich in der alten Heimat erzählte. Mit sechsundvierzig war seine »Karriere so aufregend wie die jedes Javert im Labyrinth der Pariser Unterwelt oder eines Inspektors von Scotland Yard — ein von Abenteuer und Heldentaten pralles Leben, wie nicht einmal Conan Doyle es sich hätte aufregender ausmalen können.« Er war zurückhaltend gegenüber Fremden, unbestechlich, still, tapfer bis zur Waghalsigkeit, brachial, wenn man ihn reizte, und ein derart begabter Verkleidungskünstler, dass selbst seine Freunde ihn auf der Straße oftmals nicht erkannten. Von der Schule war er nach der sechsten Klasse abgegangen, konnte sich dank seines fotografischen Gedächtnisses jedoch erinnern, was auf Zetteln stand, die er Jahre vorher kurz gesehen hatte. Frau und Kind hatte er nicht; er hatte sein Leben der Aufgabe verschrieben, sein geliebtes Amerika von der Bedrohung durch den Bund der Black Hand zu befreien. Beim Gehen summte er Operetten.
In seinem üblichen Outfit aus schwarzem Anzug, schwarzen Schuhen und schwarzer Melone trat Petrosino bei den Labarberas ein. William Labarbera, der Vater des vermissten Jungen, zeigte dem Detective die Briefe, konnte sonst aber nicht viel sagen. Die Black Hand war überall und nirgends, sie war brutal, und ihre Allwissenheit grenzte an Zauberei. Den beiden Männern war das genau bewusst. Petrosino sah Willies Eltern an, dass sie »fast verrückt vor Trauer« waren.
Umgehend machte sich der Detective an die Arbeit, quetschte seine Informanten nach Hinweisen aus. Sein weitverzweigtes Netzwerk solcher Spitzel — der sogenannten nfami — erstreckte sich über die ganze Metropole: Barmänner, Ärzte, Krämer, Anwälte, Opernsänger, Straßenfeger (die sogenannten white winger), Bankiers, Musiker, narbengesichtige sizilianische Ganoven. Willies Beschreibung erschien bald in allen Zeitungen der Stadt.
Doch niemand hatte den Jungen gesehen. Ein vierter Brief drängte die Familie, ihr bescheidenes Heim zu verkaufen, um das Lösegeld aufzutreiben. Das Haus war alles, was die Labarberas in Amerika besaßen, sie hatten ihr Leben lang dafür gespart. Es zu verkaufen würde die Eltern mitsamt ihren Kindern zu eben jener bitteren Armut verurteilen, vor der sie aus Süditalien geflohen waren. Ihr amerikanischer Traum wäre mindestens für eine Generation ausgeträumt.
Der Bund hatte die Reaktion der Familie offenbar vorhergesehen. Dem vierten Brief war ein zusätzlicher Anreiz beigelegt, vielleicht an Mrs. Labarbera gerichtet. Beim Auffalten des Schreibens fiel etwas zu Boden: eine dunkle Locke von Willies Haar.
*
Die Tage gingen ins Land. Nichts. Der Junge war wie vom Erdboden verschluckt.
Dann, in der dritten Woche, ein Tipp von einem nfame. Der Mann hatte eine merkwürdige Geschichte aus Kenilworth, New Jersey, gehört. Beim Spazierengehen in einem Arbeiterviertel war eine Frau einem Mann begegnet, der ein großes Bündel bei sich trug. Just in dem Moment, als die Frau vorbeiging, drang aus dem Bündel ein spitzer Schrei. Der Mann eilte in ein nahes Haus, so einfach und marode, dass es als »Hütte« beschrieben wurde, und schloss die Tür. Die Frau aber blieb stehen und behielt die Tür im Auge. Wenige Minuten später trat derselbe Mann heraus und legte das — inzwischen stumme — Bündel hinten auf einen Planwagen. Dann fuhr er davon.
Petrosino hatte die Geschichte kaum vernommen, da hastete er auch schon die West 23rd Street hinab und ging an Bord eines der Fährdampfer nach New Jersey. Über die Reling gebeugt lauschte der Detective den gegen den Bug schlagenden Wellen und sah zu, wie die Docks der West Side, wo die Lampen der Krämerwagen in der Dämmerung glommen wie ferne Lagerfeuer, langsam kleiner wurden. Verschiedenste Möglichkeiten schwirrten ihm durch den Kopf, die Namen und Gesichter von Verdächtigen, die er sich vor Monaten und Jahren eingeprägt hatte und nun wieder abrief. Vielleicht trank er unterwegs ein Glas Buttermilch von einem der Händler an Bord (drei Cent für die sterilisierte, zwei Cent für die unsterilisierte Version). Die Überfahrt würde etwa eine Viertelstunde dauern, sodass Petrosino ein paar Minuten nachdenken konnte.
Der Bund der Black Hand wurde mit jedem Monat frecher und skrupelloser. Das Ausmaß dessen, was sich da in New York abspielte, war schwer begreiflich. In den Italienerkolonien, wie man die Einwandererviertel nannte, patrouillierten Männer mit geladenen Schrotflinten vor ihren Häusern; Kinder wurden in Zimmern verbarrikadiert und durften nicht zur Schule gehen; ganze Häuserfronten waren von den Bomben des Bundes weggerissen worden, und es regnete in die Wohnungen. In manchen Vierteln von New York, einer der reichsten, kosmopolitischsten Städte der Welt, detonierten so viele Sprengsätze, als würde die Metropole von einem in der Upper Bay liegenden Panzerschiff belagert. Der »Bund der Finsternis« hatte Dutzende Männer ermordet, verstümmelt und verkrüppelt, und hielt nun Zehn-, ja vielleicht Hunderttausende Bürger in seinem Bann. Die Angst war so immens, dass eine Familie bloß nach Hause kommen und eine schwarze Hand aus Kohlenstaub an ihrer Haustür zu finden brauchte — ein Zeichen, dass der Bund zu Besuch gewesen war —, um sofort ihre Siebensachen zu packen und das nächste Schiff zurück nach Italien zu nehmen.
Und das geschah nicht nur in New York. Wie Petrosino lange prophezeit hatte, breitete sich die Angst von einer Stadt zur nächsten aus wie ein Präriefeuer. Die Schwarze Hand war in Cleveland aufgetaucht, in Chicago, Los Angeles, Detroit, New Orleans, San Francisco, Newport, Boston und Hunderten kleineren und mittleren Städten, in Bergarbeiterlagern, Steinbrüchen und den Ortschaften dazwischen. Vielerorts hatte sie Männer und Frauen ermordet, Gebäude gesprengt, Lynchmobs angestachelt und das Misstrauen der Amerikaner gegenüber ihren italienischen Nachbarn vertieft. Unzählige Menschen — nicht nur Einwanderer — waren dem Bund bereits ausgeliefert, weitere sollten ihm bald zum Opfer fallen: Millionäre, Richter, Gouverneure, Bürgermeister, Rockefellers, Anwälte, Spieler der Chicago Cubs, Sheriffs, Staatsanwälte, feine Damen und Gangsterbosse. In jenem Januar hatten sogar Kongressmitglieder Drohbriefe des Bundes erhalten, und obgleich diese Geschichte ein bizarres, aber gutes Ende fand, gingen doch diverse Abgeordnete daraus mit »nervöser Erschöpfung« hervor.
Im Kohlengürtel Pennsylvanias hatte der Bund ganze Städte übernommen wie bei einem bewaffneten Putsch; seine Anführer waren seitdem Herren über Leben und Tod der Einwohner. Nach einem besonders grausigen Mord der Black Hand schickten die Bürger von Buckingham County dem Gouverneur Pennsylvanias eine Botschaft, die an Hilferufe von Apachen umzingelter Siedler im Wilden Westen erinnerte: »Lage unerträglich; Mörderbande drei Meilen von hier verschanzt; ein Bürger in den Rücken geschossen, andere bedroht; County-Verwaltung offenbar machtlos.« Die Bittsteller forderten »Detectives und Bluthunde.« Man verabschiedete neue Gesetze, um eine Terrorwelle wenigstens abzubremsen, die ganz aufzuhalten anscheinend unmöglich war. Im Süden kam es — großenteils dank der Schandtaten der Black Hand — zu Übergriffen gegen italienische Einwanderer. Von Präsident Teddy Roosevelt, der mit Petrosino noch aus seiner Zeit als Commissioner der New Yorker Polizei befreundet war, hieß es, er verfolge die Entwicklungen aufmerksam im Weißen Haus. Selbst Viktor Emanuel III., der kleinwüchsige König Italiens, hatte sich von seiner geliebten Münzsammlung losgerissen, um Petrosino in dieser ihm persönlich so wichtigen Angelegenheit zu schreiben, und dem Brief eine wertvolle goldene Uhr beigelegt. Selbst in Indien, Frankreich und England beobachtete man gebannt das Duell zwischen den Mächten der Zivilisation und denen der Anarchie — womöglich nicht ganz ohne Schadenfreude angesichts der Schwierigkeiten, die der Emporkömmling USA mit seinen dunkeläugigen Einwanderern hatte.
Petrosino war sich dieser Aufmerksamkeit sehr wohl bewusst, und zwar aus guten Gründen. Nicht nur verdiente er seine Brötchen beim New York Police Department, er war obendrein der vielleicht berühmteste Italo-Amerikaner des Landes. Dieser Ruhm, so sah es wenigstens der Detective, brachte Verantwortung mit sich. Gemeinsam mit einer kleinen Avantgarde seiner Landsleute — einem Anwalt, einem Staatsanwalt und dem Gründer eines Herrenklubs — wollte er eine Bewegung anstoßen, die den Italienern aus ihrer prekären Lage helfen sollte. Die Einwanderer seien doch nur Wilde, hieß es nämlich, die nicht zu amerikanischen Bürgern taugten. Petrosino widersprach wütend: »Der Italiener ist von Natur aus freiheitsliebend«, erklärte er der New York Times. »Die Aufklärung in seiner Heimat hat er hart erkämpft, und was Italien heute ist, wurde heldenhaft errungen.« Doch sein Ringen darum, die Italiener zu vollwertigen Amerikanern zu machen, wurde vom permanenten Krieg mit dem Bund behindert; selbst die Times stimmte in die Rufe ein, die weitere Einwanderung aus Süditalien unterbinden wollten. Wie sollte er seine Landsleute rehabilitieren, wenn die »Vampire« der Black Hand sich gleichzeitig quer durchs Land mordeten und bombten?
Gar nicht, wie Petrosino erkennen musste. Die Kämpfe hingen viel zu eng zusammen. Der Schriftsteller H. P. Lovecraft sollte später ein Beispiel für die Feindseligkeit liefern, die viele Amerikaner gegen die Neuankömmlinge hegten. In einem Brief an einen Freund beschrieb er die sich in der Lower East Side drängenden Einwanderer aus Italien als Geschöpfe, die »mit keiner noch so großen Anstrengung der Fantasie Menschen genannt werden können.« Stattdessen seien sie »monströse, nebelhafte Schattenskizzen des Pithecanthropoiden und Amöbenhaften; undeutlich geformt aus irgendwelchem stinkenden, zähflüssigen Schleim irdischer Verderbtheit, glitschen und triefen sie auf und über die verschmutzten Straßen und durch Türen hinaus und hinein, wie es sonst nichts tut als Pestwürmer oder namenlose Kreaturen aus der Tiefsee.«
Wäre Petrosino erfolgreicher im Kampf gegen die Black Hand gewesen, wäre wohl auch sein Kreuzzug für die Italiener besser gelungen. Doch 1906 war ein übles Jahr; Blut, Verbündete und Boden waren verloren worden. Der Bund warf seinen Schatten inzwischen auf Petrosinos gesamte Wahlheimat, von den prächtigen Villen Long Islands bis zu den zerklüfteten Buchten Seattles. Dem Detective schwante nichts Gutes.
Heute aber würde er diese Sorgen beiseiteschieben. Er musste Willie Labarbera finden.
Die Fähre legte am Ufer von Jersey an. Petrosino mietete eine Kutsche, der Fahrer zischte die Pferde an, und los ging es nach Kenilworth, etwa dreißig Kilometer westlich. Am Pier zerstreuten sich unterdessen die Passagiere, und ein mit Kohle beladenes Pferdefuhrwerk ratterte auf die Fähre, um den Maschinenraum mit neuem Brennstoff zu versorgen. Als das Fuhrwerk zurück an Land war, legte die Fähre wieder in Richtung Manhattan ab, und es wurde still am Dock. Einige Stunden später tauchte Petrosinos Kutsche wieder auf. Er stieg aus, wartete auf die Fähre und ging an Bord. Das Schiff entfernte sich vom Pier in New Jersey, glitt über das dunkle, unruhige Wasser auf die Gaslaternen zu, die in der niedrig gebauten Stadt jenseits des Hudson funkelten. Petrosino war allein. Der Junge war nirgends zu finden gewesen.
Wenn Petrosino sich über einen besonders schwierigen Fall den Kopf zerbrach, suchte er gern Zuflucht in den Opern Verdis, seines Lieblingskomponisten. Er nahm seine Geige und spielte ein ganz bestimmtes Stück: »Di Provenza il mar«, Germonts Arie aus La Traviata. Darin tröstet ein Vater seinen Sohn, der seine Geliebte verloren hat, indem er den jungen Mann an sein Elternhaus in der Provence erinnert, an strahlende Sonne und süße Erinnerungen:
Oh, rammenta por nel duol
ch'ivi gioia a te brillò;
e che pace colà sol
su te splendere ancor può.
(Oh denk in deinem Schmerz daran
welche Freude dir gelacht
und dass der Friede jener Sonne
über dich noch heute wacht.)
»Unablässig« spielte Petrosino allein in seiner Junggesellenwohnung diese Arie, wobei seine starken Hände den Bogen sanft durch die zarten ersten Noten und hinein in die schwierigeren Passagen führten. Das Stück ist schön, aber auch traurig; es drückt die Sehnsucht nach Vergangenem aus, das höchstwahrscheinlich nie mehr wiederkehrt.
Man kann sich gut vorstellen, dass Petrosinos Nachbarn diese Arie an jenem Abend nicht nur einmal zu hören bekamen.
Die Black Hand
1
»Diese Hauptstadt für die halbe Welt«
Am 3. Januar 1855 lag ein Toter am Ufer des Mississippi unweit von New Orleans, die ausgestreckte Hand nur ein kleines Stück vom südwärts in den Golf von Mexiko strömenden Wasser entfernt. Schon von weitem war offensichtlich, dass der Mann keines natürlichen Todes gestorben war. Sein Hemd war durchlöchert und blutgetränkt; über ein Dutzend Mal hatte man auf ihn eingestochen. Obendrein war ihm von einem Ohr zum anderen die Kehle aufgeschlitzt worden, das Blut trocknete in der Hitze zu einer dicken Kruste. Der Mann hieß Fransisco Domingo. Er war das erste bekannte Opfer der Black Hand auf amerikanischem Boden.
Erst fünf Jahre später sollte Joseph Petrosino das Licht der Welt erblicken. Der Bund hatte es fast zwei Jahrzehnte vor ihm auf den Kontinent geschafft.
Anders als Domingo und die meisten seiner künftigen Widersacher war Petrosino kein Sizilianer. Er stammte aus der Provinz Salerno, in Kampanien, vorne am Knöchel des Stiefels. Giuseppe Michele Pasquale Petrosino kam am 30. August 1860 in einem Dorf namens Padula zur Welt, wo auch eine berühmte Kartause steht. Sein Vater Prospero war Schneider, seine Mutter Maria Hausfrau. Giuseppe hatte einen kleinen Bruder und eine kleine Schwester — für italienische Verhältnisse eine eher kleine Familie. Zwei Tragödien ereilten in Giuseppes Kindheit das bescheidene Heim des Schneiders: Die Mutter starb — woran, wurde nirgends vermerkt — und Giuseppe bekam die Pocken, was damals oft ein Todesurteil war. Er überlebte, trug jedoch sein Leben lang die Narben im Gesicht.
Der erste Schlag dürfte den kleinen Jungen am heftigsten getroffen haben. Petrosino sprach nie von seiner Mutter — wie er überhaupt kaum je ein Wort über Persönliches verlor —, war jedoch für eine Schweigsamkeit und Insichgekehrtheit bekannt, über deren Gründe viele sich später den Kopf zerbrachen: Seine mangelhafte Bildung und der schwierige Job waren zwei beliebte Theorien. »Er lächelte nie«, lautete eine gängige Beschreibung in den Zeitungsporträts, die sich in den frühen 1900ern häuften, als Petrosino landesweit bekannt wurde. Richtig war sie nicht. Petrosino konnte sehr emotional sein, fröhlich, zärtlich und auch zornerfüllt; enge Vertraute schworen sogar, er habe sich auf Partys zu Parodien von Berühmtheiten überreden lassen. Dennoch, die Trauer um seine Mutter hinterließ gewiss eine tiefe Spur in seinem Wesen.
Petrosinos Jugendjahre waren auch für Italien prägend. Durch einen von Giuseppe Garibaldi angeführten Krieg wurden die Staaten der Halbinsel, einschließlich des Königreichs beider Sizilien und des Vatikans, zum modernen Italien vereint. Doch Armut und Machtmissbrauch hielten sich hartnäckig, besonders im Süden, und 1873 — Petrosino war dreizehn — beschloss Petrosinos Vater Prospero, sein Glück in Amerika zu versuchen. Er schiffte die Familie auf einen Dampfsegler nach New York City ein.
Dreizehn ist in Süditalien ein wichtiges Alter: Es markiert den Zeitpunkt, an dem ein Junge seine Kindheit hinter sich lässt und lernt, wie die Welt funktioniert und wie man sich in ihr zu benehmen hat — den Punkt also, an dem er zum Mann wird. Petrosino hatte inzwischen sicher schon viele Werte eines ehrbaren Italienerlebens angenommen, deren bedeutendster der ordine della famiglia war, der das Leben in den Städten Süditaliens diktierte. Eine der wichtigsten Regeln dieses ordine besagte, dass man sich niemals selbst über die Familie, seine privaten Ziele niemals über seine Pflichten stellen durfte. Der dauernde Überlebenskampf im rauen Mezzogiorno verlangte nun einmal, dass die Familie zusammenhielt.
Nach fünfundzwanzigtägiger Reise erreichten die Petrosinos New York, als Teil einer frühen Welle italienischer Einwanderer, die größtenteils aus Fachkräften und Akademikern bestand. Sie ließen sich in Manhattan nieder, wo Petrosino auf eine öffentliche Schule ging und Englisch lernte (als Nicht-Muttersprachler stufte man ihn vermutlich in eine niedrigere Klasse ein). Das Zeitalter italienischer Masseneinwanderung nach Amerika war noch nicht angebrochen. Bis 1875 waren nur 25 000 Italiener gekommen, die sich verhältnismäßig leicht in Städte wie New York oder Chicago integriert hatten. Erst ab den 1880ern würden Unmengen bitterarmer Einwanderer vom Stiefel an die Ostküste strömen, was häufig zu Spannungen mit den Einheimischen führte. So brachte 1888 eine Zeitung in New Orleans eine Reihe Karikaturen mit dem Titel »Über die Italiener«. Eins der Bilder zeigte einen mit Italienern vollgestopften Käfig, der in einem Fluss versenkt wurde. Die Bildunterschrift lautete: »Wie man sie wieder loswird.« Doch auch 1873 bekam der junge Joseph in den Straßen Lower Manhattans schon den Hass zu spüren.
Italiener zogen in Viertel, die seit mindestens zwei Generationen den Iren gehört hatten. Die Neuankömmlinge mit der merkwürdig melodischen Sprache, den rauschenden Festen, dem olivfarbenen Teint und dem wunderlichen Essen waren in der Unterzahl und wurden zutiefst verachtet. Zog in einem Mietshaus eine italienische Familie ein, zogen die Iren häufig aus. An einem der Brennpunkte bildete die Polizei täglich einen Kordon entlang der Straße, wenn die letzte Schulglocke erklang. Als die italienischen Kinder aus der Schulpforte kamen, erhob sich Gebrüll aus den umliegenden Häusern und hallte von den Pflastersteinen wider. Eine irische Mutter nach der anderen schob ihr Fenster auf, beugte sich hinaus und rief ihren Söhnen zu, sie sollten die »Dagos kaltmachen!« Die hellhäutigen Jungen hörten sie, schnappten sich Steine und schleuderten sie nach den Köpfen ihrer italienischen Mitschüler und Mitschülerinnen, die in Scharen aus der Schule flohen. Kleine Grüppchen setzten den dunkelhaarigen Kindern nach, versuchten Nachzügler von den anderen zu trennen. Hatten sie einen in die Ecke getrieben, schlugen sie auf ihn ein, bis Blut floss. »Es ging zu wie im Tollhaus«, erinnerte sich später ein Mann, der dieses tägliche Ritual als Kind hatte erdulden müssen.
In ihrer Furcht vor ausgeschlagenen Zähnen und gebrochenen Knochen wandten ein paar italienische Schüler sich an einen Neuling, dem die Kraft aus allen Poren strahlte. Der junge Joe Petrosino ging keiner Prügelei mit den Iren aus dem Weg, ja, er schien sogar Spaß daran zu finden. Nach Schulschluss führte Joe seine Freunde auf die Straße und hielt Ausschau nach Gegnern. Gelang es einem jungen Iren, zwischen den Cops hindurchzuschlüpfen und einen Stein auf die sich hinter Joe drängenden Kinder zu schleudern, ging er sofort auf den Missetäter los. Erst hagelte es Schwinger gegen dessen Kopf, dann krachte der Schädel des Steinewerfers aufs Pflaster. Oft kam Petrosino mit blutverschmiertem Hemd nach Hause. Mit der Zeit rankte sich um seinen Namen bereits eine kleine Legende.
Trotz dieses rauen Einstands in Manhattan erwies Petrosino sich als typischer amerikanischer Einwanderer: Er suchte einen Weg nach oben. Zusammen mit Anthony Marria, einem anderen jungen Italiener, eröffnete er einen Zeitungs- und Schuhputzstand gleich vor 300 Mulberry Street, mitten in dem Viertel, das bald als Little Italy bekannt sein sollte. Zufälligerweise handelte es sich bei der Adresse um das Präsidium des New York Police Department, und wenn Petrosino nicht gerade den Herald oder die World an den Mann brachte, putzte er die Schuhe der Streifenpolizisten in ihren dunkelblauen Wolluniformen mit den glänzenden Goldknöpfen. Manche der Beamten waren nett zu den Jungen, andere beschimpften sie als »Dago«, als »Wop« (kurz für: without papers) oder als »Guinea«, eine für die Italiener besonders beleidigende Gleichsetzung mit Sklaven, denn der Begriff bezog sich ursprünglich auf die Verschleppten aus dem westafrikanischen Guinea.
Die Schmähungen schreckten den Teenager nicht ab. »Petrosino war ein strammer Bursche«, erinnerte sich sein Freund Anthony, »und ausgesprochen ehrgeizig.« Die meisten Italiener schmissen früh die Schule und suchten sich Arbeit in einem der Textil-Sweatshops, die überall in Little Italy aus dem Boden schossen, sammelten Lumpen oder gingen bei Schrott- oder Straßenhändlern in die Lehre. Joe hielt auf der Schule länger durch als die meisten anderen Einwanderer, obwohl er praktisch in Vollzeit Schuhe putzte. Von der Public School 24, Ecke Bayard und Mulberry, ging er nach der sechsten Klasse ab.
Nun war Joe einer von Tausenden italienischen Jungen, die — teilweise barfuß, selbst im eisigen New Yorker Winter — durch die Straßen zogen und riefen: »Schuhe wichsen gefällig?« Fand er einen Kunden, warf er ein altes Stück Teppich für seine Knie auf den Boden, schrubbte mit einer Bürste den Dreck von Arbeiterstiefeln oder den Schnürschuhen der sich um das Präsidium scharenden Anwälte und Journalisten und polierte zum Schluss das Leder mit dem Lappen blank.
Mit einem Verdienst von etwa fünfundzwanzig Cent pro Tag befanden Schuhputzer sich am unteren Ende der ökonomischen Nahrungskette des Manhattan der 1870er. Die Arbeit machte den jungen Petrosino mit der rauen Seite des New Yorker Kapitalismus bekannt — und mit Tammany Hall, einer politischen Seilschaft, die über Jahrzehnte hinweg die Politik der Stadt kontrollierte. Unter der Ägide dieser irischen Politiker mussten italienische Schuhputzjungen für das Recht bezahlen, an einer bestimmten Ecke zu arbeiten, und Polizistenschuhe sogar gratis putzen, als kleinen Bonus sozusagen. Wer sich widersetzte, bekam Besuch von einem irischen Schläger.
Petrosinos Arbeitseifer kam nicht von ungefähr: Die Schneiderei seines Vaters war gescheitert, der einzige andere Mann in der Familie, Joes kleiner Bruder Vincenzo, hatte sich als Taugenichts erwiesen. »Er war verantwortungslos«, berichtet Petrosinos Großneffe Vincent. »Blieb nie lange bei einer Arbeit, bekam in Amerika nie Boden unter die Füße.« Tatsächlich teilte niemand in Joe Petrosinos Familie dessen brennenden Ehrgeiz; laut Großneffe Vincent waren sie »ein Haufen Gammler«, deren Auskommen bald ganz vom Verdienst des Teenagers abhing. Vater Prospero träumte nur davon, nach Italien zurückzukehren, ein Stück Land zu kaufen und seinen Lebensabend in den Zitrushainen Kampaniens zu verbringen. Ganz anders Joseph: »Er wollte es um jeden Preis in New York schaffen«, erinnerte sich sein Freund Anthony Marria.
Neben Entschlossenheit und Kraft zeigte Joe als Teenager auch bereits Anzeichen dessen, was die Italiener pazienza nennen. Wörtlich übersetzt heißt das Wort »Geduld«, doch in Süditalien hatte es besonderen Gehalt. Es bedeutete, seine intimsten Gefühle zu verbergen und den rechten Augenblick zu ihrem Ausdruck abzuwarten. Das gehörte zum Männlichkeitskodex des Mezzogiorno, bot Schutz vor Unterdrückung und miseria. »Pazienzabedeutet nicht etwa, Lebenskräfte zu unterdrücken«, schreibt Richard Gambino. »Der Kodex von Zurückhaltung, Geduld, Warten auf den richtigen Moment, Vorausplanung und entschlossenem, leidenschaftlichen Handeln dient dem Leben … Impulsives, unbeherrschtes Verhalten führte nur ins Unglück.« Eine Art, pazienza zu beweisen, bestand darin, gelassen, ja fast gleichgültig zu bleiben, bis der Zeitpunkt zum Handeln gekommen war. Dann aber brach die Leidenschaft sich heftig Bahn.
Eines Tages putzten Anthony und Joseph Schuhe vor einem Saloon an der Ecke Broome und Crosby. Petrosino kniete auf seinem alten Teppich, polierte die Lederstiefel eines Kunden und stand auf, um seine Pennys zu kassieren. Ein Teil seines Verdiensts würde die Miete der Familie bezahlen, ein anderer deren Essen, Kohlen und Bekleidung. Nur wenig — wenn überhaupt etwas — blieb für ihn und seinen Traum, es aus der Italienerkolonie herauszuschaffen.
An jenem Nachmittag wurde es Petrosino zu dumm. Unter Anthonys ungläubigen Blicken hob er seine Schuhputzkiste mit den starken Armen hoch über den Kopf und schmetterte sie auf den Bürgersteig. Die Kiste zerbarst. Anthony starrte seinen Partner an, während Passanten um die Splitter herum vorbeigingen. »Tony«, verkündete Petrosino seelenruhig. »Mit dem Schuhewichsen ist jetzt Schluss. Ich will was aus mir machen.«
Die Geschichte ist so urtypisch amerikanisch, dass man versucht ist zu glauben, Anthony habe sie aus einem der Romane Horatio Algers, in denen häufig Schuhputzer mit großen Träumen vorkamen. Doch er schwor, sie habe sich genau so zugetragen. Der amerikanische Traum war dem jungen Joe in Fleisch und Blut übergegangen. Jetzt, wo seine Kiste unwiederbringlich ruiniert war, musste er auf andere Weise seinen Lebensunterhalt verdienen. Schuhe putzte er nie wieder, weder in New York noch anderswo.
Anthony zeigte der Ausbruch, welch heftige Gefühle hinter dem ruhigen Äußeren des Freundes brodelten.
*
Petrosino durchstreifte Manhattan auf der Suche nach besserer Arbeit und bot sich in den verschiedensten Geschäften an. Er probierte eine Reihe von Aufgaben aus: Fleischergehilfe, Zeitnehmer bei der Eisenbahn, Hutverkäufer, Börsenbote. Mit seiner Geige reiste er sogar als fahrender Musiker durchs Land, bis hinab in den tiefsten Süden. Doch keine dieser Tätigkeiten bot Petrosino einen Weg nach oben, hinaus aus der beschämenden Armut, in der er sich befand.
Endlich, im Alter von siebzehn oder achtzehn, ergatterte er eine Stelle als White Winger, als städtischer Straßenfeger in New York. Das mag nicht nach viel klingen, doch die Stadtreinigung unterstand damals der New Yorker Polizei. Für den richtigen Einwanderer konnte sie ein Sprungbrett zu Höherem sein.
Petrosino hatte das Glück, unter die Fittiche des toughen und sagenhaft korrupten Inspektors Aleck »Clubber« Williams, »Zar des Tenderloin« genannt, genommen zu werden. Williams war durch und durch Ire, gesellig und körperlich einschüchternd, einer, den jeder in New York sofort erkannte, wenn er sein Revier entlang der Seventh Avenue durchstreifte. Und »sein« Revier war es tatsächlich: Ohne Williams' Erlaubnis konnte kein Saloon betrieben werden, kein Krimineller lange überleben. »Ich bin in New York dermaßen bekannt«, prahlte er einmal, »dass mir morgens die Pferde zunicken.« Eines Tages hängte er, um Reporter zu beeindrucken, die ihn interviewten, seine Taschenuhr an eine Laterne an der Ecke 35th Street und Third Avenue, mitten im wilden, von Verbrechen heimgesuchten Gas House District, um dann gemütlich mit den Reportern um den Block zu spazieren. Als die Gruppe wieder zur Laterne kam, hing Williams Uhr immer noch daran. Keiner der vielen Hundert Ganoven des Viertels hatte gewagt, Hand an seine Wertsachen zu legen.
Auch um sein Talent für Korruption beneidete man Williams im Department. Er nannte eine Villa mit siebzehn Zimmern in Cos Cob, Connecticut, und eine sechzehn Meter lange Yacht sein eigen, angeblich bezahlt vom bescheidenen Gehalt eines Polizeiinspektors. Fragte man, woher er so viel Geld hatte, gab er die großartig unsinnige Antwort: »Japanische Immobilien.«
Petrosino arbeitete schwer auf seiner neuen Stelle. New York war für seinen Schmutz berüchtigt; die Stadt war viel dreckiger als London oder Paris. Petrosino hatte einen dreirädrigen Karren durch die Straßen zu schieben und das unglaubliche Sortiment an Unrat vom Pflaster zu fegen, das sich über Nacht dort angesammelt hatte. Eine besondere Herausforderung waren die Pferdeäpfel. Die 150 000 Pferde, die in New York und Brooklyn (bis etwa 1898 eine unabhängige Stadt) lebten und arbeiteten, produzierten täglich ein- bis zweitausend Tonnen Kot. Die Tiere selbst hielten im Schnitt nur zweieinhalb Jahre durch, bevor sie vor Erschöpfung tot umfielen. Die Kadaver wogen um die fünfhundert Kilo, zu schwer, als dass die White Winger sie hätten bewegen können, sodass sie warten mussten, bis die Tiere verwest waren, bevor sie sie stückweise auf die Karren hieven konnten. Tag für Tag fegte Petrosino Asche, Obstschalen, Zeitungen und Bruchstücke von Möbeln auf, dazu tote Schweine, Ziegen und Pferde.
Doch es ging aufwärts mit ihm. Bald befehligte er den Lastkahn, der all den stinkenden Abfall weit hinaus auf den Atlantik brachte, um ihn in der Dünung zu verklappen. Täglich steuerte er den Kahn durch die Wellen, die so hart gegen den Bug schlugen, dass Salzwasserfontänen übers Ruderhaus spritzten. Rechts und links sah er dabei vielleicht die schnittigen Sportboote der reichen Stenze von der Madison Avenue vorüberziehen. Womöglich wurde er sogar von Räuberbaron Jay Gould überholt, wenn dieser in seiner prunkvoll wie der Palast eines Radschas ausgestatteten Siebzig-Meter-Yacht Atalanta, dem »prächtigsten privaten Schiff der sieben Weltmeere«, von seinem Haus in Tarrytown kam. Ein weniger selbstsicherer Mann wäre sich neben solchen Luxusgefährten vielleicht albern vorgekommen, als Kommandant eines Bootes, das bis zum Dollbord mit verwesenden Pferdeköpfen und Bananenschalen beladen war. Ein wahres Traumschiff für den Sohn Kampaniens! Doch Petrosino ließ sich nicht unterkriegen. An Selbstbewusstsein mangelte es ihm nie.
Während es mit dem jungen Italiener aufwärtsging, wurde auch die Stadt um ihn herum beständig höher, heller, schneller. 1868 war entlang der Ninth Avenue die erste Hochbahn eröffnet worden. Seit 1880 löste elektrisches Licht nach und nach die alten Gaslaternen ab; ab 1882 dampfte es aus unterirdischen Leitungen auf die Straßen; die 1883 fertiggestellte Brooklyn Bridge spannte sich in ihrer unfassbar langen Herrlichkeit über den East River. Das Land hungerte nach Arbeitskräften; die Wirtschaft boomte und brauchte starke Schultern für Bergwerke, Steinbrüche und Schmieden, zum Bauen und zum Graben. New York war das Zentrum dieses Wandels. Achtzig der hundert größten Unternehmen des Landes hatten ihren Sitz in Manhattan. »Die Wall Street lieferte dem Land sein Kapital«, schreibt der Historiker Mike Dash. »Ellis Island kanalisierte seine Arbeitskraft. Die Fifth Avenue bestimmte seine Mode. Der Broadway (gemeinsam mit dem Times Square und Coney Island) hielt es bei Laune.« Alle vier Jahre wuchs die Stadt um die Einwohnerzahl von Boston; schon jetzt war sie die größte jüdische und die größte italienische Stadt der Welt, weshalb ein Autor Manhattan liebevoll »diese Hauptstadt für die halbe Welt« nannte. Viele dieser Neubürger waren contadini, arme Bauern aus Süditalien. Zwischen 1850 und 1910 stieg die Zahl der in der Stadt lebenden Italiener von 833 auf eine halbe Million.
Zahlreiche Amerikaner sahen in den großen Scharen, den dunklen Gesichtern und unbekannten Sprachen keine Anzeichen des Fortschritts, sondern der Anarchie. So zum Beispiel Henry Adams:
Die Silhouette der Stadt wurde frenetisch in ihrem Bemühn, etwas zu erklären, das den Sinn gänzlich überstieg. Die Energie, so schien es, war ihrer Fron entwachsen und hatte ihre Freiheitserklärung geltend gemacht. Der Zylinder war explodiert und hatte große Massen von Stein und Dampf an den Himmel geschleudert. Die Stadt hatte die Miene und das Tempo der Hysterie und ihre Einwohner schrien in allen Tonarten von der Wut bis zum Schrecken, daß den neuen Energien, koste was es wolle, gesteuert werden müsse … ein Reisender auf der Heerstraße der Historie blickte vom Klubfenster auf den Tumult der Fifth Avenue und meinte in Rom zu sein, unter Diokletian; er sah die Anarchie und war sich des Zwanges bewußt. Er sann auf eine Lösung und blieb doch ohne einen Schimmer, woher der nächste Impuls kommen sollte, oder wie er sich auswirken würde.
Andere erkannten die Veränderungen als Gelegenheit zu Profit und Machtausbau. So warf auch Tammany Hall, der all der nach Manhattan strömende Wohlstand Millionen in die Taschen spülte, ein Auge auf jene Einwanderer, die die U-Bahn-Tunnel freisprengten und in den Textilfabriken schufteten. Die Iren brauchten Leute, die mit den Sizilianern und Kalabriern umgehen und sie am Wahltag zur Urne bewegen konnten. Als Clubber Williams einen jungen Italiener sah, der auf einem Kahn souverän Befehle schrie, merkte er auf. Etwas in Petrosinos Gebaren sowie sein fester, ruhiger Blick gefielen dem Inspektor.
Williams rief über die Wellen: »Wollen Sie nicht Polizist werden?« Petrosino beäugte den Inspektor, lenkte den Kahn ans Ufer, sprang heraus und ging auf Williams zu. Der sah augenblicklich, dass es ein Problem gab. Mit einem Meter sechzig war der junge Italiener für die Polizei zu klein; die Mindestgröße für Rekruten war eins siebzig. Doch der irische Cop hatte schon größere Hürden als ein paar fehlende Zentimeter überwunden und ließ umgehend seine Beziehungen spielen, um Petrosino einzustellen. Bald darauf, am 19. Oktober 1883, wurde der Dreiundzwanzigjährige als Polizist vereidigt.
Für den ehemaligen Schuhputzer war das ein Hauptgewinn. Petrosino wurde einer der ersten italienischen Polizisten des NYPD, das 1883 noch überwiegend irisch besetzt war, ergänzt durch eine Handvoll Deutsche und Juden. Seine Anstellung war zugleich ein Meilenstein für alle Italo-Amerikaner, die nur mühsam einen Fuß in die Tür zum Herrschaftsgefüge ihrer neuen Heimat bekamen. Falls Petrosino aber glaubte, sein Durchbruch würde von seinen Landsleuten gefeiert, falls er dachte, die Marke mit der Nummer 285 brächte ihm den Jubel der Neapolitaner und Sizilianer der Mulberry Street ein, sollte er bitter enttäuscht werden. An seinem ersten Arbeitstag verließ der frischgebackene Polizist die Mietskaserne in Little Italy, in der sich seine Wohnung befand, gekleidet in blaue Wolle und mit rundem Filzhelm, einen Knüppel aus Robinienholz in einer Lederschlaufe an der Hüfte. An der neuen Kleidung war ihm seine Neuerfindung als Amerikaner deutlich anzusehen. Schon auf den ersten Schritten riefen ihm die Italiener nach — keine Glückwünsche allerdings, sondern »Beleidigungen und Schimpfwörter.« Straßenhändler riefen bei seinem Anblick: »Frische Petersilie!« (auf Sizilianisch bedeutet petrosino Petersilie), um Verbrecher vor dem nahenden Polizisten zu warnen. Es dauerte nicht lange, da fand Petrosino in der Post die ersten Morddrohungen.
In der sonnenverbrannten Heimat dieser Menschen, das war Petrosino zweifellos bewusst, galt jeder Uniformträger als Feind. »Der Staat ist ein gewaltiges, leibhaftiges Ungeheuer«, schrieb ein Beamter im sizilianischen Partinico 1885, »vom Amtsdiener bis hinauf zu jenem privilegierten Wesen, das sich König nennt. Es begehrt alles, stiehlt unverhohlen, verfügt über Person und Eigentum zum Vorteil der Wenigen, weil es von Schergen und Bajonetten unterstützt wird.« Selbst die Kirche verachtete Gesetzeshüter. In den zwischen 1477 und 1533 veröffentlichten Taxae cancellariae et poenitentiariae romanae sprach der Erzbischof von Palermo alle von ihren Sünden frei, die einen Meineid bei Gericht geleistet hatten, einschließlich derer, die Richter bestochen oder anderweitig die Justiz behindert hatten, sofern der Angeklagte dadurch freikam. Verbrecher konnten sich durch Almosen an ihre Pfarrgemeinde freikaufen und gemäß dieser speziellen Auslegung des Kirchenrechts sogar ihr Diebesgut behalten. Doch der birro, der Polizist? Der war ein stinkendes Stück Aas.
In irischen oder deutschen Vierteln war ein in den Polizeidienst übernommener Landsmann oft ein Grund zum Feiern, doch nicht in Little Italy. Nach Ansicht vieler hatte Petrosino sich den Unterdrückern in der neuen Heimat angeschlossen. Er war »geboren alscontadino«, merkte ein sizilianischer Amerikaner später an. Auf Seiten der Fremden polizeilich gegen die eigenen Leute vorzugehen, war ein »schlimmer, vorsätzlicher Affront«, den man ihm nicht leicht vergaß. »Petrosinos Verhalten kam einem beleidigenden Verstoß gegen die Sitten gleich, einer infamia, die nach Strafe verlangte. In den Augen der Sizilianer hatte Petrosino eine Art erweiterten ordine della famiglia verletzt, indem er ganz offen Partei gegen seine Landsleute ergriff, um seine eigene Stellung zu verbessern.« Nach Ansicht einiger Süditaliener hatte Petrosino den Weißen seine Ehre verkauft.
Obgleich die Italiener als die Letzten und Ärmsten der Westeuropäer nach Amerika gekommen waren, fehlte es ihnen nicht an Selbstvertrauen oder Heimatliebe. In vielerlei Hinsicht hielten sie ihre mitgebrachte Kultur für der amerikanischen überlegen. Jeder Italiener hatte die Pflicht, sie zu ehren.
Petrosino jedoch hatte einen Weg gewählt, der vielen Süditalienern schwerfiel: Aus vollem Herzen hatte er die Verheißungen des neuen Landes angenommen und sich dessen Werte zu eigen gemacht. Die hasserfüllten Blicke seiner Landsleute müssen ihn schockiert haben. Auf den Straßen Little Italys als nfame bezeichnet zu werden, als Spitzel und Verräter, sollte ihn auf ewig schmerzen. »Mit Petersilie schmeckt die amerikanische Polizei zwar besser«, so lautete ein Bonmot über den jungen Cop, »aber sie liegt trotzdem schwer im Magen.«
Viele Italiener wussten auch, dass die Kolonie dringend italienische Polizisten benötigte, und waren stolz auf Petrosinos Leistung. Doch andere schickten ihm einen Strom von Drohbriefen, die mit der Zeit so besorgniserregend wurden, dass Petrosino sich eine neue Bleibe suchte. Er fand eine kleine Wohnung in einem irischen Viertel und zog mit seiner bescheidenen Habe um. Dass ein alleinstehender Mann die Kolonie verlässt, um unter Fremden zu wohnen, war unter Italo-Amerikanern so gut wie unvorstellbar. Petrosino war dadurch selbst als straniero gebrandmarkt, als Fremder, der bei den blassen, undurchschaubaren Iren lebt. Allein und fort von der Familie zu sein, war fast so, als existiere man überhaupt nicht mehr, als sei man ein saccu vacante (ein leerer Sack), wie die Sizilianer sagten, ein nùddu miscàto cu niènti (ein Nichts und Niemand). Doch Petrosino hatte schon früh seine Bereitschaft bewiesen, mit den Traditionen zu brechen, die das Leben im Mezzogiorno jahrhundertelang beherrscht hatten. Für seinen Aufstieg war er bereit zu gehen.
*
Petrosinos erster Dienstort war das Tenderloin, das Vergnügungsviertel zwischen 23rd und 42nd Street, von der Fifth bis zur Seventh Avenue, der unruhigste Bezirk der Stadt. Seine erste Festnahme, die es in die New York Times schaffte, war die eines umtriebigen Schauspielers, der vor lauter Arbeitseifer das sonntägliche Theaterverbot gebrochen hatte. Mit wachsender Erfahrung wurde Petrosino auch anderswo auf Streife geschickt. Eines Abends wagte er sich bis zu den Piers am Ende der Canal Street, einem schwärenden Loch voller Seemannskneipen und Bordelle. Energisch wie immer schritt er die Straße entlang, als plötzlich verzweifelte Schreie an sein Ohr drangen. Vor ihm herrschte Aufruhr. Eine Gruppe Weißer beugte sich über eine Gestalt auf dem Bürgersteig, prügelte brutal auf einen Schwarzen namens William Farraday ein.
Afro-Amerikaner waren unter den Angehörigen des NYPD nicht sonderlich beliebt. Viele Cops waren beinharte Rassisten. Sogar der Mann, der bald Commissioner werden sollte, verlieh seiner Geringschätzung für seine schwarzen Mitbürger Ausdruck. »Der Tenderloin-Neger«, erklärte William Gibbs McAdoo, »ist ein angeberisch gekleideter, juwelenbehängter Faulpelz und oftmals ein gewöhnlicher Verbrecher.« Officer Petrosino allerdings zögerte keine Sekunde, als er Farraday schreien hörte. Er rannte los, holte im Laufen seinen Knüppel aus der Schlaufe und zog ihn dem ersten Weißen, der ihm unterkam, über den Schädel. Einige Schläge später ergriffen die Angreifer die Flucht. »Vier Männer wollten mich umbringen«, erinnerte sich Farraday später. »Joe rettete mir im letzten Augenblick das Leben.« Farraday sollte den Vorfall nie vergessen.
Petrosino erwies sich als geborener Polizist. Er war ein Sprachgenie, beherrschte nicht nur den Dialekt seiner Heimat in Kampanien, sondern auch die meisten anderen Dialekte der Einwanderer aus den Abruzzen, Neapel, Sizilien und Apulien. Er wurde nie auch nur beschuldigt, von irgendjemandem Geld angenommen zu haben, und er war ungewöhnlich zäh. Falls er je einen Kampf verlor, wurde davon nie berichtet. Und doch wurden seine herausragenden Fähigkeiten zu Beginn seiner Karriere kaum bemerkt. Petrosino hatte sich einer Bruderschaft von Iren angeschlossen, die aus genau jenem Schlag Männern bestand, die ihm als Schuljungen hatten den Kopf abreißen wollen. Auf Beförderungen brauchte man als Italiener in der New Yorker Polizei gar nicht erst zu hoffen. Für die Mordkommission oder das Detective Bureau, die Elite-Abteilungen des Departments, wurden nur Iren oder Deutsche ausgewählt. Im ganzen Department — ja im ganzen Land — gab es Ende der 1890er keinen italienischen Sergeant. Die Iren glaubten sich schon qua Geburt zum Dienst im NYPD berechtigt; altgediente Cops schenkten ihren Söhnen häufig Spielzeugknüppel zum Geburtstag, um sie über die Zeit hinwegzutrösten, bis sie richtige Polizisten werden konnten. In den Worten eines Iren: »Man konnte keine zwei Blocks weit gehen, ohne einem Blaurock namens O'Brien, Sullivan, Byrnes, O'Reilly, Murphy oder McDermott zu begegnen … Meines Vaters Wunsch an meiner Wiege, einen Polizisten aus mir zu machen, lag tief in seinem Irenblut.«
Selbst mit einem Ziehvater wie Clubber Williams war Petrosino noch ein Außenseiter. Die Polizeikasernen, in denen er in jenem ersten Winter häufig schlief — die Uniform zum Trocknen auf einer Leine an der Wand, ein dicker Bollerofen mitten im Zimmer —, waren für einen Sohn Italiens kalte Orte, an denen irische Cops einen voll Verachtung oder kaum verhohlenem Hass anblitzten. Manche sprachen gar nicht erst mit ihm oder nannten ihn, wenn sie es doch taten, gradeheraus einen »Guinea«. »Alle im Department waren gegen ihn«, schrieb ein Journalist über diese Zeit in Petrosinos Leben. »Still und würdevoll ertrug er den Spott, den Schimpf und die Schmähungen, die Angehörige anderer Nationalitäten über ihn ergossen.« Angesichts der jährlich wachsenden Zahl italienischer Einwanderer und der vor Vorurteilen brodelnden Straßen musste jeder dieser Einwanderer, der »was aus sich machen« wollte, schweigen. Doch das war nicht der ganze Preis, wie Petrosino bald erfahren sollte.
2
Der Menschenjäger
Anfang 1895 drückte Teddy Roosevelt, der nichts mit sich anzufangen wusste, nachdem seine Frau ihm untersagt hatte, als Bürgermeister von New York zu kandidieren, sich in seinem Anwesen Sagamore Hill in Cove Neck, Long Island herum. Er war deprimiert und mürrisch, glaubte, die »eine, goldene Gelegenheit« verpasst zu haben. Eines Nachmittags schlug er einen Fotoband des Sozialreformers Jacob Riis auf. Das Buch hieß Wie die andere Hälfte lebt: Studien zu den Liegenschaften von New York und offenbarte das im Schatten des neuen Manhattan entstandene Elend: Riis' Themen waren Armut, Hoffnungslosigkeit und Alkoholsucht. Das vor kurzem entwickelte Blitzlicht erlaubte ihm, aus den Mietskasernen der Mulberry Street und anderer Viertel von Lower Manhattan Aufnahmen barfüßiger Kinder mitzubringen, die auf Gitterrosten schliefen, und von Männern und Frauen, die in winzige Zimmer gepfercht waren wie rußgeschwärzte Kaninchen.
Roosevelt war von den Bildern ebenso schockiert wie viele andere Mitglieder der New-Yorker Oberschicht, die kaum je einen Fuß südlich der 14th Street setzten, der Trennlinie zwischen dem sich modernisierenden New York und der Welt der Einwanderer. Teddy schritt zur Tat. »Keiner half je so viel wie er«, erinnerte sich Riis. »Zwei Jahre lang waren wir Brüder in der Mulberry Street.« Roosevelt übernahm den Vorsitz des New York Board of Police Commissioners und machte sich daran, das für seine Korruptheit berüchtigte NYPD zu reformieren. »Sing, himmlische Muse, den tristen Trübsinn unserer Polizisten«, frohlockte die New York World, das Flaggschiff von Joseph Pulitzers Zeitungsimperium. »Wir haben einen richtigen Commissioner. Sein Name ist Theodore Roosevelt … Seine Zähne sind weiß und fast so groß wie die eines jungen Hengsts. Sie scheinen zu sagen: ›Sei ehrlich zu deinem Commissioner, sonst beißt er dir den Kopf ab!‹« Roosevelt stellte Polizisten nach Eignung ein statt nach Parteibuch, installierte Telefone in den Polizeirevieren, ordnete jährliche Fitnesstests und Waffenprüfungen an und ging zu Fuß von Wache zu Wache um sich zu vergewissern, dass seine Leute ihre Pflichten ernst nahmen. Detectives wurden versetzt oder sogar gefeuert. Das sorgte für freie Stellen, und Roosevelt, der wusste, dass die Einwandererkolonien polizeilicher Aufsicht bedurften, machte sich auf die Suche nach einem geeigneten Italiener. Er fand Joseph Petrosino. Am 20. Juli 1895, nach nur zwei Jahren als Polizist, wurde dieser der erste italienische Detective Sergeant des Landes.
Roosevelt zu begegnen, war, als träte man einem Fürsten gegenüber. Doch die beiden Männer, die sich in ihrer verbissenen Hartnäckigkeit so ähnelten, wurden so etwas wie Freunde. »Angst war ihm ein Fremdwort«, sollte Roosevelt später über Petrosino sagen und hätte damit ebenso gut sich selbst beschreiben können. Petrosino begriff seinerseits schnell, wie nützlich ein Förderer wie Roosevelt seiner Karriere sein konnte. Bei jeder Gelegenheit lobte er den Commissioner gegenüber Reportern und Kollegen.
In seiner neuen Rolle als Detective blühte Petrosino auf, tat offenbar kaum noch ein Auge zu. Er modernisierte. Er arbeitete mit Verkleidungen, was ihm den Spott seiner Kollegen einbrachte. Es hieß, der Kleiderschrank seiner Junggesellenbude gliche dem Fundus der Metropolitan Opera. Dieses schwindelerregende Kostümsortiment erlaubte ihm, ein Dutzend falscher Identitäten anzunehmen: die eines Tagelöhners, eines Gangsters, eines orthodoxen Juden, eines blinden Bettlers, eines Beamten des Gesundheitsamts oder eines katholischen Priesters. Petrosino betrat einfach seine Wohnung und kam als jemand anderer wieder heraus. Er zog zerschlissene Arbeitskleidung an, schnappte sich einen Pickel und besorgte sich einen Job im Straßenbau, wo er aussah wie jeder andere sizilianische Arbeiter auch. Nach wochenlangen verdeckten Ermittlungen kehrte er dann auf die Wache zurück, mit Schwielen an den Händen — er spielte nicht den Arbeiter, er wurde einer — und einem Notizbuch voller neuer Hinweise. Sogar das größte aller Italienerklischees nutzte er zur Tarnung: den Drehorgelspieler mit seinem Äffchen.
Obwohl er schon nach der sechsten Klasse von der Schule abgegangen war, dürstete der junge Detective nach Wissen. »Einer seiner liebsten Zeitvertreibe war, mit Intellektuellen über ästhetische Fragen zu diskutieren«, schrieb ein Journalist. »Er war empfindsam und emotional. Freundschaft und Geselligkeit bedeuteten ihm viel.« Zwar konnte er dumm aussehen, wenn er wollte, doch nur, weil es der Arbeit nutzte. Er hatte gelernt, den typischen grignono zu imitieren, das Greenhorn, das eben erst vom Dampfer aus Genua gestiegen war. Petrosino übte das regelrecht. »Er ist ein Meister darin, den schüchternen Naivling zu spielen«, schrieb ein Italiener. »Doch so mancher Räuber oder Mörder erfuhr bereits zu seinem Schaden, wie schnell sein Verstand und wie geschickt sein Arm ist.« In gewisser Weise sprach das Bände über die Geringschätzung, welche die meisten Amerikaner den Italienern entgegenbrachten: Wie hätte man unsichtbarer sein können als hinter der Maske des beschränkten Guinea? So mancher irische Polizist begegnete dem verkleideten Detective, ohne auch nur etwas zu ahnen.
Statt, wie normalerweise üblich, schriftliche Akten zu führen, trug Petrosino seine Fälle »unter dem Hut« mit sich herum; das sollte heißen, er prägte sich jede Einzelheit selbst ein, dazu die Namen Tausender italienischer Verbrecher, ihre Gesichter, wichtigsten Daten, Herkunftsorte, Gewohnheiten und die Verbrechen, die man ihnen vorwarf. Eines Abends erklomm er die Treppe eines Hauses in der First Avenue, um Freunde zu besuchen, die im Dachgeschoss wohnten. Während seines Aufstiegs fiel sein Blick nach rechts durch eine offene Tür in eine Wohnung, in der ein Mann am Küchentisch saß. Petrosino ging noch etwas weiter, blieb stehen, hielt einen Moment inne und kehrte um. Er trat durch die offene Tür auf den Mann zu, befahl ihm aufzustehen und sagte ihm auf den Kopf zu, sein Name sei Sineni, ihm werde vorgeworfen, vier Jahre zuvor in Chicago einen gewissen Oscar Quarnstrom mit einem Rasiermesser getötet zu haben, und die Polizei dort suche ihn wegen Mordes. Achtundvierzig Monate vorher hatte Petrosino einen kurzen Blick auf ein entsprechendes Rundschreiben der Chicagoer Polizei geworfen und den Mann, dessen Gesicht er darauf nur den Bruchteil einer Sekunde gesehen hatte, nun wiedererkannt. Sineni gestand und wurde nach Chicago ausgeliefert.
Petrosino überflügelte bald all seine Kollegen. Er verfolgte und zerschlug den »Auferstehungspolicen«-Ring, dessen Mitglieder Lebensversicherungen abschlossen, sich für tot erklären ließen und vom Erlös weiterlebten. Er deckte ein Komplott auf, bei dem unbescholtene Italiener von Gangstern ermordet wurden, die erst vorgaben, sie in der Heimat gekannt zu haben, dann Versicherungen im Namen ihrer Opfer abschlossen und sie schließlich vergifteten. In einem Jahr überführte er siebzehn Mörder, Rekord im NYPD; im Laufe seiner Karriere sollte er einhundert Mörder auf den elektrischen Stuhl oder zu langen Haftstrafen nach Sing Sing schicken.
Ganz Manhattan, nicht bloß die Italiener, sprach über diesen wirbelnden Derwisch von Detective. Petrosino wurde so berühmt, dass Kriminelle ihn sich gleich nach ihrer Ankunft aus Süditalien zeigen ließen. Sie warteten auf dem Bürgersteig gegenüber von 300 Mulberry, beobachteten stumm, wie die Blauröcke und Detectives herauskamen, sich auf den Stufen unterhielten oder zum Einsatz gingen. Manchmal warteten die Kriminellen mehrere Stunden, bis ein Freund ihnen zuraunte: »Das ist er.« Das war also Petrosino, stiernackig, dunkeläugig, ganz in Schwarz gekleidet, die typische Melone auf dem Kopf. Sie prägten sich seine Züge ein, seine Größe (manchmal trug er Absätze, um eine andere vorzutäuschen), seinen ausgreifenden Gang. Diese Begutachtung hatte praktische Gründe: Die Männer wollten wissen, wie Petrosino aussah, um ihm bei ihren Machenschaften aus dem Weg zu gehen. Doch bestimmt waren sie auch ein wenig fasziniert von diesem Star. Ein gebürtiger Italiener, der Teddy Roosevelt kennt! Sie mögen zwar Diebe und Mörder gewesen sein, aber sie waren auch Einwanderer. »Petrosino verkörperte den amerikanischen Traum«, schreibt der Historiker Humbert Nelli, »für viele inner- und außerhalb der Italienerkolonie.«
Manche dieser Männer würden zu den ersten Mitgliedern des Bundes der Black Hand werden, der in jenen letzten Tagen des Jahrhunderts wie der Typhus in den Mietskasernen der Mulberry Street umging.
Dass der berühmteste Italo-Amerikaner des Landes Ende des 19. Jahrhunderts ausgerechnet der war, den die Mächtigen rekrutiert hatten, um seine eigenen Landsleute hinter Gitter zu bringen, spricht Bände. Unter den Einwanderern gab es auch Künstler und Intellektuelle — Professoren, Schriftsteller, Opernsängerinnen, Bildhauer, die große öffentliche Kunstwerke schufen. Für die interessierte man sich im Land allerdings kaum. Fasziniert waren die alteingesessenen WASPs und Knickerbocker von Petrosino, dem »Menschenjäger«, ihn akzeptierten sie wie keinen anderen Italo-Amerikaner seiner Zeit. Es war, als wäre das Bild, das man sich von Italienern machte, derart beschränkt, dass von den Tausenden Gestalten, die durch die Tore von Ellis Island kamen, nur zwei darauf Platz hatten: der Mörder, der Amerika in Angst und Schrecken versetzte, und sein Gegenpart. Der Gesetzeshüter. Der Erlöser.
*
Eine besondere Eigenschaft des Detectives erklärt, weshalb er auf der Mott Street respektiert, ja sogar bewundert wurde — wenigstens von denen, die ihn nicht hassten. Deutlich hervor trat sie im Fall Angelo Carbone.
Eines Abends im Jahre 1897