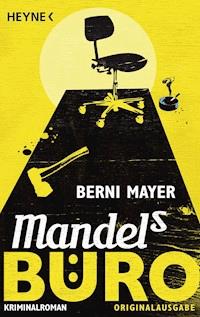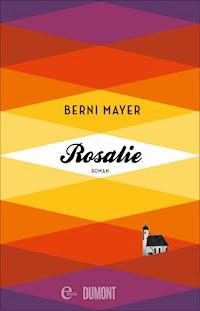8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Krimi
- Serie: Max Mandel
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Es ist verteufelt wenig los in der Detektei der ehemaligen Musikjournalisten Mandel und Singer. Doch gerade als der Lagerkoller einsetzt, werden sie nach Bergen in Norwegen auf ein Konzert eingeladen. Nach einem hemmungslosen Besäufnis finden sie sich mitten in einem Clankrieg der dortigen Black-Metal-Szene wieder. Auf der Suche nach dem verschwundenen Musiker Baalberith machen sie Bekanntschaft mit Kirchenbrandstiftern, Kultführern, Okkultisten und grotesken Fischgerichten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 454
Ähnliche
Berni Mayer
Black Mandel
Krimalroman
Wilhelm Heyne Verlag
München
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe 12/2012
Copyright © 2012 by Berni Mayer
Copyright © 2012 by Wilhelm Heyne Verlag, München
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Redaktion: Heiko Arntz
Umschlagillustration und -gestaltung: Eisele Grafik Design, München
Satz und eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-08609-1V002
www.heyne.de
Inhalt
1: KRAFTBLUES
2: NORDLAND
3: BEICHTE
4: VILDE
5: KREUZIGUNG
6: MASSAKRE
7: ZAHNARZT
8: THERION
9: QUISLING
10: UTGANG
11: AASEN
12: LUTEFISK
13: REICHSWEHR
14: TROLDHAUGEN
15: RAUCH
16: POLITI
17: OMASTRAND
18: GRIMNIR
19: BAALBERITH
20: DEMOGORGON
21: FENGSEL
22: ANGELN
23: HÅVARD
24: WILDE JAGD
25: FANTOFT
26: FEUER
27: SVARTE SIRKEL
28: CALYPSO
Für Ludwig und Barbara
BANDS
DARKREICH
Cristian »Baalberith« Hallberg – Gesang
Jonas »Abbadon« Anderssen – Gitarre
Espen »Balrog« Krog – Bass
Ragnar »Nergal« Nagell – Schlagzeug
GODFUCK
Thorstein »Hades« Motzfeld – Schlagzeug, Gesang
Aksel »Therion« Raske – Bass
Jan »Grave« Ungdom – Gesang
Sven Per »Necronomicon« Stubbe – Gitarre
DØD
Aksel »King Therion« Raske – Gesang, Gitarre, Bass
Gunarr »Ujak« Aasen – Schlagzeug
UTGANG
Anders »Jörmungandr« Myklebust – Bass, Gesang
Olaf »Grimnir« Sandman – Gitarre
Ragnar »Neofenrir« Nagell – Schlagzeug
Heißer brennt als Feuer der Bösen
Freundschaft fünf Tage lang;
Doch sicher am sechsten ist sie erstickt
Und alle Lieb’ erloschen
Die Ältere Edda, Des Hohen Lied
The barbecue has just begun
Deathcrush – deathcrush – deathcrush
Mayhem, Deathcrush
And when I awoke, I was alone, this bird
had flown.
So I lit a fire, isn’t it good, Norwegian wood.
The Beatles, Norwegian Wood
1: KRAFTBLUES
IchträumevoneinemHotelinderPetersburgerStraße,wowirunsalleversammelthaben.DieIdeeisteinbisschenverrückt,indereigenenStadtineinemHotelzuübernachten,aberwirwolltendasimmerschontun.DenAbendverbringenwiranderHotelbarundbetrinkenunsmitüberteuertenCocktails.Ichentschuldigemichkurz,weilichaufsKlomuss.IchmöchtezumScheißennichtaufdieToiletteinderLobby,alsofahreichmitdemAufzugganznachoben,umdasKloinmeinemeigenenZimmerzubenutzen.AlsichdasZimmerwiederverlasseundzurückzumAufzuggehe,bemerkeich,dassnocheinekleineTreppenachobenführt.IchsteigedieTreppehinaufbiszueinerkleinenStahltür,dienurangelehntist.EinunendlichgeräumigerDachbodenliegtdahinter,einregelrechtesLabyrinth.DieHoteleinrichtungenvonJahrhundertenwerdenhieraufbewahrt.ÜberallstehenalteSchränkeundSessel,hängenKleidungsstücke,dieGästeausvergangenenZeitenindemHotelvergessenhaben.ÜberallliegtStaub,überallriechtesnachEwigkeit.DasAlteekeltmichan,dieseBewahrungsmaniederLeute,dieserpanischeHistorismus,diesezwanghafteAngstvordemNeuanfang.SelbstderletzteScheißdreckwirdnochaufgehoben,weilmanihnjairgendwannnoch malbrauchenkönnte.IchnehmedasStreichholzbriefchen,dasichunteninderBarzumeinemCocktailbekommenhabe,zündeeinStreichholzanundwerfeesineineoffeneHolzkistemitaltenKleidungsstücken.Danngeheich,ohnemichumzudrehen,wiederzurückinmeinStockwerkundnehmedenAufzugnachunten.AnderBarsitzeichmitden anderen und warte, bis der Feueralarm einsetzt.
Lang ging das nicht mehr gut mit uns.
»Hast du dir schon überlegt, ob du heute Abend mitkommst?«, fragte der Mandel.
»Ja, hab ich. Und zwar schon letzte Woche«, sagte ich.
»Und?«, fragte der Mandel.
»Ich komm nicht mit«, sagte ich.
»Na gut«, sagte der Mandel und zündete sich eine Zigarette an, während er die Beine auf den Doppelschreibtisch legte, sodass seine italienischen Lederstiefeletten in meine Tastatur hineinragten.
»Ich sag dir auch, warum ich nicht mitkomme«, sagte ich, aber der Mandel starrte bereits wieder rauchend aus der breiten Ladenfront zum Nordufer hinaus. Wir hatten ausgemacht, dass wir uns jede Woche mit dem Schreibtischplatz abwechseln. So schaute jeder eine Woche lang raus aufs Nordufer. Der Mandel saß jetzt schon die dritte Woche in Folge auf dem Platz mit der besseren Aussicht.
»Ich komme nicht mit, weil ich so einen Spleen nicht unterstütze«, sagte ich.
»Was meinst du mit Spleen?«, fragte der Mandel, ohne den Blick von der Uferpromenade abzuwenden. Mittlerweile gab es auch hier junge, gut aussehende Mütter, die mit Kinderwagen an der schäbige Uferpromenade patrouillierten, deshalb war der Platz mit dem Norduferblick auch so begehrt. Wie sie so gelangweilt in völlig austauschbaren Kleidungsstücken über die Schlaglöcher dahinliefen, ihres Frauseins völlig beraubt, das hatte eine wahnsinnige Erotik.
»Den Bluesrock-Spleen. Den meine ich«, sagte ich.
»Das ist kein Spleen. Mit Bluesrock hat überhaupt alles angefangen«, sagte der Mandel.
»Mit dem Urknall hat alles angefangen«, sagte ich.
»Was regst du dich denn so auf?«, fragte der Mandel und holte einen Schokoriegel aus seiner Schreibtischschublade, die eigentlich diese Woche meine Schreibtischschublade hätte sein sollen. Und wenn er schon wieder fragt, warum ich mich so aufrege, obwohl ich mich gar nicht aufrege, dann rege ich mich noch viel mehr auf.
»Ich reg mich überhaupt nicht auf. Ich finde es nur merkwürdig, sich an einem Mittwochabend, mitten im Winter, die zweieinhalb Stunden bis nach Stralsund raufzuquälen, um irgendeine halb verweste DDR-Bluesrock-Band in einem heruntergekommenen Gasthaus anzuschauen. Das deutet alles auf einen Spleen hin.«
»Nicht irgendeine. Monokel. Das ist Kraftblues. Das hatte eine totale Brisanz damals. War vielleicht nicht ganz so brisant wie Freygang, aber doch brisant. Außerdem haben wir schon Frühling.«
»Wer ist bitte Freygang?«, sagte ich.
»Der Blues muss bewaffnet sein, sonst glaubt dir kein Schwein, das sind Freygang«, sagte der Mandel, als handle es sich um das Allgemeinwissen schlechthin. Er fuhr sich mit beiden Händen sanft durch die gegelte Frisur, als genieße er die Konsistenz seines Haars.
»Kennt keine Sau«, sagte ich und dachte, dass er wirklich langsam alt wird. Immer grauer und merkwürdiger wird er.
»MonokelspielendiesesJahrnurnocheinmal,undzwarinStralsund«,sagtederMandelundbissvondemSchokoriegelab.
»Spleen«, sagte ich.
Der Mandel drehte die Musik aus seinem Computer lauter. Er hatte sich nach dem Auftrag von der Malleck letztes Jahr sofort einen neuen Laptop gekauft und zwei völlig überteuerte High-End-Lautsprecher dazu und hatte sich damit endgültig zum musikalischen Usurpator im Büro aufgeschwungen. Wir hörten jetzt viel zu laut »Das Monster vom Schilkinsee«. Ich kannte den Text beinahe auswendig, so oft hatte der Mandel das diese Woche schon abgespielt.
»Machst du ein bisschen leiser? Ich bin noch längst nicht durch mit der Steuererklärung«, bat ich den Mandel, und er benutzte seinen alten Trick, bei dem er am Lautstärkeregler herumnestelt, aber in Wirklichkeit gar nicht leiser macht.
»So besser?«, fragte er scheinheilig.
»Nein«, sagte ich.
Der Mandel nahm die italienischen Schuhe vom Schreibtisch und ging in unsere kleine Kaffeeküche. Die Lautstärke ließ er unverändert. Es war Mitte April, und ich saß vor der Steuererklärung vom letzten Jahr, in dem wir gar nicht schlecht verdient hatten. Da war der sehr gut bezahlte Auftrag von der Malleck gewesen, und auch der fette Urbaniak hatte uns vermutlich aus lauter schlechtem Gewissen noch fünftausend Euro mehr überwiesen, und dann kam der ganze Kleinkram dazu, den wir über Josef Windisch, den Kumpel vom Mandel, zugeschustert bekommen hatten. Der Windisch war damals direkt nach der Schließung vom Rock’n’Roll Express zu einem Boulevardblatt umgesiedelt, weil der Chefredakteur dort mit seinem Schwager befreundet war. Der Windisch wollte Fotos von Reese Witherspoon beim Abendessen im Poschardt, Fotos von dem Abgeordneten, dessen Namen ich nicht sagen soll, auf seiner neuen Joggingstrecke am Straßenstrich vorbei, Fotos vom Schürmann, diesem Jungschauspieler, beim Koksen auf dem Klo vom Sägewerk, und dann noch das Meisterstück vom Mandel, als er dem Defensivspieler von den Hertha-Amateuren den Peilsender untergejubelt hat und der Windisch dadurch seinem Kollegen vom Sport eine Reportage über die Charlottenburger Wettmafia verkaufen konnte. Diesen Zweig unseres Gewerbes nannte man »die dunklen Künste«, und er ist zuletzt ein wenig ins Gerede gekommen, aber ich kann versichern, für einen Privatdetektiv ist das heutzutage eine ganz herkömmliche Möglichkeit, an Geld zu gelangen. Unterm Strich war dann auch so viel zusammengekommen, dass wir den Schlaganfall vom Windisch letzten November erst mal gut verkraften konnten. Dieses Jahr hatte sich leider noch nicht viel getan, obwohl wir diverse Anzeigen in allen großen Tageszeitungen der Stadt geschaltet hatten.
New-Media-Detektei »Mandel und Singer«.
Technik und Recherche auf neuestem Stand.
Die Internet-Experten
Während ich überlegte, in welcher Spalte ich die Prüfungsgebühren für das IHK-Zertifikat »Fachkraft Detektiv in Ausbildung an der Sicherheitsakademie« eintragen musste, kam der Mandel mit einem Kaffee zurück an den Schreibtisch und zündete sich eine Zigarette an.
»Wir wollten das mit dem Rauchen doch nur noch draußen machen«, sagte ich.
»Draußen ist mir zu kalt«, sagte der Mandel. »Ist ja praktisch noch Winter.«
»Hast du für mich auch einen Kaffee?«, fragte ich.
»Du hast nichts gesagt. Wie viel Gewerbesteuer müssen wir eigentlich nachzahlen?«, fragte der Mandel.
Mein Telefon klingelte. Es war Maria.
»Mach die Musik aus«, sagte ich zum Mandel und stand gleichzeitig auf.
»Mach doch nicht immer so einen Stress, Sigi«, sagte der Mandel.
Es herrscht immer eine gewisse Anspannung, wenn Maria anruft, weil auch immer irgendwas ist, wenn sie anruft, selbst wenn nichts ist. Dieses Mal ging es um den Zulauf von der Waschmaschine. Als ich wieder aufgelegt hatte, schaute der Mandel konsterniert. Im ersten Moment hielt ich es für Anteilnahme und fing an zu reden.
»Sie hat halt diese Ängste. Und das überträgt sich dann auf so simple Alltagsgegenstände wie die Waschmaschine. Das ist eine Lebenspanik. Da können Kleinigkeiten wie der defekte Zulauf das Weltbild erschüttern. Außerdem kann das wirklich die ganze Pumpe kaputt machen. Deshalb braucht sie jetzt die Gewissheit, dass ich da bin.«
»Bitte was?«, sagte der Mandel und schaute immer noch konsterniert, aber jetzt merkte ich, dass sich das nicht auf mich bezog, sondern auf etwas, das er auf seinem Bildschirm entdeckt hatte.
»Die spinnen doch. Seit anderthalb Jahren hab ich keinen Satz mehr über Musik geschrieben, und die laden mich immer noch zu ihren Konzerten ein«, sagte er.
»Promoverteiler bestehen für die Ewigkeit. Hat man sich einmal eingetragen, ist das wie eine Verbeamtung. Kommt man zu Lebzeiten nicht mehr heraus«, sagte ich und gab das Maria-Thema wieder auf, denn der Mandel fand immer eine andere Ausrede, um sich aus der Sache herauszuhalten.
Er klickte mit einer genussvollen Ausholbewegung auf seine Maus, weil er das immer machte, wenn er Mails löschte, die er für besonders überflüssig hielt.
»Um welches Konzert geht es denn?«, fragte ich.
»Dark Reich gibt’s wieder.«
»Dark Reich? Echt?«, sagte ich, während ich überlegte, wer Dark Reich waren.
»Die mit den Schafsköpfen und den Gekreuzigten. Norwegischer Black Metal halt«, sagte der Mandel.
»Weiß ich doch. Ich leb doch nicht hinterm Mond. Da würde ich übrigens deutlich lieber mit dir hinfahren als zu Monokel nach Stralsund.«
»Das ist aber noch weiter als Stralsund. Dark Reich spielen übernächstes Wochenende in Bergen. Bergen in Norwegen. Großes Revival-Konzert, bei dem sie angeblich ihre legendäre Show von damals noch übertreffen wollen.«
»Cool«, sagte ich.
»Überhaupt nicht. Das ist doch jetzt gerade ein Trend. Liest du keine Zeitung?«
»Doch«, sagte ich und hatte in keiner Zeitung etwas von einem Black-Metal-Trend gelesen. »Jetzt lies trotzdem vor.«
Der Mandel holte missmutig die Mail aus dem elektrischen Papierkorb und las laut:
Die Pforten der Hölle stehen wieder offen
Dark Reich sind zurück
Als Dark Reich 1995 ihr legendäres Konzert Last Black Mass in Bergen gaben, stockte der Welt der Atem. Es war tatsächlich eine schwarze Messe in Konzertform. Verkehrt herum gekreuzigte, splitternackte, blutbesudelte Frauen und aufgespießte Ziegenköpfe waren das Bühnenbild für vier wie Leichen geschminkte Musiker, deren Musik sich jeder Konvention entzog und die mit ihrem infernalischen Lärm wie ein tödlicher Eisregen auf ihr Publikum hinabfuhren. Dark Reich hatten sich Anfang der Neunziger durch ihre brutalen Bühnenshows an der Spitze der skandinavischen Metal-Bewegung positioniert, zu einer Zeit, als in Norwegen die Kirchen brannten und der Staat in Black Metal und dem sogenannten satanischen Terrorismus einen neuen Erzfeind ausgemacht hatte. Black Metal war damit aus seiner finsteren regionalen Nische heraus ins grelle Licht der Weltöffentlichkeit getreten: Baalberith, Balrog, Abbadon und Hellzombie waren für ein paar Wochen so bekannt wie U2. 1995 waren sie mit der Bergener schwarzen Messe auf dem Zenit ihrer zweifelhaften Berühmtheit angekommen, doch die geplante DVD wurde aufgrund einer Klage wegen Gewaltverherrlichung vom Markt genommen. Diverse Tonträger der Band wurden in ihrer Heimat Norwegen, in Deutschland und in anderen Ländern auf den Index gesetzt. Die Ablehnung der Zensurgremien wurde der Band zum Verhängnis. Zu zermürbend waren die Versuche, sich gerichtlich gegen den Medienboykott aufzulehnen. Sänger Baalberith verschwand spurlos von der Bildfläche, kurz darauf löste sich auch der Rest der Band auf. Niemand in ihrer Heimatstadt Bergen konnte oder wollte sagen, was aus den legendären Dark Reich geworden war.
»Was für ein Schwachsinn. 1995 war die Bewegung schon längst wieder vorbei. Die Last Black Mass war doch nur noch ein letztes Aufbäumen, bevor der Laden endgültig dichtgemacht hat«, sagte der Mandel, und ich hatte keine Ahnung, wovon er redete.
»Jetzt lies weiter«, sagte ich.
Doch ohne eine Vorwarnung oder ein Raunen aus dem Untergrund tauchte plötzlich ein neuer Eintrag auf der stillgelegten Website der Band auf: »Dark Reich will perform live in their home town of Bergen, Norway, this Easter Sunday celebrating the 20th anniversary of their first album Ave Versus Christus.«
»Stopp, das reicht«, sagte ich. »Wie lange fährt man nach Bergen?«
»Einen ganzen Tag. Du musst ja durch Schweden oder durch Dänemark und dann noch die Fähre und dann noch durchs halbe Norwegen.«
»Warst du schon mal in Norwegen?«, fragte ich.
»Natürlich«, sagte der Mandel, als wäre jeder Depp schon einmal in Norwegen gewesen.
»Was hast du da gemacht?«, fragte ich, aber ich hätte mir die Antwort auch selbst geben können.
»Leute interviewt. Auf Festivals.«
»Und das hat damals der Express bezahlt, oder was?«, fragte ich und dachte darüber nach, wie oft ich für den Express auf Reisen gewesen war. Ich kam auf zweimal.
»Nein, nein, das hat meistens die Plattenfirma bezahlt, damit wir einen Bericht über die Bands abdrucken.«
»Dann sollen die das doch jetzt auch bezahlen, ich könnte einen Urlaub gut gebrauchen. Bei uns ist ja eh nichts los, mal abgesehen von deinem Zonenrock.«
»Wiestellstdudirdasvor?IchbinseitübereinemJahrkeinMusikjournalistmehr.Ichglaubenicht,dassmansichdaauchals Privatdetektiv akkreditieren kann«, sagte der Mandel.
»Das weiß doch keiner, dass du Detektiv bist. Und wenn doch, könntest du nebenbei immer noch schreiben. Quasi im Erstberuf Ermittler, im Zweitberuf Musikjournalist. Ruf einfach mal bei der Plattenfirma an und schau, was du herausschinden kannst. Zwei Flüge, zwei Tickets fürs Konzert. Hotel natürlich auch.«
»Heutzutage haben die Plattenfirmen nicht mehr die Spendierhosen an, das weißt du doch. Und am Ende werden sie ein Belegexemplar von der Geschichte wollen.«
»Dann sag halt, du bist grade dabei, die Reportage ans Iron Fist zu verkaufen. Wenn’s am Schluss nichts wird, werden sie dich ja kaum den Flug zurückzahlen lassen. Du kannst dir maximal den Ruf in einer Branche versauen, in der du nicht mehr arbeitest. Und wenn du das nicht willst, können wir ja wirklich eine Reportage schreiben«, schlug ich vor.
»Ich möchte aber keine Reportage schreiben.«
»Ich kann das ja machen«, sagte ich.
»Du?«, sagte der Mandel.
Ich überhörte die unterschwellige Gehässigkeit, weil der Mandel mir schon damals nie zugetraut hat, ich könne auch mal was für die Druckausgabe vom Express schreiben. Für ihn war ich als Online-Redakteur immer ein Journalist zweiter Klasse gewesen. Wenn überhaupt ein Journalist. Ich stand auf und ging in die Küche, um mir auch einen Kaffee zu machen. Ich befüllte den Siebträger mit Espresso, drehte ihn fest und schaltete die Maschine ein. Ein Geräusch ertönte, als ob sich brodelnde Lava in der Maschine befände.
»Was ist denn das für ein Krach?«, rief der Mandel vorwurfsvoll vom Schreibtisch her.
Es fing an zu zischen. Besorgt entfernte ich den Siebträger aus seiner Halterung, und eine braune Soße schoss wie eine Naturgewalt an die Küchenwand und auf mein Hemd.
»Ich glaub, die Kaffeemaschine ist kaputt«, schrie ich in Richtung Mandel, während ich mit der Hand die Kaffeelava auf meinem Hemd verteilte, damit sie mir wenigstens symmetrisch die Haut von den Knochen schmolz.
»Unsinn. Mein Kaffee ist perfekt«, sagte der Mandel.
»Ich komm übrigens nicht mit nach Stralsund«, sagte ich und hielt meine Hände unter den eiskalten Wasserstrahl der Spüle.
Als ich abends zu Hause in meiner Wohnung saß und mich fragte, was Maria wohl mit der Waschmaschine gemacht hatte, die vorher immer tadellos funktionierte, ging mir das Black-Metal-Konzert nicht mehr aus dem Kopf. Maria war Gott sei Dank für zwei Tage zu ihrer Mutter nach Chemnitz gefahren, und so schüttete ich mir einen Ouzo mit Eiswasser in ein Glas und schaute mir im Internet diverse Videos von Dark Reich an. Da gab es vor allem die Ausschnitte aus dem Bergen-Konzert. Die aufgespießten Schafschädel sahen in dem mattroten Bühnenlicht aus wie Stofftiere, und einer umgedreht gekreuzigten Frau hingen die Brüste nach oben beziehungsweise nach unten, also in Richtung Gesicht auf jeden Fall. Dazu die überdimensionale Nietenausstattung des Sängers und die Leichenschminke – auf den ersten Blick fand ich es zum Lachen. Ich mochte so Sachen wie Slayer, Exodus und Death, aber zum Begriff Black Metal fiel mir eigentlich nur Venom ein. Und für die war der ganze Satanismus-Kram ja nur eine passable Effekthascherei gewesen, um mehr Weiber zu vögeln als die Konkurrenz. Das waren Party-Satanisten und damit dem Credo des Satanismus Tu, was du willst deutlich näher als die verkrampften Harlekins in dem Video. Aus reiner Langeweile schaute ich weiter ein Video nach dem anderen von dem Bergen-Konzert durch. Ab dem fünften Song, The Ancient Moon, fühlte ich mich unwohl. Es lag nicht an den Schafsköpfen oder den gekreuzigten Frauen, es lag tatsächlich an der Musik. Die Band raste sieben Minuten lang durch ein und dasselbe Schema, geführt von einer für die Musikrichtung ungewohnt hochtonig gespielten Gitarrenlinie, die sich andauernd wiederholte. Dazwischen schrie der Sänger in scheinbar von Raum und Zeit befreiten Intervallen etwas, das ich nicht verstand. Für meine Ohren klang es zunächst wie der nicht enden wollende Schluss eines Songs, aber die Band trug ihn vor wie eine Sinfonie. In dieser Zermalmung der herkömmlichen Songstruktur lag eine gewisse Anmut, das musste ich zugeben. Es hatte wenig mit dem Black Metal von Venom zu tun. Riffs und Refrains waren zweitrangig beziehungsweise nicht vorhanden, und auch das Handwerk stand – für Metal untypisch – nicht an erster Stelle. Alles ordnete sich der Atmosphäre des Songs unter, wenn man diesen endlosen Wutausbruch Atmosphäre nennen wollte. Nachdem der Song zu Ende war, sah ich mir das Video noch einmal an. Und noch einmal. Ab dem dritten Mal las ich den Text mit, den ich auf einer Website gefunden hatte, weil man verstand ja bei der Aufnahme kein einziges Wort davon.
Arduous dreams arrive
At the deep sleep of your life
As I watch the pale moon rise
I can hear the ancient cries.
A forest clearing dimly lit
From a distance I will follow
The chosen one draws near
The ground beneath is hollow.
Echo of the past
From northern fields of wrath
Chaos heads down south
Killing false gods in its path.
Das war vielleicht nicht das idiomatischste Englisch und vielleicht auch kein ordentlicher Jambus, aber Dark Reich beschrieben hier ein Erweckungserlebnis, eine komplette Umwälzung der Verhältnisse, und das in einem fast sehnsuchtsvollen Ton, dass einem ganz warm ums Herz werden konnte. Nun fand ich auch die Bühnenshow nicht mehr so albern, besonders die Leichenbemalung war doch ganz passend, weil sie jeden dieser längst zerblödeten Rockmusik-Gesichtsausdrücke gnadenlos unterdrückte. Die Band betrieb ihre Musik mit einer bewundernswerten Ernsthaftigkeit. Die wollten gar nicht in den NME, dachte ich noch. Dann schlief ich auf der Couch ein.
Der Mandel und ich fahren mit einem uralten Ford über eine holprige Landstraße durch Irland. Aus irgendeinem Grund hat der Mandel das Licht ausgeschaltet, sodass man überhaupt nicht sieht, wohin er fährt. Der Mandel sitzt am Steuer und lenkt den Wagen über eine Straße, die man nicht sehen kann, nur hören. Jeden Stein, der von unten gegen das Bodenblech schlägt. Ich versuche angestrengt, draußen etwas zu erkennen, aber es ist so stockfinster, dass wir noch nicht einmal einen Baum sehen können, außer wir fahren dagegen. Das einzige Licht kommt von den Armaturen und erhellt einen Teil vom Gesicht vom Mandel. Wie seine eigene Leiche sieht der Mandel aus, bis auf den Umriss ganz dunkel und zugleich schneeweiß im Gesicht. In dem bleichen Licht der Armaturen. Vielleicht ist er auch längst tot und krallt sich nur noch in einer Totenstarre am Lenkrad fest. Aber für einen Toten fährt er recht gut, muss man sagen. In der Ferne taucht ein Licht auf. Bald sind es zwei, und sie reißen die Dunkelheit auseinander und teilen sie unter sich auf. Ein Auto kommt uns entgegen. Der Mandel fährt unbeirrt weiter. Das fremde Auto kommt kurz vor uns zum Stehen, und auch der Mandel bremst. Anscheinend ist der Mandel doch noch nicht ganz tot, oder sein leichenstarrer Fuß ist auf die Bremse gerutscht. Die grellen Scheinwerfer des anderen Autos schießen in unseren Ford hinein. Der Mandel starrt in das gleißende Licht, und sein rechter Nasenflügel bebt. Er ist also nicht tot. Ich betrachte wieder das andere Auto und werde das Gefühl nicht los, dass ich den Fahrer kenne, obwohl ich natürlich nichts sehe in dem weißen Licht. Der Mandel hat die Hand am Türgriff, aber ich sage: »Nicht aussteigen. Das geht uns gar nichts an.« Der Mandel zieht seine Hand zurück. Plötzlich erlöschen die Scheinwerfer des anderen Autos. Ich sehe überhaupt nichts mehr, aber dann schält sich ein Bild aus der Schwärze hervor, als die Augen sich an die Dunkelheit gewöhnen. Das Auto gegenüber ist auch ein Ford, auch ein alter Taunus, es ist, als hätten wir vor einem Spiegel geparkt. Blasses weißes Licht strömt aus der Fahrerkabine des spiegelverkehrten Taunus. Man kann nicht genau erkennen, wer am Steuer sitzt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch ein Beifahrer ist. Ich kenne die Leute irgendwoher, kann ich nicht aufhören zu denken.
»Fahr!«, dränge ich den Mandel, aber der sitzt nur regungslos da. Sein rechter Nasenflügel bebt nicht mehr. Irgendwo in der Nähe muss die Küste sein, denke ich noch, wahrscheinlich ein Übersprungsgedanke, weil ich so eine panische Angst vor dem anderen Taunus habe. Dann lässt der Mandel endlich den Motor an und fährt dem anderen Taunus davon, der hinter uns in der Dunkelheit zurückbleibt wie eine unangenehme Erinnerung.
2: NORDLAND
»Die zahlen keinen Flug«, sagte der Mandel zur Begrüßung am nächsten Tag im Büro. Ich war mit der U-Bahn gekommen und durch den schwarzen Schnee und die Hundescheiße zum Nordufer gelaufen, weil der Mandel das Auto mit nach Hause genommen hatte. Ich war trotz der Kälte nass geschwitzt, weil es in der U-Bahn zu heiß war.
»Guten Morgen erst einmal«, sagte ich.
»Die würden sich aber über eine Berichterstattung freuen und uns das Hotel für drei Tage zahlen. Aber keinen Flug. Damit ist es gestorben, oder?«, sagte er.
»Gehen wir erst mal in den Deichgraf. Unsere Kaffeemaschine ist kaputt«, sagte ich.
»Unsinn«, sagte der Mandel und hielt triumphierend seine Tasse hoch, in der sich offensichtlich frischer Kaffee befand. Ich zog meine Jacke aus und setzte mich. Als hätte er nur darauf gewartet, dass ich endlich ins Büro kam, machte der Mandel seinen Bluesrock an und rauchte eine Zigarette dazu. Lang ging das nicht mehr gut mit uns.
»Kann ich dein Detektiv-Zertifikat haben?«, fragte ich durch den Bluesrock und den Rauch hindurch zur anderen Seite des Schreibtischs, von wo aus der Mandel aufs Nordufer schauen konnte.
»Wozu?«
»Ich wollte eine Kopie an den Winter schicken. Er meinte doch, wenn wir Arbeit brauchen, kennt er einen beim Gericht, der hin und wieder Recherchearbeiten anfordert. So ähnlich wie bei EinFall für zwei.Aber man muss sein Zertifikat vorlegen.«
»Als ob der Winter uns jemals freiwillig einen Gefallen tun würde«, sagte der Mandel.
»Du warst doch dabei, als er’s uns angeboten hat.«
»Das war vor einem Kühlregal in der Metro. Auf mich hat er verwirrt gewirkt«, sagte der Mandel.
»Ich hatte den Eindruck, er hat sich gefreut, uns zu sehen. Nach seinem Erfolg mit dem Buch ist er nicht mehr so angespannt wie früher«, sagte ich, aber der Mandel schüttelte nur kurz den Kopf und tippte auf seiner Maus herum. Der Winter war der Leiter der achten Mordkommission in der Keithstraße.
»Fahren wir doch mit dem Auto nach Norwegen. Hier ist eh nichts los«, sagte ich.
»Ich weiß nicht«, sagte der Mandel, ohne von der Maus abzulassen.
»Warum denn nicht?«
»Es ist kalt«, sagte der Mandel, ohne sich darauf festzulegen, wo es kalt war. Vermutlich meinte er Norwegen.
»Schau, so ein Urlaub würde uns ganz guttun. Wir sitzen sonst nur den ganzen Tag hier oder im Deichgraf drüben«, sagte ich und schaute mir den Mandel genauer an. Er trug ein graues Jackett und ein schwarzes Hemd darunter, die obersten Knöpfe geöffnet. Er wirkte gepflegt wie immer, aber seine Augenringe waren dunkler als noch im letzten Jahr. Ich fand, man sah ihm seine vierzig plus deutlich an.
Der Mandel zuckte mit den Schultern, und mein Telefon klingelte. Es war Maria. Sie hatte Ärger mit ihrer Mutter gehabt, und ich versuchte, sie zu beruhigen, weil sie sonst heute Abend noch von Chemnitz zurückkommen wollte. Der Mandel stieß scharf die Luft aus, während ich telefonierte.
»Lass uns fahren«, sagte der Mandel, ungefähr eine Sekunde nachdem ich aufgelegt hatte.
»Super, Mandel, super. Das wird sicher gut.«
»Ja, ja«, sagte der Mandel.
»Warst du eigentlich noch in Stralsund gestern Abend?«, fragte ich.
»Nein, Stralsund ist doch viel zu weit weg«, sagte der Mandel.
Die folgenden Nächte schlief ich schlecht. Ich war schon länger nicht mehr im Urlaub gewesen, wenn man von den Desaster-Wochenenden an der Ostsee mit Maria einmal absieht, und ich wusste gar nicht, was ich alles einpacken sollte. Zunächst kaufte ich mir zwei CDs von Dark Reich, damit ich beim Konzert nicht vor einem Berg unbekannter Lieder stehen musste, denn bis man sich live in eine unbekannte Band reingehört hat, ist das Konzert vorbei. Dann holte ich mir in einem Secondhandgeschäft einen grünen Parka mit wärmeisolierendem Innenfutter, weil ich die Kälte und den Wind fürchtete, den die Leute in den Norwegen-Foren kolportierten. Maria war in der Zwischenzeit zurück, und ihre Freude darüber, dass die Waschmaschine wieder funktionierte, trübte ich durch die Ankündigung, mit dem Mandel ein paar Tage nach Norwegen zu fahren. Ich sagte, dass ich einen Artikel schreiben müsse und dass die Plattenfirma alles bezahlen würde. Maria war trotzdem nicht einverstanden mit meinen Reiseplänen.
»Du lässt mich dauernd allein«, sagte sie, und ich dachte, dass sie jetzt vollkommen spinnt. Immerhin hatte ich sie bei mir einziehen lassen.
Ich freute mich auf die Reise, auf die Tage ohne die Büro-Agonie. Es war gut, etwas zu unternehmen, statt zu warten, bis das große Nichts über einen hinweggezogen war. Weil das große Nichts jahrelang verharren kann, das ist hartnäckig, wenn man nichts unternimmt.
Am Karfreitag, um fünf Uhr früh, stand ich wie verabredet unten auf der Straße und wartete auf den Mandel, der den Firmenwagen wie üblich mit nach Hause genommen hatte. Angeblich wegen der schlechten Verkehrsverbindung zu seiner Wohnung. Um Viertel nach fünf schrieb ich ihm eine SMS, und um halb sechs rief ich bei ihm an, erreichte aber nur den Anrufbeantworter. Egal, wie kalt es in Norwegen war, es konnte nicht kälter als bei uns sein, denn als ich kurz vor sechs zurück in die Wohnung ging, ohne den Mandel erreicht zu haben, war ich fast erfroren. Das war mit Abstand der kälteste April, den ich in dieser Stadt erlebt habe. Um sieben rief der Mandel an und sagte, er habe verschlafen, brauche aber noch ein bisschen, bis er fertig sei.
Autofahren mit dem Mandel ist immer dasselbe. Du redest auf ihn ein, er tut so, als ob er dir zuhört, hört aber eigentlich der Musik zu. Dann lässt man das Reden sein, der Mandel fährt und hört weiter Musik, und man beschäftigt sich irgendwie alleine. Mein Pech ist, dass mir vom Lesen im Auto schlecht wird und ich deshalb auf den Musikgeschmack vom Mandel angewiesen bin. Wie im Büro verhält er sich auch im Auto wie ein Alleinherrscher. Ich hatte gehofft, dass sich das mit dem gemeinsamen Auto ändert, aber da habe ich mich getäuscht. Stattdessen sind wir in unserem Firmenwagen der endgültigen Machtergreifung vom Mandel noch näher gekommen. Nachdem sie dem Mandel letztes Jahr seinen Audi angezündet haben, hat er trotz Erhalt der vollen Versicherungssumme inklusive der bisher gezahlten Leasing-Raten beschlossen, dass er gar keinen eigenen Wagen mehr braucht, es werde sowieso viel zu viel Auto gefahren auf der Welt. Und ob wir uns nicht auf Firmenkosten einen gemeinsamen Dienstwagen leisten wollten. Einen schwarzen Ford Focus, fünf Jahre alt, den der Mandel von einem mit seinem Bruder befreundeten Ford-Händler unten im Süden günstig erstanden hat. Eigentlich hatte uns der Bruder vom Mandel sein ausrangiertes Fahrschulauto, auch ein Audi, zum Vorzugspreis geben wollen, aber der Audi war gelb. Und so saß ich neben dem Mandel in dem Ford Focus und hoffte erneut auf mein Mitspracherecht an der Musik, weil es doch zur Hälfte mein Wagen war.
»Später kannst du die Musik aussuchen«, log der Mandel.
WasnochrelativharmlosmitderBrothersandSistersvondenAllmanBrothersbegann,fandseinenNegativhöhepunktinderKerschowski&BlankenfelderBoogie-Band,einertotalenRarität,wiederMandelmirerklärte.Sobliebmirnichtsanderesübrig,alsdemBluesrockzuentschlafen,bisichaneinerRaststättewiederaufwachte.WirwarenungefähraufderHöhevonFlensburg,deutlichnachzwölf.EswarKarfreitag,undwirstecktenmittenimOsterreiseverkehr,bloßweilderMandelverschlafenhatte.WirhattenunsfürdieRouteüberDänemarkentschieden,diesiebzehnStundendauert.KeinePauseneingerechnet.AmSonntagabendwardasKonzert,amSamstagfrühwürdenwirinBergenankommen.WährendsichderMandeleinenKaffeeundeinenSchokoriegelholte,setzteichmichansSteuer.Nichtweilichunbedingtfahrenwollte,aberwenneseinenunveräußerbarenGrundsatzindenRegulariendeszivilenPersonentransportsgibt,dannden,dassderFahrerdieMusikaussucht.NachnurzehnMinutenmitmeinerMusikfingderMandelandazwischenzureden,unddaswargarantiertnichtseinemRedebedürfnisgeschuldet.Dagingesplötzlichdarum,obnichtderFlugbilligergewesenwäre,obichdieFährenpreiseimKopfhätte,obichdiesesundjeneskannte,undwennnein,warumnicht,undamEndewardieMercyful-Fate-Plattedurchgelaufen,ohnedassichnureineinzigesLiedhättegenießenkönnen.
Auf der Fähre von Hirtshals nach Kristiansand saßen der Mandel und ich im Bordcafé an der Theke. Der Mandel sitzt gerne an der Theke, weil ein paar der wichtigsten Dinge auf der Welt passieren an der Theke, sagt er, ohne Beispiele zu nennen. Der Mandel trank einen Cappuccino und ich einen Weinbrand.
»Warum trinkst du denn Weinbrand?«, fragte der Mandel und sah mich befremdet an.
»Warum nicht? Ist mal was anderes.«
»Man trinkt doch nichts, nur weil es mal was anderes ist«, sagte der Mandel und schaute auf sein Mobiltelefon.
»Hast du hier Empfang?«, fragte ich ihn.
Der Mandel ignorierte die Frage.
»Ich nämlich nicht«, sagte ich. »Seit wir auf dem Wasser sind.«
Ich nahm einen Schluck von dem Weinbrand und schaute auf den Quittungszettel, den uns der Kellner gleich mit dazugelegt hatte. Ich steckte ihn ein.
»Wahnsinn, wie teuer hier so ein Weinbrand ist«, sagte ich.
Der Mandel schaute nicht von seinem Telefon auf, als er fragte: »Wie teuer?«
»Acht Euro«, sagte ich.
»Das geht ja noch«, sagte der Mandel. »Warte mal, bis wir in Norwegen sind.«
»Zehn Euro?«, fragte ich.
»Nix Euro«, sagte der Mandel. »Kronen. Norwegische Kronen.«
»Scheiße. Warum haben die keinen Euro? Ich hab gar kein Geld gewechselt«, sagte ich.
»Sigi, in welchem Jahrhundert lebst du? Geh halt zum Automaten«, sagte der Mandel.
»Aber die Gebühren, wenn man im Ausland Geld abhebt«, sagte ich.
»Was musst du auch einen Weinbrand bestellen?«, sagte der Mandel eine Minute später.
Da mir der Mandel auf Dauer zu wenig gesprächig war, wanderte ich ein bisschen auf dem Deck umher. Es war längst dunkel, und die pechschwarze Nordsee brachte die gemeinste und windigste Kälte hervor. Schon als Kind war es meine größte Angst, in der Nacht auf einem Schiff über Bord zu gehen und so von Wind und Wellen überzogen zu werden, dass mich sofort niemand mehr sehen konnte und mein Verschwinden zunächst völlig unbemerkt blieb. An der Reling vor dem Bordcafé stand der Mandel und rauchte. Der Wind richtete seine Frisur zugrunde, sein akkurater Seitenscheitel war für heute Geschichte, konnte man meinen. Aber der Mandel würde nach der Zigarette auf die Schiffstoilette gehen und mit dem kleinen schwarzen Plastikkamm, den er neuerdings in der Innentasche trug, den Scheitel wieder dahin ziehen, wo er hingehörte. Wie er so an der Reling stand und rauchte, sah er aus wie ein Mann aus einem vorherigen Jahrhundert. Er trug eine bullige braune Fliegerjacke mit einem weißen Fellkragen und braune Lederhandschuhe. Es sah aus, als hätte er sich als der »Seewolf« verkleidet. Mein Telefon summte. Ich schaute auf das Display, und der Balken für den Empfang war auf null. Trotzdem zeigte es mir eine Kurznachricht von Maria an. Du hättest nicht einfach so wegfahren sollen. Die spinnt wohl, dachte ich. Der Platz an der Reling war leer, der Mandel war hineingegangen. Es blieb ohnehin nicht mehr viel Zeit bis zur Ankunft in Kristiansand.
Wären wir bei Tageslicht in Norwegen angekommen, hätte ich vielleicht einen ganz anderen Eindruck von dem Land gewonnen, aber wir fuhren durch eine Dunkelheit, die so undurchdringlich war, als hätte jemand ein Tuch über uns geworfen. Der Mandel hatte mich genötigt, nach der Fähre das Steuer zu übernehmen, weil er sich hinlegen wollte, aber ich fühlte mich nicht besonders gut nach dem Wellengang. An der erstbesten Tankstelle fuhren wir raus, und ich legte mich auf den Rücksitz, während der Mandel weiterfuhr. Wir waren jetzt elf Stunden am Stück unterwegs, und der Mandel war besessen von der Idee, ohne Übernachtung oder längere Pause in Bergen anzukommen. Als ich wieder aufwachte, war es kurz nach Mitternacht, und wir waren immer noch auf der Straße. Die Autos, die uns entgegenkamen, schienen aus dem Nichts aufzutauchen. Der Mandel saß im völligen Dunkeln, nur das fahle Licht der Armaturen erzeugte einen hellen Fleck auf seinem Gesicht. Es lief keine Musik.
»Wo sind wir?«, fragte ich, während ich wieder nach vorn kletterte.
»Bei Stavanger«, sagte der Mandel, aber das sagte mir nichts.
»Warum fahren wir keine Autobahn mehr?«
»Es gibt hier keine Autobahn«, sagte der Mandel.
»Warum wirst du langsamer?«, fragte ich.
»Da vorn kommt eine Mautstelle«, sagte der Mandel.
»Eine Mautstelle? Für diese schäbige Straße?«
»Für den Tunnel«, sagte der Mandel und deutete auf den Berg, der auf uns zukam.
»Kennst du dich gut aus mit Black Metal?«, fragte ich, weil ich für meinen Artikel die Expertise vom Mandel brauchen würde.
»Ja«, sagte der Mandel.
»Von Dark Reich hab ich mir das Konzert im Netz angeschaut und mir die ersten beiden Alben gekauft. Was muss ich noch kennen?«
»Dark Reich sind nur die Plakativen. Die wahre Wut kommt von viel weiter unten«, erklärte der Mandel.
»Was meinst du mit weiter unten?«, fragte ich.
»Die kleineren Bands. Die, die’s wirklich ernst gemeint haben. Die die Kirchen angezündet und Leute umgebracht haben.«
Der Mandel kam mir jetzt vor wie ein alter Museumswärter, der den Kindern beim Schulausflug eine Schauergeschichte erzählt. Die vom unbenutzten Museumstrakt, wo sich niemand hineintraut, wo aber jede Nacht Geräusche zu hören sind.
»Leute umgebracht?«, wiederholte ich.
»Das musst du doch mitbekommen haben. Das stand damals in allen Zeitungen. Mittlerweile werden sogar Anwärter für den norwegischen diplomatischen Dienst einem Workshop in Sachen Black Metal unterzogen. Was hast du denn Anfang der Neunziger gemacht?«
»Lass mich überlegen. Da hatte ich mein erstes eigenes Auto und bin mit der Ellen Weinzierl nach Südtirol gefahren. Zum Pfitscher, auf dieses Weingut, weil ihre Eltern …«
»Warte«, sagte der Mandel und hielt den Wagen an. Er steckte seine EC-Karte in einen Maut-Automaten.
»Geb ich dir dann später«, sagte ich.
»Was gibst du mir später?«, fragte der Mandel, während er auf die Schranke wartete.
»Meinen Anteil von der Maut.«
Der Mandel schüttelte nur den Kopf. Als wir wenig später den Tunnel hinter uns gelassen hatten, griff er an mir vorbei ins Handschuhfach und holte eine CD heraus. Auf dem Cover war ein Mann mit langen Haaren in einer schwarzen Lederjacke zu sehen, der auf einer Lichtung stand. Sein Gesicht war in derselben Art geschminkt, die ich schon aus dem Video von Dark Reich kannte. Das Foto sah aus wie vierundzwanzigmal schwarz-weiß kopiert. Über der Lichtung befand sich der Schriftzug »Død«in Fraktur. Falls wer nicht weiß, was das ist: Eine Fraktur ist, wie der Name schon sagt, eine gebrochene Schrift. Wird fälschlicherweise gerne als altdeutsche oder altenglische Schrift bezeichnet. Macht sich immer gut bei nordeuropäischer Nationaltümelei, sieht manchmal aber auch wirklich cool aus. Am unteren Ende des Bildes stand in derselben Schrift: Si Satanas Pro Nobis, Quis Contra Nos –wenn der Teufel für uns ist, wer ist dann gegen uns.
»Die musst du kennen«, sagte der Mandel.
»Mach rein«, sagte ich zum Mandel und zeigte auf den Schacht des CD-Players.
»Die zweite Død ist noch besser. Auf der zweiten ist weniger Schlagzeug. Aber wenn, dann ganz simpel und massiv wie aus weiter Ferne. Konzeptmusik, fast Avantgarde.«
»Aha«, sagte ich, »aber kannst du trotzdem die erste einlegen, wo du sie grade in der Hand hältst?«
Der Mandel steckte die CD ins Fach. Man kann jetzt nicht sagen, dass die Musik mit einem großen Knall begann. Noch nicht einmal mit einem kleinen. Dafür war sie viel zu schlecht abgemischt. Sie fing eher beiläufig an. Wie bei Dark Reich diese klirrenden Gitarren. Der große Unterschied lag allerdings im Gesang. War es bei Dark Reich eher ein Grunzen, so klang er jetzt abwechselnd asthmatisch keuchend und schrill und roh. Einen Bluthusten konnte man sich gut dazu vorstellen. Leider verstand man wieder kein Wort vom Text.
»Was ist denn das für eine grässliche Produktion?«, fragte ich.
»Das haben sie mit Absicht so gemacht. Wegen der Gegenkultur«, klärte der Mandel auf.
»Ach so«, sagte ich. Die Musik klang, als ob jemand tödlich beleidigt war. Ich fand das interessant. Ich war dabei, mich einzuhören.
»Reicht auch wieder, oder?«, sagte der Mandel und wechselte die CD. Kurz darauf sang jemand »Schwätzer umschwirrn mich. Mach mal das Licht aus, ist ja nicht anzusehen, die kann man nur niedermähn« zu einem 08/15-Riff.
»Was ist denn das für ein Unsinn?«, fragte ich.
»Der bewaffnete Blues«, sagte der Mandel.
Laut dem Mandel verschlief ich das nächste kurze Stück Fähre über einen Fjord. Wenn ich zwischenzeitlich aufwachte, schimmerte das Navigationsgerät im Dunkeln, das der Mandel in den Aschenbecher geklemmt hatte, weil die Halterung für die Windschutzscheibe abgebrochen war. Es befand sich im Nachtmodus, glühte nur matt, und das Meer wurde als schwarze Fläche angezeigt. Der Mandel hatte extra eine Norwegen-Software draufgespielt. Ich habe vergessen, wie oft wir letztendlich auf eine Fähre mussten, weil wir ja für die kurzen Überfahrten nicht ausstiegen und ich meistens am Schlafen war. Es können zwei, aber auch fünf Mal gewesen sein. Ich weiß aber noch, dass ich immer mehr das Gefühl bekam, dass wir in Gebiete vordrangen, die nicht für den Personentransport vorgesehen waren. Hier gab es nur noch Tunnels und Fähren. Die Natur hielt das Heft in der Hand, und der autofahrende Mensch zwängte sich demütig zwischen ihren Auswüchsen aus Wasser und Stein hindurch. Ich wünschte, wir hätten ein Flugzeug genommen.
Als wir nach einer Ewigkeit auf dunklen Straßen in den Außenbezirken von Bergen ankamen, war es immer noch nicht hell. Selbst dem Mandel sah man seine Müdigkeit jetzt an. Er hatte diese Hundefalten im Gesicht, von den Augenringen ganz zu schweigen. An einer Tankstelle holte er einen Kaffee und einen Schokoriegel und lehnte sich gegen den Ford. Den Becher stellte er nach einem Schluck auf dem Dach ab, wo der Kaffeedampf in die norwegische Nacht abzog. Den Schokoriegel steckte er in die Innentasche seiner Seewolfjacke. Ich saß auf dem Beifahrersitz und hatte die Tür geöffnet. Es war ungnädig kalt draußen, und wir befanden uns in einer Art Industriegebiet.
»Die Luft ist gut. Wie bei uns daheim«, sagte der Mandel, ohne zu erklären, was er mit »bei uns daheim«meinte.
»Und eiskalt«, sagte ich.
Der Mandel nahm seinen Becher vom Dach und stieg wieder ein. Es fing an zu regnen.
»Jetzt haben wir gar nicht geschaut, wo das Hotel ist, das die Plattenfirma reserviert hat«, sagte ich.
»Doch«, sagte der Mandel und ließ den Motor an.
Wir fuhren bald über Kopfsteinpflaster durch die Innenstadt. Im Dunkeln sah es hier aus wie in der Innenstadt von Erlangen oder einer beliebigen seelenlosen deutschen Stadt. Nur die Berge ringsherum waren sehr eng an die Siedlung herangerückt, das hatte ich so noch nie gesehen. Als hätte jemand die Stadt eingemauert. Kein Mensch war auf der Straße, und nur vereinzelt trafen wir auf andere Autos. Hordaland hieß die Provinz, in der wir uns befanden, hatte ich zuvor auf einem Schild gelesen. Bergen, Hordaland. Unwillkürlich denkt man an eine Horde Wilder mit Streitäxten.
»Ist unser Hotel am Hafen, in diesem netten Viertel?«, fragte ich den Mandel, weil ich von einem netten Viertel am Hafen gelesen hatte.
»Spinnst du? Wer soll denn das bezahlen?«, sagte der Mandel.
»Die Plattenfirma. Wenn man schon mal am Meer ist«, sagte ich, sah aber natürlich ein, dass wir bei der momentanen Lage der Musikindustrie kein teures Hotel mit Meerblick erwarten konnten.
Links unter uns lag die Bucht. Die Straßen wurden enger, es ging bergauf, die Häuser wurden kleiner, die Stadt wirkte jetzt fast wie ein Bergdorf. Aus der Dunkelheit wuchsen uns zwei symmetrische Kirchtürme mit prägnanten Spitzdächern entgegen. Die Türme hatten etwas Herrisches an sich.
»Mariakirken, ältestes Gebäude im Ort«, sagte der Mandel, als hätte ich ihn danach gefragt. Der Mandel umrundete die Kirche, und wir fuhren an einem kleinen Haus vorbei, auf dessen Schaufenster Nirvana Pizza Orient stand. Außer einem eingeschweißten Chicken-Barbecue-Sandwich hatte ich auf der ganzen Reise nichts gegessen, weil der Mandel dagegen war, in einem Restaurant zu halten. Wahrscheinlich hatte er auch gar keinen Hunger mit den ganzen Schokoriegeln im Magen. Überhaupt war der Mandel in den letzten Wochen kaum noch ohne Schokoriegel anzutreffen, und langsam sah man ihm das an, fand ich. Ich schaltete mein Telefon nach längerer Zeit wieder ein und sah die Anzeige für zehn Anrufe in Abwesenheit. Von Maria. Mitten in der Nacht. Unter dem Logo der Pizzeria stand: Den absolutt beste kebaben i Bergen. Es brannte Licht. Ich hoffte, der Mandel würde nicht mehr weit fahren, und tatsächlich hielt er ein paar Minuten später an einem vierstöckigen Haus, aus dessen Fassade in jedem Stockwerk kleine Erker in die Straße hineinragten. Neben jedem Erker befand sich ein winziger französischer Balkon. Die anderen Häuser in der Straße waren so gedrungen, dass dieses Haus im Gegensatz dazu wie ein Hochhaus wirkte. Der Mandel stieg aus, und ich folgte ihm. Er klingelte neben einem goldenen Klingelschild, auf dem Gjestehus Kaltenborn stand.
»Es ist halb sechs in der Früh. Da ist wahrscheinlich noch keiner da«, sagte ich und wischte mir den Regen aus dem Gesicht. Der Türöffner summte. Die Eingangshalle war schmal, aber links und rechts mit ornamentierten Spiegeln versehen, in denen der Mandel im Vorbeigehen seinen Seitenscheitel überprüfte. Es gab keinen Aufzug, und wir fanden keinen Lichtschalter, aber im dritten Stock hatte jemand die Tür geöffnet, und ein sanfter Lichtstrahl erhellte das dunkle Treppenhaus. Mit einer erstaunlichen Selbstverständlichkeit trat der Mandel ein und sagte: »God morgen.« Ein goldblondes Mädchen saß in einem winzigen Foyer hinter einem Schreibtisch und sagte: »Hi there. How can I help you?«
Ihre Konsonanten klangen liebenswert, vor allem das k. Sie war vielleicht Mitte zwanzig und hatte ihre Haare lose mit einem weißen Tuch zusammengebunden. Dazu die unglaublichsten Pausbacken, aber ein schmales, spitzes Kinn. Sie strahlte uns an, als hätten wir ihr gerade den Preis für die beste Rezeptionistin Norwegens verliehen. Der Mandel erklärte, er habe eine Reservierung von der Plattenfirma für ein Doppelzimmer für drei Nächte. Das Lächeln des Mädchens verflüchtigte sich sanft, als sie dem Mandel unter völlig glaubwürdigem Bedauern mitteilte, dass das Gästehaus ausgebucht war und sie keine Reservierung unter seinem Namen oder dem einer Plattenfirma finden konnte. Sie könne uns aber auf jeden Fall eine sehr günstige Alternative nennen: das Fantoft-Studentenhostel, nur fünf Kilometer vom Zentrum entfernt. Die Zimmerverwaltung dort habe noch nicht geöffnet, aber sie würde jemanden anrufen, der uns vor dem Hostel treffen und uns einen Schlüssel geben würde. In der Regel sei das Hostel ohnehin nur an Austauschstudenten vermietet, aber zurzeit waren viele Zimmer frei wegen der Semesterferien. Der Mandel ließ sich die Adresse geben und bedankte sich. An der Tür drehte er sich noch mal zu dem Mädchen um und sagte ein zweites Mal Danke. Unten im Auto lächelte er wie blöd vor sich hin, als er den Motor anließ.
»Scheiß Plattenfirma«, sagte ich. »Jetzt müssen wir das auch noch selber zahlen.«
»Das klären wir, wenn wir wieder zurück sind«, sagte der Mandel und lächelte noch immer.
Das Navigationsgerät fand kein Signal vom Satelliten, nachdem ich es zwischenzeitlich ausgeschaltet hatte, um Batterien zu sparen. Der Mandel steuerte den Ford Focus zügig durch die engen Straßen, als würde er sich auskennen, während ich wehmütig auf die langsam erwachende Innenstadt zurückblickte. Jetzt sah man die Berge deutlich, wie sie fast auf der Stadt draufsaßen. Ich hasse Hotels, die außerhalb liegen, weil man einen wesentlichen Teil seines Urlaubs damit verschwendet, in die Innenstadt zu gelangen. Nach einer größeren Kreuzung ging es erst mal wieder eine längere Zeit bergab. Es war das reinste Mini-San-Francisco hier, steigungstechnisch. Eine lang gezogene Allee führte uns an Villen aus Holz vorbei, die durch Bäume sorgfältig abgeschirmt waren. Links von uns tauchte ein graues spitzdachiges Holzhaus mit in die Höhe geschwungenen Seitenflügeln auf, das mich an das Bates-Anwesen aus Psycho erinnerte. Rechts gegenüber ein flaches Funktionalgebäude mit einem gläsernen Unterbau. Das Navigationsgerät hatte immer noch keinen Empfang. Keine Ahnung, was dem Mandel die Sicherheit verlieh, auf dem richtigen Weg zu sein.
»Sind wir auf dem richtigen Weg?«
»Ja«, sagte der Mandel.
»Woher weißt du das? Warst du schon mal in Bergen?«
»Nein, nur in Oslo. Aber ich habe auf der Karte nachgesehen, wo die Fantoft-Kirche liegt. Und dem Namen nach kann das Fantoft-Hostel ja nicht weit sein.«
»Was ist die Fantoft-Kirche?«, fragte ich und überlegte, wann der Mandel so genau auf die Karte geschaut haben könnte.
»Die haben sie abgebrannt.«
»Wer?«
»Der Schwarze Kreis.«
»Wer?«
»Wenn du wirklich den Artikel schreiben willst, bist du aber schlecht vorbereitet.«
»Ich bin nur müde«, sagte ich.
Der Mandel hielt kurze Zeit später an, weil er endlich einen Passanten gesichtet hatte. Einen Jogger mit einem orangefarbenen Stirnband und schwarzen Leggins, der beschwingt durch den Regen lief, als wäre es das schönste Wetter. Der Mandel fragte auf Englisch nach dem Hostel. Ich konnte nicht hören, was der Jogger sagte, aber dem Mandel schien es zu reichen. Er winkte und fuhr weiter. Zwei Minuten später bogen wir links ab über einen kleinen Bahnübergang. Vor uns, quasi in die Hügel hineingerammt, häuften sich mehrere graue Betonkästen, die mich an die Plattenbauten bei uns in der Oststadt erinnerten. Ein Hochhaus in der Mitte überragte alle anderen Plattenbauten auf dem Platz und ragte in die grüne Hügelkette hinein wie ein Wachturm.
»Ist es das?«, fragte ich ungläubig.
»Fürchte schon«, sagte der Mandel.
Unser Zimmer war vielleicht ein Zimmer, aber kein Hotelzimmer. Die Wände ein Verlauf von vergilbtem Weiß zu ranzigem Gelb, darunter ein länglicher Schreibtisch, an dem ohne Weiteres und völlig grundlos vier Leute Platz gehabt hätten, eine Art Sitzecke, aus der ein Bett herausgeklappt werden konnte, und ein echtes Bett, das allerdings nur Platz für eine Person bot. Dazu ein schmuckloser Schrank und das minimalste Badezimmer. Die gesamte Einrichtung bestand aus hellbraunem Holz, das zu der Zeit modern war, als man seine Möbel noch bei Hinumit statt bei Ikea kaufte. Die Zimmergröße betrug vielleicht fünfzehn Quadratmeter ohne die Nasszelle. Es fühlte sich an, als wäre man bei Bekannten behelfsmäßig in einem Gästezimmer untergebracht, aus dem schnell noch das Gerümpel geräumt worden war. Der Mandel hängte seine Fliegerjacke über den Stuhl, schmiss seine Tasche auf den Schreibtisch und legte sich auf das echte Bett. Nach wenigen Sekunden war er eingeschlafen. Ich war hellwach und hörte dem Regen zu, wie er immer stärker wurde, während ich versuchte, das Ausklappbett aus seiner Verankerung zu lösen.
3: BEICHTE
BevoresjetztgleichlosgehtmitdemganzenMalheur,beidemamEndeanderthalbLeutetotundetlichekreuzunglücklichsind,möchteichquasialsVorgruppeeineGeschichtevonfrühererzählen.UndobwohlesmeineGeschichteist,stehtsieauchstellvertretendfürdieGeschichtevomMandel.DerMandelistjabekanntlichderhartnäckigsteautobiografischeSchweiger,deshalbgebeichanseinerStelleeinenEinblickindasTagesgeschäfteinesjungenKatholiken.UndwennichjetztkurzdieseGeschichteerzähle,danngeschiehtdasselbstverständlichimallgemeinenInteresseundKontextdesvorliegendenFalls,nichtweilichmirhieretwasvonderSeeleschreibenwilloderauchnurdiegeringsteArtvonNostalgieverspüre.ImGegenteil.AberbessermeineGeschichtealsgarkeine.Weil,würdenwirdenMandelnachseinerfragen,würdenwirkeinebekommen.Andererseits,esistihmaufeinegewisseWeiseauchnachzusehen,seinDiskretionswahn.SeineSchwierigkeitenmitdemVaterunddasDramaumdieMutter,daspartmansichausreinerHöflichkeitschondieFragenachderKindheit.UndwenndannalleswiebeidenMandelsnochsoklammheimlichundbeschämtunterdengesellschaftlichenTeppichgekehrtwird,dannbistduschonalsKindaufdembestenWeg,aucheinUnter-den-Teppich-Kehrerzuwerden,bevordudichüberhauptfreientscheidenkannst.
Gegen die Gravitas der mandelschen Familienchronik ist meine Geschichte geradezu ein Ausbund an Heiterkeit. Dennoch muss ich sie erzählen, um dem Leser klarzumachen, mit welcher theologischen Vorbelastung wir in den folgenden Fall gegangen sind. Wenn man ihn überhaupt Fall nennen kann. Denn dass ausgerechnet uns das passiert ist, was passiert ist, vor allem dem Mandel, ist auch das Resultat einer Kindheit im Katholizismus, da bin ich mir mittlerweile sicher. Das Ergebnis davon, wie man in der Vergangenheit mit Leuten wie dem Mandel und mir umgesprungen ist. In religiöser Hinsicht, aber auch in menschlicher, weil nichts anderes ist ja die Religion als eine Negierung des Menschlichen, weil zu kompliziert und zu fickrig. Das Göttliche dafür so schön regelhaft und nachlesbar wie die Hausordnung. Das Menschliche stört in der Religion nur, deshalb ist sie so unmenschlich.
Ich persönlich habe überhaupt nichts gegen den Glauben an sich. Ich glaube ja selbst an so manche Unmöglichkeit. Dass der FC Bayern in diesem Jahrzehnt noch mal die Champions League gewinnt zum Beispiel, oder dass der Mandel den Computer nach der Arbeit auch mal runterfährt, statt nur auf Stand-by zu schalten. Ich will damit sagen, dass die Leute ruhig an etwas glauben können. Jeder nach seiner Fasson, da kann man niemandem etwas vorschreiben. Der Thomas Bernhard hat in diesen Mallorca-Interviews mal sinngemäß gesagt, dass man den Leuten ihren Glauben ruhig lassen soll. Man nimmt den Leuten ja auch nicht einfach ihre Illustrierte weg. Am Glauben ist nichts auszusetzen, solange er die Leute unterhält statt unterdrückt. Solange der Glaube die Menschen nicht drangsaliert, ist er nicht per se etwas Schlechtes. Ich kann nicht für andere Religionen sprechen, weil ich nicht genau weiß, wie beispielsweise der Hinduismus den Leuten zusetzt, aber ich weiß, wie die katholische Kirche Leuten wie mir einen ungeheuerlichen Wackelkontakt im Kopf beschert hat, der mich auch dreißig Jahre später noch manchmal denken lässt, ich wäre dem lieben Gott etwas schuldig. Der liebe Gott, die Phrase allein schon. Nicht mehr hinauszuwaschen aus dem katholizierten Gehirn. Und das kommt, weil sie einen nicht einfach glauben lässt, sondern dazu zwingen will.
Diese jahrzehntelange Oppression durch die Kirche hat bei mir schon mit den Großeltern begonnen.
»Unser lieber Herrgott sieht das, wenn du im Gottesdienst nicht mitsingst«, hat der Opa väterlicherseits warnend an jedem Sonntagmorgen vor der Messe zu mir gesagt. Natürlich hatte ich schon damals meine Zweifel, ob der liebe Gott am Sonntagfrüh ausgerechnet immer in unserer Kirche vorbeischaut, weil immerhin gibt es eine nicht unbeträchtliche Anzahl an Kirchen, wo Sonntagfrüh eine Messe gehalten wird, da kann mir keiner erzählen, dass der liebe Gott jeden Sonntag alle abklappert, um nachzuschauen, wer gerade nicht mitsingt. Das Gefühl des Beobachtetwerdens blieb. Aber weil der Opa gesagt hat, dass Gott alles sieht, von Hören aber keine Rede war, bewegte ich zu Evergreens wie O Haupt voll Blut und Wunden oder Was Gott tut, das ist wohlgetan meist nur die Lippen. Weil ich auch partout nicht singen wollte vor den ganzen Leuten aus meinem Ort. Das ist ja vor allem in der Pubertät eine einzige Bloßstellung, wie wenn die Personalabteilung vom Abfüllanlagenhersteller Krones geschlossen zum Karaoke geht. Ist ja keiner ein ausgebildeter Sänger. Von uns Buben hat damals sowieso eigentlich niemand mitgesungen. Mitsingen galt als unmännlich. Na ja, der Stefan Prebeck hat mitgesungen, aber der ist später auch Sozialpädagoge in Hildesheim geworden.
Aber egal, ob man jetzt mitsang oder nicht, ständig hatte man Gott gegenüber ein schlechtes Gewissen, und der Religionsunterricht an der Schule verschärfte dieses schlechte Gewissen nur noch. Genauer gesagt der Pfarrer Gneissel. Der Verschärfer schlechthin. Ein unangenehmer Zeitgenosse und einer der Gründe, warum man schon mit sechs aus der Kirche austreten können sollte, damit man Menschen wie ihm im Fach Religion nicht in die Fänge gerät. Der Gneissel lief richtig zur Höchstform auf in seinem Beichtunterricht. Das war genau sein Ding. Da war man am Ende der Stunde heilfroh, dass man erst acht war und noch zirka achtzig Jahre übrig blieben, um seine ganzen Verfehlungen wiedergutzumachen, um am Ende nicht auf einer glühenden Mistgabel die Ewigkeit absitzen zu müssen. Im Beichtunterricht vom Gneissel hat ja alles auf die erste und gleichzeitig finale Beichte vor der Erstkommunion hinkulminiert. Die hat der Gneissel akribischer vorbereitet als jedes juristische Staatsexamen.
»Dass ihr mir ja keine Sünden vergesst«, hat der Gneissel gedroht, woraufhin sich der Prebeck meldete:
»Und wenn doch, weil man vielleicht zu aufgeregt ist?«