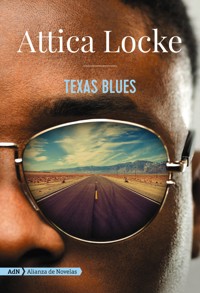20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Polar Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Jay Porter, ein Anwalt mit einer Strip-Mall-Kanzlei, mietet am Geburtstag seiner schwangeren Frau Bernie einen Kahn und nimmt sie mit auf eine Mondscheinfahrt. Plötzlich hören sie Schreie, Schüsse, sehen wie ein Körper aufs Wasser trifft. Porter eilt zu Hilfe, rettet eine verängstigte Frau aus dem Bayou und bringt sie zur Polizeistation. Die er allerdings nicht betritt, da er schwarz und die Frau weiß ist. In seiner Jugend war er ein Black-Power-Ajktivist und ist nur knapp einer Inhaftierung anlässlich einer erfundenen Anklage wegen Verschwörung zum Mord entgangen. Sein Schwiegervater bittet ihn, beim drohenden Streik der Hafengewerkschaft zu vermitteln und seine Kontakte zur Bürgermeisterin zu nutzen, die er von früher kennt. Unmittelbar sieht Porter sich und seine Familie nicht nur in einen Mord verstrickt, sich vielmehr auch den Machenschaften der Ölindustrie ausgesetzt, die es sich nicht leisten kann, einen der wichtigsten Häfen in AAmerika von einem Streik lahmgelegt zu sehen. Attica Locke hochgelobtes Debüt als Kriminalautorin
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 606
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Attica Locke
Black Water Rising
Aus dem Amerikanischen von Andrea Stumpf und Gabriele WerbeckHerausgegeben von Wolfgang Franßen
Originaltitel: Black Water Rising
Copyright: © 2009 by Attica Locke
Deutsche Erstausgabe, 1. Auflage 2021
Aus dem Amerikanischen von Andrea Stumpf und Gabriele WerbeckMit einem Nachwort von Peter Henning
© 2021 Polar Verlag e.K., Stuttgart
www.polar-verlag.de
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) oder unter Verwendung elektronischer Systeme ohne schriftliche Genehmigung des Verlags verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Redaktion: Sven Koch
Umschlaggestaltung: Robert Neth, Britta Kuhlamnn
Coverfoto: © Mauro Rodrigues / Adobe Stock
Autorenfoto: © Mel Melcon, Los Angeles
Satz/Layout: Martina Stolzmann
Gesetzt aus Adobe Garamond PostScript, InDesign
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck, Deutschland
ISBN: 978-3-948392-40-6eISBN 978-3-948392-41-3
Für meinen Großvater
Inhalt
Teil I
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Teil II
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Danksagung
Attica Locke über Black Water Rising
Ein Nachwort von Peter Henning
If we are blinded by darkness,we are also blinded by light.
Annie Dillard
Teil I
Kapitel 1
Texas, 1981
Das Boot ist kleiner, als er es sich vorgestellt hat. Und schäbiger.
Selbst bei Nacht kann Jay sehen, dass es einen Anstrich braucht.
Das ist ganz und gar nicht das, was vereinbart war. Der Typ am Telefon hat was von »Mondscheinfahrt« gesagt. Die Lichter der Stadt und so weiter. Jay hat sich was Hübsches mit ein bisschen Romantik vorgestellt, wie die Vergnügungsdampfer auf dem Lake Pontchartrain in New Orleans, nur kleiner. Aber das Ding da ist bestenfalls ein aufgemotztes Fischerboot. Es ist flach und breit und hässlich – ein übertrieben herausgeputzter Kahn, wie ein dickes Mädchen, das zum ersten und wahrscheinlich letzten Mal zum Schulball eingeladen ist. Überall hängen Lichterketten, sogar die Kajütentür rahmen sie ein. Unregelmäßig und irgendwie verzweifelt blinken sie und zwinkern Jay zu, fordern ihn auf einzusteigen, ein bisschen Spaß zu haben. Jay rührt sich nicht von der Stelle und starrt die Kajüte an: vier schiefe Wände, über die eine billige Plane gespannt ist. Das Ding sieht aus wie nachträglich draufgeklatscht, ein halbherziger Versuch, etwas herzumachen, wie der schief sitzende Hut auf dem Kopf eines Betrunkenen.
Jay dreht sich zu seiner Frau um, die noch nicht richtig aus dem Auto ausgestiegen ist. Die Tür ist offen, und Bernies Füße stehen auf dem Boden, aber sie sitzt immer noch auf dem Beifahrersitz und sieht ihren Mann durch den Spalt zwischen der Tür und dem rostfleckigen Holm des Skylark an. Sie blickt auf ihre Schuhe, dunkelblaue Dr.-Scholl-Sandalen, ein kleiner Luxus, den sie sich gegen Ende des sechsten Monats geleistet hat. Dann blickt sie zu dem dümpelnden Boot. Er weiß, dass sie rasch ihren Zustand und den des Boots gegeneinander abwägt. Sie sieht wieder ihren Mann an und wartet auf eine Erklärung.
Jay blickt über den Bayou. Kaum mehr als ein schmaler, schlammiger Wasserlauf ungefähr zehn Meter unter Straßenniveau; er schlängelt sich durch den Bauch der Stadt, von Westen kommend quer durch Downtown, dann weiter zum Ship Channel und zum Hafen, wo er in den Golf von Mexiko mündet. Seit Jahren ist die Rede davon, dass die »Bayou City« eine Flusspromenade braucht, wie die in San Antonio, nur größer natürlich und deshalb besser. Unzählige Stadtentwickler haben alle möglichen Pläne für Restaurants und Läden entlang des Buffalo Bayou vorgelegt. Das Amt für Stadtentwicklung hat an dem Abschnitt durch den Memorial Park sogar schon einen Fußgängerweg anlegen lassen. Weiter sind die Pläne für die Flusspromenade nie gediehen, und dieser gepflasterte Weg endet abrupt bei Allen’s Landing am nordwestlichen Rand von Downtown, da wo Jay jetzt steht. Bei Nacht ist die Gegend nahezu ausgestorben. Kultur findet ein Stück weiter südlich statt. Im Johnson and Lindy Cole Arts Center gibt es Konzerte, Restaurants und Bars um die Jones Hall und das Alley Theatre herum. Allen’s Landing selbst ist ein trostloser Anblick. An den Flussufern hat sich Unkraut und dichtes Gestrüpp breitgemacht und rankt sich an den Betonpfeilern der Main-Street-Überführung hoch, und abgesehen von einer schwachen gelben Glühbirne am Ende eines schmalen Holzpiers ist es stockfinster.
Vor sich das abgehalfterte Boot, über sich seine Stadt, spürt Jay, wie sich in seiner Kehle ein Kloß bildet, ein vertrautes Stechen im Nacken, das Gefühl, nie etwas auf die Reihe zu kriegen, wenn es um seine Frau geht. Wut durchzuckt ihn. Der Typ am Telefon hat ihn angelogen. Der Typ ist ein Lügner. Es tut gut, die Schuld abzuwälzen, sie jemand anderem in die Schuhe zu schieben. Aber wenn er ehrlich ist, stapeln sich auf seinem Schreibtisch die Akten zu fünfunddreißig unabgeschlossenen Fällen, bei mindestens zehn oder zwölf steht ein Gerichtstermin an, und er hat einfach keine Zeit gehabt, etwas anderes für Bernies Geburtstag zu planen. Und vor allem ist kein Geld da, seit Monaten nicht. Er wartet darauf, dass ein paar Schmerzensgeldforderungen wegen Ausrutschern und Stürzen was bringen, aber bis dahin kommt nichts rein. Also hat er die Gelegenheit genutzt, als ein Mandant, der ihm das Honorar in einer kleinen Nachlasssache schuldet, erzählte, sein Bruder oder Onkel oder wer auch immer biete Bootstouren auf dem Bayou an. Die Tour ist sein Honorar. Wie die Esstischgarnitur, an der Bernie und er jeden Abend essen. Wie das Auto seiner Frau, das seit April aufgebockt in Peteys Werkstatt steht. Angewidert schüttelt Jay den Kopf. Er arbeitet hart, hat zwei Uniabschlüsse und lebt immer noch von Almosen, führt ein Leben aus zweiter Hand. Wieder spürt er Wut hochsteigen und dahinter ihre hässliche Schwester, Scham.
Er verdrängt das Gefühl.
Wut ist das, was junge Männer antreibt, etwas, das er längst hinter sich hat.
In der Nähe des Bugs steht ein Mann. Er ist dünn, geht auf die siebzig zu und trägt eine schlecht sitzende Wrangler. Unter der Nylon-Baseballkappe mit dem von Dreck und Öl verschmierten Schriftzug BROTHERHOOD OF LONGSHOREMEN, LOCAL 116 ringeln sich graue Locken hervor. Er zieht an einer heruntergebrannten braunen Zigarette. Er nickt Jay zu und tippt an den Schirm seiner Kappe.
Jay greift nach der Hand seiner Frau.
»Auf das Ding steig ich nicht.« Sie will die Arme vor der Brust verschränken, um ihren Worten Nachdruck zu verleihen, aber ihr Bauch ist nicht mehr da, wo er mal war und wölbt sich noch weiter vor als letzte Woche. Er ist ihr im Weg. Ihre Arme reichen nicht mehr so weit.
»Komm schon«, sagt er. »Der Mann wartet.«
»Der ist mir egal.«
Jay zieht an ihrer Hand, spürt, dass sie ein kleines bisschen nachgibt. »Komm.«
Bernie pfeift leise durch die Zähne, kaum hörbar, aber Jay hört es und weiß sofort, was es bedeutet. Dass sie mit ihrer Geduld am Ende ist. Trotzdem nimmt sie seine Hand, rutscht bis an die Sitzkante und lässt sich beim Aussteigen helfen. Sobald sie sicher steht, greift Jay auf den Rücksitz, packt eine Schuhschachtel mit Kompakt- und Achtspurkassetten und klemmt sie sich unter den Arm. Aufmerksam verfolgt Bernie jede seiner Bewegungen. Jay nimmt ihren Arm und führt sie ans Ende des kleinen Stegs. Die Bretter knirschen und biegen sich unter ihrem Gewicht, mittlerweile schleppt die zierliche Bernie zusätzliche dreißig Pfund mit sich herum. Der alte Mann mit der Baseballkappe stellt einen Cowboystiefel auf eine morsche Holzplanke, die als Gangway zwischen Boot und Steg dient, und schnippt seine Zigarette über die Reling. Jay sieht sie ins Wasser fallen, das schwarz wie Öl ist. Es lässt sich unmöglich sagen, wie tief der Bayou ist, wie viel Meter es bis zum Grund sind. Jay drückt die Hand seiner Frau, zögert, sie diesem Alten zu überlassen, der Bernie eine Hand entgegenstreckt und darauf wartet, dass sie den ersten Schritt macht. »Sind Sie Jimmy?«, fragt er.
»Nee, Jimmy kommt nich.«
»Wer sind Sie?«
»Jimmys Cousin.«
Jay nickt, als hätte er nichts anderes erwartet, als wäre Jimmys Cousin zu sein eine ausreichende Qualifikation für einen Bootsführer, der einzige Ausweis, den man dafür brauchte. Er will nicht, dass Bernie etwas von seiner Beunruhigung mitbekommt. Er will nicht, dass sie schnurstracks zurück zum Auto marschiert. Der Alte nimmt Bernies Hand, hilft ihr fürsorglich an Bord und führt sie und Jay zur Kajütentür. Er bleibt dicht neben Bernie und passt auf, dass sie nicht stolpert oder ausrutscht, und Jay empfindet unwillkürlich Sympathie für Jimmys Cousin. Er deutet mit dem Kinn auf die Baseballkappe. »Bei der Gewerkschaft?«, fragt er. Der alte Mann wirft Jay einen raschen Blick zu, registriert dessen frisch rasiertes Gesicht, den gebügelten Anzug und die Lederschuhe, die glatten Hände ohne Kratzer oder Schwielen. »Was wissen Sie denn davon?«
Jay weiß eine Menge, viel mehr, als seine Kleidung verrät. Aber hier und jetzt will er keine Zeit mit dieser Frage verschwenden. Stattdessen konzentriert er sich auf den Boden vor ihm, weicht einer schmutzigen Pfütze aus, die sich unter dem im Kajütenfenster klemmenden Kasten der Klimaanlage ausgebreitet hat, und überlegt, wie leicht hier jemand ausrutschen und hinfallen könnte. Er geht dicht hinter seiner Frau, die am Eingang zur Kajüte stehen bleibt. Drinnen ist es dunkel, und sie wartet, dass Jay zuerst reingeht.
An ihr vorbei tritt er über die Schwelle.
Er kann Evelyns Parfüm riechen, das immer noch im Raum hängt – es hat eine rauchige, holzige Note, wie Sandelholz, wie die Seife, die Bernie zum Baden benutzte, bevor sie schwanger wurde und deren Geruch und jede Menge anderer Gerüche wie den von Benzin und Rühreiern nicht mehr ertrug. Der Duft verrät ihm, dass Evelyn hier gewesen ist, dass sie seine sorgfältigen Anweisungen befolgt hat. Er spürt eine Welle der Erleichterung, greift nach der Hand seiner Frau und zieht sie mit sich. Sie mag die Dunkelheit nicht, das weiß er, sie mag es nicht, wenn sie über etwas im Ungewissen gelassen wird. »Was ist das?«, flüstert sie.
Jay macht noch einen Schritt und tastet an der Wand nach einem Lichtschalter.
Als das Licht angeht, schnappt Bernie nach Luft und legt eine Hand auf die Brust.
In der Kajüte erwarten sie Ballons statt Blumen, Würstchen und Rinderbrust statt Filet und eine Kühlbox mit Bier und Traubenlimo statt Wein. Jay weiß, dass es nicht viel ist, nichts Besonderes, aber es hat trotzdem einen gewissen Charme. Er ist dankbar – für seine Frau, für diesen Abend, sogar für seine Schwägerin. Er hat Evelyn nur ungern um Hilfe gebeten. Mit Ausnahme von Bernie scheint niemand besser zu wissen, was Jay kann und was nicht, als Evelyn Annemarie Boykins. Zwei Wochen lang lag sie ihm mit der Frage in den Ohren, ob er dieses Mal ein besseres Geburtstagsgeschenk für ihre kleine Schwester habe als so was wie den Bademantel letztes Jahr, der ihn bei Foley’s fast dreißig Dollar gekostet hatte. Das heute Abend hätte er allein nicht hingekriegt, ohne dass Bernie etwas gemerkt hätte. Deshalb war er sehr froh über Evelyns Angebot, in der Scott Street was zu essen zu besorgen und ein paar Luftballons aufzublasen. Sie würde alles vorbereiten, sagte sie. In der Mitte des Raums ist ein Tisch für zwei gedeckt, mit einer Schokoladentorte mit weißen und gelben Zuckerrosen, genau so, wie Evelyn versprochen hat. Bernie mustert die Torte, die Luftballons und alles andere, und auf ihrem Gesicht breitet sich langsam ein Lächeln aus. Sie dreht sich zu ihrem Mann, stellt sich auf die Zehenspitzen und legt ihre Wange an seine. Sie beißt ihn ins Ohrläppchen, ein liebevoller kleiner Rüffel, eine Erinnerung daran, dass sie Geheimnisse nicht mag. Trotzdem flüstert sie anerkennend: »Das ist hübsch, Jay.«
Der Bootsmotor springt an. Jay spürt das Vibrieren in seinen Knien.
Sie starten zu einer langsamen Fahrt raus aus Downtown Richtung Osten, auf dem Kasten der Klimaanlage rollen und springen Wassertropfen hin und her. Der schwache feuchte Luftstrom, den sie erzeugt, würde nicht mal reichen, um ein Klo zu kühlen. Ein paar Grad mehr, und die Hitze in der Kajüte wäre nicht mehr auszuhalten. Jays Anzughemd ist jetzt schon durchgeschwitzt. Bernie lehnt sich gegen den Tisch, fächelt sich Luft zu und bittet ihn, ihr etwas zu trinken zu geben.
In der Ecke steht eine Kühlbox aus Styropor. Jay beugt sich hinunter und holt eine Dose Limo für Bernie und ein Bier für sich heraus. Er schnippt Eisbröckchen von den Aludeckeln und wischt mit dem Ärmel seiner Anzugjacke darüber, bevor er sie auszieht und über die Rückenlehne seines Stuhls hängt. Auf einem Kartentisch neben der Kühlbox steht eine Stereoanlage mit schwarzen Strippen und Verlängerungskabeln, die auf den Boden hängen. Jay schiebt sie mit dem Fuß zur Seite und denkt wieder, dass jemand stolpern, ausrutschen oder hinfallen könnte. Bernie übernimmt die Musikauswahl, kramt in Jays Schuhschachtel, übergeht das, was ihm gefällt – Sam Cooke und Otis, Wilson Pickett und Bobby Womack –, und sucht etwas nach ihrem Geschmack. Momentan steht sie auf Kool & the Gang. Cameo und die Gap Band. Rick James und Teena Marie. Sie legt eine Kassette von den Commodores ein, die Jay zumindest erträgt. »Just to be close to you …« Die Worte schweben durch den Raum. Jay beobachtet seine Frau, die sich mit ihrem Bauch unbeholfen zu der Musik wiegt, während ihre französischen Zöpfe im Takt hin und her schwingen. Er lächelt vor sich hin und denkt, dass alles, was er braucht, hier in dieser Kajüte ist. Seine Familie. Bernie und das Baby. Alles, was er hat.
Irgendwo gibt es noch eine Schwester.
Eine Mutter, mit der er nicht spricht.
Alte Freunde, denen er seit über zehn Jahren aus dem Weg geht. Seit seinem Prozess hat er nicht mehr mit seinen Kumpeln – seinen Weggefährten aus einer lange zurückliegenden Vergangenheit – gesprochen. Der Prozess, der ihn beinahe das Leben gekostet hätte. Der ihn überhaupt erst zum Jurastudium brachte. Danach ging er nicht mehr zu Treffen, erschien nicht auf Beerdigungen und reagierte nicht auf Anrufe, bis seine Freunde schließlich nicht mehr anriefen. Bis sie den Hinweis kapierten.
Er findet, dass er sich wirklich glücklich schätzen kann.
Viele seiner alten Freunde sind tot oder sitzen im Knast oder verstecken sich außer Landes, weil sie nicht mehr nach Hause kommen können. Aber Jay ist verschont geblieben. Um Haaresbreite, dank einer einzelnen Geschworenen: einer Frau und der einzigen Schwarzen auf der Geschworenenbank. Er weiß noch, dass sie ihm jeden Morgen bei Verhandlungsbeginn zulächelte, immer mit einem kleinen Nicken. Schon gut, sagte das Lächeln. Ich bin bei dir, Junge. Ich lass dich nicht fallen.
Nach dem Prozess, nachdem er sich selbst ins St. Joseph’s Hospital eingewiesen und wieder entlassen hatte, erfuhr er, dass diese Geschworene, sein Engel, Witwe war und in der Noble Street wohnte, in der Nähe von Bernies Kirche, vor der ihr Vater Reverend Boykins an jedem Verhandlungstag seine halbe Gemeinde in einen Bus geladen hatte. Hauptsächlich Frauen, die ihre besten Strümpfe, Pelzhüte und strassbesetzte Schmetterlingsbrillen trugen. Zwei Wochen lang fuhren sie jeden Morgen zum Gericht, weil sie gehört hatten, dass ein junger Mann in Schwierigkeiten steckte. Sie stellten keine Fragen, nahmen ihn einfach als einen der ihren an. Tag für Tag saßen sie da und hörten sich FBI-Aussagen an, darunter eine heimliche Tonbandaufnahme, die im totenstillen Gerichtssaal abgespielt wurde – der Mitschnitt eines hastigen Telefongesprächs, das Jay im Frühling 1970 geführt hatte.
Die Anklage lautete auf Anstiftung zum Aufruhr und Verschwörung zum Mord an einem FBI-Agent – so alt wie er und ein bezahlter Spitzel. Sie hatten Jay auf Band, wie er mit Stokely sprach, ein nicht mal dreieinhalbminütiges Telefonat, das sein Schicksal besiegelte. Jay, damals neunzehn, saß in einem geliehenen Anzug neben seinem Verteidiger und konnte vor Angst nicht klar denken. Der Pflichtverteidiger war ein junger Weißer und kaum älter als Jay. Er hörte nicht zu und sah Jay nur selten an. Stattdessen schob er einen gelben Notizblock und einen Bleistift über den Tisch. Wenn Jay etwas zu sagen hatte, sollte er es aufschreiben.
Er erinnert sich daran, dass er den Bleistift anstarrte und an seine Prüfungen dachte, ausgerechnet.
Es war sein Abschlussjahr an der Uni und er war in der Spanischprüfung durchgerasselt. Er saß neben seinem Verteidiger und überlegte, wie alt er sein würde, wenn er wieder rauskam, ob sie ihn zu zwei Jahren oder zu zwanzig verurteilen würden. Er versuchte, sich sein Leben im Gefängnis vorzustellen – jedes Weihnachten, jeden Kuss, jeden Atemzug. Dann teilte er dieses Leben in zwei Hälften, in vier Viertel, rechnete weiter und teilte es noch mal und noch mal, bis die einzelnen Teile klein genug für eine zwei mal drei Meter große Zelle im Walls in Huntsville waren. Aus welchem Blickwinkel er es auch betrachtete, eine Verurteilung kam einem Todesurteil gleich.
Er erinnert sich, dass er sich jeden Morgen im Gerichtssaal umsah und in kein einziges bekanntes Gesicht blickte. Seine Freunde hielten sich fern, als wären seine Verhaftung und die drohende Freiheitsstrafe ansteckend. Er fühlte sich erbärmlich, ihm war geradezu übel vor Scham, als er die Frauen aus der Kirche sah, Frauen, die er nicht einmal kannte und die jeden Tag kamen und die ersten zwei, drei Reihen der Zuschauerbänke füllten. Sie sprachen nicht, gaben nicht einen Mucks von sich. Sie waren einfach da, jedes Mal wenn er sich umdrehte.
Wir sind bei dir, Junge. Wir lassen dich nicht fallen.
Seine eigene Mutter erschien kein einziges Mal im Gerichtssaal, hatte ihn nicht einmal im Gefängnis besucht.
Damals kannte er Bernie und ihren Vater noch nicht, wusste nichts von der Kirche oder von Gott. Er war ein junger Mann voller Ideen, die schlicht und einfach waren, schwarz und weiß. Er hielt gern Reden über die bevorstehende Revolution, über den Kirchenneger, der nichts tat außer Reden schwingen, der nichts für die Sache tat … ein Wort, das zu oft ausgesprochen wurde, in zu viele Aufrufe eingebaut wurde, bis es für Jay jede Bedeutung verlor, bis es nur noch eine Worthülse war, eine Abkürzung, ein Lackmustest, auf welcher Seite man stand.
Nun ja, jetzt steht er auf keiner Seite mehr. Außer seiner eigenen.
Er ist zu dem Schluss gekommen, dass es andere amerikanische Träume gibt.
Einer davon ist natürlich Geld. Eine andere Form von Freiheit und scheinbar in Reichweite gerückt. Wenn er hart arbeitet, einen Anzug anzieht, sich an die neuen Regeln hält.
Mittlerweile sind seine Träume schlicht. Ein Zuhause, seine Frau, sein Kind.
Er sieht Bernadine zu, wie sie sich zur Musik bewegt, sich den Schweiß von der Stirn wischt und dabei ein paar einzelne schwarze Haare an ihrer bronzenen Haut kleben bleiben. Jay steht regungslos da, versunken in den Hüftschwung seiner Frau. Rechts, links, wieder rechts. Lächelnd beugt er sich zur Kühlbox, um ein zweites Bier herauszunehmen, spürt, wie sich das Boot unter seinen Füßen bewegt.
Eine Stunde später ist die Torte angeschnitten und vom Essen fast nichts mehr übrig. Jay und Bernie sind an Deck, um die heiße, feuchte Luft in der Kajüte gegen die heiße, feuchte Luft draußen zu tauschen. An Deck besteht wenigstens die Hoffnung auf eine gelegentliche Brise, während das Boot nach Westen tuckert. Bernie stützt sich mit den Unterarmen auf die Reling und hält das Gesicht in die schwüle Nachtluft. Jay reißt den Deckel einer Dose Coors auf. Das vierte, vielleicht auch das fünfte. Irgendwo beim Turning Basin, der einzigen Stelle zwischen Downtown und Hafen, wo ein Boot auf dem schmalen Bayou drehen kann, hat er den Überblick verloren. Inzwischen sind sie auf dem Rückweg nach Allen’s Landing, aber noch ein ganzes Stück von Downtown entfernt. Vom Heck aus sieht Jay die Lichter der Hochhäuser vor ihnen, allesamt überragt von der Hauptverwaltung von Cole Oil Industries. In der anderen Richtung blickt man auf den Hafen und den Ship Channel, auf beiden Seiten gesäumt von Ölraffinerien. Von hier aus sind die Raffinerien nichts als Ansammlungen blinkender Lichter und weißer Rauchwolken vor einem gewaltigen pechschwarzen Himmel und erheben sich am schimmernden Horizont wie Städte auf einem fernen Planeten.
Außer Wasser und Bäumen gibt es zwischen den Raffinerien und dem Zentrum von Houston nicht viel zu sehen, während das Boot eine Weile durch die nahezu undurchdringliche Finsternis fährt. Jay steht neben seiner Frau und folgt den Schatten, versucht, die Umrisse des Louisianamooses auszumachen, das von den verwitterten Eichen an den Ufern hängt. Er trinkt sein Bier aus und lässt die Dose auf das Deck fallen.
Gerade als sie zurück in die Kajüte gehen wollen, hören sie den Schrei, der im ersten Augenblick wie der einer Katze klingt, schrill und verzweifelt. Er kommt von der Nordseite des Bayou, irgendwo hoch über ihnen aus dem Dickicht der Bäume und Büsche am Ufer. Jay denkt an ein Tier, das sich im Gestrüpp verfangen hat. Doch dann hört er es erneut. Er sieht zu seiner Frau, die ebenfalls zwischen die Bäume späht. Aus dem engen Ruderhaus am Bug, in dem Steuerinstrumente und Armaturen untergebracht sind, taucht der alte Mann mit der Baseballkappe auf. »Was war das?«, fragt er und sieht Jay und Bernie an.
Jay schüttelt den Kopf, obwohl er es bereits weiß. Irgendwo tief in seinem Inneren weiß er es. Was er da gehört hat, war kein Tier. Das war eine Frau.
Der Alte verschwindet in der Kajüte. Ein paar Sekunden später verstummt die Musik, und dann folgt Stille, nur unterbrochen vom leisen Plätschern der Wellen, die gegen den Rumpf des Boots schlagen, während es langsam auf dem Bayou dahingleitet.
Der Alte tritt aus der Kajüte wieder an Deck. »Haben Sie das auch gehört?«
»Es kam von da drüben«, sagt Bernie und zeigt auf das Ufergestrüpp.
Jay versucht, hinter den Bäumen Gebäude zu erkennen, die ihm verraten, wo sie sind. Rasch überschlägt er die Entfernungen, um abzuschätzen, wie weit sie noch nach Downtown haben, wie lange sie schon wieder nach Westen gefahren sind. Aber in der Dunkelheit und mit einem vom Alkohol beeinträchtigten Zeitgefühl kann er nur raten. Sie dürften sich in der Nähe des Lockwood Drive befinden, in der Nähe des Fifth Ward. Von hier aus kann er einen Teil der Uhr an der Freedman’s National Bank sehen, die sich hinter den Bäumen erhebt. Es ist spät, kurz vor Mitternacht.
Er hat einige Fälle aus dem Fifth Ward vertreten. Eigentumsstreitigkeiten und Bagatelldiebstähle. Aber auch Schlägereien und Raubüberfälle und einen Jungen, der einen anderen niedergestochen hat, nur weil der seine Musik zu laut laufen ließ. Jay weiß, dass sie auf der Rückseite eines der rauesten Viertel der Stadt unterwegs sind.
Bernie dreht sich zu ihm um. »Da stimmt was nicht, Jay.«
Hinter ihnen ist erneut ein Schrei zu hören, genauer gesagt ein Aufheulen, ein Flehen.
Die Stimme einer Frau, die ganz deutlich ein Wort ausstößt: Hilfe.
Jay spürt ein leichtes Flattern in der Brust, als hätte er vor Schreck Schluckauf bekommen.
Bernie senkt die Stimme zu einem Flüstern. »Was zum Teufel ist da los?«
Der alte Mann verschwindet im Ruderhaus.
Ein paar Sekunden später taucht er mit einer Taschenlampe wieder auf. Bernie und Jay treten auf dem engen Deck zur Seite, damit er an ihnen vorbei zum Heck gehen kann. Er richtet den schwachen Lichtstrahl auf das Gebüsch am Nordufer des Bayou und ruft jemandem, den sie in der Dunkelheit nicht sehen können, zu: »Alles okay da drüben?«
Niemand antwortet. Der Alte leuchtet mit der Taschenlampe zwischen die Bäume. In gleichmäßigem, langsamem Tempo gleitet das Boot dahin und entfernt sie immer weiter von der Frau. Der Alte ruft erneut. »Hey … alles okay da drüben?«
Ein Schuss zerreißt die Stille.
Jays Herzschlag setzt aus, alles erstarrt. Das war’s, denkt er einen panikerfüllten Moment lang. Unwillkürlich blickt er an sich hinunter, ob er getroffen ist, eine alte Gewohnheit, ein Überbleibsel aus seinem anderen Leben, in dem ihn jede Fehlzündung in Angst und Schrecken versetzte.
Dann folgt ein zweiter Schuss. Wie ein Donnerschlag hallt er durch die Luft.
Dem Alten entweicht ein heiseres Stöhnen. »Gott steh uns bei.«
Bernie murmelt ein Gebet.
Jay packt sie bei der Hand, zieht sie zur Kajütentür, weg vom offenen Deck. Bernie reißt sich mit einer so kraftvollen, heftigen Bewegung los, dass sie auf dem glitschigen Deck ins Rutschen kommt. Sie hält sich an der Reling fest und dreht sich zu dem Alten. »Sir, ich denke, Sie sollten besser umdrehen.«
Der Alte starrt Bernie an, unsicher, ob sie das ernst meint. »Geht nicht«, sagt er an sie und Jay gerichtet. »Dafür ist’s viel zu eng hier. Nach dem Basin gibt’s bis Allen’s Landing keine Stelle mehr, wo ich umdrehen könnt.«
»Dann halten Sie das Boot an«, sagt Bernie.
Als der Alte einen raschen Blick zu Jay wirft, um klarzustellen, dass er von der Schwangeren keine Anweisungen entgegennimmt, die der Ehemann nicht abgenickt hat, wird Bernie wütend. »Halten Sie das Boot an«, wiederholt sie.
Schließlich gibt der Alte nach und setzt sich in Richtung Ruderhaus in Bewegung.
Jay packt ihn am Arm. »Nicht.«
»Da drüben steckt jemand in Schwierigkeiten, Jay!«
»Da drüben sind zwei Leute, B«, sagt er. »Die Frau und irgendwer oder irgendwas, vor dem sie wegläuft.« Er sieht einen Überfall vor sich oder eine Prügelei, ein streitendes Liebespaar oder etwas Schlimmeres … etwas sehr viel Schlimmeres.
»Misch dich nicht ein«, hört er sich selbst sagen.
Bernie starrt Jay an. »Was ist denn bloß los mit dir?« Ihre Stimme ist nur mehr ein Flüstern.
Ihre Enttäuschung trifft ihn, aber darum geht es jetzt nicht.
»Da drüben schießt jemand, B«, sagt er. »Auf diesem Boot sind nur ich und er …« Er zeigt auf die einzige andere einsatzfähige Person an Bord, ein Mann um die siebzig. »Und meine Frau«, fügt er hinzu und senkt ebenfalls die Stimme. Er sucht nach Argumenten. »Ich werde weder dich noch mich in Gefahr bringen, indem ich mich in was einmische, von dem wir keine Ahnung haben. Wir kennen diese Frau nicht, wir wissen nicht, in welche Schwierigkeiten sie uns vielleicht bringt«, sagt er und hört selbst den abstoßenden Zynismus in seiner Stimme, trotzdem muss er es sagen. Der älteste Trick der Welt, denkt er, eine Frau in Not. Das Mädchen mit der Reifenpanne am Straßenrand, dessen Freund im Gebüsch lauert, um sich auf einen zu stürzen, sobald man anhält, um zu helfen. »Misch dich einfach nicht ein«, sagt er.
Ein paar qualvolle Sekunden lang sieht Bernie ihn an, kneift die Augen zusammen, als würde sie ihn abschätzen, jemanden, den sie eigentlich gut zu kennen glaubt. »Mensch, Jay«, sagt sie schließlich mit einem Seufzen.
»Wir benachrichtigen die Polizei«, sagt er plötzlich entschlossen.
Das ist gut: sauber, einfach, vernünftig.
Der Alte steht verlegen da und schabt mit dem rechten Fuß über das Deck. »Wir haben keine Lizenz von der Stadt, um die Zeit mit dem Kahn rumzufahren.«
»Was?«, sagt Jay.
»O Gott«, murmelt Bernie.
»Rufen Sie die Polizei, Mann«, sagt Jay bestimmt.
Der Alte seufzt und geht zu einem ehemals weißen Telefon, das öl- und dreckverschmiert neben der Tür des Ruderhauses hängt. Er nimmt den Hörer, der wie ein Walkie-Talkie oder ein CB-Funkgerät aussieht. Er wählt, wartet, lauscht, angestrengt, wie es scheint. Jay und Bernie sehen zu, wie er ein paarmal auf die Tasten drückt. Als er nichts hört, knallt er den Hörer wieder auf die Gabel. Offenbar funktioniert das Telefon nicht.
»Jimmy, dieser Blödmann«, sagt er.
Erneut ertönt ein Schrei, näher dieses Mal.
Bernie reißt dem Alten die Taschenlampe aus der Hand und richtet den trüben weißen Lichtstrahl gerade rechtzeitig aufs Ufer, um eine Regung zwischen den Bäumen, eine Bewegung im Gebüsch einzufangen. Sie sehen, wie jemand fällt, über die steile Böschung stürzt, zwischen dem Gestrüpp und den Erhebungen im Boden hin und her geworfen wird. Der Körper rollt bis ans Ufer und dann … verschwindet er. Jay hört ein leises Platschen und ein saugendes Geräusch, als der Bayou den Körper verschluckt.
Dann … nichts mehr. Eine gefühlte Ewigkeit lang.
Bernie sieht Jay an. Tief in der Kehle spürt er seinen Herzschlag.
Gleich darauf kräuselt sich die Wasseroberfläche, und kleine Wellen breiten sich aus wie Arme, die sich zu einer Umarmung öffnen. »Da bewegt sich was«, murmelt der Alte.
Es blubbert und gurgelt. Etwas taucht auf.
Jay hört Wasser aufspritzen, dann einen heiseren Schrei, ein Ringen nach Luft.
Ohne um Erlaubnis zu fragen, stapft Bernie zum Ruderhaus. Der Alte macht Anstalten, sie aufzuhalten, besinnt sich dann anders. Bernie schafft es kaum, sich in den engen Raum zu quetschen. Sie muss an ihrem Bauch vorbeigreifen, um den Schlüssel zu packen, der aus dem Armaturenbrett ragt, und dreht ihn nach links.
Stotternd verstummt der Motor.
Keiner an Deck rührt sich, keiner sagt etwas.
Bernie und der alte Mann sehen Jay an.
Wortlos nimmt er mit einer raschen Bewegung die Uhr ab, aber nicht den Ehering, und dabei geht ihm durch den Kopf, dass dies einer der Momente ist, in denen das Mannsein, oder besser gesagt dessen einigermaßen überzeugende Verkörperung, die Oberhand über sein Urteilsvermögen gewinnt. Er ist nicht besonders kräftig, und im Lauf der Jahre hat sein Körper die Drahtigkeit verloren. Jay schleudert die Schuhe von sich, reißt das Hemd über dem kleinen Rettungsring um seine Mitte aus der Hose. Er will es sich über den Kopf ziehen, überlegt es sich dann aber anders. Unbeholfen klettert er auf die Reling, holt tief Luft, hält sie an und springt.
Das Wasser ist warm und bitter. Es ist überall, dringt in seinen Mund und Rachen, durch seine Kleidung. Unter der schwarzen Oberfläche ist der Bayou lebendig, zieht an ihm, zerrt an seinen Armen und Beinen. Er spürt, wie Zweige und Blätter und etwas, von dem er hofft, dass es Fische sind, seine Arme und Beine streifen. Er meint einen schwachen Lichtschein vom Boot her zu erkennen, aber seine Augen brennen, und er kann nicht klar sehen. Blind bewegt er sich durch die Finsternis, folgt dem Klang der Stimme, den Geräuschen.
Als seine Hände in etwas Strähniges greifen, das sich um seine Finger windet, weiß er, dass er sie gefunden hat, er hat ihre Haare in den Händen. Sie röchelt, spuckt, hustet. Er legt einen Arm um ihren Brustkorb und hält sie über Wasser, zieht sie. Er dreht den Kopf zum Boot, und das helle Licht blendet ihn und raubt ihm einen Moment lang die Orientierung. Er zieht und schwimmt und schwimmt und zieht, bis seine Beine brennen, bis seine Arme schwer werden, bis er sicher ist, dass sie beide ertrinken werden. Ein paar Meter vom Boot entfernt legt er noch einmal zu, zwingt sich über seine Grenzen hinaus. Als er die schmale Leiter am Heck des Boots erreicht, nimmt er alle Kraft zusammen, um die Frau hochzustemmen. Der alte Mann beugt sich über die Reling und hilft ihm, den erschöpften und erschlafften Körper an Deck zu hieven.
Vornübergebeugt steht Jay da, die Hände auf die Knie gestützt, und versucht, einen Atemzug an den anderen zu reihen, nicht ohnmächtig zu werden. Aus dem Augenwinkel kann er zum ersten Mal einen Blick auf die Frau werfen, die er durch den Bayou gezogen hat, der er gerade das Leben gerettet hat.
Sie ist weiß und schmutzig.
An ihrer Haut klebt schwarzer Dreck, an den Armen hängen halb verrottete Blätter. Sie steht unter Schock, zittert, starrt lauter schwarze Gesichter an, die ihrerseits sie anstarren. In der Kajüte ist es still bis auf das Summen der Klimaanlage am Fenster und das leise Platschen der Wassertropfen, die von ihren Körpern, ihrem und Jays, auf den Boden fallen.
»Ist er Ihnen gefolgt?«
Es ist seine erste Frage, noch bevor er sie nach ihrem Namen fragt, bevor er fragt, ob es ihr gut geht.
Sie kann oder will nicht sprechen. Sie sitzt auf der Kante eines Klappstuhls am Tisch, ihre Zähne klappern, über ihrem Kopf schweben völlig deplatziert blaue und gelbe Luftballons. Bernie, die auf dem anderen Stuhl sitzt, greift über den Tisch nach einem Stapel zerknitterter Papierservietten. Sie hält sie der triefenden Fremden hin. Aber die Frau will ihre Handtasche nicht lange genug loslassen, um eine zu nehmen.
»Alles in Ordnung mit Ihnen?«, fragt Bernie sanft.
Jays Blick gleitet über den Körper der Frau, ihre Arme, ihre Beine, ihr Gesicht.
Offenbar ist sie nicht angeschossen. Die Haut an ihrem Hals ist rot und geschwollen, aber er ist sich nicht sicher, ob er das war – als er sie im Wasser gepackt hat – oder jemand anderes. Davon abgesehen hat sie keinen Kratzer. Als sie merkt, dass Jay sie mustert, hebt sie den Kopf und umklammert die Handtasche noch fester, als würde sie halb damit rechnen, dass er sie ihr entreißt und damit abhaut. Er spürt, dass die weiße Frau Angst vor ihm hat. Er ignoriert die Beleidigung, drängt den aufsteigenden Ärger zurück, der ihm jetzt auch nicht weiterhilft.
»Wo ist er?«, fragt er.
Noch immer spricht sie nicht.
»Wo ist er?«, wiederholt Jay, lauter dieses Mal.
»Ich weiß es nicht«, sagt sie und öffnet damit zum ersten Mal den Mund. Sie hat eine melodische Stimme, auch wenn sie jetzt etwas rau klingt. »Ich bin weggerannt, ich bin einfach weggerannt.«
Jay, der an die Waffe denkt, die sich irgendwo in der Nähe befindet, dreht sich zu dem alten Mann mit der Baseballkappe. »Werfen Sie den Motor an«, fordert er ihn auf. »Sofort.«
Der Alte schiebt sich durch die Kajütentür, und ein paar Sekunden später hört Jay, wie der Motor anspringt. Er wendet sich wieder der Frau zu. »Was ist passiert?«
Sie senkt den Blick, ihr Gesicht rötet sich.
Offenbar schämt sie sich zu sehr, um ihm in die Augen zu sehen.
»Hat er Sie angegriffen?«
»Jay«, sagt Bernie leise. Sie sieht ihn an und schüttelt den Kopf, ein stummer Hinweis, dass die verängstigte und zitternde Frau womöglich nicht bereit ist, über das zu sprechen, was auch immer hinter den Bäumen geschehen ist, schon gar nicht in Anwesenheit eines Mannes. Jay nickt, hält sich zurück, lässt die Fremde jedoch nicht aus den Augen. Sie hat ihre Schuhe verloren, aber Schnitt und Stoff ihres Kleides lassen erkennen, dass es nicht billig war. Auch ein Ohrring fehlt. Der verbliebene ist rund und golden mit einem Diamanten in der Mitte. Sie trägt auch einen Diamantring – an der rechten Hand, nicht der linken –, dreimal so groß wie Bernies Stein. Die Handtasche, die sie keine Sekunde loslässt, ist mit lauter kleinen G bedruckt. Von einem italienischen Designer, wie Jay weiß, wie die, mit denen die Anwältinnen großer Versicherungen im Gerichtssaal erscheinen.
Den Blick abwechselnd auf ihre Kleidung und den Diamantring gerichtet, fragt Jay: »Wo waren Sie?«
»Verzeihung?«, sagt die Frau mit einem überraschten Unterton.
»Wo sind Sie hergekommen?«
Sie sieht ihn verständnislos an, als wüsste sie nicht, wie die Frage gemeint ist, aber in ihren braunen Augen sieht Jay Begreifen aufblitzen. Er ist sich sicher, dass sie genau weiß, worauf er hinauswill: Was hat eine Frau wie sie in einem Viertel wie diesem zu suchen, um Mitternacht, allein?
Sie wendet den Blick von Jay ab und dreht sich zu Bernie. »Gibt es hier eine Toilette, die ich benutzen kann?«
Bernie deutet auf eine Schwingtür auf der anderen Seite des Raums. Sie endet knapp über dem Boden und lässt abgesehen von einem kleinen handgeschriebenen Schild mit der Aufschrift BESETZT wenig Privatsphäre. Bernie hält ihr erneut die Papierservietten hin. Die Frau bewegt sich langsam und steif, so als wäre sie eine kaputte Puppe, die bei jeder heftigeren Bewegung ganz auseinanderbrechen könnte und durch bloßen Willen zusammengehalten wird. Und sie umklammert noch immer die Handtasche. Bernie streckt die Hand aus, um sie ihr abzunehmen und auf den Tisch zu legen. Die Geste lässt die Frau zusammenzucken, und sie stößt einen kleinen Protestschrei aus, in ihren Augen flackert Panik auf. Sofort lässt Bernie die Handtasche los, und sie rutscht der Frau vom Schoß. Alle sehen zu, wie sie zu Boden fällt und erstaunlich geräuschlos landet. Dabei geht sie auf, und es zeigt sich, dass sie leer ist. Es befindet sich nichts darin, kein Lippenstift, kein Streichholzheftchen, nicht einmal Haustürschlüssel oder ein paar Münzen. Wie die Schuhe und der Ohrring scheint der Inhalt der Handtasche im Bayou verloren gegangen zu sein. Verloren gegangen oder weggeworfen, denkt Jay, das Wort kommt ihm unvermittelt in den Sinn und nistet sich in seinem Hinterkopf ein, wie ein spitzer Stein im Schuh.
Bernie und die Frau bücken sich gleichzeitig nach der Handtasche.
»Nicht anfassen«, platzt Jay heraus. »Fass nichts an, B.«
Lass einfach die Finger davon, denkt er.
Die Frau hebt die Tasche auf. Sie steht auf, dreht ihnen den Rücken zu und geht in die Toilette. Jay hört, wie auf der anderen Seite ein Metallriegel einrastet. Der alte Mann lehnt inzwischen an der Kajütentür und raucht eine Zigarette, die er zwischen Daumen und Zeigefinger hält. Er deutet mit dem Kopf zu der Weißen, deren Füße unter der Tür zu sehen sind, dann sieht er Jay an und zuckt die Schultern. »Mehr is im Augenblick nich zu machen«, sagt er. »Außer sie nach Haus bringen, schätz ich.«
Jay beobachtet sie im Rückspiegel.
Mit geschlossenen Augen sitzt sie auf dem Rücksitz und dreht den Diamantring an ihrem Finger hin und her, betastet den funkelnden Stein, als wäre er ein Talisman oder ein Rosenkranz, etwas, das Glück bringt oder Erlösung verspricht. Sie sind nur noch ein paar Blocks von der Central Patrol Station entfernt. Schweigend fahren sie dahin, die Fremde auf dem Rücksitz des Buick Skylark und Bernie auf dem Beifahrersitz. Jay fährt konstant fünfzig, er will keine unnötige Aufmerksamkeit erregen. Er ist sich der Ironie bewusst, auf dem Weg zur Polizei Angst vor der Polizei zu haben. Aber eine fremde weiße Frau, deren Namen er nicht kennt, um diese Zeit in seinem Auto, in dieser Stadt, das macht ihn nervös und vorsichtig. Von sich aus hätte er ihr auch nicht angeboten, sie zu fahren, aber Bernie hat darauf bestanden. Sein Anzug ist noch nass und stinkt nach dem Bayou.
Vor dem Polizeigebäude ist niemand zu sehen, als er am Straßenrand hält.
Jay lässt den Motor laufen.
Die Central Patrol Station in Downtown ist in einem älteren Gebäude untergebracht, eine Seltenheit in einer Stadt mit der merkwürdigen Angewohnheit, ihre eigene Geschichte auszuradieren. Es wurde Mitte des Jahrhunderts erbaut, bevor die Stadt zur Boomtown wurde, bevor die explodierende Anzahl an Highways nach dem Krieg Benzin zur begehrtesten Ware im Land machte, vor 1973 und dem Embargo, vor der Krise, bevor das Erdöl Houston zu dem gemacht hat, was es heute ist.
»Sollen wir mit rein?«, fragt Bernie, das Gesicht ihrem Mann zugewandt.
Die Frau auf dem Rücksitz öffnet die Augen. Ihr Blick trifft sich im Rückspiegel mit dem von Jay. »Ab hier komme ich allein klar.« Ihre Stimme ist höflich, ruhig. »Vielen Dank.«
Sie steigt aus dem Auto und geht die ersten paar Stufen hoch, dann bleibt sie stehen. Vielleicht sammelt sie ihre Kräfte, denkt Jay, oder sie schindet Zeit.
»Meinst du, es geht ihr gut?«, fragt Bernie.
Jay legt den Gang ein, auf seiner Stirn bildet sich neuer Schweiß.
Allein der Gedanke, sich nachts in der Nähe einer Polizeiwache zu befinden, wie ein Straßenköter auszusehen und in die Probleme einer wildfremden weißen Frau verwickelt zu sein, macht ihn mehr als ein bisschen nervös. Er weiß aus Erfahrung, wie erfinderisch und mächtig die Gesetzesvertreter hier im Süden sind, er weiß, wann er am besten den Mund halten sollte.
Er verriegelt die Türen und fährt los, wirft einen letzten verstohlenen Blick in den Rückspiegel. Er sieht die Frau allein vor dem Polizeigebäude stehen und fragt sich, ob sie reingeht.
Kapitel 2
Am Montagmorgen kreuzt die Prostituierte mit einer Halskrause auf. Jay wirft nur einen Blick darauf und erklärt ihr, dass das Ding verschwinden muss. Mitten auf dem Flur fängt sie an, sie abzunehmen. »Nicht hier«, unterbricht er sie, ein weiteres Mal überrascht, dass man ihr wirklich alles sagen muss. Er schaut links und rechts den Flur hinunter und vergewissert sich, dass der gegnerische Anwalt nichts von den Vorbereitungen seiner Mandantin mitbekommen hat. Mit dem Kinn deutet er zur Damentoilette auf der anderen Seite. »Und passen Sie auf, dass niemand Sie sieht.«
Die Anhörung beginnt in drei Minuten, und bei diesem Richter sollten sie nicht zu spät kommen. Jay braucht alles an Wohlwollen und Gnade, was das Gericht zu gewähren bereit ist. In dieser Sache bewegt er sich auf dünnem Eis, und alle wissen das. Er fährt mit dem Finger über die Bügelfalte seiner Hose, die beste, die er besitzt, aus einer exklusiv für JCPenney hergestellten Polyestermischung. Dann streicht er sein Hemd unter dem Jackett glatt und hebt leicht die Arme, um die feuchten Flecken unter seinen Achseln zu begutachten. Ihm ist heiß und unwohl. Seit seinem Bad im Bayou Samstagnacht hat er Kopfschmerzen, ein dumpfes Pochen hinter den Ohren, ein nahezu konstanter quälender Schmerz, das nagende Gefühl, dass etwas nicht stimmt.
Es ist nur eine Anhörung, ruft er sich in Erinnerung. Bring Hicks einfach dazu, die Klage zuzulassen.
Er blickt auf die geschlossene Tür der Damentoilette und fragt sich, ob er seiner Mandantin jemanden hinterherschicken sollte.
Aber der Flur im dritten Stock ist praktisch leer.
Montagmorgens geht es beim Zivilgericht gemächlich zu. Hier fehlt es an der Konzentration oder der Zielstrebigkeit des Strafgerichts, wo es praktisch überall vor rechtschaffener Empörung knistert und selbst die banalste Bürotätigkeit von dem Gefühl durchdrungen ist, dass etwas Großes auf dem Spiel steht. Auf den Fluren begegnet man Mördern und Vergewaltigern, Betrüger und Diebe sind im Gebäude unterwegs, man sieht Handschellen und bewaffnete Polizisten. Dieses Schauspiel allein reicht, um den Eindruck zu erwecken, es gehe um die Verfolgung eines heroischen Ziels, oder zumindest um alle in aufgeregte Spannung zu versetzen. In einem Zivilgerichtssaal geht es dagegen nur um eins: Geld. Fragen nach richtig oder falsch, danach, wer wem was angetan hat, werden hier von jedem moralischen Aspekt befreit und auf eine mathematische Formel reduziert. Was ist dein Schmerz wert? Was ist der aktuelle Kurs von Trauer? Wenn es nicht gerade um das eigene Geld oder den eigenen Schmerz geht, fällt es schwer, größeres Interesse für die Verfahren aufzubringen, und sie ziehen auch nicht viele Zuschauer an. Der Gerichtssaal von Richter Hicks ist fast leer, als Jay ihn betritt, abgesehen vom Gerichtsdiener, der Protokollführerin und Charlie Luckman, der in einem cremefarbenen Anzug und braunen Krokodillederschuhen am Tisch der Verteidigung sitzt und als Einziger im Raum lächelt.
»Wo steckt denn Ihre Mandantin?«, fragt er Jay.
»Wo steckt denn Ihr Mandant?« Jay deutet mit dem Kopf auf den leeren Platz neben Luckman.
»Ich habe meinem Mandanten geraten, nicht zu erscheinen. Wir wollen diesem Antrag nicht mehr Gewicht verleihen, als ihm zukommt«, sagt Luckman und dreht den goldenen Ring am kleinen Finger seiner rechten Hand, direkt über dem dicken Knöchel. »Außerdem habe ich die Aussage des Polizisten«, fügt er hinzu und greift nach einer eidesstattlichen Versicherung, die neben seiner glänzenden ledernen Aktentasche auf dem Tisch liegt. »Ich habe meinem Mandanten gesagt, er soll die Anschuldigungen nicht durch seine Anwesenheit würdigen. Immerhin leistet Mr. Cummings wichtige Arbeit für die Gesellschaft.«
Jays Unterlagen stecken in einem ausgeleierten Akkordeonordner. Er legt ihn vor sich auf den Tisch. »Vielleicht hätte Ihr Mandant an seine gesellschaftliche Stellung oder auch an seine Frau denken sollen, bevor er eine Prostituierte in sein Auto einsteigen ließ.«
»Welche Prostituierte, Mr. Porter?«, fragt Luckman mit einem Zwinkern.
Die Tür zum Richterzimmer öffnet sich. Zuerst erscheint ein Justizbeamter, dann der Richter. Alle erheben sich. Jay dreht sich um und blickt über die Schulter. Seine Mandantin betritt gerade den Saal, die Halskrause für alle sichtbar in der rechten Hand. Während sie auf Jay zugeht, flüstert sie ziemlich laut, es sei verdammt schwierig gewesen, das Ding runterzubekommen. Jay schließt die Augen und holt tief Luft. Er ist als Erster dran.
Im Zeugenstand hat die Prostituierte einen Namen: Dana Moreland. Und einen neuen Beruf: Hostess. Sie spricht leise, mit einer einstudierten Verletzlichkeit, von der Jay weiß, dass sie sie an den Wochenenden geübt hat, so wie man einen neuen Tanzschritt für den Abschlussball lernt. Immerhin ist das ihr großer Auftritt, die Chance, ihre Geschichte so zu erzählen, wie die anderen sie hören sollen. Und die lautet: Eine Freundin hat sie mit Mr. Cummings zusammengebracht. (»Nein, Sir, er ist nicht im Gerichtssaal anwesend.« Jay möchte, dass das ins Protokoll aufgenommen wird.) Sie erklärte sich damit einverstanden, ihn auf dem Parkplatz eines Fischrestaurants im Norden der Stadt zu treffen. Sie einigten sich auf den Preis, und sie stieg in sein Auto. Dann bat sie ihr »Date«, mit ihr raus nach Pasadena ins Gilley’s zu fahren. Urban Cowboy hatte sie mindestens zehnmal gesehen und wollte dort tanzen, wo John Travolta und Debra Winger geheiratet hatten. Für eine Runde Line Dance und einen BJ war J. T. damit einverstanden. (»Einen ›BJ‹?«, fragt Jay, weil er es fragen muss. Sie beugt sich im Zeugenstand zum Mikrofon vor, als wollte sie es an Ort und Stelle vorführen. »Einen Blowjob«, erklärt sie.) Ihr »Date« fuhr mit ihr zwanzig, dreißig Meilen über die Stadtgrenze hinaus (»keine Kleinigkeit, der Sprit kostet teilweise einen Dollar fünfunddreißig die Gallone«). In dem Club amüsierten sie sich so prächtig, dass Mr. Cummings unvorsichtig wurde und ein oder zwei (»vielleicht waren es auch drei«) Long Islands zu viel trank, und auf dem Rückweg fuhr er Schlangenlinien. Sie bat ihn mehrmals anzuhalten. Aber er weigerte sich, er war ja gerade ihr Arbeitgeber. Irgendwo auf der Rückfahrt, berichtet Jays Mandantin, baute Mr. Cummings einen Unfall: Er fuhr gegen einen Telefonmast.
»Und wo befanden Sie sich zum Zeitpunkt des Unfalls?«
»In seinem Schritt.«
Die Protokollführerin hebt den Kopf. Der Gerichtsdiener grinst.
»Na ja, also … nur mein Kopf.«
Der Richter hüstelt kurz.
Jay schießt der Gedanke durch den Kopf, dass er sich zum Idioten macht mit seinem JCPenney-Anzug und seinem beschissenen Fall. Er hat die Geschichte schon ein Dutzend Mal gehört, und nie hat sie lächerlicher geklungen als in diesem Moment, wo Dana im Zeugenstand steht. Offen gestanden hat er nicht damit gerechnet, dass es so weit kommen würde. Er ist sicher gewesen, dass die Erwähnung von Ms. Morelands Namen und ihrem Beruf sowie die Behauptung einer wie auch immer gearteten Verbindung zu Mr. Cummings für eine umgehende außergerichtliche Einigung mit dem gegnerischen Anwalt reichen würden. Er hat sich tatsächlich eingebildet, die Angelegenheit wäre mit einem einzigen Telefonat erledigt. Aber da hat er Charlie Luckmans Neigung zum Zocken grob unterschätzt.
Jay wirft einen Blick auf seine Notizen. »Ein gewisser Officer Erikson kam zum Unfallort?«
»Ein State Trooper, ja.«
»Und als er Mr. Cummings hinter dem Lenkrad sah, betrunken, und Sie mit dem Kopf zwischen seinen Beinen eingeklemmt … was hat er da gemacht?«
»Nichts.«
»Nichts?«
»Er hat sich praktisch bei dem Kerl entschuldigt.«
»Und was haben Sie daraus geschlossen?«
»Dass er J. T. erkannt hat und ihn nicht in Schwierigkeiten bringen wollte.«
Jay wartet auf den Einspruch: »rein spekulativ«, »fehlende Grundlage«, »irrelevant« … irgendwas. Aber wie er mit einem raschen Blick aus dem Augenwinkel feststellt, hat Charlie Luckman sich auf seinem Stuhl zurückgelehnt und verfolgt das Geschehen wie eine Sportveranstaltung, die ihn nicht besonders interessiert.
»Er hat Ihnen keine medizinische Hilfe angeboten?«
»Nein, Sir.«
»Also wird sich das Ausmaß Ihrer Verletzungen in dieser Nacht vermutlich nicht genau feststellen lassen, weil Sie nicht sofort medizinische Hilfe erhielten?«
Erneut wartet er darauf: »Die Zeugin ist keine medizinische Expertin.«
Aber Luckman sagt nichts.
Er sieht einfach nur zu, wie Jay diese aussichtslose Sache weitertreibt, seine Mandantin durch den Rest ihrer Zeugenaussage dirigiert – eine Beschreibung ihrer Verletzungen, Schmerzen und Beschwerden und ungefähr eine Million Gründe, warum sie nicht zum Arzt gegangen ist. Jays letzte Frage: »Es war Mr. Cummings, der Ihren Kopf in seinen Schoß gedrückt hat, richtig?«
»Ich hab’s ganz sicher nicht meiner Gesundheit zuliebe getan.«
Inzwischen ist sie aus ihrer einstudierten Rolle gefallen. Die Verletzlichkeit ist verschwunden, dafür hat sich wieder Heiserkeit in ihre Stimme geschlichen. Jay kann sich plötzlich all die Schöße vorstellen, in denen sie schon den Kopf hatte, sieht ihre berufliche Karriere in Cinemascope vor sich.
»Keine weiteren Fragen, Euer Ehren.«
Luckman verzichtet auf ein Kreuzverhör. Stattdessen tritt er mit einem Stapel zusammengehefteter Blätter an den Richtertisch: die eidesstattliche Versicherung des Polizisten und der Polizeibericht. Der Richter liest schweigend, während alle warten. Die Protokollführerin inspiziert einen eingerissenen Nagel. Der Gerichtsdiener sieht auf die Uhr. Vom Flur her hört man Gummisohlen über das Linoleum quietschen und eine der Ansichten in einer Diskussion darüber, wo es den besten Seewolf gibt, bei Delfina in der Main Street oder bei Guido.
Endlich hebt Richter Hicks den Kopf und sieht Jay an.
»Der Polizist hat ihn wegen eines defekten Rücklichts angehalten.«
»Ja, Euer Ehren, aber –«
»Hier steht nichts von einem Unfall, kein Wort davon, dass Ms. Moreland sich überhaupt im Auto des Beschuldigten befand.«
»Euer Ehren«, sagt Luckman. »Die Verteidigung bittet das Gericht höflich darum, dem Antrag auf ein summarisches Urteil stattzugeben und alle Ansprüche abzuweisen.«
»Immer langsam, Counselor«, sagt der Richter.
Er wendet sich Jay zu, als wäre er sich nicht sicher, was der in dieser Situation von ihm erwartet. Jay räuspert sich. »Euer Ehren, wir bringen vor, dass Officer Erikson Mr. Cummings, Mitglied der Hafenkommission und früherer Stadtrat, nachdem er ihn in einer ›kompromittierenden‹ Situation überrascht hatte, lediglich eine Verwarnung wegen einer Ordnungswidrigkeit erteilte und bewusst ignorierte, dass Mr. Cummings betrunken war und sich in Begleitung einer Frau befand, die nicht seine Ehefrau war.«
»Sie behauptet also, dass der Officer ebenfalls das Gesetz gebrochen hat?«, fragt Luckman.
Der Richter hebt eine Hand, um Luckman zu bremsen. Jay fragt er: »Können Sie das beweisen?«
»Aus der Zeugenaussage von Ms. Moreland geht klar hervor –«
»Mein Mandant ist der Antragstellerin niemals begegnet, Euer Ehren«, unterbricht ihn Luckman.
Richter Hicks sieht Jay an. »Sie haben doch noch etwas anderes als die Frau, oder? Einen anderen Beweis? Einen Zeugen, irgendwas?«
»Ich arbeite daran.«
Richter Hicks stößt einen Seufzer aus, kurz und gepresst, als würde er nach einem schlechten Essen einen Wind fahren lassen, als hätten sie ihm alle miteinander den Vormittag versaut. Er blickt zwischen Charlie Luckman und Jay hin und her, dann ruft er den Verteidiger – er nennt ihn beim Vornamen – zu sich an den Richtertisch. Jay fragt sich, wie gut die beiden sich kennen. Luckman, inzwischen Mitte vierzig, war früher Staatsanwalt mit einem gewissen Renommee. In seinen besten Tagen wäre er zweimal fast zum Bezirksstaatsanwalt von Harris County gewählt worden, in der gleichen Zeit wurde er »Staatsanwalt des Jahres« und konnte eine nahezu perfekte Verurteilungsbilanz vorweisen. Als Strafverteidiger befindet er sich jetzt in der eigenartigen (und ziemlich einträglichen) Position, mit praktisch jedem Staatsanwalt und Richter im County auf freundschaftlichem Fuß zu stehen. Jay beobachtet die Männer, die am Richtertisch die Köpfe zusammenstecken, beide mit feisten Backen und sonnenverbrannten Gesichtern, als hätten sie das Wochenende auf dem Golfplatz verbracht – gemeinsam. Sie flüstern, wechseln Worte, die Jay nicht verstehen kann.
Die Prostituierte zieht ihn am Jackenärmel. »Worum geht’s hier eigentlich?«
Jay ignoriert sie.
Ein paar Sekunden später geht Luckman lächelnd zurück zu seinem Tisch.
Der Richter verschränkt die Finger, drückt die Handflächen aneinander. »Mr. Porter, ich muss Sie vermutlich nicht daran erinnern, dass Mr. Cummings ein angesehenes Mitglied unserer Gesellschaft ist. Falls das ein Erpressungsversuch sein soll …«
»Nein, Euer Ehren.«
»Und wenn ich einen Prozess zulasse, wenn ich einen Mann wie Mr. Cummings auf die Anklagebank bringe, dann sollten Sie ein bisschen mehr zu bieten haben als heute.«
»Ja, Sir.«
»Ich habe kein Interesse daran, die Zeit des Gerichts oder die von Mr. Cummings zu vergeuden.«
Der Richter blickt erneut auf die eidesstattliche Versicherung des Polizisten und den Polizeibericht. Dann hebt er den Kopf und sieht die Prostituierte neben Jay an. »Es steht ihr Wort gegen seins.«
»Das war bisher bei jedem meiner Prozesse so, Euer Ehren. Das Wort des einen gegen das des anderen.«
Der Richter starrt Jay eine gefühlte Ewigkeit an.
Schließlich nickt er und fällt eine Entscheidung. »Ich lasse die Klage zu.«
Am Tisch der Verteidigung räuspert sich Charlie Luckman ziemlich laut.
Der Richter erhebt sich und tut so, als hätte er es nicht gehört. Die Protokollführerin dehnt die Arme. Der Gerichtsdiener macht rasch einen Anruf. Die Prostituierte fragt Jay, ob er sie nach Hause fahren kann. Er sieht auf seine Uhr. Obwohl er den ganzen Tag noch nicht in der Kanzlei gewesen ist, erklärt er sich dazu bereit. Das wär’s jetzt, dass sie zu Fuß geht und ihrem Vorstrafenregister einen weiteren Eintrag hinzufügt, noch bevor der Prozess begonnen hat.
Auf dem Weg aus dem Gerichtssaal spürt er eine Hand auf seinem Rücken.
»Ich bewundere Ihre Standfestigkeit, Porter«, sagt Luckman und übertüncht jeden Missmut mit Charme. »Vielleicht können wir uns in dieser Sache ja noch irgendwie einigen.«
»Sprechen Sie mit Ihrem Mandanten«, sagt Jay, »und geben Sie mir Bescheid.«
Viel zu spät kommt er in die Kanzlei. In seinem Kopf pocht es, und in seinem Schreibtisch ist nichts außer einer alten Flasche Pepto-Bismol und einer Dose Lutschpastillen. Zum Mittagessen zieht er sich zwei Tüten Fritos aus einem Automaten in dem Einkaufszentrum, in dem sich seine Kanzlei befindet. Er isst sie allein am Schreibtisch.
Eddie Mae, seine Sekretärin, glänzt wieder mal durch Abwesenheit, dieses Mal hat sie eine Notiz hinterlassen, dass sie mit ihrem Enkel zum Zahnarzt muss. Jay ist mit den Telefonen auf sich gestellt.
Er spricht mit zwei potenziellen Mandanten.
Als Erstes mit einer Frau in den Siebzigern, die in der Obstabteilung eines Safeway-Supermarkts auf einer roten Weintraube ausgerutscht ist. Anfangs klingt es recht verheißungsvoll, bis er die Frau nach ihren bisherigen Erfahrungen mit der Justiz fragt. Es stellt sich heraus, dass sie in den vergangenen sechzehn Monaten bei Kroger auf einer Cantaloupe-Melone ausgerutscht ist, bei Walgreens auf Enthaarungscreme und in einer Waschanlage in der Griggs Road auf Seifenlauge. Als er ihr sagt, dass er ihren Fall nicht übernimmt, bezeichnet sie ihn als Dummkopf. »Ich hab sämtliche Prozesse gewonnen, Schätzchen, jeden einzelnen.«
Er wünschte, er könnte behaupten, dass es sich bei seiner Ablehnung um einen Akt juristischer Integrität handelt. Aber die Wahrheit ist, dass ihn der Fall mehr kosten würde, als er einbrächte, weil Safeway ein großer Konzern mit sehr viel Geld und einer Heerschar von Anwälten ist, einem für jeden Wochentag, wenn sie wollen. Mit Sicherheit würden sie die Sache mit Anhörungen, Anträgen und eidesstattlichen Erklärungen vom Filialleiter bis zum Highschool-Freund seiner Mandantin unendlich in die Länge ziehen. Als Einmannkanzlei hat Jay keine Zeit für etwas anderes außer sicheren Fällen.
Der zweite potenzielle Mandant, mit dem er redet, erscheint vielversprechender.
Der Mann kommt persönlich vorbei und sagt bitte und danke, als Jay ihm Kaffee anbietet. Er hat eine gute Geschichte. Es geht um ein Motel in der Nähe von Katy. Seine kleine Tochter liegt dort im Krankenhaus. Sie hat sich ein paar üble Schnittwunden durch zerbrochene Bierflaschen zugezogen, die jemand neben dem Pool des Motels liegen gelassen hatte. Der Manager hat angeboten, ihm den Zimmerpreis zu erlassen, aber sich geweigert, die Behandlungskosten zu übernehmen, und jetzt hat der Mann eine Krankenhausrechnung an der Backe, die mit jeder Sekunde höher wird, und kein Geld, um sie zu bezahlen. Er hat seine Tochter zusammen mit seiner Frau im Krankenhaus zurückgelassen, weil er nicht wusste, was er sonst tun sollte. »Meine Chancen stehen gut, das weiß ich«, sagt er. »Aber im Augenblick will ich einfach nur meine Kleine heimholen.«
Jay legt seinen Stift auf den Schreibtisch. Er ist dabei.
»Ich brauch bloß ein bisschen Geld«, setzt der Mann an. »Ich zahl’s Ihnen zurück, das schwör ich. Oder Sie ziehen’s mir vom Schmerzensgeld ab, wenn wir gewonnen haben.«
Jay steht auf und zeigt ihm die Tür.
Die Prostituierte ist der einzige helle Streifen am Horizont.
Er versucht sein Glück mit zwei Telefonnummern, die Ms. Moreland auf die Rückseite einer Tankquittung gekritzelt hat und unter denen er vielleicht die Freundin erreicht, die das Treffen zwischen seiner Mandantin und J. T. Cummings arrangiert hat. Sonst fällt ihr niemand ein, der ihre Geschichte bestätigen kann. Die erste Nummer ist abgeschaltet. Unter der anderen meldet sich eine Mexikanerin, die der Stimme nach um die achtzig ist. Sie hat noch nie von Dana Moreland gehört. Jay legt Eddie Mae eine Notiz auf den Schreibtisch: Sie müssen die Zeugin finden.
Er kommt spät nach Hause, nach acht. Bernie liegt schon im Bett und schnarcht.
Auf dem Herd hat sie einen Teller mit Essen für ihn stehen lassen. Jay nimmt seine Krawatte ab und isst am Küchentisch. Danach spült er Teller und Gabel ab und lässt beides zum Trocknen im Abtropfgestell. Er will ein bisschen aufräumen, um sich nützlich zu fühlen, aber Bernie hat bereits Töpfe und Pfannen gespült und die Arbeitsfläche abgewischt. Also nimmt er sich den Kühlschrank vor und entsorgt die Reste von Bernies Geburtstagsessen vor zwei Tagen: gegrilltes Fleisch, inzwischen trocken und zäh, und alter Kartoffelsalat. Von dem Bier trinkt er eine Dose im Stehen vor der offenen Kühlschranktür. Er rülpst und greift nach einer zweiten Dose, um die anhaltenden Kopfschmerzen zu betäuben. Er trinkt sie über die Stereoanlage gebeugt, während er langsam seine LPs durchgeht. Er entscheidet sich für eine von Otis, seine Lieblingsplatte, und setzt die Nadel beim fünften Track auf.
I want security, yeah, and I want it at any cost.
Schließlich geht er mit der Post, den bisher geflissentlich übersehenen Rechnungen, dem Taschenrechner und seinem Scheckbuch zum Sofa. Er gibt die Zahlen ein, zweimal, dreimal, aber er kommt nicht hin. Er sortiert die Rechnungen noch mal danach, welche sofort bezahlt werden müssen und welche warten können. Was übrig bleibt, reicht kaum für zwei, geschweige denn für eine zukünftige Familie. Er sieht sich in der kleinen Zweizimmerwohnung um, die mit einem Sammelsurium an Möbeln, juristischen Fachbüchern und geborgten Babysachen vollgestopft ist, und denkt sorgenvoll, dass sie niemals hier rauskommen werden. Ans Sofa gelehnt, seine Finanzen auf dem abgetretenen Teppich ausgebreitet, geht er im Kopf seine Fälle durch, die Akten auf seinem Schreibtisch, als wären sie Lottozahlen, und versucht zu entscheiden, auf welche er setzen soll, wofür er Zeit und Geld aufwenden soll.
Es ist ein Spiel für ihn geworden, ein Glücksspiel.
So war es nicht von Anfang an. Bei einem seiner ersten Fälle nach dem Jurastudium ging es um eine Klage gegen die Stadt wegen Polizeigewalt. Angeblich hatte ein junger Polizist einen schwarzen Sechzehnjährigen verprügelt, der nervös nach seinem Führerschein kramte. So wie der Junge es erzählte, hatte der Cop ihn aus dem Auto gezerrt, beschimpft und auf den Boden geworfen, und zwar so heftig, dass er Blutergüsse davontrug und eine deutlich sichtbare Narbe zurückbehielt. Jay übernahm den Fall pro bono und ging auf Konfrontation mit dem Anwalt der Stadt, einem Weißen, der ihm mindestens zehn Jahre Prozesserfahrung voraushatte. Aber Jay hatte sich sein Leben lang auf diesen Prozess vorbereitet. Seine eigenen Konflikte mit dem Gesetz waren ihm noch gut in Erinnerung. Er wusste, wie es war, am Tisch der Verteidigung zu sitzen, erinnerte sich, wie es sich anfühlte, wenn die grundlegendsten Bürgerrechte zur Debatte standen. Damals hatte er die Wut noch nicht überwunden. Und er ließ sich von ihr leiten. Gnadenlos setzte er dem jungen Polizisten zu, ließ den armen Kerl für alles geradestehen, was mit einem Land und einer Regierung, die das Gesetz willkürlich anwandten, nicht stimmte. Während seines Schlussplädoyers nickte die Hälfte der Geschworenen bei jedem Wort, das er sagte, und Jay gewann.
Aber es war ein moralischer Sieg, kein finanzieller. Was von der bescheidenen Abfindung der Stadt für ihn abfiel, reichte nicht mal, um die Unkosten zu decken oder den Verlust auszugleichen, der ihm durch die Vernachlässigung seiner anderen Fälle während des Prozesses entstanden war. Der Auftritt im Gerichtssaal brachte seinen Namen in die Zeitung, zum zweiten Mal in seinem Leben, und ehe er sichs versah, standen die Leute bei ihm Schlange und baten um Hilfe. Sie hatten gehört, dass er den Fall des Jungen ohne Bezahlung übernommen hatte, und wollten wissen, was er für sie tun könnte. Ihre Probleme waren nichts Besonderes, es gab sie in jedem schwarzen Viertel im Land: ein Sohn im Gefängnis, ein Cousin, der gefeuert worden war, oder ein Ex-Mann, der mit dem Kindesunterhalt in Verzug war. Nie hatten sie Geld, und Jay konnte kaum die eigene Miete zahlen. Als Anwalt zu arbeiten war das Gleiche, wie einen anderen kleinen Betrieb zu führen, wie er bald feststellte. An den meisten Tagen versucht er nur, seine Fixkosten zu decken: Versicherungen und Anmeldegebühren, Eddie Maes mageres Gehalt plus 500 Dollar Miete im Monat für das möblierte Büro in der West Gray Street.
Prinzipien kann er sich eigentlich nicht leisten.
Er braucht etwas Gewinnbringendes, den Jackpot.
Und wenn der in Form einer Prostituierten mit Nackenschmerzen daherkommt, dann ist es eben so.