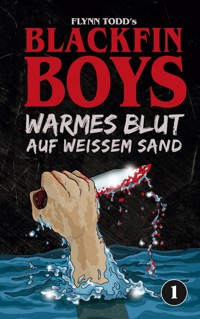
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Blackfin Boys
- Sprache: Deutsch
Mit Mut und Geschick gegen schreckliche Bedrohungen - begleite die Blackfin Boys auf ihrer gefährlichen Rettungsmission! Über vierzig Stunden treiben die Teenager Toby, Roland und Mark hilflos und völlig erschöpft auf einer Rettungsinsel auf dem offenen Meer. Wie von Geisterhand gesteuert, landet das schlauchbootähnliche Gefährt auf einer einsamen Insel. Der dortige Süßwassersee und einige Früchte retten die Jungen vor dem Verhungern. Als die drei Gestrandeten die tropische Insel erkunden, stoßen sie auf eine entstellte Leiche im Skianzug. Mit List und Taktik, aber auch mit Harpune, Messer und Pistole machen sich die Jungs daran, dem Grauen auf den Grund zu gehen ... Dies ist der packende 1. Band der Mystery-Abenteuer-Reihe! Die Blackfin Boys sind vier Jungs im Alter von 16 bis 19 Jahren, die mit ihrem gutmütigen Rottweiler immer wieder in gefährliche Abenteuer verwickelt werden. Die unzertrennlichen Freunde sehen sich oft mit paranormalen Bedrohungen konfrontiert, die sie nur als Team bewältigen können. Ihr Überleben hängt von ihrer einfallsreichen Zusammenarbeit ab. Ihre Gegner versuchen immer wieder, sie auszuschalten, aber mit viel Geschick, List und ein paar Waffen gelingt es ihnen, die Oberhand zu behalten. Das ist nicht immer garantiert, aber eines ist so sicher wie das Amen in der Kirche: Die Jungs sind füreinander da. Ausnahmslos. Ihre Abenteuer führen sie in ferne Länder: Ob auf einer tropischen Insel, im Schwarzwald, an der Küste Israels, im peruanischen Amazonas-Regenwald, im Bermuda-Dreieck, selbst in der Antarktis kämpfen sie gegen skrupellose Wissenschaftler, Dämonen, mysteriöse Erscheinungen, okkult fanatische Nazis, Tierquäler, Mörder, Grabräuber und Zombies (die, die schneller laufen können). Selbst im Reich der Toten haben die Jungs wichtige Dinge zu klären.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BESTEN DANK AN
Saskia Römer
fürs Ordnen, Lektorieren und Zurechtrücken.
Dylan O’Brien
für den (entscheidenden) kreativen Schlag ins Gesicht.
Sehen Sie seine Filme!
www.dylanobrien.de
Swen Marcel Illustration
für das wahnsinnig schöne Titelbild.
Besuchen Sie auch
www.swenmarcel.de
Inhaltsverzeichnis
KAPITEL 1 – HILFLOS
KAPITEL 2 – GESTRANDET
KAPITEL 3 – EXPEDITION INS UNGEWISSE
KAPITEL 4 – EIN NEUER VERBÜNDETER
KAPITEL 5 – AUSGELIEFERT
KAPITEL 6 – NEUE ERKENNTNISSE
KAPITEL 7 – EINER KOMMT, EINER GEHT
KAPITEL 8 – DIE FLUT
KAPITEL 1 – HILFLOS
Toby war bleich im Gesicht. Seine haselnussbraunen Augen umrandet von einer finsteren Leere, übergab er sich praktisch im Minutentakt. Durch seine nassgeschwitzten dunkelbraunen Haare sah er noch bleicher aus, als er es ohnehin schon war. Die vielen kleinen Leberflecke auf seiner Haut wirkten dadurch besonders dunkel, fast schwarz. Quälende Krämpfe ließen seinen Körper nur noch wenige Tropfen Galle absondern. Kein Wunder, denn Toby hatte vor über vierzig Stunden die letzte feste Nahrung zu sich genommen. Doch seine Übelkeit ließ einfach nicht nach.
Der unruhige Seegang ließ die kleine, frei treibende, sechseckige Rettungsinsel nicht zur Ruhe kommen. Die Wellen waren nicht hoch und auch nicht bedrohlich, reichten aber aus, um das schlauchbootartige Gefährt, auf das sich Toby und seine Freunde gerettet hatten, im Einklang mit den Wellen unangenehm auf- und abzusenken. Toby versuchte verzweifelt, das Gute an dieser Situation zu sehen. Das Wetter war schön – nicht eine Wolke am Himmel ‒, die Sonne schien warm und freundlich. Der angenehme Geruch der Meeresluft erinnerte ihn an seinen letzten Badeurlaub, der fast ein Jahr zurücklag.
Toby hielt sich an dieser Erinnerung fest, denn er merkte schnell, dass sie Balsam für seine Seele war. Er schloss die Augen und sah, wie er mit seinen Freunden im flachen Wasser in Strandnähe tobte. Sie versuchten, sich gegenseitig unterzutauchen und lachten laut. Sorglos und ausgelassen. Toby wusste noch genau, wie kaputt und müde er nach diesen Tobereien gewesen war. Er und seine Freunde hatten sich nach ihren kräftezehrenden Wasserschlachten durch die schweren Wassermassen des Meeres zurück zum Strand geschleppt, um der nächstgelegenen Pommesbude einen Besuch abzustatten. Eine extragroße Pommes mit Majo und dazu eine eiskalte, prickelnde Cola. Das bestellten sie sich. Jedes Mal, wenn Toby mit seinen Freunden auf ihren Fahrrädern zum Baden an den Strand fuhren, gab es Pommes und Cola. Toby wünschte sich sehnlichst, jetzt dort zu sein.
Aber er fühlte sich, als hätte er gerade eine mehrstündige Operation hinter sich und würde in diesem Moment aus der Narkose erwachen. Keine leckeren Pommes und keine erfrischende Cola, nur das scheinbar endlose Blau des Ozeans. Die Situation schien Toby hoffnungslos. Er dachte daran, dass er vielleicht nie wieder Essen und Trinken bekommen, dass er und seine Freunde hier verdursten würden. Dass er einen fetten Sonnenbrand im Nacken und an den Unterarmen hatte, nahm er kaum wahr. Längst hatte er sich an den stechenden Schmerz gewöhnt, der die ganze Zeit da war.
Der drahtige, ein Meter achtzig lange Körper des Neunzehnjährigen war ausgedorrt und er fühlte sich zu schwach, um seine Position zu verändern. Zu schwach, sich einfach nur umzudrehen, um seine verbrannte Haut vor der Sonne zu verstecken.
Toby drehte seinen Kopf ein wenig zur Seite. Undeutlich und verschwommen sah er die zwei atmenden, aber regungslosen Körper seiner besten Freunde neben sich. Da war zum einen Roland – achtzehn Jahre alt. Er lag ausgestreckt am Boden, sein Kopf ruhte auf seinen kräftigen Oberarmen. Roland lief praktisch jeden Tag ins Fitnessstudio, um Gewichte zu stemmen. Er war ein gutmütiger Typ mit einem ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit. Seine kurzen blonden Haare sahen aus, als wären sie eben gerade erst geschnitten worden. Aufgrund seiner stattlichen Größe von 1,92 Metern wurde er auch liebevoll der sanfte Riese von seinen Freunden genannt. So kräftig, so athletisch – und jetzt doch so hilflos wie Toby selbst.
Dicht neben Roland lag Mark, ein kleiner, schmächtiger Jugendlicher. Er war erst sechzehn Jahre alt, aber bereits die rechte Hand seines Vaters in dessen Flugzeugbetrieb. Die Firma transportierte überwiegend Spenderorgane per Flugzeug und Hubschrauber. Mark machte die beißende Sonne aufgrund seiner hellen Haut besonders zu schaffen. Dass er von seinen Freunden stets Kleiner gerufen wurde, lag eher an seinem manchmal etwas kindlichen Auftreten als an seinem Alter. Seine Augenbrauen waren außergewöhnlich dunkel, seine Augen leuchtend blau, groß und aufgeschlossen. Man hatte ständig das Gefühl, ihn beschützen zu müssen. Seine dichten hellbraunen Haare wehten im Wind wie ein Kornfeld, über das ein tief fliegendes Flugzeug hinwegzog. Bekleidet waren die Jungs nur mit kurzen, knielangen Hosen und T-Shirts. Wenn man die beiden da so liegen sah, hätte man annehmen können, dass der kleine Mark einfach nur Schutz und Geborgenheit bei seinem großen Freund Roland suchte. Toby schmunzelte leicht bei dieser Vorstellung, denn Roland und Mark waren meist unterschiedlicher Meinung und stritten ziemlich oft, egal um was es ging. Doch jetzt schienen sie ausnahmsweise einmal das gleiche Ziel zu haben – einfach nur schlafen und hoffen, dass sie irgendjemand aus dieser scheinbar ausweglosen Situation rettete.
Erneut verließ auch Toby die Kraft, die Augen offenzuhalten. Er fiel in einen unruhigen Schlaf. Die grell gelbe Rettungsinsel, die für maximal acht Personen ausgelegt war, bot den Jungs eine bequeme und vorerst sichere Schlafstätte. Das Meer hatte sich weitgehend beruhigt. Das heftige Auf und Ab war von jetzt kaum noch wahrnehmbaren Bewegungen der unendlich weiten Wassermassen abgelöst worden.
„Schlafe ich und träume, oder bin ich wach?“, fragte sich Toby. „Ich kann keinen Unterschied feststellen. Gibt es nur noch zwei Farben auf der Welt? Nur noch blau und gelb? Das Meer ist blau, und ich liege auf einer gelben, mit Luft gefüllten, ziemlich dicken Folie – wie abgefahren.“ Tobys Mundwinkel hoben sich, er lachte schwach in sich hinein. „Vielleicht werde ich auch einfach nur verrückt.“
Ein wahnsinnig lauter Donnerschlag riss Toby, Roland und Mark innerhalb einer Sekunde aus dem Schlaf. Sie richteten sich auf, als hätten sie einen Elektroschock erlitten, und sahen sich mit weit aufgerissenen Augen gegenseitig an. Doch schnell machte sich auf ihren Gesichtern Erleichterung breit, denn es begann heftig zu regnen.
„Los, sucht nach irgendwelchen Behältern!“, schrie Toby seine Leidensgenossen an. „Wir müssen so viel Wasser sammeln, wie es nur geht!“
„Gute Idee, fangt schon mal an“, sagte Roland, der instinktiv seinen Mund öffnete, um das kühle Nass aufzufangen. Toby und Mark konnten der Versuchung ebenfalls nicht widerstehen und reckten ihre offenen Münder in den Himmel. Gleichzeitig hielten alle drei ihre Hände auf, um zusätzliches Wasser zu schöpfen. Wie sie so dastanden, sahen sie aus, als würden sie eine Gottheit anbeten – in T-Shirts und knielangen Badeshorts auf einer schwankenden Gummiinsel.
„Das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich über ganz stinknormales Wasser freue! Danke da oben!“, schrie Roland in den Himmel.
Auch Mark war erleichtert. „Geht mir genauso, ich erkläre H2O hiermit offiziell zu meinem zweitliebsten Getränk.“
Toby und Roland drehten gleichzeitig ihre Köpfe zu Mark und warfen ihm einen ungläubigen Blick zu.
„Was? Man wird ja wohl noch Bier bevorzugen dürfen?!“
„Los jetzt, solange es noch regnet – sucht endlich was zum Auffangen“, trieb Toby seine Freunde an.
Hektisch durchsuchten die drei Jungs die Rettungsinsel und wurden in einer kleinen Seitenklappe, die mit einem roten Kreuz gekennzeichnet war, fündig. Roland riss den erbeuteten Erste-Hilfe-Koffer so energisch auf, dass durch den Ruck sämtliche Utensilien auf der gesamten Oberfläche der Rettungsinsel verteilt wurden.
„Ups – mein Fehler.“
Ein Haufen Verbandsmaterial, Pflaster, Desinfektionsspray und eine Signalpistole lag zu ihren Füßen – aber keiner dieser Gegenstände eignete sich für das Auffangen von Regenwasser. Enttäuscht sahen sich die drei Jungs gegenseitig an. Sie ließen sich auf ihre Hintern sinken, die Beine nach vorn ausgestreckt, und stützten ihr Gewicht schwerfällig hinterrücks auf ihren Händen ab. Sie machten den Eindruck, eine Schlacht gegen einen unbesiegbaren Gegner verloren zu haben.
„Mann, sind wir blöd, lasst uns doch den Koffer als Auffangschale benutzen“, rief Mark plötzlich.
Diese Lösung schien tatsächlich die beste zu sein ‒ und die einzige. Mark griff nach dem stabilen Plastikkoffer und legte ihn geöffnet in die Mitte der Rettungsinsel. Es dauerte nicht lange, bis der starke Regen das zweckentfremdete Behältnis zu füllen begann. Gleichzeitig schöpften sie, wie von der Tarantel gestochen, mit ihren sonnenverbrannten Händen Wasser aus der Kofferschale und tranken, als gäbe es kein Morgen. Für ihre ausgedorrten Körper war es die reinste Wohltat. Obwohl es warmer Regen war, der auf sie herabfiel, fühlten sich die Jungs in diesem Moment wie im kühlen, flüssigen Himmel.
Es war schon ziemlich merkwürdig, dass es so stark regnete und gleichzeitig die Sonne schien. Die Tropfen waren überdurchschnittlich groß und verursachten einen Riesenlärm, als sie auf die prall aufgepumpte Rettungsinsel fielen. Es sah sogar so aus, als würde sich keine einzige Wolke am Himmel befinden. Aber all das fiel Toby, Roland und Mark überhaupt nicht auf, sie genossen in diesem Moment einfach nur ihr Dasein, lagen entspannt nebeneinander auf dem Rücken und gaben sich dem angenehm warmen Regen hin. Sie waren zufrieden. In diesem Augenblick.
Der Regen ließ allmählich nach, und umso weniger Tropfen vom klaren Himmel fielen, desto heißer wurden sie. Es schien beinahe, als würden die Tropfen in der Luft verdampfen. Schlagartig war es vorbei mit der Ruhe und Entspannung, die Jungs versuchten hektisch, ihre Haut vor den heißen Regentropfen zu schützen.
„Was zur Hölle ist das?“, schrie Toby.
„Viel wichtiger finde ich die Frage, wann das wieder aufhört!“, entgegnete Roland mit schmerzverzerrtem Gesicht.
Mark hingegen setzte sich auf einmal völlig ruhig und entspannt auf den wabbeligen Boden der Rettungsinsel und brabbelte leise unverständliche Worte vor sich hin. Doch bevor Toby und Roland dieses merkwürdige Verhalten deuten konnten, wurde ihre Rettungsinsel von einer starken Strömung erfasst. Mit erstaunlichem Tempo schoss ihr Gefährt vorwärts. Durch die plötzlich aufkommende Fahrt verloren die Jungs ihr Gleichgewicht. Sie drohten, ins Wasser zu fallen, und versuchten hektisch, sich irgendwo festzuhalten. Die Geschwindigkeit blieb konstant hoch, als würden sie von etwas gezogen.
Mark rief: „Das sind bestimmt zehn Knoten, mit denen wir hier lang düsen.“
Seine Feststellung blieb unkommentiert – zu groß war die Anspannung, um überhaupt zu sprechen. Durch die sechseckige Form peitschte die Rettungsinsel eine Menge Wasser vor sich in die Luft. Sie war eigentlich nur für das Treiben auf dem Wasser konstruiert und nicht für eine so hohe Geschwindigkeit. In weiter Ferne sahen die drei Jungs etwas auf sich zukommen. Ein Schiff? Aufgrund der anhaltenden Geschwindigkeit von ungefähr zwanzig km/h wurde schnell klar: Das war etwas Größeres, Land! Vielleicht eine Insel? Es waren noch gute fünfhundert Meter, bis Toby, Roland und Mark den Sandstrand erreichen würden. Die Euphorie der Jungs war grenzenlos, endlich würden sie wieder festen Boden unter ihren Füßen haben. Sie sahen einander erleichtert an und lachten laut.
Plötzlich verlor ihr Gefährt an Fahrt und wurde langsamer – bis sie schließlich wieder langsam Richtung Meer hinaustrieben.
„Los, alle ins Wasser, den Rest schwimmen wir“, rief Toby seinen Kumpanen zu.
Sofort sprangen die Jungs ins Wasser und schwammen in Richtung des Strandes. Es waren noch ungefähr dreihundertfünfzig Meter.
„Ob es hier wohl Haie gibt?“, fragte Mark ängstlich.
Toby antwortete: „Das werden wir schon merken.“
„Hört auf zu quatschen und spart euren Atem, wir haben noch mindestens dreihundert Meter vor uns“, befahl Roland energisch.
Die Aussicht war jetzt schon wunderschön, geradezu märchenhaft. Der Sand war weiß, und die Blätter der Palmen glänzten in der Sonne in einem kräftigen Grün. Das Wasser unter ihnen war klar wie Leitungswasser und angenehm warm, es schimmerte in einem satten Türkis. Dies schien das Paradies zu sein. Das Einzige, das diesen überwältigen Moment leicht trübte, war das angestrengte, laute Atmen der Jungs, die ihre letzten Kräfte zusammennahmen, um den Strand zu erreichen.
Endlich war es so weit. Toby war der Erste, der unter seinen sonnenverbrannten Füßen den weichen Meeresboden spürte.
„Ich kann stehen!“, rief er voller Freude. Vor Erleichterung traten ihm die Tränen in die Augen.
Nun hatten auch Roland und Mark festen Boden unter den Füßen. Die drei kämpften sich schwerfällig, vom Wasser gebremst, Richtung Strand. Nach den ersten wenigen Schritten an Land sackten die Jungs, begünstigt durch ihre durchnässten Klamotten, regelrecht in Zeitlupe zusammen. Es war ihnen völlig egal. Sie ließen sich einfach bäuchlings in den weichen Sand fallen. Eine Palme spendete mit ihren Blättern den völlig Erschöpften angenehmen Schatten. Ein leichter, warmer, fast zärtlicher Wind streifte ihre geschundenen Körper.
Mark sagte noch leise: „Lasst uns die Umgebung erkunden“, bevor er tief und fest einschlief. Zu groß waren die Strapazen der letzten Tage gewesen. Auch Toby und Roland mussten dem Verlangen ihrer Körper nachgeben und schliefen ebenfalls ein.
KAPITEL 2 – GESTRANDET
Tobys knurrender Magen weckte ihn in den frühen Morgenstunden. Ach du Scheiße, was, wenn wir hier weder was zu essen noch zu trinken finden, schoss es ihm durch den Kopf. Er richtete sich auf und blickte um sich. Die Natur war überwältigend. Oh Mann, dieser Sonnenaufgang, dieses intensive dunkle Orange. Wie friedlich das alles ist. Ich kann schon die angenehme Wärme der Sonnenstrahlen fühlen. Was für eine Kraft doch dieser Stern hat. Toby saß noch gute zehn Minuten im weißen Sand und beobachtete voller Demut und Respekt, wie die Sonne langsam hinter dem Meer hervorkroch und den Horizont eroberte. Es war das erste Mal, dass er einem Sonnenaufgang so viel Aufmerksamkeit schenkte.
„Hey ihr zwei, aufwachen, mir ist langweilig“, sagte Toby schließlich laut, während er kräftig an Roland und Mark rüttelte.
„Bist du bescheuert oder was?“, schimpfte Roland entnervt. „Wenn dir langweilig ist, hättest du ja mal Frühstück machen können.“
Auch Mark war wenig begeistert, so grob geweckt zu werden. „So habe ich mir meinen perfekten Urlaub vorgestellt: morgens an einem schönen Strand aufwachen und als Erstes eure dämlichen Hackfressen sehen.“
Toby und Roland sahen sich kurz an, dann stürzten sie sich wie auf Kommando auf den kleinen Mark und kitzelten ihn durch.
„Stopp, aufhören, ich entschuldige mich ja.“
Für einen kurzen Moment vergaßen die drei Freunde alles um sich herum. Ihr herzhaftes Lachen vertrieb alle Sorgen und Nöte. Sie ahnten noch nicht, dass dies einer der Momente im Leben war, die sie nie und nimmer vergessen würden. Toby unterbrach die kleine Rangelei und sah besorgt aufs Meer.
„Leute, wo ist eigentlich unsere Rettungsinsel?“
„Ach du Scheiße, das Teil ist abgetrieben. Den Erste-Hilfe-Koffer hätten wir vielleicht gebrauchen können“, stellte Roland besorgt fest.
„Der Koffer nützt uns gar nichts, wenn wir verhungern oder verdursten!“, widersprach Mark.
Die drei sahen enttäuscht auf das weite Meer. Und da war sie wieder. Die Hoffnungslosigkeit, die wie ein fetter Kloß im Hals ein freies Atmen unmöglich machte.
„Lasst uns ins Landesinnere gehen und nach Wasser suchen“, schlug Toby vor.
Die Jungs rappelten sich auf, ließen den Strand hinter sich und drangen in die dicht gewachsene, dschungelartige Botanik ein. Das Vorwärtskommen erforderte einen hohen Kraftaufwand, denn bei jedem Schritt versanken die nackten Füße der Jungs in dem weißen, extrem weichen Sand. Bereits nach wenigen Minuten war Mark erschöpft. Boah, der Sand ist mega-heiß, ist ja kaum zum Aushalten. Aber ich sag lieber nix, sonst bin ich wieder das Weichei hier. Er ging hinter Toby und Roland her, deswegen konnte er nicht deren leicht verzogene Gesichter sehen ‒ sie waren ebenso erschöpft und ausgelaugt wie er.
Sie gingen übertrieben langsam und vorsichtig, fast wie auf rohen Eiern. Die Sorge war groß, dass plötzlich ein wildes Tier aus dem Nichts auftauchen könnte, das Appetit auf Fleisch hatte. Auch auf dem Boden konnten Gefahren lauern, ständig blickten die Jungs nach unten aus Angst, auf eine Schlange oder Spinne zu treten. Die grünen Pflanzen und Sträucher um sie herum erstrahlten in einem kräftigen, satten Grün. Der angenehme frische Duft signalisierte, dass an diesem Flecken der Erde die Natur völlig gesund war. Zehn Minuten schlichen sie so durch das wild gewachsene Grün, bis Toby aufhorchte.
„Leute, seid mal ruhig. - Hört ihr auch, was ich höre?“
„Wasser!“, schrien Mark und Roland gleichzeitig.
Sie stürmten los in die Richtung, aus der das Rauschen kam. Sie sprinteten durch die Büsche, ignorierten die Äste, die ihnen dabei ins Gesicht schlugen ‒ und blieben abrupt stehen. Vor ihnen lag ein Wasserfall, ungefähr fünfzehn Meter hoch, der in einen riesengroßen See mündete. Das Wasser war kristallklar. Der gesamte See hatte ungefähr die Größe eines Fußballfeldes und war von weißem Sand und einigen meterhohen Felsen umgeben.
„Ob da irgendwelche Tiere drin sind?“, fragte Mark etwas besorgt.
Er hatte den Satz noch nicht beendet, da sprangen Toby und Roland schon kopfüber in den See. Roland blieb zunächst unter Wasser und tauchte ein paar Meter, so lange wie er die Luft anhalten konnte.
„Wow, das ist so erfrischend“, rief er, als er wieder an die Oberfläche kam. „Als ob ich tausend Gläser Wasser mit Eiswürfeln auf einmal trinken würde. Mein Puls, so laut wie Paukenschläge, um uns diese friedliche Stille, ich liebe es.“
Roland tauchte noch einmal kurz ab, kam wieder an die Oberfläche und spuckte einen Mund voll frisches Wasser gezielt in Tobys Gesicht. Nun konnte sich auch Mark nicht mehr zurückhalten.
„Achtung, Leute, ich komme!“
Mit Anlauf und einem lauten Platsch sprang er ins Wasser und gesellte sich zu seinen Freunden, die ihn zum Spaß erst mal kurz untertauchten. Der See war nicht sehr tief. Zumindest nicht an der Stelle, an der sich die Jungs aufhielten. Zu ihrer großen Erleichterung war es ein Süßwassersee. Mit ihren Händen schöpften sie Wasser und tranken und tranken.
„Verdursten werden wir hier wohl nicht“, stellte Toby fest, wobei sein Schlürfen fast lauter war als seine Worte. Genüsslich füllten sie ihre leeren Bäuche mit Wasser. Dass sie dabei beobachtet wurden, bemerkten sie nicht.
„Lasst uns mal quer durch den See schwimmen“, schlug Roland vor.
Toby winkte ab. „Das können wir doch auch später machen, lasst uns erst mal was Essbares suchen!“
Mark nickte zustimmend. „Ganz genau, dieser Plan gefällt mir gut.“
Toby deutete auf die übergroßen Pflanzen, die rundherum standen. „Seht euch doch mal die Palmen an, da hängen Kokosnüsse ganz oben.“
Langsam verließen die Jungs den See und zogen ihre durchnässten T-Shirts aus. Es waren nur ein paar Meter bis zur nächsten Palme, die in ihrer Krone die begehrte tropische Frucht trug. Während Toby und Roland begannen, mit herumliegenden Steinen nach den hoch hängenden Kokosnüssen zu werfen, träumte Mark vor sich hin. Seine ausgeprägte Unsportlichkeit rief den inneren Schweinehund hervor, der ihm sagte, dass seine Freunde eh die besseren Werfer waren. Sein Blick wanderte über das dichte Grün rundherum. Plötzlich stockte er: In etwa dreißig Metern Entfernung sah er etwas Rotes, Glänzendes, das immer wieder in kurzen Abständen durch einen vom Wind bewegten Busch verdeckt wurde.
„Jungs, da ist was“, sagte er leise.
Doch Toby und Roland waren so darauf erpicht, die Kokosnüsse aus der Höhe zu Boden zu befördern, dass sie ihn gar nicht wahrnahmen. Toby feuerte Roland an:
„Los jetzt, ziel mal genauer und wirf härter, wozu hast du so kräftige Oberarme!“
„Und da du so schlank und drahtig bist, kannste doch bestimmt flink wie ein Affe da raufklettern und die Kokosnüsse abreißen!“, konterte Roland.
„Man reißt Kokosnüsse nicht ab, man erntet sie, du Intelligenzbestie.“
Mark konnte dem Wortgefecht der beiden nichts abgewinnen und ging wie hypnotisiert langsam auf den unbekannten roten Gegenstand zu. Toby und Roland entging in ihrem Eifer, dass ihr Freund sich entfernte. Die erste Kokosnuss fiel herunter, endlich hatte einer ihrer Würfe getroffen.
„So macht man das und nicht anders!“, rief Roland triumphierend.
Mittlerweile hatten die beiden sich eingeschossen. Jetzt war jeder Wurf ein Treffer. Insgesamt konnten sie sechs Früchte der Kokospalme ergattern.
„Lass uns einen Stein mit einer scharfen Kante suchen, dann können wir die Kokosnuss in zwei Hälften teilen und die Schale entfernen“, schlug Toby vor.
„Gute Idee, machen wir beim nächsten Mal“, erwiderte Roland und schlug die Frucht unvermittelt nach seinem Kommentar heftig auf einen großen Stein. Zu groß war der Hunger, der schon Tage andauerte und endlich gestillt werden wollte. Die Kokosmilch spritzte in alle Himmelsrichtungen, auf die Blätter, den Stein und in die Gesichter der beiden. Es sah aus, als hätte sich ein durchgeknallter Serienkiller der Kokosnuss angenommen. Aber das war völlig egal, denn jetzt gab es was zu essen. Endlich!
„Oh Mann, wie weich und saftig dieses süße Fruchtfleisch schmeckt. Aber ich hoffe, dass wir uns nicht ausschließlich von diesem Zeug ernähren müssen“, meinte Toby.
Mit absolutem Höchstgenuss kauten die beiden Jungs auf der saftigen Frucht herum und grinsten sich zufrieden an. Roland hatte keine Lust, etwas zu sagen, aber sein Gesichtsausdruck sprach Bände. Er grinste Toby kauend an und zog seine Augenbrauen zwei- bis dreimal schnell hintereinander hoch.
„Roland, du siehst echt schick aus mit der ganzen Kokosmilch in deinem Gesicht. Besonders gut gefällt mir das Stück, das in deinen Haaren klebt.“ Toby verschluckte sich fast vor Lachen.
Da der erste Hunger nun einigermaßen gestillt war, sammelte Toby die restlichen Kokosstücke ein.
„Die geben wir Mark. Wo ist der eigentlich abgeblieben?“ Er sah sich um und entdeckte den blonden Kopf seines Freundes in einiger Entfernung. „He, Kleiner, hast du keinen Hunger?“
Doch Mark reagierte nicht. Toby stand auf, griff nach den Kokosnüssen und ging in Marks Richtung. Roland schlenderte gemütlich hinterher. Als die beiden Mark erreichten, sagte dieser genervt:
„Ich habe doch gesagt, dass ich was entdeckt habe.“
„Iss erst mal etwas Kokosnuss, dann biste auch wieder besser drauf“, erwiderte Toby.
Mark griff nach der Frucht und aß ein paar Stücke. Kauend deutete er auf das Grünzeug, welches sich hinter ihm auftürmte.
„Ich glaube, dahinter ist etwas versteckt.“
Toby und Roland sahen ihn erstaunt an, griffen aber ohne lange nachzufragen nach den vielen sperrigen Zweigen und Blättern, auf die Mark gedeutet hatte, und zogen diese zur Seite.
„Seid vorsichtig, es könnten sich vielleicht kleine Stacheln an den Ästen befinden, lieber nicht mit vollen Händen in das Gestrüpp greifen“, riet Mark besorgt.
„Mensch, du hast recht, Kleiner, da ist was, etwas Rotes!“
Als die drei das Gestrüpp entfernten, stießen sie auf eine Plane, die an einigen Stellen durchlöchert war und etwas ziemlich Großes verbarg. Die Spannung war unerträglich, die Jungs zogen und zerrten gemeinsam an der Plane, bis die schließlich nachgab. Ihnen stockte der Atem. Ein knallroter Helikopter kam zum Vorschein. Es war eher ein kleineres Modell mit nur einem Rotorblatt, in der Personenkabine gerade Platz für vier Personen. Die Jungs gerieten in helle Aufregung.
„Was macht dieses Teil hier, und wem gehört es?“ „Ob der noch funktioniert?“ „Wie lange der hier wohl schon steht?“
Sie umkreisten das Gefährt und kletterten dann hinein, um die Kabine zu untersuchen. Vielleicht gab es Anhaltspunkte, die Informationen über ihren Standort verraten würden, oder, noch besser, ein Funkgerät, mit dem sie Hilfe rufen konnten. Auf dem Rücksitz lag eine hellblaue Thermoskanne, die natürlich gleich auf ihren Inhalt überprüft wurde: Beherzt setzte Roland die Kanne an seine Lippen und nahm einen kräftigen Schluck ‒ den er postwendend wieder ausspuckte.
„Bääh, alter, kalter Kaffee, dazu noch ohne Milch und ohne Zucker.“
„Die Kanne können wir mit Wasser aus dem See befüllen, dann haben wir wenigstens was zu trinken, wenn wir uns weiter entfernen sollten. Wer weiß, was noch kommt“, schlug Toby vor.
Sie fanden außerdem ein fünf Meter langes Sicherheitsseil und einen aufgerissenen Verbandskasten. Gut die Hälfte der Verbände und Pflaster waren bereits entnommen worden. Mark war inzwischen nach vorn geklettert, um sich im Cockpit-Bereich umzusehen.
„Hey, guckt euch mal das Armaturenbrett an, da sind ja überall angetrocknete Blutstropfen. Der Pilotensitz und der des Co-Piloten sind auch blutverschmiert“, rief er erschrocken.
Es sah so aus, als habe eine verletzte Person den Helikopter durch die rechte Tür, die weit offen stand, verlassen. Die Blutspur führte einige Meter weiter über den mit Pflanzen bedeckten Boden. Ein Geräusch im dichten Grün ließ sie zusammenzucken.
„Hört ihr das?“, fragte Toby etwas ängstlich.
„Klingt nach einem Schnaufen oder Grunzen“, stellte Roland fest.
Mark schlug vor, einen herumliegenden Ast als mögliche Waffe zu benutzen. „Damit braten wir dem Was-auch-immer eins über, falls es uns angreift.“
Er hatte den Satz noch nicht ganz ausgesprochen, da sahen sie ein großes Wildschwein aus einer höhlenartigen kleinen Einbuchtung in einem hohen Baum herausstürmen. Es blieb abrupt stehen und fixierte die Jungs. Das graue Fell war stumpf und struppig.
„Der Größe nach müsste das ein Keiler sein“, flüsterte Toby.
„So wie der Kollege schnauft, scheint er übermäßig aggressiv zu sein“, meinte Roland.
Mark stellte sich schutzsuchend hinter Roland. Die Schnauze des Tieres war blutgetränkt, als ob es mit seinen beeindruckend großen Hauern etwas Fleischiges aufgerissen hätte. Doch das Wildschwein griff sie nicht an, sondern flüchtete in die dicht gewachsene Botanik.
„Okay, der ist weg. Was meint ihr, sollen wir mal gucken, was der in seiner Höhle hatte?“
Die anderen nickten stumm und folgten ihm nervös. Im schnellen Schritt und in der Hoffnung, dass das wilde Tier keine Bedrohung mehr darstellte, gingen sie auf die Baumhöhle zu. Ein fürchterlicher Gestank schlug ihnen entgegen.
„Was zur Hölle ist das denn? Wie kann etwas denn so stinken“, fragte Toby entsetzt.
„Vielleicht sollte man nicht immer alles wissen wollen“, entgegnete Roland.
Mark hielt sich nur seine Nase zu und sagte gar nichts. Jetzt standen sie direkt vor der Baumhöhle und sahen, was das Wildschwein von seiner Mahlzeit übriggelassen hatte. Es war die Leiche eines großen Mannes, der einen orangefarbenen Ski-Anzug mit seitlichen blauen Streifen trug. Das Gesicht war zur Hälfte weggerissen, sodass der Tote nur noch ein Auge hatte, welches weit offenstand, und sie anzustarren schien. Aus dem Bauch quollen blutgetränkte Innereien, die in der hellen Mittagssonne glänzten. Die Jungs waren für den Moment vor Schreck erstarrt. So unglaublich viel Blut hatten sie noch nie zuvor gesehen. Angewidert und gleichzeitig erschüttert hielten sie sich die Hände vor ihre Münder und begannen zu würgen. Im Gegensatz zu Toby und Roland schaffte Mark es nicht, seinen Mageninhalt bei sich zu behalten. So verlor er auf unangenehme Weise ein paar Stücke Kokosnuss, die er nur wenige Minuten zuvor genüsslich zu sich genommen hatte.
„Mann, ist das widerlich, und dieser Gestank! Das Bild krieg ich nie wieder aus dem Kopf“, wimmerte Mark, bevor er sich nach vorn beugte und sich erneut erbrach.
Roland kümmerte sich sorgsam um seinen Freund und hielt ihn fest, da er sich kaum noch auf seinen Beinen halten konnte. Nachdem Mark sich einigermaßen beruhigt hatte, traten die Jungs schnellen Schrittes den Rückzug an. Vorbei an dem Helikopter, setzten sie sich in den weißen Sand, der den Süßwassersee umgab. Keiner sagte etwas. Die Geräuschkulisse wurde einzig und allein von dem Wasserfall bestimmt, der seine schweren Wassermassen hinabschüttete. Die Jungs blickten stumm auf den See. Er schien so friedlich. Ganz im Gegensatz zu dem ausgeweideten Leichnam. Aus der Mitte des Sees tauchte plötzlich ein fußballgroßes, augenscheinlich mit nassem Fell bedecktes, lebendiges Etwas auf, das sacht auf der Wasseroberfläche zu treiben schien.
„Leute, guckt mal, was da aus dem Wasser kommt. Sieht aus wie ein nasser Bieber oder so“, meinte Toby.
„Wohl eher 'oder so'“, warf Mark ein.
Beide lagen falsch – denn als sich dieses „Ding“ um hundertachtzig Grad drehte, entpuppte es sich als der Kopf eines Jungen mit blonden Haaren, blauen Augen und unzähligen Sommersprossen. Er starrte mit finsterem Blick aus der Mitte des Sees zu ihnen herüber. Sie erschraken dermaßen, dass sie sich für ein paar Sekunden aneinander festhielten. Mark klammerte sich unbewusst an Roland und flüsterte:
„Der guckt ja so, als ob er uns gleich umbringen will, total hasserfüllt!“
„Pssst, sei ruhig, mal sehen, was er macht“, sagte Toby leise.
Bevor sie sich dazu entscheiden konnten, den fremden Jungen anzusprechen, tauchte er schon wieder unter.
„Wer zum Teufel war das denn?“, wollte Mark wissen.
„Der muss ja irgendwo wieder auftauchen, dann schnappen wir uns diesen Typen“, sagte Roland selbstsicher.
Woher der wohl kommt, fragte sich Toby im Stillen. Lebt er hier? Und wenn ja, gibt es noch andere? Vielleicht war der unbekannte Junge ihre Chance, hier weg und wieder nach Hause zu kommen. Aber so wie er sie angesehen hatte … Die Jungs beobachteten die Wasseroberfläche. Minutenlang. Doch nichts geschah. Es schien, als habe der See den unheimlichen Jungen für immer verschlungen und weigerte sich, ihn wieder freizugeben. Roland machte einen Vorschlag, während er etwas zögerlich ins Wasser stieg:
„Wir schwimmen jetzt mal den gesamten See ab, so eine große Fläche ist es ja nicht, das kann ja wohl nicht sein, dass der Typ einfach so weg ist.“
Toby und Mark folgten ihm. Gemeinsam schwammen und tauchten sie – in der Hoffnung, unter Wasser etwas zu finden. Das kristallklare Wasser ermöglichte den Jungs eine ungehinderte Sicht. Aber ohne Taucherbrillen konnten sie nur Umrisse erkennen, die von einer leichten Unschärfe umhüllt waren. Roland war der beste Schwimmer der drei. Schon als Kind war er Mitglied in einem Team für Schwimmrettung. Dadurch war er in der Lage, ohne Probleme den Atem lange anzuhalten und Gegenstände aus mehreren Metern Tiefe an die Wasseroberfläche zu holen.
„Ich habe was gefunden!“, rief er seinen zwei Freunden zu. Er war ungefähr in der Mitte des Sees, dort wo der unheimliche Junge spurlos abgetaucht war. „Ich glaube, hier gibt es unter Wasser eine Art Eingang in den Felsen, vom Durchmesser her ungefähr einen Meter. Dort könnten wir hineintauchen, da muss der Typ durch sein, eine andere Möglichkeit gibt’s ja nicht.“
„Dann lasst uns nochmal tief Luft holen und los geht’s“, schlug Toby vor.
Mark war etwas besorgt und dachte: Ein Meter Durchmesser, das ist ziemlich eng, hoffentlich bleibt da keiner von uns stecken. Aber wenn was passiert, wird Roland uns sicher retten.
Die Jungs schwammen nun, angeführt von Roland, in einem steilen Winkel hinab. Ihr Ziel, der Grund des Sees, lag vier Meter unter der Wasseroberfläche. In der Totenstille hier unten war jeder der drei Freunde allein mit seinen Gedanken. Roland hatte nur den unheimlichen Jungen im Kopf und war auf Krawall gebürstet: Wenn ich diesen frechen Kerl zu packen kriege – der wird uns schon verraten, wo wir hier sind und wie wir hier wegkommen, soviel ist sicher! Toby machte sich weniger Gedanken um den Jungen. Sein Forschergeist war geweckt: Ich kann den Umriss des Höhleneingangs schon erkennen. Das sieht aber dunkel und finster aus. Was uns wohl darin erwartet? Vielleicht ist es ja auch ein Durchgang zu einer verborgenen Welt. Ich kann es kaum erwarten.
Mark hingegen beschäftige was ganz anderes: Wenn wir da drin stecken bleiben, oder wir bekommen keine Luft mehr, oder irgendwas greift uns an! Es hat bestimmt einen Grund, warum dieser Eingang tief unter der Wasseroberfläche verborgen ist.
Sie erreichten nun die röhrenartige Öffnung und schwammen nach-einander hinein. Ein Meter Durchmesser war eindeutig zu eng, um die Arme auszubreiten. Aber die Innenseite der Röhre hatte eine recht grobe Struktur, die so uneben war, dass sich die Jungs problemlos an den einzelnen Furchen voranziehen konnten. Durch diese Fortbewegungstechnik sparten sie Kraft. Trotzdem: Die Luft so lange anhalten zu müssen, war eine enorme Herausforderung, gerade für die eher ungeübten Schwimmer Toby und Mark. Sie hatten bereits eine Strecke von ungefähr acht Metern zurückgelegt, ihnen war klar, dass sie damit so weit in die Höhle hineingeschwommen waren, dass ein Umkehren den sicheren Tod bedeuten würde. Es gab kein Zurück, sie hatten den berühmten Point of no return erreicht. Toby blickte voraus, an Roland vorbei, und erkannte, dass die Röhre vor ihnen immer enger wurde: Ach du Scheiße, da kommen wir doch nie im Leben durch!, war sein erster Gedanke. Wenn wir nicht bald irgendwo Luft holen können, sehe ich schwarz. Lange halte ich das nicht mehr durch, die Schmerzen in meinem Brustkorb werden unerträglich!
Ihre Schädel schienen jede Sekunde platzen zu wollen. Die Jungs wurden nur noch von einem Gedanken beherrscht: einfach nur einatmen oder jämmerlich ertrinken. In seiner Panik blickte Roland wild um sich ‒ und machte eine lebensrettende Entdeckung:
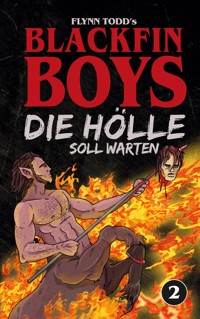
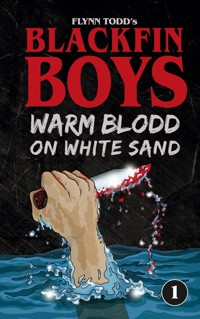
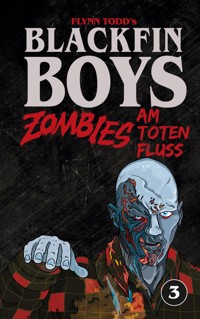














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











