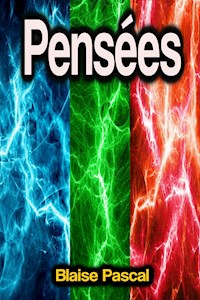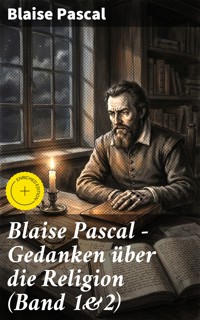
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
In "Gedanken über die Religion" präsentiert Blaise Pascal seine tiefgreifenden Überlegungen zu den fundamentalen Fragen des Glaubens, der Existenz Gottes und der menschlichen Natur. In einem literarisch dichten, teils aphoristischen Stil verbindet Pascal philosophische Reflexionen mit theologischen Einsichten. Seine Gedanken sind sowohl eine Verteidigung des Christentums als auch eine kritische Auseinandersetzung mit der rationalistischen Philosophie seiner Zeit. Das Werk, das häufig als Vorbereitung für seine berühmte "Pensées" verstanden wird, bietet eine faszinierende Erkundung des Spannungsfelds zwischen Vernunft und Glauben. Blaise Pascal (1623-1662), ein französischer Mathematiker, Physiker und Philosoph, war eine Schlüsselfigur der Wissenschaftlichen Revolution und ein passionierter Christ, dessen Lebensweg stark von religiösen Fragen geprägt war. Seine eigene Erfahrung einer spirituellen Wandlung und die Auseinandersetzung mit der Skepsis seiner Zeit beeinflussten stark seine schriftstellerische Tätigkeit. Seine einzigartige Perspektive, die sowohl wissenschaftliche als auch spirituelle Dimensionen umfasst, verleiht seinem Werk eine außergewöhnliche Tiefe und Relevanz. "Gedanken über die Religion" ist nicht nur für Theologen von Interesse, sondern auch für alle, die sich mit den großen Fragen des Lebens auseinandersetzen möchten. Es fordert den Leser heraus, über die Grenzen des Rationalen hinaus zu denken und die emotionalen und spirituellen Aspekte des Glaubens zu betrachten. Ein unverzichtbares Werk für alle, die die Gedanken eines der profundesten Denker der westlichen Philosophie nachvollziehen möchten. In dieser bereicherten Ausgabe haben wir mit großer Sorgfalt zusätzlichen Mehrwert für Ihr Leseerlebnis geschaffen: - Eine prägnante Einführung verortet die zeitlose Anziehungskraft und Themen des Werkes. - Die Synopsis skizziert die Haupthandlung und hebt wichtige Entwicklungen hervor, ohne entscheidende Wendungen zu verraten. - Ein ausführlicher historischer Kontext versetzt Sie in die Ereignisse und Einflüsse der Epoche, die das Schreiben geprägt haben. - Eine Autorenbiografie beleuchtet wichtige Stationen im Leben des Autors und vermittelt die persönlichen Einsichten hinter dem Text. - Eine gründliche Analyse seziert Symbole, Motive und Charakterentwicklungen, um tiefere Bedeutungen offenzulegen. - Reflexionsfragen laden Sie dazu ein, sich persönlich mit den Botschaften des Werkes auseinanderzusetzen und sie mit dem modernen Leben in Verbindung zu bringen. - Sorgfältig ausgewählte unvergessliche Zitate heben Momente literarischer Brillanz hervor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Blaise Pascal - Gedanken über die Religion (Band 1&2)
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Diese zweibändige Sammlung mit dem Titel „Blaise Pascal – Gedanken über die Religion (Band 1 & 2)“ bietet eine umfassende Übersicht über jene Texte, die unter Pascals religiös-philosophischem Nachlass bekannt geworden sind. Sie vereint thematisch geordnete Stücke, die den Menschen, seine Erkenntniskräfte und seine Stellung vor Gott in den Blick nehmen. Der Zweck dieser Ausgabe ist nicht, einen abgeschlossenen Traktat oder fortlaufenden Roman zu präsentieren, sondern die innere Dramaturgie eines Denkens sichtbar zu machen, das mit Fragen, Einwänden und Einsichten ringt. Die Gliederung in einen ersten und zweiten Teil schafft Orientierung und lässt die großen Linien von Anthropologie, Erkenntnistheorie und Apologetik erkennbar werden.
Die hier versammelten Texte stammen aus verschiedenen Gattungen und Schreibformen: kurze Reflexionen, fragmentarische Aufzeichnungen, aphoristische Zuspitzungen, philosophische und theologische Betrachtungen, moralpsychologische Skizzen, literarische Urteile sowie – in einzelnen Fällen – Gebet und erbauliche Ermahnung. Sie bewegen sich zwischen Essay und Notiz, zwischen Entwurf und ausgearbeitetem Gedankengang. Dieses Spektrum spiegelt eine Schreibweise, die von Arbeitscharakter und geistiger Wachheit geprägt ist. Es sind keine Briefromane oder dramatischen Dichtungen, sondern überwiegend Reflexionen und Argumentationen, die auf Klärung, Prüfung und Zuspitzung abzielen und den Leser einladen, mitzudenken und zu prüfen.
Der erste Teil reicht von Grundfragen der Autorität in der Philosophie bis zu Auskünften über den Menschen. Er umkreist die Stellung der mathematischen Methode, untersucht die Kunst zu überzeugen und fragt nach der allgemeinen Kenntnis des Menschen. Daran schließen Überlegungen zu Eitelkeit, Eigenliebe, Schwäche und Elend an, die die menschliche Lage in ihrer Zerrissenheit zeigen. Weitere Stücke betreffen Volksmeinungen, Moral, Philosophie und Literatur sowie Charakteristiken klassischer Autoren. Mit dem „Stand der Großen“ tritt eine soziale Dimension hinzu, die die Mechanismen von Ansehen und Macht deutet und die Verquickung von Rolle und Person kritisch ausleuchtet.
Der zweite Teil nimmt die im ersten Teil beschriebenen Spannungen auf und führt sie in eine religionsphilosophische Bewegung über. Ausgehend von auffallenden Widersprüchen der menschlichen Natur behandelt er die Notwendigkeit, Religion zu studieren, und bespricht die Grenzen rein natürlicher Beweise. Es werden Kennzeichen der wahren Religion diskutiert, ebenso die Frage nach Ursprung und Zustand des Menschen. Im Zentrum stehen Auseinandersetzungen mit Schrift und Überlieferung, mit Vorbildern des alten Gesetzes, mit der Gestalt Jesu Christi sowie mit Weissagungen und Wundern. Abschließend treten meditative Stücke über Tod, Gebet, Umkehr und die Vergleichung der alten mit den heutigen Christen hinzu.
Verbindendes Thema ist die Doppelgestalt des Menschen: groß in seinen Fähigkeiten, elend in seinen Grenzen; fähig zu Erkenntnis, doch von Ungewissheit bedrängt. Die Texte beschreiben nicht bloß Mängel, sondern kartieren das Feld, in dem Wahrheit, Glück und Sinn gesucht werden. Sie fragen nach Recht und Gebrauch der Vernunft, nach dem Gewicht von Einwänden und nach dem Punkt, an dem Einsicht in Zustimmung übergeht. Indem sie Widerspruchslagen nüchtern benennen, meiden sie sowohl kalten Rationalismus als auch blinden Enthusiasmus. So entsteht eine Spannung, die nicht gelöst, sondern fruchtbar gemacht wird – als Raum verantworteter Entscheidung.
Stilistisch verbinden sich Strenge und Beweglichkeit. Prägnante Kürze, klare Definitionen und antithetische Zuspitzungen stehen neben bilderreichen Vergleichen und psychologischer Beobachtung. Der fragmentarische Charakter ist Ausdruck einer Methode: Gedanken werden erprobt, verworfen, verschärft, in neue Konstellationen gestellt. Dadurch entsteht eine besondere Lesedynamik, die nicht belehrt, sondern zur eigenständigen Prüfung anstiftet. Die Kunst zu überzeugen wird nicht nur theoretisch behandelt, sondern performativ vorgeführt: in der Führung vom Bekannten zum Fraglichen, von der Zustimmung zum Zweifel und wieder zur Einsicht, die nicht erzwungen, sondern ermöglicht wird.
Die Präsenz mathematischen Denkens zeigt sich in Präzision, Ordnungsliebe und Argumentationsdisziplin. Wo über Mathematik im Allgemeinen reflektiert wird, dient dies nicht der Ausweitung einer Methode auf alle Lebensbereiche, sondern der Klärung ihrer Reichweite. Der Gedanke, dass es unterschiedliche Evidenzformen gibt, prägt den Stil: neben strenger Demonstration treten Wahrscheinlichkeitserwägungen, Erfahrungswissen und Zeugenschaft. Diese Unterscheidungen wirken in moralischen und religiösen Passagen weiter, wo das Gefüge aus Gründen, Zeichen und innerer Zustimmung bedacht wird. So wird die Verbindung von begrifflicher Schärfe und existenzieller Relevanz zum Markenzeichen dieser Texte.
Im religiösen Teil entfaltet sich eine Apologetik, die Vernunft ernst nimmt und zugleich deren Grenzen markiert. Kennzeichen der wahren Religion werden nicht als bloße Behauptungen vorgetragen, sondern in Auseinandersetzung mit Einwänden, historischen Zeugnissen und der inneren Logik der Überlieferung. Die Betrachtung der Juden, der Vorbilder und der Schrift stellt den Zusammenhang von Verheißung und Erfüllung heraus. Die Texte laden zu einer Lektüre ein, die weder Skepsis noch Vertrauen überspringt: Sie prüfen Gründe, deuten Zeichen, erwägen die Wirkungsgeschichte und fragen nach dem Verhältnis von äußerem Beweis und innerer Gewissheit.
Die anthropologischen Abschnitte erkunden Motive des Handelns: Eigenliebe, Ruhmsucht, Bedürftigkeit, die Rolle öffentlicher Meinung. Sie zeigen, wie Irrtümer entstehen, welche Gewohnheiten Denken lenken und wie soziale Stände Selbstverständnisse formen. Moral wird hier nicht als Katalog von Regeln präsentiert, sondern als Schule der Aufmerksamkeit. Zugleich wird das Verhältnis von Individualität und Gemeinschaft thematisiert: wie Autorität wirkt, wie Zustimmung gewonnen wird, worin Ansehen gründet. Diese Beobachtungen werden nicht isoliert, sondern auf ihren letzten Grund hin befragt, sodass das Psychologische in das Theologische übergeht und beide Dimensionen sich gegenseitig erhellen.
Auch literarisch ist die Sammlung vielfältig. Neben analytischen Stücken stehen meditative Texte, die die Stimme des Betenden oder des Suchenden vernehmbar machen. Das Gebet um den rechten Gebrauch der Krankheiten eröffnet einen Raum geistlicher Übung; das Bruchstück über die Bekehrung des Sünders zeigt die pastorale Stoßrichtung des Denkens. Der Wechsel der Register – argumentativ, aphoristisch, kontemplativ – schafft eine besondere Dichte. Dadurch wird die Sammlung zugleich Arbeitsbuch, Spiegel der Seele und Werkstatt der Begriffe, die den Leser in verschiedenen Modi anspricht: als Mitdenker, als Hörer, als Gewissensprüfer.
Die anhaltende Bedeutung dieser Texte liegt in der Fähigkeit, Grundfragen der Moderne zu fokussieren: Was kann Vernunft wissen? Wovor schützt Skepsis, und wo lähmt sie? Wodurch gewinnt ein Leben Einheit? In Philosophie, Theologie, Literaturwissenschaft und Kulturdebatten wirken Pascals Einsichten fort, weil sie nicht an enge Kontroversen gebunden sind, sondern stabile Unterscheidungen anbieten. Sie provozieren zur Selbstprüfung, ohne sich in bloßer Selbstbeobachtung zu verlieren, und sie öffnen einen Diskursraum, in dem Glaube, Zweifel und Wissen miteinander reden können – sachlich, präzise und mit Blick auf die Konsequenzen des Erkannten.
Diese Ausgabe verfolgt das Ziel, den Reichtum des Nachlasses zugänglich zu machen, ohne dessen offene Form zu verdecken. Die zweibändige Gliederung führt vom vorsichtigen Erkunden der Erkenntnisbedingungen über die Analyse des Menschen zur Auseinandersetzung mit Schrift und Glauben. So entsteht ein Weg, der weder linear noch zufällig ist, sondern Orientierung bietet und zugleich vielfältige Einstiege erlaubt. Der Leser mag den Pfad als Ganzen gehen oder thematische Linien verfolgen. In beiden Fällen lädt die Sammlung zu einer langsamen, prüfenden Lektüre ein, die die Kraft dieser Gedanken gerade in ihrer Fragmentarität erfahrbar macht.
Autorenbiografie
Blaise Pascal (1623–1662) war ein französischer Mathematiker, Physiker und Religionsphilosoph der frühen Neuzeit. Er gilt als eine der prägenden Gestalten des 17. Jahrhunderts, weil er strenge wissenschaftliche Forschung mit tiefgehender Reflexion über die menschliche Natur und den Glauben verband. Neben bahnbrechenden Beiträgen zur Mathematik und Naturforschung hinterließ er eine Sammlung von Fragmenten und Traktaten, die nach seinem Tod unter dem Titel Gedanken bekannt wurde. Die vorliegende Auswahl erschließt diese Facetten: von Überlegungen zur Philosophie und Rhetorik bis zu Entwürfen einer christlichen Anthropologie. Pascals Stimme bleibt durch Genauigkeit, psychologische Schärfe und einen nüchternen Blick auf Wahrheit bemerkenswert.
Seine Ausbildung verlief außerhalb universitärer Bahnen und speiste sich aus Pariser Gelehrtennetzwerken, in denen Mathematik, Naturforschung und Philosophie eng verwoben wurden. Prägend wirkten die Lektüre antiker Moralisten und Skeptiker sowie die strenge Frömmigkeit der Kreise um Port-Royal. Diese Einflüsse treten später ausdrücklich hervor, etwa in Ueber Epiktet und Montaigne, wo er stoische Tugendlehre und skeptische Selbstprüfung prüft. Zugleich reflektiert er in Von der Kunst zu überzeugen die Bedingungen wirkungsvoller Argumentation und das Verhältnis zwischen Vernunft und Einbildungskraft. Sein Denken verbindet methodische Disziplin mit bewusstem Misstrauen gegen vorschnelle Gewissheiten und hält intellektuelle Redlichkeit für eine religiöse Tugend.
Früh machte Pascal sich in der Mathematik einen Namen: In der Projektivgeometrie formulierte er grundlegende Sätze, und seine Untersuchungen zur Kombinatorik führten mit zur Begründung der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Zur Entlastung praktischer Buchführung entwickelte er eine Rechenmaschine. In der Physik prüfte er die Existenz des Vakuums und zeigte Gesetzmäßigkeiten von Luftdruck und Flüssigkeiten, woraus die Hydrostatik neue Impulse bezog. Diese Arbeiten verbanden experimentelle Sorgfalt mit theoretischer Kühnheit und prägten Debatten der europäischen Gelehrtenrepublik. Auch später, als ihn religiöse Fragen stärker beschäftigten, blieb der Respekt vor methodischer Strenge zentral und beeinflusste die Form seiner philosophischen und apologiebezogenen Fragmente.
Der Erste Theil der Sammlung entfaltet eine kritische Anthropologie und Methodik. In Von der Autorität in Betreff der Philosophie prüft Pascal die Grenzen gelehrter Stimmen; in Betrachtungen über die Mathematik im Allgemeinen reflektiert er Nutzen und Reichweite des Exakten. Texte wie Allgemeine Kenntniss des Menschen, Eitelkeit des Menschen. Wirkungen der Eigenliebe, Schwäche des Menschen und Elend des Menschen zeichnen ein Bild widersprüchlicher Größe und Bedürftigkeit. Gründe einiger Volksmeinungen, Zerstreute Gedanken über Moral und Verschiedene Gedanken über Philosophie und Literatur zeigen seinen Blick für sprachliche, soziale und kulturelle Mechanismen. Ueber Epiktet und Montaigne sowie Ueber den Stand der Großen situieren sein Denken historisch.
Der Zweite Theil setzt bei Auffallenden Widersprüchen in der menschlichen Natur an und führt zur Nothwendigkeit die Religion zu studiren. Pascal hält es für schwer, das Dasein Gottes allein durch natürliche Geisteskräfte zu beweisen; zugleich argumentiert er, daß das Sicherste ist es zu glauben. Kennzeichen der wahren Religion und Die wahre Religion bewiesen durch die Widersprüche im Menschen und durch die Erbsünde bündeln seine Kriterienprüfung. Unterwerfung und Gebrauch der Vernunft markiert das richtige Maß zwischen methodischer Strenge und Demut. Das eindringliche Bild eines Menschen, der müde geworden ist Gott zu suchen durch die bloße Vernunft, eröffnet eine existenzielle Lektüresituation.
Entscheidend ist Pascals biblische Argumentation: Die Juden, mit Bezug auf unsre Religion betrachtet und Von den Vorbildern; daß das alte Gesetz vorbildlich war verbinden Schriftzeugnis. Von Jesu Christo, Beweise für Jesum Christum aus den Weissagungen und Verschiedene Beweise für Jesum Christum entfalten Christologie, die Vernunft und Offenbarung verbindet. Von dem Rathschluß Gottes sich dem einen zu verbergen und dem andern zu offenbaren beleuchtet Glauben. Daß die wahren Christen und die wahren Juden nur eine Religion haben sowie Man erkennt Gott nicht anders heilsam als durch Jesum Christum bestimmen die Mitte. Gedanken über die Wunder, Gedanken über den Tod und Gebet zu Gott um den rechten Gebrauch der Krankheiten setzen Akzente.
In seinen späteren Jahren verschob sich Pascals Schwerpunkt endgültig zur religiösen Apologie und zu asketischer Lebenspraxis; gesundheitliche Schwäche begleitete ihn. Die Gedanken blieben als Notizen und Entwürfe unvollendet und wurden erst nach seinem Tod geordnet überliefert. Ihr Nachdruck auf die Spannung zwischen menschlicher Größe und Elend, auf die Grenzen der Vernunft und auf die Verantwortung des Willens hat über Konfessionen hinaus gewirkt. In der Wissenschaft lebt sein Name in der Wahrscheinlichkeitsrechnung und im nach ihm benannten Druckmaß fort. Bis heute prägen seine Einsichten Debatten über Überzeugung, Gewissheit, Zweifel und die Möglichkeit, wissenschaftliche Nüchternheit mit religiöser Ernsthaftigkeit zu verbinden.
Historischer Kontext
Blaise Pascal (1623–1662) lebte in einer Epoche tiefgreifender Umbrüche. Frankreich bewegte sich zwischen konfessionellen Konflikten, höfischer Zentralisierung und der wissenschaftlichen Revolution. Die in dieser Sammlung versammelten Gedanken über die Religion, in zwei Teile gegliedert, stammen aus einem unvollendeten Apologie-Projekt, das nach Pascals frühem Tod aus Fragmenten geordnet wurde. Entstanden sind sie vor allem in den 1650er Jahren, als Pascal sich vom Naturforscher und Mathematiker zum religiösen Schriftsteller wandelte. Die Texte spiegeln eine Zeit, in der Vernunft, Autorität, Erfahrung und Schrifttradition neu austariert wurden, und sie reagieren auf Debatten, die die Gelehrtenrepublik von Paris bis Rom prägten.
Politisch war Frankreich vom Ausbau absolutistischer Herrschaft geprägt. Unter Kardinal Richelieu und später Mazarin wurden Macht und Verwaltung zentralisiert, während der Dreißigjährige Krieg und seine Folgekonflikte die Gesellschaft belasteten. Die Fronde (1648–1653) zeigte, wie fragile Loyalitäten und ökonomische Spannungen den alten Ständekonsens aufbrechen konnten. Diese Krisenerfahrung bildet einen Resonanzraum für Pascals Überlegungen zum Stand der Großen und zu den Konventionen, die Autorität stützen. In einer Kultur, die Rangzeichen, Zeremoniell und öffentliche Legitimation hoch gewichtete, gewinnt seine Analyse der Zeichen und Gewohnheiten politische Schärfe, auch wenn sie philosophisch und moralisch begründet bleibt.
Konfessionell wurde das 17. Jahrhundert von heftigen Auseinandersetzungen über Gnade, Freiheit und kirchliche Autorität bestimmt. Der Jansenismus, an Port-Royal verankert und von Augustins Gnadenlehre inspiriert, stand im Konflikt mit jesuitischer Theologie und Praxis. 1653 verurteilte Papst Innozenz X. mit der Bulle Cum occasione fünf Sätze aus Jansens Augustinus. Diese Konfliktlage rahmt Pascals Bemühung, Wahrheit, Gewissheit und Heilsordnung zu klären. Die in der Sammlung behandelten Themen zur Notwendigkeit, die Religion zu studieren, und zu Kennzeichen der wahren Religion sind ohne diese Streitfragen um Gnade, Sünde und Autorität nicht zu verstehen.
Gleichzeitig wirkte die wissenschaftliche Revolution transformativ. Pascal leistete Pionierarbeit in der Geometrie der Kegelschnitte, baute mit der Pascaline eine Rechenmaschine und zeigte in Experimenten zum Vakuum und Luftdruck die Fruchtbarkeit empirischer Methode. Der Briefwechsel mit Fermat prägte die frühe Wahrscheinlichkeitstheorie. Diese Erfahrungen formen seine Reflexionen über die Mathematik im Allgemeinen und die Kunst zu überzeugen: Klarheit der Begriffe, Beweisführung und die Grenzen mathematischer Sicherheit. Die Spannungen zwischen strenger Demonstration und praktischer Überzeugungskraft durchziehen die Sammlung und positionieren Vernunft als notwendig, jedoch nicht als hinreichend für Glaubensgewissheit.
Die intellektuelle Öffentlichkeit Frankreichs war von Kollegien, religiösen Kongregationen, Hof und literarischen Salons getragen. Port-Royal wurde zu einem Zentrum strenger Bildung und Logikreflexion; Arnauld und Nicole publizierten 1662 die Logik von Port-Royal. In dieser Kultur erwarb die Kunst zu überzeugen besonderes Gewicht. Pascals Überlegungen zur Autorität in der Philosophie und zur Rhetorik reagieren auf Debatten, wie man Zustimmung gewinnt: durch Evidenz, durch Autoritäten, durch Gewohnheit oder durch das Herz. Dass die Sammlung diese Fragen mit Blick auf Moral, Politik und Theologie verbindet, entspricht der interdisziplinären Verzahnung des 17. Jahrhunderts.
Die anthropologischen Kapitel über Eitelkeit, Schwäche und Elend des Menschen fügen sich in eine barocke Kultur, die Vergänglichkeit und Widerspruch der menschlichen Existenz ständig vor Augen hatte. Kriege, Seuchen und wirtschaftliche Volatilität nährten Skepsis gegenüber optimistischen Fortschrittserzählungen. Pascals Augustinische Prägung lässt ihn Größe und Elend zusammendenken: Fähigkeit zur Vernunft und moralischem Streben neben Selbsttäuschung und Eigenliebe. Diese Polarität wird später zum Leitmotiv der Sammlung und bildet den Hintergrund für die Erörterung von Volksmeinungen, der Rolle der Zerstreuung und der Unsicherheit natürlicher Erkenntnis.
Pascals Auseinandersetzung mit antiken und neuzeitlichen Morallehren tritt besonders in den Gedanken über Epiktet und Montaigne hervor. Stoizismus und Skeptizismus waren im Frankreich des 17. Jahrhunderts lebendige Referenzsysteme: der eine forderte Selbstbeherrschung und Tugend, der andere relativierte Gewissheiten und hob die Gewohnheit hervor. In höfisch-gelehrten Milieus dienten beide als intellektuelle Ressourcen. Pascal nutzt sie, um das Bedürfnis nach einer Gnade jenseits moralischer Selbstoptimierung zu markieren und das Risiko eines Skeptizismus ohne Erlösungsbezug aufzuzeigen. So positioniert er das Christentum als Antwort auf die einander neutralisierenden Einseitigkeiten beider Schulen.
Die Gedanken über den Stand der Großen reflektieren die gesellschaftliche Ordnung des Ancien Régime. Adel, Geistlichkeit und Dritter Stand waren durch Privilegien und sichtbare Zeichen strukturiert. Nach der Fronde festigte der Hof die Symbolpolitik, um Loyalität zu binden. Pascal analysiert die Kraft der Zeichen, die Autorität performativ erzeugen, und die moralische Verantwortung der Mächtigen. Er entlarvt die Konventionalität vieler Anerkennungspraktiken, ohne die Notwendigkeit sozialer Ordnung zu leugnen. Diese doppelte Perspektive – Anerkennung der Faktizität politischer Macht und Kritik ihrer willkürlichen Fundamente – gibt seiner Moral- und Sozialanalyse nachhaltige Aktualität.
In der Sammlung kulminieren die Widersprüche der menschlichen Natur in Fragen nach Wahrheit und Glück. Der Anspruch, die Religion zu studieren, reagiert auf eine Epoche, in der theologische Gewissheiten öffentlich verhandelt wurden und Druck, Zensur und Fakultätsurteile den Diskurs rahmten. Pascal insistiert darauf, dass es schwer sei, Gottes Dasein durch natürliche Geisteskräfte zu beweisen, macht aber die existenzielle Dringlichkeit der Entscheidung geltend. Diese Haltung spiegelt die konfessionellen Kontroversen und die Erfahrung, dass Gelehrtenstreitigkeiten das religiöse Leben prägen, ohne existenzielle Unruhe zu stillen.
Die polemischen Erfahrungen mit der jesuitischen Kasuistik bilden den Hintergrund von Pascals sprachlicher Zuspitzung. Seine Lettres provinciales (1656–1657) verteidigten Antoine Arnauld und kritisierten moraltheologische Laxheit. Sie machten ihn zu einer stilprägenden Stimme der französischen Prosa. Die in der Sammlung verhandelten Themen der Moral, des Gebrauchs der Vernunft und der Merkmale der wahren Religion tragen Spuren dieser Polemik: Präzise Begriffsarbeit, ironische Distanz, und die Forderung nach innerer Lauterkeit. Die Auseinandersetzungen verstärkten zugleich den Druck auf Port-Royal und verschärften den Rahmen, in dem religiöse Argumentationen geführt werden konnten.
Eine Schlüsselerfahrung für Pascals religiöse Wendung war seine sogenannte Nacht des Feuers im November 1654, ein intensives mystisches Erlebnis, dessen Memorial man später in seinem Gewand fand. In Verbindung mit dauerhaften gesundheitlichen Beschwerden – Schmerzen, Schwäche und Krankheitsepisoden – förderte dies asketische Strenge und Mitleid mit Leidenden. Texte wie das Gebet um den rechten Gebrauch der Krankheiten beziehen persönliche Erfahrung auf eine theologische Deutung des Leidens. Die Verbindung von Mystik, Askese und intellektueller Prägnanz verleiht der Sammlung eine Doppelspannung aus radikalem Ernst und argumentativer Strenge.
Die Pensées sind kein systematischer Traktat, sondern ein Fragmentenbestand für eine geplante Apologie der christlichen Religion. Freunde aus Port-Royal gaben 1670 eine erste Ausgabe heraus, die die Zettel thematisch ordnete und teilweise glättete. Spätere kritische Editionen versuchten, den ursprünglichen Zustand und die Ordnung näher zu rekonstruieren. Die Zweiteilung, die diese Sammlung reflektiert, knüpft an die frühneuzeitliche Tendenz an, Erkenntniskritik und Anthropologie mit Schriftbeweisen und Dogmatik zu verschränken. Die editorische Geschichte ist selbst Teil der Rezeptionsgeschichte, weil Ordnung und Gewichtung der Fragmente das Bild von Pascal prägen.
Der Blick auf die Juden und die Typologie des Alten Gesetzes steht in der Tradition des christlichen Hebraismus, der seit dem 16. Jahrhundert Bibelstudien, Sprachkenntnis und Kontroversliteratur förderte. Port-Royal pflegte eine intensive Schriftarbeit. Pascals Deutung der Vorbilder und seine These, dass die wahren Christen und die wahren Juden eine Religion haben, folgen augustinischer Exegese, die Kontinuität und Erfüllung behauptet. Diese Sicht spiegelt die damaligen konfessionellen Selbstverständnisse und Missionsansprüche. Zugleich zeigt sie, wie sehr die Auslegungsgeschichte Teil der Auseinandersetzung um die Kennzeichen der wahren Religion und um kirchliche Identität war.
Ein zentrales Thema ist die Frage nach Wundern, Prophezeiungen und dem Sinn göttlicher Selbstverborgenheit. Die Debatten des 17. Jahrhunderts kreisten um die Glaubwürdigkeit von Wunderberichten und die Abgrenzung gegenüber Betrug oder Einbildung. Im Umfeld von Port-Royal erhielt der sogenannte Dornwunder-Fall von 1656 – die Heilung von Pascals Nichte Marguerite Périer – hohe Aufmerksamkeit und nährte Verteidigungs- wie Zweifelshaltungen. Pascals Überlegungen zu den Wundern und zu Gottes Ratschluss, sich zu verbergen und zu offenbaren, nehmen diese Auseinandersetzungen auf und validieren religiöse Evidenz nicht gegen, sondern mit einer kritischen Prüfung von Zeichen.
Die Diskussion von Unterwerfung und Gebrauch der Vernunft verbindet Pascals mathematische Schule mit seiner theologischen Absicht. Er unterscheidet zwischen demonstrativer Gewissheit und praktischer Entscheidungslage. Vor dem Hintergrund der neuen Wahrscheinlichkeitstheorie – die durch den Briefwechsel mit Fermat Impulse erhielt – gewinnt seine berühmte Wette kulturgeschichtliche Plausibilität: Entscheidungen unter Ungewissheit verlangen Abwägungen jenseits strenger Beweise. Die Sammlung zeigt, wie Vernunft in den Dienst einer existenziellen Wahl treten kann, ohne zur Allzuständigkeit erhoben zu werden. Damit antwortet sie auf Rationalismus wie Skeptizismus der Zeit gleichermaßen.
Die Aufklärung reagierte ambivalent auf Pascal. Voltaire sah in ihm einen düsteren Geist, dessen Anthropologie den Menschen erniedrige; andere würdigten die stilistische Größe und die psychologische Schärfe. In konfessionellen Debatten blieb Pascal ein Arsenal für apologetische wie kritische Lesarten. Im 19. und 20. Jahrhundert schätzten Romantiker und existenzielle Denker die Analyse von Angst, Zerstreuung und Entscheidung. Editionsgeschichtlich markierten Faugères Edition im 19. Jahrhundert und später Brunschvicg, Lafuma und Sellier wichtige Ordnungsversuche, die den Fragmentbestand unterschiedlich gewichtet und die Arbeitsstufen Pascals sichtbar gemacht haben.
Die Sammlung kommentiert ihre Zeit, indem sie politische Symboliken entlarvt, die Reichweite wissenschaftlicher Vernunft prüft und den religiösen Streit in existenzielles Fragen übersetzt. Ihre spätere Deutung oszilliert zwischen kultureller Diagnose des Ancien Régime und zeitloser Anthropologie. Übersetzungen und Neuordnungen machten die Pensées europaweit zugänglich; in Deutschland fanden sie in der langen Rezeption der französischen Moralisten besondere Aufmerksamkeit. Als historisches Dokument zeigt die Sammlung die Spannung von Hofkultur, kirchlichem Konflikt und Gelehrtenrepublik; als intellektuelle Provokation fordert sie bis heute zu einer nüchternen, zugleich ernsthaften Prüfung von Vernunft und Glaube heraus.
Synopsis (Auswahl)
Erster Teil: Erkenntnistheorie, Wissenschaft und Rhetorik (1,2,3,8,10)
Pascal verhandelt die Grenzen von Autorität und System in der Philosophie, unterscheidet die strenge Gewissheit der Mathematik von den weicheren Gewissheitsgraden in anderen Wissensfeldern und misstraut scholastischer Wortklauberei. Er analysiert die Kunst zu überzeugen als Zusammenspiel von Gründen und Gewohnheiten, zeigt, wie Volksmeinungen aus Nutzen, Gewohnheit und Einbildungskraft entstehen, und plädiert für klare Sprache. Der Ton ist analytisch und nüchtern, mit Sinn für rhetorische Psychologie.
Erster Teil: Anthropologie des Menschen – Wissen, Eitelkeit, Schwäche, Elend (4,5,6,7)
Diese Schriften zeichnen ein Doppelbild des Menschen: fähig zu Erkenntnis und Größe, zugleich von Eitelkeit, Eigenliebe und Schwäche verformt. Aus der Ungewissheit natürlicher Erkenntnis und dem Gefühl des Elends erwächst eine existenzielle Unruhe, die auf ein höheres Maß an Wahrheit verweist. Der Ton ist psychologisch präzis und oft schonungslos.
Erster Teil: Zerstreute Gedanken über Moral (9)
In kurzen moralischen Reflexionen prüft Pascal Tugend, Gewohnheit und Gerechtigkeit unter dem Blick auf Motive und Selbsttäuschungen. Er warnt vor moralischer Selbstsicherheit und empfiehlt eine nüchterne Selbsterforschung. Die Notizen sind pointiert, fragmentarisch und praxisnah.
Erster Teil: Über Epiktet und Montaigne (11)
Pascal kontrastiert die stoische Strenge Epiktets mit der skeptischen Mäßigung Montaignes und würdigt beider Einsichten in Pflicht und Begrenztheit. Zugleich zeigt er, wo beide Entwürfe an der Widersprüchlichkeit des Menschen scheitern. Daraus leitet er die Notwendigkeit einer Wahrheit ab, die über reine Moral oder Skepsis hinausweist.
Erster Teil: Über den Stand der Großen (12)
Die Betrachtung des Standes der Großen entlarvt Rang und Macht als weitgehend konventionelle Ordnungen, die durch Zeichen und Rituale stabilisiert werden. Pascal empfiehlt den Mächtigen Demut und Verantwortlichkeit und den Untergebenen kluge Anerkennung der Ordnung, um Anomie zu vermeiden. Der Blick ist kritisch, doch pragmatisch.
Zweiter Teil: Der widersprüchliche Mensch und die Notwendigkeit der Religion (1,2,3,5,6)
Aus den auffälligen Widersprüchen des Menschen in der Suche nach Wahrheit und Glück folgert Pascal die Notwendigkeit, Religion ernsthaft zu prüfen. Er betont die Grenzen der Vernunft in Gottesfragen, ohne sie zu verwerfen, und argumentiert, dass angesichts der Unsicherheit ein vertrauendes Sich-Orientieren an Gott das sicherste Vorgehen ist; die Lehre von der Erbsünde erklärt die innere Zerrissenheit. Der Ton ist streng argumentativ und zugleich existenziell.
Zweiter Teil: Vom Weg der Suche – Von der Vernunft zur Schrift und der verborgene Gott (7,13)
Ein nachdenkliches Porträt zeigt einen Suchenden, der von rein rationalen Beweisen ermüdet zur Schrift greift und dort eine andere Art von Licht erwartet. Pascal entfaltet dazu das Motiv des Gottes, der sich verbirgt und offenbart, um Freiheit und Demut des Menschen zu prüfen. So erscheinen die Zeichen des Glaubens als hinreichend, aber nicht zwingend.
Zweiter Teil: Kennzeichen und Wesen der wahren Religion (4,14,15)
Pascal benennt Kriterien der wahren Religion: Sie erklärt zugleich die Größe und das Elend des Menschen, steht in Kontinuität mit der Geschichte Israels und hat ihren Mittelpunkt in Jesus Christus. Heilsames Gotteserkennen geschieht nicht abstrakt, sondern in und durch Christus. Die Darlegung ist prüfend und grenzt sich von bloßer Schwärmerei ab.
Zweiter Teil: Israel, Vorbilder und Weissagungen (8,9,11,12)
Die Betrachtungen zu den Juden präsentieren Israel als Träger einer überlieferten Offenbarung, deren Schriften in Figuren und Vorbildern auf Zukünftiges deuten. Prophezeiungen und Typologien werden als zusammenlaufende Belege für Christus gelesen, ergänzt durch weitere, historisch-praktische Erwägungen. Der Zugang ist textnah, apologetisch und systematisierend.
Zweiter Teil: Von Jesu Christo (10)
Die Darstellung Christi verbindet die Diagnose des Menschen mit der Verheißung von Erlösung: Gerechtigkeit und Barmherzigkeit finden in ihm ihre Einheit. Pascal zeichnet ein Bild, das zur persönlichen Antwort einlädt, ohne auf bloße Gefühlsbewegung zu setzen. Der Ton ist andächtig und konzentriert.
Zweiter Teil: Gedanken über die Wunder (16)
Pascal plädiert für eine mittlere Haltung gegenüber Wundern: Sie sind weder leichtgläubig zu akzeptieren noch dogmatisch zu verwerfen. Als Zeichen, die deuten statt zu zwingen, bedürfen sie der Prüfung nach Kontext, Zeugen und Frucht. So dienen sie der Erbauung, nicht der Neugier.
Zweiter Teil: Frömmigkeit, Endlichkeit und Erneuerung (17,18,19,20,21)
Verschiedene Betrachtungen bündeln praktische Religiosität: die Ausrichtung des Lebens, die ernüchternde Gegenwart des Todes, die Gebetsbitte um rechten Umgang mit Krankheit und die Aufforderung zur Umkehr. Der Vergleich alter und heutiger Christen mahnt zu Einfachheit, Ernst und Gemeinsinn. Insgesamt entsteht ein Bild von Frömmigkeit als erneuernder Lebensweg.
Wiederkehrende Themen und Stil
Die Sammlung arbeitet mit Fragment, Aphorismus und gedanklichem Versuch, um den Leser von Selbstsicherheit zu Entdeckung und Entscheidung zu führen. Wiederkehren die Spannung von Vernunft und Glaube, die Psychologie der Eigenliebe und das Paradox von Größe und Elend. Der Stil ist klar, knapp und oft paradox, mit einer Dramaturgie, die vom diagnostischen Blick zur existenziellen Einladung fortschreitet.
Blaise Pascal - Gedanken über die Religion (Band 1&2)
Erster Theil.
Gedanken, die sich auf Philosophie, Moral und schöne Wissenschaften beziehn.
Erster Abschnitt. Von der Autorität in Betreff der Philosophie.
Die Achtung vor dem Alterthum ist heut zu Tage, in den Gegenständen, bei welchen sie am Wenigsten gelten sollte, auf dem Punkt, daß man aus allen seinen Gedanken Orakel macht und selbst aus seinen Dunkelheiten Geheimnisse, daß man nicht mehr ohne Gefahr etwas Neues vorbringen kann und daß die Worte eines (alten) Autors hinreichen die stärksten Gründe zu zerstören.
Meine Absicht ist nicht einen Fehler durch den andern zu bessern und den Alten gar keine Achtung zu beweisen, weil man ihnen zu viel beweist und ich will nicht ihre Autorität verbannen um ganz allein das Selbstdenken zu erheben, obgleich man ihre Autorität allein zum Nachtheil des eignen Vernunftgebrauchs aufrichten will. Aber man muß erwägen, daß unter den Dingen, die wir zu kennen streben, einige allein vom Gedächtniß abhängen und rein historisch sind, indem dann nur unser Zweck ist wissen zu wollen was die Autoren geschrieben haben; die andern aber hängen allein von dem Forschen der Vernunft ab und sind gänzlich dogmatisch, indem wir dann zum Zweck haben die verborgnen Wahrheiten zu entdecken. Nach dieser Unterscheidung muß man abmessen, wie weit die Achtung vor den Alten gehen darf.
In den Gegenständen, wo man allein erforschen will was die Autoren geschrieben haben, wie z.B. in der Geschichte, Geographie, Sprachen, Theologie, endlich in alle denen, die entweder die einfache Thatsache oder eine göttliche oder menschliche Anordnung zur Grundlage haben, muß man nothwendiger Weise auf ihre Bücher zurückgehen, weil alles, was man darüber wissen kann, in diesen enthalten ist, und es leuchtet ein, daß man nur da die vollkommne Erkenntniß von diesen Dingen finden kann und daß es nicht möglich ist noch etwas hinzu zu setzen. Also wenn die Frage ist, wer der erste König der Franzosen war, auf welchen Ort die Geographen dem ersten Meridian verlegen, welche Worte in einer todten Sprache vorkommen u. d. m. welche andre Mittel giebt es das zu erfahren als die Bücher? Und wer könnte irgend etwas Neues zu dem, was sie uns darüber lehren, hinzufügen, da man ja eben nur wissen will, was sie enthalten? Die Autorität allein kann uns darüber aufklären[1q].
Wo aber diese Autorität die größte Stärke hat, das ist in der Theologie, weil sie da unzertrennlich von der Wahrheit ist und wir diese nur durch jene kennen, so daß es, um den Dingen, die für die Vernunft die unbegreiflichsten sind, die volle Gewißheit zu geben, hinreicht in der heiligen Schrift nach zu weisen, wie man auch, um die Ungewißheit der wahrscheinlichen Dinge zu zeigen, nur nach zu weisen braucht, daß sie nicht darin enthalten sind. Denn die Prinzipien der Theologie sind über der Natur und Vernunft und der Geist des Menschen, zu schwach und dazu durch eigne Anstrengung zu gelangen, kann diese hohen Einsichten nicht erreichen, wenn er nicht zu ihnen erhoben wird durch eine allmächtige und übernatürliche Kraft.
Anders ist es mit den Gegenständen der Sinne oder der Vernunft. Die Autorität ist hier unnütz, die Vernunft hat allein das Recht sie zu erkennen; beide haben ihre getrennten Rechte. Jene war so lange ganz im Vortheil, hier nun kommt diese an die Reihe zum Herrschen. Und da die Gegenstände dieser Art der Fassungskraft des Geistes angemessen sind, hat er vollkommne Freiheit sich hier aus zu breiten; seine unerschöpfliche Fruchtbarkeit bringt unaufhörlich hervor und seine Erfindungen können zugleich ohne Ende und ohne Unterbrechung sein.
Auf diese Weise müssen die Geometrie, Arithmetik, Musik, Naturlehre, Arzneikunde, Baukunst und alle die Wissenschaften, welche von Erfahrung und Nachdenken abhängig sind, erweitert werden um vollkommen zu werden. Die Alten fanden sie bloß aus dem Groben gearbeitet von denen, die ihnen vorangingen und wir werden sie denen, die nach uns kommen, in einem vollendetern Zustande nachlassen, als wir sie empfangen haben. Da ihre Vervollkommnung von Zeit und Arbeit abhängt, so ist klar, daß, wenn auch unsre Arbeit und Zeit uns weniger erworben hätte als ihre Bestrebungen von den unsren getrennt, doch alle beide mit einander verbunden mehr Wirkung haben müssen als jede für sich besonders.
Die Aufhellung dieses Unterschiedes muß uns lehren die Blindheit derer beklagen, die in Sachen der Naturlehre die einzige Autorität zum Beweise aufführen statt der Vernunft und der Erfahrung und muß uns Abscheu einflößen vor der Schlechtigkeit derer, die in der Theologie allein die Vernunft anwenden statt der Autorität der Schrift und der und der Kirchenväter. Man muß aufrichten den Muth jener furchtsamen Seelen, die in der Naturkunde nichts Neues zu erfinden wagen und niederwerfen den Uebermuth der Vermessenen, die in der Theologie Neues aufbringen.
Aber das ist das Unglück des Jahrhunderts, man sieht in der Theologie viele neue Meinungen, die dem ganzen Alterthum unbekannt waren und die mit Hartnäckigkeit behauptet, mit Beifall angenommen werden; dagegen die Meinungen, die man in der Physik, wenn auch nur in kleiner Anzahl neu aufstellt, scheinen der Falschheit bezüchtigt werden zu müssen, sobald sie auch nur ein wenig gegen die angenommenen Meinungen anstoßen; gleich als wenn die Achtung, die man für die alten Philosophen hat, Pflicht wäre und als wenn die Achtung, welche man vor den ältesten Vätern hegt, bloß Höflichkeit wäre.
Ich überlasse es den Verständigen die Wichtigkeit dieses Mißbrauchs zu beachten, welcher die Ordnung der Wissenschaften auf so ungerechte Art umkehrt und ich glaube, daß wenige unter ihnen sein werden, die nicht wünschen, daß unsre Forschungen einen andern Gang nehmen möchten, da die neuen Erfindungen unfehlbar Irrthümer sind in theologischen Gegenständen, die man ungestraft entweihet, und dagegen unbedingt nothwendig sind zur Vervollkommnung so vieler anderer Gegenstände einer untergeordneten Gattung, die man jedoch nicht an zu rühren wagt.
Wir müssen unser Glauben und unser Mißtrauen gerechter vertheilen und unsre Achtung vor den Alten einschränken. Wie die Vernunft sie erzeugt, so muß sie ihr auch Maß und Ziel setzen. Wir müssen bedenken: wenn sie die Zurückhaltung geübt hätten nichts zu den empfangenen Kenntnissen hinzu zu fügen oder wenn die Leute zu ihrer Zeit eben solche Schwierigkeit gemacht hätten das Neue, was sie ihnen boten, an zu nehmen, so würden sie sich und ihre Nachkommen der Früchte ihrer Entdeckungen beraubt haben.
Wie sie sich der Entdeckung, die ihnen hinterlassen waren, nur als Mittel bedient haben um neue zu machen, und wie diese glückliche Kühnheit ihnen den Weg zu großen Dingen geöffnet hat, so müssen wir die, welche sie uns erworben haben, auf dieselbe Weise nehmen und daraus nach ihrem Beispiel die Mittel und nicht den Zweck unsers Studiums machen und so streben sie zu übertreffen, indem wir sie nachahmen. Denn was wäre unbilliger, als wenn wir unsre Vorfahren mit mehr Zurückhaltung behandelten, als sie gegen ihre Vorfahren gehabt haben und vor ihnen den unglaublichen Respect hegten, den sie sich von uns nur darum verdient, weil sie nicht einen gleichen vor denen hegten, die denselben Vorzug vor ihnen besaßen?
Die Geheimnisse der Natur sind verborgen. Obgleich sie immer handelt, entdeckt man nicht immer ihre Wirkungen. Die Zeit offenbart sie von Geschlecht zu Geschlecht und wenn auch immer gleich an sich, ist sie doch nicht immer gleich gekannt. Die Erfahrungen, die uns die Kenntniß davon geben, vervielfältigen sich unaufhörlich und wie sie die einzigen Grundlagen der Naturlehre sind, so vervielfältigen sich die Folgerungen im Verhältniß.
In dieser Weise darf man heut zu Tage andre Meinungen und neue Ansichten ergreifen, ohne die Alten zu verachten und ohne Undankbarkeit gegen sie. Die ersten Kenntnisse, die sie uns gegeben, sind zu Stufen geworden für die unsrigen und wenn wir so im Vortheil sind, verdanken wir ihnen den Vorsprung, den wir vor ihnen haben; denn sie haben sich bis zu einer gewissen Stufe erhoben und uns bis dahin gebracht und so bringt die geringste Anstrengung uns höher und mit weniger Mühe und weniger Ehre befinden wir uns über ihnen. Von da aus können wir Dinge entdecken, die sie unmöglich gewahr werden konnten. Unser Blick ist ausgedehnter und obgleich sie alles, was sie von der Natur zu bemerken vermochten, eben so gut kannten als wir, so kannten sie doch nicht so viel und wir sehen mehr als sie.
Es ist merkwürdig, wie man ihre Meinungen verehrt. Es wird zum Verbrechen gemacht ihnen zu widersprechen und zum Frevel etwas hinzu zu fügen, als hätten sie nicht Wahrheiten hinterlassen zu erkennen.
Heißt das nicht die Vernunft des Menschen unwürdig behandeln und sie mit dem Instinct der Thiere in eine Reihe stellen? Man nimmt den Hauptunterschied weg, der darin besteht, daß die Leistungen der Vernunft ohne Aufhören zunehmen, wogegen der Instinct immer in gleichem Zustande bleibt. Die Stöcke der Bienen waren vor tausend Jahren eben so wohl abgemessen als heute und jede bildet jenes Sechseck eben so genau das erste Mal wie das letzte. Eben so ist es mit allem, was die Thiere durch diesen verborgnen Trieb hervorbringen. Die Natur unterrichtet sie, je nachdem die Nothwendigkeit sie drängt; aber diese schwache Kunst verliert sich, sobald sie sie nicht mehr brauchen. Sie empfangen sie ohne Studium und sind nicht so glücklich sie erhalten zu können und jedes Mal, wenn sie ihnen gegeben wird, ist sie ihnen neu. Die Natur, welche nur den Zweck hat die Thiere in einer beschränkten Vollkommenheit zu erhalten, flößt sie ihnen jene einfach nothwendige und immer gleiche Kunst ein, damit sie nicht verkommen und gestattet nicht, daß sie etwas hinzuthun, damit sie nicht die Gränzen überschreiten, welche sie ihnen vorgeschrieben hat.
Anders ist es mit dem Menschen, der nur für die Unendlichkeit geschaffen ist. In der ersten Zeit seines Lebens ist er in Unwissenheit, aber wie er fortschreitet, unterrichtet er sich ohne Aufhören, denn er zieht nicht bloß von seiner eignen Erfahrung Nutzen, sondern auch von den Erfahrungen seiner Vorgänger, weil er die Kenntnisse, die er sich einmal erworben, immer im Gedächtniß bewahrt und weil die Kenntnisse der Alten immer in den Büchern, die sie darüber nachgelassen haben, vorhanden sind. Und wie er seine Kenntnisse bewahrt, so kann er sie auch leicht vermehren, so daß die Menschen heute in gewisser Art auf demselben Standpunkt sind, worauf jene alten Philosophen sich befinden würden, wenn es möglich gewesen wäre, daß sie bis jetzt fortgelebt und zu den Kenntnissen, die sie hatten, noch die hinzugefügt hätten, welche ihre Studien in so vielen Jahrhunderten ihnen würden erworben haben. So kommt es denn durch ein besonderes Vorrecht der Menschen, daß nicht allein jeder von ihnen Tag für Tag in den Wissenschaften fortschreitet, sondern daß alle zusammen darin einen ununterbrochenen Fortschritt machen, je älter die Welt wird; denn ein Gleiches geschieht in der Folge aller Menschen wie in den verschiedenen Alterstufen des einzelnen. Die ganze Reihefolge der Menschen im Lauf so vieler Jahrhunderte, muß angesehen werden als ein und derselbe Mensch, der immer besteht und fortwährend lernt. Daraus sieht man, wie unbillig es ist, wenn wir das Alterthum in seinen Philosophen respectiren. Das Alter ist die Zeit, die am Weitesten von der Kindheit abliegt, und wer sieht nicht, daß also das Alter jenes Universalmenschen nicht in den Zeiten, die seiner Geburt am Nächsten stehn, sondern in denen, die am Meisten von ihr entfernt sind, gesucht werden muß?
Diejenigen, welche wir Alte nennen, waren in Wirklichkeit jung in allen Dingen und bildeten eigentlich die Kindheit der Menschen und da wir mit ihren Kenntnissen die Erfahrung der Jahrhunderte, die auf sie gefolgt sind, verbunden haben, so kann man eigentlich in uns jenes Alterthum finden, was wir an den andern verehren. Sie müssen bewundert werden in den Schlüssen, welche sie vortrefflich aus den wenigen Grundgesetzen, die sie hatten, gezogen haben und sie müssen entschuldigt werden in denen, bei welcher ihnen mehr das Glück der Erfahrung als die Stärke des Denkens fehlte.
Waren sie zum Beispiel nicht zu entschuldigen in der Vorstellung, die sie von der Milchstraße hatten, wenn die Schwäche ihrer Augen noch nicht die Hilfe der Kunst empfing und sie diese Farbe einer größern Dichtigkeit in dem Theil des Himmels, der das Licht stärker zurückstrahlt, zuschrieben? Würden wir aber zu entschuldigen sein, wenn wir in derselben Vorstellung bleiben, jetzt da wir unterstützt von den Vortheilen, welche uns das Fernglas giebt, in der Milchstraße eine Unzahl von kleinen Sternen entdeckt haben, deren stärkeres Licht uns erkennen läßt, was die wahre Ursache jener weißen Farbe ist?
Hatten sie nicht auch Grund zu sagen, daß alle Körper, die dem Verderben unterworfen sind, in den Kreis des Mondes am Himmel eingeschlossen wären, weil sie während so vieler Jahrhunderte weder ein Untergehn noch ein Enstehn außer diesem Raume bemerkt hatten? Müssen wir aber nicht das Gegentheil versichern, weil die ganze Erde deutlich Kometen hat sich entzünden und weit außerhalb jener Sphäre verschwinden sehn?
Eben so ist es mit der Lehre vom leeren Raum. Sie hatten Recht zu sagen, die Natur leide keinen leeren Raum, weil alle ihre Erfahrungen ihnen immer gezeigt hatten, daß sie ihn fliehe und nicht leiden könne. Aber wenn die neuen Versuche ihnen bekannt gewesen wären, so würden sie vielleicht Veranlassung gefunden haben, das zu bejahen, was sie Veranlassung hatten zu verneinen aus dem Grunde, weil das Leere noch nicht zum Vorschein gekommen war. Auch in dem Schluß, welchen sie machten, daß die Natur nichts Leeres leide, haben sie doch nur von der Natur, in so weit sie sie kannten, zu sprechen gemeint, da es, ganz im Allgemeinen gesagt, nicht genug wäre sie in zehn oder in tausend Fällen oder in irgend einer andern noch so großen Zahl von Fällen beharrlich beobachte zu haben, denn wenn ein einziger Fall übrig bliebe zu erforschen, so würde dieser einzige hinreichen die allgemeine Entscheidung zu verhindern. In der That bei allen den Gegenständen, deren Beweis in Erfahrungen und nicht in Demonstrationen besteht, darf man daraus keine andre allgemeine Behauptung aussprechen als nur durch allgemeine Aufzählung aller Theile und aller verschiednen Fälle.
So, wenn wir sagen, der Diamant ist der härteste von allen Körpern, so meinen wir von allen den Körpern, die wir kennen und wir können und dürfen darunter nicht die mit begreifen, die wir nicht kennen, und wenn wir sagen, das Gold ist der schwerste von allen Körpern, so wäre es vermessen, wenn wir in diesen allgemeinen Satz auch die mitbegriffen, die uns nicht bekannt sind, obgleich es nicht unmöglich ist, daß sie in der Natur seien.
Also ohne den Alten zu widersprechen, können wir das Gegentheil behaupten von dem, was sie sagten und welches Ansehn auch das Alterthum hat, die Wahrheit muß immer den Vorzug haben, wenn sie auch kürzlich erst entdeckt worden ist; denn sie ist immer älter als alle Meinungen, die man je über sie gehabt und es hieße die Natur gar nicht kennen, wenn man sich einbilden wollte, sie hätte angefangen zu sein zu der Zeit, da sie anfing bekannt zu werden.
Zweiter Abschnitt. Betrachtungen über die Mathematik im Allgemeinen.
Bei Erforschung der Wahrheit kann man drei Hauptzwecke haben, erstens sie zu entdecken, wenn man sie sucht, zweitens sie zu beweisen, wenn man sie besitzt, drittens sie vom Falschen zu unterscheiden, wenn man sie untersucht.
Ich spreche nicht von dem ersten, sondern behandle besonders den zweiten, welcher den dritten einschließt; denn wenn man die Methode kennt die Wahrheit zu beweisen, so hat man zugleich die Methode sie zu unterscheiden, denn indem man untersucht, ob der Beweis, den man giebt, den Regeln, die man kennt, gemäß ist, sieht man auch, ob er genau geführt ist.
Die Mathematik, die in diesen drei Stücken ausgezeichnet ist, hat die Kunst entwickelt die unbekannten Wahrheiten zu entdecken, das nennt man Analyse und es wäre überflüssig darüber zu sprechen nach so vielen vortrefflichen Werken, die geschrieben worden sind.
Die Methode die schon gefundenen Wahrheiten zu beweisen und dieselben so auf zu hellen, daß der Beweis davon unwiderleglich sei, das ist die einzige, die ich angeben will und ich brauche dazu nur den Gang zu entwickeln, welchen die Mathematik dabei beobachtet; denn sie lehrt es vollkommen.
Indessen vorher muß ich einen Begriff von einer noch höhern und vollendetern Methode geben, welche aber die Menschen nie erreichen (denn was über die Mathematik geht, übersteigt uns) und doch ist es nöthig etwas über sie zu sagen, obgleich es unmöglich ist sie auszuüben.
Diese wahre Methode, welche die Beweise in der höchsten Vollkommenheit bilden würde, wenn es möglich wäre sie zu erreichen, würde in zwei Hauptsachen bestehen, erstens sich keines Ausdrucks zu bedienen, ohne zwar genau seinen Sinn zu entwickeln, und zweitens nie einen Satz auf zu stellen ohne ihn durch schon bekannte Wahrheiten zu beweisen, das heißt mit einem Wort, alle Ausdrücke zu definiren und alle Sätze zu beweisen.
Aber um der Ordnung, die ich entwickle, selbst zu folgen, muß ich erklären, was ich unter Definition verstehe. In der Mathematik erkennt man allein die Definitionen, welche die Logiker Namenerklärungen nennen, das heißt, allein die Benennungen, die man den Dingen giebt, nachdem man sie vollkommen durch bekannte Ausdrücke bezeichnet hat, und nur von diesen allein spreche ich.
Ihr Nutzen und ihr Gebrauch ist Aufhellung und Abstürzung der Rede, indem man mit dem bloßen Namen, den man beilegt, das ausdrückt, was sich nur mit mehren Worten sagen ließe; doch so, daß der beigelegte Namen von allem andern Sinn, wenn er einen hat, entkleidet bleibt um keinen andern mehr zu haben als den, wozu man ihn einzig bestimmt. Ein Beispiel ist folgendes. Wenn man benöthigt ist unter den Zahlen diejenigen, die durch zwei in gleiche Theile zu theilen sind, von denen, die das nicht sind, zu unterscheiden, so giebt man, um die öftere Wiederholung dieser Bedingung zu vermeiden, einen Namen in der Art: ich nenne jede durch zwei gleich theilbare Zahl eine gerade Zahl. Das ist eine mathematische Definition, denn erst hat man eine Sache klar bezeichnet, nämlich jede Zahl, die durch zwei gleich theilbar ist, und darauf giebt man ihr einen Namen, den man aller andern Bedeutung, wenn er eine hat, entkleidet um ihm die Bedeutung der bezeichneten Sache zu geben.
Daraus ist ersichtlich, daß die Definitionen sehr frei sind und nie dem Widerspruch unterworfen, denn es ist nichts mehr erlaubt als einer Sache, die man klar bezeichnet hat, einen Namen zu geben, wie man will. Man muß sich bloß in Acht nehmen, daß man die Freiheit, die man hat, Namen bei zu legen, nicht mißbraucht, indem man denselben an zwei verschiedene Sachen giebt. Nicht daß das nicht erlaubt wäre, wenn man nur die Folgerungen daraus nicht vermengt und nicht eine auf die andre ausdehnt. Verfällt man aber in diesen Fehler, so kann man ihm ein sehr sichres und unfehlbares Mittel entgegen setzen, nämlich daß man die Definition in Gedanken an die Stelle des Definirten setzt und die Definition immer so gegenwärtig hat, daß man jedes Mal, wenn man z.B. von der geraden Zahl spricht, genau bedenkt, das sei das, was in zwei gleiche Theile zu theilen ist, und daß diese beiden Dinge in der Vorstellung unzertrennlich verbunden seien und daß sobald die Rede das eine ausspricht, der Geist unmittelbar damit das andre verknüpfe. Denn die Mathematiker und alle, die methodisch zu Werke gehn, legen den Dingen nur Namen bei um die Rede ab zu kürzen und nicht um den Begriff der Dinge, von denen sie reden, zu verkleinern oder zu verändern und sie verlangen, daß der Geist immer die ganze Definition bei dem kurzen Ausdruck ergänze, den sie nur gebrauchen um die Verwirrung zu meiden, welche die Menge von Worten hervorbringt.
Nichts entfernt schneller und mächtiger die verfängliche List der Sophisten als diese Methode, die man immer gegenwärtig haben muß und die allein hinreicht alle Arten von Schwierigkeiten und Zweideutigkeiten zu verbannen.
Ist dies zu gut verstanden, so komme ich wieder auf die Erklärung der wahren Ordnung zurück, die, wie gesagt, darin besteht, daß man alles definirt und alles beweist.
Gewiß wäre diese Methode schön, aber sie ist absolut unmöglich, denn es ist einleuchtend, daß die ersten Ausdrücke, die man definiren möchte, andre vorhergehende voraussetzen würden, die zu ihrer Erklärung dienen müßten und daß eben so auch die ersten Sätze, die man beweisen möchte, andre voraussetzen würden, die ihnen vorangingen und auf die Art ist klar, daß man nie zu den ersten gelangen würde.
Treibt man auch die Nachforschungen weiter und weiter, so kommt man nothwendig auf primitive Wörter, die man nicht mehr definiren kann und auf Grundsätze, die so klar sind, daß man keine andern findet, die es mehr wären um ihnen zu Beweise dienen.
Hieraus geht hervor, daß die Menschen ein natürliches und unveränderliches Unvermögen haben irgend eine Wissenschaft in einer absolut vollendeten Methode zu behandeln; aber es folgt nicht daraus, daß man deshalb jede Art von Methode aufgeben soll.
Denn es giebt eine, nämlich die der Mathematik, die allerdings niedriger steht darin, daß sie weniger überzeugend, nicht aber darin, daß sie weniger gewiß ist. Sie definirt nicht alles und beweist nicht alles und darin steht sie niedriger; aber sie setzt nur Dinge voraus, die durch den natürlichen Verstand klar und aus gemacht sind und daher ist sie vollkommen wahr, denn die Natur unterstützt sie, wo die Rede es nicht thut.
Diese Methode, die vollkommenste bei den Menschen, besteht nicht darin alles zu definiren und alles zu beweisen auch nicht darin nichts zu definiren und nichts zu beweisen, sondern darin sich in der Mitte zu halten, nicht zu definiren die klaren und von allen Menschen verstandene Dinge und alle übrigen zu definiren, nicht zu beweisen die bekannten Dinge und alle übrigen zu beweisen. Gegen diese Methode sündigen eben so gut diejenigen, die alles zu definiren und alles zu beweisen versuchen als auch die, welche das versäumen in den Dingen, die nicht von selbst einleuchten.
Dies lehrt die Mathematik vollkommen. Sie erklärt nichts von solchen Dingen als Raum, Zeit, Bewegung, Zahl, Gleichheit und dergleichen weiter, deren es sehr viele giebt; weil diese Ausdrücke die Dinge, die sie bedeuten, für die, welche die Sprache verstehen, so natürlich bezeichnen, daß die Erklärung, die man davon machen wollte, mehr Dunkelheit als Belehrung schaffen würde.
Nichts ist schwächer als das Gerede derer, die solche primitive Wörter definiren wollen[2q]. Welche Nothwendigkeit giebt es z.B. zu erklären, was man unter dem Wort Mensch versteht? Weiß man nicht zur Genüge, was für ein Ding das ist, welches man mit diesem Ausdruck bezeichnen will? und welchen Vortheil meinte Plato uns zu verschaffen, da er sagte: der Mensch wäre ein Thier auf zwei Beinen ohne Federn? Als wenn der Begriff, den ich natürlich davon habe und den ich nicht ausdrücken kann, nicht viel schärfer und sichrer wäre als der, welchen er mir durch seine Erklärung giebt, die unnütz und sogar lächerlich ist, da ein Mensch nicht die Menschheit verliert, wenn er die beiden Beine verliert und ein Kapaun sie nicht erlangt, wenn er seine Federn los wird.