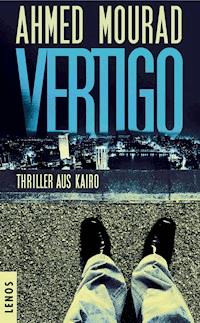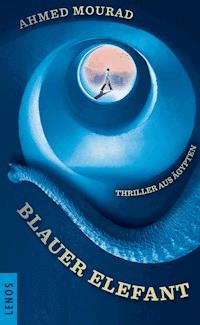
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lenos Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Lenos Polar
- Sprache: Deutsch
Jachja, Doktor der Psychologie, nimmt nach fünf Jahren selbstgewählter Isolation seine Arbeit in der forensischen Psychiatrie wieder auf. Sein erster Patient ist ein alter Bekannter: Scharîf ist des Mordes an seiner Frau verdächtig. Sollte er die Tat wirklich begangen haben und nicht geisteskrank sein, droht ihm der Galgen. Was als Versuch beginnt, die offensichtliche Persönlichkeitsspaltung seines alten Freundes zu enträtseln, wird schon bald zu einem Höllentrip: Als Jachja, der Drogen jeder Art nicht abgeneigt ist, in einer ausschweifenden Nacht eine Pille mit einem sechsbeinigen Elefanten einnimmt, sieht er sich in eine andere Realität versetzt. Zusehends versinkt er in Halluzinationen, in einem Strudel aus Zaubersprüchen, geheimnisvollen Zahlen und einem Tattoo, das sich in einen Dämon verwandelt. Als sich schließlich ein weiterer Todesfall ereignet, gibt er sich selbst die Schuld. Der packende, surrealistische Psychothriller ist nach "Vertigo" und "Diamantenstaub" der dritte Roman des ägyptischen Bestsellerautors. Er war 2014 für den International Prize for Arabic Fiction (Shortlist) nominiert, wurde im selben Jahr von Marwan Hamed verfilmt und 2015 von der Egyptian Modern Dance Theatre Company auf die Bühne gebracht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 480
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
www.lenos.ch
Ahmed Mourad
Blauer Elefant
Thriller aus Ägypten
Aus dem Arabischenvon Christine Battermann
Der Autor
Ahmed Mourad, geboren 1978 in Kairo, studierte an der Filmhochschule der ägyptischen Hauptstadt. Sein Abschlussfilmprojekt gewann mehrere internationale Preise. Er ist Filmemacher, Drehbuchautor und Fotograf, einst arbeitete er auch als persönlicher Fotograf des Staatspräsidenten. Seit 2007 veröffentlichte er sechs Thriller und historische Romane, die zu Bestsellern in Ägypten wurden. Ahmed Mourad lebt in Kairo.
Im Lenos Verlag erschienen seine Thriller Diamantenstaub (2014) und Vertigo (2016) in deutscher Übersetzung.
Die Übersetzerin
Christine Battermann, geboren 1968 in Wuppertal, studierte Arabisch und Türkisch in Bonn. 1996–2000 Lehrbeauftragte für Türkisch an der Universität Bonn. Seit 1998 freie Literaturübersetzerin. Sie übertrug u.a. Werke von Ahmed Khaled Towfik, Machmud Darwisch, Rosa Yassin Hassan und Alexandra Chreiteh ins Deutsche und lebt in Köln.
Zur Erleichterung der Aussprache arabischer Namen wurden in der Übersetzung betonte lange Silben mit einem Zirkumflex (^) versehen.
Titel der arabischen Originalausgabe:
al-Fîl al-azraq
Copyright © 2012 by Ahmed Mourad
E-Book-Ausgabe 2018
Copyright © der deutschen Übersetzung
2018 by Lenos Verlag, Basel
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung und -motiv: Hauptmann & Kompanie, Zürich, Dominic Wilhelm
eISBN 978 3 85787 964 7
Inhalt
Der Autor
Die Übersetzerin
Inhalt
Dank
Endnoten
September
Temperatur: 43 Grad Celsius
Der Handywecker riss mich aus finsterstem Schlaf. Nach Luft ringend und mit beklommenem Herzen lag ich auf der linken Seite. Ich hatte furchtbares Sodbrennen und troff vor Schweiss wie ein Boxer in der zwölften Runde.
Angestrengt versuchte ich, zum Nachttisch zu langen, aber mein Arm war eingeschlafen und gehorchte mir nicht. Nachdem ich ihn geschüttelt hatte, strömte das Blut jedoch wieder hinein, und ich griff nach dem Telefon, um das penetrante Klingeln abzuschalten. Schliesslich brachte ich es sogar fertig, mich aufzusetzen. Dabei musste ich gegen die morgendliche Benommenheit und den Kopfschmerz ankämpfen, der wie glühende Kohle in meinem Hinterkopf brannte und mir Lava zwischen die Augen goss. In Anbetracht des Restalkohols in meinem Blut hatte dieser Schmerz allerdings auch seine Berechtigung. Im Schrankspiegel gegenüber sah ich mein Bild, eine griechische Tragödie, die nur noch jemand niederschreiben musste. Ich streckte den Rücken durch, liess die Wirbel schmerzhaft knacken und drehte mir meine Morgenzigarette.
Währenddessen betrachtete ich die cremefarbene Harley Davidson Fat Boy mit 132 PS, die mit mehreren Kissen zwischen den Beinen neben mir parkte. Ihr röhrender Motor hatte letzte Nacht die Nachbarn aus dem Schlaf gerissen, und ich war so ausgiebig auf ihr geritten, dass ich nun ziemlichen Muskelkater hatte. Ich musterte ihre rekordverdächtigen Kurven, die weissen, sommersprossigen Schultern, die wilden Locken, in denen noch der Alkohol hing, und die beiden Tachometer, auf denen ich meine Fingerspuren hinterlassen hatte.
Mit dir, Maja, hat man immer karibischen Sommer – selbst auf dem Mond!
Nachdem ich mein Nikotin aufgesogen hatte, streckte ich einen Fuss aus dem Bett und tastete nach den Schlappen, um darin wie üblich mit knackenden Knöcheln in die Küche zu schwanken. Dort griff ich mir eine bibbernde Flasche Meister Max aus dem Kühlschrank, ein Kater lässt sich schliesslich am besten mit Alkohol bekämpfen. Ich leerte sie in einem Zug und setzte sie dann vorsichtig auf die Flaschenpyramide, deren Bau ich zwei Monate zuvor in Angriff genommen hatte, um meinem Namen Unsterblichkeit zu verleihen. Nur noch ein paar Flaschen, dann hatte ich die Spitze erreicht! Ich holte mir Eiswürfel aus dem Gefrierfach, nahm sie mit ins Bad, verstöpselte den Abfluss, drehte den Hahn auf und leerte meine Hand ins Waschbecken. Als es vollgelaufen war, steckte ich den Kopf ins eiskalte Wasser, damit meine geweiteten Blutgefässe sich wieder zusammenzogen. So versuchte ich das Blut auf diplomatischem Wege davon abzuhalten, ständig in meinen Kopf zu strömen. Nach einer Minute verglomm die Glut und erlosch. Ich hauchte die siebenunddreissig Jahre an, die mir aus dem Spiegel entgegenschauten. Zeit genug, selbst einen Elefanten zu verwandeln. Allerdings bleibt der ein Elefant und behält seinen Rüssel. Bei mir lag die Sache anders: Alle Jahre wieder sah ich mich im Spiegel einem Fremden gegenüber, dessen Gesicht ich, wenn ich es mit den Fotos aus der Sekundarschulzeit verglich, kaum wiedererkannte. Ich stand mit mir selbst in keinerlei Zusammenhang mehr! Und dann die Erosionserscheinungen: In den Bart schmuggelte sich ein weisses Härchen nach dem anderen, die Zähne wurden durch Zigaretten und Kaffee immer unansehnlicher, und über die Augäpfel rankten sich rote Äderchen wie Efeu an einer Mauer.
Ein leichtfüssig nahender Tod.
Ich liess eine kalte Dusche über mich ergehen und stach mir den gnädigen Insulinpen in den Schenkel. Dreissig Einheiten, um das schändliche Versagen meiner Bauchspeicheldrüse zu kompensieren und im Voraus zu verbrennen, was ich bis zum Abend unterwegs in mich reinstopfen würde. Ich brockte mir einen Sesamkringel auf ein Stück Käse und betrachtete dabei das Couvert mit dem Mahnschreiben auf dem Tisch. Schliesslich nahm ich das Briefblatt heraus und liess den Blick über die unappetitlichen Worte wandern.
Zweite Abmahnung: unentschuldigtes Fehlen am Arbeitsplatz Herr Jachja … und in Anbetracht dessen, dass Sie, ohne der Klinikleitung eine Entschuldigung zukommen zu lassen, Ihrer Arbeit mehr als fünfzehn Tage ferngeblieben sind und damit die gesetzliche Frist überschritten haben … ist die Leitung gezwungen, Massnahmen … und die Bestimmungen von Paragraph 98 des Gesetzes Nummer 47 aus dem Jahre … mit endgültigem Beschluss …
Zur Hölle mit den Vorschriften, möge Gott die Akten verbrennen und die Beamten in alle Winde zerstreuen!
Ich hörte auf zu lesen, zerknüllte den Brief und warf ihn in Richtung Mülleimer. Wie üblich landete er daneben. Ich ging in mein Zimmer und öffnete den Schrank, um mir etwas zum Anziehen zu holen. Mein Blick fiel auf ein altes Sakko, das sich in einer Ecke vor mir versteckte. Ich schüttelte es aus und probierte es neugierig an, aber weil ich mir darin so verloren vorkam wie der Klöppel in einer Glocke, legte ich es wieder ab und stopfte es in eine Tüte. Dann zog ich mich an, suchte in dem Tohuwabohu nach zwei gleichfarbigen Socken und ging zu Maja zurück, die, von den Pfeilen der Lust niedergestreckt, auf der Seite lag.
Ich strich ihr die Locken beiseite und flüsterte ihr ins Ohr: »Ich muss was besorgen gehen.«
Sie bewegte sich nicht, öffnete nicht einmal die Lider, sondern antwortete nur mit erotisch rauchiger Stimme: »Das ist nicht dein Ernst. Warte doch noch, bis ich richtig wach bin!«
»Das geht nicht. Ruf mich an!«
Sie gähnte. »Okay.«
»Dreh den Hahn im Bad zu, wenn du fertig bist, und schliess die Tür ab, Maja, hörst du?«
»Okay, okay.«
Die drei wichtigsten Erfindungen der Menschheit:
Elektrizität.
Alkohol.
Und Maja™. Achtundzwanzig Jahre Erfahrung.
Ich drückte ihr einen Kuss auf den Rücken und ging hinaus in den verkommenen Garten vor dem Haus. Ich lief über das durstige Gras und an meinem Auto vorbei, das vor dem Eingang kauerte wie ein Rhinozeros ohne Horn. Am linken Kotflügel war die Schutzplane hochgerutscht. Ich zog sie wieder herunter, bis auch der platte Reifen verdeckt war. Dann überquerte ich die Strasse und kaufte mir eine Zeitung, die erste seit fünf Jahren. Ich winkte ein Taxi heran, liess mich in die Rückbank sinken, setzte meine Sonnenbrille auf und packte meine bescheidene Ausrüstung aus. Zigarettenpapier, Tabak und eine Stopfmaschine. Ich hasste die schnell abbrennenden Fertigzigaretten voll pürierter Mäuse und Arbeiterspucke! Während ich mir zehn »anständige« Zigaretten drehte, die mir für den halben Tag reichen würden, beobachtete ich im Rückspiegel die Augen des Fahrers. Angewidert warf er mir wutentflammte Blicke zu und flehte bei Gott um Beistand gegen den verirrten Haschischraucher. Der Mann wusste ja nicht, dass ich schon volle drei Tage nicht mehr bei Auni gewesen war. So lange hatte ich es noch nie ohne sein marokkanisches Haschisch ausgehalten!
Ich stopfte die Zigaretten in meine Dose, liess die Scheibe herunter, um mein Nikotin auf die Strasse zu blasen, und beobachtete die Menschen, die, noch im Halbschlaf und mit Sand in den Augen, zu ihrer Arbeit glitten. Dann allerdings gerieten wir in einen solchen Stau, dass ich mich fragte, ob bei einem möglichen Angriff auf unser Land die Invasoren mit ihren Panzern überhaupt durchkämen.
Ich schlug die Zeitung auf, und sie enttäuschte mich nicht: Chefredakteur war die Langeweile! Mühsam arbeitete ich mich bis zur Nachrichtenseite durch.
»Das Islamische Museum ist beraubt worden?«, fragte ich den Fahrer, ehrlich überrascht.
Er warf mir im Spiegel einen Blick zu, der schlimmer war als jede Verunglimpfung meiner Mutter, dann antwortete er: »Herzlich willkommen auf der Erde, Pascha! Das ist acht Monate her. Den Dieb haben sie immer noch nicht. Täglich nehmen sie jemand fest, aber dann war er’s doch nicht. Riesensummen haben die Hundesöhne ausgegeben, um das Museum zu renovieren und zu versichern. Und am Ende wird es ausgeraubt! Mit dem Geld hätten sie besser die Haschischsüchtigen behandelt, von denen das ganze Land wimmelt!«
Ich quittierte seine giftige Botschaft mit einem bitteren Lächeln, faltete die Zeitung zusammen und stopfte sie als Geschenk für den nächsten Fahrgast in die Rückenlehne des Vordersitzes. Dann labte ich mich an den Abgasen, dem Lärm und meinem Zigarettenrauch, der den Chauffeur so störte, bis wir endlich an der Umfassungsmauer des Krankenhauses ankamen – der Abbassîja-Klinik für Psychiatrie. Ich bezahlte den verärgerten Fahrer und ging auf das Pförtnerhaus zu.
Heraus trat ein Mann, dem der Bauch bis zum Knie hing. »Besuch?«
»Wie geht’s Ihnen, Abdalfattâch?«
Er kniff die Augen zusammen, um mich besser sehen zu können, dann hellte sich sein Gesicht auf.
»Wie schööööön, Doktor Jachja! Ich hab Sie wirklich nicht erkannt, mit dem Bart sehen Sie total verändert aus. Was für ein Glück für die Klinik, dass Sie wieder da sind! Bitte sehr …«
Ich ging weiter, links und rechts die blasstürkis gestrichenen, einstöckigen Stationsgebäude, die teilweise mehr als hundert Jahre alt waren.1 Ringsumher irrten Patienten, ausgemergelt und mit leblos starren Blicken, kostbare Seelen in gebeugten Körpern. An ihren Fingern baumelnde Plastiktüten bargen ein ganzes Leben, wertlosen Plunder oder Träume, die nach jemandem suchten, der sie zu deuten wusste. Die meisten von ihnen sahen unverändert aus, trotz meiner fünfjährigen Abwesenheit.
Bevor ich das Direktionsgebäude erreichte, fiel mein Blick auf eine Leiche mitten im Park. Man hatte ihr sämtliche Glieder abgetrennt, und doch hatte niemand es gewagt, sie der Erde zu übergeben. Ich bückte mich und tastete nach ihrem Herzen – dem Herzen des Blauen Eukalyptusbaums, der erbleicht und so grau wie Staub war. Ein besiegter Gigant, dessen Leib nun den Passanten als Sitzgelegenheit diente.
»Doktor!«
Wie aus dem Nichts stand plötzlich Onkel Sajjid vor mir, der berühmteste Patient der Klinik, ein über siebzigjähriger ehemaliger Schneider, von dem niemand mehr wusste, wann er hierhergekommen war, nicht einmal er selbst. Residual schizophrenia2 hatte man seinen Zustand genannt, als ich ihn fünf Jahre zuvor verlassen hatte. Er trug ein ehemals grünes Hemd und ein verschlissenes Basecap, das sein zahnloses Grinsen jedoch nicht verbergen konnte. Sein halber Fuss sah aus den zerrissenen Holzschlappen heraus, so dass die ungepflegten Zehen bis auf den Boden hingen, und in der Hand trug er eine Tüte, die mit Stoffen, Garn und Nadeln vollgestopft war.
»Hallo, Onkel Sajjid! Wie geht es dir, mein Guter?«
»Er wusste, dass Sie zurückkommen würden«, flüsterte er leise. »Es war uns bestimmt, uns bei dem Baum zu treffen.«
Ich überging seinen Hinweis auf den, der ihm meine Rückkehr angekündigt hatte, und fragte ihn stattdessen nach dem gefällten Eukalyptusbaum.
»Ich hab ihn mit eigenen Ohren schreien hören, als sie ihn geschlachtet haben.«
»Schreien hören! Wunderbar. Du bist noch immer in der Intermediären Betreuung, stimmt’s? Ich komm mal bei dir vorbei.«
Der Mann wollte schon gehen, aber ich hielt ihn zurück und gab ihm mein altes Sakko, auch wenn es an ihm aussehen würde wie eine Autoschutzhülle über einem Motorrad.
»Motz es ein bisschen auf, und schneid es dir zurecht, Meister! Das hab ich aus dem Ausland.«
Mit dankbarem Lächeln legte sich der Mann das Sakko über den Arm und ging.
Als ich die Stufen zum Direktionsgebäude erklomm, wich ich den musternden Blicken der Kollegen und anderen Angestellten aus, um allen Fragen aus dem Wege zu gehen, die zu beantworten ich nicht die Energie finden würde. Ich ignorierte ihre Neugier und ging geradewegs ins Büro der Klinikleiterin, Frau Doktor Safâa.
Obwohl schon über fünfundfünfzig, hatte sie sich eine gewisse Schönheit bewahrt, der sie mit Puder und sorgfältig lackierten Nägeln etwas nachhalf. Als sie mich in der Tür stehen sah, beendete sie ihr Telefonat und warf mir einen säuerlich-vorwurfsvollen Blick zu, den ich deutlich spüren sollte. Mit angehaltenem Atem, damit sie den morgendlichen Alkohol nicht roch, gab ich ihr die Hand.
»Willkommen, Jachja! Wie ist es, haben Sie die Klinik nicht vermisst?«
Ich nahm ihr gegenüber Platz. »Ich hab sie vermisst, einschliesslich der Ärzte und Patienten.«
»Was möchten Sie trinken?«
Ich bemühte mich, dem Sonnenlicht standzuhalten, das durch das Fenster hinter ihrem Kopf hereinschien. »Kaffee, mit einem halben Löffel Zucker.«
Sie beugte sich über das Telefon und sagte: »Kaffee mit einem halben Löffel Zucker, Badr!«
»Was ist mit dem grossen Eukalyptusbaum passiert?«
»Das ist vier Jahre her, es war eine Schande. Gott sei Dank konnten wir das Ganze an dieser Stelle stoppen. Einen sechzig Jahre jüngeren Baum wollte das Gouvernement auch noch abholzen lassen. Wir haben die Sache bis vor den Minister gebracht, al-Masri al-Jaum3 hat darüber berichtet. Sie müssen doch davon gehört haben!«
»Ich lese keine Zeitungen.«
»Leben Sie noch immer allein? Haben Sie keine …?«
»Ich fühle mich nur wohl, wenn ich allein bin. Aber alle zwei Wochen fahre ich nach Alexandria und besuche meine Mutter und meine Schwester.«
Der Laufbursche brachte den Kaffee, und so konnten wir zunächst nicht weiterreden. Zur Begrüssung umarmte er mich liebenswürdig und mit schweissnasser Wange. Ich nahm mich zusammen und verzichtete darauf, mich abzuwischen, bis er wieder gegangen war.
Safâa liess ihre Brille auf die Nasenspitze rutschen und tat, als sei sie mit ihren Papieren beschäftigt. Ich wusste, dass sie jetzt die unerlässlichen Einleitungsfloskeln hinter sich hatte und über mich herfallen würde. Grossmütig liess sie mich ein wenig Koffein schlürfen, um mir dann, ohne mich anzusehen, die Frage zu stellen, die den Schrecken für mich auf die Spitze trieb: »Haben Sie das Schreiben zu der Personalangelegenheit erhalten?«
Es brauchte einen weiteren Schluck, bis ich ihr antworten konnte: »Den Drohbrief? Ist angekommen.«
Meine absichtliche Provokation liess sie explodieren: »Dieses Jahr sind es volle fünf Jahre, dass Sie nicht zur Arbeit erschienen sind, Jachja! Dass ein Angestellter sich fünf Jahre lang einfach nicht blicken lässt, ist in der Geschichte der Klinik noch nicht vorgekommen. So was können wir nicht verkraften! Ich nehme ja Rücksicht auf das, was passiert ist, und habe den Gang der Dinge schon zigmal aufgehalten. Selbst dann noch, als sie Leute geschickt haben, die uns nach Ihrem Zustand fragten. Ich meine die Dienstaufsicht von der Agentur für Organisation und Verwaltung. Die wollten schon rechtliche Massnahmen einleiten, wäre ich nicht eingeschritten und hätte verhindert, dass die Informationen weitergegeben wurden. Wenn jemand gegen Vorschriften verstösst, schreite ich selbstverständlich ein. Aber bei Ihnen soll ich dann den Mund halten? Ich werde niemandem gestatten, mir vorzuwerfen, ich hätte zwei Gesichter oder legte zweierlei Mass an.«
»Nein, natürlich nicht, ich weiss ja, dass …«
»Hinzu kommen die Leute«, unterbrach sie mich, »die unter denen, die sich freinehmen, und unter den Ermittlungen zu leiden haben. Am meisten hat mich geärgert, dass auch Doktor Abdalmuati in ein schiefes Licht gerät. Der Mann betreut Ihre Dissertation, und Sie lassen seit drei Jahren nichts von sich hören! Oder steckt ein Plan dahinter? Wie sieht es aus, Jachja? Keine Arbeit, keine Dissertation – was bleibt denn da noch?«
»Die Forschungen brauchen ihre Zeit. Und ausserdem …«
»Wenn Sie meinen, dass der Doktortitel nicht so wichtig ist, gut! Vielleicht geht es ja auch ohne, und Sie können an irgendeiner Universität im Ausland unterkommen, obwohl ich das bezweifle. Aber die Arbeit? Wollen Sie auch ohne die leben?«
»Mit der Dissertation bin ich schon ziemlich weit und …«
Zum zweiten Mal unterbrach sie mich: »Doktor Abdalmuati hat mir mitgeteilt, ›Ich bin schon ziemlich weit‹, hätten Sie schon vor drei Jahren gesagt. Wissen Sie, was das heisst?«
»Ich weiss. Das Problem ist nur, dass ich …«
Aber zum dritten Mal fiel sie mir ins Wort: »Das heisst, dass Ihre Karriere und Ihre Zukunft mit einem Federstrich zu Ende sind.«
Ihre Worte waren – ein Bollywoodfilm, den man zum tausendsten Mal sieht!
»Ich bin nicht nur die Leiterin der Klinik, Jachja, ich betrachte mich, wie Sie wissen, auch als Ihre grosse Schwester. Das Äusserste, was ich tun kann, um eine Entlassung zu vermeiden, ist, dass ich Sie wieder an die Arbeit zurückkehren lasse und dass Sie wieder regelmässig kommen. Ich tue das ganz aus eigenem Antrieb. Sie wissen ja nicht, was für eine grosse Sache die Dienstaufsicht daraus machen wollte! Aber ich hab sie dran gehindert.«
Es ist wissenschaftlich erwiesen: Eine Frau verwendet das Wort ich beim Sprechen mehr als doppelt so oft wie ein Mann.
»Und wohin soll ich zurückkehren?«
»In die Klinik.«
»Ah – gut! Ich schreibe die Dissertation fertig, und dann komme ich wieder.«
»Ob Sie sie abschliessen oder nicht, Hauptsache, Ihre Situation entspricht den Vorschriften. Sorgen kann ich nicht gebrauchen. Das ist meine einzige Bedingung dafür, zu intervenieren und Sie unter meine Fittiche zu nehmen.«
Nach diesen Worten steckte sie ihre Nase wieder in die Papiere und tat, als lese sie. Allerdings bewegten ihre Augen sich nicht über die Zeilen. Sie liess mich warten, bis ich so gut abgehangen war wie ein Stück zähes Kamelfleisch. Mir fiel auf, dass sie die Füsse in Abwehrhaltung übereinandergelegt hatte. Der Zeiger der Wanduhr hinter ihrem Kopf zählte die Sekunden, bis sie beschloss, in die zweite Runde zu gehen – mit einem entscheidenden Hieb.
»Und sollten Sie nicht regelmässig erscheinen, werde ich Sie ebenfalls unter meine Fittiche nehmen. Allerdings werde ich dann, nachdem sie mein Ansehen bei den Angestellten und Kollegen so in den Schmutz gezogen haben, dafür Sorge tragen, dass Sie keine Beschäftigung mehr finden. Sehen Sie mal zu, wer Sie noch anstellt, wenn Sie aus der Abbassîja-Klinik rausgeflogen sind!«
Sie schluckte. Ihre zweite Warnung bedeutete mit zwei-undsiebzigprozentiger Wahrscheinlichkeit nur, dass sie ihre spekulativen Drohungen fortsetzen würde, bis auch noch der letzte Kubikzentimeter Luft im Raum verbraucht wäre.
»Wann soll ich denn immer hier sein?«, fragte ich sie.
»Gemäss Dienstplan, genau wie Ihre Kollegen.«
Ich wusste nichts einzuwenden.
»Und schreiben Sie Ihre Dissertation fertig!«
»Können wir das mit der Dissertation nicht verschieben und …«
Sie unterbrach mich zum vierten Mal: »Sagten Sie nicht, Sie arbeiten daran? Mein Angebot ist ein take it or leave it package.«
Bei diesen Worten ballte sie die Faust. Jetzt mit ihr zu diskutieren würde nichts bringen. Ausserdem hatte sie ja dummerweise recht. Meine Entlassung aus der Klinik würde einen Makel hinterlassen, der nie mehr zu tilgen wäre.
Ich nickte also und zwang meine Lippen zu einem Lächeln »minderwertiger lokaler Produktion«.
Seufzend registrierte sie meine fragwürdige Unterwerfung. »Gut, gut! Wie lautete noch einmal das Thema Ihrer Doktorarbeit? Helfen Sie mir!«
»Psychoanalysis through the Body Language.«
»Psychoanalyse über die Körpersprache. Gut. Haben Sie Ihre Diplomarbeit noch?«
»Hab ich.«
»Das wird Ihnen vieles erleichtern. Reissen Sie sich zusammen! Dann brauchen wir jetzt nur noch nach einer Stelle zu suchen. Wo möchten Sie denn hin?« Sie schlug eine Akte auf und blätterte darin. »Ich hab einen Platz auf Station 7 – Frauen.«
»Die Inkontinenz halt ich nicht aus!«
»Wo möchten Sie dann hin?«
Ich versuchte, das zwanghafte Gähnen zu unterdrücken, das mich immer überkommt, wenn ich mich am liebsten aus dem Staub machen würde. »Ich weiss es wirklich nicht.«
»Hm. Die Intermediäre Betreuung ist voll. Hygiene 58 auch. Was halten Sie von 8 West? Doktor Muwaffak ist verreist, und ich brauche jemanden, der ihn vertritt.«
»8 West. In Ordnung!«
»Die Umstände dort kommen dem Thema Ihrer Dissertation entgegen. Und vielleicht erklärt Doktor Kilâni sich ja bereit, sie zu betreuen. Warum lachen Sie?«
»Ich lache, weil Sie schon wussten, dass ich Station 7 ablehnen würde. Ich sollte anfangen, über meine Optionen nachzudenken, und darüber vergessen, dass ich eigentlich überhaupt nicht in die Klinik zurückkehren wollte.«
Sie setzte die Brille ab und lehnte sich mit einem überraschten Lächeln zurück. »Statt mir hier Lektionen zu erteilen, stecken Sie Ihr Wissen lieber in Ihre Dissertation! Sie waren einer meiner fähigsten Ärzte, Jachja. Jeder weiss noch, was Sie in den paar Jahren, die Sie bei uns waren, alles zustande gebracht haben, bevor … vor fünf Jahren, meine ich. Es wäre eine Schande, wenn das alles den Bach runtergeht!«
Ich nickte verständnisvoll, damit sie ihre Vorlesung in analytischer Chemie beendete.
»Werfen Sie doch, bevor Sie gehen, noch einen Blick auf das neue Haus 8 West. Vor dem Salâch-Sâlim-Tor links.«
»In Ordnung.«
Doch bevor ich die Tür erreicht hatte, rief sie mich zurück. »Noch was, Jachja – was Ihren Bart betrifft …«
»Wie? Ist das heutzutage verboten?«
»Nein, er macht Sie nur etwas älter. Und wie Sie wissen, versuchen wir das Klischee vom Psychiater mit Bart und Pfeife, mit dem man uns im Kino nervt, zu brechen. Nun ja.« Als sie meinen missbilligenden Blick sah, hielt sie inne. »Whatever«, fügte sie hinzu, »schön, dass Sie wieder da sind.«
Wie hätte es schlimmer ausgehen können? Mein Einverständnis, die Arbeit wiederaufzunehmen, war, als kehrte ein Lebenslänglicher freiwillig ins Gefängnis zurück, nachdem er dem frühen Aufstehen, dem An- und Abmelden, den regelmässigen Sitzungen der Hygienekommission und dem gezwungenen Small Talk mit den Kollegen schon einmal entronnen war.
Zurück in die Hölle auf Erden.
Als Abwehrtechnik gegen die Erhöhung meines Blutzuckerspiegels liess ich die Sache jedoch vorerst auf sich beruhen. In den kommenden Tagen allerdings wollte ich aufrichtig und hingebungsvoll an einem überzeugenden Vorwand feilen, um mich aus dem Staub machen zu können. Ich verabschiedete mich von Doktor Safâa, unterschrieb die Erklärung über die Wiederaufnahme meiner Arbeit mit fester, hasserfüllter Schrift und machte mich auf zu Haus 8 West4.
Die Strecke vom Direktionsgebäude bis zum westlichen Rand des Klinikgeländes dauerte eine Zigarette. Auf beiden Seiten des Weges standen alte Bäume und schauten auf die Passanten herab. Insgeheim betete ich darum, dass die Schwärme von Kuhreihern, die auf den Ästen hockten, mich nicht mit einer milden Gabe beehrten. Schliesslich kam ich zu einer hohen Mauer, auf der mit Messingbuchstaben geschrieben stand: »Forensische Station«. An den oberen Gebäudeecken waren grosse Scheinwerfer angebracht, die nach der Dämmerung die Nacht zum Tage machen würden, und in hohen Türmen sassen Wachleute. Davor parkte ein geräumiger Gefangenentransporter, in dem zwei Offiziere ihre Langeweile hinter grossen Sonnenbrillen versteckten. Ringsum, im Schatten der wenigen noch übrig gebliebenen Bäume, trieben sich ihre Rekruten herum.
Station 8 West nahm Personen auf, die ein Verbrechen begangen hatten und über deren Schuldfähigkeit man sich nicht im Klaren war. Im Zuge der unter strenger Bewachung stattfindenden Ermittlungen brachte man sie dorthin, um sie innerhalb von etwa fünfundvierzig Tagen auf ihren psychischen und geistigen Zustand hin zu untersuchen. So wollte man den Grad ihrer Schuldfähigkeit zum Zeitpunkt des Verbrechens feststellen. Sollten sie für ihre Taten verantwortlich sein, stellte man sie vor ein reguläres Gericht. Falls jedoch eine geistige oder seelische Krankheit sie zu dem Verbrechen getrieben hatte, kamen sie in den Massregelvollzug in al-Chânka. Dort wurden sie therapiert und im Falle ihrer Genesung wieder auf freien Fuss gesetzt. Aufgabe der Ärzte auf Station 8 West war es, diesen Streitpunkt zu klären und die Justiz mit ihrem Gutachten bei der Urteilsfindung zu unterstützen.
Als ich das mit Ketten gesicherte Eisentor erreicht hatte, winkte ich einem Rekruten, der irgendetwas vor sich hinmurmelte. Als er herankam, senkte ich selbstgewiss die Lider. »Doktor Jachja«, sagte ich.
Der Rekrut steckte seinen Schlüssel ins Schloss und öffnete die schweren Eisenketten. »Ich sehe Sie hier zum ersten Mal, Exzellenz«, sagte er.
»Ein langer Urlaub.«
Das Gebäude hinter den Mauern bestand aus einem einzigen grossen, blassrot verklinkerten, ebenerdigen Geschoss in Form eines Rechtecks mit einer Aussparung an einer Seite. Die vergitterten Fenster und schweren Türen umgab eine Atmosphäre der Hoffnungslosigkeit. Nachdem ich es umrundet hatte, ging ich durch ein Tor, auf dem stand: »Männersektion A«. Der Erste, den ich dort traf, war Muchsin, ein Pfleger, mit dem ich früher zwei Jahre zusammengearbeitet hatte. Dürr wie ein Besenstiel, mit langen Zähnen, die Pupille des rechten Auges grösser als die des linken, begrüsste er mich herzlich. Anschliessend passierten wir einen Schreibtisch mit einem Hauptmann und zwei Polizeisekretären dahinter und traten in einen langen Gang voller Feuerlöscher und Türen.
Wie ein Touristenführer durchbrach Muchsin dabei das Hallen unserer regelmässigen Schritte mit seinen Erklärungen: »Dieses Gebäude ist viel besser als das alte, nur dass die Pflegezimmer ein bisschen eng sind. Sie haben es in A für gefährliche Patienten, B für normale und C für Frauen unterteilt. Zurzeit haben wir zweiundfünfzig Angeklagte, siebenunddreissig von ihnen wegen Mordes.« Muchsin öffnete eine Tür und fuhr fort: »Das ist das Ärztezimmer. Heute ist der Ausschuss früh fertig, nur Doktor Sâmich ist noch auf der Toilette. Soll ich Tee machen?«
»Welcher Sâmich? Sâmich Sidân etwa?«
»So Gott will.«
Von allen nutzlosen Menschen, die ich lieber vergessen hätte, war niemand so nutzlos wie Sâmich!
»Machen Sie mir einen doppelten Kaffee! Ohne Zucker!«
Ich wartete, im Zimmer roch es intensiv nach frischer Farbe. Zwei Schreibtische aus Stahlblech, eine ratternde Klimaanlage, unter einem hohen Fenster neben einer Schubladeneinheit ein kleiner Kühlschrank sowie ein bescheidener Computer. Gerade als ich meine Zigarette rauchte, klopfte es.
»Rauchen ist verboten!«
In der Tür stand Sâmich und grinste mich mit geschlossenen Zähnen an. Voller Hass, der sich hinter gekünstelter Freundlichkeit verbarg, gab er mir die Hand.
»Schön, dass Sie wieder da sind! Sie haben aber abgenommen. Ihre Kleider schlottern ja richtig!«
Ich bemühte mich, meine Mimik unter Kontrolle zu halten, während ich sein wabbelndes Doppelkinn beobachtete.
»Wie geht es Ihnen, Sâmich? Ich wusste gar nicht, dass Sie hier in 8 West sind.«
»Wie? Hätten Sie sich sonst etwa eine andere Station ausgesucht?« Ich machte gute Miene zum bösen Spiel und verfluchte die Direktorin insgeheim siebzigmal, während Sâmich sein Haar über der Stirn glattstrich und fortfuhr: »Oder haben Sie keinen anderen Ort gefunden als 8 West?«
»Schicksal!«
»Zum Aufwärmen hätten Sie sich was Leichteres suchen sollen. Schwachsinnige zum Beispiel oder irgendwas in der Verwaltung. Bestimmt haben Sie Ihren Job verlernt.«
Seine Worte waren – wie der Geruch eines feuchten Teppichs, der in einer verschlossenen Wohnung gelagert wurde!
»Was gibt’s Neues hier? Erzählen Sie!«
»Das ganze Gebäude ist neu. Kommen Sie, ich zeige es Ihnen!«
Um seinem Führungsanspruch Ausdruck zu verleihen, ging Sâmich voran. Während ich ihm folgte, beobachtete ich, wie er sich zwanghaft alle paar Sekunden übers Haar strich. Mit Pflegern und Angestellten riss er seine Witzchen, die den meisten allerdings keineswegs zusagten, und versuchte so, die Station zu dominieren. Fehlte nur noch, dass er wie ein Strassenköter an die Wand pinkelte oder sich mit dem Fuss am Rücken kratzte, um sein Revier zu markieren! Ich musste mich ständig zusammenreissen, ihn nicht in seinen dicken Hintern zu treten.
Er schleppte mich hinter sich her und machte mich mit der Aufteilung des Gebäudes und mit den Kollegen bekannt. Schliesslich kamen wir zum geschlossenen Krankensaal, einem grossen, rechteckigen Raum mit vergitterten Fenstern. Über seine gesamte Länge zogen sich zwei Reihen von Betten, die wie Steinbänke aufgemauert waren. Darauf lagen mit Laken und leicht zu reinigenden dunklen Wachstüchern bezogene Schaumstoffmatratzen. Die fünf Meter hohe Decke wurde von einem riesigen Ventilator und einem Netz von Rauchmeldern beherrscht. An den Seiten befanden sich grosse Fernseher, die, um die Langeweile zu vertreiben, schwachsinnige Satellitensender zeigten. Rechter Hand waren die Toiletten, bestehend aus sechs hinter Vorhängen verborgenen Kabinen, aus denen man alles entfernt hatte, was sich eventuell abreissen und als Waffe gebrauchen liess.
Als wir vor dem Saal stehen blieben, zog dies ein paar Patienten an. Wie Zombies aus einem billigen Horrorfilm drängten sie an die Tür, flehten um Medikamente, die man ihnen hier vorenthielt, damit ihre echten Symptome zum Vorschein kamen, oder forderten eine schnelle Erstellung ihres Gutachtens. Einige von ihnen wiesen verlangsamte Bewegungen auf und waren geistesabwesend, andere recht normal, während wieder andere so unter Strom standen, dass ihre Augen Funken sprühten.
»Ende der Diskussion!«, stoppte Sâmich das Ganze. Dann trat er nahe an mich heran, und um mir zu beweisen, dass er sich hier genau auskannte, flüsterte er mir über einige Fälle ein paar Einzelheiten ins Ohr: »Saîd hat seine Frau umgebracht. Ein Loser. Morgen geht er. Und das ist Fox. Der hat seine Nachbarin zwei Wochen lang gefangen gehalten und dann erwürgt. Der Ausschuss hat noch nicht entschieden. Und der daneben ist Abdalmagîd. Er hat seine Eltern vergiftet. Wahrscheinlich Verfolgungswahn.«
Ein paar Minuten später, nachdem die Patienten herausgefunden hatten, dass ich eine neue Option für sie darstellte, gingen wir. Im Ärztezimmer ersetzte Sâmich sein Kaugummi durch ein neues und schlug dann mit der Hand auf einen Aktenstapel auf dem Schreibtisch.
»Hier ist der Neuzugang. Die übrigen Fälle sind in der Schublade, der Vertretungsplan hängt hinter der Tür. Schön, Sie wiederzusehen.«
Sâmich ging, mit seinem Kaugummi, seinem Dünkel und seinem zerzausten Haarschopf über der Stirn. Blödmann bleibt Blödmann. Jahre waren vergangen, doch noch immer hatte er das Mädchen nicht vergessen, von dem er einmal fälschlicherweise angenommen hatte, es hätte ein Auge auf ihn geworfen. Und jetzt führte uns das Schicksal auf ein und derselben Station wieder zusammen!
Ich schüttelte den Kopf, um das Bild seines platten Gesichts loszuwerden, zündete mir eine Zigarette an und blätterte die Patientenakten durch. Gesichter, aus denen Niedergeschlagenheit, Wahnsinn und anderes sprach, das mit Worten nicht zu beschreiben war. Seit fünf Jahren ging ich davon aus, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis auch mein Foto dort steckte. Seit eintausendachthundertfünfundzwanzig Tagen wartete ich darauf, als Patient in die Klinik zurückzukehren. Und jetzt war ich zurückgekehrt.
Nur mit einem feinen Unterschied.
Ich wartete eine obligatorische Stunde ab, schluckte währenddessen zwei Eimer Kaffee, verbrannte zwei Tabaksträucher und liess mich von den Kollegen beäugen. Sie starrten mich so neugierig an wie einen frischen Leichnam auf dem Asphalt der Strasse. Ich neutralisierte ihre Aufdringlichkeit mit einem amtlichen Grinsen, das sie – »in Zukunft« – auf Distanz halten würde. Dann raffte ich mich auf und floh.
Als ich nach Hause kam, war es nach fünf.
Neben der Fussmatte, auf der einmal »Welcome« gestanden hatte, lagen zwei Couverts. Ich nahm sie an mich und schloss die Tür auf. Drinnen legte ich Schuhe und Armbanduhr ab, trat gegen ein paar leere Bierflaschen und räumte die Reste meines Abendessens vom Vortag sowie einen überquellenden Aschenbecher vom Sofa. Ich schaltete National Geographic ein, stellte den Fernseher lautlos und liess mich zwischen zwei Kissen sinken. Ich liebte diesen Sender, vor allem wenn weisse Haie, Hyänen oder Eisbären gezeigt wurden. Was die Pandas betraf, wünschte ich mir allerdings, sie würden aussterben und uns ihr albernes Herumscharwenzeln in Zukunft ersparen. Auch die Taxis waren ja mal schwarz-weiss gewesen, for God’s sake!
Ich legte das Dokument meiner Knechtschaft beiseite und griff nach dem zweiten Umschlag. Er war weiss, mit dem üblichen rot-blauen Rand. In schlechter Schrift stand darauf: »Jachja Râschid Ibrahîm«, ausserdem meine genaue Adresse. Kein Absender, nur eine einheimische Briefmarke und ein verwischter Stempelaufdruck. Als ich das Couvert aufriss, fiel ein mittelgrosses, zusammengefaltetes elfenbeinfarbenes Blatt Papier heraus, mit einer primitiven Zeichnung darauf, die am ehesten wie die Kritzelei eines Kindes aussah: die obere Hälfte eines Kreises mit zwei schwarzen Punkten in der Mitte. Darunter kamen zwei Arme heraus, die rechts und links herabbaumelten und ein geschlossenes Quadrat hielten. Dieses wiederum war in neun gleich grosse Kästchen aufgeteilt, ähnlich dem bekannten Spiel Tic-Tac-Toe. Ich drehte das Blatt um, fand aber nur ein paar hellgelbe Flecken, die verdächtig an Urin erinnerten; ich schnupperte daran, aber sie rochen nach nichts. Also steckte ich das Blatt wieder in den Umschlag, knüllte ihn zusammen und wollte ihn schon wegwerfen, doch dann sah ich mir die Adresse und meinen dreiteiligen Namen noch einmal genauer an. Dass alles so exakt angegeben war, war mir unerklärlich! Mit Rücksicht auf die Umwelt, die Erderwärmung und die Sauberkeit meiner Wohnung, die ich ebenfalls nicht auf die leichte Schulter nahm, feuerte ich den Brief dann zusammen mit dem Schreiben der Bank in ein mit Papieren vollgestopftes Glasbecken, das früher mal als Aquarium gedient hatte. Dann stand ich auf, ging in mein Schlafzimmer und warf mich aufs Bett, nachdem ich einen purpurroten Slip beiseitegelegt hatte, den Maja dort vergessen – oder auch nicht vergessen – hatte. Wenige Minuten später kroch mir der Schlaf in die Glieder.
An diesem Tag kam der Abend ganz plötzlich herab. Wie ein verschlissener Theatervorhang fiel die Dämmerung nieder und überzog den Himmel mit blutiger Röte. Als ich die Tür öffnete, reizten die erstickend klebrige Luft und der Brandgeruch bereits meine Nasenhöhlen. Fünf Minuten lang lief ich unter den staubgrauen Bäumen dahin, bis Maja anrief. Gleich beim »Hallo« wurde mir klar, dass sie sich erst ein paar Minuten zuvor einen LSD-Blotter von der Zunge genommen hatte. Das war ein wirklicher Vorzug an ihr: Mit solchen halluzinogenen Blättchen hielt sie die Sorgen von ihrem schönen Kopf fern, die bestimmt einen negativen Einfluss auf ihren physischen Zustand und ihre rekordverdächtigen Kurven gehabt hätten. So schaltete sie ihren Verstand aus und versetzte ihn in freien Fall. Während dieser achtstündigen Trips klopfte sie an die Pforten einer Art von Paradies, in dem sie barfuss und ohne anzuhalten umherrannte. Danach tauchte sie in tiefen Schlummer, aus dem sie so euphorisch erwachte, dass ihr selbst ein räudiger Köter inmitten von Ruinen urkomisch vorgekommen wäre. Dann ging sie aus und unterhielt ihren täglichen Salon im Deals in Samâlik, eben-der Bar, in der ich sie zwei Jahre zuvor kennengelernt hatte. Dort verbrachte sie ihre Zeit mit einer Clique, in der die banalsten Facebook-Geschichten kursierten. Um Mitternacht stand sie auf wie eine angetrunkene Cinderella, behielt aber beide Schuhe an und begab sich nach Hause. Sieben Stunden Schlaf, dann war sie wieder wach, schmiss sich in ihr offizielles Outfit und mutierte darin zur sexy Marketingfachfrau einer bekannten Firma, die sogar Luft hätte an den Mann bringen können. Nach Feierabend rief sie mich an, um mir normalerweise in aller Ausführlichkeit von der vergangenen Nacht zu berichten und davon, wie es mit mir gewesen war. »Wow, wirklich! Ich sitze schon wieder auf heissen Kohlen. Ich konnte kaum noch an mich halten, als ich mit dem Kunden telefoniert hab. Wann seh ich dich wieder?«
Manchmal fragte ich sie, was ihr an mir eigentlich so gefalle, und sie antwortete, ich sei in ihren Augen schöner als Brad Pitt.
Natürlich sah ich eher aus wie Brad Pitt nach seinem Tod plus ein gerüttelt Mass an Mitleid und Erbarmen. Das blieb mir bei ihren Worten nicht verborgen.
Das Gespräch endete üblicherweise damit, dass wir uns innerhalb der nächsten zwei Tage verabredeten, die ich dafür nutzen würde, mich entsprechend zu präparieren – für das Zupacken des Infernos, das blutige Treffen, den Kampf der Titanen Teil drei!
Als ich bei Aunis Haus ankam, beendete ich das Telefonat. Es war ein modernes Gebäude, der Eingang mit schwarzem Marmor und Zierpflanzen dekoriert. Ich grüsste den Pförtner, nahm den Aufzug und klopfte an eine dicke dunkle Tür. Kurz darauf öffnete Nigosi, die afrikanische Dienerin; sie war Mitte vierzig und hatte mir mal gesagt, in ihrer Heimat Ruanda bedeute ihr Name »die Gesegnete«. Auch von ihrer Familie hatte sie mir erzählt, die beim Genozid 1994 ausgerottet worden war. Sie selbst war danach nach Ägypten gegangen.
Nigosi begrüsste mich mit leuchtenden Zähnen inmitten glänzender ebenholzfarbener Haut und führte mich zu einem mit einer Schiebetür verschlossenen Raum. Mühsam zog sie sie auf, und Warda al-Dschasairîjas Lied Meine Geschichte im Laufe der Zeit5 drang heraus. Eine Minute war Nigosi verschwunden, bevor sie wieder herauskam, hinter ihr Auni in bis zur Brust offenem engem schwarzem Hemd.
Elegant, der Teufel!
Er schloss die Tür hinter sich und führte mich zum Ausgang. »Heute ist es full, man!«, sagte er.
»Schâkir ist da, stimmt’s?«, fragte ich.
Ungeduldig fuhr sich Auni mit den Fingern durch das silbergraue Haar. »Hast du vergessen, was letztes Mal passiert ist?«
»Schliesslich bestand er darauf, als er erfuhr, dass ich Psychiater bin«, antwortete ich. »Wenn er eine wahrheitsgetreue Analyse seiner Psyche nicht aushält, ist das ja nicht meine Schuld.«
Missbilligend riss Auni die Augen auf. »Analyse!«, rief er. »Eine Pisse hast du ihn analysiert, man! Einen Einlauf hast du ihm verpasst, ihm ins Gesicht gesagt, dass er mit neunzigprozentiger Wahrscheinlichkeit impotent ist! Der Mann hat geschworen, nie wieder hierherzukommen, mein Gott! Ich musste ihm den Kopf küssen!«
Ich zog an meiner Zigarette. »Er ist definitely impotent«, sagte ich. »Während der ganzen round redete er nur davon, wie er die Frauen flachlegt. Und wenn er spricht, sieht er seinem Gegenüber dauernd in die Augen, beobachtet uns, um sich zu vergewissern, dass wir ihm glauben. Und als er sagte, Viagra sei was für Gehandicapte, nicht für Könner wie ihn, spielte er an seinen Nasenlöchern herum. Weil es eine Lüge war, der sein Körper nicht folgen konnte. Ich hab ihm von Anfang an gesagt, dass meine Worte ihn ärgern würden. Aber er selbst hat ja darauf bestanden!«
»Und du haust ihn zu Brei! Vor allen Leuten!«
»Er hat pausenlos geredet, ich konnte mich nicht mehr auf das Spiel konzentrieren. Irgendwie musste ich ihn ja zum Schweigen bringen.«
Auni liess seine Nackenwirbel knacken. »Die Leute kommen hierher, um zu spielen und ihre Freude zu haben, man. Keine Privatangelegenheiten, keine Geheimnisse, this was always the rule.« Er sah zur Decke hoch, um mein aufdringliches Grinsen nicht sehen zu müssen.
»Soll ich gehen?«, fragte ich. »Soll ich gehen?«
Er fingerte an der Kette herum, die ihm tief auf die haarlose Brust hing, dann seufzte er ergeben. »No, man, nur …«
»Genug gequatscht, Auni, kommen wir zur Sache! Was kostet dein Stoff heute?«
»Das Piece macht hundertachtzig Pfund.«
»Du Halsabschneider! Vor zehn Tagen waren es noch hundertsechzig!«
»Das ist marokkanisches Haschisch in Öl! Wie du weisst, mische ich weder Henna noch Chemikalien rein. Und ausserdem, was macht es dir denn schon! Bist etwa du der, der am Ende der Nacht für die Runde zahlt? Du bist doch der Herr, der die anderen blechen lässt, Doktor!«
»Was spielt ihr denn gerade?«
»Poker.«
Ich folgte ihm wieder hinein.
Als Auni zum Türgriff langte, drehte er sich noch einmal nach mir um. »Keine Psychoanalyse, egal mit wem, please! Especially nicht mit Schâkir.«
Ich nickte und lächelte scheinheilig.
Der Raum war gross, die Klimaanlage machte ihn so kalt wie eine Kühltruhe. In der Mitte standen zwei Tische. Auf dem ersten standen Gläser, Teller mit Appetithäppchen und eine Ansammlung von Flaschen, aus der mir meine Geliebte Chivas Regal zuwinkte. Daneben ein Tablett mit Zigarettenpapier, Tabak und einer Platte Haschisch höchster Qualität, die vor Öl troff. Der zweite Tisch war rund und mit einem Tuch bezogen. Von der Decke schien eine trübe Lampe auf ihn hinunter. Ihr Licht drang durch eine Rauchwolke, in deren Schatten fünf Männer mit ernsten Gesichtern sassen. Als ich eintrat, drehten sie sich zu mir um. Schâkir starrte mich unwillig an, zerbröselte seine Zigarette zwischen den Fingern, bedachte Auni mit einem vorwurfsvollen Blick und war kurz davor, aufzustehen und zu gehen. Ich grüsste die Anwesenden, sie nickten mir mit geheuchelter Freundlichkeit zu, dann ging ich zu dem heiligen Tisch. Ich drehte mir eine Tüte und schenkte mir ein Glas ein. Die Mischung aus Alkohol und Haschisch macht einen zum schlimmsten aller Feinde. Und genau das brauchte ich jetzt.
Ich nahm einen Zug, und aus innigem Sadismus heraus schob ich meinen Stuhl absichtlich Schâkir gegenüber an den Tisch. Auni beugte sich zu ihm und flüsterte ihm etwas »Stärkendes« ins Ohr, das seine Züge ruhiger werden liess, dann ging er wieder an seinen Platz. Unwillig zündete sich Schâkir eine neue Zigarette an, nachdem er die andere zerbröselt hatte, und grinsend begrüsste ich ihn: »Einen wunderschönen Abend, Schâkir Bey!«
Ohne zu antworten, schenkte er sich ein Glas ein und nahm wütend einen Schluck.
»Sie sehen aus, als wären Sie noch immer sauer«, meinte ich.
»Hat es Ihnen Spass gemacht, was Sie letztes Mal gesagt haben?«
»Das war nur eine Meinungsäusserung, Schâkir Bey. Hatten Sie nicht selbst gesagt: ›Analysieren Sie mich doch mal, Doktor‹? Wenn wir die Leute hier als Zeugen befragen sollen, ich hab damit kein Problem!«
Schâkirs Gesicht wurde blass und seine Ohren rot. Mit seinen dicken Fingern griff er sich die Spielkarten und versteckte sich hinter ihnen. Ich wartete ab, bis das unterbrochene Spiel zu Ende war, und stieg in das nächste mit ein.
Auni in seiner Eigenschaft als Spielführer mischte mit geübten Fingern und zog dann für jeden der Anwesenden zwei Karten. Ich hob die Ecken meiner beiden an und warf einen verstohlenen Blick darunter. Zwei Neunen, ein gutes Blatt. Ich legte sie wieder verdeckt vor mich hin, zündete mir eine Zigarette an und warf meinen Einsatz auf den Tisch.
Aunis Gesicht flehte: Lass den Abend gut zu Ende gehen, und benimm dich anständig!
Aber es war zu spät, denn es juckte mich schon wieder. Es reizte mich, die Leute ringsum zu studieren, ihren Code zu knacken, sie nackt auszuziehen und ihre Lügen mit blossem Auge aufzudecken. Denn der Körper lügt nicht. Wenn einer sich an die Nasenspitze fasste, so liess das erkennen, dass er zwar selbstsicher tat, seine Karten aber nicht gut waren. Zog er sich am Ohrläppchen, bedeutete das gute Karten, aber Unentschlossenheit. Regelmässiges Zucken mit dem Fuss dagegen zeigte, dass jemand ungeduldig wurde, der kurz davor war, zu gewinnen, aber einen unvermittelten Angriff fürchtete. Letzteres bemerkte ich nun bei Schâkir. Dieses Rütteln wie ein aus seiner Verankerung gerissener Automotor! Wie gierig er an seiner Zigarette zog, und wie leichtsinnig er seinen Einsatz vervielfachte: Dieser Mann verging vor Sorge, und er hielt ein gutes Blatt in der Hand, zumindest dachte er das.
Ein Auszug aus dem Buch Poker for Dummies, Seite 26: »Pokerstrategie:
– Entweder du lässt deinen Gegner glauben, deine Karten hätten einen höheren Wert als seine – auch wenn es nicht so ist –, dann wird er aus Furcht passen und einen schnellen Verlust einem fernen, risikoreichen Gewinn vorziehen;
– oder du lässt deinen Gegner glauben, deine Karten hätten einen geringeren Wert als seine – auch wenn es nicht so ist –, dann wird er vor lauter Gier seinen Einsatz erhöhen, bis dir sein Geld zur Beute fällt. Und anschliessend erleidet er eine Angina pectoris oder eine Thrombose!«
In der dritten Runde legten vier Spieler ihre Karten ab und passten, und nur noch Schâkir und ich blieben im Spiel. Um sicherzustellen, dass er mich studierte, blickte ich zu ihm hinüber und beschloss dann, ihm ein Geschenk zu machen.
»Raise.«
Ich verdoppelte meinen Einsatz, zog dabei mit zitternden Fingern heftig an meiner Zigarette und wischte mir nicht vorhandenen Schweiss von der Stirn. Schâkir trat ein triumphierendes Lächeln auf die Lippen. Unwillkürlich las er meine falschen Zeichen, denn alle Pokerspieler besitzen einen angeborenen Lügendetektor, der das Gesicht ihres Gegners für sie durchschaubar macht. Nur findet man heutzutage fast überall nur noch die billigen Geräte aus chinesischer Herstellung!
Im Glauben, ich wolle ihm mit der Erhöhung einen Schreck einjagen und ihn damit zum Aufgeben drängen, verdoppelte Schâkir ebenfalls seinen Einsatz. Sein zuckender Fuss beruhigte sich, und er drückte seine Zigarette im Aschenbecher aus. Seine Entscheidung stand fest. Unter den Augen der Umsitzenden lehnte er sich zurück, blickte noch einmal bedächtig auf seine beiden Karten, dann auf sein Geld, deckte sie auf, und Auni zog sie zu den Gemeinschaftskarten in der Tischmitte: Herz 2, 4, 6, 8, 9 – ein Flush. Das reichte für den Sieg, zumindest dachte er das. Nun allerdings ging ich daran, mein Blatt – ganz langsam – aufzudecken. Auni zog sie ebenfalls in die Mitte und ersetzte damit Schâkirs Karten. Mit der dritten Neun hatte ich Full House und damit ein höheres Blatt als er. Schâkir stöhnte auf, als hätte er unvermutet einen Schlag abbekommen, und warf mir einen so hasserfüllten Blick zu, als wollte er mich töten. Ich jedoch zog sein Geld auf meine Seite und spiesste ihn mit einem farblosen Lächeln auf. Was für ein Zocker!
Wer sagt, Geld mache nicht glücklich, kann nicht das Geld anderer Leute damit meinen …
Drei Stunden später war das Spiel zu Ende, ich war als Einziger noch übrig. Ich leerte mein drittes Glas, stellte mich auf den Balkon, um ein sommerliches Lüftchen zu erhaschen, und zählte die Ausbeute des Abends: Eintausendachthundert Pfund würde ich in den kommenden Tagen zur Verfügung haben.
Zwei Joints und drei Gläser Whiskey hatten mich an den Rand eines Abgrunds gebracht, an dem ich gern entlanglief, solange mir noch genug Platz blieb, um die Balance zu halten und genau in das Haus heimzukehren, in dem ich wohnte.
Schâkirs Gesicht zu sehen, während er diese Niederlage einstecken musste – gelobt sei der Sadismus, solange er nicht zu weit geht!
Auni räumte den Tisch ab und kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. »Wenn du noch drei Jahre bei mir bleibst, werde ich verrückt«, sagte er zu mir. »Wie machst du das nur?«
»Was meinst du mit ›das‹?«
»Du sackst die round ein, als könntest du alle Karten sehen!«
»Die Karten sind verdeckt, aber die Gesichter liegen offen.«
»Du bist ein … ein Geisterseher, stimmt’s?«
»Ach was, Geisterseher – ein Geist aus den Klubs von Los Angeles!«
»Nein, im Ernst! Zählst du die Karten? Merkst du dir die Zahlen?«
»Auni, Auni! Nenn mir doch den Preis für die paar Gläser und die Zigarette, Gott segne dich! Irgendwann geht dir schon ein Licht auf.«
»Komisch, dass du manchmal so extrem down bist!«
»Nur an den Tagen, an denen dein Haschisch mit irgendwas gestreckt ist.«
Auni lachte. »Du bist verrückt, man. Aber ein Genie!«
Ohne zu antworten, grinste ich ihn an. Ich hatte an seinem Spieltisch meine ganze Energie verbraucht und fühlte mich nun wie ein Duracellhase mit leerer Batterie.
Nachdem ich mich verabschiedet hatte, marschierte ich drauflos, bis ich mein Haus gefunden hatte. Auf dem Weg zum Schlafzimmer zog ich mich aus und sank dann auf mein Bett.
Wie ein Baum ohne Wurzeln.
Vor Sonnenaufgang
Temperatur: 90 Grad Celsius
Meine Sinne waren auf einen Schlag aktiviert. Schweissgebadet lag ich auf dem Rücken und hörte etwas keuchen. Verstohlen blinzelte ich durch halbgeöffnete Lider und sah ihn an der Zimmertür stehen: einen kohlschwarzen Hund, der hechelte, als sei er einen Monat lang ununterbrochen gerannt, mit struppigem Haar und dunkelroter Zunge, von der Schaum troff. Wütend und mit blutunterlaufenen Augen starrte er mich an und knurrte. Hinter den hochgezogenen Lefzen erkannte ich zwei Reihen scharfer Lanzenspitzen und grosse Angriffslust. Vor Schreck fuhr ich zusammen, meine Haare sträubten sich, und Schweiss brach mir aus allen Poren. Ich wollte aus dem Bett springen und hinter irgendetwas Schutz suchen, aber meine Glieder waren taub. Ein Ameisendorf hatte meinen Körper besiedelt und ihn gänzlich seiner Kultur unterworfen. Ich war wie gelähmt, unfähig zu reagieren, mein Herz raste, und innerlich zitterte ich vor Angst. Im selben Moment sah ich eine menschliche Silhouette, deren Gesicht ich wegen der Dunkelheit nicht erkennen konnte. Sie stand hinter dem Hund, und obwohl keine Details zu erkennen waren, war ich mir sicher, dass sie mich beobachtete, mich mit ihren Blicken durchbohrte. Nach ein paar zähen Sekunden, in denen mir das Blut aus den Adern wich, packte die Person den Hund fest am Hals. Das Tier knurrte, gehorchte dann aber seinem Herrn, drehte sich um, und beide verschwanden im Nichts.
Der Bann war gebrochen. Als hätte mich etwas gestochen, richtete ich mich auf und suchte hysterisch auf dem Nachttisch herum, bis ich mein Handy gefunden hatte. Das schwache Licht des Displays half mir jedoch nicht, dem Bettrand auszuweichen, so dass ich mir auf dem Weg zum Lichtschalter schmerzhaft den kleinen Zeh stiess. Der Raum wurde hell, ich war zunächst geblendet, konnte aber allmählich Einzelheiten ausmachen. Vorsichtig öffnete ich die Tür, streckte zunächst nur den Kopf hindurch und ging dann hinaus. Im Licht sämtlicher Lampen rannte ich an den Türen und Fenstern entlang und liess den Blick suchend darüberwandern. Nichts!
Ich setzte mich ins Wohnzimmer und rief mir die letzten zwei Minuten ins Gedächtnis zurück. Als der Kopf des Hundes und die Gestalt seines Herrn mir wieder vor Augen traten, lief mir ein Schauer über den Rücken.
Doch dann erwachte ich. Es war nur ein Albtraum gewesen, aber realistischer als die Wirklichkeit.
Angesichts meines blutenden Zehs und meiner ausgedörrten Kehle trank ich eine Flasche Bier, was mir einen starken Harndrang bescherte. Ich leerte meine Blase, liess dann die Wanne volllaufen und legte mich, von alkoholisch riechendem Schweiss triefend, hinein. Von der Waschmaschine griff ich mir einen albernen Roman, der schon seit zwei Monaten dort lag. Ich blätterte ein wenig darin herum und mühte mich mit dem langsamen Erzählrhythmus und meinem schweren Kopf ab. Schliesslich übermannte mich wieder der Schlaf.
Zwei Stunden später weckte mich die Stimme eines Strassenhändlers – er wird nicht ins Paradies kommen! –, der krächzend irgendetwas anpries. Nass, wie ich war, sprang ich auf. Doch ich rutschte aus und wäre beinahe in den Spiegel gestürzt. Das völlig durchnässte Buch hängte ich zum Trocknen auf das Badewannenrohr, ging in mein Zimmer, zog mich an und machte mich auf den Weg in die Klinik. Vorher allerdings legte ich noch die leere Bierflasche auf die Flaschenpyramide.
Um meine Erschöpfung nach der letzten Nacht und dem Albtraum zu kaschieren, der mir noch in allen Einzelheiten gegenwärtig war, behielt ich die Sonnenbrille auf, als ich Haus 8 West betrat.
Sâmich war der Erste, den ich traf. Er kam auf mich zu, schnüffelte provozierend an mir herum und drang in meine Intimsphäre ein – gegenüber jemandem wie ihm bemass die sich auf drei Kilometer. »War wohl ’ne geile Nacht! Ist das eigentlich eine Ray-Ban, diese Brille?«
Ich sah mich vergeblich nach einer Kotztüte um. »Guten Morgen, Sâmich!«, sagte ich also.
»Es gibt heute zwei Neuzugänge. Wenn du wach bist, kannst du dir einen aussuchen.«
Ich ging in mein Zimmer, schloss die Tür und wartete, bis seine Stimme nicht mehr zu hören war. Dann rief ich Pfleger Muchsin und fragte ihn: »Geht Sâmich eigentlich nie nach Hause?«
»Was soll er denn da? Er ist ja nicht verheiratet. Manchmal schläft der sogar im Pausenraum, obwohl er gar keine Aufsicht hat.«
»Herrlich! Bringen Sie mir die Akten der Zugänge von heute, und machen Sie mir einen Kaffee, aber richtig, nicht so wie letztes Mal! Kochen Sie ihn, Muchsin, kochen Sie ihn!«
Ein paar Minuten später kam er mit einem Kaffee und den Patientenakten zurück, legte sie vor mich auf den Tisch und ging. Ich setzte die Brille ab, nahm mir die erste Akte vor und blätterte sie durch. Um die Buchstaben trotz meiner früh eingetretenen Weitsichtigkeit klar entziffern zu können, hielt ich die Papiere dabei weit weg von mir.
Beim ersten Fall handelte es sich um einen Mann Mitte fünfzig. Auf dem Foto wirkte er ganz normal, so als könne er keiner Fliege etwas zuleide tun. Er wurde jedoch beschuldigt, einen Kollegen umgebracht zu haben. Seine Äusserungen waren wirr und unzusammenhängend. Er sagte, er sei bei der Arbeit von einer Clique ständig gemobbt worden. Schon seit Jahren habe sie ihm nachgestellt, und der Getötete sei ihr Anführer gewesen. Doch obwohl man ihn mit einem Messer in der Hand nur ein paar Meter von der Leiche entfernt aufgegriffen hatte, leugnete er, mit dem Verbrechen etwas zu tun zu haben. Sein Anwalt hatte beantragt, den Geisteszustand des Mannes zu untersuchen. Das war der letzte Kniff, der der Verteidigung blieb, um erreichen zu können, dass ihr Mandant ins Krankenhaus eingewiesen wurde, statt auf dem Schafott zu landen.
Bei neunzig Prozent der Betroffenen stellte sich allerdings heraus, dass sie normal waren und nur simulierten, um nicht verurteilt zu werden. Zehn Prozent Schuldunfähige sind dennoch eine ganze Menge.
Ich las die erste Akte zu Ende, zog mir dann die zweite heran und überflog sie eilig. Plötzlich jedoch hielt ich inne und blätterte zwei Seiten zurück. Dieses Gesicht! Ich liess den Blick zwischen dem Foto und dem Namen des Patienten hin- und herwandern, bis ich keinen Zweifel mehr hatte. Wie von der Tarantel gestochen fuhr ich hoch und verschüttete dabei den Kaffee über Schreibtisch und Hose. Ich rannte hinaus, stoppte, kehrte ungläubig zu der Akte zurück und sah mir, um ganz sicher zu sein, das Foto noch einmal genau an. Dann begab ich mich in den Krankensaal und von dort ins Pflegezimmer, von dem man den Saal überblickte. Dabei tat ich, als sei ich die Ruhe selbst, obwohl dies absolut nicht zutraf. Ich grüsste zwei Pfleger, die sich bestimmt nicht die Butter vom Brot nehmen liessen, und sah mich in dem langgestreckten Raum um. Schliesslich fragte ich einen der beiden nach dem Neuzugang, und er zeigte auf einen korpulenten Mann, der sich mit einem Mitpatienten unterhielt. Das war der Fall aus der ersten Akte. Ich beachtete ihn nicht weiter und erkundigte mich nach dem zweiten. Der Pfleger sah sich suchend um und zeigte dann auf einen Mann, der auf dem Rand des letzten Betts im Saal hockte. Er trug eine dunkelblaue Trainingshose und ein kurzärmeliges weisses Hemd und kauerte dort so unbeweglich wie ein Fels. Seine Augen blickten starr zu dem Deckenventilator hinauf, der sich über ihm drehte. Trotz der Entfernung war er nicht zu verkennen, es war – Scharîf! Scharîf al-Kurdi.
Ich ging zurück in mein Zimmer, bestellte einen neuen Kaffee als Ersatz für den, den ich verschüttet hatte, und schlug Scharîfs Kriminalakte auf, die mit ihm von der Polizei gekommen war. Es war ein drei Zentimeter dickes Dossier aus Text und Bildern von dem Verbrechen.
Scharîf Mâhir al-Kurdi ist Psychiater. Bis zum vergangenen Jahr arbeitete er an der Behman-Klinik, bevor er dort aus ungeklärten Gründen entlassen wurde. Er wird beschuldigt, seine Ehefrau Basma Magdi ermordet zu haben, die unbekleidet aus dem dreissigsten Stock eines der Osman Towers in Maâdi stürzte. Sein Anwalt plädierte vor Gericht auf eine Geisteskrankheit seines Mandanten, um ihn im Hinblick auf den Vorfall für schuldunfähig erklären zu lassen. Ausserdem sagte er, sein Mandant sei zum Todeszeitpunkt nicht anwesend gewesen, sondern erst später hinzugekommen. Da die Beteiligung seines Mandanten durch nichts ausgeschlossen oder erhärtet wurde, versicherte er, das Opfer habe Suizid begangen. Es erging der Beschluss, den Angeklagten unter der Obhut der Experten der Abbassîja-Klinik auf Station 8 West untersuchen zu lassen.
Eilig überflog ich den detaillierten Polizeireport und stiess auf den Bericht der Rechtsmedizin. Auf der ersten Seite war ein Foto des Opfers. Wow! Ich konnte mich nicht erinnern, jemals ein Gesicht mit solch ebenmässigen Zügen gesehen zu haben! Ihr selbstbewusster Blick liess es unvorstellbar erscheinen, dass eine Frau wie sie sterben könnte, die Fotos der Spurensicherung jedoch straften diesen Eindruck Lügen. Darin erschien ihr Körper wie ein benutzter Putzlumpen, der aus dem siebten Himmel auf die Erde gestürzt und dort von einer rostigen Dampfwalze überrollt worden war. Dickflüssiges Blut war literweise aus ihrem in den Asphalt gepressten Körper geströmt, und die Knochen hatten widernatürliche Stellungen eingenommen. Mir drehte sich der Magen um, obwohl ich derlei aus dem Anatomiesaal an der Universität gewöhnt war. Ich hielt es nicht länger aus, klappte die Akte zu, schluckte schwer und rief nach dem Pfleger: »Muchsin, bringen Sie mir Scharîf al-Kurdi, der gestern gekommen ist!«
Ein paar Minuten später hörte ich es an die Tür klopfen. Ich sog die Luft tief in die Lunge und drückte meine Nieren in den Stuhl zurück. Mit Scharîf an der Hand trat der Pfleger ein. Ruhig liess er ihn auf dem Stuhl mir gegenüber Platz nehmen. Ich signalisierte ihm, dass er uns allein lassen solle. Es herrschte zähes Schweigen, nur unterbrochen vom Geräusch der Klimaanlage. Geistesabwesend starrte Scharîf auf einen imaginären Punkt an der Wand. Währenddessen machte ich eine Bestandsaufnahme der Dinge, die an ihm anders waren als vor zehn Jahren, als ich ihn zuletzt gesehen hatte. Wie hatte er sich verändert! Sein Gesicht war eingefallen, tiefe Furchen durchzogen seine Wangen, die grünen Augen waren in ihre Höhlen gesunken wie zwei Inseln in einen Ozean, das mit weissen Fäden durchwirkte Haar war lang und mit einem breiten schwarzen Band nach hinten gebunden, die Nägel ebenfalls lang, und an den Armen traten die Adern hervor. Auf den linken Arm war eine senkrechte Linie tätowiert, die an der Schulter begann und in der Handfläche endete. Sie wurde von mehreren Querlinien gekreuzt, die sich wie Treppenstufen um den Arm wanden und in einem Muster ausliefen, das aussah wie der arabische Buchstabe Sâd () und dessen Spiegelbild.
»Scharîf!« Mein Ruf war der Versuch, auf grundlosem Meer einen Anker auszuwerfen. Weder bewegte sich Scharîf, noch schenkte er mir auch nur die geringste Aufmerksamkeit. Seine starren Augen blinzelten nicht einmal. Ich stützte mich auf den Schreibtisch, reckte mich zu ihm hinüber und rief erneut: »Scharîf! Ich bin Jachja … Jachja Râschid.«
Eine Marmorstatue, auf die die Vögel ihren Kot fallen liessen.
Ich stand auf, setzte mich direkt vor ihn und unterbrach absichtlich seine Richtung Wand verlaufende Blicklinie, um ihn damit aus seiner Abwesenheit zu reissen. »Kann es wirklich sein, dass du dich nicht an mich erinnerst, Scharîf?«
Ein flüchtiges Zittern lief über seine Lider, und daran hielt ich mich fest.
»Wie geht’s dir, Scharîf? Nicht zu glauben, dass wir beide wieder beisammensitzen, oder? Etwa zehn Jahre lang haben wir uns nicht gesehen.«
Ein zittriges Lächeln huschte über seine Lippen. Aber es war schnell verschwunden, und sein Blick irrte erneut zur Wand ab.
»Dieser neue Look steht dir, weisst du das? Dein Haar und das Tattoo. Ein ganz neuer Typ. Möchtest du immer noch so gerne schauspielern? Ach, Scharîf! Erinnerst du dich noch an die Schule? An Rânia und Schirîn? Oder an das libanesische Mädchen, Lîna?«
Für den Bruchteil einer Sekunde sah er mich an. Mehrmals bemerkte ich ein Zucken um seinen Mund, das jedoch bald entwischte, genau wie sein Blick.
»Weisst du, wo wir sind, Scharîf?«
»Salz!«, entgegnete er mit heiserer Stimme, die nicht seine war, und mit versteinerten Augen.
»Wie bitte?«
»Ich will Salz.«
»Salz?«
»Viel. Im Essen.«
»Warum Salz, Scharîf?«
Er antwortete nicht.
»In Ordnung. Ich kümmere mich darum. Weisst du, warum du hier bist, Scharîf?«