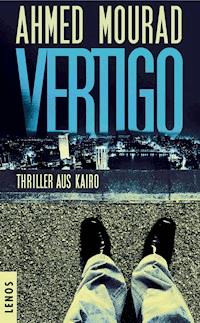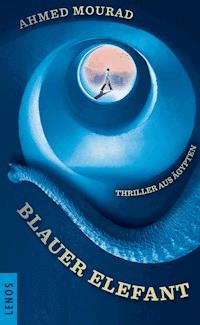12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lenos
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Lenos Polar
- Sprache: Deutsch
Taha lebt in Kairo, tagsüber arbeitet er als Pharmavertreter und nachts als Apotheker. In seiner Freizeit spielt er Schlagzeug, ausserdem kümmert er sich um seinen Vater, der an den Rollstuhl gefesselt ist und seine Tage damit verbringt, das Leben der anderen mit dem Fernglas zu beobachten. Als Taha eines Morgens heimkommt, findet er seinen Vater leblos auf - er wurde ermordet. Die Polizei stellt ihre Ermittlungen bald ein, und so sucht Taha selbst nach dem Täter. Dabei lernt er Kairos dunkelste Seiten kennen, er begegnet Grausamkeit und Skrupellosigkeit, aber auch Menschen, die an eine Veränderung der durch Korruption und Klientelismus zerstörten Gesellschaft glauben. Taha beginnt seine Welt mit anderen Augen zu sehen. Unverhofft fällt ihm das Tagebuch seines Vaters in die Hände, in dem dieser die Morde beschreibt, die er einst im jüdischen Viertel Kairos begangen hatte. Taha kommt hinter das Geheimnis des mysteriösen Diamantenstaubs, des »Königs der Gifte« - einer Substanz, die, einmal eingenommen, sich unmerklich im Körper verteilt und sehr langsam zum Tode führt -, und er macht sich dieses Wissen fortan zunutze. Doch auch die junge Journalistin Sara stellt Recherchen an … In seinem Thriller zeichnet Ahmed Mourad das Bild einer Gesellschaft kurz vor der Explosion, und er erzählt von einer Stadt, die längst ihre Unschuld verloren hat, nicht aber ihren typisch ägyptischen Humor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 515
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Der Autor
Ahmed Mourad, geboren 1978 in Kairo, studierte an der Filmhochschule der ägyptischen Hauptstadt. Sein Abschlussfilmprojekt gewann mehrere internationale Preise. In der Folge arbeitete er als Fotograf im Stab des Präsidenten. 2007 erschien sein vielbeachteter erster Roman, Vertigo, der das Genre des Politthrillers in Ägypten begründete und 2012 als Fernsehserie verfilmt wurde. Diamantenstaub ist sein zweiter Roman.
Die Übersetzerin
Christine Battermann, geboren 1968 in Wuppertal, studierte Arabisch und Türkisch in Bonn. 1996–2000 Lehrbeauftragte für Türkisch an der Universität Bonn. Seit 1998 freie Literaturübersetzerin. Sie übertrug u.a. Werke von Machmud Darwisch, Rosa Yassin Hassan und Alexandra Chreiteh ins Deutsche und lebt in Köln.
Die Übersetzung aus dem Arabischen wurde vom SüdKulturFonds in Zusammenarbeit mit LITPROM – Gesellschaft zur Förderung der Literatur aus Afrika, Asien und Lateinamerika e.V. unterstützt.
Titel der arabischen Originalausgabe:
Torab Al-Mas
Copyright © 2010 by Ahmed Mourad
Copyright © 2010 by Dar El Shorouk
E-Book-Ausgabe 2015
Copyright © der deutschen Übersetzung
2014 by Lenos Verlag, Basel
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Hauptmann & Kompanie, Zürich, Dominic Wilhelm
www.lenos.ch
ISBN 978 3 85787 599 1 (EPUB)
ISBN 978 3 85787 600 4 (Mobipocket)
Diamantenstaub
Dem Mann der letzten Gelegenheit,
Herrn Präsidenten Muhammad Nagîb
Die finstersten Zeiten in der Geschichte der Völker sind die, in denen der Mensch glaubt, das Böse sei der einzige Weg zum Guten.
Ali Adham in seinem Buch Geheimgesellschaften
über den Nihilismus
1
Montag, 15. November 1954
Jüdisches Viertel, al-Churunfusch/al-Gamalîja
Auf dem buckligen englischen Pflaster am Zugang zur Salomongasse wurden die Schatten immer länger. Ein dünner Mann mit einer Stange und einer kleinen Leiter ging auf einen Laternenmast zu. Nachdem er die Sprossen behände erklommen hatte, klappte er das gläserne Türchen der Laterne auf und steckte das brennende Ende der Stange hindurch. Nach ein paar Sekunden lag um den Mast ein matter Lichtschein, der den Boden vor einem kleinen Laden zitternd erhellte. »al-Sahâr – Parfums« stand mit der Hand geschrieben auf dem Schild über der Tür. In den Regalen im Inneren drängten sich Fläschchen mit Blütenessenzen. Sie waren mit kleinen Lederfetzen und dünnen Schnüren verschlossen, trotzdem duftete es noch bis auf die Strasse hinaus.
Das Abendgebet war vorüber, und Hanafi war unterwegs zu seinem Geschäft. Jedes Mal, wenn er die Hand hob, um die übrigen Ladenbesitzer zu grüssen, sah man an seinen Ärmeln noch die Spuren der Gebetswaschung. Als Farûk, sein Ältester, ihn kommen sah, warf er seine Zigarette schnell auf die Strasse und wedelte mit den Händen, um den Tabakgeruch zu vertreiben. Verschämt lächelte er dabei zu Halâwa hinüber, die in ihrer Milâja1 vor ihm stand: zwei weisse Marmorsäulen, jede von einem goldenen Fussreif umfasst. Darüber eine Sahneschüssel – unter einer stolz vorgeschobenen Brust und einem Gesicht mit kajalgeschwärzten Augen, für die man hätte sterben mögen. Die Witwe des Viertels war sie, und der Spruch »Hinter jeder grossen Frau steht ein Mann – der ihr aufs Hinterteil starrt!« schien wie für sie gemacht. Bei ihrem Anblick trat Hanafi ein wohlgefälliges Lächeln auf die Lippen. Er fuhr sich mit den Fingern durch die schwarzen Locken, gab aus einem Fläschchen ein paar Tropfen Parfum in seine Rechte und klopfte es sich in den gepflegten Schnurrbart. Während er auf Halâwa zuging, liess er den Blick über ihren Körper wandern. Schliesslich tauchte er in ihre Aura ein.
»Halâwa, wie geht’s Ihnen?«
»Guten Abend, Herr Hanafi«, flüsterte sie mit aufreizend heiserer Stimme.
Um seine Nervosität zu überspielen, zog er einen Stuhl heran und hiess sie sich neben die Tür setzen: »Ruhen Sie sich fünf Minuten aus!« Dann wandte er sich an Farûk, der ihm sehr ähnlich sah – nur dass er seine Ärmel hochgekrempelt trug, wie es durch den Schauspieler Schukri Sarhân im Film Lahalîbu in Mode gekommen war. »Hat jemand was gekauft?«, fragte er ihn.
»Oberstleutnant Hassan hat Nelken und Basilikum genommen und gesagt: ›Die Rechnung Ende des Monats.‹«
»Wenn du aus dem Hinterteil einer Ameise Fett gewinnen willst, wirst du nie was zum Braten haben«, murmelte Hanafi vor sich hin. »Der wird uns wieder mit dem Geld hinhalten!«
»Gehst du heute zu Chawâga Lieto?«
»Ja.« Hanafi klopfte seinem Sohn auf die Schulter. »Jetzt aber ab mit dir, deine Mutter ist allein.«
Farûk warf Halâwa einen Blick zu und zwinkerte schicksalsergeben. »Recht so, Abu Farûk.«
Hanafi beugte sich vor, um ein paar Flaschen einzusammeln, und sagte, ohne aufzusehen: »Und geh direkt nach Hause, lauf nicht erst überall herum! Ausserdem: Pass auf, dass du nicht so viel Teer in die Lungen kriegst. Es ist ein ziemlicher Gestank hier im Laden.«
»In Ordnung, Papa.«
Farûk rannte fort, und Hanafi wandte sich wieder an das Kind des Hauses El Rashidi El Mizan2: »Eine schlimme Generation! Was kann ich für Sie tun, gnädige Frau?«
»Jasmin«, sagte sie langsam.
Hanafi riss seinen Blick von ihren Lippen, nahm ein Fläschchen und wickelte es in ockerfarbenes Papier. »Jasmin vom Jasminstrauch.«
»Haben Sie rotes Henna?«
Er erhaschte einen kurzen Blick auf ihre Waden. »Was wollen Sie mit Henna? Ihre Fersen sind doch von Natur aus so rosig wie Gazellenblut.«
Sie biss sich auf die Unterlippe. »Ihr Gesicht gefällt mir nicht. Was haben Sie, Bruder?«
»Hexenwerk, Halâwa. Der böse Blick setzt mir zu.«
»Jemand muss Sie mit einem Zauber belegt haben.«
»Ich sehe die Dämonen ja vor mir herumhüpfen, Gott gnade mir.«
»Er steh uns bei! Sie müssen bei mir vorbeikommen, dann vertreibe ich die Geister und verbrenne ein bisschen Räucherwerk für Sie.«
Hanafi musste lächeln. »Geht das nicht auch hier im Laden?«
»Das Dämonenauge3 verbrenne Sie!«, sagte sie mit einem wohlklingenden Lachen.
Er beugte sich zu ihr hinunter. »Sie kommen zu spät, Halâwa. Wenn wir uns früher begegnet wären …«
Mit verträumtem Lächeln stand sie auf und raffte ihre Milâja zusammen. »Das kommt alles von dem Geist, er hat unglaubliche Kraft! Wenn ich Ihre Frau wäre, wären Sie vielleicht nicht …«
Ohne nachzudenken, sagte er: »Bei meiner Gesundheit, ich würde gar nicht mehr in den Laden kommen. Sie kennen mich nicht, ich …«
»Schwören Sie nicht, Sie Maulheld! Was bin ich Ihnen schuldig?«
Hanafi nahm ein Tütchen Henna, drückte es ihr in die Hand und versuchte dabei, ihre zarten Finger zu berühren. »Alles schon bezahlt, und Sie bekommen noch was wieder.«
»Wenn Sie es sich anders überlegen sollten, kommen Sie in die Burkukîjagasse!« Halâwa raffte die Milâja um ihre bemerkenswerten Hüften zusammen, und nachdem sie Hanafi einen Blick zugeworfen hatte, der seine Brust in Flammen setzte, ging sie hinaus.
Er sah ihr nach, bis sie fort war, und summte dabei vor sich hin: »Nie werd’ ich den Montag vergessen, an dem wir beide uns trafen.«
Um neun Uhr machte Hanafi die Türen seines Ladens zu und verrammelte sie mit einem eisernen Querriegel und einem grossen Schloss. Als er gerade im Begriff war, zu gehen, hörte er plötzlich ein Klirren wie von zersplitterndem Glas. Er öffnete die Türen wieder, und im Licht der Strassenlaterne sah er einen hölzernen Bilderrahmen zerbrochen auf dem Boden liegen. Er hob ihn auf, legte ihn auf den Tisch und besah sich die Schnur. Sie war ohne erkennbare Ursache gerissen. Dann zog er auch das Bild aus den Glasscherben. Es war ein handkoloriertes Foto des Präsidenten Muhammad Nagîb in Uniform. Darunter stand der Wahlspruch »Einheit – Ordnung – Arbeit«.
»Es gibt keinen Gott ausser Gott«, seufzte Hanafi, als er Nagîbs Augen betrachtete, die unendlich traurig und sorgenvoll blickten. Dann rollte er das Bild zusammen und legte es in eine Ecke. Er zog sich die Kufîja fest um den Hals, setzte sein Käppchen auf und machte sich auf den Weg in die Nusairgasse, wo sein alter Freund Lieto wohnte. Der hatte ihm einen gemütlichen Abend mit den Liedern der Dame, Laila Murâd4, versprochen.
Auf dem Weg durch den stürmischen Novemberwinter, während er sich die Hände in den Manteltaschen wärmte, geriet Hanafi ins Grübeln über die stockenden Einnahmen seines Ladens und seine Verantwortung für sieben hungrige Mäuler. Und über Halâwa, die schwer zu ignorieren war, die seine Wachträume beherrschte und vergessene Hoffnungen wiederaufleben liess. Bei alledem war er, ohne zu wissen, warum, seltsam angespannt und kaute an den Nägeln. Etwas war nicht so, wie es sein sollte. Nur der Gesang der Dame würde diese düstere Stimmung aufhellen können – und ein Stückchen Haschisch, mit dem seine Finger bereits in der Manteltasche spielten.
Hanafi ging durch so enge Gassen, dass er die Häuser auf beiden Seiten hätte berühren können, wenn er die Arme ausgestreckt hätte. Schrill wie das Wehgeschrei einer Witwe pfiff der Wind dort hindurch, wirbelte Abfälle und Papier auf und klatschte alles gegen Fenster und Türen. Die Wäsche auf den Dächern flatterte so, dass man meinen konnte, dort trieben die Dschinnen ihr Wesen.
Am Zugang zur Nusairgasse durchschritt Hanafi ein Eisentor, das mit einem sechszackigen Stern und einem grossen Widderhorn bewehrt war. Er stieg in den ersten Stock hinauf, klopfte und wartete, bis das Licht anging und die Tür geöffnet wurde: von Tûna, einer voll erblühten Blume mit kajalumrandeten Augen und einem Kaugummi im Mund.
Sie hielt einen kleinen Kater an die Brust gepresst und sagte: »Willkommen, Onkel Hanafi, treten Sie ein.«
»Du bist noch wach, Mädchen?«
Sie drehte sich eine Strähne ihres welligen roten Haars um den Zeigefinger. »Papa hat uns mit einer neuen Schallplatte Kopfschmerzen gemacht. Wir müssen wohl wegen Laila Murâds schöner Augen noch bis zum Morgen aufbleiben.«
Hanafi kraulte dem Kater den Nacken, aber der fauchte wie ein Löwe.
»Schön ruhig, Babsi. Kommen Sie rein, Onkel Hanafi, ich mach Ihnen Tee.«
Lietos Wohnung war bescheiden und atmete den Geschmack des Musikliebhabers. Den Ehrenplatz im Wohnzimmer hatte ein grosses Bild von Laila Murâd inne, und an der Wand hing eine Ud, von der es hiess, sie habe einst Daûd Husni5 gehört. Im Bücherschrank daneben stand eine rechteckige Tafel mit dem Gebet »Erhoben und geheiligt werde sein grosser Name auf der Welt, die nach seinem Willen von Ihm erschaffen wurde. Sein Reich erstehe in eurem Leben, in euren Tagen und im Leben des ganzen Hauses Israel«.
Im Wohnzimmer kämpfte Lieto mit dem Grammophon und versuchte, ihm Laila Murâds Stimme zu entlocken. Aber sie klang wie das Quietschen einer rostigen Tür. »Verflucht sei dein Vater, alte Hexe!«
Hanafi lächelte. »Laila Murâd muss dich aber geärgert haben.«
Ohne sich umzudrehen, sagte Lieto: »Fünfunddreissig Piaster hat die Platte gekostet, und sie klingt fürchterlich! Morgen schmeisse ich sie ihnen ins Gesicht.«
»Warum regst du dich so auf? Du hast doch dein Philips-Radio mit den acht Röhren.«
»Weil ich Musik hören möchte, wann ich will, Bruder. Und mein Gott, es ist schliesslich Laila Murâd!«
Lieto warf die Platte beiseite, putzte mit einem feuchten Lappen die Gläser seiner Hornbrille und setzte sie sich wieder auf die schmale Nase. Dann nahm er vom Tisch einen Ring in Form eines Löwen mit einem Karneol im aufgesperrten Maul und steckte ihn an den kleinen Finger.
Hanafi zog die Lederpantoffeln aus und setzte sich. »Nichts für ungut, Madame Laila, aber was gibt’s heute eigentlich zum Abendessen?«
»Zwei Stück gegrilltes Ziegenfleisch. Du wirst dir die Finger danach lecken.«
Ein paar Minuten später kam Tûna mit dem Tee herein. Sie stellte ihn auf den Tisch und zog sich gleich wieder zurück.
Lieto drehte am Senderknopf des Radios herum, bis zu seiner Erleichterung der Ansager zu hören war: »Meine Damen, Fräulein und Herren, nun ist es wieder an der Zeit für grosse Kunst und eine betörende Stimme. Sie hören eine Aufzeichnung des Auftritts von Umm Kulthûm, dem Stern des Orients, anlässlich einer Soiree des Ägyptischen Rundfunks vom Donnerstag, dem 11. November, im Saal des Kinos Rivoli. Das Konzert beginnt mit dem Lied Du liebst erneut, es folgt Du bist grausam zu mir, und zum Schluss hören Sie Die Menschen der Liebe. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Abend.«
Hanafi hatte das Haschischstückchen aus der Zellophanhülle befreit und war nun ganz darin vertieft, es in einem leeren Kaffeetopf mit Halwa und Muskatnuss zu vermengen. Er knetete die Mischung mit dem Zeigefinger durch, legte sie sich dann unter die Zunge und saugte den Saft heraus.
»Du siehst aus, als wolltest du heute noch auf die Zitadelle steigen«, neckte Lieto ihn.
Hanafi lachte so sehr, dass seine beiden Silberzähne im Mund aufblitzten. »Nur wenn Madame Zitadelle wach ist und die sieben Soldaten schlafen. Probier mal!«
»Lieber nicht, das ist genau das Zeug, das mich schon letztes Mal umgehauen hat.« Lieto rieb sein Stückchen zusammen mit dem Tabak unter die glühende Kohle. Dann füllte er die Wasserpfeife mit Rosenwasser, setzte sie zusammen und hielt Hanafi das Rohr hin. »Besser, man verbrennt es. Zieh mal dran!«
Hanafi nahm einen tiefen Zug, der ihm bis ins Gehirn drang, und blies eine dicke Wolke in die Luft. »Erstklassig.«
In dem Moment sang Umm Kulthûm: »Warum liebst du erneut, nachdem doch das Herz Ruhe fand? Hättest du’s nicht getan! Lass es, vergiss, was vorbei ist!«
Lieto blies den Rauch an die Decke, dann fragte er: »Was gibt’s denn Neues von der Götterspeise?«
Hanafi nahm das Käppchen ab und strich sich übers Haar. Beim Gedanken an Halâwa wurde ihm gleich heiss. »Da weiss man nichts zu machen. Jeden zweiten Tag kommt sie in den Laden. Wie ein Stück Butter ist sie, dieses Weibsstück! Proper und wie geschaffen fürs Bett, süsser als Dalida6. Aber da sei Gott vor, bloss nicht in Sünde fallen!«
Lieto zwinkerte ihm zu. »Sie ist hinter dir her, bis du nachgibst.«
»Wäre sie nur ein bisschen früher gekommen, mein Gott, ich wäre im Hotel über sie hergefallen! Safîja hat rissige Fersen, die Kinder haben sie ihre ganze Kraft gekostet. Und jetzt, wo alles überstanden ist, kommt die andere und will die Zeit zurückdrehen.«
»Und wie geht’s deinen Kindern?«
Hanafi zog an der Pfeife und sagte dann: »Die Kinder wollen nicht arbeiten. Im Laden, meine ich. Keiner von ihnen will selbständig sein, alle wollen sie beim Staat unterkommen. Der Beruf ihres Vaters und ihres Grossvaters ist ihnen peinlich! Aber um die Wahrheit zu sagen, ich bin froh darüber. Ich will nicht, dass die Kinder durchmachen, was ich durchgemacht habe.«
»Ach, du liebe Güte! Wenn alle ihre Kinder beim Staat unterbringen, wer soll denn dann noch den Boden bestellen?«
»Mein Gott, wer wohl? Die Bauern, Junge!«
»Aber du brauchst jemanden, der dir im Laden hilft. Wir sind alt geworden.«
Hanafi winkelte den Arm an, so dass sein Bizeps sich unter dem Gilbâb abzeichnete. »Du bist alt geworden, mein Lieber! Ich bin noch gut in Form.«
In dem Moment klopfte es an der Tür. Es war Jûssuf Bachûm, dessen fröhliches Gesicht so rund war, als wäre es mit dem Zirkel gezogen. Hanafi brauchte ihn nur mit Herr Unterhosenverkäufer anzureden, schon kicherte er los.
Jûssuf zog sich die Lederpantoffeln aus und zwängte seinen Hintern, zu dem Süssspeisen und Butterschmalz ihren grosszügigen Beitrag geleistet hatten, zwischen zwei Kissen. »Ihr habt schon ohne mich angefangen, ihr Halunken!«
Lieto pikste ihn mit dem Pfeifenrohr. »Hätte die Dame etwa auf dich warten sollen?«
Das auf Petersilie gebettete und mit Tahina angerichtete Ziegenfleisch wurde gebracht, und jeder bekam eine Flasche Bier. Nach der Mahlzeit machte wieder die Wasserpfeife die Runde. Die blaue Wolke über ihnen wurde so dicht, dass man meinte, gleich würde ein Blitz daraus niederfahren. Indessen sang Umm Kulthûm: »Ich gehorche deiner Liebe, mein Herz … vergesse deinetwegen alles … und schmecke das Bittre in meiner Liebe … im Kelch deiner Abweisung, deines Verlassens.«
»Habt ihr heute die Zeitungen gelesen?«, fragte Jûssuf.
Betroffen klatschte Hanafi in die Hände. »Nagîb! Grosser Gott, sein Bild ist heute von selbst von der Wand gefallen!«
Lieto blies den Rauch in die Luft. »Ein böses Omen.«
»Gott, dieser Mann verdient nicht … aber er kommt wieder hoch. Mit Gottes Hilfe kommt er wieder hoch«, sagte Jûssuf und zog einen Ausschnitt aus der Zeitung al-Ahrâm aus der Tasche seines Gilbâbs. »Hört zu … hm, hm, hm … also: ›Nagîb des Amtes enthoben. Muhammad Nagîb stand seit April in Verbindung zu den Muslimbrüdern. Das Amt des Staatspräsidenten bleibt vakant. Sämtliche Befugnisse übernimmt bis auf weiteres der Revolutionäre Kommandorat unter dem Vorsitz von Oberstleutnant Gamâl Abdel Nasser.‹«
»Gütiger, steh uns bei!«, antwortete Hanafi gedankenverloren.
Lieto befeuchtete seine Fingerspitzen und legte die Kohlestückchen neu zurecht. »Wenn die Leute diesen Mann aus dem Spiel nehmen, bedeutet das nichts Gutes.«
»Jetzt versteh ich gar nichts mehr«, erklärte Jûssuf.
Lieto beugte sich zu ihnen und flüsterte: »Die Offiziere wollen in den Schlössern bleiben. Wie kriegt man sie jetzt wieder in die Kasernen zurück?«
Jûssuf erwiderte: »Aber im März wollten sie doch den Revolutionsrat auflösen!«
»Ja«, sagte Hanafi, »und die Armee hat die Regierung gebeten, den Revolutionsrat bestehen zu lassen. Damals, als sie al-Sanhûri7 zusammengeschlagen haben.«
Lieto schnaubte erregt: »Aber die Armee ist doch die Regierung, meine Herren!«
Jûssuf tätschelte sich zufrieden den Bauch. »Aber das heisst ja nicht, der Revolutionsrat wüsste nicht, was er tut. Präsident Gamâl wird schliesslich seiner Rolle gerecht und hält den Diwan wie ein Uhrwerk am Laufen.«
»Du meinst also, ein paar Majore und ein Oberstleutnant sollen alles ganz allein regeln?«, fragte Lieto.
»Ja, das sollen sie«, meinte Hanafi. »Diese Leute haben das Land umgekrempelt. Sollten sie dann jetzt nicht auch in der Lage sein, es zu lenken?«
»Wie soll man dem Wolf beibringen, Rosinen zu fressen?«, wandte Lieto ein. »Die Soldaten sind gierig. Alle, die ihnen geholfen haben, beseitigen sie: Muslimbrüder, Kommunisten – und viele Juden sind schon nach Jerusalem geflohen.«
»Das kann er doch nicht machen, mein Lieber«, empörte sich Hanafi. »Mein Gott, Cicurel sollte er vertreiben oder Chemla oder Adès8? Du bist verrückt. Der Oberstleutnant ist doch ein vernünftiger Mann.«
»Hast du nicht Nassers Rede neulich gehört?«, fragte Lieto. »Über die jungen Kerle, die das Kino und die amerikanische Bibliothek in die Luft gejagt9 haben? Darüber kann er nicht so einfach hinweggehen. Sie werden sie alle kriegen, und bald weisen sie uns aus.«
»Um Gottes willen, wen weisen sie aus, Hagg?«, fragte Jûssuf, das Pfeifenrohr noch zwischen den Lippen.
»Genau, alter Junge, was hast du denn bloss?«, fügte Hanafi hinzu. »Du bist doch Ägypter.«
Lieto stand auf, um noch etwas Kohle zu holen. »Aber Jude. Ich schaue nur in die Zukunft. Wir bekommen hier immer mehr Hass zu spüren. Und was kommt, ist noch schlimmer. Der Oberstleutnant und seine Hintermänner wollen nicht, dass die Armee die Kontrolle verliert. Und ich sehe niemanden, der sich dem entgegenstellt.«
»Aber alle diese Leute lieben das Land«, warf Hanafi ein.
»Und Cadillacs lieben sie auch«, sagte Lieto.
»Du übertreibst«, meinte Jûssuf.
Hanafi klopfte mit der Feuerzange die Kohle in gleich grosse Stückchen. »Ja, und du machst den Revolutionsrat etwas zu schlecht.«
»Unter uns«, flüsterte Lieto ihnen zu, »ich hab einen Verwandten, der mit einer Frau aus der Familie Kattâwi verheiratet ist. Wisst ihr, was der mir gesagt hat? ›Wenn du abhauen willst, tu’s jetzt! Alle reichen Leute bringen ihr Geld ins Ausland. Selbst Abdalhakam Bergas wird seine Firma liquidieren.‹«
Jûssuf riss die Augen auf. »Donnerwetter! Der grosse Abdalhakam Bergas?«
Hanafi zog ein in Mahalla al-Kubra10 gefertigtes, etwa briefmarkengrosses Taschentüchlein hervor und spuckte hinein. »Du bist immer pessimistisch, Sohn Davids.«
»Das wird sich weisen«, sagte Lieto, und Umm Kulthûm sang: »Er sagt: o Nacht, wir sagen: o Nacht, wir alle sagen: o Nacht. Die Menschen der Liebe, o Nacht …«
Jûssuf wollte das Thema wechseln. »Lasst doch mal die Politik und die ganzen Sorgen beiseite! Habt ihr gehört, was der jungen Biba passiert ist?«
Hanafi lächelte verschmitzt. »Etwas Gutes hoffentlich.«
Jûssuf rutschte ein wenig hin und her, bis er genau in ihrer Mitte sass. »Sie war die Geliebte von Marsûk, dem Uhrmacher. Als sie zu ihm ging, liess sie ihren drei Monate alten Sohn in einem anderen Raum liegen, während sie mit Marsûk im Schlafzimmer war. Aber der Kleine hörte nicht auf zu plärren, und das störte Marsûk. ›Was hat der Junge, Mädchen?‹, fragte er. – ›Er ist erkältet und hat Husten.‹ – ›Dann gib ihm doch ein Schlückchen Cognac, damit ihm warm wird‹, riet er. Das tat sie, der Junge wurde still und gab Ruhe, und sie legte sich wieder unter den Mann.«
»Und dann?«, fragte Lieto.
Jûssuf fuhr fort: »Als sie zwischendurch mal Pause machten, ging sie nach dem Jungen schauen. Da sah sie, dass er ganz blau war. Und sie wälzte ihn hin und her.«
»Haaa?«, rief Hanafi.
Jûssuf schwieg kurz und sah beiden ins Gesicht. »›Der Junge ist tot!‹, rief Marsûk. Er war wohl betrunken und wusste nicht, was er sagte. Biba rannte nackt und am ganzen Leib schlotternd aus dem Haus und schrie aus Leibeskräften. Die gesamte Strasse bekam mit, dass Marsûk mit ihr schlief, und Gross und Klein lief hinter ihr her. Sie liess den Jungen bei Fathîja liegen, der Frau von Saad, dem Friseur, ging in ihre Wohnung, drehte das Gas auf und zündete es an.«
Hanafi schlug sich gegen die Stirn. »So ein Unglück!«
»Sie verbrannte zu Asche«, fügte Jûssuf hinzu. »Nach kurzer Zeit kam Naîm, ihr Ehemann, und hörte, was passiert war. Er nahm den Jungen und brachte ihn ins Krankenhaus. Da stellte sich raus, dass der Kleine lebte. Der Cognac hatte ihm nur auf die Brust gedrückt. Zwei Stunden, und er war wieder frisch und munter.«
Hanafi stand auf. »Und damit wolltest du uns von Politik und Sorgen ablenken? Da hast du uns aber einen Bärendienst erwiesen, du Miesepeter. Was für eine schreckliche Geschichte!«
»Gott schütze unsere Frauen!«, sagte Jûssuf.
Lieto bemühte sich, den Brandgeruch im Raum zu vertreiben. »Wie geht es denn deinem kleinen Hussain, Hanafi?«
»Gut, er ist mein ganzer Stolz. Den Jungen schicke ich mal auf die Militärakademie, weisst du. Er soll Offizier werden.«
»Gleich auf die Militärakademie?«, fragte Jûssuf.
»Wohin denn sonst? Er ist so elegant und smart. Schliesslich ist er der, der mir am ähnlichsten ist. Auf ihn werd ich mal stolz sein können. Eines Tages nennt ihr mich Hanafi, Vater von Oberstleutnant Hussain.«
Lieto klopfte ihm auf den Rücken. »Mögest du lange leben und dich an ihm erfreuen!«
Es war Viertel nach zwei geworden, als Jûssuf, wie ein Kriegsverletzter auf Hanafi gestützt, aufstand. Lachend verabschiedeten sie sich von Lieto. An einer Strassenecke trennten sie sich dann.
Beim Abschied fragte Hanafi noch: »Wann spielt eigentlich Al Ahly gegen Farûk?«
»Du sagst immer noch Farûk, Hanafi. Der heisst doch jetzt Zamalek! Sie spielen am 20., kommenden Samstag.«
»Und so Gott will, werden sie gewinnen. Mekawi und Toto werden die Sache besiegeln.«
»Träum nur weiter.«
Hanafi machte sich auf den Rückweg zu seiner Wohnung in der Nähe des Ladens. Obwohl es sehr kalt war, fror er nicht. Als ihm die frische Luft in die Brust strömte, machte sie ihn nur noch trunkener und träger. Die Mixtur aus dem Halwatopf drückte ihm mehr und mehr auf die Brust und heizte ihm dermassen ein, dass ihm der Schweiss aus allen Poren brach. An einer dunklen Mauer blieb er stehen, um Wasser zu lassen. Er hob den Gilbâb hoch und seufzte erleichtert. Plötzlich liess ein Laut zu seiner Linken ihn auffahren. Er stoppte seinen Strahl. Alle Härchen an Händen und Kopf sträubten sich ihm. Nicht weit entfernt stand ein gehörnter Ziegenbock mit langem weissem Kinnbart und leeren Augenhöhlen. Ruhig steckte Hanafi sein Ding wieder in die Unterhose und sagte: »Erscheinst du mir jetzt in Gestalt meines Grossvaters? Mach dich davon, du Satansbraten!« Um seinem zittrigen Schrei Nachdruck zu verleihen, stampfte er dabei mit dem Fuss auf. Aber der Bock bewegte sich nicht einen Millimeter. Hanafi schluckte und begann leise, aber doch hörbar, die letzten beiden Suren des Korans zu rezitieren. Der Ziegenbock starrte ihn noch einige Sekunden an, drehte sich dann einmal um sich selbst und ging gemächlich davon. Nach Luft ringend, sah Hanafi zu, wie der Schatten lautlos verschwand. Mit dem Rücken zur Wand stand er eine Weile stumm und wie erstarrt da. Dann zog er sich die Kufîja fester um den Hals und wandte sich in die entgegengesetzte Richtung. Er war immer bemüht, diese Wesen zu vertreiben, die ihm nach Mitternacht, unter dem Einfluss des Haschischs, regelmässig über den Weg liefen – in Gestalt von Ziegen, Schafen oder heulenden schwarzen Hunden. Er verbannte sie aus seinem Hirn und rief sich stattdessen Halâwa in Erinnerung. Ihr Duft drang ihm in die Nase und das leise Klirren ihrer Fussreife ins Ohr, ihre rosige Ferse peinigte ihn. Er schwamm im Quell ihrer Brüste, die er fest drückte. »Du quälst und verbrennst mich, du verwirrst mich und zehrst mich auf, und wenn ich klage, lässt du mich stehen, bist mir böse, wenn ich dir sage, du bist grausam zu mir …«, summte er vor sich hin, um sich die dunklen Gassen ein bisschen freundlicher zu machen, bis er endlich zu Hause ankam.
Er erklomm die sechzehn Stufen bis zur Tür und klopfte. Nach einer Minute öffnete Safîja, und all seine Phantasien zerstoben auf einen Schlag. »Warum bist du noch auf?«
»Hussain fühlt sich nicht wohl, er hat Husten«, antwortete sie mit sorgenvoller Stimme. »Was ist mit dir?«
Hanafi musste aufstossen und sagte dann: »Ich bekomme schlecht Luft, ich hab ein bisschen Druck auf der Brust. Mach mir ein Glas Minztee, und verbrenn etwas Räucherwerk!«
»Gern. Aber leg dich neben den Jungen, ich will ihm gerade einen Guavenblättertee kochen.«
Er nahm Käppchen und Kufîja ab, zog den Mantel aus und legte sich neben seinen Sohn, der wach wurde, als er die Bewegung im Bett spürte. »Hussain, was hast du denn?«
»Ich bin so müde, Papa, ich hab Husten«, antwortete er mit mattem Blick.
»Weil du nicht richtig isst, wie dein Vater das tut. Wenn du heute den Geist gesehen hättest, den ich gesehen hab – du hättest nicht gewusst, wie du ihn vertreiben sollst.«
»Du hast heute einen Geist gesehen?«
»Er erschien mir in Gestalt eines Ziegenbocks. Ich sagte: ›Im Namen Gottes!‹, und warf einen Stein nach ihm, da lief er weg. Hätte ich vorher nicht gut zu Abend gegessen, hätte ich mich gefürchtet und wär selbst weggelaufen.«
»Papa, ich hab Angst.«
»Hab keine Angst, Hussain!« – In dem Moment spürte er ein Stechen, als stiesse ihm ein Nagel durch Schulter und Brust. Er knirschte mit den Zähnen und schloss die Augen. Dann küsste er seinen Kleinen auf die Stirn und nahm ihn in die Arme.
Minuten später hörte man ihn schnarchen, heftig schnarchen, röcheln. Laut genug, um Safîja mit der Petroleumlampe in der Hand aus der Küche heranstolpern zu lassen. Sie lief geradewegs aufs Bett zu. »Hanafi … Hanafi!«
Farûk im Raum nebenan hörte den Schrei und stiess an der Tür mit seiner Mutter zusammen. »Was ist los, Mama?«
»Dein Vater antwortet nicht!«
»Papa … Papa!« Farûk zog Hussain aus dem Bett und warf sich über seinen Vater. »Los, wach auf!«
Er nahm dessen Arme und bewegte sie auf und nieder, wie er es im Erste-Hilfe-Kurs der vormilitärischen Ausbildung11 gelernt hatte. Dann schnitt er die Knöpfe der Weste ab, und sie klackerten ihnen zwischen die Füsse. Zwei Sekunden später erschienen auch Salâch und Sainab, gefolgt von Machmûd und Nawâl, schliesslich noch Faika. Mit weit aufgerissenen Augen klammerte sich Hussain an den Bettpfosten, unfähig, zu begreifen, was vor sich ging.
»Hol ein Glas Wasser, Mama! – Komm näher ran mit der Lampe, Salâch!«, rief Farûk. Er massierte seinem Vater die Brust und schaute ihm in die glanzlosen Augen. »Nein, Papa, nein!« Seine Tränen fielen Hanafi auf die Brust.
Mit einem Blick gab der ihm zu verstehen, dass er seine Bemühungen einstellen sollte. Dann richtete er seine matten Augen auf Hussain und flüsterte ihm zu: »Hab keine Angst … hab keine Angst!« Ihm versagte die Stimme. Seine Augen füllten sich mit Tränen – wenige Sekunden noch, und es war vorbei. Mit Tränen in den Augen war er gestorben …
Farûk legte sein Ohr auf die Brust seines Vaters und hörte nur noch Stille. Er schrie auf, und alle fielen ein: »Nein, Papa, nein!« Farûk fuhr hoch und rannte mit dem Kopf gegen die Fensterscheibe, bis sie zersplitterte. Blut strömte ihm über die Stirn, und seine Mutter brach zusammen. Schluchzend stürzten sich die Mädchen auf sie, während die Jungen sich auf die Brust ihres Vaters warfen. Nur Hussain stand noch immer stumm und ausdruckslos da. Den Blick auf das bleiche Gesicht geheftet, verfolgte er wie versteinert das Geschehen. Schliesslich zog eine Hand ihn fort, und er tauchte in eine tiefe Umarmung.
Am kommenden Tag machte sich feierlich der Leichenzug auf den Weg. Sämtliche Bewohner des Viertels, Juden, Christen und Muslime, gingen mit. Alle beweinten Hanafi, vor allem die beiden Freunde, die seinen letzten Abend mit ihm verbracht hatten. Sie beteten für ihn in der Sajjida-Aischa-Moschee, dann begruben sie ihn in der Totenstadt des Imam al-Schâfii in einem Grabhof, den er schon kurz nach seiner Ankunft in Kairo dort erstanden hatte.
Drei Tage später kam Lieto, voller Kummer und mit achtzehn Pfund in der Tasche, die Hanafi bei ihm angespart hatte. Er sprach Safîja sein Beileid aus und klopfte Farûk auf die Schulter. »Du bist jetzt der Mann im Haus. Halt die Ohren steif!«
Dann rief er nach Hussain, der äusserst schweigsam war, fuhr ihm durch die Locken und sah ihm ins Gesicht. »Er ist wirklich das genaue Ebenbild des Seligen!« Er gab ihm zehn Piaster und sagte: »Komm doch morgen bei mir im Laden vorbei, Hussain.«
Der Junge nickte stumm.
2
Vierundfünfzig Jahre später
Samstag, 15. November 2008, nach Mitternacht
Totenstadt des Imam al-Schâfii
Inmitten der Grabsteine glomm eine Lampe. Ihr zitternder Schein erweckte die schlafenden Schatten zum Leben und beleuchtete zwei Gestalten, die langsam vorwärtsschlichen: einen grossen, vornübergebeugten, mit einer Gallabija bekleideten Mann, der die Lampe hielt, und einen jungen Burschen in Hemd und Hose mit einem Brecheisen in der Hand. Weder Hundegebell noch Katzengeschrei hielt die beiden auf, bis sie zu einem kleinen, von zahlreichen Feigenkakteen umsäumten Grabhof gelangten. Neben der verrosteten Pforte, die den Zugang verschloss, stand ein baufälliger Brunnen mit der Inschrift »Lest die Fâtiha für den Inhaber dieses Brunnens, Hanafi al-Sahâr.« Darunter war ein Koranvers eingraviert: »O du befriedete Seele, kehre heim zu deinem Herrn, glücklich und zufrieden, und tritt ein zu meinen Knechten, und tritt ein in meinen Garten!«12 Der Mann streckte seine Hand in die Tiefen seiner Gallabija, die so weit war, dass man sie als Schutzhülle für einen Doppelkabinen-Pritschenwagen hätte verwenden können, und zog einen grossen Schlüsselbund hervor. Im Lampenschein sortierte er die Schlüssel mit seinen langen Fingern, griff schliesslich ein antik aussehendes Exemplar heraus und hielt es ans Licht. »Lies mal, was da draufsteht!«
»al-Sahâr«, antwortete der andere matt.
Der Mann nahm dem schmächtigen Burschen das Brecheisen ab. »Komm!«
Der hielt ihn jedoch zurück. »Soll ich nicht lieber hier auf dich warten?«
Mit einem grauen, halb erblindeten Auge sah der Mann ihn an. »Hast wohl Angst? Drinnen ist es hundertmal sicherer als draussen, du Schlauberger!«
Der Bursche sah sich argwöhnisch um. »In Ordnung, Onkel Gâbir, lass es gut sein.«
Im Grabhof stellte Gâbir die Lampe auf den Boden, steckte seine Hand in die Tasche und zog ein Tuch heraus, das eher wie ein löchriger Lappen aussah. Er faltete es auseinander und entnahm ihm zwei Knoblauchzehen, die er sich mit dem Zeigefinger, so weit es eben ging, in die haarigen Nasenlöcher steckte. Anschliessend kratzte er den Mörtel aus den Fugen der Grabplatten, holte einmal tief Luft und zwängte die Brechstange in den Spalt. Als ein kurzes Knacken ertönte, warf er sie fort, riss die Platten heraus und legte sie beiseite. Ein infernalischer Gestank breitete sich aus, und der Bursche wich schnell zurück. Gâbir jedoch hob die Lampe auf, stieg in das Grab hinab und murmelte dabei die Sure »Die Menschen«. Kurz darauf stiess er einen Schrei aus, der dem Burschen durch Mark und Bein ging: »Ewig ist Gott allein!«
Der Junge spuckte aus. »Erst mal zerstöre Gott das Haus deiner Mutter, du Sohn einer Wahnsinnigen!«
Wenige Minuten später stieg Gâbir wieder aus dem Grab, den Zipfel seiner Gallabija zwischen die Stümpfe geklemmt, die der häufige Gebrauch der Wasserpfeife von seinen schwarzen Zähnen noch übrig gelassen hatte. Unter dem Gewand lugten zwei dichtbehaarte Schenkel, krumm wie Kakerlakenbeine, und eine weite Kattununterhose hervor. Gâbir gab sich alle Mühe, die Steinplatten wieder an Ort und Stelle zu schieben, und stopfte auch den Mörtel zurück in die Fugen, bevor er sich dem Burschen zuwandte und die Hand in den Tiefen seiner Gallabija verschwinden liess. Als er sie wieder herauszog, präsentierte er dem Jungen zwei Totenschädel. »Zwei Stück, und was für welche! Gut abgelagert, du wirst deine Freude dran haben. Ich hab nämlich genau diesen Grabhof ausgesucht, weil hier neulich noch alles offen gewesen ist, als sie die Tochter von dem Besitzer des Brunnens beerdigt haben. Falls jemand das Grab besuchen kommt, wundert er sich so nämlich nicht, dass es vor kurzem jemand aufgemacht hat«, sagte er und wies mit dem Zeigefinger auf seinen Kopf. »Schlau, was? Du brauchst nur irgendwem zu sagen: Gâbir vom Friedhof des Imam al-Schâfii, und er weiss gleich, woran er ist. Ich bin der Generalvertreter.«
»Jaja, du bist der neue BMW-Generalvertreter. Nun mach’s aber kurz, Onkel, der Gestank bringt mich um!«
»Stell dich nicht so an, Junge, es gibt lebende Menschen, die ekliger riechen. Hast du mal ’ne Plastiktüte?«
Der Junge trat mit dem Fuss seine Zigarette aus, die sowieso schon fast aufgeraucht war, und zog einen schwarzen Müllbeutel aus der Tasche.
Gâbir reichte ihm den einen Schädel, nachdem er ihn gründlich untersucht hatte. Danach prüfte er den anderen, der wesentlich lädierter aussah. »Komm näher mit der Lampe, du Mimöschen!« Im tanzenden Lichtschein inspizierte Gâbir das Gebiss, bis er fand, was er gesucht hatte: zwei Silberzähne. »Nix für ungut, aber die sind mein Trinkgeld. Ist doch in Ordnung, Goldjunge?«
»Na, denn prost!«, knurrte der Bursche mit zusammengebissenen Zähnen.
Gâbir presste seinen geöffneten Mund auf den Oberkiefer des Totenschädels, biss fest zu und verharrte so eine Weile in einem langen Kuss. Schliesslich hatte er die beiden Silberzähne herausgelöst und deponierte sie in seiner geräumigen Tasche. Dann stopfte er den Schädel in die Tüte. »Soll ich sie für dich kleinmachen?«13
»Was denn sonst, sollen wir sie uns etwa fürs Mittagessen füllen? Mach sie klein, Onkel!«
Gâbir ging zu einer anderen Grabpforte und holte daneben einen riesigen Hammer hervor, der aussah, als verstehe er sich auf sein Handwerk. Er beugte sich vor, hielt die Tüte mit einem Knie fest und liess den Hammer immer wieder auf die Schädel niedersausen, bis sie vollständig pulverisiert waren. Dann schüttelte er den Staub von seiner Gallabija ab und hielt dem Burschen die Tüte hin. Der holte eine Hundertpfundnote aus der Tasche und drückte sie ihm in die Hand. Gâbir presste einen feuchten Kuss der Zufriedenheit auf beide Seiten des Geldscheins. »Möge Gott uns auf immer gewogen bleiben und uns das alles auf Dauer erhalten! Denn was brauchen wir mehr?« Er breitete die Arme aus und zeigte auf die Gräber ringsum, stolz wie ein englischer Duke auf seine Ländereien. »Seine Gnade ist unendlich. Deshalb gebe ich dir auch Rabatt.«
Der Junge zog den schwarzen Beutel fest zu. »Ja, das merkt man.«
Gâbir streckte seine rissige Hand aus. »Und ob, ist ein reiner Freundschaftspreis. Zwei Schädel für hundert Pfund, das ist doch geschenkt! Mein Gott, wenn so ein Kerl von der Medizinischen Fakultät kommt, da nehme ich dreihundert. Weisst du, wie der Dollar steht?«
»Willst du mich auf den Arm nehmen, Onkel? Das sind Tote. Was hat das mit dem Dollar zu tun?«
»Alles wird teurer, das gilt für die Toten noch mehr als für die Lebenden. Und so propere Schädel gibt es schliesslich fast gar nicht mehr – mit denen, die hier begraben sind, hatte der liebe Gott es mal gut gemeint. Jetzt ziehen solche Leute ja alle weg in die 6.-Oktober-City. Guck doch mal, was die da für so ein Stück haben wollen und in welchem Zustand das ist!«
»Hast du keine Angst, eines Tages den Geistern dieser Menschen zu begegnen?«
Gâbir zeigte auf zwei Grabstelen. »Ach Gott! Der eine hier ist mein Onkel mütterlicherseits und das da hinten mein Onkel väterlicherseits.« Dann holte er tief Luft. »Die Lebenden überdauern die Toten. Wenn der Besitzer des Brunnens jetzt bei uns sässe – er würde zwei Züge aus seiner Pfeife drauf rauchen. Das ist das Gesetz des Lebens, jeder lebt von jedem. Oder sind die Würmer mehr wert als wir?«
Der Junge schüttelte über diese Logik missbilligend den Kopf. »Schon gut. Komm, bring mich zum Ausgang!«
Als sie in die Nähe der Strasse kamen, blieb Gâbir stehen, als dürfe er den Friedhof nicht verlassen. Er hob seine riesige Hand und winkte. »Alles Gute, Jungchen – und viele Grüsse an die, die dich geschickt haben!«
Dann drehte er sich um und kehrte in den Grabhof zurück. Von dort trat er in eine Kammer, die gleichfalls ein gutes Grab abgegeben hätte, bückte sich unter ein rostiges Eisenbett und zog eine Plastikmarmeladendose hervor. Sie war bis oben hin mit Silber- und Goldzähnen gefüllt, nebst einigen Ringen und Ohrringen, die die Angehörigen der Toten nicht an sich genommen hatten, weil sie sie nicht hatten abziehen können – oder weil sie fürchteten, die Ruhe des Verstorbenen zu stören. Gâbir öffnete den Deckel und warf die beiden Silberzähne in die Dose. Zwei Zähne, die einst – vor langer Zeit, in Lietos Haus – in Hanafis lachendem Mund aufgeblitzt hatten … Dann stellte er sie wieder an ihren Platz und ging hinaus, um die Tonköpfe seiner Wasserpfeife zu sortieren, bis der Ruf zum Morgengebet erschallte. Und damit begann ein neuer Tag: der erste Tag, an dem Hanafi al-Sahârs Kopf nicht bei seinem Körper ruhte.
3
Hanafi al-Sahârs Vorhersage, was seine Sprösslinge betraf, bewahrheitete sich: Jeder von ihnen folgte seinem eigenen Traum. Aus Pietät ihrem verstorbenen Vater gegenüber und von dem Wunsch beseelt, das schwere Erbe zu bewahren, führten sie den Laden noch zwei Jahre weiter. Weil sie jedoch weder von der Landwirtschaft noch von Geschäften etwas verstanden, wurde der Schuldenberg mit der Zeit immer grösser und lastete schwer auf ihren Schultern. Wie ein Stück glühende Kohle, an dem man sich die Hände verbrannte, schoben sie sich gegenseitig die Verantwortung zu, aber schliesslich ging es nicht mehr, und sie mussten verkaufen. Den Erlös teilten sie so untereinander auf, dass jeder sein Krümelchen abbekam. Danach gingen alle Brüder arbeiten, und auch die Mädchen fanden ihr Auskommen. So hielten sie ein weiteres Jahr durch, bis die Erste einen Ehemann in Aussicht hatte. Das brachte das Fass endgültig zum Überlaufen. Auch der Boden musste nun verkauft werden. Die jungen Männer hatten einigermassen sichere Stellen – nur Hussain, der beim Tod seines Vaters erst zwölf Jahre alt gewesen war, musste sich noch eine Arbeit suchen, um sich Bata-Schuhe, eine Gabardinehose und vielleicht ein Gazehemd mit gestärktem Kragen leisten zu können. Für zwei Jahre hatte Lieto ihn in seine Werkstatt genommen – als Polierjungen für Gold und Diamanten. Dort erhielt er zwei Piaster am Tag, hinzu kamen die Geschenke der grosszügigen Bewohner des Viertels und das Entgelt für seine Hilfe am Sabbat, das sich in manchen Wochen auf ein Pfund summierte.14Es war ein beständiges Leben – bis Lieto Anfang 1957, nach dem Sinai-Feldzug, unheilbar erkrankte und arbeitsunfähig wurde. In einem Klima täglicher Wut- und Hassausbrüche gegen die Juden und ihre Anwesenheit im Lande liquidierte er seine Geschäfte, verkaufte seinen Laden und wanderte nach Frankreich aus.
1962 leistete Hussain seinen Militärdienst. Zuvor hatte er an der Philosophischen Fakultät seinen Abschluss in Geschichte gemacht. Den Traum seines Vaters, auf die Militärakademie zu gehen, konnte er wegen fehlender Beziehungen nicht verwirklichen. Alle Gesellschaftsschichten drängten inzwischen in die Armee, die ihnen unvergleichliche Aussichten bot. Die Uniform verschaffte einem Bewunderung und Respekt und öffnete verschlossene Türen, deshalb galt sie allen als erstrebenswertes Ziel. Rundfunk, Zeitungen und Kinofilme heizten diesen Trend weiter an, indem sie Geschichten von Armeeoffizieren verbreiteten, aus denen später führende Politiker geworden waren. Nach einem Jahr beim Militär nahm Hussain seinen Abschied, um in einer Primarschule als Geschichtslehrer zu arbeiten. Dort blieb er bis zum Juni 1967.
An einem Morgen dieses Jahres wachte er plötzlich von einem lauten Klirren auf. Durch eine Phantom, die die Schallmauer durchbrochen hatte, war die Scheibe im Schlafsaal seiner Armee-Einheit zersprungen! Nur zwei Wochen zuvor war er bei einer Generalmobilmachung eingezogen worden. Die politische Führung hatte zu einem Sommerurlaub nach Tel Aviv eingeladen, inklusive Verpflegung, »Reise nach Jerusalem« und Zaubervorstellung. Später wurde Hussain in die Gegend von Arîf al-Gamâl, auf dem Weg nach al-Arîsch, verlegt. In den drei Wochen dort lebte er von Staub und Steinchen, die der Wind herbeigetragen hatte. Eines Tages brach er mit zwei Kameraden zu einem Patrouillengang auf. Bei ihrer Rückkehr einen Tag und eine Nacht später fanden sie die Männer, die dageblieben waren, am Boden wieder. Gefesselt und mit den Gesichtern im Staub, lagen sie nebeneinander aufgereiht. Und jeder hatte einen Einschuss im Kopf, so gross wie ein Mauseloch.
Zwei Monate später war Hussain wieder in Kairo. Statt auf einen Reisebus zu warten, der doch nicht kommen würde, war er lieber zu Fuss nach Hause gegangen – ohne eine Kugel verschossen zu haben, mit leerer Feldflasche und einer Verletzung am Kniegelenk, derentwegen man ihn aus dem Militärdienst entliess.
Kurz darauf war Hussain wieder Lehrer in derselben Schule wie zuvor. Bis zur Hochzeit mit Nâhid, seiner fünfzehn Jahre jüngeren Nachbarin, dauerte es allerdings noch. Nach der Heirat ging er für vier Jahre als Leiharbeiter nach Saudi-Arabien. In dieser Zeit kam er nur einmal, 1977, für einen Urlaub nach Hause, um seinen einzigen Nachkommen zu zeugen: Taha Hussain al-Sahâr.
Im September 1989 wurde ganz Ägypten von einer Nachricht aufgeschreckt: Man hatte die Gelder der Rajjân-Gruppe beschlagnahmt. Für Tausende, die ihre gesamten Ersparnisse dort angelegt hatten, war diese Meldung ein unbeschreiblicher Schlag. Noch am selben Tag nahm das Misr International Hospital einen Patienten auf, der einen Nervenschock erlitten hatte, durch den sein Unterkörper gelähmt war. Dieser Mann war niemand anderes als Hussain al-Sahâr!
Er wurde vorzeitig pensioniert und musste sich fortan mit einem Einkommen zufriedengeben, das kaum für schlechte Zigaretten und die Medikamente reichte. Hätte er nicht Privatunterricht erteilt, wären sie alle zugrunde gegangen, er und seine Familie. Sechs Jahre harrte Nâhid noch bei ihm aus, dann allerdings rebellierte sie. Sie trennten sich und vereinbarten, dass sie ihm Taha überliess und sich mit gelegentlichen Besuchen begnügte. Die Frequenz dieser Besuche nahm jedoch mit der Zeit immer weiter ab wie die Herzschläge eines Todkranken. Schliesslich hörten sie ganz auf. So blieben Hussain und sein Sohn zu zweit in ihrer Wohnung in Dukki, direkt am Finneyplatz15, zurück. Diese hatte Hussain gekauft, als er in Saudi-Arabien gearbeitet hatte. Sie war das Einzige, was ihm vom Geld aus der Fremde geblieben war. Die vermögende Schicht zog währenddessen nach Muhandissîn und Samâlik.
*
Taha trat nach Abschluss seines Pharmaziestudiums als Berater in eine Pharmafirma ein. Seine Aufgabe bestand hauptsächlich darin, die Arztpraxen abzuklappern, um dort die Medikamente seiner Firma an den Mann zu bringen, neue Produkte vorzustellen sowie die Nachfrage nach den Mitteln und deren Verbreitung zu erfassen. Er trug Anzug und Krawatte – und ein Lederköfferchen, in dem sich all die Gunsterweise befanden, mit denen seine Firma den Ärzten ein Produkt schmackhaft machen wollte: kostenlose Musterpräparate, Einladungen zu Kongressen, Übernachtungen in den Hotels von Scharm al-Scheich und so weiter. Taha besuchte Praxen in den stattlichsten Gebäuden der Stadt, in denen eine ruhige Atmosphäre herrschte. Dort gab es leise Hintergrundmusik, Stapel ausländischer Zeitschriften, eine gedämpfte Beleuchtung, mannigfache Gerüche und meist auch ein abstraktes Gemälde, mit dem er nichts anzufangen wusste. Darunter sass normalerweise eine korpulente Arzthelferin, die den Telefonhörer nicht vom Ohr nahm.
Eine geheimnisvolle Patientin mit ausladender Brust warf ihm kurze, verstohlene Blicke zu – zumindest bildete er sich das ein. Um die Zeit totzuschlagen, hörte er während des Wartens meist Musik auf seinem MP3-Player. Er setzte sich in eine Ecke, stöpselte sich die Ohrhörer ein und stützte die Wange auf die Faust, bis man die Abdrücke der Finger darauf sah. Den Blick hielt er auf seine Schuhe und sein Köfferchen gerichtet, die für ihn wie lebendige, lederne Stücke seiner selbst waren. Währenddessen drehten sich in seinem Kopf die Gedanken so zäh wie das träge Wasser in einem Kanal, das leblos und unbewegt, grün und still vor sich hin rottet. Wie alle, die keinen Ausweg aus dem Räderwerk des Alltags sehen und sich unter dem Motto »Das Leben ist nun mal kein Zuckerschlecken, Kind« allmählich aufreiben, war er dabei innerlich voll Wut. Erst die näselnde Stimme der Schwester rüttelte ihn auf: »Bitte sehr, Herr Doktor.« Mit gezwungenem Lächeln erhob er sich, gefolgt von den neugierigen Blicken der Patienten. Und gleich setzte er eine andere Maske auf, eine, die zu dem, was er an der Universität gelernt hatte, in keinerlei Verbindung stand. Die Seele eines Hausierers ergriff Besitz von ihm, als er bei dem Arzt anklopfte, bei dem keiner seiner Kollegen vorher nennenswerten Erfolg gehabt hatte. Das lag unter anderem daran, dass es ihnen an Persönlichkeit mangelte. Wären sie schöne Frauen gewesen, hätte die Sache freilich anders ausgesehen.
»Guten Abend, Doktor Sâmi.«
In seine Unterlagen vertieft, sah der Arzt gar nicht auf, als der Floh zur Tür hereingehüpft kam.
»Nur drei Minuten, wenn Sie erlauben?«
Unter den Ärzten, mit denen Taha zu tun hatte, gehörte Doktor Sâmi Abdalkâdir zur Kategorie A: Er hatte einen guten Ruf, eine normale Untersuchung bei ihm – nach vorheriger Terminabsprache – kostete mehr als zweihundert Pfund. Ausserdem war er reizbar, kalt, überheblich, elegant, selbstsicher, unwillig – und trug auf die Stirn geschrieben: »Bitte nicht stören.« Mit der üblichen Methode kam man bei ihm nicht weiter. Taha würde sich anstrengen müssen – und so unterwürfig graben wie am Hinterteil einer altjüngferlichen Meeresschildkröte …
Er strich sich über das schwarze Haar, das er von seinem Grossvater geerbt hatte, und drückte sich die Brille auf der Nase zurecht. »Eine Frage: Das Bild da hinter dem Schreibtisch – haben Sie das gemacht?« Hinter dem Kopf des Arztes hing ein Foto von einem trübseligen Sonnenuntergang. Unten rechts stand klein und in blasser Farbe das Datum, woran Taha erkannt hatte, dass es von einem Amateur stammen musste.
Doktor Sâmi sah sich genötigt, seine schmale Brille abzusetzen und sich eitel wie ein Pfau umzublicken. »Ja, das hab ich fotografiert.«
Taha tat äusserst erstaunt, setzte sich und stellte sein Köfferchen auf dem Stuhl gegenüber ab. »Nein, nicht möglich!«
Mit einem Lächeln, das sagen sollte, so etwas sei für ihn doch ein Klacks, richtete sich der Arzt in seinem Stuhl auf und erwiderte: »Ich hab es an der Nordküste aufgenommen.«
»Das kann ich ja gar nicht glauben, Arzt und gleichzeitig Profifotograf – das geht doch eigentlich gar nicht!«, sagte Taha mit überwältigter Miene. Der Arzt verzog sein Gesicht zu einem selbstzufriedenen Lachen, und Taha machte mit seiner Bauchpinselei weiter: »Auch die Praxis ist äusserst erlesen eingerichtet – die Farbabstimmung und die ganze Atmosphäre sind sehr angenehm.« Er strich mit der Handfläche über den Schreibtisch. »Fühlen Sie nur das Holz!«
Der Arzt lachte, während Taha aufstand und nach seinem Köfferchen griff. »Hat mich sehr gefreut, Herr Doktor.«
»Wo wollen Sie denn hin?«, hielt der andere ihn zurück.
»Ich halte Sie nur auf. Mir reicht es schon, dass ich Sie kennenlernen durfte – ich bin übrigens Taha.«
»Sind Sie deswegen gekommen?«
»Nein, eigentlich wollte ich mit Ihnen über unser Produkt sprechen. Aber die drei Minuten sind vorbei und …«
»Setzen Sie sich, Taha!«, fiel Doktor Sâmi ihm ins Wort.
Das liess bei solch einem urzeitlichen Ungeheuer doch hoffen!
Taha nahm wieder Platz. »Wie steht es mit dem Hebsolan?«
Doktor Sâmi lehnte sich zurück. »Darüber hat schon jemand mit mir gesprochen. Einwandfrei, gut!«
»Wie dosieren Sie es, Herr Doktor?«
Der Arzt geriet ein wenig aus der Fassung und rieb sich die Nase. »Ähm, eine Tablette … eine Tablette täglich.«
Taha lächelte spitzbübisch. »Zwei Tabletten. Zwei Tabletten ist die Dosis, Herr Doktor«, sagte er, öffnete sein Köfferchen, nahm mehrere Werbebroschüren heraus und breitete sie vor dem Arzt aus. »Der Name Hebsolan kommt von Hebe. So hiess bei den alten Griechen das Mädchen, das den Göttern den Wein einschenkte. Und das tat es zweimal am Tag. So können Sie sich die richtige Dosis merken.«
Der Arzt musste lachen. »Schön, das gefällt mir. Kommt der Name wirklich von …?«
»Natürlich«, unterbrach ihn Taha, »passt doch gut! Hebe ist die Mundschenkin der Götter. Hebsolan ist nämlich nicht nur ein Beruhigungsmittel. Es ist genauso zusammengesetzt wie die Sedativa, die Sie zur Betäubung bei Operationen verwenden. Das heisst, es wirkt gleichzeitig stimmungsaufhellend und beruhigend. Natürlich beeinflusst es auch Blutdruck, Zuckerspiegel und so weiter.«
»Alles klar, aber woher wissen Sie von dieser Mundschenkin der Götter?«
»Mein Vater ist Geschichtslehrer. Seit meiner Kindheit ist Geschichte mein tägliches Brot. Er raucht Cleopatra-Zigaretten, fährt einen Ramses und trinkt Isis-Tee.«
Das reichte, um die drei senkrechten Linien, die sich zwischen den Augenbrauen des Arztes gebildet hatten, wegzubügeln. Er lachte laut auf und spielte dann eine neue Karte aus. »Wie sieht es denn mit Kongressen aus? Sie haben ja noch etwas Zeit …«
»O ja«, unterbrach Taha ihn, »da gibt es den Kongress der CCIH in Kanada. Die Firma trifft gerade ihre Vorbereitungen dafür.«
»Wann ist dieser Kongress?«
Taha fühlte, dass er dem Arzt den Mund wässrig gemacht hatte, und fuhr fort: »In drei Monaten. Anmeldung, Aufenthalt und Reisekosten übernehmen wir.«
»Gut, und wo sind die Einladungen, mein lieber …?«
Zum zweiten Mal lächelte Taha spitzbübisch. »Taha. Taha al-Sahâr, Herr Doktor. Offen gestanden weiss ich nicht, ob ich Sie auf die Liste setzen kann«, sagte er dann, stützte sich mit dem Ellenbogen auf den Schreibtisch und beugte sich vor, um eine gewisse Vertraulichkeit herzustellen. »Die Firma konzentriert sich nämlich auf die Ärzte, die das Produkt auch unterstützen. Wir sehen das an den Abrechnungen der Apotheken in der Umgebung, Sie verstehen. Die Firma verlangt von mir, in den kommenden sechs Monaten in Dukki und Muhandissîn mehr Hebsolan abzusetzen. Wenn ich den geforderten Prozentsatz erreiche, kann ich zwei Ärzte für den Kongress nominieren. Hier in der Gegend kommen nur Sie und Doktor Saîd Iskandar in Frage – er fährt übrigens zum Kongress. Über Sie hab ich aber in den Apotheken hier erfahren, dass Sie bei chronischen Schmerzen Vicodin verschreiben. Dabei wissen Sie doch: Hebsolan wirkt direkter und schneller.«
»Nun ja, Hebsolan ist für ältere Menschen ein wenig gefährlich – und teuer«, antwortete der Arzt beschwichtigend und in einschmeichelndem Tonfall.
Taha lächelte. »Teuer sind Sie selbst ja auch – und ein Medikament ohne Nebenwirkungen gibt es nicht. Doktor Saîd Iskandar nämlich …«
Als er den Namen seines Konkurrenten hörte, wurde Doktor Sâmi fuchsteufelswild. »Was soll ich also tun?«
»Hebsolan ein bisschen fördern.«
»Aber die kostenlosen Muster sind sehr rar!«
»Kein Problem«, sagte Taha, zog mehrere Medikamentenschachteln aus seinem Köfferchen und legte sie auf den Schreibtisch. »In Ordnung so?«
»Ich hätte gern noch ein paar für den Apotheker an der Ecke. Sagen Sie ihm, es kommt von Doktor Sâmi, er wird verstehen.« Der Arzt riss ein Blatt aus einem kleinen Block und kritzelte Namen und Adresse des Apothekers darauf.
Taha nickte. »Selbstverständlich.«
»Und der Kongress?«, erinnerte ihn Doktor Sâmi.
»Ich werde tun, was ich kann«, sagte Taha, nahm sein Köfferchen und streckte lächelnd die Hand aus. »Hat mich sehr gefreut, Herr Doktor.«
Grundregeln der Arbeit im Vertrieb:
– Zuallererst gilt es, bei jedem Kunden den Schwachpunkt zu finden.
– Lächeln und selbstsicher auftreten.
– Ein bisschen Lob kann nicht schaden.
– Leg nicht gleich all deine Karten offen auf den Tisch.
Taha verstand sich auf seine Arbeit. Er wandte stets alle Regeln an und galt bei seinen Kollegen und Chefs als Mann für schwierige Fälle. Man setzte ihn bei den schwer anzusprechenden Ärzten ein, die einen gewissen Ruf hatten. Bevor er jemanden aufsuchte, sammelte er mit Hilfe der firmeneigenen Datenbank Informationen über ihn, studierte dessen Abrechnungen bei den Apotheken und taxierte das Verkaufsvolumen der Konkurrenz. Während des Besuchs las er seine Körpersprache. Und dann kam das Einfallstor, der Schwachpunkt: Bei fünfzig Prozent der Ärzte waren das materielle Interessen, bei fünfundvierzig Prozent eine Schwäche für Frauen und bei fünf Prozent Perversitäten und unvorhersehbare Dinge.
Ganz unmerklich schmeichelte er sich ein – sein Lächeln war einzigartig –, ein wenig Schmieren und dann ein Angebot, das schwer zurückzuweisen war. Und zum Schluss kam der Lehrsatz der pressing power: andauerndes, beharrliches Drängen, monoton wie Pulsschläge – nur nicht aufhören! –, bis der Arzt sich dem Produkt beugte. So vergingen die Tage, ermüdende wöchentliche Routine, eine Sisyphusarbeit. Vor elf Uhr abends war er nicht damit fertig. Es sei denn, er schaute im Café al-Nil vorbei – von dem aus man den Nil gar nicht sehen konnte –, weil es ihn nach seiner Dosis Koffein verlangte, mit der er sich einen weiteren Tag am Leben halten konnte. Und weil er dort seinen Freund Jassir treffen wollte, der ewig Sprüche klopfte wie: »Die Schiedsrichter sollten kein Schwarz mehr tragen – die Trauer sitzt doch im Herzen, nicht in Trikot und Shorts.«
Jassir war Tahas Nachbar und alter Freund, mit dem er als Kind immer Fangen gespielt hatte. Später waren sie dann dazu übergegangen, Sexfilme anzuschauen. Und jetzt rauchten sie zusammen eine Wasserpfeife mit Apfelaroma. Jassir war ein leidenschaftlicher und unverbesserlicher Kaffeetrinker. Man hätte sich leichter einen Kaugummi aus dem Schamhaar entfernen als ihn vom Kaffee abbringen können. Dabei war er – bis auf einen kleinen Bauchansatz, den er sich seit seiner Hochzeit zugelegt hatte – dünn wie eine Palmgerte und trug fast nur Karohemden. Die türmten sich in seinem Schrank zu solchen Stapeln, dass man alle Schaufenster des Warenhauses El Tawheed & El Nour damit hätte zubauen können. Seine Freunde versuchten zwar immer wieder, ihm diese Art Hemden auszureden, weil sie aussahen wie Küchentischdecken, aber keine Chance! Eher würde man im Stadtteil Dâr al-Salâm Olympische Spiele veranstalten! Jassirs Haare waren schwarz und vorn hochgebürstet, in den dichtbehaarten Händen hielt er ständig eine Zigarette, und Drogen schluckte er wie ein gefrässiger Staubsauger, vor allem potenzsteigernde Mittel. Wie eine Biene die Blüte suchte er regelmässig die Strasse nach Bilbais auf, um sich dort seine wöchentliche Ration zu besorgen. Er war Absolvent der Juristischen Fakultät und arbeitete als Rechtsanwalt in einer renommierten Kanzlei. Als Helfer in der Not erschien er oft urplötzlich wie ein in Karos gehüllter Geist aus der Lampe, griff Taha unter die Arme und verschwand dann wieder in seine Welt. Tagelang liess er sich nicht blicken, um dann unvermittelt wieder auf der Bildfläche zu erscheinen, Rauch auszustossen und über die Spielergebnisse von Al Ahly und ein bisschen über Politik zu reden. Dabei landete er allerdings jedes Mal automatisch beim Thema Frauen.
»›Teil 9 Artikel 60: Die Bestimmungen des Strafgesetzbuches sind nicht anzuwenden auf Taten, die in guter Absicht ausgeführt wurden.‹ Bei der Seele meines verstorbenen Vaters: Als ich geheiratet habe, hatte ich jede Menge guter Absichten«, sagte er nun unwillig.
»Ich hab es dir doch von Anfang an gesagt, du Blödian. Du weisst doch, warum ich bei der Hochzeit hinter dir hergelaufen bin und dir die Prostata massiert habe.«
»Die hättest du besser ganz entfernt! Diese Frau wiegt hundertzehn Kilo! Sie ist so gross wie der Wassertank für ein ganzes Mietshaus: Um sie zu wiegen, braucht man eine Brückenwaage. Und stemmen kann sie kein Mensch, höchstens ein Gabelstapler.«
»Juhuuuu, so kannst du sie doch wunderbar loswerden! Fahr sie irgendwohin weit weg, und setz sie dort ab. Dann kann sie nicht wieder zurück.«
»Ich sag es dir unter vier Augen, Taha, aber verrat es niemandem: Ich hab eine Freundin bei Facebook. Mein lieber Scholli, die hat vielleicht einen blütenweissen Teint! Du kennst doch die Figur von Jennifer Lopez. Und die ist nichts gegen sie!«
»Das sind doch Ammenmärchen! Am Ende ist sie auch noch Europäerin.«
Jassir richtete sich auf und schlug sich auf die Schenkel. »Ich erzähle keine Ammenmärchen, bei der Seele meines Vaters! Sie heisst Jasmin. Und jeden Tag krieg ich von ihr die heissesten Nachrichten, die man sich vorstellen kann. Und ihre Fotos erst! Wohlgeformte Beine, weiches Haar und sinnliche Lippen. Eine richtige Sahneschnitte.«
»Und du willst mir weismachen, so eine interessiert sich ausgerechnet für dich?«
»Die sagt Sachen, mein Lieber, aber hallo! Gestern meint sie zu mir: ›An dir ist was Besonderes.‹«
»Sie meinte sicher: was besonders Blödes!«, ulkte Taha.
»Ich hatte ihr nur mal versuchsweise eine Freundschaftsanfrage geschickt und konnte es gar nicht glauben: Sie hat mir ihr ganzes Herz ausgeschüttet! Sie fühlt sich allein, ihr Mann ist dauernd hinter anderen Frauen her. Und sie kommt um vor Wut. Gott gebe, dass sie sich scheiden lassen kann!«
»Und wenn sie sich wirklich scheiden lässt?«
»Dann schnapp ich sie mir natürlich.«
»Und machst es wie Rifâa al-Tahtâwi16 – du holst dir einfach die passende Vase ins Haus?«
»Für einen Mann ist doch eine Frau nicht genug. Erst recht nicht eine made in Egypt. Sei nicht so kindisch, und hilf mir lieber!«, forderte Jassir seinen Freund auf.
»Was soll ich denn für dich tun? Soll ich sie für dich heiraten?«
»Ach was, guck dir doch an, was ich für ein Wrack bin! Es geht darum, dass ich das aus eigener Kraft nicht schaffe.«
»Dann gib dein Letztes!«
»Du musst mir was besorgen, was Tote aufweckt.«
»Versuch’s doch mal mit Facebook!«
»Das ganze Gerede mit ihr hab ich schon durch, mein Lieber. Das Mädchen ist jetzt richtig heiss. Bald hab ich sie so weit.«
»Und du hast ihr gesagt, dass du verheiratet bist und so – und Rechtsanwalt und alles?«
»Sie weiss, dass ich verheiratet bin. Und sie weiss, dass ich auch meine Frau nicht mehr leiden kann. Aber ich hab ihr erklärt, dass ich Staatsanwalt bin.«
»Oje! Und wenn sie es rausfindet, stehst du in Unterhosen da.«
»Das wird sich dann schon alles lösen lassen. Aber was soll ich einnehmen?«
»Tramadol, Virecta. Oder besser: Nimm Erec, eine rote Pille. Aber brich sie durch!«, riet Taha ihm.
»Nein, diese Sachen hab ich ja schon alle zu Hause im Regal liegen. Ich brauch eine richtige F-16, so was ganz Wildes, sag ich dir.«
»Was Wildes, dann nimm dir doch eine Schrotflinte! Hast du übrigens gehört, was neulich in der Zeitung stand?«
»Was denn?«
»Ein Boot voll Viagra ist im Nil untergegangen. Geh dir doch zwei Kanister abfüllen, bevor die Leute den Fluss trockenlegen!«
»Ach, lass doch den Quatsch, hör auf damit!«
»Es soll ein neues Zäpfchen geben.«
»Und wie heisst es?«, fragte Jassir neugierig.
»Wick VapoRub.«
»Blödmann.«
Taha lachte Tränen. »Du meine Güte, du willst dein ganzes Leben lang Zäpfchen nehmen, um deinen Händen beim Hochzeitmachen zuzugucken! Ich kann gar nicht glauben, dass unter zehntausend Spermien ausgerechnet du das schlaueste gewesen sein sollst.«
»Ich weiss ja, dass du mich unbedingt fertigmachen willst.«
»Wenn es so weit ist, komm doch bei mir in der Apotheke vorbei! Dann setze ich dir eine Spritze, die dir einen Allradantrieb bescheren wird. Lieber Gott, wer dich so sieht, kann sich gar nicht mehr vorstellen, wie du in deiner Verlobungszeit warst: mit gegelten Haaren und sooo müüüde! Teddybärchen als Geschenk – und die ganze Nacht telefonieren! Und wie du immer in der Zeitschrift Dein Privatarzt die Artikel über das Eheleben gelesen hast!«
»Genau die haben mich gegen die Wand gefahren. Sie müssen wohl von Importfrauen gehandelt haben.«
»Und wie sich herausgestellt hat, ist Dâlia made in Egypt!«
»Guck, Dâlia ist die Beste – theoretisch. Aber praktisch … du verstehst schon. Wir brauchen nicht noch mal drüber zu reden. Komischerweise hängen wir zurzeit aneinander wie die Kletten. Die Neue hat die Leistung hochgefahren.«
»Weil du dich schuldig fühlst, Jassir.«
»So was wie Schuld sollte es, verdammt noch mal, dabei gar nicht geben! Jeder sollte zwei Frauen haben, eine offizielle und eine zweite auf Basis eines Vertrags, der alle sechs Monate erneuert wird. Du wirst schon noch sehen.«
»Was werde ich sehen? Bin ich denn wie du? Bei dir ist es so, als gingst du ins Restaurant und bestelltest dir was zu essen. Und wenn du es dann kriegst, guckst du lieber auf die Teller der andern. Eine Schande ist das!«
»So langsam zweifle ich an deinen Fähigkeiten.«
Taha nahm einen kräftigen Zug aus der Wasserpfeife, blies Rauchkringel in die Luft und sagte: »Zweifle doch an dir selbst, und mach dir um mich keine Sorgen!«
»Du wirst auch mal eine treffen, die dein Leben auf den Kopf stellt.«
»Damit eine mein Leben auf den Kopf stellen kann, müsste ich ja erst mal ein Leben haben«, sagte Taha lächelnd.
*
Tahas Treffen mit Jassir dauerte eine Apfelaroma-Wasserpfeife lang, die Hamdi, der Wächter über Feuerzange und Kohle, zweimal anzündete. Dann begann es nach Kohle zu riechen. Taha sah auf seine Uhr und brach auf. Nachdem er an seinem Hauseingang Mansûr, den Türhüter, begrüsst hatte, der mit einem oberägyptischen Zauberspruch antwortete, »Grügotterr Ta-a!«, ging er hinein. Noch nie hatte er den Ehrgeiz gehabt, diesen Spruch in seine einzelnen Buchstaben zu zerlegen oder