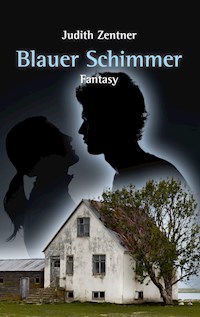
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Die achtzehnjährige Theresa lebt in Althusen - einem kleinen, verschlafenen Dorf in Norddeutschland. Sie glaubt an einem der langweiligsten Orte der Welt zu wohnen, in dem nie irgendetwas Aufregendes passiert. Dies ändert sich jedoch schlagartig, als sie die Verlassenen kennenlernt: Es eröffnet sich ihr eine verborgene, geheimnisvolle Welt, in die sie immer weiter eintaucht. Als sich Theresa dann auch noch Hals über Kopf in eines dieser übersinnlichen Wesen verliebt, wird ihr Leben aufregender, als sie es sich je hätte träumen lassen: Matti, der Junge mit den Wuschelhaaren, zieht Theresa sofort in seinen Bann. Doch Matti ist unsterblich und kein Mensch mehr. In Theresa wachsen die Zweifel, ob ihre Liebe überhaupt eine Zukunft hat…. Eine romantische Fantasy-Geschichte für junge und junggebliebene Leserinnen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
- Für meinen Großvater und für Tom und Ylvie -
Inhaltsverzeichnis
VORWORT
DIE VERBORGENEN WINKEL ALTHUSENS
FAMILIE
ACHTZEHN
FRIEDRICHS GESCHICHTE ODER ZURÜCK ZU IHR
FRAGEN ÜBER FRAGEN
DIE VERLASSENEN
EIN SCHOCK
ENDLICH ANTWORTEN
JOHANNS GESCHICHTE ODER KAMPF GEGEN DAS VERGESSEN
NEU IN ALTHUSEN
GEISTERGESCHICHTEN
ALLTAG IM ANGESICHT DER UNENDLICHKEIT
MATTIS GESCHICHTE ODER UNZERTRENNLICH
GÄNSEHAUT
UNERWARTETER BESUCH
ANSGARS GESCHICHTE ODER MUTTERLIEBE
EIN NEUER FREUND
MAGDALENAS GESCHICHTE ODER FLUCHT IM FEUER
PLÄNE SCHMIEDEN
AUF DER SUCHE
ABSCHIED
NEUE PROBLEME
ROUVENS GESCHICHTE ODER EWIGE RACHE
UNTER BEOBACHTUNG
ENDE DER SUCHE
ENTTÄUSCHUNG
WIE EIN ALBTRAUM
ZURÜCK IM LEBEN
ALTE LIEBE ROSTET NICHT
DIE WELT RETTEN
DANKSAGUNG
KONTAKT
VORWORT
Eigentlich passiert nie irgendetwas Außergewöhnliches in Althusen, jedenfalls nicht so lange ich denken kann. Es ist eines dieser typischen Dörfer in Norddeutschland, das im Windschatten einer größeren Stadt liegt: ein paar Bauernhöfe, ein Bäcker, eine Tankstelle, ein kleiner Supermarkt, ansonsten nur Wohnhäuser. Das Aufregendste ist hier noch der Baggersee, der im Sommer Badespaß verspricht und im Winter, wenn man Glück hat, zum Schlittschuhlaufen taugt. Manche würden Althusen vielleicht sogar „idyllisch“ nennen, andere fänden vermutlich „öde“ oder - etwas netter ausgedrückt - „verschlafen“ passender.
Aber jetzt ist alles anders - hier in Althusen. Dabei hat sich eigentlich nichts verändert, außer mir selbst!
DIE VERBORGENEN WINKEL ALTHUSENS
Ich war wie üblich auf dem Weg zu Großvater Friedrich und fragte mich, was es wohl heute zum Mittag gäbe: aufgewärmte Dosen-Ravioli oder doch eher Pfannkuchen? Für viel mehr als diese Gerichte reichten Großvaters Kochkünste nicht aus. Trotzdem gingen mein Bruder Kurt und ich immer gerne zu ihm essen, wenn unsere Eltern lange arbeiten mussten. Er freute sich über die Gesellschaft, vor allem seit meine Oma Martha vor fünf Jahren gestorben war, und wir freuten uns über eine warme Mahlzeit und die unzähligen Geschichten, die Großvater immer zu erzählen hatte. Die Tür wurde schwungvoll geöffnet, als ich klingelte und Friedrich vor mir stand. Obwohl er schon zweiundachtzig Jahre alt ist, misst er fast zwei Meter, hat eine kräftige Statur und schlohweiße Haare, die er sich mit einem Kamm feinsäuberlich zu einem Seitenscheitel kämmt, so dass ihm eine Haarsträhne seitlich über die Stirn hängt. Das lässt ihn fast noch ein bisschen jugendlich und verwegen aussehen, einmal ganz davon abgesehen, dass er nur noch ein Auge hat. Während des zweiten Weltkrieges hat er einen Kopfschuss erlitten, der ihn fast das Leben gekostet hätte. Stattdessen verlor er sein rechtes Auge und trägt seitdem entweder eine Augenklappe über der rechten Augenhöhle oder aber eine Brille, die links so aussieht wie jede andere Brille auch, deren rechte Seite jedoch einfach dunkelbraun eingefärbt ist. Als ich noch ein Kind war, führte das zu dem hartnäckigen Gerücht, dass mein Großvater ein Pirat sei und Friedrich trug auch nicht zur Aufklärung dieses Missverständnisses bei, da er nur geheimnisvoll grinste und mit seinem verbliebenen Auge zwinkerte, wenn ein Kind wagte, ihn direkt danach zu fragen.
„Zu welchen kulinarischen Genüssen hast du dich heute hinreißen lassen, Großvater Friedrich?“, fragte ich ihn, nachdem ich ihm einen Kuss auf die Wange gegeben hatte. Früher sagte ich einfach Opa zu ihm. Aber als ich älter wurde, machte ich mir einen Scherz daraus ihn förmlich Großvater zu nennen, da er immer fand, dass sich das so furchtbar alt anhörte. Irgendwann krönte ich das Ganze dann noch, indem ich seinen Vornamen hinzufügte. Es ist so eine Art augenzwinkernder running-gag zwischen uns geworden und Kurt hat es von mir übernommen. „Wir empfehlen für heute Spiegelei auf Toast, verehrte Enkeltochter“, antwortete er gewohnt verschmitzt. Erstaunt zog ich die Augenbrauen hoch. „Tatsächlich. So etwas Exotisches hatten wir aber schon lange nicht mehr“, zog ich ihn auf. Kurt hatte vor mir Schulschluss gehabt und saß darum schon auf der Eckbank in der Küche. Er stopfte bereits ein Toast in sich hinein und brachte lediglich ein „Hey“ und ein Nicken zur Begrüßung heraus, während er weiterkaute.
Nachdem wir mit dem Essen fertig waren, brach Kurt nach Hause auf, weil er am Nachmittag mit seiner Band proben wollte. Mich aber fragte Großvater Friedrich: „Hast du noch Lust auf einen kleinen Spaziergang?“. Zwar war morgen Wochenende und ich hatte heute auch noch nichts weiter vor, aber mich machte der Ausdruck „kleiner Spaziergang“ misstrauisch, da ich wusste, was das bei Friedrich zu bedeuten hatte. Schon oft war ich mit ihm zu einen „kleinen Spaziergang“ aufgebrochen und fand mich dann auf einer ausgedehnten Wanderung wieder. Das war so eine Art Hobby von Großvater: Mit seinem Fotoapparat bewaffnet, unternahm er lange Streifzüge durch Althusen, dessen Umgebung und Nachbardörfer, immer auf der Suche nach passenden Motiven für seine Fotosammlung. Dabei bevorzugte er alles Alte, Verlassene, Verfallene, irgendwie Geheimnisvolle. Auf diesen Exkursionen hatte ich ihn schon oft begleitet und auch wenn ich häufig maulte, weil mir der Weg zu lang wurde, so musste ich doch insgeheim zugeben, dass es sich stets lohnte, weil er mir immer wieder Dinge zeigen konnte, die ich ohne ihn gar nicht bemerkt, an denen ich einfach vorbeigeblickt hätte. Das konnte ein knorriger, abgestorbener Baum sein, ein vor sich hin rostendes Autowrack oder ein altes, verlassenes Fabrikgebäude, das dem Verfall anheimgefallen war. Er öffnete mir die Augen für die geheimnisvolle Magie dieser Dinge. Vor allem in meiner Kindheit wurde meine Fantasie davon beflügelt und ich malte mir Geschichten von Elfen und anderen zauberhaften Wesen aus, die diese Orte und Dinge bewohnten.
Ich wog also einen langen Fußmarsch gegen möglicherweise verlockende Einblicke in die verborgene Welt Althusens ab und gab mich geschlagen. „Ja gerne“ antwortete ich, „aber ich möchte anschließend keine Blasen an den Füßen haben, weil du mich um die halbe Welt gezerrt hast.“ Er lachte nur und bemerkte gespielt theatralisch: „Ich gelobe feierlich, den Fußmarsch auf ein Mindestmaß zu begrenzen und dir dafür etwas Besonderes zu zeigen.“ „Abgemacht!“, antwortete ich und schlug in seine ausgestreckte Hand ein.
Er führte mich zunächst durch die Straßen Althusens, die ich nur allzu gut kannte, bis wir den Ortsrand erreichten. Von da an führte ein Feldweg in die Weiden, Wiesen und Felder, die das Dorf umgaben. Auf diesen steuerte Großvater zielstrebig zu. Er war nicht asphaltiert, sondern bestand aus Sand und Schlacke. Außerdem war er nach tagelangen Regengüssen ziemlich aufgeweicht. Mit Blick auf meine Chucks, die garantiert nicht wasser- und schlammfest waren, fragte ich Großvater, ob wir ausgerechnet diesen Weg gehen müssten. „Es ist nicht mehr weit“, beschwichtigte er mich. Und dann fing er ein merkwürdiges Gespräch an: „So, morgen wirst du also achtzehn, stimmt`s?“, stellte er mehr fest, als dass er fragte. „Ja, stimmt. Wieso?“, erwiderte ich. „Wichtiger Tag ist das morgen, weißt du?“, fuhr er fort. „Ab morgen bist du volljährig, sozusagen erwachsen. Die Kindheit ist morgen offiziell zu Ende.“ Ich sah ihn argwöhnisch an, um zu sehen, ob er vielleicht grinste, weil er mich ein bisschen aufziehen wollte, aber er sah sehr ernst aus. Verwunderung machte sich in mir breit. Mit meinem Großvater konnte ich mich zwar immer wunderbar unterhalten, aber normalerweise waren unsere Themen die Bücher, die wir gerade lasen oder die Musik, die wir gerne hörten und ähnliche Dinge. Ich konnte mich nicht erinnern, dass er schon mal ein Gespräch über „ernste Angelegenheiten“ mit mir geführt hätte. „Wie meinst du das?“, fragte ich ihn schließlich. „Ich muss dir etwas erzählen. Etwas, was mir mit achtzehn Jahren widerfahren ist. Es hat mein Leben verändert und es ist an der Zeit, dass du davon erfährst und selbst entscheidest, was du mit diesem Wissen anfangen möchtest. Aber jetzt sind wir erst mal angekommen. Ich erzähle später weiter.“ Verwirrt blickte ich mich um. Seine bedeutungsschwere Ankündigung hatte mich so durcheinandergebracht, dass ich gar nicht mehr auf den Weg und meine Umgebung geachtet hatte. Wir waren etwas außerhalb des Dorfes inmitten einiger Kuhweiden angekommen. Zwischen zwei dieser Weiden führte ein kleiner Sandweg auf eine Gruppe dicht beieinander stehender Bäume zu – beinahe ein kleines Wäldchen. Auf diesen Sandweg bog er nun ein und ich stolperte ihm hinterher. Der kleine Weg war mir vorher noch nie bewusst aufgefallen und ich hatte keine Ahnung wohin, er führte. Als wir auf Höhe der Bäume angelangt waren, konnte ich sehen, dass dahinter ein Gebäude versteckt lag. Je näher wir kamen, desto mehr wurde von dem kleinen Häuschen sichtbar. Es musste einmal ein altes Bauernhaus gewesen sein, das in früheren Zeiten zu einem Hof gehörte, der hier inmitten der Weiden gelegen hatte. Als wir vor dem Haus angelangt waren, nahm ich es deutlicher in Augenschein. Es war ein typisches Objekt von Großvaters Fotobegierde: Das alte Häuschen hatte seine besten Tage eindeutig hinter sich. Durch den hellen Putz an der Frontseite zogen sich tiefe Risse, das rotgedeckte Ziegeldach wies viele Löcher auf und war in der Mitte offensichtlich eingesunken. In den Fenstern, die mit ihren sechsfachen Sprossen bestimmt einmal freundlich ausgesehen hatten, fehlten an vielen Stellen die Scheiben. Teile des Hauses waren außerdem mit dichtem Efeu überwuchert, der auch vor dem Inneren nicht Halt machte und durch die Löcher in den Fenstern und im Dach hineinwuchs.
Großvater Friedrich schien das jedoch alles nicht abzuhalten. Einsturzgefährdete Gebäude hatten ihn meines Wissens noch nie abgeschreckt und so ging er geradewegs auf die Eingangstür zu. Diese hing schief in der Türzarge, so dass sie ihren eigentlichen Zweck, nämlich vor Wind und Wetter zu schützen sowie ungebetene Gäste draußen zu halten, sowieso nicht mehr erfüllte. Großvater öffnete die Tür so weit, dass wir hineintreten konnten. Wir standen in der Diele des alten Häuschens. Vorsichtig darauf bedacht, wohin ich trat, sah ich mich um, während wir weiter in den nächsten Raum schritten. Im Inneren des Hauses sah es auch nicht besser aus. Überall lagen Steine, Dachziegel und Glasscherben auf dem Boden, Teile der Innenwände waren eingestürzt und an manchen Stellen war die Zimmerdecke eingebrochen, so dass man durch klaffende Löcher in das obere Stockwerk sehen konnte. Von den Wänden, die einst mit einer gemusterten Tapete beklebt waren, war nun der nackte Putz zu sehen von wenigen Stellen abgesehen, an denen noch Reste der Tapete in zerfetzten Bahnen herabhingen. An einigen Fenstern hingen noch Fetzen vergilbter Gardinen. Es waren sogar noch ein paar alte Möbelstücke vorhanden. Mitten im Raum stand ein altes Ledersofa, an dessen Rückseite der Bezug aufklaffte und den Blick auf das Schaumstoffinnere freigab. Aus der Sitzfläche stachen Sprungfedern hervor. Ebenso erging es dem dazu passenden Sessel, der seitlich vom Sofa stand. Ein Esstisch aus Holz mit sechs Stühlen, von denen die weiße Farbe abblätterte, eine große Schrank- und Regalwand, die aussah, als würde sie in sich zusammenfallen, sobald man sie berührte, und sogar ein Fernseher aus prähistorischen Zeiten, dessen Mattscheibe zersprungen war, komplettierten die Inneneinrichtung in dem Raum, in dem wir standen. Es musste einmal das Wohn- und Esszimmer der Menschen gewesen sein, die hier einst gelebt hatten, dachte ich. Sofort kamen mir tausend Fragen: Wer hat hier wohl gelebt? Und warum haben sie das Haus verlassen? Wieso haben sie ihre Einrichtung nicht mitgenommen? Während ich so vor mich hin grübelte bemerkte ich, dass auch Großvater sich umsah – aber nicht so wie ich, so erstaunt wie man sich nur beim ersten Mal umsieht. Er sah so aus, als wäre er schon oft hier gewesen und, was mich noch viel mehr wunderte, er nickte mehrmals in verschiedene Richtungen. Als er bemerkte, dass ich ihn beobachtete, sah er mich fragend an, oder vielleicht sogar prüfend. Als ich nicht darauf reagierte, fragte er nur: „Und?“. Ich wusste nicht so Recht, was ich darauf sagen sollte. Sicher, es war wieder einer dieser faszinierenden Orte, der geheimnisumwoben, fast sogar magisch wirkte. So ein typischer Großvater-Friedrich-Ort eben. Und als Kind hätte ich sicher schon überlegt, wo man sich am besten verstecken kann und ob es hier wohl spukt, wenn es Nacht wird. „Es ist … außergewöhnlich“, antwortete ich darum nun zögerlich. Aber das schien nicht das zu sein, was sich Großvater erhofft hatte. Er sah ein wenig frustriert, vielleicht auch enttäuscht aus, versuchte aber, sich das nicht anmerken zu lassen. Er fragte leichthin: „Willst du auch noch die anderen Zimmer sehen?“ „Klar“, gab ich zurück.
Das Bild, das sich im Wohnzimmer des Hauses gezeigt hatte, setzte ich in den anderen Räumen fort: Überall Spuren des Verfalls, aber ein Großteil der Hauseinrichtung war zumindest noch vorhanden. Im Erdgeschoss gab es noch die Küche, ein kleineres Schlafzimmer, ein Bad und eine Art Abstellraum. Zum Obergeschoss gehörten drei weitere Wohn- und Schlafräume. Wenn ich richtig gerechnet hatte, wohnten hier also ehemals mindestens fünf Menschen, wenn man davon ausging, dass eines der Schlafzimmer von einem Elternpaar benutzt wurde. Vom oberen Stockwerk aus hatte man einen guten Einblick in den ziemlich großen Garten, der sich an die Rückseite des Hauses anschloss. Er bestand aus einer weitläufigen Wiese, die mit mehreren Obstbäumen bewachsen war. Diese wurden oftmals von dichten Schlingpflanzen überwuchert. Zwischendrin gab es mehrere Inseln aus dichtem Rosengestrüpp, die einstmals die Beete gebildet haben müssen. Der verwunschene Eindruck des Hauses setzte sich hier nur natürlich fort.
Als wir dort oben standen und in den Garten hinabblickten sagte Großvater: „Ich kenne dieses Haus schon sehr lange und komme oft hierher.“ Fragend sah ich ihn an: „Warum?“. Als er gerade antworten wollte, hörte ich den Klingelton meines Handys, der mir eine SMS ankündigte. Ich murmelte: „Entschuldigung“, und sah auf das Display. Die Nachricht kam von meiner Mutter. „Es ist Regina“, fügte ich erklärend hinzu und las die wenigen Zeilen: „Wo bleibst du? Die Pizza wartet.“ „Oh nein!“, entfuhr es mir. „Was ist los?“, wollte Großvater wissen. „Ich habe völlig vergessen, dass ich Regina und Joschi versprochen habe, dass wir heute Abend gemeinsam Pizza backen. Sie warten schon auf mich.“ Meine Eltern halten es aus irgendeinem Grund für pädagogisch sehr wertvoll, wenn man sie nicht Mama und Papa, sondern bei ihren Vornamen nennt. Ich verstehe zwar nicht warum, aber tue ihnen trotzdem den Gefallen. Mein Vater heißt eigentlich Joachim, aber er wurde schon „Joschi“ genannt, solange ich denken kann. „Na, dann aber los – ab nach Hause!“ forderte mich Großvater auf. „Es tut mir so leid. Ich hätte so gerne noch deine Geschichte gehört. Und ist es wirklich in Ordnung, wenn du alleine nach Hause gehst?“, fragte ich besorgt. Es war Herbst und obwohl es erst später Nachmittag war, fing es schon an, dunkel zu werden. „Machst du Witze? Ich bin schon so oft alleine von hier nach Hause gegangen, da werde ich es dieses Mal wohl auch noch schaffen. Schließlich bin ich ein Mann im besten Alter!“, scherzte er. Ich schaute ihn skeptisch an, aber er schien daran keinen Zweifel zu hegen. Also beschloss ich, dass es tatsächlich am einfachsten wäre, wenn ich direkt von hier nach Hause ginge und mir den Umweg über Großvaters Wohnung sparte. Ich tippte noch eine schnelle Antwort - „Bin in zehn Minuten da!“- und drückte Großvater einen Kuss auf die Wange. Im Gehen rief ich ihm noch zu: „Komm gut nach Hause. Bis morgen. Auf deine Geschichte bin ich immer noch sehr gespannt!“ Ich lief vorsichtig die wackelige Holztreppe hinunter, aus dem Haus hinaus und zurück auf den kleinen Sandweg. An dessen Ende lief ich in die entgegengesetzte Richtung, aus der wir gekommen waren und war in wenigen Minuten zu Hause angekommen.
FAMILIE
Joschi, Regina und Kurt saßen schon am Esstisch und unterhielten sich, als ich ankam. Es war zu einer Art Ritual geworden, dass wir alle paar Wochen gemeinsam Pizza machten. Wenn Kurt und ich auch zunehmend eigene Wege gingen und Regina und Joschi uns dabei große Freiheiten ließen – auf diese wenigen gemeinsamen Familienabende legten unsere Eltern großen Wert. „Kurt hatte uns ausgerichtet, dass du noch mit Friedrich unterwegs bist, aber ich dachte, du bist vor siebzehn Uhr zu Hause“, erklärte Regina. „Tut mir echt leid, ich hab unseren Termin völlig verschwitzt“, gab ich zu. „Aber wir können sofort loslegen“, fügte ich noch beschwichtigend hinzu. „Das will ich auch hoffen“, grummelte Kurt vor sich hin, „ich hab einen Mordskohldampf!“. Ich rollte mit den Augen. Schließlich hatte er bei Großvater Friedrich ja zum Mittag auch schon mehrere Toasts verdrückt, so dass er jetzt eigentlich noch keinen Hunger leiden dürfte. Aber vierzehnjährige Jungs schienen irgendwie immer Hunger zu haben.
Unser Pizza-Ritual lief jedes Mal folgendermaßen ab: Alle Zutaten für den Belag wurden auf den Tisch gelegt. Jeder schnappte sich etwas davon und schnippelte, was das Zeug hielt. Ich nahm mir eine rote Paprika. Anschließend holte Joschi den Teig, den er schon vor einigen Stunden zubereitet hatte und der nun schön aufgegangen war, rollte ihn auf dem Blech aus und jeder bekam eine Ecke des Bleches zugeteilt, die er mit seinen Wunschzutaten belegen durfte. Nachdem die Pizza im Backofen war und ihren herrlichen Duft verströmte, deckten wir gemeinsam den Tisch und ließen uns anschließend unser gemeinsames Werk schmecken. So saßen wir oft noch recht lange beieinander und unterhielten uns, manchmal spielten wir auch im Anschluss noch etwas gemeinsam. Diese wenigen gemeinsamen Familienabende genossen wir alle, auch wenn Kurt sich vermutlich zu cool vorkam, um das zuzugeben.
Heute lief das Gespräch unweigerlich auf meinen morgen bevorstehenden Geburtstag zu. „Und? Was steht nun morgen an? Planst du doch noch die ultimative Spontangeburtstagsparty?“, wollte Joschi wissen. Wie mich das nervte! Mehrmals schon in den letzten Wochen hatte ich deutlich gemacht, dass ich keine Lust auf eine große Party hatte und es nichts dergleichen geben würde. Ehrlich gesagt war mir nicht klar, was alle sooo außergewöhnlich daran fanden, achtzehn Jahre alt zu werden. Klar, rein rechtlich war man nun volljährig. Aber ansonsten änderte sich doch am eigenen Leben erst einmal gar nichts. Außerdem war ich ein ziemlicher Partymuffel, ich machte mir einfach nicht viel daraus. „Nein, Joschi! KEINE PARTY. Ich hab Lena und ein paar anderen Freundinnen gesagt, dass sie gerne vorbeischauen und sich ein Stück Kuchen abholen können. Und Großvater kommt natürlich auch. Aber das war`s.“ Joschi guckte mich entgeistert an. „Das kann doch nicht dein Ernst sein. Als ich achtzehn wurde, hab ich die Party des Jahrhunderts gefeiert. Also zumindest glaub ich das, denn ich war so besoffen und bekifft, dass ich gar nicht mehr viel davon weiß“, kicherte er. Das war ja mal wieder ganz typisch. Allein die Vorstellung fand ich schon peinlich, aber er schien zu erwarten, dass ich das genauso machen würde. Mir war die Lust auf Familie geradewegs vergangen, darum stand ich auf und sagte: „Ich backe noch schnell einen Kuchen für morgen.“ Als ich mich schon gerade aus dem Zimmer stehlen wollte, rief Joschi mir hinterher: „Das kommt gar nicht in Frage. Du wirst doch nicht deinen eigenen Geburtstagskuchen backen. Ich mache dir wie jedes Jahr meine berühmte Schokotorte.“ Dazu konnte ich trotz allen Ärgers nicht nein sagen, denn seine Schokotorte war wirklich ungemein lecker und ich selbst hätte jetzt nur noch Lust gehabt, einen schnellen Marmorkuchen zusammenzurühren. „Na gut, wenn du unbedingt willst“, entgegnete ich grinsend. „Dann geh ich jetzt hoch und mach noch ein paar Hausaufgaben“, versuchte ich aus der Situation zu entkommen. „Resa, morgen ist Wochenende“ seufzte Joschi. „Sei doch nicht so verdammt pflichtbewusst.“ „Okay, dann hör ich jetzt laut Musik und lese dabei. Ist dir das wild genug?“, fragte ich entnervt. Alle am Tisch schmunzelten vor sich hin: Unterhaltungen dieser Art gab es bei uns öfter.
Bevor mich noch jemand aufhalten konnte, war ich zur Tür hinausgeschlüpft, lief die Treppe hinauf und schloss meine Zimmertür hinter mir. Ich drehte tatsächlich laute Musik auf, schnappte mir das Buch vom Nachttisch, das ich gerade las und warf mich auf mein Bett. Schon nach wenigen Seiten merkte ich, wie meine Augenlider immer schwerer wurden und ich gar nicht mehr richtig verstand, was ich da eigentlich las. Ich legte das Buch beiseite, zog mich schnell um und ging mir die Zähne putzen. Als ich wieder in mein Bett fiel, musste ich noch einmal an Großvaters merkwürdiges Verhalten heute denken. Das eigenartig ernste Gespräch über meinen Geburtstag, das er angefangen hatte, sein prüfender Blick im verfallenen Haus und sein seltsames Genicke. Mir fiel auch wieder ein, dass er mir anscheinend eine wichtige Begebenheit aus seinem Leben erzählen wollte und mir lief ein Kribbeln den Rücken hinunter, als mir klar wurde, dass das alles irgendwie miteinander in Verbindung stehen musste. In Gedanken ging ich noch einmal durch das verfallene Haus, das mir Großvater heute gezeigt hatte. Dann war ich auch schon eingeschlafen.
ACHTZEHN
Am nächsten Morgen, einem Samstag, wurde ich von einem durchdringenden Lärm aus meinem Traum gerissen. Ich saß senkrecht im Bett und sah meine Familie vor mir, die sich um mein Bett gruppiert hatte. Kurt und Joschi hatten ihre E-Gitarren umgeschnallt und spielten darauf Happy Birthday, während Regina dazu sang. Meine Eltern spielen beide in einer Rock-Punk-Grunge-Band - Joschi als Gitarrist und Regina als Sängerin. Sie sind wohl auch die größten Fans der Band Nirvana, die, die den Grungerock erfunden haben. Als sich ihr Sänger, Kurt Cobain, 1994 erschoss, war die Namensgebung für Kurt, der 1995 geboren wurde, quasi besiegelt. Manchmal frage ich mich, ob das nicht irgendwie ein schlechtes Omen war, schließlich ist die Sache für Kurt Cobain ja nicht gerade gut ausgegangen und drogenabhängig war er auch noch. Allerdings wirkt mein Bruder Kurt meist ganz fröhlich und die einzige Parallele, die ich bisher zu seinem Namensgeber feststellen kann, ist, dass er ebenfalls in einer Band spielt. Unser Keller wurde schon vor langer Zeit zum Probenraum umfunktioniert und meine Eltern und Kurt müssen sich darum streiten, wer wann mit seiner Band dort spielen darf.
Ich hingegen durfte mich jetzt, dank Nirvana, über das schrägste Geburtstagsständchen meines Lebens freuen. Auf jeden Fall war ich jetzt wach – hellwach. „Alles Gute zum Geburtstag!“, riefen alle fröhlich im Chor, als sie ihr Lied beendet hatten. Ich war aufgestanden und alle umarmten mich und gratulierten mir. Wir gingen hinunter und setzten uns an den bereits gedeckten Frühstückstisch. Regina hatte meinen Platz mit Blumen, Kerzen und bunten Servietten geschmückt und meine Geschenke drum herum drapiert. Das hatte sie schon so gemacht, als ich noch ein Kind war und das würde sie wohl auch noch so machen, wenn ich alt und grau wäre. Aber es sah wirklich nett aus und ich fing gleich an auszupacken. Von Kurt hatte ich eine CD mit den seiner Meinung nach derzeit abgefahrensten Bands bekommen. Ich kannte nicht eine davon, ließ mich aber gerne überraschen. Meine Eltern schenkten mir ein paar Bücher und hauptsächlich Geld. Das hatte ich mir so gewünscht, da ich noch unschlüssig war, ob ich mir ein neues Fahrrad oder ein Tablet davon kaufen sollte. Wir frühstückten gemeinsam und anschließend begann ich mit den Geburtstagsvorbereitungen. Joschi kam mit seiner Schokotorte ins Esszimmer und stellte sie in die Mitte des Tisches. Sie sah wirklich extrem lecker aus. „Danke dafür. Manchmal bist du doch der Beste“, sagte ich strahlend und drückte ihm einen Kuss auf die Wange. „Immer gerne“, gab er grinsend zurück, „für meine Lieblingstochter habe ich keine Kosten und Mühen gescheut“. Ich bin, nebenbei bemerkt, seine einzige Tochter – zumindest hoffe ich das!
Ich wusste nicht genau, wann die ersten Gäste eintreffen würden, denn ich hatte allen einfach nur gesagt, dass sie im Laufe des Tages vorbeischauen könnten, wann es ihnen gerade passte. Ich war soeben fertig mit meinen Vorbereitungen, da klingelte es auch schon an der Tür und mir war klar, dass das nur meine beste Freundin Lena sein könnte. Ich hatte die Tür noch nicht ganz geöffnet, da sprudelte sie auch schon drauflos: „Herzlichen Glückwunsch, Theresa! Ich hab mich so auf deinen Geburtstag gefreut. Das wird bestimmt ein ganz toller Tag und dann bist du jetzt endlich achtzehn. Mann, wie ich dich beneide…“. Ich hatte schon jetzt den Eindruck, dass sie aufgeregter war als ich. Sie schloss mich in eine dicke Umarmung. Dann ging sie einen Schritt zurück und musterte mich von oben bis unten. „Na, da hat sich ja jemand so richtig in Schale geschmissen“, bemerkte sie sarkastisch.
Ich blickte an mir herab: Jeans, Turnschuhe, ein Strickpulli – also das, was ich eigentlich fast immer trug. Im Sommer auch wahlweise mit T-Shirt. Meine langen dunklen Haare trug ich zu einem Zopf zusammengebunden. Mir war klar, dass mein Äußeres in Lenas Augen ein absolutes No-Go war. Sie selbst wurde in ein paar Wochen achtzehn und ich war mir sicher, dass sie schon jetzt fieberhaft überlegte, was sie anziehen würde, welches Makeup dazu passen würde und wie sie ihre langen, blonden Haare stylen würde. Ich verdrehte nur die Augen, bat sie ins Esszimmer und fragte sie, was sie gerne essen und trinken würde.
Obwohl sie stets enorm auf ihre Figur bedacht war, konnte sie Joschis Schokotorte doch nicht widerstehen. „Mal ehrlich, Theresa. Du hättest doch wirklich was sagen können. Wir wären nett zusammen shoppen gegangen, ich hätte dich bei der Auswahl geeigneter Klamotten beraten und heute Morgen wäre ich gekommen und hätte dich gestylt und geschminkt.“ Allein bei der Vorstellung daran, wie ich danach ausgesehen hätte, musste ich grinsen. Ich wäre mir vermutlich vorgekommen wie früher beim Kinderkarneval – einfach nur verkleidet. „Lass gut sein, Lena. Ich fühl mich so am wohlsten“, antwortete ich. „Du weißt doch: Bei mir ist modemäßig Hopfen und Malz verloren.“ „Da hast du wohl leider recht“, seufzte sie nur.
Meine Familie kam ins Esszimmer und begrüßte Lena, die ich schon seit dem Kindergarten kenne. Ich wunderte mich ein bisschen, dass sich sogar Kurt mit an den Tisch setzte und auch noch dort blieb, nach dem er sein drittes Stück Torte in sich hineingestopft hatte. Ich hatte schon länger den Verdacht, dass er heimlich für Lena schwärmte. Nachdem sie eine Weile geflirtet hatten, fragte Lena endlich, womit ich schon die ganze Zeit gerechnet hatte: „Na los, Resa, sag schon: Was geht heute Abend ab?“ „Was sollte denn deiner Meinung nach abgehen?“, fragte ich skeptisch. Lena sprudelte sofort begeistert los. „Du musst heute Abend unbedingt mit ins Midnight kommen.“ Das war die zurzeit angesagteste Disco in der Stadt. „Da sind heute Abend bestimmt alle aus der Schule und du kannst mit allen feiern, ohne selbst eine Party schmeißen zu müssen. Das ist doch perfekt, oder?“, fragte sie überschwänglich. Ich verzog das Gesicht. „Echt lieb gemeint, Lena. Aber das ist nichts für mich. Ich kann nicht tanzen und im Midnight läuft nicht gerade meine Musik. Ich bleib einfach hier zu Hause, ehrlich, das macht mir nichts aus. Heute kommen noch die anderen Mädels hier vorbei, hoffe ich jedenfalls, und damit habe ich dann auch alle gesehen, die ich gerne sehen möchte.“ Lena gab nur noch ein resigniertes „Wie du meinst!“ von sich und fuhr fort, sich mit Kurt zu unterhalten, der darüber übers ganze Gesicht strahlte. Nach einer Weile klingelte es wieder und Sarah, Laura, Anna und Daniela standen vor der Tür. Sie wohnten ebenfalls alle in Althusen, ich kannte sie schon seit Ewigkeiten und traf mich ab und zu mit ihnen. Außerdem fuhren wir alle mit demselben Bus zu Schule, wenn schlechtes Wetter war. Ich konnte sie alle gut leiden, war aber nicht so eng mit ihnen befreundet, wie mit Lena. Meine Freundinnen hatten alle zusammengeschmissen und einen Gutschein vom großen Elektronikmarkt in der Stadt besorgt: Sie wussten, dass ich mit einem Tablet liebäugelte. Sollte ich mich doch für das Fahrrad entscheiden, könnte ich den Gutschein ja in CDs oder DVDs umsetzen.
Es wurde noch ein richtig netter Vormittag – alle langten noch ordentlich bei Joschis Torte zu, der das natürlich mit Stolz bemerkte. Gegen Mittag brachen meine Freundinnen nach Hause auf und pünktlich um drei Uhr läutete es dann wieder an der Tür und Großvater Friedrich stand mit einem Blumenstrauß in der Hand davor. Er überreichte ihn mir mit einer kleinen Verbeugung – ganz Kavalier der alten Schule- und drückte mich dann an sich. „Herzlichen Glückwunsch, liebliche Enkeltochter“ wünschte er mir genauso verschmitzt-förmlich, wie ich ihn Großvater Friedrich nannte. Er hatte mir ein Fotoalbum zum Geschenk gemacht, in dem er selbstgeschossene Fotos von mir seit meiner Geburt bis heute eingeklebt hatte. Darüber freute ich mich riesig, denn Großvater machte nie gestellte Fotos, sondern zog auf einmal die Kamera in irgendwelchen Situationen und drückte auf den Auslöser, bevor man es überhaupt bemerkte. So entstanden echte Schnappschüsse, auf denen ich mich sogar selbst manchmal leiden mochte, was sonst bei Fotos fast nie der Fall war.
Ich bat ihn an den Tisch und Regina, Joschi und Kurt setzten sich zu uns. Wir plauderten eine Weile, aber nachdem auch er sich mit Torte und Kaffee gestärkt hatte, wandte er sich mit einem winzigen Zwinkern, das nur ich sehen konnte, an mich: „Du wolltest mir doch noch ein Buch zeigen, das dich so begeistert hatte. Du sagtest, es wäre so außergewöhnlich illustriert!“ Es dauerte einen Augenblick bis ich begriff, dass er nach einem Vorwand suchte, mit mir allein verschwinden zu können, aber dann stieg ich darauf ein: „Ach ja, natürlich. Komm mit, ich muss es eben in meinem Zimmer suchen, dann zeig ich`s dir.“ Es hatte funktioniert – keiner der anderen schien Verdacht zu schöpfen.
Großvater Friedrich setzte sich in meinen knarzenden Schaukelstuhl in der Ecke und ich ließ mich im Schneidersitz auf meinem Bett nieder und wartete gespannt auf das, was er mir erzählen wollte. Großvater sah sich in meinem Zimmer um, als würde er zum ersten Mal so richtig registrieren, wie es dort aussah. Dann durchbrach er das Schweigen: „Jetzt bist du volljährig. Und wie ich dir schon angedroht habe, möchte ich dir eine Geschichte erzählen. Ich habe damit lange gewartet, weil ich denke, dass es nicht ganz einfach sein wird, damit umzugehen und ich es dir nicht zu früh zumuten wollte. Du solltest eine unbeschwerte Kindheit und Jugend haben und dich nicht zu früh mit solchen Dingen herumplagen. Wobei das bei dir vermutlich sowieso nicht funktioniert hat: Du bist irgendwie schon immer ein ernstes Kind gewesen und hast dir über viele Dinge Gedanken gemacht, die anderen erst am Ende ihres Lebens kommen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum du – von deiner Großmutter einmal abgesehen - die erste bist, der ich diese Geschichte anvertraue. Bei dir ist sie gut aufgehoben, denke ich. Du wirst das Richtige tun. Aber genug der Vorrede, jetzt erzähle ich dir, was mir einst geschehen ist.“
Nach dieser Eröffnung spürte ich wieder einen Schauder meinen Rücken hinunterlaufen und bekam eine Gänsehaut, während Friedrich zu erzählen begann.
FRIEDRICHS GESCHICHTE ODER ZURÜCK ZU IHR
Im Jahr 1944, der Krieg tobte nun auch in Deutschland, bekam ich meinen Einberufungsbefehl als Soldat. In wenigen Wochen sollte ich in den Krieg ziehen. Zum damaligen Zeitpunkt war ich siebzehn Jahre alt und wir wohnten auf dem Lande nahe Berlin. Meine Mutter bat mich, eine Fotografie von mir anfertigen zu lassen, bevor ich in den Krieg zöge, damit sie eine Erinnerung an mich hätte, während ich nicht bei ihr wäre.
Ich fuhr nach Berlin und suchte einen Fotografen auf. Als ich den Laden betrat, stand hinter dem Tresen das schönste Mädchen, das ich je gesehen hatte. Sie sah so sanft und freundlich aus. Und das war sie auch, wie ich schnell bemerkte. Sie hieß Martha, war die Tochter des Fotografen, dem das Geschäft gehörte und arbeitete dort selbst als Fotografin. Sie merkte, dass ich schüchtern war, weil ich vom Land kam und noch nie vorher fotografiert worden war. Aber sie behandelte mich so liebenswürdig, dass meine Scheu schnell verflog. Auch als das Foto bereits geschossen war, konnte ich das Geschäft nicht einfach verlassen, sondern unterhielt mich noch so lange mit ihr, wie der Anstand der damaligen Zeit es zuließ. Mir fiel auf, dass auf dem Tresen ein Strauß Blumen stand. Dies erschien mir als ein Ausdruck ihres Wesens: Obwohl draußen Tod und Zerstörung herrschten, holte sie sich etwas Schönes und Lebendiges in ihren Alltag. Es zeugte von ihrem Optimismus und Lebenswillen. Bereits an diesem ersten Tag verliebte ich mich in sie.
Von jetzt an pflückte ich ihr alle paar Tage Blumen, wo ich gerade welche fand - in unserem Garten oder auf den Wiesen und Feldern- und fuhr mit dem Fahrrad nach Berlin hinein, um sie ihr zu bringen. Nach einigen Wochen gingen wir zum ersten Mal miteinander spazieren, nachdem das Geschäft geschlossen hatte. Das taten wir in der folgenden Zeit immer öfter, dann wir wurden ein Paar. Martha stammte ursprünglich ebenfalls vom Land. Sie war mit ihrer Familie erst vor ein paar Jahren nach Berlin gezogen. Ihre Kindheit war geprägt von allerlei Geschichten und Märchen, die man sich am Abend erzählte – es gab ja noch lange kein Fernsehen. Für sie waren sie alle wahr und im Grunde genommen war sie ein abergläubischer und naiver Mensch geblieben. Sie hatte sich dadurch etwas liebenswert Kindliches bewahrt. Das sollte mich retten, wie sich herausstellte.
Der Tag meiner Einberufung rückte näher und so verlobten wir uns, bevor ich in den Krieg ziehen musste. Wir schworen uns, zu heiraten, wenn der Krieg zu Ende wäre und wir ihn überleben sollten.
Im Januar 1945 wurde ich während eines Feuergefechts mit russischen Soldaten verletzt: Ich erlitt einen Kopfschuss. Eine Gewehrkugel traf mein rechtes Auge und zerstörte es, zertrümmerte meine Nase, streifte meinen Mund und trat dann wieder aus. Ich wurde in ein Feldlazarett gebracht und die Ärzte und Schwestern dort taten ihr Möglichstes, um mein Leben zu retten. Aber ihre Mittel waren begrenzt und meine Verwundung zu schwer. Ich starb. Jedenfalls hörte ich von ganz weit weg, wie ein Arzt meinen Tod feststellte.
In mir selbst war ein Gefühl völliger Ruhe, von Frieden und Gelassenheit. Vor meinem inneren Auge sah ich ein helles, freundliches Licht und hörte sanfte, wunderschöne Klänge, wie sie noch nie zuvor an mein Ohr gedrungen waren. Es stand für mich völlig außer Zweifel, dass das der Tod wäre und dass ich keine Angst vor ihm zu haben bräuchte. Im Gegenteil – es würde friedlich sein dort, aller Schmerz würde vergessen sein. Ich bräuchte nur ein paar Schritte auf dieses Licht zuzugehen, es schien so einfach.
Aber etwas drang in mein Bewusstsein, etwas, das mich davon abhielt: Ich sah Marthas sanftes Gesicht vor mir und unser gegenseitiges Versprechen klang ganz deutlich in meinem Geist nach. Von da an wehrte ich mich mit aller Kraft gegen den Tod, obwohl er so verlockend wirkte. Ich versuchte mit aller Macht, mich von dem Licht zu entfernen, ich kämpfte dagegen an, in seinen Bann gezogen zu werden. Es war schmerzvoll, aber ich wusste genau, was ich wollte. Ich wollte leben, ich wollte zurück zu Martha und mein Versprechen einlösen.
Nach einer Zeit, die mir wie eine Ewigkeit und wie ein kurzer Moment zugleich erschien, war der Kampf, der nur in mir getobt hatte, vorbei. Das Licht und die Klänge waren verschwunden, die Schmerzen versiegt. Ich schlug die Augen auf und erhob mich von der Liege, auf die man mich gelegt hatte. Dann erschrak ich: Ich sah, wie zwei weiß gekleidete Männer kamen und meinen leblosen Körper auf eine Bahre legten. Sie wollten gerade mit ihm davongehen, doch ich schrie und versuchte sie aufzuhalten. Ich sagte ihnen, dass ich noch lebte, dass ich nicht tot sei, aber sie beachteten mich gar nicht, als ob sie mich nicht hörten. Erst als ich versuchte, ihnen hinterher zu rennen, sah ich im Lauf meine eigenen Beine und Füße. Sie sahen verändert aus – als wären sie durchscheinend, nicht vollständig da. Erschrocken blieb ich stehen und betrachtete meinen ganzen Körper. Er sah überall so aus: durchschimmernd wie ein Seidentuch und meine Haut hatte einen bläulichen Farbton, so als wäre ich zu lange in kaltem Wasser geschwommen. Ich berührte mein Gesicht: Es fühlte sich völlig unversehrt an, als wäre ich nie von einer Kugel getroffen worden.
Verzweifelt sah ich mich um und versuchte, auf mich aufmerksam zu machen, aber niemand schien mich wahrzunehmen. Es war, als sähen sie durch mich hindurch. Ich wollte eine vorbeieilende Schwester am Ärmel festhalten, aber sie bemerkte meine Berührung gar nicht, so dass ich durch sie hindurchgriff.
Schließlich rannte ich den Männern hinterher, die meinen Körper davongetragen hatten. Sie waren nach draußen gegangen und legten ihn gerade auf die Ladefläche eines Lastwagens. Es lagen schon viele weitere tote Körper dort. Die Männer liefen wieder hinein. Ich aber ging auf den Laster zu, betrachtete meinen Körper und streckte schließlich die Hand nach ihm aus. Als meine Finger die blasse Haut berührten, fühlte sie sich kalt an. Erschrocken zuckte ich zurück und rannte so schnell ich konnte weg von diesem Ort. Vermutlich bin ich viele Stunden so gerannt, doch ich fühlte keine Ermüdung. Während ich lief, rotierten meine Gedanken: Wenn das, was ich berührt hatte, mein toter Körper war, was war dann ich? Warum sah ich selbst so verändert aus? Warum konnte ich sehen, hören und fühlen, aber niemand sah oder hörte mich? War ich tot, war ich lebendig?
Als ich kurz vor Berlin war, kam ich in einen Wald, in dem ich die Nacht verbrachte. Es wurde die längste Nacht meines Lebens. Ich war nahe davor, den Verstand zu verlieren. Neben all den Fragen, die mich und meinen Körper betrafen, fragte ich mich, was ich jetzt tun sollte. Wo sollte ich hin? Und doch wusste ich am Morgen die Antwort, denn nur zu einem Menschen wollte ich. Ich musste wissen, ob sie mich ebenso ignorieren würde, wie alle anderen Menschen, denen ich bisher begegnet war. Am frühen Morgen suchte ich das Haus ihrer Eltern auf, bei denen sie noch lebte. Ich versuchte die Türklingel zu betätigen, aber der Knopf ließ sich nicht hineindrücken und als ich anklopfen wollte, ertönte kein Geräusch. Immer verzweifelter und immer stärker ließ ich meine Fäuste auf die Tür niederprallen, bis sie mit einem Mal durch die Tür hindurchtraten. Zuerst dachte ich, ich hätte ein Loch in die Tür geschlagen, doch als ich genauer hinsah, war die Tür völlig unversehrt und es sah aus, als steckten mein Arme in der Tür: die Hände und Unterarme auf der Innenseite, die Oberarme an der Außenseite. Ich bewegte meinen Körper nun immer näher an die Tür heran und stellte fest, dass ich mit sehr viel Kraft und Druck dazu in der Lage war, meinen Körper durch die Tür hindurch zu bewegen. Es war, als würde ich mich durch einen engen Spalt hindurch quetschen wollen. Es dauerte eine ganze Weile, aber am Ende stand ich im Flur des Hauses von Marthas Eltern. Ich ging zielstrebig die Treppe hinauf zu Marthas Zimmer. Auch dort versuchte ich der Höflichkeit halber noch einmal anzuklopfen, jedoch wieder ohne Erfolg. Also versuchte ich, auch durch diese Tür hindurchzugehen und es funktionierte auf die gleiche Weise wie an der Haustür. Es war sogar etwas einfacher, vermutlich weil die Tür dünner war. Mir blieb keine Zeit, mir darüber Gedanken zu machen, warum es mir möglich war, durch verschlossene Türen zu gehen. Denn als ich in Marthas Zimmer stand, sah ich, dass sie gerade aufgewacht war und sich im Bett aufgesetzt hatte. Sie sah mit großen und etwas furchtsamen Augen in meine Richtung. Sollte sie mich etwa sehen können? Ich ging langsam und vorsichtig einen Schritt auf sie zu, um sie nicht zu erschrecken, aber ich sah, wie sie ein wenig zurückwich. Also blieb ich stehen und sprach mit ruhiger Stimme: „Martha, ich bin es – Friedrich. Du brauchst keine Angst zu haben.“
Sofort wich der ängstliche Ausdruck aus ihrem Gesicht und ein Lächeln breitete sich darauf aus. „Du bist zu mir zurück gekommen“, antwortete sie schlicht. Ich setzte mich auf ihre Bettkannte und erzählte ihr alles, was ich am gestrigen Tag erlebt hatte – von meiner Verwundung, meinem Tod und wie ich zurück zu ihr gekommen war; dass mich anscheinend niemand außer ihr sehen und hören konnte. Sie erzählte mir, dass sie in ihrer Kindheit viele Geschichten gehört hätte, in denen Totgeglaubte zu ihren Angehörigen zurückkehrten und dass sie sich darum gar nicht so sehr darüber wundere. Sie habe schon immer gewusst, dass es so etwas gäbe und sei einfach froh, dass ich wieder da sei.
Viele Stunden blieb ich noch bei ihr und nach gewissen Geschehnissen in dieser Nacht sah ich am nächsten Morgen wieder aus, wie vor der Verwandlung, vor meinem Tod im Lazarett. Die Verletzung hatte ihre Spuren in meinem Gesicht hinterlassen, aber zumindest spürte ich keine Schmerzen mehr. „Friedrich, du bist wieder ganz bei mir“, fasste Martha es in Worte. „Aber du bist verletzt“, fügte sie dann entsetzt hinzu. „Dein Gesicht…“, sie konnte den Satz nicht vollenden. „Mich traf eine Gewehrkugel. Findest du mich jetzt abstoßend?“, fragte ich beklommen. „Du bist mein Friedrich und wirst es immer sein. Hauptsache, du lebst!“, war alles, was sie dazu sagte. Und bis heute habe ich die Verletzung als Preis für die Rückkehr in mein normales Leben gerne gezahlt.
Wir unterhielten uns noch viele Jahre und Jahrzehnte, bis zu Marthas Tod, immer wieder über die Ereignisse dieser zwei Tage. Gerade jetzt in diesem Moment, wo ich dir diese Geschichte erzähle, bemerke ich, wie unglaublich und irreal sie sich anhört. Immer wieder brauchte ich das Gespräch mit ihr, um mich zu vergewissern, dass ich es nicht nur geträumt hatte, dass sie es auch gesehen hatte. Hätte es sie nicht gegeben, hätte ich vielleicht den Verstand darüber verloren. Nun ist sie vor ein paar Jahren gegangen und sie ist ganz gegangen. Das war etwas, was wir beide uns nach vielen Gesprächen gegenseitig versprochen hatten: Es zuzulassen, zu gehen, wenn unsere Zeit gekommen wäre. Nicht dagegen anzukämpfen, wie ich es mit achtzehn Jahren getan hatte. So schwer es mir fiel zu akzeptieren, dass sie nicht mehr da ist, so schwer es mir noch immer fällt – sie fehlt mir jeden Tag, jede Minute und jede Sekunde- so sehr weiß ich doch, dass es richtig so ist, dass es der natürliche Lauf der Dinge ist. Zu wenig wissen wir auch jetzt, nach so vielen Jahren, was damals wirklich mit mir geschehen ist und ich hatte einfach unendliches Glück, einen Menschen wie Martha zu kennen. Das Wagnis der möglicherweise immerwährenden Verwandlung sollte keiner von uns noch einmal eingehen, das hatten wir uns geschworen. Und Martha hat sich an ihren Eid gehalten. Dafür bin ich ihr dankbar, auch wenn ich nun ohne sie mein Leben zu Ende leben muss.
Seit sie nicht mehr bei mir ist, suche ich vermehrt die Gesellschaft der Verlassenen. So verrückt es klingt: Sie zu sehen, gibt mir die Gewissheit, dass ich nicht geisteskrank bin, dass es nicht nur ein Hirngespinst von mir ist, sondern dass ich einst einer von ihnen war, wenn auch nur für sehr kurze Zeit.
FRAGEN ÜBER FRAGEN
Während Friedrich erzählte, hatte ich vollkommen erstarrt dagesessen und keinen Laut von mir gegeben. Wie gebannt hatte ich seinem Bericht gefolgt. Nachdem er geendet hatte, sprach eine lange Zeit keiner von uns ein Wort. Großvaters Gesichtsausdruck wirkte abwesend und ich glaube er war mit seinen Gedanken in einer anderen Zeit und an einem anderen Ort. Mir aber schwirrte der Kopf. Ich glaubte, nicht mehr klar denken zu können. Noch nie in meinem Leben hatte ich so eine verstörende und unfassbare Geschichte gehört und ich spielte in Gedanken verschiedene Möglichkeiten durch:
Variante Nummer eins: Großvater wollte mich auf den Arm nehmen. Er hielt es aus irgendeinem Grund für eine lustige Idee, mir so eine ungeheuerliche Geschichte aufzutischen, um dann irgendwann „reingefallen“ zu rufen, wenn ich sie tatsächlich glaubte. Mir kam ein Bild von seinem riesigen Bücherregal in den Kopf, das eine ganze Wand seines Arbeitszimmers einnahm. In diesem Regal gab es meterweise Bücher mit fantastischen Romanen und Grusel- oder gar Horrorgeschichten. Er mochte diese Art der Literatur und ihm fehlte es vermutlich also nicht an Anregung für das eben Erzählte. Auch fielen mir die unzähligen Geschichten ein, die er Kurt und mir erzählt hatte, als wir noch Kinder waren. Er brauchte keine Märchenbücher zum Vorlesen, sondern dachte sich Geschichten über Trolle, Zwerge und Riesen für uns aus. Und diese heutige Geschichte war nur ein weiteres Produkt seiner überschäumenden Fantasie. Ja, so musste es sein: Es war so eine Art verspäteter Aprilscherz zu meinem Geburtstag. Diese Variante war zwar in meinen Augen geschmacklos, aber vergleichsweise harmlos.
Variante Nummer zwei: Großvater war tatsächlich verrückt geworden. Er glaubte, was er da erzählte, aber es war nie passiert. Er war paranoid, schizophren oder auf sonst irgendeine Weise durchgeknallt. Diese Variante war eindeutig schlimmer als die erste, aber ich musste sie in Betracht ziehen.
Variante Nummer drei: Alles, was er mir gerade erzählt hatte, entsprach der Wahrheit. Ich wusste nicht, was ich von dieser Variante halten sollte. War sie die schlimmste oder die harmloseste von allen?
Während meiner Grübelei hatte ich vor mich auf die Bettdecke gestarrt, doch als ich nun aufsah, bemerkte ich erst, wie Großvater mich beobachtete. Er sah mich durchdringend an und versuchte offensichtlich, in meinem Gesicht zu lesen, was ich dachte. Nach einer Weile sagte er ganz ruhig: „Ich weiß, dass es sich unglaublich anhört. Und ich kann mir vorstellen, was jetzt in dir vorgeht und dass du vermutlich an meiner Zurechnungsfähigkeit zweifelst. Aber ich schwöre dir: Es ist so geschehen, wie ich es dir gerade erzählt habe.“ Er sah so ernst und beinahe verzweifelt bemüht darum aus, mich von der Wahrheit zu überzeugen, dass ich Variante eins schon mal streichen konnte. Aber wie sah es um Nummer zwei bestellt aus? Noch niemals zuvor hatte Friedrich mir Anlass gegeben, mich an seiner psychischen Gesundheit zweifeln zu lassen und auch jetzt wirkte er nicht so, wie Verrückte in Filmen immer wirken. Er ereiferte sich nicht, rollte nicht wild mit den Augen und kicherte auch nicht wahnsinnig vor sich hin. Alles an ihm schien sehr ernsthaft und überlegt. Widerstrebend begann ich mir selbst einzugestehen, dass alles auf Variante Nummer drei hinauslief. Aber was sollte das bedeuten? Jede Menge Fragen machten sich gleichzeitig in meinem Kopf breit, so dass ich gar nicht wusste, wo ich anfangen sollte.
Das erste, was ich mit brüchiger Stimme herausbrachte war: „Willst du mir ernsthaft weismachen, dass du mit achtzehn Jahren für zwei Tage lang so eine Art … Geist














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














