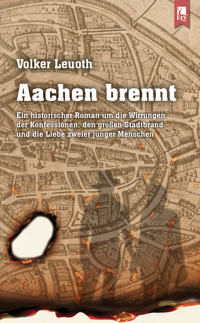8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eifeler Literaturverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts gehört Burtscheid noch nicht zu Aachen und ist ein Zentrum der sich wandelnden Textilindustrie. Es ist die Zeit des Übergangs vom traditionellen Handwerk zur maschinellen Herstellung und Industrialisierung in der Tuchmanufaktur. Die siebzehnjährige Katharina wächst in einer wohlhabenden Burtscheider Tuchfabrikantenfamilie auf und gerät in die Auseinandersetzungen rebellierender Tuchscherer, die bedingungslos um ihren Status kämpfen. Gegenüber den liberalen Gedanken der Arbeiter zeigt sie Sympathien. Mehr und mehr fühlt sie sich von dem selbstbewussten Aufrührer Hein angezogen. Schließlich kommt es zur Katastrophe, die das Leben der jungen Frau grundlegend verändert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Volker Leuoth
Blaues Tuch
Ein Historischer Roman
aus der Zeit der Tuchherstellung
in Burtscheid bei Aachen – um 1820
Volker LeuothBlaues Tuch
Ein historischer Roman aus BurtscheidEifeler Literaturverlag 2024
Impressum
1. Auflage 2024
© Eifeler Literaturverlag
In der Verlagsgruppe Mainz
Alle Rechte vorbehalten
Printed in Germany
Eifeler Literaturverlag
Verlagsgruppe Mainz
Süsterfeldstraße 83
52072 Aachen
www.eifeler-literaturverlag.de
Gestaltung, Druck und Vertrieb:
Druck & Verlagshaus Mainz
Süsterfeldstraße 83
52072 Aachen
www.verlag-mainz.de
Abbildungsnachweis (Umschlag):
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:Burtscheid_Stich_Kurgarten_1822.jpg
Print:
ISBN-10: 3-96123-020-X
ISBN-13: 978-3-96123-102-7E-Book:
ISBN-10: 3-96123-129-X
ISBN-13: 978-3-96123-129-4
Prolog
»Mama, Mama, Post für dich. Guck mal, was das für ein Stempel ist. Von der Stadt habe ich noch nie was gehört.«
Der Junge glättete das zerknitterte Päckchen und buchstabierte nun mit Hilfe des Zeigefingers: »P – i – t – t – s – burg – h. Wo liegt das?«, fragte er aufgeregt seine Mutter.
»Ich glaube in Amerika.«
»Schau, Mama, dein Name steht drauf, aber nicht, von wem der Brief kommt.«
Nichts ahnend nahm seine Mutter das Päckchen an sich und legte es zunächst auf den Stapel für Schreiben an das Unternehmen und beachtete es nicht weiter. Zu viel Post kam täglich ins Haus.
Als dann am Abend ein wenig Ruhe eingekehrt und alle notwendigen Absprachen für den nächsten Tag erledigt waren, erinnerte sie sich an die geheimnisvolle Sendung und las die Anschrift.
»Brammertz heiße ich ja nun schon länger nicht mehr«, murmelte sie und nahm das Päckchen zum Öffnen in die Hand.
Als sie einen Zettel entnahm und auffaltete, durchfuhr sie ein Schreck, der ihr wie ein Stich ins Herz ging und sie heftig zittern ließ.
Auf dem Papier stand in ungelenker Schrift zu lesen:
Nach mehr wie 15 Jar meld ich mich aus Amerika. Ich schik dir Geld aus der Prosche und wegen einer anderen Sach. Ich brauchte damals das Geld musste ja abhaun. Mir hat das alles keine ruh gelassen … – deswegen jetz der Brif. Jetz hab ich einen kleinen Laden wo ich Stoffe verkauf und ein Kind.
Mir gets gut. Hofentlich dir auch.
Verzei mir.
Verwirrt legte sie den Zettel auf den Tisch, nahm einen Stapel Geldscheine aus der Tüte und betrachtete ihn wie einen Störenfried, der plötzlich in ihr Leben eingedrungen war und an längst Vergessenes erinnern sollte.
Aufgewühlt lehnte sie den Kopf an die Rückenlehne ihres Sessels und schloss die Augen.
1.
»Herzlich willkommen!« Damit begrüßten Hausdiener die ankommenden Gäste der Unternehmerfamilie Brammertz in Burtscheid.
Etliche Kutschen waren nacheinander vor das prächtige Gebäude gefahren. Es war in Form eines Ehrenhofes mit einem Querbau und zwei Flügelgebäuden angelegt. Der hohe, schwarz gestrichene Gitterzaun, versehen mit einem eindrucksvollen Eingang aus Schmiedeeisen, sollte diese Welt von jener der einfachen Leute trennen.
Dort hatte die Familie ihren herrschaftlichen Wohnbereich, dessen prachtvolles Portal zwei blühende Rosenstämme einrahmten. In einem Flügel befanden sich das Bureau des Unternehmers und das Kontor.
Neben dem Gebäude erhob sich die Fabrikhalle mit einem riesigen Tor und großen, düsteren Fenstern, die wie die Augen eines Ungeheuers auf die zahlreichen Arbeiter schauten, die Tag für Tag ihrer schweren Tätigkeit nachgingen.
Die weiblichen Hausangestellten halfen den Damen mit ihren ausladenden Röcken, sich durch die schmale Kutschentür zu zwängen.
Eine der Bediensteten, die junge Elisabeth, hatte die besondere Aufgabe, die mächtigen ballonförmigen Ärmel der Damen so aus der Kutsche herausgleiten zu lassen, dass sie keinen Schaden nehmen konnten.
Das junge Mädchen betrachtete neidvoll die unter dem Kinn gebundenen Schutenhüte. So was würde sie sich nie leisten können. Aber das Hantier mit dem hinten hochgebundenen und vorn abgeflachten Rock würde sie nicht jeden Tag haben wollen, beschloss sie und lächelte höflich, als sie der Gattin des Bürgermeisters aus dem Wagen half. Zu gern wäre sie allerdings das ewige Einerlei ihrer Kleidung mit dem Häubchen, der langen Schürze und den groben Schuhen losgeworden. Wie sollte sie so an einen Mann kommen? ›Söhne von denen da‹, damit meinte sie die Gäste in den anrollenden Kutschen, gezogen von herausgeputzten Pferden und dem Kutscher in einer Livree auf dem Bock, ›die schauen unsereins nur an, weil sie sich hinter der Schürze den Busen vorstellen oder dir beim Vorbeigehen einen heimlichen Klaps auf den Hintern geben.‹
Die älteren Männer in ihren grauenvollen schwarzen Gehröcken und Zylindern auf dem Kopf sind nicht besser – nur väterlicher. Da bliebe sie lieber bei Peter, der als Knecht seinen festen Lohn bekam und wusste, wie man ein Mädchen glücklich machen kann. Aber reichte das für die Ehe?
Während ihre Gedanken abschweiften, wäre Elisabeth beinahe einer der Damen an der Austrittstufe der Kutsche auf den Rocksaum getreten. Erschrocken mahnte sie sich selbst zur Achtsamkeit und verschwand zunächst wieder im Dienstboteneingang.
Jeder Gast wurde zum Speisesaal geleitet. An der breiten Tür angekommen, fiel der Blick zunächst auf farbige Tapeten mit Schäferszenen, die den Betrachter in die unberührte Natur versetzen sollten. Einige goldgerahmte Gemälde zeigten Ahnen der Familie in üppiger Kleidung, umgeben von Beigaben aus wertvollem Glas, Hirschgeweihen und seltenen Pflanzen. Sie schienen das Geschehen im Saal und an der Festtafel überwachen zu wollen.
Kenner unter den Gästen betrachteten interessiert die Vitrine aus kostbaren Intarsien mit uraltem Porzellan. Der aus verschiedenen Hölzern bestehende braune Fußboden bildete einen wirkungsvollen Gegensatz zur weißen Stuckdecke.
In der Mitte des Saales stand die wuchtige, festlich gedeckte Tafel.
Henriette Brammertz begrüßte an der weit geöffneten Tür herzlich lächelnd Verwandte und gute Bekannte. Honorationen von Burtscheid und aus Aachen hieß sie höflich distanziert willkommen. Ihre nach wie vor jugendliche Figur wurde durch die eng geschürzte Taille betont. Auf die mächtigen Ärmel der derzeitigen Mode hatte die Hausherrin verzichtet. Jeder durfte ihre vornehm blassen Arme bewundern. Es war ja auch Sommer. Sollen die alten Schachteln doch neidisch werden, dachte sie und fühlte sich ausgesprochen wohl in ihrer Haut, als sie die Gattin eines ortsansässigen Unternehmers begrüßte.
Neben ihr stand die 17jährige Katharina, das nunmehr einzige Kind der Gastgeber, nachdem vor Jahren der Erstgeborene an Typhus gestorben war. Ihr hochgestecktes blondes Haar wurde durch einen kostbaren Kamm geschmückt. Sie trug ein Kleid aus feinem blauen Tuch, das am Hals von einer Brosche gehalten wurde. Das reich verzierte, überaus wertvolle Schmuckstück war ein Geschenk ihrer verstorbenen Großmutter. »Es ist französischer Stil«, hatte jene gemeint, als sie Katharina die Brosche an das Kleid geheftet hatte.
Des Öfteren hatte Katharina vor dem Geburtstagsfest das Erbstück aus der Schatulle genommen und ausgiebig vor dem Spiegel betrachtet. In der Mitte befand sich ein Saphir, umrahmt von strahlenförmig angeordneten hellen Edelsteinen, eingefasst in Weißgold.
Wenn Katharina die Brosche in der Hand hielt, empfand sie große Dankbarkeit, so reich beschenkt worden zu sein – und es gefiel ihr, sie zu besonderen Anlässen zu tragen.
Die eintreffenden Gäste waren von Kathi – wie sie in der Familie genannt wurde – angetan. Besonders die Herren. Henriette nahm es mit sichtlichem Stolz zur Kenntnis, war ihre Tochter doch im heiratsfähigen Alter. Wie sie allerdings bemerkte, befand sich unter den jüngeren Gästen kein Kandidat, der zu ihr gepasst hätte.
Kathi begrüßte die älteren Herrschaften mit einem angedeuteten Knicks und wechselte mit dem einen oder anderen ein paar belanglose Worte.
»Nun Katharina, wirst du uns wieder was Schönes vorspielen? Ich bin schon gespannt.«
»Ja, Herr Pfarrer. Für Sie habe ich mein Lieblingsstück rausgesucht.«
»Ich freue mich drauf«, meinte er, lächelte ihr zu und verschwand im Speisesaal.
Henriette legte die Hand auf die Schulter ihrer Tochter.
»Du verstehst es, Männer zum Lächeln zu bringen«, flüsterte sie ihr zu und schaute sie dabei liebevoll an.
»Mal sehen, ob es auch bei unserem Verwalter klappt«, meinte Kathi in aufgekratzter Stimmung, als sie Friedrich Radermann die Treppe heraufkommen sah. Er war mittleren Alters, groß gewachsen und von hagerer Gestalt. Der leicht gekrümmte Rücken zeugte von der jahrelangen schweren Arbeit eines Tuchmachers und der späteren Verantwortung als Verwalter. Es gelang ihm, in dem sicherlich selten getragenen schwarzen Anzug und mit der seidenen Halsbinde einen guten Eindruck zu hinterlassen.
Die beiden unterhielten sich trotz des großen Altersunterschiedes sonst immer gern über Gott und die Welt. Diesmal aber war er förmlich und begrüßte die Damen ohne eine Miene zu verziehen.
Mutter und Tochter waren über das seltsame Verhalten verwundert. »Ob er Kummer hat?«, meinte Katharina und beließ es dabei.
Leonhard Brammertz, ein schwergewichtiger Mann von großer Statur, lief von einem zum anderen Gast und genoss die Ehrungen und Glückwünsche zu seinem 50. Geburtstag. Mancher Freund wünschte ihm mit verschmitztem Lächeln und unterdrückter Stimme vielsagend ein weiteres Jahr irdischer Freuden! War er doch bekannt dafür, es mit der ehelichen Treue nicht so genau zu nehmen.
Die Honorationen dagegen leierten pflichtgemäß ihre Glück- und Segenswünsche herunter.
Wie es Brauch war, erhob sich zunächst der Geistliche. Augenblicklich wurde es still an der Tafel. Jeder spürte, dass er es gewohnt war, bei vielen Festen in Burtscheid Ehrengast zu sein, wovon sein Bauchumfang erzählte. Im kurzen Gebet dankte er zunächst dem Himmel für den reich gedeckten Tisch und erst danach folgten Segenswünsche für das Geburtstagskind und die Bitte um Gesundheit und Wohlergehen der Gastgeberfamilie.
Inzwischen hatten sich die Bediensteten zurückgezogen, um einen der nächsten Gänge mit Wildfleisch und Fisch, dazu Pasteten nach französischem Rezept, vorzubereiten.
Immer wieder klirrten mehrfach die Gläser unter den zarten Schlägen derjenigen, die den Jubilar ehren wollten und ihn mit ernsthaften oder spaßigen Beiträgen bedachten.
Offensichtlich befanden sich Sangesbrüder unter den Gästen, die dem ernsten Segen des Pfarrers etwas Heiteres entgegensetzen wollten, als der Apotheker wie verabredet anstimmte: »Er lebe hoch …, er lebe hoch ...!« Sofort stimmten die Gäste ein. Die hellen Sopranstimmen der Damen bildeten zusammen mit den geübten Tenören und Bässen einen wunderbaren Klang zum Wohl des Gastgebers. »Er lebe hoch …, dreimal hoch!«, und jeder griff zum Glas und prostete in die Runde.
Noch während der vielen Lobenshymnen um die Verdienste des Hausherrn in den vergangenen Jahren setzte allmählich leichte Schläfrigkeit ein. Die beginnende Verdauung verlangte nach Entspannung!
In der Pause vor dem mit Ungeduld erwarteten Dessert gab Henriette ihrer Tochter ein Zeichen. Dabei stellte sie für alle gut hörbar die musikalischen Fortschritte ihrer Tochter am neuen Hammerklavier heraus. Dies missfiel Katharina gehörig. Sie murmelte vor sich hin: »Ich bin doch kein Zirkusäffchen, das man vorführt.«
Mit bösem Blick auf ihre Mutter stand sie auf und strich ihr Kleid glatt. Als sie das Instrument erreicht hatte, wartete sie, bis alle Gespräche verstummt waren und kündigte mit leiser Stimme an, eine Sonatine von Diabelli spielen zu wollen.
Gespannte Ruhe war eingetreten. Kaum hatte sie die ersten Takte – mit Wut im Bauch über die Äußerungen ihrer Mutter – etwas zu forsch gespielt, kam Unruhe auf.
Der Hausknecht war ohne anzuklopfen in den Festraum gestürmt. Nach wenigen Schritten erreichte er den Hausherrn. Noch ehe Brammertz begriff, was sich ereignet hatte, packte Henriette den Knecht am Kittel. »Wilhelm, was soll das!?«, zischte sie ihn an. »Ich bitte um Verzeihung«, flüsterte er. »Junge Tuchmacher, darunter Scherer und Färber von uns, sind mit den wartenden Kutschern in Streit geraten. Es hat eine Prügelei gegeben. Ein Gespann konnte vom Kutscher nicht mehr gehalten werden und ist durchgegangen, nachdem sich der Mann mit der Peitsche verteidigen musste.«
Katharina war die Unruhe nicht verborgen geblieben. Sie verspielte sich und ließ schließlich die Hände sinken.
Unheilvolle Stille hatte sich breitgemacht. Fragende Gesichter. Wortfetzen wurden flüsternd weitergegeben.
Inzwischen hatte sich der Hausherr etwas gesammelt. Seine Serviette flog über den Tisch. »Radermann, mitkommen!«, bellte er laut über die Festtafel hinweg und drängte am Hausknecht vorbei, der sich als Überbringer der schlechten Nachricht in seiner Haut nicht wohl zu fühlen schien.
Einige der Herren hatten sich aus Sorge um ihre Kutsche dem Hausherrn und seinem Verwalter angeschlossen. Schon waren das Wiehern der Pferde und laute Männerstimmen zu hören.
»Aus welchem Grund wird hier Unfrieden gestiftet?«, donnerte Brammertz den Kutscher an, der ihm am nächsten stand und eines seiner Pferde am Halfter festhielt, um es zu beruhigen.
»Mit Verlaub«, antwortete der Mann, »ich musste mich mit der Peitsche gegen zwei junge Kerle wehren. Erst hatten sie mir mit unflätigen Worten zu verstehen gegeben, dass ich den reichen Tuchfabrikanten die Füße lecken würde, weil ich eine Livree trage und auf dem Bock sitze. Dabei bin ich froh, Arbeit zu haben. Dann griffen sie mich an und wollten mich runterzerren.
»Kennst du die Übeltäter von irgendwoher? Und wo ist die Kutsche geblieben, deren Pferde angeblich durchgegangen sind?«
»Mit großer Mühe hat Otto ein schweres Unglück verhindert.« Dabei zeigte der Kutscher die abschüssige Straße hinunter.
»Erst weit entfernt kam das Gespann zum Stehen, und Otto hat sich erst wieder hierher getraut, nachdem die Schläger verschwunden waren.«
Zum Glück waren keine Personen, keine Pferde und auch keine Kutsche zu Schaden gekommen. Brammertz konnte daher die neugierig nachdrängenden Gäste beruhigen und sie bitten, wieder an die Festtafel zurückzukehren.
Zusammen mit seinem Verwalter blieb er noch draußen, denn er wollte unbedingt wissen, wer der oder die Übeltäter wären und wollte seine Wut über das gestörte Festessen loswerden.
Er hatte eine Vermutung und wandte sich an Radermann: »Es handelt sich nicht um einen Dumme-Jungen-Streich, sondern um einen Angriff auf mich und meine Gäste. Wir müssen noch mehr herausfinden!«
Damit sprach er nochmals den Kutscher an und musste sich dabei zwingen, diesem nicht seinen Unmut zu zeigen. »Also nochmal: Sind dir die Burschen bekannt?« In diesem Moment übernahm Radermann die weitere Befragung und ergänzte: »War der eine von kräftiger Statur, wirre blonde Haare, kräftiges Kinn, stechend blaue Augen?«
»Ich glaube, er heißt Hein«, antwortete der Kutscher, »denn als der andere von mir abließ, weil sich die Pferde im Geschirr aufbäumten, hatte er ihm zugerufen: ›Hein, komm jetzt, wir müssen weg!‹«
»Volltreffer! Das muss er sein!«, meinte Brammertz erregt. Von seinem Angestellten kannte er bisher nur den Vornamen. Er brachte ihn einerseits mit massivem Fehlverhalten, andererseits mit guten Arbeitsergebnissen in Verbindung.
Dankbar lächelnd wandte sich Brammertz dem Kutscher zu und ging mit seinem Verwalter zum Haus zurück. »Wir sollten das Urteil des hiesigen Gerichts beachten. Wir Unternehmer müssen jegliche Unruhe unterbinden!«
Er dachte einen Moment nach. »Was meinen Sie, wollen wir ihn rauswerfen und wegen Aufruhrs bei der preußischen Polizei anzeigen? Oder noch einmal ein Auge zudrücken?«
»… weil wir ihn brauchen!?«, vollendete Radermann seinen Satz.
»Ja, aber wie lange?«, erwiderte Brammertz. »Noch brauchen wir seine Muskelkraft und seine Erfahrung im Umgang mit den Werkzeugen und Arbeitsabläufen.«
»Und genau hier beginnt das Problem«, fuhr der Verwalter fort, während beide den Speisesaal betraten. »Er beherrscht die riesige Schere wie kaum ein anderer und ist dazu ein erfahrener Färber für unser feines Tuch – unser blaues Tuch.«
»Aus weichem Burtscheider Wasser«, ergänzte Brammertz und lächelte trotz des ernsthaften Themas.
»Daher kommt sein übersteigertes Selbstbewusstsein und die Neigung, Konflikte mit Gewalt auszutragen. Weil er keine Ruhe gab, war ihm ja bereits in Vaals gekündigt worden.«
Nach einer kurzen Pause wollte Brammertz wissen: »Wie ist nochmal der Name seiner Familie?«
»Kessel.«
Radermann spürte die Bedeutung dieses Gesprächs, denn aus persönlichen Gründen war er sehr daran interessiert, dass die Situation zugunsten des Burschen ausging.
»Offensichtlich ist er gegen alle Neuerungen. Er hat die Vorstellung, dass alle Änderungen den Heimarbeitern die Lebensgrundlage nehmen würden«, meinte Brammertz. »Und ich denke, er verlangt noch mehr: den Umsturz der bestehenden Ordnung!«
»Aber nicht den Sturz der Obrigkeit«, schwächte Radermann ab, »obwohl er durch die Region zieht und seine aufrührerischen Gedanken mit Sachbeschädigungen ausdrücken möchte.«
Der Verwalter seufzte hörbar. »Es ist leider so, dass Rebellische in Monschau neuartige mechanische Webstühle und Schermaschinen in den nächsten Bach geschmissen haben. Und sie wollen erzwingen, dass der Einbau von Dampfkesseln und Dampfmaschinen verhindert wird. Nach deren Auffassung werden die Heimarbeiter durch die neuartigen Maschinen gezwungen, nun aus ihren Dörfern heraus als abhängige Lohnarbeiter bei Wind und Wetter weite Wege zur Tuchfabrik auf sich zu nehmen und danach stundenlang stumpfsinnige Arbeit dort an den Maschinen zu verrichten. Zugegeben, Hein Kessel ist verwahrlost, und es war ein Fehler, ihn bei uns einzustellen. Ich sah in ihm einen tüchtigen, gut ausgebildeten Scherer. Den Rauswurf hatte er uns ja verschwiegen. Man bedenke aber: Seine Mutter ist früh gestorben, der Vater, selber herzkrank, und Hein, als Ältester der Geschwister, mussten für alles sorgen. Keine leichte Aufgabe«, murmelte er, aber doch so laut, dass es Brammertz mitbekam. »Außerdem möchte ich noch vermerken, dass die jungen Leute – wie dieser Kessel – in das neue Gedankengut unserer Zeit hineinwachsen.«
Radermann war erstaunt über sich selbst, wie er plötzlich Stellung für die Jugend einnahm. Oder steckte auch in ihm der Wunsch nach Veränderung, um vielleicht auf der gesellschaftlichen Leiter ein paar Sprossen nach oben zu klettern? Oder war etwas ganz anderes dahinter? Angst?
»Erst französisch«, fuhr Radermann fort, »nun sind wir preußisch. Daher fühle ich mit den jungen Leuten, wie den Hein Kessel, wenn ihnen die Arbeitsbedingungen nicht behagen.«
Brammertz schaute seinen Verwalter verdutzt an und schmunzelte: »Sie reden wie ein Gelehrter.« Unbeeindruckt sprach Radermann weiter: »Mir ging es wie den jungen Leuten heute. Eine neue Welt hatte sich während der Franzosenzeit aufgetan. Liberté, egalité, fraternité. Die altvorderen Zünfte in Aachen und sonst wo hatten nichts mehr zu sagen. Es herrschte Gewerbefreiheit, und die Engländer konnten sich wegen der Kontinentalsperre ihre Waren an den Hut stecken.«
»Und wie stand es um die Tuchmacherei?«, wollte der Unternehmer wissen, der etwas jünger als sein Verwalter war und erst spät durch den Vater in die Geheimnisse der Tuchmacherei eingeführt worden war, da es ihn mehr zur Schifffahrt in den Norden gezogen hatte.
»Mit der Wirtschaft war es mächtig bergauf gegangen«, fuhr Radermann fort und unterstrich seine Worte gestenreich. »Unsere Tuche wurden sogar bis nach Russland geliefert. Wir bemühten uns sehr, die Konkurrenz durch Qualität beim Weben, Walken und Scheren abzuhängen und in den Farben besonders wählerisch zu sein – wie das blaue Kleid von Mademoiselle Katharina zeigt.
Gemocht haben wir ihn ja nicht, den Emporkömmling aus Frankreich, aber er war wichtig für uns«, machte Radermann weiter und merkte während seines Redeflusses nicht, dass der Hausherr mehr und mehr auf seinen Platz an der Tafel zusteuerte. »Anders als sonst wo in Deutschland, auch bei Ihnen im Norden, galt hier, dass ein Metermaß exakt ein Meter war, in Liège, Montjoie oder in Aix-la-Chapelle, wie sie unsere Nachbarstädte alle nannten. Die Gewichte waren gleich und wurden streng kontrolliert. So konnte man nicht so schnell übers Ohr gehauen werden. Und mit dem einheitlichen Geld wurde der Handel auch leichter. Selbst der Segen von oben war da. In Aachen gab es nämlich von Napoleons Gnaden plötzlich einen Bischof!«
»Aber Aachen war besetzt!«, schnitt ihm Brammertz das Wort ab, während er sich an seinen Ehrenplatz setzte. »Wir sollten nach dem Essen im Herrenzimmer weiterreden und es uns erst mal gut gehen lassen. Das Dessert wartet«, meinte er lächelnd.
Nach all der Aufregung war Radermann der Appetit vergangen. Er wunderte sich, wie leichtfüßig diejenigen mit den Problemen von Reichen und Armen umgehen, die auf der richtigen Seite des Tisches sitzen. So wie er sich heute der Ehre bewusst war, mit an der Tafel Platz nehmen zu dürfen und Köstlichkeiten vorgesetzt zu bekommen. Trotzdem fühlte er sich unwohl und hätte allzu gern den Herrschaften die Maske vom Gesicht gerissen und ihnen entgegen geschrien, was es bedeutete, arm wie Kirchenmäuse zu sein, ohne Aussicht auf Veränderung. Das Vermögen der Fabrikanten jedoch vermehrt sich ständig, und er, der Verwalter, half dabei mit, schämte er sich!
Radermann hatte sich, ausgestattet mit dem Spürsinn für das Unten und Oben in der Gesellschaft und für Privilegien, die seine Familie nie erreichen würde, vom einfachen Tuchmacher zum Verwalter hochgearbeitet. Er wusste, dass er dort bleiben würde, wohinein er geboren worden war. Trotzdem hatte es ihm einen leichten Stich ins Herz versetzt, als er Katharinas Musizieren zuhörte. Etwas, das er seiner Tochter Irmgard niemals ermöglichen könnte.
Vielleicht sollte es so sein, tröstete er sich, denn auch diese Familien tragen Sorgen und Probleme mit sich herum – möglicherweise sogar größere!
Nachdem Radermann ein wenig von der feinen Crème probiert hatte, legte er den Löffel beiseite und blickte über die Gäste hinweg in den herrschaftlichen Park. Seine Augen schienen in dem satten Grün der Bäume Halt zu suchen.
Lautes Beifallklatschen brachte ihn aus seiner Gedankenwelt wieder in die Wirklichkeit zurück. Ein Gast hatte mit der letzten Laudatio den Gastgeber geehrt. Auch Radermann spendete Beifall und machte sich lustlos über das weitere Dessert her, das von allen Seiten als besonders köstlich gepriesen worden war: Eis mit heißen Erdbeeren und Sahne.
Radermann spürte einen leichten Schrecken, als er Katharinas Stimme hörte. Sie hatte sich auf den freien Platz neben ihn gesetzt. Beide mochten einander. Als sie noch klein war, hatten sie oft Späße gemacht. Wenn er auf dem Weg zum Kontor im elterlichen Gebäude war und sie sich zufällig begegneten, hatten sie sich hinter einer Säule versteckt oder sind mit steifen Beinen wie Soldaten über den langen Flur stolziert, wobei sich beide vor Lachen schütteln mussten.
Nachdem sie zu einer jungen Dame herangewachsen war, scherzte er kaum noch mit ihr. Nach seiner Vorstellung schickte es sich nicht, mit der fast erwachsenen Tochter seines Vorgesetzten herumzualbern. Was sie allerdings anders sah.