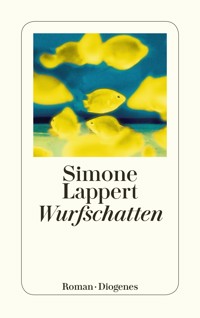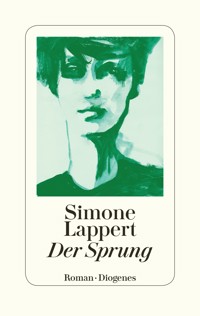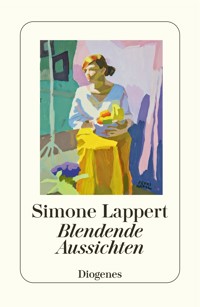
4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Neben einer Liebeserklärung an das Zugfahren und Passfotoautomaten, der Frage nach dem Stellenwert von Kunst und Kultur in unserer Gesellschaft und der Bedeutsamkeit von Zufällen, widmet sich Simone Lappert in kurzen Texten den Besonderheiten unseres Alltags und Zusammenlebens. Humorvoll, kritisch und klug observiert sie in ›Blendende Aussichten‹ die kleinen und großen Dinge, stellt Fragen, die nachhallen und regt zum Nachdenken an. Der perfekte Wegbegleiter für alle Simone-Lappert-Fans und die, die es noch werden wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 47
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Simone Lappert
Blendende Aussichten
Diogenes
Nur der Dachs und ich
Ich gebe zu, ich bin in gewissen Belangen eine hoffnungslose Nostalgikerin. Ein Smartphone habe ich mir erst 2016 widerwillig angeschafft, vor meinem Schreibstipendium in New York. Auf Instagram bin ich auf Anraten meines Verlages, vorerst auf Probe und fürs Buch, idealerweise nicht mehr als zehn Minuten am Tag. Aber eben. Sie kennen das ja. Diese Smartphones sind Zeitsauger, wo man sie hinhält, lösen sich Minuten in nichts auf. Oder es entsteht Aufmerksamkeitschaos. Ich jedenfalls gehöre zu den Menschen, die nicht einmal gleichzeitig eine Karotte schneiden und einen Witz erzählen können.
Neulich habe ich das Handy zu Hause vergessen. Es zu holen war keine Option, dafür war meine To-do-Liste zu voll. Zuerst war ich besorgt, dass dies ein überaus chaotischer Tag werden würde. Nach ein paar Stunden stellte ich fest, dass ich seit Langem nicht mehr so fokussiert gearbeitet, gegessen, gelesen hatte. Ich beschloss, das Handy nun öfter zu Hause zu »vergessen«.
Tage später musste ich beim Packen der Umzugskisten wieder an das Phänomen Smartphone denken. Mir fiel eine Postkarte mit einem Gedicht von Hilde Domin in die Hände, es trägt den Titel »Es gibt dich« und war als Jugendliche eines meiner liebsten. »Dein Ort ist / wo Augen dich ansehen / (…)«, heißt es dort, »Es gibt dich / weil Augen dich wollen, / dich ansehen und sagen / dass es dich gibt.« Ich musste darüber nachdenken, dass man diese Worte heute, im Zeitalter von Internet und Social Media, auch weniger tröstlich lesen kann als damals, als ich zum Telefonieren noch mit dem Festnetz in die Waschküche ging und das Kabel gerade so reichte, wenn ich mich auf den Boden legte. Irgendwie, dachte ich, hat sich dieser »Ort« – zumindest vermeintlich – für viele von uns ins Internet verlagert, ins kühle Glimmen hinter dem Display. Früher fanden Gespräche am Telefon unter zwei Ohren statt. Heute teilen wir Bilder und Videos und richten uns gleich an Hunderte, Tausende, je nachdem sogar an Millionen Augen. Und ab einer gewissen Menge »Follower:innen« oder »Freund:innen« schaut garantiert gerade irgendwo irgendjemand auf meine Story oder mein Profil, um mir zu bestätigen, dass ich aufmerksamkeitswürdig bin, dass ich gesehen werde, dass es mich gibt.
Als ich am Abend nach dem handylosen Tag den Weg zur Wohnung hinaufging, auf dem ich sonst immer Sprachnachrichten abhöre und Mails lese, hörte ich es hinter der Hecke sehr laut rascheln. Ein Mensch, dachte ich zuerst, dann: eine Wildsau, mindestens. Ich blieb stehen, wartete. Das Rascheln kam näher, ein schwarzweißer Kopf schob sich unter der Hecke hindurch, und plötzlich stand mir ein Dachs gegenüber. Er schaute mich eine Weile an und machte sich dann gemächlich in Richtung Nachbargarten davon. Einen wildlebenden Dachs hatte ich noch nie gesehen. Und ich war überzeugt, dass mir sein Rascheln entgangen wäre, wenn ich meine Mailbox abgehört hätte.
»Mein Ort« ist eben auch da, wo ich einem Dachs in die Augen schauen kann, im Hier und Jetzt. Okay, ich habe hinterher meinen Freund angerufen, um ihm von dem Dachs zu erzählen. Aber das hätte ich auch mit dem Festnetztelefon getan. Ein Wort, das Word mir übrigens als falsch unterstreicht.
Auf der Suche nach der verborgenen Zeit
Kennen Sie das: diese Lieder, die einem das Herz und den Kopf aufmachen wie ein Fenster und davor ganze Landschaften ausbreiten? Neulich saß ich bei einer Freundin, wir aßen Erdbeeren und unterhielten uns. Im Hintergrund lief eine Playlist, die immer mal wieder so ein Lied abspielte und uns ablenkte, weshalb wir irgendwann auf dieses Phänomen zu sprechen kamen, gegen das man sich nicht wehren kann. »Ein bisschen so, wie Prousts Erzähler sich nicht gegen den Geschmack von Madeleines wehren kann«, fand die Freundin, »nur anders.«
Ich begann darüber nachzudenken, welche Songs für mich ein bisschen wie Madeleines sind und warum.
Mit wenigen Ausnahmen sind es solche, die für ein Lebensgefühl stehen, für eine Suche nach Welt und Weite, nach etwas, das die Gegenwart zu verbergen oder im Voranschreiten zu verschlucken scheint. Es sind Lieder, die mich innerlich sofort in Bewegung setzen, akustische Fortbewegungsmittel. Manche dieser Lieder begleiten mich schon seit der Kindheit, sie haben jede Beziehung und jeden Umzug mitgemacht, ohne sich abzunutzen. Für andere ist es nicht besonders spaßig, mit mir solche Lieder zu hören, weil ich andauernd dabei sprechen muss.
»Jetzt!«, sage ich. »Hörst du das, Achtung, gleich kommt es, da, das, genau das meine ich, ist das nicht phänomenal?!« Und so weiter.
»Shine On You Crazy Diamond« von Pink Floyd ist so ein Stück. Ein Freund meines Vaters hat es mir auf Schallplatte vorgespielt, als ich vielleicht zwölf war. Auch wenn mein Kopf den Song damals nicht begriffen hat, so hat mein Bauch das sehr wohl; ich saß in dem Polstersessel vor der Musikanlage wie im Rumpf eines Flugzeugs, das abhebt. Andere Flugzeuge hießen »Bohemian Rhapsody« von Queen oder »Romeo and Juliet« von den Dire Straits. In Dauerschleife habe ich diese Songs mit einer Freundin auf meiner ersten Interrail-Reise gehört. Es war Hochsommer, und wir lagen in einer Jugendherberge in La Spezia bei gefühlten vierzig Grad, an Schlaf war nicht zu denken, es gab nicht mal einen Ventilator.
Um uns abzukühlen, haben wir unsere Laken in der Etagendusche mit kaltem Wasser durchtränkt und uns darin eingewickelt. Außenrum die Musik. Tom Waits hat mich ganze Schreibmonate lang durch die Straßen von Paris und New York begleitet, Bob Dylan sowieso überallhin: »Don’t Think Twice, It’s Alright«. Mit vielleicht vierzehn habe ich zum ersten Mal »Der Tod und das Mädchen« gehört, das Streichquartett von Schubert, dessen »Andante con moto«