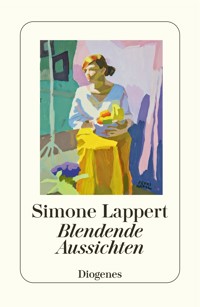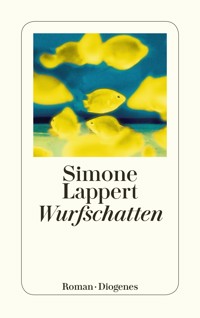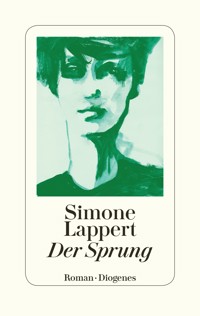
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine junge Frau steht auf einem Dach und weigert sich herunterzukommen. Was geht in ihr vor? Will sie springen? Die Polizei riegelt das Gebäude ab, Schaulustige johlen, zücken ihre Handys. Der Freund der Frau, ihre Schwester, ein Polizist und sieben andere Menschen, die nah oder entfernt mit ihr zu tun haben, geraten aus dem Tritt. Sie fallen aus den Routinen ihres Alltags, verlieren den Halt – oder stürzen sich in eine nicht mehr für möglich gehaltene Freiheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 367
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Simone Lappert
Der Sprung
Roman
Diogenes
Für meine Schwester und meinen Bruder
Ein Körper verharrt in Ruhe oder im Zustand der gleichförmig geradlinigen Bewegung, wenn keine äußeren Kräfte auf ihn wirken.
Isaac Newton, 1. Gravitationsgesetz, das Trägheitsprinzip
Maybe I’m crazy
Maybe you’re crazy
Maybe we’re crazy
Possibly
Gnarls Barkley
Bevor sie springt, spürt sie das kühle Metall der Dachkante unter den Füßen. Eigentlich springt sie nicht, sie macht einen Schritt ins Leere, setzt den Fuß in die Luft und lässt sich fallen, mit offenen Augen lässt sie sich fallen, will alles sehen auf dem Weg nach unten, alles sehen und hören und fühlen und riechen, denn sie wird nur einmal so fallen, und sie will, dass es sich lohnt; und nun fällt sie, fällt schnell, Adrenalin flutet ihre Kapillaren mit Hitze, als würden ihre Glieder vor Scham erröten, aber sie schämt sich nicht, sie fällt, fällt mit dem Gesicht nach unten, und alles dreht sich, während sie fällt, alles weitet sich in ihr, ihre Poren weiten sich und ihre Zellen, ihre Adern, ihre Gefäße, alles öffnet sich, schreit, sperrt sich auf, bevor es sich wieder zusammenzieht, ihr ganzer Körper eine Faust jetzt, die sich nach unten boxt und die Umgebung mitreißt, die Fassaden nur noch Striche auf den trockenen Pupillen, und Luft schneidet ihre Netzhaut, seziert ihr das Sichtfeld, etwas blendet und brennt in den Augen und im Mund, die Stadt dreht sich, dreht sich um sie herum, der Boden dreht sich ihr entgegen, kein anderes Geräusch jetzt als die Luft, in der sie sich dreht, die schneidende Luft, durch die sie fällt, die ihr die Kleidung gegen die Knochen schlägt, die ihr gegen den Brustkorb drückt und alles ganz nah jetzt, der Asphalt, die Fenster, die Köpfe, grün, blau, weiß, und wieder blau, und all die Haare im trockenen Mund, und das Herz steckt ihr groß in der Luftröhre fest, und sie rotiert jetzt im Fallen, rotiert auf den Rücken, ob sie will oder nicht.
Der Tag davor
Felix
Felix zerbiss einen Eiswürfel und seufzte, noch neunzehn Minuten bis zum zweiten Teil seiner Schicht. Es war einer dieser ersten warmen Maitage im Jahr, die nach Sommer rochen, an denen alle versuchten, sich ein wenig um ihre Pflichten zu drücken, im Kaufhaus Kühltruhen mit Eis am Stiel neben die Kassen gestellt wurden und sich am Abend um die Stadtbrunnen herum Pfützen bildeten, weil Kinder hineingestiegen waren, um zu baden. Männer und Frauen mit noch winterbleichen Beinen machten Besorgungen, radelten oder schlenderten vorbei, Kinder trugen in ihren Rucksäcken die Hausaufgaben nach Hause, die sie heute würden ausfallen lassen. Felix’ Glas war längst leer. Hin und wieder nippte er am Schmelzwasser, das sich am Glasboden sammelte, oder zerkaute einen der Eiswürfel, die noch leicht nach Tomatensaft schmeckten. Er mochte das Gefühl, wenn die Härte des Eiswürfels den Mahlbewegungen der Zähne nachgab und der Wärme im Mund, sich in einen winzigen Schluck Wasser auflöste, kalt genug, um jeden Gedanken auf der Stelle einzufrieren. Roswitha hatte komplett rausgestuhlt, das Wetter würde also stabil bleiben heute, in dieser Hinsicht war auf Roswitha Verlass. Durch einen Riss im Stoff der Markise brannte die Sonne aufs weiße Papiertischtuch, ein Fleck, der ihn blendete. Er hatte es so eilig gehabt, aus dem Revier zu kommen, dass er seine Sonnenbrille im Spind vergessen hatte. Felix nahm die letzten drei Zahnstocher aus dem dunkelblauen Plastikbehälter und stülpte ihn umgekehrt über den Fleck wie über ein ungebetenes Insekt. Er seufzte noch einmal. Zeit, die Rechnung zu bestellen.
Roswitha saß mit geschlossenen Augen auf einem der Korbstühle, die Beine an den Körper gezogen, den Kopf an die Hauswand gelehnt. In der linken Hand hielt sie eine elektronische Zigarette, an der sie alle paar Sekunden zog, um dann in einer großen Wolke aus Dampf zu verschwinden, die zu ihm herüberwehte und angeblich nach Tabak, Leder und Heu roch, Edition Wilder Westen. Roswitha verschränkte die dünnen Arme vor der Brust, der Erdbeeranhänger, den sie um den Hals trug, verschwand in der Falte ihres viel zu braunen Dekolletés.
Felix räusperte sich, aber Roswitha reagierte nicht. Jeder wusste, dass sie sich nicht beim Rauchen stören ließ, doch seit sie von Gauloises Blau auf dieses Elektroding umgestellt hatte, blieben die Pausen zwischen den einzelnen Glimmstengeln aus.
»Ich weiß, ich weiß«, sagte Roswitha, ohne die Augen zu öffnen. »Die Rechnung, nicht wahr? Gib mir noch zwei Minuten. Lass uns zwei Minuten an was Schönes denken.«
Was Schönes. Das sagte sich so leicht. Als ob es das geben würde, etwas, das einfach nur schön war. Zum Beispiel diese Ruhe heute. Sosehr er sie hier auf der Terrasse genoss, sosehr wusste er um das Trügerische, das in ihr lag. Es gab keine ruhigen Tage. Nicht einmal hier in Thalbach. Ruhige Tage waren eine Werbeerfindung von Einrichtungszeitschriften, Bierbrauereien, Kaffeeherstellern und Reiseanbietern. Irgendeine Tragödie ereignete sich immer. Bis jetzt war es bei einem Unfall ohne Verletzte im Kreisverkehr am Stadtausgang geblieben, einem Ladendiebstahl im Kaufhaus am Marktplatz und drei bekifften Schulschwänzern hinter dem Schwimmbad. Bis jetzt. Felix beobachtete Roswitha, wie sie den Kopf noch ein wenig mehr nach hinten neigte und genüsslich den Heudampf auspustete. Woran sie wohl dachte? An Palmen? Einen Bergsee, einen Birkenwald oder ein flauschiges Kleintier? Auf ihn hatte solcher Kalenderkitsch keine Wirkung. Pyramiden fand er einigermaßen schön. Und Eiswürfel. Die glatte Oberfläche von unbenutzten Seifen. Und natürlich seine Freundin Monique, ihren langen Hals und diese kurzen Schläfenhärchen, die nicht weiterwuchsen und sich bei Regen kräuselten. Aber Pyramiden gab es hier in der Altstadt keine, seine Eiswürfel waren fast weggeschmolzen, die Seife in der kleinen Cafétoilette war mit Sicherheit nicht unbenutzt, und Monique hielt er seltsam auf Distanz in letzter Zeit, ohne recht sagen zu können, warum. Manchmal stellte er sich vor, wie es wäre, wenn sie das Kind verlieren würde, einfach so. Manchmal träumte er es. Dass sie vor ihm stand, mit vom Weinen geschwollenen Augen und einem winzigen Sarg in der Hand, der kaum größer war als die Box mit den Dominosteinen in der Küchentischschublade. Wenn sie sich daran machte, den Sargdeckel aufzuschieben, wachte er auf, schwer atmend und verschwitzt. Felix sah zu, wie der Blendfleck sich langsam auf ihn zubewegte. Schnell rückte er den Zahnstocherbehälter nach. Er rümpfte die Nase und sah sich nach etwas Schönem um. Aber alles, was er sah, waren Menschen, die ihm lächerlich vorkamen, die versuchten, nach etwas auszusehen, nach jemandem, den man kannte. Lauter wandelnde Zitate. Dort, bei den Fahrradständern, ein schüchterner Snoop Dog, der eine Familienpackung Klopapier schulterte, als sei es ein Ghettoblaster. Am Parkrand eine zerzauste Marilyn Monroe, die immer wieder die hellen Locken schüttelte und seit zehn Minuten in derselben hohlkreuzigen Pose Selfies machte. Und dann diese anzugtragenden Wolf-of-Wallstreet-Verschnitte, die mit angespannten Kiefermuskeln vorbeihasteten, so gerne nach weltbewegenden Investment-Entscheidungen aussehen wollten, nach Koks und Edelprostituierten, nach Segelyachttörn und Penthouseparty. Und wenn sie dann abends nach Hause kamen, setzten sie sich frustriert auf die Kunstledercouch und kommandierten ihre Frauen herum oder den Hund oder wer immer ihnen sonst in die Quere kam, bevor sie sich mit Bier oder Cognac oder Rotwein im Arbeitszimmer einschlossen und dank Youporn fünf Minuten lang fühlten wie die Könige der Welt. Nein, es kam ihm hier nichts Schönes unter. Das meiste, was andere Menschen schön fanden, war für ihn mit einer schlechten Erinnerung behaftet. Zum Beispiel die Pfingstrosen, drüben im Park. Seine ganze Pause lang hatte er verzückte Menschen beobachtet, die neben dem Busch mit den üppigen weißen Blüten stehen geblieben waren, ihre Nase hineingesteckt oder ein Foto gemacht hatten. Felix aber erinnerten diese Blumen an einen Abend im Sommer 1987. An den ersten Toten, den er in seinem Leben gesehen hatte.
»Ist das nicht herrlich?« Roswitha seufzte, lang und gründlich. »Gar nicht mehr aufstehen möchte man«, sagte sie, »sich einfach der Hitze ergeben, wie etwas, das schmelzen kann, ein Eiswürfel, zum Beispiel.« Sie öffnete ein Auge und sah zu ihm herüber. »Jetzt schau nicht so grimmig. Da traut sich doch keiner mehr her, wenn du so ein Gesicht machst. Unmöglich denkst du an was Schönes. Kein Wunder, wenn die Gäste wegbleiben. Da nützt mir dein gutes Aussehen auch nix. Um euch Polizisten herum fühlt man sich ja ohnehin schon verdächtig, du brauchst gar nicht noch zusätzlichen Ernst verbreiten.«
Sie inhalierte einen letzten Zug Wildwestdampf, dann stand sie auf. Felix schob das leere Glas über den Tisch. Dort, wo es stand, vergrößerte der Glasboden die Noppen im weißen Papiertischtuch. Das hatte Monique ihm auch schon gesagt, dass er grimmig dreinschaute, den Leuten Angst machte. Obwohl das nicht seine Absicht war. Manchmal fragte er sich, was sie wohl denken würde, wenn sie von dem kleinen dünnen Jungen wüsste, der in diesem breitschultrigen Körper verborgen war, einem Körper, den er sich manchmal selbst kaum glaubte, der ihm mit den Jahren irgendwie passiert war und an den er lediglich erinnert wurde, wenn jemand eine Anspielung machte, Frauen sich nach ihm umdrehten oder er sich beim Öffnen des Duschvorhangs im Spiegel sah. Man hielt ihn für einen, der vor nichts Angst hatte, der jeder Herausforderung gewachsen war. Die Uniform tat ihr Übriges, niemand schien in Frage zu stellen, dass er zum Helden taugte.
»Das macht dann drei fünfzig, Sheriff.« Roswitha stand neben ihm und grinste, die Hände in den Hüften.
Felix zahlte und stemmte sich schwerfällig aus dem Korbstuhl. Der Blendfleck war wieder da. Noch einmal verschob er den warm gewordenen Plastikbecher. Ordnung musste sein.
In diesem Haus war er noch nie gewesen. Das Treppenhaus sah frisch geputzt aus, es roch nach Zitrone und Chlor, nach einer sehr gründlichen Reinigung. Doch das hatte nichts zu bedeuten. Durch die saubersten Flure hatte er schon die übelsten Kerle abgeführt, und in den schicken Wohnungen waren einfach nur die Teppiche feiner, unter die der Dreck gekehrt wurde. Schweinereien waren Schweinereien, und Blut war ihm zuwider, ob es nun auf Linoleum oder Marmor vergossen wurde. Auch Treppenhäuser waren ihm zuwider, diese wenigen Sekunden, in denen noch unklar war, worauf er treffen würde. Schlimmer waren nur Lifts, niemals wäre es ihm in den Sinn gekommen, den Lift zu nehmen, nichts gab ihm so sehr das Gefühl, ohnmächtig zu sein, wie in einem sterilen Gehäuse durch die Eingeweide eines Gebäudes zu ruckeln, ohne aus eigenem Körperantrieb voranzukommen. Still war es im Treppenhaus, als wäre nirgendwo jemand zu Hause. Nur Carola, die junge Auszubildende, die ihn heute begleitete, schnaufte ein wenig und schaute auf jedem Zwischenboden sehnsüchtig die Lifttür an, traute sich aber nicht, etwas zu sagen. Als sie den fünften Stock erreicht hatten, hörte Felix ein Kind weinen. »Verdammt«, sagte er und nahm nun zwei Stufen auf einmal.
Carola fiel zurück. »Hast du das gehört?«, rief sie ängstlich.
Er hasste das. Er hasste es, nicht zu wissen, was ihn in der Wohnung erwartete, aus der der Notruf eingegangen war, und am allermeisten hasste er es, wenn ein Kind involviert war.
»Konzentration«, sagte Felix über die Schulter zu Carola, »das ist jetzt das Wichtigste. Konzentrier dich bitte. Atme doppelt so lange aus, wie du einatmest.« Er hatte es gewusst. Der ruhige Vormittag würde sich rächen, ruhige Vormittage hatten sich noch immer gerächt. Die Frau, die ihnen schließlich aufmachte, zitterte, die blaue Wimperntusche hatte Schlieren auf ihren Wangen hinterlassen, sie schlang ihre Arme eng um den Körper, als wollte sie die Ärmel ihrer Strickjacke hinter dem Rücken verknoten. Das Kind war nirgends zu sehen, man hörte es nur schluchzen.
»Im Wohnzimmer«, sagte die Frau und deutete auf die Tür schräg hinten im Flur. »Er ist mit dem Jagdgewehr im Wohnzimmer. Die Tür geht nicht auf, ich hab alles versucht, aber sie geht einfach nicht auf …«
Felix bedeutete Carola, nach dem Kind zu sehen, ging dann zur Wohnzimmertür, rüttelte daran, sagte: »Aufmachen, Polizei«, sagte es zweimal, dreimal, hörte nichts, trat so weit zurück, wie es ging, warf sich mit voller Wucht gegen die Tür, die dabei aus dem Furnierholzrahmen splitterte, stolperte in ein unerwartet helles Zimmer, brauchte geblendet einen Moment, bis er die Sinne wieder beisammen hatte und festen Stand, sah den Mann am Fenster das Gewehr zum Kopf heben, stürzte sich auf ihn, den Lauf des Gewehres im Visier, der wegmusste von diesem Kopf, weg davon, er erwischte ihn seitlich, mit der Handkante nur, es knallte, dröhnte in seinen Ohren, er taumelte, wusste einen Augenblick lang nicht, wen von beiden es getroffen hatte, dann aber sank der Mann zu Boden, mit der rechten Hand noch immer das Gewehr umklammernd, Felix entriss es ihm und schob es mit Wucht unter die Couch, bückte sich hinunter zu dem Mann, der wimmernd am Boden lag, die Beine zur Seite geknickt. Blut lief warm zwischen Felix’ Fingern hindurch auf den grauen Spannteppich. In seinen Ohren wummerte der Schuss. Felix stützte den Kopf des Mannes, dessen wässriger Blick orientierungslos die Decke absuchte.
Irgendwann wusste Felix nicht mehr, wie lange er den Kopf des Mannes schon stützte. Vermutlich wäre dieser längst tot gewesen, hätte Felix nicht den Gewehrlauf zu greifen bekommen. So hatte sich der Mann nur das Ohr abgeschossen. Nur das Ohr. Felix wiederholte die Worte stumm im Kopf. Nur das Ohr. Nur das Ohr. Er kniff die Augen fest zusammen, bis der Kopf des Mannes in seinen Händen verschwamm, das Blau seiner Uniformärmel, seine beiden Kollegen, die plötzlich da gewesen waren, die junge, graugetigerte Katze, die sich unter dem Sofa verkrochen hatte und geduckt neben dem Gewehr saß, die Wohnwand aus Holzimitat und der Couchtisch aus Glas. Ruhig atmen, dachte Felix, das ist mein Job, das hier hat nichts mit mir zu tun, gar nichts. Das hier ist ein Mann, der versucht hat, sich in den Kopf zu schießen. So was passiert. Nur das Ohr. Nur das Ohr. Felix kniff die Augen fester zusammen, blinzelte, so schnell und oft er konnte. Ein Trick, den sein Ausbilder ihm vor fünf Jahren ins Ohr geflüstert hatte während seines ersten Einsatzes bei einem schweren Autounfall. Ihm war flau im Magen und seine Arme schliefen allmählich ein. Entsetzlich heiß war es. Die Abendsonne brannte ihm durchs geschlossene Fenster auf Rücken und Nacken, ein Schweißtropfen löste sich von seiner Stirn, rann über die Wange, tropfte vom Kinn und versickerte im grauen Haar des Mannes, der lautlos die Lippen bewegte. Sein Atem roch nach Kaffee und ungeputzten Zähnen. Unten auf der Straße heulte die Sirene der Sanität, gleich würden sie hier sein und übernehmen, zwei Minuten vielleicht, höchstens drei. Bis dahin musste Felix noch durchhalten. Er wünschte sich, er könnte Ohren und Nase und Nerven genauso zukneifen wie seine Augen. Um nicht das Blut und die abgefeuerte Waffe zu riechen, vermischt mit dem Geruch nach Aftershave, den Hauptkommissar Blasers Uniform verströmte, dem Atem des Mannes und dem Katzenfutter, das in einem Napf auf der Türschwelle zum Flur stand, um nur noch gedämpft die hektischen Schritte durchs Zimmer zu hören und den U2-Song, der im Endlosloop aus der iPhone-Anlage auf dem Schreibtisch dröhnte, it’s a beautiful day, don’t let it get away, it’s a beautiful day, um nicht mehr den Temperaturunterschied zu spüren zwischen dem warmen Blut, das immer noch aus dem Kopf dieses fremden Mannes quoll, und seinen eigenen kalten Händen, vor allem aber, um sich später an möglichst wenig zu erinnern. Felix dachte an Monique, eigentlich hatte er versprochen, um halb acht zu Hause zu sein. Er wollte auf seine Armbanduhr schauen, aber dafür hätte er sein Handgelenk drehen und den Kopf des Mannes bewegen müssen. Felix’ Augen brannten, er entspannte seinen Blick für einen kurzen Moment, schaute rüber zur Wohnwand, wo hinter zwei Glasschiebetüren verstaubte Pokale standen: Karate-Deutschlandmeisterschaft 1993, 94 und 97, ein Rettungsschwimmerabzeichen und eine Bronzemedaille, wie Felix sie von den Skirennen im Urlaub kannte. Unten der Fernseher, an den mit Tesafilm ein unsorgfältig abgerissenes Blatt Papier geklebt war, darauf stand in Großbuchstaben mit blauem Leuchtmarker geschrieben:
ES TUT MIR LEID.
FRANZ
»Das will ich auch hoffen«, murmelte Felix. Durch die offene Wohnzimmertür hörte er die Frau des Angeschossenen schluchzen: »Einfach ausgesperrt hat er mich, als wäre ich eine Fremde, einfach ausgesperrt …« Hinter der Frau stand reglos ein kleiner Junge, höchstens zehn Jahre alt, die Frau streichelte ihm mit der linken Hand mechanisch den Kopf. Im Türrahmen stand Carola mit rotem Gesicht, die Hände zu Fäusten geballt, als hielte sie sich links und rechts an einem Geländer fest, um nicht in den Abgrund zu stürzen, der sich in diesem Zimmer vor ihr auftat. Felix hätte ihr gerne etwas Beruhigendes gesagt, er wusste genau, wie sie sich fühlte, knapp zwanzig Jahre alt und frisch von der Polizeischule, den Kopf voller Fallbeispiele, die mit der Realität nichts zu tun hatten. Aber er konnte ihr die vielen ersten Male nicht ersparen, die ihr noch bevorstanden.
»Kannst du dich bitte um den Kleinen kümmern«, sagte er zu ihr. »Bring ihn doch rüber in die Küche.«
Sie schien froh über diese Aufgabe außerhalb des Raumes. Zwei grellorange Hosenbeine schoben sich vor den Flachbildfernseher und damit in Felix’ Blickfeld, jemand stellte die Musik aus, endlich, jemand berührte Felix am Arm und sagte: »Du kannst loslassen, wir übernehmen.«
Felix ließ den Kopf des Mannes los und stand auf. »Händewaschen wär nicht schlecht«, sagte er, mehr zu sich selbst als zu dem Sanitäter, der ihm gegenüberstand.
»Drüben im Bad«, sagte dieser und zeigte auf eine Tür im Flur, an der ein alter Katzenkalender hing. Felix schaute mit Absicht nicht in den Spiegel. Er griff nach der Seife, die in einer verklebten Untertasse auf dem Waschbeckenrand lag und noch feucht war, ein paar Fusseln klebten daran, Katzenhaare vielleicht. Ob er sich vorher noch die Hände gewaschen hat, dachte Felix, und versuchte, nicht so genau hinzuschauen. Hastig wendete er die Seife in den nassen Händen, wusch weiter, auch als das Wasser längst klar war.
Maren
Maren drehte sich vor dem Spiegel. Seitlich unter den Armen drückten die Bügel des Korsetts ins Fleisch. Sie stützte die Arme in die Hüften, so, wie die Verkäuferin im Dessousgeschäft es ihr gezeigt hatte. Die Wülste unter den Armen wurden etwas kleiner. Zufrieden öffnete Maren das Tiegelchen mit dem Lipgloss. Die Oberfläche der rotglänzenden Paste war noch unversehrt, sie drückte den Finger hinein und tupfte sich etwas davon auf die Lippen, es fühlte sich klebrig an und roch nach diesen Kirschen, die man bei Roswitha manchmal im Cocktail serviert bekam. Hannes war kurz nach acht ins Bett gegangen, weil er neuerdings schon um halb fünf aufstand. Angeblich trug das zu mehr Erfolg und besserer Gesundheit bei. Maren fand, dass die neue Schlafgewohnheit ihn vor allem muffeliger machte.
Hannes ahnte nichts. Sie hatte das alles seit Tagen geplant. Das Korsett. Die hübschen Schuhe aus schwarzem Wildleder, die sie sonst nie trug, weil sie an den Zehen kniffen. Die Netzstrümpfe und darüber der dünne Trenchcoat aus schwarzem Rayon. Im Kühlschrank der vegane Prosecco. Auch das wusste sie inzwischen, dass es veganen und nicht veganen Prosecco gab. Drei Stunden war sie dafür durch die Stadt geirrt. In der Küche standen die Erdbeeren bereit und ein Pudding aus Kokosmilch, ohne Zucker, nur mit Agavendicksaft gesüßt.
Auf Zehenspitzen schlich sie sich ans Bett. Das Nachtlicht aus Quarzstein brannte noch. Die Fensterläden waren geschlossen. Hannes atmete tief und gleichmäßig, die Hände über der muskulösen Brust zusammengefaltet. Das hatte er sich nebst Bizeps ebenfalls mühsam antrainiert: auf dem Rücken zu schlafen. Weil es angeblich besser für den Energiefluss war. Maren rückte ihr Dekolleté zurecht, kniete sich sorgfältig neben ihn, schob die Decke zurück und begann ihn zu küssen, Kuss an Kuss, vom Brustbein abwärts Richtung Lenden. Hannes grummelte, rümpfte die Nase und wischte sich an der Stelle über den Bauch, auf die sie ihn gerade geküsst hatte. Er machte die Augen auf und schaute sie ärgerlich an.
»Um Himmels willen«, sagte er. »Was machst du da?«
»Quality time«, sagte Maren und küsste ihn auf den Bauchnabel.
Hannes setzte sich ruckartig auf. »Aber Hase, doch nicht mit dem Mantel ins Bett, bitte, mit dem Ding warst du gestern noch draußen. Da sind massenhaft Pollen dran, gerade jetzt, in dieser Jahreszeit, davon schwellen mir null Komma nichts die Augen zu.«
»Sicher. Natürlich. Die Pollen.« Maren stand auf, und Hannes faltete die Hände wieder über der Brust zusammen. Mit keinem Blick hatte er ihr Korsett gewürdigt. Oder ihre Strümpfe. Hase nun also. Ein Salatfresser. Ein Kuscheltier, das sich rein makrobiotisch ernährte. Maren setzte sich auf die Bettkante und ließ die Schuhe aufs Parkett plumpsen. Sie konnte sich nicht mehr daran erinnern, wann sie zum letzten Mal mit Hannes geschlafen hatte. So viel wie er trainierte, fiel er abends wie ein Stein ins Bett. Hin und wieder drückte er ihr einen kurzen hartlippigen Kuss auf die Stirn oder die Wange, der ihr eher das Gefühl gab, er wolle sie von sich wegstoßen, als sie liebkosen, ein als Kuss getarnter Schubser. Manchmal, wenn sie sicher war, dass er schlief, masturbierte sie neben ihm im Bett, oder drüben im Badezimmer, auf dem dicken Teppich vor dem Waschbecken, hastig und verschämt, wie früher als Teenager, in ihrem kleinen Zimmer ohne Schlüssel. Vor zwei Monaten noch hatte Hannes sie liebevoll Pralinchen genannt, mittlerweile schien ihm sogar dieser Kosename zu viele Kalorien zu enthalten. Nur seinetwegen stand sie jetzt hier und fühlte sich unförmig und schwabbelig, nur seinetwegen war sie es auch, weil er sie zu diesem naschhaften Leben verführt hatte. Mit seinen Vorträgen über die Wichtigkeit von Genuss ohne Reue, über seine Abscheu vor Salat und Proteinshake-Frauen. Mit Cannelloni und Caramel-Éclairs hatte er sie zu dem gemacht, was sie jetzt war: eine pummelige Damenschneiderin Ende dreißig, die ihre Kundinnen um hervorstehende Hüftknochen beneidete. Seit zwölf Jahren war sie nun mit ihm zusammen, und nie hatte er ihr einen Grund zum Zweifeln gegeben, immer war da dieser Pakt gewesen, das Versprechen, sich auch im hohen Alter noch eine Familienpackung Schokoladeneis vor dem Fernseher zu teilen, eine private Rebellion, sie und er, bewaffnet mit Marshmallows und Marlboro Lights gegen den genussfeindlichen Rest der Welt. Bis zum Tag nach Hannes’ vierzigstem Geburtstag. Er hatte es wie eine gute Nachricht klingen lassen:
»Ich will mein Leben ändern.«
Seither hatte er 25 Kilo abgenommen, gut sah er schon aus, keine Frage, nur sah er eben nicht mehr aus wie Hannes, mit diesen Bauchmuskeln und den sehnigen Armen, dem braungebrannten Teint. Es kam ihr vor, als wäre jeder Kilometer, den er auf dem Hometrainer zurücklegte, ein Kilometer Abstand zwischen ihnen, als wäre er weit weg auf Reisen, selbst wenn er mit ihr am Tisch saß, vor einer Schüssel Haferflocken mit Mandelmilch und Chiasamen, und vorwurfsvolle Blicke auf den Toast warf, den sie mit Marmelade bestrich. Obwohl sie bereits die Butter wegließ. Seit dem Tag nach seinem vierzigsten Geburtstag, an dem er das Nutellaglas auf ihre Seite des Tisches zurückgeschoben hatte, waren sie sich fremd geworden. Mit jedem Gramm Muskelmasse, das er zunahm, beging er ein Gramm Verrat an ihr, mit jedem Gramm Fett, das er verlor, schmolz er sich die gemeinsame Vergangenheit von den Rippen.
Hannes seufzte. »Machst du dann bitte noch das Licht aus? Licht ist eine der stärksten Drogen«, sagte er, ohne die Augen zu öffnen. »Wenn man nicht aufpasst, verstellt es einem die innere Uhr, dann ist der gesunde Schlaf dahin.«
Maren drehte sich zu ihm um. Sie sog die Wangen ein und machte ein Hasengesicht, wie man es für Kinder macht, nur nicht so freundlich, nein, sie schnitt Hannes eine böse Hasenfratze und ging in die Küche. Sie ließ die Kühlschranktür offen, als sie sich im Stehen über den noch warmen Pudding hermachte. Gar nicht so übel, dieses Agavenzeugs. In der Schublade unter dem Backofen, hinter dem verstaubten Waffeleisen, fand sie die Zuckerdose, die sie dort versteckt hatte. Herrlich, die Erdbeeren spitzvoran hineinzutunken, dieses süßsaure Knirschen zwischen den Zähnen. Der Prosecco ließ sich beinahe geräuschlos entkorken. Sie machte sich nicht die Mühe, ein Glas aus dem Schrank zu holen. Sie setzte die Flasche direkt an die Lippen und rülpste ins Halbdunkel der Küche, als ihr die Kohlensäure in die Nase stieg. Sie aktivierte die Dampfabzugshaube über dem Herd und steckte sich eine Zigarette an. Die Herdplatte war noch heiß vom Puddingkochen. Es zischte, als ihr eine Träne vom Kinn aufs Cerankochfeld tropfte.
Egon
Jetzt begann die beste Zeit des Tages. Egon legte den Feldstecher zur Seite und salzte das Schnittlauchbrot mit der kleinen Drehmühle aus Plexiglas, die Roswitha ihm hingestellt hatte. Niemand machte so gute Schnittlauchbrote wie Roswitha. Die Butter gerade dick genug, die Schnittlauchschicht ein wenig dicker, das Brot herb und schwarz, in der Mitte sauber durchgeschnitten, keine Tomaten, keine Karottenröschen, kein Schnickschnack. Er liebte den ersten Bissen in die unversehrte Schnitte. Bis vor einer Stunde hatte er am Vakuumiergerät gestanden und Kutteln eingeschweißt, an seinen Händen hing noch immer der Geruch der Latexhandschuhe, er roch es, wenn er sich die müden Augen rieb. Aber hier bei Roswitha fühlte er sich wohl. Kein Fließband, keine schreienden Tiere, keine Lastwagenmotoren, nur das träge Summen der Deckenventilatoren, ab und zu die alte Drehtür, die sich in Bewegung setzte, wenn Gäste das Lokal betraten oder verließen, und kaum hörbar die Countrymusik aus der kleinen Box an der Theke. Nur wenn sie Klassik auflegte, Brahms oder Tschaikowski, dann drehte Roswitha die Lautstärke auf. Es gab Musik zum Teilen und Musik zum Alleinhören, so sah sie das, und er fand, dass sie recht damit hatte. Er saß am Ecktisch neben dem großen Fenster mit den grünen Samtvorhängen. Von hier aus sah er alles, was er sehen musste. Die Theke zur Linken, hinter der Roswitha stand, die wirbelstürmische Roswitha mit ihrer wilden Hochsteckfrisur, immer ein Hingucker, ob im Kaftan oder im Polkarock, stundenlang hätte er ihr zusehen können, wie sie die Messingkörbchen mit gefärbten Eiern bestückte und die Behälter mit Streuwürze nachfüllte, Besteck in heißes Wasser tauchte und mit dem Geschirrtuch polierte, blind nach Flaschen und Gläsern griff, mit der Hüfte eine Schublade schloss, gleichzeitig mit der einen Hand Kuchen anschnitt und mit der anderen eine Serviette auf den Teller legte, über Jahre hinweg perfektionierte Choreographien. Rechts, wenn er den Kopf ein wenig drehte, sah er das Ladenlokal auf der anderen Seite des Platzes. Ja, hier saß er am liebsten, mit der rechten Gesichtshälfte im fahlen Sonnenlicht, das über den Platz fiel. Manchmal saß er hier mehrere Stunden am Stück, bis es eindunkelte. Auch wenn sein Rücken ihm wieder zu schaffen machte. Zuweilen strahlte der Schmerz bis hinunter in die Waden. Vom vielen Stehen kam das und vom Schulternhochziehen. Von der Abneigung gegen seine Arbeit, wie Roswitha meinte. Irgendwo müsse sich das ja alles zusammenrotten. Aquagymnastik hatte der Arzt ihm empfohlen und ihm die Kurszeiten aufgeschrieben. Aber die Vorstellung, dreimal die Woche von der Schlachterei direkt ins Hallenbad zu fahren und dort halbnackt, umringt von anderen Halbnackten, mit Schwimmhilfen aus Styropor herumzuhantieren, ließ ihm das Stechen im Kreuz und hin und wieder eine Spritze bei seinem kopfschüttelnden Arzt als das kleinere Übel erscheinen. Seiner mentalen Gesundheit jedenfalls wäre dieser Aquazirkus mit Sicherheit abträglich. Er nahm den Feldstecher zur Hand. Zuerst arbeitete er sich an der Wand entlang, an der früher immer die neuen Hüte ausgelegen hatten. Die letzte Sommerkollektion hatte er aus feinstem französischem Filz gefertigt, schlicht und schmalkrempig, ohne Hutbänder, ohne Federn oder Stickereien, ganz ohne Schnickschnack. Es war die edelste Kollektion gewesen, die er je angefertigt hatte, einen Monat, bevor er den Schlüssel hatte abgeben müssen. Jetzt hingen dort Kopfhörer in zwölf verschiedenen Farben, eingerollte Kabel, kleine kastenförmige Geräte, deren Namen Egon nicht kannte. Und über allem prangten in neonpinker Leuchtschrift die Worte: »Handyklinik 8h–24h«. Er schwenkte mit dem Feldstecher auf die andere Seite des Verkaufsraums, die ganze Wand war mit Hüllen für Smartphones bedeckt, Nieten, Glitzer, Tierohren, Plüsch- und Lederimitate, es sah aus, als wären eine Heißleimpistole und ein Bastelladen gleichzeitig explodiert. Schon beim bloßen Anblick dieses Erdölramschs stieg ihm der Plastikgeruch in die Nase, stechend, wie die Luft, die man nach zwei Wochen aus einem Wasserball ablässt. Eine junge Frau lief ins Bild, sie betrat den Laden schluchzend, wischte sich mit dem Sweatshirtärmel die Tränen vom Gesicht und legte ihr Telefon auf den weißen Tresen, über dem das Wort »Notaufnahme« leuchtete. Der Verkäufer dahinter, mit gelbem Hemd und Dutt auf dem Kopf, machte ein mitleidiges Gesicht, nahm das Telefon in die Hand, dem offenbar Schlimmes zugestoßen war, drückte ein paarmal prüfend darauf herum, drehte es, stellte Fragen, bot der Frau ein Taschentuch an, in das diese erschöpft hineinschneuzte. Nachdem der Verkäufer samt Telefon durch die Tür mit der Neonaufschrift »Intensivstation« verschwunden war, begann sie es nervös auf dem Tresen zu zerrupfen.
»Voilà.« Roswitha stellte Egon ein Viertelchen Rosé hin und strich ihm kurz mit der Hand über die Wange. Er mochte es, wenn sie das machte, auch wenn er wusste, dass er nicht der Einzige war, den sie mit solchen Aufmerksamkeiten bedachte.
»Du musst lernen, den alten Krempel loszulassen«, sagte Roswitha. »Und damit meine ich nicht den Feldstecher.«
Egon stellte den Feldstecher ab und schob mit der Fingerkuppe einen Tropfen Kondenswasser von der Karaffe auf die Tischplatte. »Jetzt haben sie sogar den Boden überklebt«, sagte er. »Den Terrazzoboden, Roswitha. Diese Generation Touchscreen macht vor gar nichts halt.«
»Du übertreibst«, sagte Roswitha. »Wenn du dir endlich ein modernes Telefon zulegen würdest, könnte ich dich auf WhatsApp zur Eventgruppe hinzufügen, dann wüsstest du immer, wann hier ein Konzert stattfindet oder wenn ich einen Wiener Kochkurs gebe. Und beim Einkaufen könnte ich dir Bilder von Schuhen schicken und Hüten und dich fragen, was du davon hältst.«
Egon nahm den Feldstecher wieder in die Hand und schüttelte den Kopf. »Ich sag’s dir, in ein paar Jahrzehnten besteht die westliche Zivilisation nur noch aus rachitischen, krummbuckligen Kreaturen mit vergrößerten Daumen und Zeigefingern. Wir können von Glück reden, wenn die bis dahin noch wissen, was ein Konzert ist.«
Roswitha lachte ihr heiseres Lachen und tätschelte im Weggehen seine Schulter. »Vom Schimpfen ist auch schon manch einer bucklig geworden.«
Egon schmunzelte. Den meisten sagte Roswitha, was sie hören wollten. Nur denen, die sie wirklich mochte, sagte sie, was sie dachte.
Der Vorplatz lag bereits in der Dämmerung, als die junge Frau mit dem kaputten Handy das Lokal betrat. Offenbar hatte man ihr helfen können, sie tippte und strich derart geschäftig auf dem Bildschirm herum, dass sie nicht einmal aufschaute, als Roswitha zu ihr an den Tisch trat.
»Latte macchiato, bitte«, sagte die junge Frau.
Roswitha verschränkte die Arme vor der Brust. »Kannst du haben«, sagte sie, »kostet aber 25 Euro.«
Die junge Frau schaute verdutzt von ihrem Handy auf. »Wieso das denn? Schäumt die Kuh die Milch am Tisch, oder was?«
»Nö«, sagte Roswitha, »aber so viel kostet ein Taxi von hier zu Starbucks, wo sie so was machen. Und dann wieder zurück hierher. Das Getränk ist da natürlich schon mitgerechnet.«
Die Frau verdrehte die Augen. »Gibt’s hier wenigstens W-Lan?«
»So weit kommt’s noch«, sagte Roswitha. Sie blieb vor der armen Frau stehen und fixierte sie so lange, bis diese schließlich nach ihrer Handtasche griff und sich davonmachte.
»Hast du nicht neulich erst mit deinem Glasfaser-W-Lan geprahlt«, sagte Egon, nachdem die Frau durch die Drehtür verschwunden war.
»Mein W-Lan ist nichts im Vergleich zu dem Schaum auf meinen Latte macchiatos«, sagte Roswitha. »Aber hallo sagen und in die Augen schauen, das muss drinliegen, sonst schrumpft mein Sortiment schlagartig zusammen.«
Egon lehnte sich zurück und sah Roswitha nach. Was für eine Frau. Irgendwann würde er sie fragen, ob sie mit ihm ausgehen wolle. Irgendwann, wenn ein Wunder passieren und er den Mut dazu aufbringen würde.
Finn
Ihre Anwesenheit beunruhigte ihn. Und wenn er ehrlich mit sich war, dann war es diese Beunruhigung, die er am meisten an ihr mochte. Mehr noch als ihre tiefe Stimme, die Grasflecken auf den Knien oder ihre hellen Brüste, von denen die rechte ein klein wenig größer war als die linke. Wenn er mit ihr unterwegs war, kam es ihm vor, als hätte jede noch so banale Situation einen aufregenden Backstagebereich, zu dem nur sie ihm Zutritt verschaffen konnte. An ihrer Seite war er sich sicher, nichts zu verpassen. Er genoss das trügerische Gefühl, dass alles sich zum Guten veränderte, dass er selbst sich veränderte durch Manu, zu einem Menschen, mit dem er es besser aushielt allein, in eine bessere Version seiner selbst. Es war ein launisches Gefühl, eines, das von Manus Blicken abhängig war. Von ihren Berührungen. Davon, wie lange sie ihn zum Abschied umarmte, ob sie sich beim Schlafen von ihm abwendete oder nicht. Finn beobachtete Manu, wie sie sich an den welken Grünstreifen vor dem Bezirksgebäude heranschlich, das bisschen Erde unter der Dachrinne, am Eingang des Polizeireviers, wo ein großer Blumentopf stand. Flink bewegte sie sich durch die Dunkelheit, fast lautlos, die schwarze Mütze tarnend übers blonde Haar gezogen, in der einen Hand die Harke, in der anderen eine kleine Schaufel. Hinter den hellerleuchteten Fenstern im Erdgeschoss sah Finn zwei Polizisten an ihren Schreibtischen sitzen, einer von ihnen tippte mit zusammengezogenen Augenbrauen einen Text ab, der andere, der ihm gegenübersaß, gähnte ungewöhnlich oft in die vorgehaltene Faust und sah seinen Kollegen verstohlen an, vermutlich flimmerte auf seinem Bildschirm etwas, das mit dem Dienst nichts zu tun hatte.
»Psst!« Manu winkte Finn mit der Harke heran. So lautlos und schnell wie sie gelangte er nicht zum Grünstreifen, aber immerhin ohne den Bewegungsmelder am Gebäudeeingang zu aktivieren. Geübt stach Manu die Schaufel in den Topf, rund um die Pflanze, die darin wuchs, ein Zottiges Weidenröschen, wie sie ihm zuvor erklärt hatte. Sie packte die Pflanze, drehte den Topf, damit sie sich löste, schüttelte sie behutsam, bis sie sich samt Wurzeln herausheben ließ. Mit der Harke entfernte Manu die überflüssige Erde.
»Jetzt«, flüsterte sie und deutete auf die Plastiktüte mit dem nassen Tuch in Finns Hand. Finn hielt die Tüte auf. Hastig setzte Manu die Pflanze hinein und schlug das feuchte Tuch um die Wurzeln. Er konnte die Sonnencreme auf Manus Wange riechen, so nah war sie, und er hatte Lust, den Flaum an ihrer Schläfe zu berühren, mit den Fingern ihre großen Ohren entlangzufahren.
»Du knickst die Triebe ab«, flüsterte Manu. »Pass auf, das ist ein echtes Prachtexemplar. Da könnte man sogar die Wurzeln essen.« Eine Wespe zog aufgeregte Kreise über Manus Kopf und versuchte mehrmals, sich auf dem Saum ihrer Mütze niederzulassen. Finn wollte sie verscheuchen. Ein Klicken, blendendes Licht. Sein Gefuchtel hatte den Bewegungsmelder aktiviert. Manu schreckte hoch. »Lauf«, zischte sie und stob mit der Pflanze davon, noch bevor Finn überhaupt begriffen hatte, was passiert war. Er rappelte sich auf und rannte Manu hinterher. »Stehen bleiben«, rief einer der Polizisten, der auf die Straße getreten war. »Sofort stehen bleiben!« Aber Finn und Manu blieben nicht stehen, sie rannten und lachten, rannten die leeren Altstadtgässchen entlang, in denen die heiße Frühsommerluft sich noch immer schwer zwischen den Mauern staute, rannten unter prallen Gewitterwolken hindurch, die Regen versprachen, beide rannten sie auch noch, als es längst nicht mehr nötig war, rannten bis zur Baustelle auf der Wiese am Stadtrand, wo der Wald begann. Manu zwängte sich zwischen den hohen Bauzäunen hindurch, überquerte die verlassene Baustelle, drückte sich auf der anderen Seite wieder durch die Latten und ließ sich mit ausgestreckten Armen auf einen Sandhügel am Waldrand fallen, über den eine grüne Plane gespannt war. Sie keuchte und wischte sich mit der Mütze den Schweiß von der Stirn. Finn legte sich neben sie. »Du bist schnell«, sagte er.
Manu grinste und stellte die Pflanze neben sich ins Gras. »Wieder eine gerettet.«
»Wovor«, fragte Finn.
Manu setzte sich auf. »Na gut, komm mit«, sagte sie, »ich will dir was zeigen.« Sie hob das Zottige Weidenröschen hoch, wickelte sorgfältig das Tuch zurück um die Wurzeln, das sich ein wenig gelöst hatte. Als trüge sie ein kleines Kind, schlang sie ihre Arme um die Pflanze und stapfte vor ihm in den Wald hinein.
Finn aktivierte die Taschenlampe seines Telefons, um besser sehen zu können, wo er hintrat. »Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist«, sagte er. »Ich habe gehört, hier soll es Wildschweine geben, haben die nicht gerade Junge?«
Manu drehte sich ohne anzuhalten zu ihm um, ging ein paar Schritte rückwärts. »Im schlimmsten Fall müssen wir die Nacht auf einem Baum verbringen«, sagte sie und lachte.
Na toll, dachte Finn, spätestens jetzt weiß sie, dass sie es mit einem Angsthasen zu tun hat. Zielsicher ging Manu durchs Dickicht, hielt sich mal mit dem linken, mal mit dem rechten Unterarm die Zweige vom Leib. Er versuchte, es ihr nachzumachen, aber ständig stachen ihn Äste in die Seite oder schnellten ihm ins Gesicht, alle paar Schritte stolperte er über eine Wurzel, und mit der linken Hand hatte er versehentlich in ein Büschel Brennnesseln gefasst. Diese Entschlossenheit. Darum beneidete er Manu. Obwohl ihm klar war, dass er ihr vermutlich nie begegnet wäre, wenn er auch nur halb so mutig wäre wie sie. Dann hätte er sich längst aufgemacht zu seinem großen Satteltaschenabenteuer, würde sein Fahrrad längst über neapolitanischen oder New Yorker Asphalt schieben. Aber Ende Mai, dachte Finn, Ende Mai traue ich mich, und wer weiß, vielleicht kommt Manu ja mit. Er musste daran denken, wie er sie zum ersten Mal gesehen hatte, an einem der letzten warmen Tage im vergangenen Herbst, auf der Verkehrsinsel vor der Tanke am Ortsausgang. Sie hatte zwischen Astern, Zinnien und Anemonen gestanden, Blumen, deren Namen er erst kannte, seit er Manu kannte. Es dunkelte bereits ein, Finns Beine waren schwer von einem langen Tag auf dem Fahrrad. Manu sprang zwischen den Blumen auf und ab, fuchtelte mit den Händen. »Hey, du da, ja du, komm doch bitte mal her!« Er fuhr zu ihr hin, hielt an, sie wartete nicht einmal seine Frage ab, was denn los sei. »Kannst du die mal bitte halten«, sagte sie stattdessen und drückte ihm eine große, orangefarbene Taschenlampe in die Hand. »Dahin leuchten«, sagte sie und zeigte auf den unbepflanzten Fleck in der Mitte der Insel. Finn nahm die Lampe und richtete den Kegel aus. Schweigend setzte Manu die letzten Astern in die vorgegrabenen Vertiefungen. Nicht ein einziges Mal schaute sie dabei zu ihm hoch. Als sie alle Pflänzchen sorgfältig angedrückt hatte, stützte sie die Hände in die Hüften, nickte zufrieden und lächelte ihn an. »So«, sagte sie, »und jetzt hab ich Lust, dir an der Tanke ein Eis zu kaufen.«
Fast wäre er in Manu hineingestolpert, sie war stehen geblieben und streckte die rechte Hand nach den Zweigen einer Linde aus, stellte sich auf die Zehenspitzen, um besser an die Blüten zu kommen.
»Die musst du probieren«, sagte sie, »die schmecken süß und nach Sommer.« Finn nahm eine der Blüten und zwirbelte sie zwischen den Fingern.
»Sie sind früh dran dieses Jahr. Aber sie helfen gegen alles, was weh tut«, sagte Manu und steckte sich gleich zwei in den Mund.
Vorsichtig biss Finn ein kleines Stück Blüte ab. Tatsächlich, es schmeckte süß und saftig, fast ein bisschen nach Honig.
»Da vorne ist es.« Manu zeigte ins Dunkel. »Nur noch ein paar Schritte.«
Finn hob sein Telefon etwas höher und leuchtete zwischen die Bäume. Auch Manu schaltete nun die kleine Taschenlampe an ihrem Schlüsselbund ein. Sie waren auf einer großen Lichtung angekommen, in deren Mitte ein beachtlicher Garten blühte, Klatschmohn, Ringelblumen, Fuchsia und Pfingstrosen konnte Finn erkennen, auch wenn manche der Blüten geschlossen waren, die anderen Pflanzen kannte er nicht. Am Rand wuchsen fünf kleine Obstbäume, Apfel und Pflaume, da war er sich sicher, und Birne und Kirsche vielleicht, womöglich auch Aprikosen, Zitronen oder diese bitteren Schalenfrüchte, die ein wenig wie zu klein geratene Orangen aussahen.
»Da wären wir«, sagte Manu, »mein Topfpflanzenasyl.« Sie zeigte auf einen der Obstbäume: »Das war die Erste«, sagte sie, »ein Pomeranzenbäumchen, das ich von meinem damaligen Schulhof geklaut habe.« Sie ging zu einem aus Dachlatten zusammengezimmerten Unterstand, an dessen Innenwand ein paar Gartenwerkzeuge, eine Schubkarre und eine Gießkanne lehnten. Sie wickelte das Weidenröschen aus dem Tuch und schnappte sich eine Schaufel. »Nimm die da mit«, sagte sie, auf die Schubkarre deutend.
Finn kippte sie von der Wand und folgte Manu in den Garten. »Warum hast du all die Pflanzen hierhergebracht?«, fragte er.
In der Nähe der Pfingstrosen stach Manu die Schaufel in den Boden. »Stell dir vor, man würde dich in eine Isolationszelle sperren, ohne Kontakt zur Außenwelt, ohne Möglichkeit, mit irgendjemandem zu kommunizieren. Wie fändest du das?« Energisch schaufelte sie Erde in die Schubkarre.
»Furchtbar«, sagte Finn. »Wahrscheinlich würde ich das nicht lange überleben.«
»Tja«, sagte Manu und hob das Weidenröschen in die ausgehobene Vertiefung, »genau so geht es den Pflanzen, die man in Töpfe sperrt. Man isoliert sie. Pflanzen sind sensible Wesen, sie können unterirdisch über die Wurzeln miteinander kommunizieren, sie bilden Wurzelgeflechte, mit denen sie sich gegen Unwetter wappnen. Sie bilden eine Gemeinschaft, verstehst du?«
Finn nickte. Er ging mit der Schubkarre neben Manu zurück zum Unterstand. »Ich mag ihn, deinen gestohlenen Garten«, sagte er. »Robin Wood, Vorkämpferin der Entwurzelten, Retterin der Pomeranzen!«
Manu lachte. Sie stellte die Schaufel ab, befestigte die Taschenlampe an einem Haken an der Decke und setzte sich auf einen Sack mit Holzspänen. Der Schweiß klebte ihr die kurzen Haare an der Stirn fest. »Irgendwann«, sagte Manu, »werde ich meine eigene Gärtnerei haben, mit lauter seltenen Pflanzensorten. Wenn ich bis Ende Jahr hart arbeite, kann ich mir vielleicht etwas aufbauen. Endlich ankommen, einen Schrank kaufen und Geschirr, all so was eben. Das wär schön.« Aus der Bauchtasche ihres Sweatshirts zog sie zwei Tomaten, bevor sie es über den Kopf streifte. Im Unterhemd saß sie vor ihm, ein bisschen außer Atem, er sah ihr Herz über der linken Brust klopfen. »Kennst du das«, sagte sie, »wenn man sich einem Ort plötzlich gewachsen fühlt? Wenn die Zimmer aus der Kindheit einem plötzlich gar nicht mehr so groß vorkommen oder man sich selbst darin nicht mehr so klein? Ich meine, ich wollte hier immer nur weg, schon als kleines Mädchen, einfach weg, Hauptsache woandershin. Und jetzt, jetzt habe ich zum ersten Mal das Gefühl, dass ich es hier aushalten kann.« Sie lächelte ihn an. »Und das Gute daran«, fuhr sie fort, »ist, dass es nichts mit dir zu tun hat. Absolut gar nichts.«
Finn schluckte. Was sollte daran gut sein.
»Du darfst das nicht falsch verstehen«, sagte sie, »wirklich, das ist etwas Gutes, glaub mir.« Sie streckte ihm eine Tomate hin. »Wusstest du, dass wir ein Drittel unserer Gene mit Tomaten gemeinsam haben?« Sie nahm die Tomate zwischen Daumen und Zeigefinger. »Das bedeutet, dass wir zu einem Drittel Nachtschattengewächse sind.« Sie schaute Finn an, dann die Tomate, dann wieder Finn. »Ja«, sie grinste, »eine gewisse Ähnlichkeit kann ich erkennen.« Sie biss hinein, ein wenig Saft rann zwischen ihren Brüsten hindurch in den Stoff des Unterhemds. Sie kümmerte sich nicht darum.
Finn setzte sich neben sie, drehte die Tomate zwischen den Fingern, roch daran, um Zeit zu gewinnen. Er mochte Tomaten nicht besonders, jedenfalls nicht, wenn sie roh waren. Aber er mochte Manu, und deshalb biss er schließlich doch hinein. Manu beugte sich vor und küsste ihn, ein Kuss, der nach Tomate schmeckte und Sonnencreme. Sie setzte sich auf seinen Schoß, nahm seine Hand und schob sie sich unter den Hosenbund, zwischen die Beine, zog ihm sein T-Shirt über den Kopf. Die Trainingshose, die sie trug, saß locker, ohne Mühe ließ sie sich über ihren Hintern schieben. Es war leicht, mit Manu zu schlafen, sie schob seine Hände dorthin, wo sie sie haben wollte, und nie hatte er das Gefühl, sich ungünstig auf ihr abzustützen oder sich in einer Art und Weise zu bewegen, die ihr nicht gefiel, sie war es, die den Rhythmus bestimmte. Sie war nie besonders laut, auch jetzt nicht. Als sie kam, ging ein mehrfaches Zucken durch ihren Unterleib und ihre Oberschenkel. Sie kam ein paar Sekunden vor ihm, bewegte sich aber weiter, drückte ihr Gesicht fest an seines und blieb auch hinterher noch eine Weile so auf ihm, die Arme fest um ihn geschlungen, bis sie sich mit einem dicken Kuss auf seine Schläfe von ihm löste. Während er noch damit beschäftigt war, sich wieder anzuziehen, drehte sie sich schon mit diesem fast durchsichtigen Papier eine kleine Zigarette. Sie legte sich ihren tragbaren Aschenbecher aus grünem Metall auf den nackten Bauch, rauchte, aschte ab, rauchte, und der Aschenbecher hob und senkte sich mit ihrem Atem, der sich langsam beruhigte.
»Ich kenne wirklich niemanden, der so ist wie du«, sagte Finn nach einer Weile.