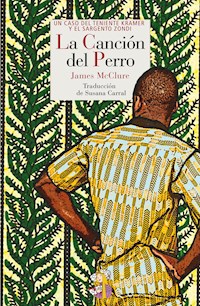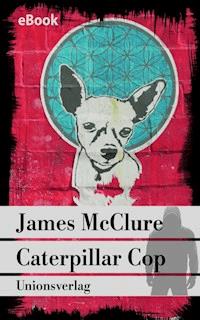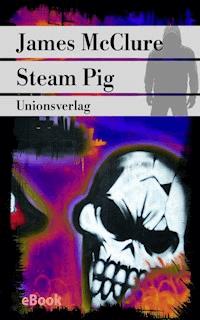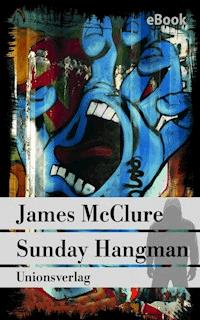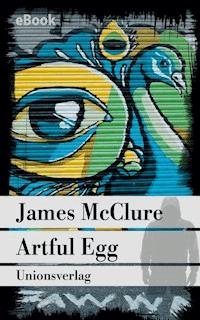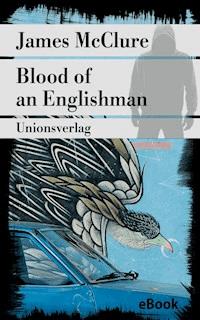
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Im Kofferraum eines Autos wird die verweste Leiche eines Mannes gefunden. Der Anblick ist grauenvoll, doch beunruhigender als der Verwesungszustand sind die Verstümmelungen, die der Tote aufweist. Es wirkt, als wurde er mit unmenschlicher Kraft misshandelt. Treibt ein mordlustiger Riese sein Unwesen in Trekkersburg? Einer konnte dem Mörder nur knapp entrinnen, da er sich tot stellte. Ist es bloßer Zufall, dass beide Opfer im Zweiten Weltkrieg Piloten der RAF waren? Während Lieutenant Tromp Kramer und Sergeant Michael Zondi versuchen, das Rätsel zu lösen und sich dabei respektlos in die Privatangelegenheiten der Trekkersburger Bürger einmischen, erfindet Gerichtsmediziner Dr. Styrdom ausgefallene Experimente mit Leichenteilen, um dem Riesen auf die Spur zu kommen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 481
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Über dieses Buch
Im Kofferraum eines Autos wird die verweste Leiche eines Mannes gefunden. Der Anblick ist grauenvoll, doch beunruhigender als der Verwesungszustand sind die Verstümmelungen, die der Tote aufweist. Es scheint, als wurde er mit unmenschlicher Kraft misshandelt. Treibt ein mordlustiger Riese sein Unwesen in Trekkersburg?
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
James McClure (1936–2006) lebte in Südafrika, bis er 1965 nach England zog. Seine Krimiserie rund um das Ermittlerduo Kramer und Zondi schildert die Jahre der Apartheid. Steam Pig wurde 1971 mit dem CWA Gold Dagger ausgezeichnet.
Zur Webseite von James McClure.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
James McClure
Blood of an Englishman
Südafrika-Thriller
Aus dem Englischen von Erika Ifang
Kramer & Zondi ermitteln (7)
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 1 Dokument
Die Originalausgabe erschien 1980 unter dem Titel The Blood of an Englishman im Verlag Macmillan, London.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1985 unter dem TitelDie Jagd nach dem Schatten im Verlag Moewig, Rastatt.
Für die vorliegende Ausgabe wurde die deutsche Übersetzung nach dem Original durchgesehen.
Originaltitel: The Blood of an Englishman (1980)
© by The Estate of James McClure 1980
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Paula Vogg
Umschlaggestaltung: Heike Ossenkop
ISBN 978-3-293-30966-1
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 26.07.2024, 16:06h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
BLOOD OF AN ENGLISHMAN
1 – Droopy Stephenson war noch nicht sehr lange ein …2 – Die Nachricht von dem schrecklichen, folgenschweren Fund auf …3 – Nach hektischen zwanzig Minuten Jagd durch alle Friseursalons …4 – N2134 NXUMALO, der Zulu-Constable und Assistent von Sergeant …5 – Für Edward »Bonzo« Hookham hatte endgültig die letzte …6 – Colonel Hans Muller, Divisionskommandant des CID, stützte die …7 – Zondi spielte noch immer mit der Schnur herum …8 – Noch immer bebend vor Wut und Empörung trotz …9 – Ein durchtriebener schwarzer Bettler mit verkrüppelten Gliedmaßen …10 – Mama Bhengus fünf Kunden hatten ihren Spaß gehabt …11 – Kramer sah auf die Uhr. Es war fast …12 – Bis Mitternacht hatte Meerkat Marais drei Typen zusammengeschlagen …13 – Der Donnerstag begann hell und klar und brachte …14 – Die dunstige Hitze überzog den Garten mit einem …15 – Colonel Muller war an dem Punkt angekommen …16 – Kramer hatte folgende Idee. Wenn Bradshaw und Hookham …17 – Kommst du mit?«, fragte Kramer, als er am …18 – Zondi entspannte die Muskeln ganz allmählich wieder …19 – Classina Marie Baksteen war eine entzückende Sechzehnjährige mit …20 – Das ist ja ein schrecklicher Gedanke«, sagte Colonel …21 – Meerkat Marais war vollkommen von seiner blinden Besessenheit …22 – Als Kramer am selben Nachmittag um kurz nach …23 – Tish Hayes stand nicht an der Ecke Alemap …24 – Das hat mir aber wirklich Angst gemacht!« …25 – In einer klaren, mondhellen Nacht mit leichter Bewölkung …26 – Eine Stunde nach Anbruch der Morgendämmerung flogen sie …27 – Colonel Muller klopfte an Zondis Fenster. »Wo ist …28 – Alle Welt schien an diesem milden Sommernachmittag im …Anmerkung des AutorsMehr über dieses Buch
Über James McClure
»Wenn meine Gedanken in Südafrika sind, höre ich immer Gelächter«
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von James McClure
Zum Thema Südafrika
Zum Thema Afrika
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema Spannung
Für Arthur Maling
»Ich rieche, rieche Menschenfleisch.«
Der Riese in Die drei Zauberbohnen
»Ich rieche, rieche Menschenfleisch.«
Der Riese in Die drei Zauberbohnen
1
Droopy Stephenson war noch nicht sehr lange ein geiler alter Bock. Er musste sich noch an die Vorstellung gewöhnen. Er war dabei, alle Pros und Kontras gegeneinander abzuwägen, und bemühte sich, seine Arbeit nicht darunter leiden zu lassen.
Was gar nicht so leicht war.
»Was höre ich da, Droopy?«, fragte Sam Collins, sein Chef, der neben dem Landrover hockte, unter dem Droopy gerade die Ölwanne ausbaute. »Mann, ich bin ja schockiert über dich!« Und er klatschte sich auf die Schenkel und ging lachend davon.
Droopy streckte die Hand nach einem Achter-Ringschlüssel aus, und Joseph, sein aufmerksamer Zulugehilfe, wischte das Öl vom Griff und reichte ihm den Schlüssel. Dann lag Droopy eine Zeit lang einfach rücklings auf dem Rollwagen und starrte von unten auf die Ablassschraube der Ölwanne.
Vor drei Tagen war er in den Obstladen an der Ecke gegangen, ein paar Meter entfernt von der kleinen Tankstelle, in deren Werkstatt er arbeitete, und hatte zu der Besitzerin gesagt: »Wieder so ein glühend heißer Tag, was, Mavis? Darf ich mal Ihre Tomaten anfassen?« Er mochte nur knackige Tomaten. Und Mavis Koekemoor, die Droopy schon seit Jahren kannte, hatte es nicht einmal für nötig befunden, zu nicken. Stattdessen hatte sie ihm erklärt, dass ihre Füße sie noch umbringen würden und dass sie daran dächte, solange die Hitzewelle anhalte, ihre junge Nichte hinter die Kasse zu stellen. Da der Laden aus nicht viel mehr als einer Kasse bestand, fand Droopy diesen Einfall vernünftig. Und dementsprechend hatte er sich auch geäußert. Er hatte sich ebenso nach Mavis’ junger Nichte erkundigt, die, wie er sich dunkel erinnerte, in den Schulferien öfters im Laden ausgeholfen hatte, und erfahren, dass sie Friseuse werden wollte. »Ja, inzwischen ist sie ein großes Mädchen«, hatte Mavis Koekemoor mit Befriedigung bemerkt und dabei die Tüte Tomaten herumgewirbelt, um sie auf diese Weise in einer Bewegung zu verschließen. Droopy hatte versucht, diesen netten kleinen Trick nachzumachen, nachdem er zwei Tomaten zu seinen Mittagsbroten verspeist hatte, aber sie waren ihm allesamt in die Grube gefallen.
»Wünscht der Boss den Sechser?«, fragte Joseph etwas beunruhigt, da unter dem Fahrzeug keinerlei Geräusche mehr zu hören waren.
»Nein, nein, der Achter passt schon.« Nachdem er ein paar Muttern losgedreht hatte, kam er wieder ins Träumen und ging noch einmal die Ereignisse durch, die ihm seinen neuen Ruf eingetragen hatten.
Vor zwei Tagen war er wieder in dem kleinen Obstladen an der Ecke gewesen und hatte sich – anders konnte man es wirklich nicht sagen – einem Paar erstaunlicher Brüste gegenübergesehen und einer Haartracht, die wie ein Elektroschock wirkte. »Sie kennen Glenda ja schon«, hatte Mavis Koekemoor von ihrem bequemen Sitz vor dem Ventilator aus gesagt. »Schauen Sie sie doch mal an! Ich bitte Sie! Das ist die Vorstellung dieser jungen Dame vom Sonnenbaden – ›Ich will braun werden, Tantchen!‹ –, und jetzt ist sie ganz rot.«
Droopy, der seine normale Schüchternheit und Scheu ganz vergessen hatte, schaute schon längst. Er starrte Glenda wie hypnotisiert an, weniger beeindruckt von den deutlichen Anzeichen des Sonnenbadens als vielmehr von Tatsachen eher bleibender Art. »Hallo, Droopy«, hatte Glenda ihn mit einem süßen, unschuldigen Lächeln begrüßt. »Was darfs denn sein?« – »Ah, darf ich mal deine Tomaten anfassen?« – »Also wirklich, Droopy!« Und von da an war es immer schlimmer geworden. Viel schlimmer. Bis sich Droopy schließlich eine herumliegende Gurke und zwei Orangen geschnappt und fluchtartig den Laden verlassen hatte, während Mavis Koekemoor, der vor Lachen die Puste ausgegangen war, in die Arme ihrer gewissenlosen Nichte sank.
»Ist dem Boss schlecht?«
Droopy hatte unabsichtlich gestöhnt. »Ach was! Aber ist es nicht an der Zeit, mir meinen Tee zu holen?«
»’tschuldigung, Boss.«
Am nächsten Tag – er schien Millionen Jahre zurückzuliegen, obwohl es erst gestern gewesen war – hatte Droopy das kleine Obstgeschäft natürlich wie die Pest gemieden und versucht, die Vorstellung seiner Hauswirtin von einem Lunchpaket aufzubessern, indem er der Konditorei einen Besuch abstattete. Für gewöhnlich schenkten ihm die drei Mädchen dort keinerlei Beachtung, sondern verkauften ihm seine Kuchenstückchen, ohne ihr Gespräch zu unterbrechen. Doch als er diesmal an die Theke trat, war hinter seinem Rücken ein erstes Kichern erklungen, und dann war es über ihn hereingebrochen, als er etwas verärgert gefragt hatte, ob sie Zitronentorten hätten.
»Das hätten wir nie von Ihnen gedacht«, sagte die Blondine. »Stille Wasser sind tief, was, Droopy?«, so etwas hätte jeden aus der Fassung gebracht, und er hatte auch prompt üble Kopfschmerzen bekommen. Deshalb war er auf dem Rückweg zu Sams Tankstelle noch bei der Drogerie vorbeigegangen. Die beiden Verkäuferinnen hatten kichernd hinter einem Schaukasten mit Sonnenbrillen gestanden, bis die eine von ihrer Kollegin vorgeschubst wurde und sagte: »Augenblick, Droopy, ich hol eben den Chef für Sie!«
»Was könnte der mir anderes verkaufen als ihr, he? Ich brauche bloß ein paar Aspirin.«
Daraufhin hatten sich ihre gezupften Augenbrauen gehoben. »Sind Sie sicher? Ihnen fehlt sonst nichts?«
»Natürlich fehlt mir was!«, empörte sich Droopy zu ihrer unermesslichen Erheiterung.
Das Fass zum Überlaufen brachte die affige Kassiererin bei seiner Rückkehr zur Tankstelle, als sie augenzwinkernd zu ihm sagte: »Na, na, Droopy, wo haben Sie denn den ganzen Mittag über gesteckt? Was hatten Sie denn vor?«
Josephs löcherige Schuhe kamen knirschend neben dem Landrover zum Stehen. »’tschuldigung, Boss. Boss Sam sagen, ob Boss wünschen, dass Boss Sam Zeug in seinen Tee tun.«
»Was für ›Zeug‹?«
»Ungasi, Boss. Ich gehen und ihn fragen?«
»Nein, bring mir endlich meinen Tee, und stell dich nicht so an, Mann! Ich habe zu tun!«
»’tschuldigung, Boss.«
Aber der Achter-Ringschlüssel lag immer noch untätig in seiner Hand. Auf dem Heimweg war ihm dann endlich ein Licht aufgegangen, als ihn nämlich die kleine Miss Brooks, die das PUPPENHOSPITAL an der Ecke führte, in ihren Laden gewunken und gesagt hatte: »Ich wollte Sie nur wissen lassen, Mr Stephenson, dass ich, ganz gleich, was diese freche Göre überall erzählt, mich nie dazu verleiten lassen werde, Sie als einen – einen alten Bock zu bezeichnen.« Droopy hatte ihr kleinlaut gedankt und war nach Hause gegangen, wo er sich die ganze Nacht über auf dem schmalen Sofa hin und her geworfen und darüber nachgegrübelt hatte, auf welche Weise er Glenda Koekemoor umbringen könnte. Am Morgen hatte er sich eingestehen müssen, dass ihm nichts anderes übrig blieb, als seinen ganzen Mut zusammenzunehmen und die Sache klarzustellen. Und so hatte er vor Arbeitsantritt bei der Konditorei, der Drogerie, beim Reisebüro, beim Filmladen und verschiedenen anderen Geschäften einschließlich des kleinen Obstladens vorgesprochen. Glenda, hatte Mavis Koekemoor ihm gesagt, käme erst später, woraufhin er die Nachricht für sie hinterlassen hatte, dass er mit ihr reden wollte. Droopy war der Gedanke an diesen Rundgang zuerst unangenehm gewesen, aber dann hatte es ihm Spaß gemacht. In der Konditorei wurde die übliche Schar von Lehrlingen und sehr männlich auftretenden jungen Büroangestellten, die sich für ihre Pause um elf Gebäck holten, schlagartig ignoriert, kaum dass er eintrat. Die Mädchen hatten ihm hingebungsvoll zugehört, und er hatte nicht einmal besonders witzig sein müssen, um sie dazu zu bringen, vor Begeisterung zu kreischen und ihre Reize spielen zu lassen. Ähnlich war es ihm in der Drogerie ergangen, bis der Chef erschienen war und Droopy mit der ersten Packung Kondome in vierzig Jahren hinausmarschierte. Und die Rothaarige im Reisebüro hatte ihm maßlos geschmeichelt, als sie darauf bestanden hatte, dass es für einen Mann seiner Reputation nur eins gäbe, nämlich möglichst bald eine Vergnügungsreise nach Paris zu machen – wohin sie ihn, wenn sie es auch nur halbwegs ermöglichen könne, gern begleiten würde. Selbst der Rückweg war aufregend anders gewesen. Während Droopy sonst einfach seines Weges ging, schäbig und unbemerkt, hatte sein Gang diesmal fast grenzenlose Aufmerksamkeit erregt.
Ein Paar ölgetränkte Mokassins tauchten neben dem Landrover auf. »Morgen, Droopy!« Es war sein Kollege Boet Swart.
»Morgen, Boet. Wie gehts?«
»So lala. Aber sag mal, wie machst du das eigentlich?«
»Was?«
»Ach, komm schon, Droopy – mir kannst du doch nichts vormachen, he! Es ist raus – ich sags dir, es ist raus!«
»Ich weiß«, sagte Droopy, und es überraschte ihn, dass er den Gedanken sogar irgendwie mochte. Manches von dem Kitzel dieses Morgens tat immer noch seine Wirkung. »Ich habe es gestern Abend von Miss Brooks gehört.«
»Ach ja?«
Der ungläubige Ton in Boets Stimme versetzte seinem Stimmungshoch einen Dämpfer. »Warum sagst du so komisch ›ach ja‹? Du wärst bestimmt froh, wenn all die Puppen –«
»Ausgerechnet Miss Brooks?«
»Sie hat mich in ihren Laden gerufen und –«
»Teufel auch.«
»Sie hats aus purer Freundlichkeit getan – was ist daran so verkehrt?«
»Hm.«
Droopy kam unter dem Landrover hervorgepaddelt und erhob sich vom Rollwagen. »Was soll das, Boet – am besten erzählst du mir mal, was du eigentlich meinst.«
»Na ja, du weißt vielleicht noch nichts über Miss Brooks, alter Freund. Es könnte einen anderen Grund geben, warum sie sich plötzlich für dich interessiert …«
Droopy legte den Kopf schief und wartete. »Was könnte eine alte Frau wie sie denn von mir wollen?«, sagte er.
»Mann, die Frage ist doch, was für eine alte Frau sie ist«, sagte Boet trübselig, »und sie wird nicht die Einzige bleiben, die hinter dir her ist, nachdems nun raus ist. Sie werden von allen Seiten hinter dir her sein.« Damit drehte er sich auf dem Absatz um und ging schnell davon, und die affige Brünette an der Kasse grinste.
Droopy wurde von Panik erfasst. Die Fantasien attraktiver junger Dinger waren eine Sache, aber nicht eine Sekunde lang hätte er es für möglich gehalten, dass geile alte Weiber scharf auf ihn sein könnten. Sein Bruder war früher Polizist gewesen und hatte oft gesagt, er würde es lieber mit neun Kaffern aufnehmen, die mit Zuckerrohrmacheten bewaffnet seien, als mit einer entschlossenen Frau – besonders so piekfeinen wie Miss Brooks, die noch dazu hysterisch seien. Hätte er mehr Zeit gehabt, wäre Droopy vielleicht einfach mit einem Lachen über die ganze Sache hinweggegangen, aber er hatte keine Chance mehr dazu.
Eine hohe kultivierte Stimme war vom offenen Werkstatttor her zu vernehmen. »Ich weiß gar nicht, was daran so schwierig sein soll! Warum kann ich den nicht haben? Es sieht nicht so aus, als wäre er gerade beschäftigt.«
Als Droopy sich umdrehte, sah er eine hochgewachsene dünne Frau mit weißem Haar und knallroten Lippen, die mit dem Finger auf ihn zeigte.
»Kannst du mal einen Moment herkommen?«, fragte Sam und wartete, bis Droopy herbeigeschlurft war, ehe er weitersprach. »Die Dame hat anscheinend ein Problem, bei dem du ihr helfen kannst.«
»Ja, bitte, gnä’ Frau?«, sagte Droopy, ohne Sams Blinzeln und das Kichern von der Kasse her zu beachten.
»Mein Kofferraum geht nicht auf – es ist zum Verzweifeln. Gerade habe ich Berge von Zeug eingekauft, das da hineinsollte, und nun kann ich einfach nicht aufschließen. Der Schlüssel lässt sich nicht einmal ins Schloss stecken.«
»Kümmer dich drum«, sagte Sam und ging in sein Büro zurück.
»Hier«, sagte die Frau und reichte Droopy ihre Autoschlüssel. »Ich hab ihn dort drüben abgestellt. Ich muss gleich los, sonst komme ich zu spät zum Friseur.«
Droopy ging nach draußen und ein kurzes Stück die Straße entlang. Das Erste, was ihm an dem Wagen auffiel, war, dass Hunde die Hinterreifen und die hintere Stoßstange vollgepinkelt hatten. Das war zwar ein bisschen merkwürdig, hätte aber dem Schloss nichts ausmachen dürfen. Dann kauerte er sich hin und inspizierte das Schloss.
»He, Droopy!«
Er sprang auf. Es war Glenda, die fast aus ihrer dünnen Bluse platzte und keinerlei Reue zeigte. Sein Griff um den Achter-Ringschlüssel, den er noch immer bei sich trug, wurde fester.
»Du wolltest mich sprechen, hat Tantchen gesagt? Ich hoffe, es wird nicht so peinlich wie neulich.«
»Hör mal!«, stieß Droopy hervor und verstummte jäh.
Es nützt sowieso nichts, sagte ihm sein gesunder Menschenverstand. Was er auch erklären würde, es würde nichts mehr ändern an dem, was sie getan hatte. Er konnte nur beten, dass irgendetwas geschah, was ihn der allgemeinen Aufmerksamkeit entzog, aber das war ja der Ärger mit dieser Straße, dass so gut wie nie etwas passierte.
»Ach, vergiss es«, murmelte er.
Glenda hockte sich neben ihn und stieß mit ihrer rechten an seine linke Schulter. »Wo liegt das Problem?«
»Du hast doch Augen im Kopf!«
»Ja. Da steckt ein abgebrochenes Streichholz drin.«
Das hatte Droopy gar nicht bemerkt. Er warf ihr einen schrägen Blick zu, legte den Schraubenschlüssel ab und suchte in seinen Taschen. »Mit ’ner Haarnadel«, sagte sie und gab ihm eine.
»Geht nicht.«
»Du hast es ja noch gar nicht probiert.«
Er probierte es. Das Streichholz steckte nur noch fester. »Diese verdammten Bälger«, knurrte er. »Denen ist alles …«
»Jaja, immer sind es die Kinder – immer sind sie schuld! Woher willst du das wissen?«
»Wer denn sonst?«
»Lass mich mal, Droopy.«
»Merkst du nicht, dass du hier überflüssig bist?«
Glenda blieb. Sie schnupperte. Sie zog die Nase kraus und schnitt ein Gesicht. »Zum Teufel, hier stinkt es ja grauenhaft«, sagte sie angeekelt. »Woher kommt dieses Auto – von einer Farm? Es muss an den Rädern kleben.«
»Zieh Leine, hab ich gesagt!«
»Ach Droopy, Mann, sei doch nicht so!«, sie legte ihre weiche Hand auf seine schwielige Faust, und schon durchfuhr ihn ein Prickeln. »Du musst auch mal einen Spaß vertragen können!«
»Was ist daran spaßig?«, sagte er verächtlich. »Seit wann ist das, was du getan hast, ein Spaß?«
»Meinst du das, was ich über die Tomaten erzählt habe?«
Ihre Unverfrorenheit nahm ihm den Atem. »Man sollte dir die Hosen runterziehen und den Hintern versohlen, mein Fräulein!«
»Ist das ein Angebot?«
»Glenda Koekemoor!«
»Natürlich war es ein Spaß«, fuhr sie ungerührt fort und nahm ihm die Haarnadel aus den nervösen Fingern, um selbst einmal ihr Glück mit dem Schloss zu versuchen. »Es wäre kein Spaß gewesen, wenn du wirklich ein Dreckschwein wärst, nicht wahr? Aber das bist du ja nicht – in Trekkersburg bist du wahrscheinlich der Mann mit dem geringsten Sex-Appeal.«
»Bitte?«
»Meinst du denn, es würde sich jemand trauen, dich so aufzuziehen, wenn du nicht so ein – so eine richtige Null wärst? Nie im Leben!«
»I – Ich –«
»Mein Freund könnte das Ding hier leicht aufkriegen – er verpasst ihm einfach einen Tritt, und schon fliegt es auf.«
»Ich –«
»Glaub mir, das hat ihm schon Ärger mit den Cops eingebracht!«
»Allmächtiger!«, keuchte Droopy so verletzt wie nie zuvor. »Eine ›richtige Null‹, sagst du, he? Was weißt du denn schon von den Männern –!«
»Aha!« Glenda lachte entzückt auf. »Du gibst also zu, dass du doch gewisse Schuldgefühle hattest, als du so rot wie eine Rübe geworden bist?«
Das reichte. Droopy hatte auf einmal wieder den Achter-Ringschlüssel in der Hand und wollte nur noch damit auf sie einschlagen, auf sie einschlagen und sie ebenso verletzen, wie sie ihn mit jedem frechen Zungenschlag verletzte. Und mehr noch, er wollte ihr den Kopf zerschmettern, sodass das Hirn, das sich solche gemeinen Dinge über ihn ausdachte, auf die Straße spritzte.
»Droopy!«, schrie Glenda und sprang entsetzt auf.
Er holte aus und schlug mit aller Kraft zu, und traf genau auf das Schloss. Der Kofferraumdeckel sprang auf, ein entsetzlicher Gestank verpestete die Luft, und vor ihnen lag unzweifelhaft der dreckigste Kerl, den sie je gesehen hatten. Er war von Schlamm, Exkrementen und Blut bedeckt, und seine Hände hatte man mit einem so grauenhaft festen Knoten nach hinten gebunden, dass die Knochen gebrochen waren. Und tot war er außerdem.
Glenda schrie und schrie, und die ganze Straße eilte zu ihrer Rettung herbei.
2
Die Nachricht von dem schrecklichen, folgenschweren Fund auf der Gillespie Street erreichte das CID-Hauptquartier in der Boomplaas Street nicht so schnell, wie sie sollte. Dafür gab es verschiedene Gründe. Als die uniformierten Officer der südafrikanischen Polizei am Tatort erschienen, mussten sie erst unter beträchtlichen Schwierigkeiten die öffentliche Ordnung wiederherstellen. Eben hatten sie die Menschenmenge unter Kontrolle, da biss einer der Polizeihunde schändlicherweise den leitenden Sergeant, dessen aufgeregt hektische Art wahrscheinlich seinen Verdacht erregt hatte. Bis also alles geregelt und eine neue Befehlskette eingerichtet worden war, herrschte noch der Status quo im CID-Gebäude. Manche Detectives saßen murrend über Schreibarbeiten, andere redeten auf die Stenotypistinnen ein, und einige wenige gingen beharrlich weiterhin Ermittlungen nach.
Er musste so lange und so still dagesessen haben, dass die Fliege gedacht hatte, sie könnte ihn getrost zum Eierlegen ansteuern. Denn was sollte sie sonst vorhaben, wenn sie ihren Rüssel in sein linkes Nasenloch schob? Um dann zu zaudern und zu überlegen, ob nicht doch das andere Nasenloch das bessere wäre. Dieses rechte Nasenloch war bei Lieutenant Tromp Kramer vom Trekkersburger Morddezernat verschnupft, und so war es dort mit Gewissheit weniger zugig. Genauer gesagt, hatte er durch dieses Nasenloch schon drei Tage lang nicht mehr atmen können. Die Fliege wechselte dorthin.
Der Gefangene fand all das offensichtlich spannend. Er saß selbst ziemlich still, starrte Kramer an und schwitzte stark.
Kramer starrte zurück; er schwitzte überhaupt nicht. Sein Fieber war über Nacht gewichen, und jetzt waren auch seine Halsschmerzen kaum noch zu spüren. Er merkte, wie die Fliege hochkrabbelte und innehielt. Papiertaschentücher, angeblich garantiert weicher als das knubbelige Gegenstück eines Kinderpopos, hatten die Mund- und Nasenpartie so aufgeraut, dass sie ungewöhnlich empfindlich war und Kramer sich leicht vorstellen konnte, was vor sich ging. Die Fliege stand auf fünf Beinen, kratzte sich mit dem sechsten den hässlichen haarigen Kopf und fragte sich, ob sie eine Münze werfen sollte oder so was. Wieder Bewegung. Sie hatte sich schließlich doch für das linke Nasenloch entschieden und bahnte sich kitzelnd einen Weg durch die Härchen.
Ein schwaches verschlagenes Lächeln erschien auf dem schmalen Gesicht des Gefangenen. Meerkat Marais – von seinen englischen Geschäftspartnern »Mungo« genannt – gab sich immer gern den Anschein, als wüsste er mehr als die anderen, und es war ziemlich egal, was.
Kramer nahm sich ein Papiertaschentuch, ohne dabei auch nur im Geringsten den Kopf zu bewegen. Er breitete das Tuch auf seiner rechten Hand aus. Dann kniff er urplötzlich die Nase ziemlich fest damit zu und blies das tote Insekt genau in die Mitte des Papiertuchs.
»Es funktioniert immer«, murmelte er.
Volle fünf Minuten dauerte es, bis der Gefangene nicht mehr an die Fliege dachte und schließlich das Schweigen brach, indem er mit dünner, gepresster Stimme fragte, warum er eigentlich auf dem Aktenschrank sitzen müsse.
Kramer zuckte die Achseln und ließ das zerknüllte Papiertuch in den Papierkorb neben sich fallen. »Ich habe gehört, du hättest Höhenangst, Meerkat, mein Söhnchen.«
»Was?«
»Na ja, ich dachte, fangen wir mal klein an, und dann sehen wir, wies weitergeht. Okay?«
Meerkat wurde aschfahl und gab ein kurzes entsetztes Lachen von sich. »Da komm ich nicht mit, Mann!«, sagte er. »Ich verstehe nicht ganz! Was für Höhen?«
Auf der anderen Seite des CID-Parkplatzes wurde gerade ein achtzehnstöckiges Bürohochhaus für eine Versicherung gebaut. Das oberste Stockwerk war fast fertig. Kramer wandte sich vom Fenster ab und sah die auffallend gekleidete Gestalt an, die mit Handschellen auf seinem Aktenschrank hockte. Sie zitterte wie ein Presbyter, der Pornofotos von sich selbst auspackt.
»Komm«, sagte Kramer und erhob sich. »Ich weiß, wo es eine hübsche steife Brise gibt.«
»Nein!«
»Bitte?«
»Seien Sie doch fair, Lieutenant«, flehte Meerkat. »Wie viele Stunden halten Sie mich schon hier fest? Drei? Und Sie –«
»Erst zwei, Meerkat.«
»Gut, zwei, aber was haben Sie mich bisher gefragt? Nichts! Woher soll ich denn wissen, was Sie wollen? Wie kann ich die leiseste Ahnung haben? Verdammt, es könnte alles Mögliche sein, stimmts?«
Kramer setzte sich wieder hinter seinen leeren Schreibtisch. »Nein, Mann, könnte es nicht«, sagte er. »Ich für mein Teil bearbeite nur Morde und Raubüberfälle, wenn ich also einen Typen zum Reden herbringe, steht das Thema bereits fest. Und wenn ich nichts sage, dann nur, verflucht noch mal, weil es unfein ist, zu unterbrechen.«
»Was zu unterbrechen?«
»Deinen Redefluss, Meerkat. Deinen Redeschwall. Deine Herzensergüsse, deine Offenbarungen. Glaub mir, Meerkat, du wirst dich dann entschieden wohler fühlen.«
Meerkat entspannte sich. »Ich soll also etwas zu gestehen haben?«, sagte er mit einem nervösen Lächeln. »Das höre ich aber jetzt zum ersten Mal!«
»Ja, schon möglich«, pflichtete Kramer bei.
Der Gefangene war ein ausgemachter Psychopath von der Sorte, die bereits mit drei Jahren der Großmama in die Wärmflasche pissen, und danach ist dann kein Halten mehr. Menschen spielten für Meerkat einfach keine Rolle. Er hatte Leuten Dinge angetan, an die man gar nicht denken durfte, alles, ohne mit der Wimper zu zucken, manchmal sogar, ohne es überhaupt zur Kenntnis zu nehmen.
»Sie haben mir immer noch nicht gesagt, worum es eigentlich geht, Lieutenant.«
»Vielleicht ist es andersherum.«
»Bitte?«
»Archie Bradshaw – erzähl mir von ihm.«
Meerkat blinzelte. »Verdammt, wenn Sie glauben, ich hätte damit –«
»Erzähl schon!«, bellte Kramer. »Erzähl mir alles, was du über Archie Bradshaw weißt, sonst gehst du in zwei Minuten in einem Zementkübel auf Reisen!«
Meerkat schluckte heftig und wand sich, als wäre sein Arschloch so fest zu, dass es ihn zwickte. »Jemand hat versucht, Bradshaw fertigzumachen«, sagte er. »Vor sechs Tagen, stimmts? Er führte gerade seinen Hund aus, oben an der Pferderennbahn, und der Schuss hat ihn hier ins Schlüsselbein getroffen. Nicht tiefer. Als er wieder zu sich kam, war sein Hund dabei, ihn abzulecken. Ich für mein Teil glaube ja, dass der Hund das Blut …« Er räusperte sich nervös, als er sah, wie Kramer die Fäuste ballte. »Na ja, wie dem auch sei, er ist jedenfalls in sein Auto gestiegen und nach Hause gefahren. Es war ein Wagen mit Automatik, es ging also. Seine Frau sah das ganze Blut und fragte ihn, was passiert sei. Er wollte ihr nichts sagen. Selbst dem Arzt wollte er nichts sagen. Dann haben sie ihn ins Krankenhaus gebracht und operiert. Als er wieder zu sich kam, sah er den Polizisten dort, wollte aber immer noch nicht mit der Sprache heraus. Die Ärzte meinten, er habe höchstwahrscheinlich einen schweren Schock erlitten. Am nächsten Morgen hat seine Frau zum ersten Mal die Story gehört. Bradshaw erzählte, er sei gerade unter den Bäumen spazieren gegangen, als er ein Geräusch im Gebüsch hörte. Daraufhin habe er sich umgeschaut und einen großen Kerl erblickt – wie ein Gorilla, hat er gesagt, oder ein Riese – mit einem silbernen Revolver in der Hand. Er habe noch nie im Leben einen so riesenhaften Kerl gesehen, sagte er, und es sei ein solcher Schock gewesen, dass er wie erstarrt gewesen sei. Dann hätte er das Mündungsfeuer gesehen, ehe er eine Chance hatte, etwas zu sagen, und es sei wie –«
»Meerkat!«
»Ja, Lieutenant?«
»Du erzählst mir genau das, was in der Zeitung steht!«
»Aber – ich …«
»Nun komm schon, Mann«, sagte Kramer, stand auf und ging zu Meerkat hinüber, um ihn von Nahem anzuschauen. »Lass mal hören, was noch nicht die ganze Stadt weiß. Lass mal hören, was du –«
»Hören Sie, Lieutenant Kramer, bitte, Sir. Alles, was ich über diese Sache weiß, habe ich in der Gazette gelesen – und das ist die reine Wahrheit.«
Kramer holte eine kleine Plastiktüte aus der Tasche und ließ sie ein paar Zentimeter vor Meerkats Nase baumeln, sodass der zu schielen anfing. »Und was ist das, he? Eine .32er Kugel.«
»Na und?«
»Kaliber .32 ist doch relativ ungewöhnlich, nicht?«
»Vielleicht, aber –«
»Vergiss das nicht«, sagte Kramer und nahm seinen Platz am Schreibtisch wieder ein. »Es heißt, ein gewisses Individuum sei illegal im Besitz einer silberbeschlagenen Pistole mit verdecktem Schlaghammer und fünf Kammern –«
»Ich?« Meerkat bemühte sich, ein ungläubiges Lachen zustande zu bringen. »Es muss ja wirklich schlecht stehen, wenn Sie ausgerechnet mich rauspicken, Mann! Erstens kenne ich diesen Bradshaw nicht einmal, und –«
»Er schwört, er hätte den Kerl auch noch nie gesehen.«
»Ach ja? Sehe ich vielleicht wie ein Riese aus?«
»Bei so etwas kommt es leicht zu Übertreibungen, wie du dir vorstellen kannst. Meiner Meinung nach kann jeder, der mit einem Revolver genau auf einen zielt, den Eindruck hinterlassen, als wäre er ein riesenhafter Kerl. Ich kann mich noch daran erinnern, wie einmal nach einem bewaffneten Raubüberfall in Peacevale ein Kaffer hinter mir und Zondi her war, und er kam uns so monströs wie King Kong vor, bis wir ihm ein paar Löcher in den Pelz gebrannt hatten.«
»Trotzdem –«
»Er war zwölf.«
Meerkat schaute den Wandkalender mit den Blutspritzern an. »Vor sechs Tagen, das wäre der Zehnte gewesen«, sagte er. »Für den Zehnten habe ich ein Alibi.«
»Wie heißt sie?«
»Krankenschwester Turner.«
»Und wo warst du mit Krankenschwester Turner zur fraglichen Zeit? In der Klappe?«
»Ich schon. Ich sollte einen Weisheitszahn gezogen bekommen.«
»Unmöglich«, sagte Kramer.
Eine zweite Fliege begann, ihn zu belästigen. Er schlug mit der Akte Archibald Meredith Bradshaw, Mordversuch nach ihr und wünschte, er hätte einen anderen Beruf ergriffen. In den sechs Tagen, seit er den Fall bearbeitete, war er in eine Sackgasse nach der anderen geraten und kein Stück weitergekommen. Bald würde Colonel Muller anfangen, ihm unangenehme Fragen zu stellen. War ein mögliches Motiv für diesen Mordanschlag ermittelt worden? Nein. Eine Spur von der Tatwaffe? Nein. War seit dem letzten Freitag überhaupt ein Fortschritt in den Ermittlungen zu verzeichnen gewesen? Nein. War Kramer vielleicht mit seinem Latein am Ende? Gut möglich, ja.
»Meerkat …«
»Ja, Lieutenant?«
»Ich will ganz offen sein. Ich habe Probleme mit diesem Fall, und mein Boss ist schon ganz schön am Fluchen. Am besten für mich wäre, wenn ich einfach eine Aussage tippe – die du natürlich unterschreibst –, dass du deine .32er an einen riesenhaften Verrückten verkauft hast, den du vorher noch nie gesehen hast. Ich weiß, dass das nicht alles ist, aber –«
»Was?«, keuchte Meerkat. Er wäre beinahe von seinem Sitz gefallen.
»Es sei denn, du kannst irgendwie beweisen, dass ich falschliege.«
Kramer hörte schnelle Schritte im Treppenhaus und sah zur Tür. Zwei Sekunden später kam ein schmucker, gut gebauter Zulu in schmissigem, schwarzem, mit Silberfäden durchwirktem Anzug und weichem, breitkrempigem Schlapphut rutschend auf der Veranda zum Stehen und steckte den Kopf zur Tür herein. Es war sein Assistent, der Bantu-Detective Sergeant Mickey Zondi.
»Sag nichts«, seufzte Kramer, »lass mich raten. Ihr Ehemann kam überraschend nach Hause und hat kein Wort gegl–«
»Es hat einen Mord gegeben, Lieutenant. Der Colonel hat versucht, telefonisch zu Ihnen durchzukommen, aber es war immer besetzt.«
Kramer legte den Hörer auf die Gabel zurück. »Welcher Art? Schwarz gegen Schwarz?«
»Ein weißer Boss – die Leiche ist eben erst gefunden worden.«
»Wo?«
»Gillespie Street.«
Meerkat sah, wie Kramer sein Jackett nahm und zur Tür schlurfte. »Moment mal, Lieutenant!«
»Was gibts, alter Freund?«
»Was wird denn aus mir?«
»Das«, sagte Kramer, schon mit Zondi auf dem Weg nach draußen, »ist eine Frage, die du dir selbst stellen solltest.«
Der Verkehr war für einen Mittwoch sehr zäh, und Zondi kam nur langsam voran. Sie fuhren zwei Häuserblocks weiter, ohne miteinander zu reden, jeder in eigene Überlegungen darüber vertieft, was sie in der Gillespie Street wohl erwartete. Dann hielt der Chevrolet vor einer roten Ampel.
»Übrigens«, knurrte Kramer. »Wie steht die Sache mit dem Clown, der in Mama Bhengus Bordell niedergestochen wurde?«
»Nicht so gut, Boss. Ich habe die Mordwaffe gefunden, aber das wärs auch schon. Es war ein geschärftes altes Sägeblatt.«
»Hm. Zumindest ein Anfang. Ich habe überhaupt noch nichts.« Zondi schnalzte mit der Zunge und schüttelte mitfühlend den Kopf. »Vielleicht sollte ich noch einmal zu Boss Bradshaws Haus gehen und mich gründlicher mit der Dienerschaft unterhalten.«
»Zeitverschwendung.«
»Und mit dem Kaliber lässt sich auch nichts anfangen?«
»Ebenfalls Zeitverschwendung. Und weißt du, was der einzige Schmutzfleck ist, den ich bisher an Bradshaw gefunden habe? Dass er einmal eine alte Dame um ein paar Goldmünzen gebracht hat, aber ihr Sohn hat es gemerkt, und Bradshaw hat dafür bezahlt. Toll, was? Nenn mir mal einen Antiquitätenhändler, der nicht von Zeit zu Zeit mit solchen kleinen Tricks arbeitet.«
Die Ampel sprang um, und sie fuhren an. »Was ist denn mit dem Silber, dessen Spur von den Kollegen vom Einbruch bis in seinen Laden zurückverfolgt worden ist, Boss?«
»Dafür hatte er eine plausible Erklärung, wie mir gesagt wurde, sodass sie keine Anzeige erstattet haben. Täusch dich nicht, Mickey, dieser Bradshaw ist ein harter Brocken. Eine Menge Leute in der Stadt halten ihn für einen brutalen Schläger und Mistkerl, aber keiner wüsste, warum jemand ihn umbringen wollte.«
»Und?«
»Und so komme ich wieder auf die Idee des Colonels zurück, dass der Täter einfach irgendein Verrückter war, der sich ausgerechnet Bradshaw als Tontaube ausgesucht hat. Sag du mir mal, welche Theorie sonst noch infrage käme.«
»Vielleicht versucht der gleiche Mann es noch einmal.«
Kramer schnaubte. »Himmel, sei doch nicht so herzlos! Habe ich nicht schon genug am Hals mit dieser neuen Sache? Nein, es war ein Verrückter, da bin ich sicher, und der Blitz schlägt nicht zweimal an der gleichen Stelle ein.«
»Boss Bradshaw ist ein hoher Baum«, sagte Zondi bedächtig, »und bei meinen Leuten gibt es ein Sprichwort.«
»Quatsch«, unterbrach ihn Kramer, »du erfindest das doch nur!«
Sie lachten beide, dann spähten sie über die Autos vor ihnen hinweg und suchten eine Abkürzung zur Gillespie Street. Dies war fast immer ein spannender Moment, dachte Kramer, so ähnlich wie beim Rendezvous mit einer Unbekannten. Die gleiche heikle Angelegenheit, aber vielleicht war er bloß abgestumpft, denn es war lange her, seit ein Körper seinen Erwartungen entsprochen hatte.
»Den müssen Sie sich anschauen, verflucht noch mal!«, schwärmte Sergeant Bangbang Bronkhorst, der vor Gericht schwören konnte, dass er Gefangene nicht ein einziges Mal schlug, weil er immer zweimal zuschlug. »Yirra, Lieutenant, der ist wirklich ekelhaft – könnte eine Hyäne zum Kotzen bringen.«
»Ich finde, Sie sehen ganz normal aus, Bangbang.«
»Bitte? Aber wie gesagt, dieser Kerl ist von oben bis unten eingekotet, fingerdick mit Blut bedeckt und hat ein großes Loch – so groß wie meine Faust! – im Hinterkopf.«
»Hm. Wo ist er denn?«
»Teufel auch, ich habe keine Ahnung, Lieutenant! Ich bin eigentlich nur stellvertretend hier, weil Fritz ausgerastet ist und den guten alten Willem in den Hintern gebissen hat, und es ging drunter und drüber, bis mich das Hauptquartier in meinem Wagen angefunkt hat.«
Kramer runzelte die Stirn. Er wusste nichts von dem Polizeihund, geschweige denn, dass er Fritz hieß, und sein Vertrauen in die Fähigkeiten seiner Kollegen bekam einen Knacks. Er ging in Richtung des grünen Rovers, der auf der anderen Seite der Gillespie Street parkte, aber Bangbang fasste ihn am Arm.
»Hat das nicht noch ’ne Minute Zeit, Sir? Ich dachte, Sie möchten vielleicht erst mal diesen Zeugen anhören. Er wird gleich ins Krankenhaus gebracht.«
»Was ist denn mit ihm?«
»Schwerer Schock, Lieutenant.«
»Nicht schon wieder«, murmelte Kramer und schüttelte die Hand ab, die ihn zurückhalten wollte. »Na schön. Wo ist er?«
Sie gingen hinter der Menschenansammlung entlang und betraten die kleine Autowerkstatt an der Tankstelle, wo ein glatzköpfiger, rotwangiger, etwa fünfzigjähriger Mann in verdrecktem Overall auf einem umgedrehten Ölfass saß. Neben ihm standen ein Angebertyp mit dickem Schnurrbart, ein weiterer Mechaniker, der noch ganz jung war und etwas Gemeines um die Augen hatte, und eine dümmlich dreinblickende junge Frau von ungefähr achtzehn Jahren. Der Sitzende summte vor sich hin.
»Sehen Sie, was ich mit ›schwerem Schock‹ gemeint habe?«, flüsterte Bangbang. »Er heißt Stephenson.«
»CID. Mr Stephenson – Lieutenant Kramer vom Morddezernat.«
»Hier sind Sie richtig!«, sagte der Angeber. »Übrigens, mein Name ist Sam Collins, dies hier ist mein Betrieb. Droopy – äh – Mr Stephenson ist der Mechaniker, dem ich den Auftrag gegeben habe, und er war es, der sie gefunden hat, müssen Sie wissen. Die Leiche.«
»Dein Bild wird in allen Zeitungen sein, Droopy!«, kicherte das Mädchen.
»Weiß ich«, brummte Stephenson. »Damit werde ich berühmt. Es ist ein Wunder.« Und er fing wieder an, vor sich hin zu summen.
»Können Sie mir sagen, was genau passiert ist?«, fragte Kramer Stephenson.
»Ganz einfach«, sagte Collins. »Ich war eben draußen und hab die Zapfsäulen kontrolliert, als eine Dame zu mir kommt und sagt, sie wäre gerade im Supermarkt gewesen, und jetzt könnte sie ihren Kofferraum nicht aufkriegen. Sie kennen doch den Supermarkt dahinten?«
»Natürlich kennt ihn der Lieutenant«, sagte Bangbang scharf. »Er ist schließlich vom CID!«
»Regen Sie sich ab, ja? Ich will doch nur helfen! Also hab ich zu Mr Stephenson hier gesagt: ›Sieh dir die Sache mal an, Droopy‹, und kaum drehe ich mich um, ist die Dame auch schon auf und davon. Ehrlich gesagt, hab ich mir gleich gedacht, dass ihr Benehmen irgendwie verdächtig ist. Hab ichs dir nicht sogar gesagt, Doreen, dass sie mir verdächtig vorkam?«
»Ich – na ja, ich weiß es nicht mehr, Mr Collins.«
Collins tätschelte ihr die Schulter und blickte Kramer mitfühlend an. »Sie ist in einer schrecklichen Verfassung, die arme Doreen«, sagte er. »Schrecklich.«
»Hm. Verstehe ich Sie recht: Sie haben keine Ahnung, wer die Frau war? War sie keine Kundin von Ihnen?«
»Mit einem Rover?«, fiel der andere Mechaniker jetzt verächtlich ein. »Sehen Sie nicht, dass wir nur alte Mühlen hier stehen haben?«
»Wir haben auch schon mal Landrover«, bemerkte Collins verärgert.
»Das stimmt«, bestätigte Bangbang.
»Heiliger Himmel«, sagte Kramer.
Einen Augenblick wurde es ganz still, während Stephenson mit einem leeren Lächeln zu ihm aufschaute. »Der Name der Frau ist Lillian Digby-Smith«, sagte er. »Das steht auf dem Lederding an ihrem Schlüsselbund.« Er kramte den Schlüsselbund aus seiner Tasche hervor.
»Ein Beweisstück!«, sagte Bangbang. »Geben Sie schon her, Mann.«
Kramer fing ihn an seiner Stelle auf, überprüfte den Namen auf dem Anhänger und steckte den Schlüssel zu seinen Papiertaschentüchern. »Können Sie mir Mrs Digby-Smith beschreiben?«
»Groß und dünn mit roten Lippen«, sagte Stephenson.
»Jung? Alt? Mittel?«
»Ah, eher älter.«
»Haar?«
»Weißes Haar. Sie sagte, sie hätte einen Termin beim Friseur.«
»Sonst noch etwas?«
»Nein, eigentlich nicht.« Und er verfiel wieder ins Summen.
Kramer wandte sich der dümmlich aussehenden jungen Frau zu, der die tröstende Aufmerksamkeit ihres Chefs unangenehm war. »Wie viele Friseurläden gibt es hier in der Nähe? Können Sie eine Liste aufstellen und diesem Sergeant geben?«
»Nun – äh – ja, ich glaube schon.«
»Gut. Wenn die junge Dame das gemacht hat, Sergeant, wünsche ich, dass Sie eine Fahndung organisieren.«
»Gern, Lieutenant«, sagte Bangbang wichtigtuerisch. »Überlassen Sie das getrost mir, Sir!«
Kramer dankte Stephenson für seine Hilfe, wofür er mit einem sonnigen Lächeln bedacht wurde, und ging, um einen Blick auf den Toten zu werfen, wobei er die seltsame Hinhaltetaktik von Bangbang Bronkhorst einfach ignorierte. Die neugierige Menschenmenge, darunter eine alte Frau mit Puppe, machte ihm bereitwillig Platz.
»Verfluchter Bronkhorst«, murmelte ein junger Constable, der sich abmühte, den Kofferraum zu öffnen. »Musstest du ihn denn so fest wieder schließen, du verdammter Hund – hallo, Sir!«
Kramer sah gleich, dass das arg mitgenommene Schloss wahrscheinlich Probleme machen würde. Er trat einen Schritt näher, hob den rechten Fuß, trat zu und sprengte den Kofferraum mit einem geübten Tritt auf. Sofort scharte sich eine Gruppe Uniformierter darum, um den Inhalt von den Blicken der Umstehenden abzuschirmen, und er beugte sich vor, um hineinzuspähen.
Zuerst sah die Leiche so aus wie andere auch – natürlich auf ihre eigene Weise atemberaubend, aber nichts Besonderes, und er war durch seine verstopfte Nase im Vorteil. Dann sah er, dass sie seine Erwartungen weit übertraf. Er sah, dass die Armknochen durch einen Knoten gebrochen waren, den ein hünenhafter Mann festgezogen haben musste, ein menschlicher Gorilla – im Grunde die gleiche Art Monster, von der auch Archie Bradshaw gesprochen hatte.
Schaudernd schloss Kramer den Kofferraum, überlegte einen Augenblick und ging, um Zondi Bericht zu erstatten.
3
Nach hektischen zwanzig Minuten Jagd durch alle Friseursalons in Gehweite von der Gillespie Street wurde Mrs Lillian Digby-Smith schließlich im Jonty’s, einem High-Society-Schönheitssalon mit breit gefächertem Angebot an kosmetischen Behandlungen, aufgespürt. Es hieß, dass sich einmal eine Tarantel dort hinein verirrt hätte und drei Stunden später mit bläulicher Haarfarbe, achterlei Lidschatten und Beinen wie Betty Grable wieder hervorgekommen sei. Außerdem erzählte man sich, dass die Ehemänner eines Großteils der feinen Gesellschaft von Trekkersburg die Rechnung dafür bekommen und ohne Einwände dankbar beglichen hätten.
Kramer genoss das Gefühl des lila Hochflorteppichbodens unter den Füßen, den Anblick der kultivierten Püppchen, die dort arbeiteten, und den aphrodisisch wirkenden Duft von heißem Haar und Henna. Besonders gefiel ihm, wie eine kleine Rothaarige mit kornblumenblauen Augen ihn mit verstohlener Anerkennung in einem Spiegel musterte. Jonty war allerdings nicht ganz nach seinem Geschmack.
Der Geschäftsinhaber segelte herbei. »Sie sind also der reizende Lieutenant, auf den wir alle gewartet haben? Super.« Und er hob das Chiffontuch um seinen Hals kokett mit dem Handrücken hoch.
»Hör mal, Kuschelbärchen, wo ist die Dame?«, fragte Kramer.
»Hören Sie«, lispelte Jonty und beugte sich nah zu ihm herüber, »noch so eine Entgleisung, Sie Mistkerl, und Sie kriegen meine Knie in die Eier.« Dann deutete er mit anmutiger Geste auf die hinterste Reihe der mit Vorhängen abgeteilten Kabinen. »Da drin, die Ärmste – ich hoffe wirklich, es ist nichts Ernstes!«
Kramer setzte grinsend seinen Weg fort. Er hatte eine Spur von Herzlosigkeit bei Jonty bemerkt, die ihm zusagte. Zwei uniformierte Sergeants traten aus der vorletzten Kabine und begrüßten ihn mit nervösem Nicken.
»Sie haben noch nicht mit ihr gesprochen?«, fragte Kramer.
»Nein, Sir«, flüsterten sie unisono.
»Gut. Wissen Sie was, lassen Sie sich eine Haarwäsche oder so was verpassen, aber bleiben Sie in der Nähe.«
In der Kabine lag Mrs Digby-Smith auf einer niedrigen Liege und blätterte in einer Ausgabe der Vogue, um sich zu zerstreuen. Sie verzog keine Miene, als sie hörte, dass die Leiche eines Mannes im Kofferraum ihres Wagens gefunden worden sei. Sie setzte sich auf, aber das war auch alles. Erst als Kramer hinzufügte, dass es sich um die Leiche eines Mannes Ende fünfzig mit welligem grauem Haar und einem großen braunen Muttermal hinter dem rechten Ohr handelte, erschienen nach und nach feine Risse in der Wachsmaske auf ihrem Gesicht.
»Um es kurz zu machen, gnä’ Frau«, fuhr Kramer fort, »kennen Sie eine solche Person – oder wissen Sie, wie sie dort hineingekommen ist?«
»Wer?«
Kramer wiederholte die Personenbeschreibung, die nicht sehr detailliert war, da der Kreisarzt den Toten erst so sehen sollte, wie er vorgefunden war, bevor jemand irgendetwas berührte. »Ach ja, und er hat beigefarbene Hosen, Sandalen und ein Sporthemd mit einem ungewöhnlichen Markennamen darauf an. Moment mal … St. Michael.«
»Großer Gott …«
Kramer wartete. Er wartete seinem Empfinden nach sehr lange. »Kennen Sie diesen Mann?«, fragte er schließlich.
Mrs Digby-Smith gab immer noch keine Antwort. Dann begann sie zu weinen – nicht schluchzend, sondern lautlos. Ihre großen grauen Augen hefteten sich starr auf den lila Vorhang hinter ihm, wurden nass und liefen über. Kramer hatte so etwas schon öfter erlebt. Aus irgendeinem Grund war ihm in diesem Leben das Los zugefallen, einer nicht unbeträchtlichen Zahl von Frauen Hiobsbotschaften zu überbringen. Natürlich verhielt es sich jedes Mal ein bisschen anders, und so war auch dieses Mal. Die Tränen füllten normalerweise das Unterlid, quollen darüber und rollten langsam die Wangen hinab, um dann unterhalb des Kinns zu verschwinden. Diese Tränen jedoch sammelten sich im Unterlid, rollten heraus, sausten über das gelbe Wachs und hinterließen ein Tropfenmuster auf dem hellgrünen Kittel, der ihre Kleidung schützte.
Mrs Digby-Smith regnete.
»Hören Sie, gnä’ Frau«, sagte Kramer und setzte sich auf den Hocker neben der Liege. »Ich weiß, dass es nicht gerade angenehm für Sie ist, aber falls Sie die Identität des –«
»Nein!«
»Nein was? Nein, Sie wissen nicht, wie er heißt?«
Die Augen starrten weiter. Sie wurden trocken und fingen an zu glänzen. Der Mund, von Lippenstift befreit und blutlos, bildete eine verkniffene unregelmäßige Linie wie eine alt gewordene Blinddarmnarbe in dem Loch, das wachsfrei geblieben war. Er sah jedenfalls nicht danach aus, als würde er sich plötzlich wieder öffnen.
Kramer schaute sich um. Auf dem kleinen Schränkchen am Kopfende der Liege bemerkte er einen Block Luftpostpapier, ein Paket Luftpostumschläge, einen halben Brief und einen kleinen Stapel Farbfotos, die auf der Rückseite beschriftet waren. Auf das oberste Foto war mit Kugelschreiber gekritzelt: Bonzo und ich im Wildreservat – das ist Jacks Schatten! Er drehte es um und sah, dass Jack, der angedeutete Schatten im Vordergrund, der Fotograf gewesen war. Vor der Hütte einer Ferienanlage in Zululand stand ein Paar und blinzelte in die Sonne. Die Person links war groß, dünn und weißhaarig, und er erkannte in ihr sofort die kerzengerade vor ihm sitzende Frau wieder. Die Person rechts war ein Mann Ende fünfzig mit welligem, grauem Haar, dem bewussten Hemd der Marke St. Michael und nagelneuen Ledersandalen. Das Bild ließ nur einen Schluss zu, aber Kramer nahm es erst noch einmal genauer unter die Lupe, ehe er es wieder auf das Schränkchen zu den anderen legte. Dann bestand jedoch kein Zweifel mehr für ihn, denn die Gesichtszüge des Paares hatten zu viel Ähnlichkeit miteinander, als dass es Zufall hätte sein können.
»Ich weiß, wer der Tote ist«, sagte er.
Ihr flackernder Blick zuckte hinüber zu ihm.
»Er heißt Bonzo, gnä’ Frau, und er ist Ihr kleiner Bruder.«
Mrs Digby-Smith sagte nichts. Sie fiel in Ohnmacht. Sie schwankte und stürzte von der anderen Seite der Liege, so plötzlich, dass Kramer sie nicht mehr auffangen konnte. Ihre Maske aus gelbem Wachs zersprang auf dem Fliesenboden in Stücke wie Eierschale, und dann fiel ihre obere Zahnprothese heraus.
»Verdammt noch mal«, sagte Kramer. »Und das, wo wir uns gerade erst kennengelernt haben.«
Im Haus des Kreisarztes klingelte erneut das Telefon. Anneline Strydom seufzte und hob ab, denn sie ahnte schon, wer am anderen Ende der Leitung war, und hatte auch gleich sein Bild vor Augen: ein großer, breitschultriger Mann mit hellem Haar, hohen Wangenknochen, leicht vorstehenden Schneidezähnen und Augen wie grüne Murmeln, vor allem aber mit riesigen Löwenpranken, die ihr Schauer über den Rücken jagten.
»Nun hören Sie mir mal zu, Trompie«, sagte sie bestimmt, denn sie ahnte auch, in welcher Stimmung der Anrufer war, »es hat gar keinen Zweck, mich so unter Beschuss zu nehmen, wenn Chris noch nicht angekommen ist. Ich habe ihm Ihre Nachricht übermittelt – mehr kann ich doch nicht tun!«
»Äh, ich bins, Mrs S. – nicht Lieutenant Kramer.«
»Sergeant Van Rensburg?«
»Genau, Mrs S.«
Sogleich hatte sie das Bild eines Leichenhallenbediensteten vor sich, der so unglaublich übergewichtig war, dass er die Finger nicht mehr in die engen Hosentaschen quetschen konnte. »Erzählen Sie mir bloß nicht, dass noch jemand reingekommen ist!«, rief Anneline ärgerlich. »Mein armer Mann nimmt sich wahrhaftig nicht oft vormittags frei!«
»Teufel auch, wir wissen doch alle, wie ernst er seine Arbeit nimmt«, sagte Van Rensburg pathetisch. »Ich wollte dem Doc ja auch nur – falls er noch nicht weg ist – den Weg in die Gillespie Street ersparen. Es ist nämlich beschlossen worden, die ganze Bescherung herzubringen, wissen Sie, zur Leichenhalle, und infolgedessen habe ich jetzt den Wagen mit der noch intakten Leiche im Hof.«
»Was?«
»Ja, sie haben ihn hergeschleppt.«
»Na schön, ich werde mal nachsehen gehen, ob Dr. Strydom irgendwo zu finden ist, obwohl ich es bezweifle. Es ist doch wohl ein Weißer, um den Lieutenant Kramer all das Theater macht, oder?«
»Selbstverständlich, Mrs S.«
»Dann ist es gut. Adieu.«
Anneline wusste genau, dass ihr Mann noch draußen im Garten war und mit Josiah, dem Gärtner, nach Schnecken suchte. Aber weil er sich nur selten für etwas anderes als eine Leichenöffnung interessierte, mochte sie ihn nicht stören, und so ließ sie die Sache weitere zehn Minuten auf sich beruhen. Dann ging sie aus Sorge, er könnte sich unbemerkt davonmachen, ohne den neuen Stand der Dinge zu kennen, hinaus, um ihn zu rufen.
»Chris?« Er war verschwunden. »Chrissie – wo steckst du denn, Mann?«
Schließlich fand sie ihren Gatten nebst Gärtner Josiah weit hinten im Garten hinter ein paar großen Azaleenbüschen. Sie wirkten wie Kinder und nicht wie erwachsene Männer, wie sie da so nebeneinanderhockten und mit großer Aufmerksamkeit im Inhalt einer großen Glasschale herumstocherten. Anneline sah mit Erstaunen, dass dieser Inhalt aus Hunderten von ekelhaften Schnecken bestand, mit Salatblättern vermengt.
»Gütiger Himmel«, rief sie. »Du willst dieses Zeug doch wohl nicht essen?«
»Hau!«, sagte Josiah und musste auf einmal lachen.
»Nein, nein, was wir machen, ist rein wissenschaftlich«, erwiderte ihr Mann munter. »Bei dieser Schnecke handelt es sich um Helix –«
»Du musst es doch nicht übertreiben mit der Wissenschaftlichkeit, Mann! Und warum benutzt ihr meine beste Salatschüssel? Ihr hättet einfach nur Salz in einen Eimer Wasser zu streuen brauchen. Das bringt sie nämlich garantiert um. Van hat gerade angerufen, ich soll dir sagen –«
»Ich komme! Ich komme ja schon! Ich wollte nur Josiah zeigen, wie man es macht.«
»Wie man das macht?«
»Gewiss. Wir bereiten einen Extrakt zu.«
»Was? Wofür denn das?« Und sie lachte wie ein Backfisch.
Er sagte ihr aber nicht, wofür, denn er war beleidigt. Er stapfte über den Rasen davon, einen Hemdzipfel aus der Hose, den weißen Haarschopf verwuschelt, und murmelte düster vor sich hin. Nur gut, dachte Anneline Strydom, dass die Person, zu der er unterwegs ist, keine rücksichtsvolle ärztliche Behandlung mehr nötig hat.
Namen wie Digby-Smith hatten Kramer immer irritiert. Sie klangen nach Englisch sprechenden Snobs mit Pferdemist unter den Fingernägeln, und es gab – außer zugedröhnten, mit Alkohol vollgepumpten, geschlechtskranken Mischlingen – keinen Menschenschlag, dem er mehr misstraute. Allerdings musste er einräumen, dass der Name Digby-Bindestrich-Smith unzweifelhaft einen Vorzug hatte. Er stand nur zweimal im Trekkersburger Telefonbuch. Und was die Sache noch einfacher machte, war, dass ein Eintrag als privat und der andere als geschäftlich gekennzeichnet war.
»Tut mir leid«, erwiderte die Sekretärin auf seine telefonische Anfrage, »aber Mr Digby-Smith ist im Augenblick unterwegs und besichtigt mit einem Klienten ein Grundstück. Darf ich Sie mit seinem Juniorpartner, Mr Wells, verbinden?«
Kramer sank in sich zusammen. »Ach nein, das würde mir nicht viel weiterhelfen«, sagte er. »Aber könnten Sie vielleicht zweierlei für mich tun? Ihren Chef, sobald er zurückkommt, bitten, zu Jonty’s zu kommen – Sie wissen doch, diesem Schönheitssalon?«
»Ähäh, ja … Sie sagten, Polizei?«
»CID, Kripo. Und würden Sie mir außerdem bitte noch die Telefonnummer des Hausarztes der Familie durchgeben?«
»Das ist Dr. Crickmay. Aber was um Himmels willen –?«
»Später«, sagte Kramer und legte auf.
Er fand Dr. Crickmays Nummer und wählte sie. Für eine Arztpraxis dauerte das Klingeln unverzeihlich lange. Während er darauf wartete, dass jemand abhob, sah er sich in Jontys Privatbüro um und konnte sich nicht entscheiden, ob er es nun verflucht modern oder verflucht einfach und bodenständig nennen sollte. Der Fußboden bestand aus nackten Holzdielen, die Wände waren einfach weiß, Pult und zwei Stühle waren normal, der Kalender ein Werbegeschenk, und das wars auch schon – bis auf einen riesigen Familienkühlschrank in der gegenüberliegenden Ecke des Raums, der erstaunlich fehl am Platz wirkte. Verflucht modern, urteilte er schließlich.
Jonty kam leise ins Zimmer und schloss die Tür. »Hatten Sie schon Glück bei dem Arzt? Sie ist noch immer nicht ganz da, wissen Sie. Brabbelt irgendwelches Zeug über Bonzo, und dann verdreht sie wieder die Augen.«
»Den versuche ich gerade zu erreichen, er scheint bloß nicht – oh, hallo, CID. Dr. Crickmay zu sprechen?«
»Tut mir leid, aber der Doktor macht gerade seine morgendlichen Hausbesuche«, sagte die Sprechstundenhilfe.
»Mist.«
»Ist es dringend? Dann könnte ich den Doktor nämlich per Pieper rufen und vom nächsten Telefon aus anrufen lassen.«
»Ideal«, sagte Kramer und gab ihr die Nummer des Salons durch.
Jonty wartete, bis der Hörer wieder auf der Gabel lag, ehe er fragte: »Was ist eigentlich los? Haben Sie ihr irgendwelche schlechten Nachrichten gebracht?«
»Ja, ziemlich schlecht.«
»Von ihrem Bruder?«
»Wie kommen Sie darauf?«
»Na ja, nach dem zu urteilen, was sie vor sich hinmurmelt, nehme ich mal an, Mr – äh …«
»Kramer – Lieutenant Tromp Kramer, Kripo, Abteilung Raub und Mord.«
»Raub? Jontys buschige Augenbrauen schossen in die Höhe. »Armer Kerl! Und wo? Hier in der Stadt? Heute Morgen?«
Kramer wollte die Sache schon richtigstellen, als ihm einfiel, dass der Salonbesitzer vielleicht mehr nützen könnte, solange er auf der falschen Fährte war. Ein Mord war im Allgemeinen eine unangenehme und sehr persönliche Angelegenheit, in die sich andere Leute nicht gern hineinziehen ließen. Dagegen wurde ein Raub eher als höhere Gewalt angesehen, sodass sich niemand scheute, jedem Interessierten alles mitzuteilen, was er über die Lebensumstände des Ausgeraubten wusste.
Also sagte er nur: »Bonzo ist vor etwa einer Stunde auf der Gillespie Street gefunden worden. Sie reden von ihm, als wenn Sie mit ihm bekannt wären.«
»Mir ist nur einiges von ihm bekannt«, sagte Jonty. »Wie Sie sich vorstellen können, sind wir immer auf dem Laufenden über unsere Kunden und ihre Angelegenheiten – sie selbst bestehen darauf, uns damit zu langweilen, und ihre besten Freunde pflegen dann noch die Klatschgeschichten hinzuzufügen. Bisweilen ist es kaum zu ertragen, aber so ist es nun einmal, wir sind schließlich im Egobusiness.«
»Hm.«
»Und da habe ich natürlich eine ganze Menge von ihm aufgeschnappt: Bonzo alias Edward Hookham, Flieger mit Orden und Ehrenzeichen – da fällt mir was ein!« Jonty riss die Kühlschränke auf, und da standen etwa zehn Dutzend Dosen kühles Bier. »Welche Sorte, Lieutenant? Ein Lager?«
»Ja, bitte«, sagte Kramer und fühlte sich plötzlich wohl, denn er war ein Mann, der Einfaches und Bodenständiges mochte. »Ohne Glas, wenns recht ist.«
Während Jonty die Dosen herausholte, nutzte Kramer die Gelegenheit zu einer schnellen Neueinschätzung. Er sah jetzt, dass der Saloneigentümer trotz seines Aufzugs – dem breiten Ledergürtel, dem bestickten Hemd und den rosa Jeans – ein ziemlich normaler Mensch war und kein bisschen pervers. Er war um die fünfunddreißig und überdurchschnittlich gut gebaut. Sein Gesicht hätte einem Bulldozerfahrer Ehre gemacht, vorausgesetzt, es wurde etwas an den goldenen Ringelchen geändert. Eine Kleinigkeit wirkte allerdings noch etwas befremdend, und das war sein Akzent.
»Gut, dann mal runter damit«, sagte Jonty und reichte ihm das Lagerbier. »Wo waren wir stehen geblieben?«
»Sie wollten mir gerade etwas von diesem Bonzo erzählen.«
»Eine alte Trekkersburger Familie, die Hookhams. Müssen schon Südafrikaner der zweiten oder dritten Generation gewesen sein, als unsere Lillian geboren wurde und ein paar Jahre später Bonzo. Ihr Papa war im Sämereigeschäft.«
»Ah ja, Hookham & Bailey am Marktplatz.«
»Richtig. Lillian hat Geld geheiratet – Digby-Smith spielt im Grunde nur den Immobilienmakler –, und Bonzo ist nach England abgedampft und bei Kriegsbeginn zur Royal Air Force gegangen. Er war bei einem Bombergeschwader, daher hat er wohl auch seinen Spitznamen Bonzo, der bis heute an ihm kleben geblieben ist. Und dann hat er das Gegenteil von mir gemacht.«
Kramer sah ihn fragend an.
»Das ist so«, erklärte Jonty. »Ich bin letzten März vor fünf Jahren aus Southampton hergekommen – ich bin ein Einwanderer.«
»Aha, hatte ich mir schon fast gedacht.«
»Und Bonzo hat es genau andersherum gemacht. Als der Krieg zu Ende war, ist er in England geblieben, hat eine Engländerin geheiratet und ein kleines Elektronikunternehmen aufgebaut. Seine Frau ist vor zwei Monaten gestorben.«
»Ach ja?«
»An Krebs. Da war er ganz allein, die Kinder waren alle aus dem Haus, und er hat beschlossen, trotzdem die für seinen Ruhestand geplanten Ferien zu genießen, indem er seine Schwester hier besuchte. Seine ersten richtigen Ferien, hat sie mir gesagt.«
»Wann ist er denn angekommen?«, fragte Kramer.
»In Trekkersburg? Na ja, ich würde sagen, vor etwa drei Kosmetiksitzungen. Ja, stimmt, sie haben ihn letzte Woche zum Hluhluwe-Wildreservat mitgenommen, angekommen sein muss er also –«
»– Anfang des Monats.«
»Genau.«
Kramer beobachtete Jonty dabei, wie er die Bierdose in einem Zug leerte. »Und jetzt etwas vom Klatsch, ja?«
»Über die Digby-Smith?«
»Genau.«
Jonty lachte. »Sie machen wohl Witze! Die beiden? Die sind nicht nur aus dem Alter raus, sondern, wie ich glaube, überhaupt nie so gewesen!«
»Nun mal los.«
»Keine Kinder, keine Hunde, sechs Diener und ein Haus von der Größe eines Hotels. Alles geregelt bei ihnen. Jahraus, jahrein tun sie immer das Gleiche. Sie haben keine Sorgen, sind nur darauf bedacht, dass alle ihre Stellung anerkennen, auf Cocktailpartys nett zu ihnen sind und der alten Schraube sagen, wie gepflegt sie ist.«
»Klingt ja ganz schön bitter, mein Freund.«
»Tatsächlich?« Jonty musste wieder lachen und ging zum Kühlschrank, um die nächsten zwei Dosen Lager zu holen. »Bin ich eigentlich gar nicht. Ich gebe mich schon seit Jahren mit ihresgleichen ab, und bisher ist immer was für mich dabei rausgesprungen.«
Das Telefon klingelte. Kramer nahm das Gespräch entgegen. Dr. Crickmay versprach, in zehn Minuten beim Jonty’s zu sein.
»Es gibt also absolut keinen Klatsch über die Digby-Smiths?«
»Himmel, nein!«, schnaubte Jonty. »Das würde sie umbringen!«