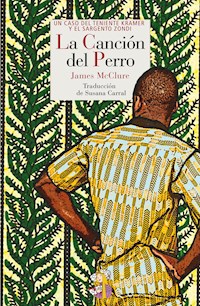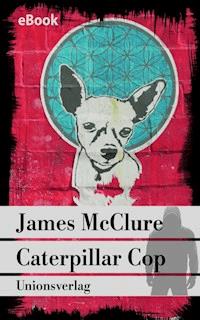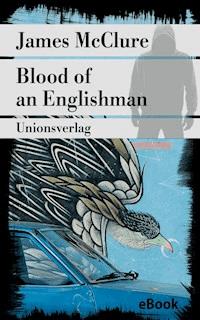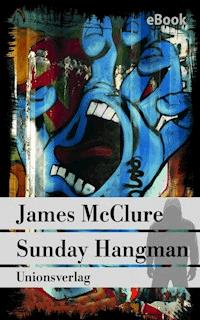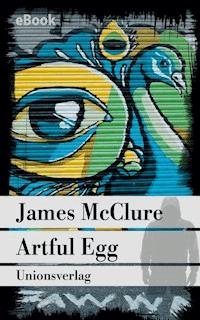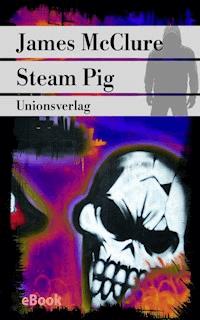
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Alles beginnt mit einer folgenreichen Verwechslung. Aus Versehen kommt die verstorbene weiße Musiklehrerin Theresa Le Roux anstatt ins Krematorium auf den Obduktionstisch. Das Ergebnis: Von einem natürlichen Tod kann keine Rede sein, die junge Frau war ermordet worden. Lieutenant Tromp Kramer übernimmt zusammen mit Sergeant Michael Zondi die Untersuchung. Gab Theresa in ihrem Städtchen wirklich nur harmlose Musikstunden? Die Ermittlungen decken eine Tragödie auf, wie sie sich nur in Südafrika unter dem Apartheid-Regime ereignen konnte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Über dieses Buch
Aus Versehen kommt die verstorbene weiße Musiklehrerin Theresa Le Roux auf den Obduktionstisch. Das Ergebnis: Es war kein natürlicher Tod, die Frau wurde ermordet. Lieutenant Kramer und Sergeant Zondi übernehmen die Untersuchung. Bald decken sie eine Tragödie auf, wie sie sich nur im Südafrika der Apartheid ereignen konnte.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
James McClure (1936–2006) lebte in Südafrika, bis er 1965 nach England zog. Seine Krimiserie rund um das Ermittlerduo Kramer und Zondi schildert die Jahre der Apartheid. Steam Pig wurde 1971 mit dem CWA Gold Dagger ausgezeichnet.
Zur Webseite von James McClure.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
James McClure
Steam Pig
Südafrika-Thriller
Aus dem Englischen von Sigrid Gent
Kramer & Zondi ermitteln (2)
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 1 Dokument
Die Originalausgabe erschien 1971 unter dem Titel The Steam Pig im Verlag Victor Gollancz Ltd, London.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1975 unter dem TitelEin Sarg mit falscher Adresse im Scherz Verlag, Bern.
Für die vorliegende Ausgabe wurde die deutsche Übersetzung nach dem Original durchgesehen.
Originaltitel: The Steam Pig (1971)
© by The Estate of James McClure 1971
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: VONDETraumer/Shotshop.com
Umschlaggestaltung: Heike Ossenkop
ISBN 978-3-293-30956-2
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 26.07.2024, 17:29h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
STEAM PIG
1 – Für einen Leichenbestatter war George Henry Abbott ein …2 – Im Nebenraum schrie ein Verdächtiger. Nicht ununterbrochen …3 – Als er zurückkam, war immer noch kein Mensch …4 – Du siehst also«, fügte Kramer hinzu, »dass es …5 – Nach dem zweiten Mal wachte Kramer erschrocken und …6 – Kramer saß am Market Square am Steuer eines …7 – Der auffallende Chrysler war gegen Kramers Chevrolet …8 – Zondi hatte so seine Probleme. Gewöhnlich war ein …9 – Es war eine Wahnsinnsnacht10 – Unerwarteterweise brauchte Kramer nichts zu sagen. Van Niekerk …11 – Im Laufe der Jahre hatte Kramer schon die …12 – Der Colonel fühlte sich geschmeichelt13 – Das Trockengerät in einer Ecke des Fotolabors gab …14 – Die Tür ging vorsichtig auf. Der Colonel steckte …15 – Kramer hasste Partys. Partys aller Art. Und Cocktailpartys …16 – Ein Geständnis half der Seele sehr, der Anklage …Mehr über dieses Buch
Über James McClure
»Wenn meine Gedanken in Südafrika sind, höre ich immer Gelächter«
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von James McClure
Zum Thema Südafrika
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema Spannung
Zum Thema Afrika
Für Lory
1
Für einen Leichenbestatter war George Henry Abbott ein beklagenswerter Mensch. Er ließ zu, dass ihm seine Arbeit über den Kopf wuchs. Er ließ zu, dass sie ihn nachts wach hielt. Er machte Fehler.
Aber die Geschäfte liefen unverändert gut. Es war hilfreich, einen Namen zu haben, der das alphabetische Recht besaß, die Liste der Bestattungsunternehmer in den Gelben Seiten anzuführen. Und eine Telefonnummer wie 77 007 zu haben. Fünfstellig – keine große Stadt, selbst nach südafrikanischen Maßstäben, doch sowohl bevölkerungsreich als auch sterbefreudig genug, um Mr Abbott und seinen Konkurrenten nur wenig Zeit für die Morgenzeitung zu lassen.
Gleich nach dem Frühstück erhob er sich und öffnete die Kühlraumtür. Am Abend vorher hatte sich Farthing, sein junger Assistent, um die Morgenarbeit gekümmert und ihm die beiden auf der rechten Seite übrig gelassen. Seufzend bückte er sich und zog am untersten Schubfach. Es glitt geräuschlos heraus, bevor es mit einem leichten Ruck arretierte, der die Zehen erzittern ließ.
Mr Abbott merkte, dass ihm der Anblick der Zehen ein seltsames, angenehmes Kitzeln unter der Bauchdecke verursachte. Er konnte eine Menge an Zehen ablesen. Diese hier waren sehr gepflegt, fast durchgeistigt, eher einem Daumen ähnlich. Und sehr weiblich.
Mithilfe des pollockschen höhenverstellbaren Rollwagens schaffte er den Inhalt des Schubfachs zum Obduktionstisch. Zwei schnelle, geschickte Bewegungen entfernten das Laken, und mit einer dritten lag es gefaltet über seinem Arm.
Diesmal erwischte es Mr Abbott in der Magengrube. Das Mädchen hatte in der Blüte seines Lebens gestanden. Und falls es so etwas gab, stand es obendrein in der Blüte seines Todes.
Die bestürzende Schönheit der sterblichen Überreste bedrückte ihn nicht. Im Gegenteil, er war schon immer der Meinung gewesen, dass seine Kollegen heuchelten, wenn sie von sich behaupteten, dass kein Objekt ihrer mühseligen Arbeit sie anrühre.
Aber er hatte recht, hol sie der Teufel. Schaut sie euch doch an. Genau wie dieser Dichter gesagt hatte: Etwas Schönes war eine immerwährende Freude. Die vollkommene Figur, Knochen, die noch jahrelang gesund geblieben wären. Der Nabel, eine zierliche Mulde, war besonders delikat.
Seine Augen spürten nichts von der Kühle der straffen weißen Haut. Seine Fingerspitzen ergötzten sich an der krausen Festigkeit der pechschwarzen Behaarung. Ebenso wie die Zehen waren auch die Finger exquisit geformt und gut gepflegt. Nirgendwo eine Unreinheit oder ein Schönheitsfehler.
Das Gesicht hatte er sich bis zuletzt aufgespart. Gott sei Dank, ein junges Gesicht. Er hatte schon genug Überraschungen erlebt. Ein geschickter Griff schloss den Mund und ließ ihn gute Laune demonstrieren. Darüber eine kecke Nase und pfiffige, ungezupfte Augenbrauen. Die Augen mussten blau sein, denn die Haare waren blond, richtiges Aschblond. Ja, kein Zweifel. Wunderschön. Minuten verstrichen.
Dann packte ihn plötzlich ein unerwarteter Groll, und er ertappte sich bei dem Gedanken an seine Frau. Mrs Priscilla Abbott, früher einmal die Witwe des Chefs, die ihm erlaubt hatte, draußen seinen eigenen Namen anzubringen in der Erwartung, dies wäre ihnen ein Ansporn, bis an ihr Lebensende glücklich miteinander zu leben.
Das hätte er wohl auch gekonnt, wenn da solch ein Körper auf ihn gewartet und ihm auch nach einem späten Anruf noch die Unmutsfalten aus der Stirn gestrichen hätte. Ein drängender, Leben spendender Körper mit Schenkeln, die ihn selbst in Augenblicken der Ruhe erregten. Kein karottenhaariger Fettkloß, der sich nie rührte, nie einen Laut von sich gab, wenn er auf Zehenspitzen hereinkam, und der immer so kalte Füße hatte, dass ihre Berührung einen regelrechten Schock hervorrief und ihn entsetzlich aus dem Schlaf riss.
»George!« Sie füllte die Türöffnung aus.
Mit ein paar hastigen Bewegungen schaffte er es gerade noch, das Mädchen zuzudecken. Dann drehte er sich räuspernd um. »Das muss die für die Obduktion sein«, sagte Mrs Abbott. Räuspern.
»Dann lass Dr. Strydom ausnahmsweise mal seine Hausaufgaben selbst erledigen und mach die andere für drei Uhr fertig. Ich hatte gerade das Krematorium am Apparat, und sie sagen, es würde ein arbeitsreicher Nachmittag werden. Wir können uns nicht schon wieder verspäten.«
Räuspern.
»Ist ein Trinity-Auftrag – nun beeil dich schon!«, bellte Mrs Abbott und ging wieder, um das Büro zu besetzen.
Ihr Ehemann wandte sich dem anderen Schubfach zu.
Drei Uhr, und alles lief glatt. Glatt wie Opa auf Rädern, bemerkte Farthing.
Mr Abbott runzelte die Stirn, zum Teil, weil er immer ein ungutes Gefühl hatte, wenn keine Probleme auftauchten, die bestätigten, dass er bei den Vorkehrungen mitgewirkt hatte. Sorgfältig, Schritt für Schritt fing er an, die Vorgänge zu rekapitulieren.
Zunächst einmal, es war eine Arabella-Bestattung, alles inklusive für 128 Rand – oder 64 Pfund Sterling, wenn man mit einer der alten Familien verhandelte, die das Vereinigte Königreich immer noch »Heimat« nannten. Und Bilder der Königin besaßen, vorwiegend der Königin Victoria. Wie seine Gedanken abschweiften. Er würde sie mit bekannten Tatsachen in Schach halten.
Arabella war ein Codename, der den Angehörigen die zusätzliche Qual ersparen sollte, über Geld sprechen zu müssen. Sie spazierten nach Belieben im Ausstellungsraum herum und trafen ihre Wahl nach Karten, die in kleinen Ständern an jedem schimmernden Deckel lehnten: Arabella, Doris, Daphne, Carson. Die Namen hatte Mrs Abbott ausgewählt. Der Preis wurde dezent klein, aber in Rot genannt.
Nicht dass es in diesem Fall irgendjemanden gegeben hätte, der eine Auswahl treffen musste. Oder überhaupt ein Wunsch geäußert werden musste. Arabella, ein Kompromiss zwischen Doris (Sozialhilfeempfänger der Stadt) und Daphne (vornehm bescheiden), war die Standardausführung für Mitglieder der Trinity-Beerdigungsgesellschaft.
Es handelte sich in diesem Fall zwar nicht um eine Beerdigung, aber er hatte wieder recht. 20 Cents zusätzlich zur wöchentlichen Prämie sicherten die Einäscherung der einsamen alten Dame mit dieser ziemlich ausgefallenen Tätowierung, die nur wenige Männer gesehen haben konnten. Oder, Gott behüte, sehr viele.
Schaudernd verbannte Mr Abbott seinen nächsten Gedanken.
Zur gleichen Zeit leuchtete in der versteckten Kabine des Krematoriumsleiters ein rotes Licht am Pult auf. Sein rechter Zeigefinger, steif wie ein Stock, senkte sich auf den Knopf mit der Aufschrift »Orgelfinale«. Sein linker setzte das Fließband in Bewegung.
Die Fünfzehn-Uhr-Arabella, Reg.-Nr. A44/TBS setzte zu ihrem schwerfälligen Abgang zur Luke an. In letzter Sekunde teilte ein automatischer Auslöser die Samtvorhänge, und sie war verschwunden. Dann schepperte leise die Ofentür. Verschwunden für immer und ewig.
»Auch noch genauso alt wie ich«, murmelte Farthing, als die Musik abbrach.
Er fügte noch etwas hinzu, was Mr Abbott nicht verstehen konnte, da »Verweile bei mir« mit voller Lautstärke zum Bandanfang zurücklief. Aber was er gesagt hatte, war mehr als genug.
Reverend Wilfred Cooke, seltsam bedrückt, da er zu einer bis auf den Allmächtigen leeren Kapelle gesprochen hatte, stieg hinab und trocknete in Erwartung des Schecks seine rosa Handflächen.
Farthing wartete im Büro des Leiters, um ihn zu überreichen. Dann musste er sich um ein paar Tafeln für den Garten der Erinnerung kümmern. Maxwell & Flynn sollten um 15.30 Uhr wegen einer Sendung von der Gesellschaft da sein und würden ihn mit in die Stadt zurücknehmen.
Denn Mr Abbott war ganz plötzlich weggefahren. Der Leichenwagen hatte einmal über 90 km/h geschafft – das war in der Jacaranda Avenue.
Sah man von einer altehrwürdigen Nüchternheit ab, schien das Gebäude von Abbott & Marcus Ltd. kaum eine Empfehlung für die Firma zu sein. Hinter der groben Backsteinfassade mit ihren trüben blauen Fenstern und ihrer herbstlaubgoldenen Beschriftung, jenseits des braun und cremefarben gestrichenen Büros und Ausstellungsraums, befand sich jedoch eine Leichenhalle, mit der es nur wenige Privatunternehmen aufnehmen konnten.
Mit ihr hatte sich Franklin Marcus, der erste Leichenbestatter, der in die damalige Grenzstadt kam, einen Traum erfüllt. Nach anfänglichen kleinen Schwierigkeiten mit dem Zimmermann, der sich über den Verlust eines einträglichen Nebenerwerbs ärgerte, sicherte er sich am Vorabend des ersten Zulukrieges einen Vertrag mit dem Militär und war überaus erfolgreich. Seine Gewinne steckte er wieder in das Geschäft, indem er zwei Operationstische per Schiff kommen und die Wände seiner neuen Leichenhalle bis Schulterhöhe kacheln ließ. Anschließend kam ein großer Kühlraum hinzu, wodurch – wie er sagte – das Gebäude Platz genug für eine Armee bot.
In seinen Anfangszeiten hatte Mr Abbott die Marcus-Tradition fortgeführt, indem er eine ordentliche, schattenfreie Beleuchtung und drei Schränke mit Autopsieinstrumenten einführte. Obwohl die offenen Feindseligkeiten mit den Eingeborenen aufgehört hatten, war die äußerst unzulänglich ausgestattete staatliche Leichenhalle oftmals froh, dass ihr seine Einrichtung zur Verfügung stand. Obendrein hielt es der Staat für zweckdienlich, dass sich Mr Abbott nach der Obduktion um die Bestattungsriten kümmerte, und dies bedeutete einen ansehnlichen Vorschuss, zuzüglich Provision. Er war immer sehr zufrieden gewesen mit dieser Vereinbarung.
Bis zu Farthings Äußerung.
Mr Abbott bog durch das Hoftor ein und hielt auf der Rückseite neben dem Pontiac des Kreisarztes an. Der Teufel sollte diesen Mann holen – kam er denn nie zu spät? Die meisten Ärzte wurden gelegentlich durch Notrufe aufgehalten, nicht so Dr. Christiaan Strydom, der zugleich als Gerichtsmediziner fungierte. Seine Patienten standen entweder zu festgesetzten Zeiten wegen Reiseimpfungen an oder warteten, gleichmütig und ohne Eile, wenn es sein musste, bis in alle Ewigkeit.
Er ging auf die Leichenhalle zu. Das laute Knirschen des Kieses ließ ihn zusammenzucken, da es die würdelose Eile verriet, mit der er sich näherte.
In der Halle befand sich das Mädchen, das ihm den Tag verschönt hatte: die süße Unbekannte mit den süßen Rätseln, deren Geheimnisse er nie erfahren würde.
Und in der Halle war Dr. Strydom, der in ihr wie in einem Buch las: Brustkorb am Brustbein entlang geteilt und aufgeklappt, die Organe entfernt und wie Fußnoten fein säuberlich aneinandergereiht. Unbeeindruckt von dem Gestank, war er in sie vertieft wie ein Antiquar, der modrige Manuskripte nach etwas Bedeutungsvollem in der ewig gleichen Geschichte durchstöberte.
Nur dass es das falsche Buch war.
Er schlüpfte durch eine Seite der Doppeltüren mit ihren Buntglasfüllungen hinein, schloss sie sorgfältig hinter sich und bewegte sich langsam zum Tisch hinüber. Der Kreisarzt nickte nur und fuhr fort, sein Formular auszufüllen. Sie waren alte Freunde.
Mr Abbott blickte auf die Zehen hinunter. Zweifelsohne war das Schild die ganze Zeit über dort gewesen, denn die Kordel, an der es befestigt war, hatte sich tief eingegraben. Noch schlimmer, keine Flecken oder andere Beschädigungen machten die genauen Angaben, die in Farthings kindlicher Kursivschrift auf der Karte eingetragen waren, unleserlich. Die Registriernummer lautete unverkennbar A44/TBS. Ihr Name lautete jedoch nicht Elizabeth Bowen, sondern Theresa Le Roux.
Er räusperte sich.
Dr. Strydom, der dies für sein Stichwort hielt, polterte: »Irgendein Schweinehund wird hierfür bezahlen, verlassen Sie sich drauf.«
Mr Abbott bekam einen Erstickungsanfall.
2
Im Nebenraum schrie ein Verdächtiger. Nicht ununterbrochen, sondern in unregelmäßigen Abständen, was die Konzentration erschwerte. Dann klemmte unerklärlicherweise die Schreibmaschine. Der Bericht würde nicht rechtzeitig fertig werden; Colonel du Plessis hatte vier Uhr festgesetzt, und es war schon fünf vor vier, wobei mindestens noch eine Seite fehlte.
»Verdammt, dann haben Sie eben Pech gehabt, Colonel, Sir«, verkündete Lieutenant Tromp Kramer laut. Er war ganz allein im Büro des Morddezernats. Und machte endlich seinem berechtigten Ärger Luft. Es war einfach sinnlos, eine Sehnenscheidenentzündung zu riskieren, und die banalen Ereignisse runterzuhämmern, die zu dem plötzlichen schmutzigen Tod der Bantufrau Gertrude Khumalo geführt hatten. Vollkommen sinnlos.
Ihr Mörder, ein Bantu namens Johannes Nkosi, hatte sich kurz vor Tagesanbruch der Verhaftung widersetzt und wurde überwiegend in der Intensivstation des Peacevale Hospitals behandelt. Seine Chancen, den Prozess durchzustehen, wären sehr gering, sagten die Ärzte – auch eine Möglichkeit der Formulierung. Na gut, dann fände also eine gerichtliche Untersuchung statt. Aber eine gerichtliche Untersuchung war nichts, verglichen mit einer Gerichtsverhandlung. Niemand wäre an mehr als einer kurzen Aussage von der Zeugenbank interessiert. Noch gäbe es irgendwelchen Ärger mit den beteiligten Familien. Gertrudes Sippe war mehr als zufrieden mit dem Verlauf der Angelegenheit. Leute aus dem Slumviertel fanden immer Gefallen daran, wenn grobes Recht in dieser Welt gesprochen wurde und die forensischen Feinheiten der nächsten überlassen blieben. Was die Verwandten Nkosis anging, so hatten sie nie von ihm gehört.
Zweifellos könnte eine Menge total überflüssiger Schreibarbeit und Rumfummelei vermieden werden, wenn man die Sache über Nacht ad acta legte. Und der Colonel wusste das nur zu genau, der Schweinehund. Er war ja nicht um vier Uhr morgens gerufen worden.
Schlimmer noch, er würde sich nicht einmal die Mühe machen, einen kurzen Blick in den Bericht zu werfen, wenn er ihn bekam; hatte man einen Bantumord-Bericht gelesen, hatte man alle gelesen, bemerkte er jedes Mal. Alles was er wollte, war eine Kurzfassung der schmutzigen Einzelheiten auf hübschem, sauberem Papier, das er mit seinem Gummistempel gefühlvoll der Länge nach bedrucken konnte. War das erledigt, fügte er die Sache selbstgefällig seiner Aufgeklärte-Verbrechen-Statistik hinzu und machte sich wieder daran, dem Brigadier in den Arsch zu kriechen – noch ein Triumph für Recht und Ordnung, reduziert auf einen Dickdarmeinstieg. Die Vier-Uhr-Deadline war vollkommen willkürlich, ein primitives Symptom beginnenden Größenwahns.
Womit irgendwie die Zeit auf eine Minute nach der vollen Stunde gerückt war und das Telefon klingelte.
Mein Gott, der Colonel. Die Stimme aus dem mit Teppich ausgelegten Büro über ihm klang pikiert. Kramer schwenkte den Hörer vom Ohr weg und fuhr mit dem Finger über den Schenkel eines Kalendermädchens. Es war wunderbar braun.
Die schrillen Quiekser brachen abrupt ab.
Kramer antwortete mit geübter Reumütigkeit: »Tut mir leid, Sir – ich werde ihn Ihnen morgen als Erstes vorbeibringen. Hä?«
Irgendetwas hatte den Colonel in Rage versetzt, aber es hatte nichts mit dem Bericht zu tun, so viel war klar. Kramer grapschte sich einen Kugelschreiber und schaffte es, drei Namen aufzuschreiben, bevor die Verbindung abbrach. Verdammt, er hätte um eine kurze Zusammenfassung bitten sollen. Er hatte nicht den blassesten Schimmer, was los war.
Na ja, er hatte wenigstens die Namen. Er kannte zwar nicht den Unterschied zwischen Theresa Le Roux und Eva aus dem Buch Genesis, dafür war ihm aber die alte Varieténummer von Abbott und Strydom nur allzu bekannt. Damit hatte er mehr als nur eine ungefähre Vorstellung davon, wo eine erfolgreiche Ermittlung ansetzen könnte, und auch von der Dauer.
Er rief den diensthabenden Polizisten an, meldete sich ab und verließ das Gebäude zu Fuß. Georgies Laden war nur um die Ecke, hinter dem Museum.
Als Kramer in die Ladysmith Street einbog, sah er ein Taxi vom Bahnhofsstand vor der Leichenhalle halten. Beinahe im gleichen Augenblick stürzte aus einem Seiteneingang ein großer, mit kupferrotem Kraushaar gekrönter weiblicher Mehlsack darauf zu, gefolgt von einem alternden Küchenboy, der zwei Koffer schleppte. Dann kam Georgie vorsichtig, als ob er Heckenschützenfeuer erwartete, auf die Straße hinaus und führte mit den Händen die Wasser-und-Seife-Nummer vor.
Kramer verkrümelte sich in eine Warteschlange vor der Bushaltestelle und beobachtete die Abfahrt über den Rand von irgendjemandes Abendzeitung.
Georgies stumme Appelle waren vergeblich. Ohne ihn auch nur eines kleinen Blickes zu würdigen, hievte sich Ma Abbott ins Taxi. Es erzitterte und machte sich dann mit einem verächtlichen Reifenquietschen davon.
Irgendjemand war mal wieder ein böser Junge gewesen. Und dieses Mal hatte die alte Hexe nicht die Absicht, die Blamage mitzutragen. Doch zu ihrer Ehrenrettung musste man sagen, dass ihre Loyalität bis jetzt bemerkenswert gewesen war, selbst auf dem Höhepunkt des Schwester-Constance-Skandals. Das war, als George vergessen hatte, die Augen zu präparieren, und die Nonne mit einem anzüglichen Zwinkern für ihre Trauergäste in der Kapelle ausgestellt hatte.
Der Bus war gekommen und wieder abgefahren, und Kramer stand allein am Bordstein. Georgie war verschwunden. Es gab nichts mehr, womit man Zeit schinden konnte – er würde es auf seinen Hang zur Routine ankommen lassen müssen.
Das vordere Büro war leer bis auf eine ältere Kundin, die sich in einen Katalog mit prunkvollen Grabsteinen vertieft hatte. So wie sie aussah, hatte sie keinen Moment zu verlieren.
Kramer ging zum äußersten Ende der hohen Theke und schlug kurz auf die Bedienungsglocke. Irgendwo hinter den Kulissen, hinter den Vorhängen raschelte es zur Antwort. Dann nichts. Vielleicht hielt sich Georgie eine Katze – wenn auch wohl nur der Himmel wusste, wovon sich Mäuse an diesem Ort ernähren sollten.
Er läutete wieder, zweimal.
Wenn man sichs recht überlegte, wäre ein satingepolstertes De-Luxe-Modell ein tolles Boudoir für Mäuse. Vielleicht kamen sie nachts zum Schlafen vorbei und luden ihre Freunde zu sich ein. Hm, sich voreilig begraben zu lassen, war riskant. Zweifellos könnte das eine Erklärung dafür sein, warum Sargträger während des Leichenzugs häufig damit beschäftigt waren, ihre Ohren an die Sargseite zu pressen: Sie beurteilten die verzweifelten Kratzgeräusche aus dem Innern.
Aber das müsste schon eine Mordskatze sein, um anderthalb Meter über dem Saum durch die Vorhänge zu linsen. Und auf dem Rückzug die Dielen knarren zu lassen. Kramer hielt das Ganze für aufschlussreich und beruhigend. Irgendwas lag eindeutig in der Luft.
Ein Eindruck, der sich fast im gleichen Moment durch die Ankunft von Sergeant Fanie Prinsloo, der in dieser Woche als Polizeifotograf einsprang, bestätigte.
»Bin gekommen, um meine kleinen Schnappschüsse zu machen«, sagte er vergnügt, als er eine gewaltige Gerätetasche auf der Theke absetzte. Prinsloo konnte nie widerstehen, jedes verdammte Teil der Ausrüstung mitzubringen; normalerweise arbeitete er in der Abteilung Fingerabdrücke und musste seinen künstlerischen Tatendrang am Wochenende mit einer Boxkamera befriedigen.
Kramer begrüßte ihn zurückhaltend.
»Was gibts, Lieutenant?«, sagte Prinsloo nach einer Pause. »Versuchen Sies mal«, schlug Kramer vor und schob die Glocke hinüber.
Prinsloo war sichtlich verwirrt über dieses ganze förmliche Getue. Aber er grinste und drückte mit seiner Filetsteakfaust drauf. Es rührte sich immer noch nichts.
Deshalb seufzte Kramer, und Prinsloo verwechselte Erleichterung mit Erregung. Nicht dass der Sergeant dumm war, nur neu bei der CID und bis jetzt kaum bekannt mit den Männern im Morddezernat – ein Umstand, den Kramer auszunutzen gedachte. Seine Masche war, das ungeschriebene Gesetz Nr. 178/a umzukehren, das einem Polizisten das Vorrecht einräumte, Unwissenheit vorzuschützen, um die Fähigkeit von Untergebenen unter Beweis zu stellen.
»Okay, Sergeant, wie lauteten Ihre Befehle?«, lockte Kramer. Im Zusammenhang mit einem Routineauftrag war Befehle ein ziemlich übertriebenes Wort, doch Prinsloo erkannte das Ritual und erwiderte ganz korrekt: »Mir wurde aufgetragen, mich hier bei Ihnen zu melden und alle notwendig scheinenden Fotos zu machen.«
»Von?«
»Irgendeiner Puppe oder so.«
»Name?«
»Äh – irgendwas Le Roux, Sir.«
»Theresa Le Roux?«, schnauzte Kramer, um den erwünschten Grad an Verlegenheit zu erreichen.
Um Beschwichtigung bemüht, sprudelte jetzt, wie vorauszusehen, alles heraus: »Hören Sie, Sir, ich war gerade in der Dunkelkammer, als der Chef durch die Tür brüllte, dass ich mich gefälligst schnell hierher begeben sollte, weil Sie schon auf dem Weg seien, und Dr. Strydom an der falschen Leiche eine Obduktion gemacht hätte, weil Abbott Scheiße gebaut hätte und es Mord sei.«
Kramer blieb stumm – wozu schon etwas gehörte.
»Das ist alles, was er sagte, Sir. Plus den Namen. Aber Sie – «
»Kein Grund, sich so aufzuregen, Sarge«, beruhigte Kramer. »Muss euch Neulinge auf Trab halten.«
Also das wars. Ein Mord. Und ausnahmsweise hörte es sich mal an, als wärs etwas Gescheites.
Prinsloo hatte gerade noch Zeit, sein Zeug zu schnappen, bevor Kramer durch die Vorhänge verschwand. Jenseits von ihnen war die Kapelle, die nach abgestandenem Blumenwasser stank, und dann ein mit Trauergebinden gesäumter Gang, die darauf warteten, an die Kranken verteilt zu werden. Mit vorsichtigen Schritten erreichten sie eine Tür mit der Aufschrift LEICHENHALLE und stießen sie auf.
Dr. Strydom war allein. Als die Tür zurück ins Schloss knallte, drehte er sich jäh um und watschelte eilig heran. »Oh, Lieutenant, ich bin entzückt, Sie zu sehen.«
»Doktor.«
»Meine kleine Nachricht erhalten, ja?«
»So ungefähr.«
»Oh.«
»Was ist denn hier passiert?«
Dr. Strydom schaute unverhohlen um Kramer herum, um zu sehen, ob jemand hinter ihm stünde. »Haben Sie Mr Abbott nicht gesehen? Seltsam, ich dachte, er wäre da draußen. Diese kleine Affäre ist ziemlich delikat.«
»Ach ja?«
Tiefes Luftholen, dann: »Kurz gesagt, Lieutenant, ich fürchte, dass es etwas Kuddelmuddel gegeben hat. Zwei Leichen, beide weiblich, und meine amtliche wurde heute Nachmittag eingeäschert.«
Prinsloo schnalzte mit der Zunge wie eine Waschfrau, die Pipiflecken entdeckt.
»Was springt für uns dabei raus?«, fragte Kramer kühl. Er hatte sich, seit er hereingekommen war, nicht von der Stelle bewegt.
Dr. Strydom dachte sorgfältig über seine Worte nach. »Man könnte sagen, eine Menge – wenn nicht zu viel Wirbel gemacht wird.«
Jetzt war Kramer sicher, dass der Kreisarzt an der kleinen Affäre, wie er es nannte, beteiligt gewesen war. Georgie war nicht ihr alleiniger Urheber. Mit dieser Seite der Angelegenheit konnte man sich allerdings später befassen, wenn die Mitarbeit und das Selbstvertrauen des alten Tattergreises nicht so unbedingt erforderlich waren. Er zuckte lässig mit den Schultern. »Hm-hm. Wer wanderte in den Ofen?«
»Ich war so frei, das nachzuprüfen, während Sie auf dem Weg hierher waren«, erwiderte Dr. Strydom. »Irgendein armes, altes Mädchen, das unter einem Busch in der Nähe des Mason’s Stream gefunden wurde, wo die Sherrypenner rumhängen. Reine Routine. Alter? Suff? Wahrscheinlich beides. Jemand muss den Schein unterschreiben. In ihrer Glanzzeit eine echte Nutte, wie ich höre.«
Kramer wandte seinen Blick zum Tisch. »Und diese da? Auch eine Nutte?«
»Das möchte ich doch stark bezweifeln«, antwortete Dr. Strydom, während er mit den Stulpen seiner Gummihandschuhe schnalzte.
»Aber Sie sind sicher, dass es Mord ist?«
»Aber ja! Warum sehen Sie sichs nicht selbst an?« Er klang auf einmal merkwürdig aufgekratzt, eher wie ein Amateurzauberer, der seine Einleitungssprüche klopft. Freunde, ich werde euch gleich in höchstes Erstaunen versetzen.
Also folgten ihm die beiden Kriminalbeamten. Unterwegs wurde Kramer klar, warum der einzige Ort, wo es ihm schwerfiel, eine Leiche anzuschauen, die Leichenhalle war. Das Problem war die Höhe des Tischs, die es einem unmöglich machte, sich auf den Anblick einzustellen, indem man sich schrittweise näherte. Man musste erst ganz nah dran sein, bevor man wusste, worum es eigentlich ging.
Wo Mr Abbott zuletzt seine Ophelia gesehen hatte, sah Kramer nun eine lebensgroße Lumpenpuppe. Beziehungsweise schien es so. Zur Öffnung einer Leiche werden große Messer, fast nie Skalpelle, benutzt. Diese hier wurde jetzt wieder durch dicken schwarzen Zwirn in Dr. Strydoms unregelmäßigem Hexenstich zusammengehalten, wobei die Wergfüllung in Abständen herausquoll. Es war obendrein ein Patchwork leuchtender Farben – durch die Sonne, die sich darüber geschoben hatte und wie eine riesige Projektorlampe hinter den Buntglasfenstern wirkte. Als Dr. Strydom das Hauptlicht einschaltete, verstärkte er die optische Täuschung noch, indem er aus den Farben Pastelltöne machte, was besser zu der Gestalt passte, und die unversehrte Kopf- und Schulterpartie wie feines Porzellan schimmern ließ. Kramer bemerkte, dass ein sehr kleiner Pinsel benutzt worden war, um so lange Augenwimpern aufzumalen.
Und er konzentrierte sich eine Weile auf den Kopf. Eins war sicher: Das war ein Gesicht, das man nie vergessen würde. Er beugte sich vor, um die Haarwurzeln zu untersuchen.
»Ja, es ist gefärbt«, sagte Strydom. »Braune Augen, wissen Sie. Eine recht weitverbreitete Unsitte bei hübschen jungen Frauen, nicht nur bei Nutten.«
Kramer machte eine ordinäre Geste mit dem Daumen.
»Nun, grob geschätzt, würde ich sagen, dass sie ihre Jungfräulichkeit ungefähr vor einem Jahr verlor«, gackerte Dr. Strydom. »Aber das bedeutet heutzutage auch nicht mehr viel. Sie sollten wissen – «
»Kinder?«
»Nein, nie.«
»Krankheiten?«
»Keine.«
»Dann hat sie aller Wahrscheinlichkeit nach nicht rumgebumst, sondern nur mit einem festen Freund geschlafen.«
»Richtig.«
»Damit können wir weitermachen. Vor Kurzem, was meinen Sie?«
»Möglicherweise nicht innerhalb von zwölf Stunden vor dem Tod. Obwohl das von der bevorzugten Verhütungsmethode abhinge.«
Kramer lächelte ironisch über den Ausrutscher in den Klinikjargon. Der alte Knabe war jetzt mehr er selbst. »Also, Doc, was ist mit der Todesart?«
»Haben Sie eine Vermutung?«
»Nachdem Sie sie zerstückelt haben? Sieht aus wie ein Mau-Mau-Gemetzel. Was steht im Totenschein?«
»Herz.«
»Und was war es?«
»Fahrradspeiche.«
Das saß. Himmel, das war ja tatsächlich was. Bantu ermordet Bantu, war nichts. Weißer ermordet Weißen, war meistens auch nicht besser, sie hatten nur einen Anwalt, der es fertigbrachte, dass einem eine Rechentabelle in der Seele leidtat. Aber wirf Bantu und Weißen in einen Topf, und schon hast du fünf Zentimeter hohe Schlagzeilen. Blieb abzuwarten, wie viel höher sie noch werden konnten, wenn bekannt wurde, dass man eine bizarre Bantuwaffe benutzt hatte.
Ungeduldig mit der Hand wedelnd, bedeutete Kramer dem Arzt, die Leiche auf die Seite zu drehen.
»Wissen Sie, worauf der Lieutenant aus ist?«, fragte Dr. Strydom Prinsloo.
»Er sucht nach Einstichstellen entlang des Rückgrats«, flüsterte Prinsloo, »wo sie die Speiche reingebohrt haben, um sie zu lähmen – wie Shoe Shoe.«
Dr. Strydom lächelte süffisant. »Sie ist tot, nicht gelähmt, Mann. Was hier passiert ist, geht zwar in die gleiche Richtung, aber die Absicht ist eine völlig andere. Überlegen Sie mal einen Moment. Wenn die Speiche von den hiesigen Jungs benutzt wird, dann sterilisieren sie zuerst die Spitze mit einem Streichholz. Warum? Damit es keine Infektion gibt. Damit das Opfer so lange wie möglich am Leben bleibt, um seine Fehler zu bereuen. Wie Shoe Shoe, Sie sagten es schon. Hier jedoch wurde sie auf die Weise benutzt, die ich zuletzt vor dreißig Jahren im Rand gesehen habe, in den Jo’burg-Townships. Nicht oft allerdings, und sie ist so raffiniert, dass wir an einem Montag nach einem Wochenende wahrscheinlich Dutzende gar nicht entdeckten. Spezialität der Bantubanden. Sehen Sie mal …«
Dr. Strydom zog den linken Arm vom Körper weg und lehnte ihn im rechten Winkel an die Kante des Tischs. Er deutete mit dem Finger. »Sagen Sie mir, was Sie da sehen«, sagte er.
Kramer beugte sich vor. Es war eine Achselhöhle. Eine kleine, behaarte Achselhöhle. Das Mädchen hatte keinen Rasierapparat benutzt, ungewöhnlich, aber ohne Bedeutung.
»Jetzt sehen Sie noch mal hin«, drängte Dr. Strydom, als er die Haarbüschel mit einem Wundhaken auseinanderzog.
»Flohbiss?«
»Alles ganz einfach, wenn Sie den Mumm dazu haben«, erklärte Dr. Strydom. »Sie nehmen Ihre Speiche, schön an einem Ziegelstein geschärft, und schieben sie hier zwischen der dritten und vierten Rippe hinein. Ihr Ziel ist die Aorta, wo sie aus dem Herzen aufsteigt.«
»Haha, das nennen Sie einfach«, spottete Prinsloo.
»Aber das ist es. Sie zielen einfach auf den hohen Punkt an der gegenüberliegenden Schulter. Die Arterie ist ziemlich widerstandsfähig, sodass Sie es merken, wenn Sie sie getroffen haben. Ein Fachmann kann das beim ersten Mal schaffen, ein Anfänger wird es wohl ein paar Mal versuchen müssen – so, als wenn Sie versuchen, mit der Gabel Spaghetti auf einem Teller aufzuwickeln.«
Prinsloo wich einen Schritt zurück. Seiner Figur nach, groß und dick, schien ihm das Essen Spaß zu machen.
»Und dann?« Kramer war gefesselt.
»Mann, der Druck in dieser Aorta ist fantastisch«, fuhr Dr. Strydom fort. »Ich habe erlebt, dass bei einem Aneurysma, das während einer Operation platzte, das Blut bis an die Decke spritzte. Aber wenn Sie so ein dünnes Ding wie eine Fahrradspeiche zurückziehen, dichtet sie ab, kapiert? Alle diese Schichten, Muskeln, Lungen, Gewebe schließen sich. Sie wickeln einfach ein Taschentuch oder einen Lappen um die Speiche in der Achselhöhle, und das kümmert sich um alles, was rauskommt.«
Kramer richtete sich auf, klopfte seine Taschen nach Zigaretten ab und nahm eine, die ihm der Arzt anbot. »Nicht übel, gar nicht übel, Doktor.«
Dr. Strydom bemühte sich um Bescheidenheit: »Natürlich bin ich der Sache durch das viele lose Blut in den Höhlen auf die Spur gekommen. Man kann Matthews wirklich keine Schuld geben, meine ich.«
»Wer ist das denn?«
»Ihr Arzt, ein Allgemeinmediziner in Richtung Morninghill. Die sichtbaren Anzeichen waren identisch mit gewissen Arten von Herzstillstand. Sie hatte eine Vorgeschichte, hat man mir berichtet.«
Das war ein Ausrutscher. Nach Kramers Erfahrung wurden in Totenscheinen niemals Krankengeschichten erwähnt. Das bedeutete, dass sich der Kreisarzt bereits mit Matthews in Verbindung gesetzt hatte. Schade, denn jetzt würde er alle seine Entschuldigungen aus dem Ärmel schütteln können, aber das war eben die Medizinerzunft – enger verschworen als die Mafia und oftmals genauso tödlich. Na schön, auch das würde er durchgehen lassen. Er hatte noch ein oder zwei Fragen.
»Wie lange dürfte es gedauert haben, bis sie starb?«
»Zehn Minuten, maximal fünfzehn; wenn allerdings der Schock selbst groß genug war, würde ich sagen, fast sofort.«
»Hm-hm. Schreie?«
»Möglich, aber ein Kissen würde genügen, um sie zu ersticken. Es gibt keine Gesichtsverletzungen. Auf jeden Fall wäre sie, wenn ihr Hirn nicht mehr mit Blut versorgt wird, ziemlich schnell hinüber.«
»Was ist mit diesen Verletzungen an ihrem Arm?«
»Kann ich nicht definitiv sagen. Leicht zu kriegen, wenn Sie bei einem Krampf um sich schlagen.«
Diese Assoziation einer gewaltsamen Tat mit der gewaltsam untätigen Miss Le Roux besaß die subtile Obszönität einer warmen Toilettenbrille. Kramer beschloss, dass es ihm jetzt reichte.
»Sie gehört ganz Ihnen, Sergeant. Wenn Sie mit den Fotos für Ihr Privatalbum fertig sind, hätte ich gerne einen Sechsersatz Kopf-und-Schultern, der nicht zu deprimierend aussieht.« Dr. Strydom begleitete ihn hinaus.
»Wo ist Abbott?«, fragte Kramer im Gang.
»Hier, Officer«, kam eine unterwürfige Stimme aus der Kapelle. Und obwohl Ma Abbott nicht mehr da und Farthing außer Haus war, um auf dem Land eine Leiche abzuholen, bestand er darauf, in seinem Ausstellungsraum befragt zu werden, der eine schalldichte Schiebetür hatte.
An diesem Punkt verabschiedete sich Dr. Strydom, da er sich plötzlich an seine tägliche Verabredung neben dem Dreieck im Zentralgefängnis erinnerte. Zwei zu Stockhieben Verurteilte würden schon angetreten sein und auf ihn warten. Er musste ihre Straftauglichkeit bescheinigen, sehen, ob ihre Nieren ordentlich geschützt waren, und auf Reaktionen achten. Hinterteile werden häufig missbräuchlich benutzt, aber es ist nicht klug, sie übermäßig zu missbrauchen.
»Okay, aber heute Abend möchte ich die Laborberichte haben«, sagte Kramer und wandte sich abrupt ab. Er ließ Abbott nach der Tür sehen, während er sich einen großen Sessel hinter dem großen Schreibtisch aussuchte. Aber er setzte sich nicht.
Dadurch musste Mr Abbott halb in die Hocke gehen, als er sich auf dem Sofa gegenüber niederließ.
Kramer lächelte.
Mr Abbott versuchte zu lächeln.
Dann kam er mit einem kleinen Satz wieder auf die Füße und ging zu einem der ausgestellten Särge hinüber. »Dummer Fehler.«
»Ein dickes Lieschen«, sagte Kramer.
»Arabella«, verbesserte Mr Abbott und zeigte auf die Ständerkarte.
Kramer ging hinüber, um sie sich genau anzusehen. Dann beugte er sich vor, um das silberne Namensschild zu lesen.
»Falsch – ich meine, frei erfunden«, erklärte Mr Abbott.
»Hm-hm.« Kramer war mit dem Spiegelbild seines Gesichtes in dem auf Hochglanz polierten Deckel beschäftigt. Es war zweifelsohne eine lehrreiche Erfahrung zu sehen, wie man eines Tages aussehen könnte. Obwohl, wenn man nochmals drüber nachdachte, dann konnte der Tod aus diesen eingefallenen Wangen, den tief liegenden Augen und den vorstehenden Schneidezähnen auch nicht mehr machen. Es war ein hartes Gesicht, ein hässliches Gesicht, ein Gesicht, das es einem oft ersparte, um den heißen Brei herumreden zu müssen. Kramer zwinkerte ihm mit dem linken Auge zu.
Dann kehrte er zu dem großen Sessel zurück und setzte sich.
Diesmal schloss Mr Abbott einen Kompromiss, indem er sich auf der Sofalehne niederließ.
»Ein dickes Lieschen«, wiederholte Kramer ernst. »Colonel Du Plessis weiß nicht, was er mit Ihnen machen soll – Ihnen gehörig den Kopf waschen oder einen Orden anheften.«
Mr Abbott wand sich. »Es tut mir wirklich schrecklich leid«, flüsterte er.
»Geschenkt«, schnauzte Kramer. »Ich bin nur an der Le Roux interessiert.«
»Aber was ist mit Miss Bowen?«
»Muss das Gericht entscheiden, wenns überhaupt dazu kommt. Sie war nichts Besonderes. Vielleicht haben Sie ja Glück.«
»Gott sei Dank.«
Mr Abbott sank in die Plüschpolster. »Betrachten Sie es mal aus meiner Sicht, Lieutenant«, bat er. »Farthing hat beide Überführungen erledigt, sodass ich persönlich nichts weiter zu tun hatte. Ich dachte, ich sollte mal nach den Schildern sehen, aber dann waren wir in Eile. Ich wäre nie darauf gekommen, dass sie im Mitgliedsverzeichnis von Trinity steht.«
»Warum nicht?«
»Sie haben doch sicher schon mal Anzeigen von Trinity gesehen, Officer. Sie richten sich an die älteren und nicht so begüterten Menschen. Sie war jung, und an ihren Zehen konnte man erkennen, dass sie Geld hatte.«
»Hä?«
»Ich weiß, es ist ein bisschen unverschämt, aber ich muss zugeben, dass ich einiges von Zehen verstehe. Allein die Länge der Nägel kann einem viel verraten. In ihrem Fall war es so, dass die Zehen nicht vollkommen deformiert waren von Schuhen, die eigentlich nicht für sie gemacht waren. Bei den meisten Schuhen besteht eine ziemliche Lücke zwischen den Größen, wissen Sie, und es wird nur nach Länge gemessen.«
»Kommen Sie, Mann, was soll das alles?«
»Nun, ich muss zugeben, dass es mich zuerst verblüfft hatte, doch dann kam ich plötzlich darauf: Sie ließ ihre Schuhe von Hand anfertigen, oder – und das war wahrscheinlicher – sie konnte sich Clark’s leisten oder eine andere teure Marke, die ebenfalls in unterschiedlichen Weiten erhältlich ist. Äußerst wichtig, Weiten. Wie auch immer, sie hatte offensichtlich Geld.«
Kramer war nicht zu einer Vorsprechprobe für Dr. Watson aufgelegt, aber es gelang ihm, beeindruckt zu klingen. »Sie müssen der Leiche ziemlich viel Zeit gewidmet haben.«
»O ja.«
»Nur den Zehen?«
»Nun ja … da waren noch die Routinekontrollen auf Ringe, Schmuck.«
»Ja?«
»Fand nichts.«
»Und Sie haben auf dem Schild nicht gesehen, dass sie eine Trinity war?«
»Nein.«
»Verstehe«, sagte Kramer. »Sie haben also den größten Teil Ihrer Zeit den Zehen gewidmet. Seltsam, so was, weil ich nämlich glaube, dass sie eine ganz niedliche Puppe gewesen sein muss, bevor sich Ihr Freund mit seinen Messern über sie hermachte.«
Mr Abbott rutschte nervös hin und her.
»Ich würde sogar sagen, dass mehr an dieser ganzen Sache dran ist, als Sie mir erzählen«, fügte Kramer aus einer plötzlichen Eingebung heraus hinzu, die seiner Stimme einen Unheil verkündenden Unterton verlieh. Und er beobachtete mit Genugtuung, wie Mr Abbott bleich wurde. Diesen Farbton mochte er lieber an ihm. Er stellte sicher, dass es mit dem unnützen Geplapper vorbei war.
»Was genau möchten Sie wissen, Lieutenant?«, brachte Mr Abbott schließlich heraus.
»Wieso hat Doc Strydom die Leiche nicht selbst überprüft? Kommt es öfter vor, dass er Ihre Kunden aus Versehen zu Filets verarbeitet?«
»Haben Sie ihn das schon gefragt?«
»Nein, nicht direkt.«
»Gut, weil ich nämlich an allem schuld bin«, erklärte Mr Abbott mannhaft. »Heute Morgen am Telefon habe ich ihm nur gesagt, dass da eine weiße Frau wäre und ich sie wie üblich fertig machen und warten würde.«
»Aber er muss doch Formulare ausfüllen, oder?«
»Normalerweise erledigen wir die Namen und das alles hinterher – zusammen, sozusagen.«
»Hm?«
»Verstehen Sie, er kommt hier herein, und ich liefere die Personalien, während wir – «
»Ja?«
»Ein oder zwei Gläschen trinken.«
Das arme Schwein, aus der Art, wie er seine Stimme für diese schreckliche Enthüllung fast auf null senkte, hätte man schließen können, dass Mr Abbott den Raum mit Wanzen gespickt hatte. Kramer probierte die Schublade aus, in der der Schlüssel steckte, und wurde zum ersten Mal fündig.
Er schenkte einen großen für sich ein und noch einen, in ein schon verdächtig duftendes Glas, für Mr Abbott. Es war billiger Arzneibrandy, zweifellos in Reserve für den Fall, dass jemand am Grab zusammenbrach. Einer schnellen Berechnung zufolge musste irgendjemand herumerzählt haben, dass Trauernde wie die Fliegen auf dem Monument Hill umfielen. Sie süffelten langsam und schweigend.
Etwa eine Minute.
»Eins wollen wir mal gleich zu Anfang festhalten«, sagte Kramer. »Farthing hat diese – äh – Dinge erledigt.«
»Überführungen, Officer. Die alte Frau kam aus der staatlichen Leichenhalle – Sergeant Van Rensburg hat nach der Panne deutlich sein Missfallen kundgetan – und das Mädchen aus seiner Wohnung.«
»Weiter.«
»Dann hatte er den Morgen frei. Ich war ziemlich in Eile, daher – «
»Jaja!«, unterbrach Kramer.
»Was passierte, war, dass wir zum Krematorium aufbrachen, bevor Dr. Strydom eintraf.«
»Aber es muss doch Formulare gegeben haben.«
»Darum hat sich immer Mrs Abbott gekümmert.«
»Wer hatte sie?«
»Farthing. Das war es ja, verstehen Sie. Miss – äh, sie war mit einem Laken zugedeckt, und die Trinity zahlt keine Vergütung für eine Inschriftentafel – das da drüben ist eine gewöhnliche Arabella. Farthing sah nur einen Sarg.«
»Beide Frauen waren ungefähr gleich groß?«
»Ja.«
»War ein Pfarrer im Krematorium? Hat er denn nicht den Namen gesagt?«
»Ich war noch einmal hinausgegangen, um den Leichenwagen zu parken, direkt nach uns erwarteten sie noch einen.«
»Und dieser Farthing?«
»Noch im Büro des Krematoriums für den Eintrag im Buch.«
»Also haben Sie erst, als Sie wieder hier waren, gewusst, dass Ihnen ein Fehler unterlaufen war?«
»Nein.«
Doppeldeutigkeit spielte ihre einzige Tugend aus, und Kramer entging eine Feinheit. Mr Abbott leerte sein Glas in einem Zug.
»Okay, wenn Sie am Anfang nicht dort waren, waren Sie dann zu irgendeinem Zeitpunkt drin?«
»Die ganze zweite Hälfte.«
»Aha, können Sie irgendeinen der Trauergäste beschreiben? Einer, der Ihnen auffiel, als – «
»Es waren keine da.«
Kramer stellte sein Glas ab. Damit hatte er nicht gerechnet. Der Aussage des medizinischen Sachverständigen zufolge hätte zumindest einer da sein müssen. Ein einsames männliches Wesen, das sich fragte, woher es seine nächste Bettgefährtin bekam.
Mr Abbott fuhr hastig fort: »Ich versichere Ihnen, dass es in den Lokalzeitungen angezeigt war, wie es in den Statuten von Trinity verlangt wird, aber es tauchte keine Menschenseele auf. Und das ist ein weiterer Grund, warum ich nicht damit gerechnet habe, dass irgendetwas nicht stimmte: Alte Menschen, vor allem die Mitglieder von Trinity, haben oft niemanden. Deswegen treten sie ja ein.«
Jetzt kam der Moment, den Kramer hatte vermeiden wollen. »Haben Sie Miss Le Roux’ Papiere zur Hand?«, fragte er.
Mr Abbott deutete auf ein mit Trinity-Unterlagen verziertes Hauptbuch neben dem Telefon. Kramer blätterte es langsam durch.
»Verstehe, was Sie meinen«, murmelte er, »die Hälfte dieser alten Tanten steht schon mit einem Fuß und einem Hühneraugenpflaster drin.«
Schließlich kam er zu dem Eintrag, den er suchte, und stellte fest, dass er außer dem Namen, der Policennummer, dem Datum, der Abwicklungsweise und dem Code nichts enthüllte. Er notierte den Code und faltete dann ein Dokument auseinander, das in die Seite gesteckt worden war.
Es schien das offizielle grüne Licht von der örtlichen Geschäftsstelle der Trinity-Beerdigungsgesellschaft zu sein, und über einer Unmenge Kleingedrucktem über Kosten standen ein paar Einzelheiten:
Name: Le Roux, Theresa
Geburtsdatum: 12. Dezember 1948
Rasse: weiß
Adresse: 223B Barnato Street, Trekkersburg
Stand: ledig
Beruf: Musiklehrerin
Nächste Angehörige: keine
Anweisungen: Abwicklung wie angemessen
Nun, damit war doch schon mal etwas geklärt. Oder? Selbst Waisen haben im Allgemeinen jemanden, der um sie weinte. Und was war mit den Leuten, die in 223A wohnten? Und – das Allerwichtigste – was war mit den Schülern? Der Tod eines Lehrers stellte Eltern vor ein Problem, das sie nur zu gerne unter einem Berg von Kränzen ersticken würden. Natürlich, da war der Zeitfaktor; die Pressenotiz war nur an einem einzigen Tag erschienen – dem Tag der Bestattung.
»Keine Blumen?«, fragte Kramer.
»Keine«, erwiderte Mr Abbott und hielt einen Moment inne, um sichtbar nachzudenken, während er sein Glas neuerlich füllte.
Sehr, sehr seltsam. Einen einzigen, unbedachten Moment lang empfand Kramer tiefen, fast liebevollen Respekt für denjenigen, der diesen Mord geplant hatte. Einmal wenigstens hatte ein Mörder den Versuch unternommen, anständige Arbeit zu leisten. Die meisten machten sich nie die Mühe, irgendeinen konstruktiven Gedanken an ihre Tat zu verschwenden – Nkosi war ein gutes Beispiel dafür gewesen. Bei ihnen war es ein Fall von miserabler Selbstbeherrschung, gefolgt von umgehendem Handeln mit der erstbesten Waffe. Nkosi hatte sich ein Bambusmesser geschnappt, vor den Augen der Nachbarn zweiunddreißigmal auf Gertrude eingestochen und dann herumgestanden und sich am Hosenboden das Blut von den Händen abgewischt, während die Polizei gerufen wurde. Manche gaben sich ein bisschen mehr Mühe. Gewöhnlich waren das Weiße oder kultivierte Schwarze, die Missionsschulen besucht hatten. Sowohl in dem einen wie auch in dem anderen Fall war es eine Frage der Lektüre, da war er sicher. Weltverbesserer, die sich um die Ausstattung von Missionsbüchereien kümmerten, schienen immer über unerschöpfliche Privatvorräte an gelesenen Agatha Christies zu verfügen. Dieser Typ von Mörder fühlte sich sozial verantwortlich, die Schlüsselrolle in einem komplizierten Geschicklichkeitsspiel zu übernehmen, das manche einen unglücklichen Zufall nennen würden. Er ging vorsichtig mit Alibis und Fingerabdrücken um. Er hatte auf alles eine Antwort. Oftmals gab er sich unglaublich viel Mühe, die Leiche zu beseitigen. Letzten Endes jedoch sah er sich der Polizei gegenübergestellt – die er entweder in aller Öffentlichkeit oder aus einem Lügendickicht heraus beobachtete. Er wusste, dass ihn schon das bewusste Verheimlichen seiner Verbindung zu dem Mord belastet hatte. Er hatte sich zu einem geistigen Kräftemessen verpflichtet. Selbst wenn es ihm gelang, eine »Vermissten«-Situation zu arrangieren, wusste er doch nie, wann das Jagdhorn plötzlich wie das Gebell eines Hundes ertönen würde, der einen köstlichen, aber verbotenen Knochen ausgräbt. Ein perfekter Mord dagegen war frei von dieser Zielsetzung. Derjenige, der ihn beging, unternahm keinen Versuch, sich von seiner Tat zu distanzieren – einfach, weil er vollkommen davon überzeugt war, dass seine Tat nie als solche erkannt werden würde. Er legte achtlos Spuren, weil niemand jemals nach ihnen suchen würde. Er machte sich über die Polizei genauso wenig Gedanken wie über einen unbekannten Namen in den Todesanzeigen der Gazette. Er folgte den Regeln der Natur. Ein Pedant könnte darauf beharren, dass immer ein gewisses Risiko damit verbunden war: Ein Ehemann, der seine Frau schwängerte, konnte ja auch nicht sicher sein, dass daraus nicht ein mongoloides Kind entstand. Trotzdem waren es in beiden Fällen nur die Chancen, die zählten. Und die Chance, dass man ein mongoloides Kind bekam, wäre um einiges geringer als jene, dass ein Arzt beim Tod eines als herzkrank bekannten Patienten an seiner eigenen Meinung zweifelte – und astronomisch geringer als jene, dass ein professioneller Leichenbestatter im Eifer einer unsäglichen Passion die Leichen vertauschte. Trotzdem hatte die Schlacht begonnen.
»Also, Georgie, ich muss zugeben, dass Sie diesmal wirklich ein Kaninchen aus dem Hut gezaubert haben«, bemerkte Kramer, vom Adrenalin leutselig gestimmt.
»Danke«, murmelte Mr Abbott. Er war schon längst beim dritten Glas und viel, viel fröhlicher.