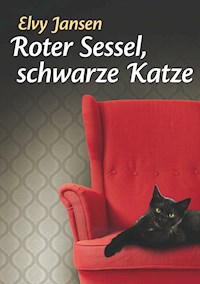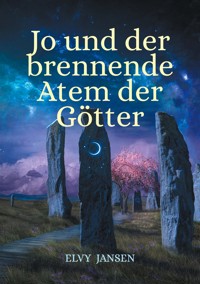Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: TWENTYSIX
- Kategorie: Krimi
- Serie: Adriana die Fuhrfrau
- Sprache: Deutsch
Im Reich Karls des Großen werden Kutschen überfallen. Sie transportieren Tributzahlungen aus den eroberten Ländern nach Aachen an den kaiserlichen Hof. Die Täter hinterlassen eine entsetzliche Spur von Tod und Verwüstung. Sie entkommen unerkannt. Es bleibt ein Rätsel. Als der unvorstellbar große Awarenschatz das fränkische Reich durchqueren muss, ist allerhöchste Alarmstufe geboten. Wem kann der Kaiser noch trauen? Adriana, Aumoury und Alexander werden um Hilfe gebeten, diese Überfälle zu untersuchen, da sie sich als Fuhrleute ständig auf den Straßen des Reichs aufhalten. Sie werden mit einer Brutalität konfrontiert, die ihresgleichen sucht! Wie viel sind Menschenleben angesichts von so viel Gold noch wert? Aber Adriana muss sich nicht nur ihres Lebens erwehren. Ein geheimnisvoller Mann löst ein Gefühlschaos in ihr aus. Auch im zweiten Teil kämpft sich Adriana mutig und selbstbewusst durch ihr Leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 698
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
...Nur wer Grenzen überschreitet, entdeckt neue Welten...
Raflan ritt mit seinem Pferd über die gleißende weiße Fläche. Die Sonne schien und die weiße Landschaft harmonierte wunderbar mit dem azurblauen Himmel. An manchen Stellen war der Schnee getaut und weiße kleine Blumen streckten neugierig ihre Köpfchen der Sonne entgegen. Es war nicht zu übersehen, in dem kalten Land im hohen Norden zog endlich der Frühling ein. Als Raflan den Hals seines schwarzen Araberhengstes streichelte, spürte er, dass die Sonne das Fell des Tiers angenehm aufwärmte. Er ließ ihn in leichten Galopp fallen, damit Rie Sarieri, der Name war arabisch und bedeutete „schneller Wind“, sich austoben konnte. Zu lange hatte er während der langen Winterzeit im Stall gestanden. Rie Sarieri genoss den scharfen Ritt und als Raflan ihn wieder zurück nach Hause dirigierte, gefiel ihm das ganz und gar nicht.
„Mir geht es nicht besser als dir, mein Freund. Ich war auch viel zu lange Zuhause. Aber was sollte ich machen? Du kennst Gydeful. Sie macht es mir und den Kindern nicht gerade leicht. Meine Anwesenheit war dringend erforderlich, Rie. Denke nur an das letzte Jahr. Meine Tochter Alba aus Hispania wurde ermordet und Gydeful hatte diese schrecklichen Dämonen im Kopf. Um ein Haar wären Gydeful und meine kleine Tochter Freda gestorben, weil meine Frau der Meinung war, Dämonen hätten von ihnen Besitz ergriffen und, dass keine Rettung mehr möglich sei. Darum hatte sie nichts mehr an zu Essen zu sich genommen und das Haus nicht mehr verlassen. Und schuld daran war angeblich meine Tochter aus Hispania, die sie von Anfang an gehasst und abgelehnt hatte.“
Rie Sarieri antwortete mit entspanntem Schnauben und galoppierte noch einmal los. Zu lange hatte er sich den Wind nicht mehr um die Nüstern wehen lassen. Raflans schwarze schulterlange Locken flogen mit dem Wind und er ließ den Hengst noch einmal die Freiheit spüren. Die Mörder seiner Tochter wurden gestellt und gerichtet. Ein guter Freund aus alter Zeit in Spanien, Aumoury, mit dem er zusammen in den Diensten von Quillat-Abn-Rachman stand, hat ihn durch einen Händler davon unterrichten lassen. Aber das machte das Zusammenleben mit seiner Gydeful nicht unbedingt leichter. Sie hatte ganz offen zugegeben, über den brutalen Mord an seiner unehelichen Tochter sogar erleichtert gewesen zu sein. Zu der Trauer um seine Tochter, hatte sich das Verhältnis zu seiner Frau nicht gebessert. Gydeful war nicht fähig, das Gefühl der Trauer um seine Tochter mit ihm zu teilen und sie war nicht in der Lage, Raflan ein Wort des Trostes zukommenzulassen. Ihre alleinige Sorge galt den Dämonen, die sie am Tag und in der Nacht quälten und heimsuchten. Das ganze Haus hing voller Talismane, um das Böse in der Welt vom Haus fernzuhalten. Selbst im Wasser und im Essen vermutete Gydeful böse Geister und nahm nur noch etwas zu sich, wenn es sich nicht mehr vermeiden ließ. Nach wie vor verließ sie niemals das Haus und nicht einmal die Magd durfte ihr Zimmer betreten. Kein anderer als Ginguf, ein alter Freund Raflans aus vergangenen Tagen, durfte in ihre Nähe. Raflan hatte seine schöne Frau schon seit Monaten nicht mehr angerührt. Eine erneute Schwangerschaft würde der völlig entkräftete Körper von Gydeful wohl nicht überstehen. Er hatte den Kampf gegen die Dämonen seiner Frau fast aufgegeben. Zu fremd erschien sie ihm, wenn sie ihre lauten Schreie gegen die Dämonen durch das Haus tönen ließ.
Ginguf orderte im tiefsten Winter den Schamanen aus dem nächsten Dorf, der die bösen Geister seiner Frau vertreiben sollte. Er trug einen langen Mantel, der aus vielen Fellresten zusammengesetzt war. Kleine Scheiben aus Eisen waren an dem langen Mantel befestigt und bei jeder Bewegung gaben sie ein sanftes Klirren von sich, was sich wie das Zwitschern der Vögel im Frühling anhörte. Eine große Fellmütze thronte auf seinem Kopf, an der kleine Ketten hingen, deren Knochen aus dem Gebein irgendwelcher Tiere stammten. Im allgemeinen hielt Raflan als gläubiger Muslime nichts von solchem Mumpitz. Aber er wollte auch diese letzte Möglichkeit nicht ausschließen. Vielleicht gelang es dem Schamanen eine Verbindung zu Gydeful herzustellen, zu der er als Ehemann schon lange nicht mehr im Stande war. Als der Schamane zusammen mit ihm und Ginguf die Kammer betrat, hielt Gydeful nur die Decke über sich und fing an zu schreien.
„Weiche von mir, Dämon! Raflan! Warum bringst du mir diesen Dämon in meine Kammer?“
Er war entsetzt, dass seine Frau den Schamanen nicht mehr erkannte und verlor jede Hoffnung. Dem Schamanen war es unmöglich, sich der Frau zu nähern. Wenn er nur an die Bettkante trat, fing sie an zu schreien und wehrte ihn mit Händen und Füßen verzweifelt ab, als wolle er sie direkt vom Leben in das Reich der Dämonen stürzen.
„Ich muss deine Frau untersuchen, ob sich ein körperliches Leiden findet, dass ihr eventuell große Schmerzen bereitet. Aber ich will ihr keine Gewalt antun. Flöße ihr diesen Trank ein. Er besteht aus Kamille, Baldrian, einer kleinen Prise Tollkirsche, ein wenig Schierlingskraut und noch etwas aus deinem Heimatland.“
Raflan sah ihn besorgt an.
„Ist das nicht gefährlich?“
„Ich habe die Dosis gut gewählt und du brauchst dir deswegen keine Sorgen zumachen, sie ist nicht tödlich. Danach wird Gydeful einschlafen. Die Götter mögen mir verzeihen, dass ich so arbeiten muss.“
Gemeinsam mit Ginguf gelang es Raflan, seiner schreienden, um sich schlagenden Frau, das Getränk einzuflößen. Ihre Gebärden wurden langsamer, die Schreie leiser und alsbald schlief sie ein. Der Schamane untersuchte Gydeful solange sie schlief vom Scheitel bis zur Sohle. Danach sprach er leise Gebete, hing Kräutersträuße auf und befestigte an ihrer Schlafstatt weitere Talismane. Danach lud Raflan den Schamanen zu einem Becher Met ein, der noch vom Julfest übrig war. Raflan stellte überrascht fest, dass der Schamane, auch wenn er diesen seltsamen Göttern anhing, recht klug war.
„Die Dämonen deiner Frau kenne ich nicht. Sie sind weder von den Riesen geschickt, noch kommen sie aus Niflheim. Auch Loki, unser listigster und klügster Gott, hat hier seine Hand nicht im Spiel. An ihrem Körper kann ich keine äußeren Anzeichen, außer dass sie viel zu unterernährt ist, erkennen. Allerdings sehen viele Frauen so aus, wenn der Winter vorbei ist, weil sie die letzten Vorräte lieber ihren Kindern geben, als selbst zu essen.“
„Sie will überhaupt keine Nahrung mehr zu sich nehmen und will auch nicht, dass ihre Kinder etwas essen! Welche Dämonen können so stark sein, dass sie Gydeful das Leben verbieten?“
Der Schamane streichelte über die Wange der tief schlafenden Frau.
„Ihre Dämonen sitzen in ihrem Kopf und ich weiß nicht, wie ich sie erreichen kann.“
„Wir haben alles schon ausprobiert. Heilsame Dampfbäder, eine Appetit fördernde Medizin, alle Heilkräuter derer ich habhaft werden konnte. Sogar einen Aderlass haben wir machen lassen. Nichts hat geholfen. Ständig will sie nur in Dunkelheit leben. Selbst ihre Kammer zu belüften, wird von ihr mit hysterischem Kreischen goutiert. Schließlich habe ich sie aus dem Haus gezerrt, damit sie die Sonnenstrahlen auf ihrer Haut spürt.“
„Empfand Gydeful die Sonne als angenehm?“
„Ganz und gar nicht, ehrwürdiger Schamane. Sie schrie und tobte, dass die Sonne auf ihrer Haut brennt und dass sie die Schmerzen nicht aushält.“
„Liebt Gydeful ihre Kinder? Wie geht sie mit ihnen um?“
„Das ist mir ein absolutes Rätsel. Sie liebt die Kinder. Aber auf eine morbide Art und Weise, die ich nicht länger dulden kann. Jede Mutter will doch, dass ihre Kinder ihr Leben in Freude und Sonnenschein verbringen, kocht ihnen ihr Lieblingsessen oder erzählt ihnen schöne Geschichten, denen die Kinder andächtig zuhören. Sie will nur, dass die Kinder bei ihr in der dunklen Kammer sitzen und ebenfalls nichts mehr essen und trinken, weil die bösen Geister ihre Kinder förmlich verbrennen würden. Ich bin wirklich sehr in Sorge!“
Der Schamane nickte bedächtig, so dass seine beeindruckende Mütze aus hellem Fell bedenklich hin und her wackelte. Die kleinen Knöchlein an den Ketten klackerten sanft dazu.
„Ich habe mein möglichstes getan und ich weiß, dass du das ebenfalls getan hast. Ginguf tut alles mögliche, aber keinem von uns wird es je gelingen, Gydeful die Kraft des Lebens spüren zu lassen. Hel, die Göttin des Todes spricht täglich mit ihr. Es ist ein seltsames Spiel der Götter. Ist es doch so, dass Hel die Lebenden im normalen Falle nicht erreichen kann. Zu tief sitzt ihr Reich, in dem die Toten nur noch als Schatten herumwandeln und es befindet sich an den Wurzeln der ehrwürdigen Yggdrasil, der Weltenesche... Die Sehnsucht Gydefuls nach Hels dunklem Schattenreich bestimmt ihr derzeitiges Dasein...“
Der Schamane betrachtete das schlafende Antlitz von Gydeful.
„Ich kenne sie seit ihrer Kindheit und da war sie schon recht eigenartig. Nie wollte sie etwas mit anderen Kindern zu tun haben, saß damals schon lieber in einer dunklen Ecke als im Sonnenschein. Sie fürchtete sich schon damals vor fließenden Gewässern und dem Sonnenlicht. Allerlei Getier waren für sie Dämonen, die sie zu zerstören suchten und im Himmel sah sie auch ständig unheilvolle Botschaften. Aber Gydeful wuchs zu einer wahren Schönheit heran und aus vielen Teilen des Landes kamen sie, um ihre Schönheit zu bestaunen. Es gab zahlreiche Bewerber, aber König Sigfridson und ihr Vater haben ihre Hand in deine Hände gelegt und das war wohlgetan.“
Raflan legte beide Hände auf seine Brust und deutet eine Verneigung an.
„Es war eine große Ehre für mich.“
„Nie warst du gewalttätig gegen deine Frau, wie es bei manchem feinem Herr hier Sitte ist, besonders, wenn wieder einmal zu viel Met im Spiel war. Du hast sie von ganzem Herzen geliebt und auf Händen getragen. Mehr kann man nicht tun.“
„Ich bin oft für König Sigfridson unterwegs und meine Frau ist viel zu viel alleine.“
„Das sind andere Frauen auch.“
„Ja, aber Gydeful ist eben anders und ich weiß nicht mehr, was ich noch tun soll. Ich habe den Eindruck, dass sie das Leben hasst!“
Der Schamane trank aus seinem Becher und aß ein Stück Brot dazu.
Für einige Zeit herrschte Stillschweigen. Raflans schwarze Augen hingen erwartungsvoll an dem ehrwürdigen, bärtigen Gesicht des Schamanen. Endlich unterbrach er sein Schweigen. Es schien ihm unendlich schwer zu fallen, was er Raflan mitzuteilen gedachte.
„Du musst deine Kinder schützen! Ihr dürft die Kinder nur noch selten zu ihr lassen und niemals, hörst du, wirklich niemals mit ihr alleine in der Kammer lassen! Ich habe deine kleine Tochter gesehen. Auch sie ist schon viel zu dünn und eifert leider ihrer Mutter nach. Und dein Sohn leidet ebenso darunter. Einer von euch muss immer gegenwärtig sein, damit Hel sich auf keinen Fall den Kindern nähern kann...“
Der Schamane fuhr sich durch den Bart.
„Es wird auf immer ein Rätsel bleiben, warum Göttin Frigg, die Gattin von Odin und oberste Schutzgöttin der Frauen, Gydeful nicht einmal annähernd erreicht und sie statt dessen lieber dem tödlichen Gesang von Hel lauscht. Das beste wäre es, wenn die Kinder zusammen mit „normalen“ Kindern aufwachsen würden. Die Götter werden mich dafür strafen, dass ich so etwas schreckliches von mir geben muss.“
Raflan schüttelte energisch mit dem Kopf.
„Ich muss dir dankbar sein, dass du die Wahrheit erkennst und auch es wagst, sie auszusprechen. Und deine Götter werden es auch sein und zu schätzen wissen, dass so ein weiser Mann in ihren Diensten steht. Ich werde mit meinem Freund Sturluffson sprechen, ob ich die Kinder im Frühjahr bei ihm unterbringen kann.“
„Sturluffson und seine Frau Svanhild sind eine gute Wahl! Wenn du den Kindern wirklich helfen willst, dann warte nicht solange. Sie sind es, die deinen Namen weiter tragen. Lodnar Raflanson und Freda Raflansdottir, denke daran.“
Es erforderte einfach zu viel Kraft von ihm und den Knechten und Mägden. Alleine Ginguf, sein uralter Mitstreiter aus alten Zeiten, der schon seit Jahren als Knecht bei ihm arbeitete, schien manchmal Zugang zu Gydeful zu haben. Aber was seine Kinder anbetraf, kam er tatsächlich in Zugzwang und musste handeln. Besonders die kleine Freda. Sie litt unsäglich und weinte nur noch und selbst ihr Bruder Lodnar konnte sie nicht mehr trösten. Und bei jedem Bissen, den das kleine Mädchen zu sich nahm, fühlte es sich schuldig und bekam Bauchschmerzen.
Raflan ritt am Tag darauf, mitten im Winter, während eines Schneegestöbers zu seinem Freund und sprach lange mit ihm und seiner Frau.
„Was gibt es da noch zu besprechen, mein Freund Raflan? Wenn selbst unser kluger Schamane nicht mehr weiter weiß, dann ist es doch das Allerbeste, wenn die Kinder so schnell wie möglich zu uns kommen. Und es ist eine große Ehre, dass der Schamane uns für würdig findet, deine Kinder aufzunehmen.“
Raflan kehrte noch am selben Tag zurück und veranlasste, dass die Kinder am nächsten Tag reisefertig sein würden. Das Mädchen und der Junge weinten sehr, als Raflan sie am ersten Tag zurückließ und er fühlte sich noch schlechter und schuldbewusster, als es ohnehin möglich war. Sturluffson nahm seinen Freund in den Arm.
„Reite nach Hause, Raflan. Heute weinen sie und vielleicht morgen auch noch. Aber meine Kinder, die Liebe meiner Frau und mit Friggs Hilfe werden wir dafür sorgen, dass deine Kinder das Lachen wieder erlernen.“
Das Herz war ihm schwer, als er an diesem Tag alleine, ohne Kinder, zurück in seine dunkle traurige Halle kehrte, aus der nur die klagenden Laute seiner Frau zu vernehmen waren. Er betrat das Haus nicht, sondern nahm auf der Bank Platz und die Tränen rannen haltlos an seinen Wangen herab. Ginguf setzte sich still zu ihm und sprach zunächst nichts. Aber dann richtete er doch das Wort an Raflan.
„Erzähle mir von deiner Heimat, Raflan. Erzähle mir von dem jährlich wiederkehrenden Wunder, wenn Früchte und Blüten zusammen an einem Baum wachsen. Schildere mir den Duft dieser Blüten. Und erzähle mir von den wundersamen Blumen, die in deinem Land blühen.“
Raflan schenkte Ginguf einen warmen Blick.
„Du weißt doch, wie diese Früchte heißen. Du hast sie doch zusammen mit mir gekostet.“
„Aber ich kann sie nicht so gut beschreiben wie du. Und wenn du davon erzählst, spüre ich den Geschmack wieder auf der Zunge, kann mir diesen unvergleichlichen herrlichen Duft vorstellen. Du hast einfach die besseren Worte dafür.“
Raflan wischte sich mit dem Handrücken die Tränen weg.
„Die Früchte nennt man bei uns Alburtuqaliu. Am Hof von König Sigfridson hörte ich, dass sie hier die Frucht Apfelsine nennen. Und im Winter kannst du die Früchte ernten, die die Größe eines Apfels haben. Schon wenn du die Schale entfernst, nimmt dich das Aroma gefangen. Sie sind das süßeste, was du jemals gegessen hast und es ist nur mit dem zarten Kuss einer schönen Frau vergleichbar. Die weißen herrlichen Blüten erfüllen das Land mit einem zarten Hauch, der direkt von Allah zu wehen scheint und jedermann, der hinaus in die Natur geht und ihren Duft wahr nimmt, wird es leichter um das Herz. Es ist jedes Mal ein Wunder zu sehen, dass zusammen mit den Früchten, der Baum bereits zarte, weiße Blüten trägt, als wolle er den Blüten zeigen, welche perfekte Form und Farbe sie dereinst einnehmen. Allah muss sie in seinem eigenen Garten haben, zu wundersam und herrlich ist dieser Geruch, der dich alles Leid dieser Welt vergessen lässt. Und Blumen gibt es dort, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Warda nennen wir diese zarten Blüten, die mit ihrer Schönheit und ihrem unvergleichlichen Duft unsere Dichter zu wundervoller Poesie inspiriert. Aber zugleich ist diese unvergleichliche Blume mit ihren sanften und zugleich feurigen Farben in der Lage, dich zu verletzen, weil sie zahllose kleine Dolche zur Verteidigung an ihren Stielen hat. Es ist die Zartheit und zugleich die Kraft, die so unendlich fasziniert. Und keine der Blüten gleicht der anderen. Jede Blume ist ein Wunderwerk Allahs, das er in seiner unendlichen Güte erschaffen hat, um sich und den Menschen Freude zu bereiten.“
„Ich nannte sie Rosen.“
So saßen sie den ganzen Abend zusammen und sprachen über die Wunder der Welt und Raflan war wieder bereit, dank dem lieben Ginguf, die Sorgen und Nöte der nächsten Tage zu meistern. Er dachte viel an seine Kinder, aber er hatte nicht mehr ganz so das Gefühl, sie im Stich gelassen zu haben. Der Schamane hatte weise gesprochen. Die Kinder wurden hier immer stiller und liefen Gefahr, genau so krank zu werden wie ihre Mutter. Und nun waren sie schon seit Wochen auf dem Hof des Freundes.
Dort wuchsen sie zusammen mit den eigenen Kindern Sturluffsons und Svanhild auf und wurden wie eigene Kinder geliebt. Aber Raflan verspürte starkes Heimweh nach Freda und Lodnar. Er hatte zwei Tage auf dem Gut des Freundes verbracht, weil er eines Teils seine Kinder wiedersehen und in den Arm nehmen und andererseits, weil er mal wieder lachen und Geschichten lauschen wollte. Es war bemerkenswert, welche Veränderungen die Kinder seit dem Winter gemacht hatten. Lodnar ritt schon sein eigenes kleines Pony und war ihm sogar von Sturluffsons Gut entgegen geritten und hatte mit ihm gewettet, wer als erster von ihnen das Gut erreichte. Rie Sarierie hatte Lodnar und seinem hellbraunen Pony großzügig den Sieg überlassen. Den ganzen Nachmittag prahlte Lodnar damit, dass sein Pony den unschlagbaren Rie Sarierie besiegt hatte. Svanhild erzählte ihm, dass Freda zunächst nicht von ihrer Mutter weg wollte, tagelang nur weinte und am Tisch keine Mahlzeit anrührte. Zu ähnlich war sie ihr in ihrem Wesen. Aber Svanhild ließ sie einfach gewähren und baute darauf, dass ihre eigenen Kinder mit ihrem Lebenswillen ansteckend auf Freda wirkten. Als erfahrene Mutter wusste sie, dass der junge Körper von Freda seinen Tribut einforderte. Und so geschah es auch. Als er vor zwei Tagen auf dem Gut ankam konnte er beobachten, wie Freda, warm eingepackt und trotz der Kälte, mit der gleichaltrigen Tochter Sturluffsons hingebungsvoll draußen vor dem Haus mit Stoffpuppen spielte und sie sich gegenseitig mit getrockneten Apfelringen fütterten. Die dunklen Schatten unter den Augen waren gänzlich verschwunden und es war eine Freude zu sehen, wie sie aufblühte. Auf ihren zarten Wangen zeigte sich erstmals eine zartrosa Farbe.
Abends, am großen Feuer in der Halle, wurden alte Geschichten erzählt und besonders zotige Lieder gesungen, weil man Raflan damit aufheitern wollte. Die hübsche, brünette Magd Alva, die ihm den Met einschenkte, warf ihm heiße Blicke zu. Der Duft ihres Körpers, der ihn umgab als sie sich, natürlich völlig unabsichtlich, eng an ihm vorbei drängte um die anderen Gäste zu bedienen, raubte ihm schier den Atem. Allzu lange hatte er schon keine Frau mehr in den Armen gehalten. Als er spät in der Nacht angenehm berauscht von dem Met auf seiner Lagerstatt lag, kam sie still und leise in sein Gemach. Alva trug nur ein weißes Schlafgewand und ihre dunklen Haare fielen ihr bis auf die Hüften. Sie stellte die Öllampe neben sein Bett und sah ihn herausfordernd an. Aufreizend langsam ließ sie das Gewand über ihre Schultern auf den Boden gleiten. Raflans Atem ging schneller, ohne dass er etwas dagegen tun konnte. Sein Herzschlag beschleunigte sich, als er die sinnliche, üppige Schönheit der Frau aufsaugte wie ein Schwamm.
„Göttin Freya verblasst vor deiner Anmut und deiner Schönheit. Du bist wie ein wundervoller Sonnenaufgang an einem Frühlingsmorgen. Und deine Haut hat die Farbe von herrlichem Alabaster und ihr Duft gleicht der von Blumen auf einer sonnenüberfluteten Wiese.“
„Freya ist in Asgard,“ hauchte sie mit samtiger Stimme. „Aber ich bin hier und bin aus Fleisch und Blut!“
„Das bist du wohl. Es wäre ein arabischer Dichter nötig, der deine Schönheit auch nur annähernd beschreiben kann.“
„Kein arabischer Dichter kann dich übertreffen.“
Alva nestelte an dem Gewand Raflans herum, zog es ihm über den Kopf und warf es achtlos vor das Bett. Ihr gefiel, was sie so stürmisch entblättert hatte.
„Ich bin nicht wegen den Worten eines Dichters hier. Lassen wir doch den Worten Taten folgen. Die Nacht ist viel zu kurz!“
Im Morgengrauen zog sich Alva aus seiner Schlafstatt zurück und überließ Raflan seinen süßen Träumen. Am Morgen wirkte er in der Halle beim Frühstück etwas zerstreut und übermüdet. Auf seiner Haut roch er immer noch den wunderbaren Duft von Alva und es gelang ihm zunächst nicht, sich so richtig an den neuen Tag zu gewöhnen. Alva brachte ihm frisches Fladenbrot und eine wohl schmeckende Suppe aus Kohl mit Erbsen und Gerste drin.
„Wie ist es möglich, dass du zu so früher Stunde so schön bist? Seit den frühen Morgenstunden, als die Nacht noch nicht dem Tage gewichen war, gehst du bereits deinem Tagwerk nach. Sieh dagegen mich an! Ich wirke völlig übernächtigt, der Kopf ist schwer, als würde er nicht zu mir gehören, meine Augen sind umschattet und liegen tief in den Höhlen.“
Alva schenkte ihm ein hintergründiges Lächeln.
„Für deine umschatteten, tiefliegenden Augen war ich zuständig. In deinen Armen zu liegen, war mir mehr als eine Wonne.“
„Du bist es, die meine Sinne zum erblühen brachten. Dank dir liebe ich wieder das Leben.“
Alva griff in ihren Ausschnitt und förderte eine kleine runde Holzscheibe zu Tage. Darauf war ein verschlungenes Muster zu sehen, das entfernt an eine Blume erinnerte.
„Dieser Talisman ist für deine Frau. Er besitzt große Kraft und wird sie vor Dämonen und Trollen schützen.“
Alva legte ihm sanft den Talisman in die Hand.
„Danke.“
„Du wirst sehen, alles wird wieder gut und Gydeful wird dich eines Tages anlächeln und ins Leben zurückkehren.“
Seine Kinder und die Kinder Sturluffsons stürmten herein und forderten seine ganze Aufmerksamkeit. Alva verschwand lachend in die Küche, um die hungrigen „Bestien“ zu füttern. Aus den umliegenden Höfen kamen noch andere Bauern und junge Männer die sich eingefunden hatten, weil es sich herum gesprochen hatte, dass Raflan zu Besuch bei Sturluffson war.
Nachmittags war ein Mann zu Gast in Sturluffsons Halle, den Raflan noch nie gesehen hatte. Er konnte so um die dreißig Jahre alt sein. Er war hochgewachsen, seine blonden Haare waren schulterlang, aber über der Stirn lichteten sich bereits die Haare und gaben einen mächtigen roten Schädel frei. Er stellte sich als Thure vor und trug in der Halle noch sein Kettenhemd. An der Seite hing an einem Gürtel ein Schwert. Raflan erkannte, dass es sich um ein handwerklich gut gearbeitetes, schönes Stück handelte, welches mit Sicherheit nicht nur zur Zierde getragen wurde. Auch der Körperbau Thures deutete darauf hin, dass Waffen zu seinem Lebensinhalt gehörten und er täglich mit ihnen übte. Als er zu Tisch gebeten wurde, legte er den Gürtel mit dem Schwert neben sich auf die Bank. Es gab gekochten Stockfisch mit Gerstenbrei und Fladenbrot. Die Gäste freuten sich auf das Essen, denn bei manchem waren die Vorratskammern schon lange leer. Sturluffson galt als wohlhabend und so war er in der Lage, mehr Vorräte als die meisten Bauern einzulagern. Es war eigentlich wie jedes Jahr. Im Frühjahr waren alle Fleischreserven aufgebraucht und der Stockfisch half ihnen, die fleischlose Zeit zu überstehen. Aber der Stockfisch war gut gewürzt, der Gerstenbrei schön heiß und das Fladenbrot frisch.
Thure tauchte genüsslich seinen Löffel in den dampfenden Gerstenbrei.
„Ach, schmeckt das gut! Das war ein sehr strenger Winter.“
„Das kann man wohl sagen,“ antwortete Sturluffson. „Ich bin erleichtert, wenn wir die erste Aussaat beginnen können. Unsere Vorräte neigen sich dem Ende zu. Es wird allerhöchste Zeit, dass Freyr, unser Gott der Fruchtbarkeit, uns ein Zeichen gibt, damit das Korn rechtzeitig in den Boden kommt.“
Thure nickte leicht und wischte mit dem Brot die letzten Reste des Gerstenbreis auf.
„Wie viele Kühe sind euch in diesem Winter verreckt?“
„Mir ist bloß eine verreckt und die war schon ziemlich alt. Ich hatte in dieser Hinsicht großes Glück.“
Die graublauen Augen Thures waren auf Raflan gerichtet.
„Und wie sieht es mit dir aus? Gibt es bei dir auch einiges zu beklagen?“
Raflan sah den Fremden nachdenklich an. Woher wusste Thure, dass er über einen eigenen Gutshof verfügte? Das stand ihm schließlich nicht in roten Lettern auf der Stirn geschrieben.
„Warum so misstrauisch, mein Freund? Ich habe gesehen, was für ein herrliches Tier du reitest und deine Garderobe sieht auch nicht aus, wie die eines Untergebenen. Und du wirst wohl nicht über Nacht aus dem Morgenlande gekommen sein.“
Das hatte Raflan nicht bedacht.
„Ich habe auch eine Kuh zu beklagen. Es war einfach nicht genug Futter da, um sie durch den Winter zu bringen. Ziegen sind leichter zu halten und fressen im Gegensatz zu Kühen einfach alles, was man ihnen anbietet.“
„Aber genügt es trotzdem um ein, sagen wir wir, luxuriöses Leben zu führen? Warst du in der Lage, jeden Tag im Winter gutes Met und gutes Bier zu trinken und jeden Tag vortreffliches Fleisch zu essen?“
Raflan krauste leicht die Stirn.
„Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Jedermann weiß doch, dass Bier und Met nur hergestellt werden, wenn ein Feiertag ansteht. Wie das Julfest zum Beispiel und im Frühling das Fest der Yggdrasil. Oder wie heute, wenn ein guter Freund zu Besuch kommt. Und hier, in diesen nordischen Breiten, wird nicht jeden Tag Fleisch gegessen. Wie sollte das denn gehen? Jeder kann nur eine begrenzte Anzahl an Tieren halten, mehr lässt sich auf unseren Höfen einfach nicht erwirtschaften.“
Raflan hob seinen Becher zu Sturluffson und trank einen Schluck.
„Da sagst du was, Raflan!“
Obwohl er Muslime war, gönnte er sich hin und wieder so ein herrliches Getränk. Der Geist wurde freier und man konnte herrlich über alberne Witze lachen, die bei Raflan leider die letzte Zeit viel zu kurz gekommen waren. Im maurischen Spanien flüsterte man sich sogar zu, dass die berühmten Dichter hin und wieder einem Becher andalusischen Weins nicht abgeneigt waren und so ihren Inspirationen freien Lauf lassen konnten.
Thure klopfte sich auf die Oberschenkel.
„Tja, worauf will ich hinaus?“
„Das frage ich mich mittlerweile auch!“ Sturluffson füllte den Becher von Thure nach.
„Also, ich sage einmal so...“
Thure schaute in die Runde, ob er die Aufmerksamkeit eines jeden am Tisch hatte.
„Es könnte uns bedeutend besser gehen.“
„Da stimme ich dir voll zu,“ grölte Sturluffson, dem man mittlerweile anmerkte, dass das Met seine Wirkung auf den Geist voll entfaltete. „Wenn der Winter nur zwei Monate dauerte, würde es uns allen besser gehen. Die Kühe und die Weiber würden den Frühling viel früher spüren und uns Männer wissen lassen, dass es Zeit ist, neue Nachkommen zu zeugen!“
„Dann möchte ich wissen,“ rief einer der Gäste am Tisch dazwischen, „warum die meisten Kinder immer zwischen August und Oktober auf die Welt kommen.“
„Das ist wohl wahr,“ grölte ein anderer Gast. „Bei manchen Äckern ist es nun einmal wichtig, sie im Winter zu bearbeiten, damit die Ernte im Sommer stimmt.“
Thure schien verärgert zu sein, dass das Gespräch nicht die Richtung einschlug, die er sich erhofft hatte. Er musste unbedingt wieder das Ruder übernehmen. Er knallte den Becher wuchtig auf den Tisch, ergriff seinen Dolch und ließ ihn effektvoll mit der Spitze in der Tischplatte landen. Erstaunt hielten die Männer inne. Nur hin und wieder hörte man noch einige Heranwachsende kichern.
„Bei den Göttern! Verspürt ihr denn nicht die geringste Lust, dafür zu sorgen, dass eure Kinder das ganze Jahr lang satt werden? Verspürt ihr denn nicht die geringste Lust, eure Frauen reich mit Gold und Geschmeide auszustatten und ihnen somit Ehre erweist und eure Hallen von ihrer Schönheit strahlen?“
Svanhild warf einen ihrer dicken, goldenen Zöpfe zurück und bedachte Thure mit vernichtenden Blick.
„Willst du damit sagen, dass ich hässlich bin, weil an mir kein Gold klimpert?“
Die Gäste, einschließlich Sturluffson, starrten Thure böse an. Sturluffsons Verstand war mittlerweile durch den Met stark eingeschränkt. Mit glasigen Augen stierte Sturluffson Thure an.
„Wenn du meine Frau hässlich findest, prügele ich den Stockfischeintopf, samt Gerstenbrei und Met aus dir heraus, bis sie dir im schönsten Licht erscheint. W...was hältst du davon?“
Raflan hatte seinen Becher mit Met nicht mehr angerührt, als Thure in Sturluffsons Haus erschienen war. In seinen vielen Jahren, in denen er in Sigfridsons Dienst stand, hatte es ihm so manches Mal geholfen, wenn er seinem Instinkt gefolgt war. Das gedachte er hier auch zu tun. Was wollte dieser Krieger hier in dieser Einöde? Was war seine Absicht? Was war König Sigfridsons Absicht? Aber damit er diese endlich kund tun konnte, musste es Raflan zunächst einmal gelingen, die Wogen zu glätten, damit der Abend nicht in einer sinnlosen Rauferei endete.
„Ich glaube nicht, dass Thure die Schönheit deiner Frau Svanhild anzweifelt. Vielmehr lag ihm wahrscheinlich daran, mit welchen Attributen man ihre Schönheit noch unterstreichen könnte.“
Thure erhob seinen Becher und prostete Raflan zu.
„Genau so ist es, mein arabischer Freund. Die Schönheit Svanhilds und eure Gastfreundschaft werden weithin gerühmt. Und ich werde nicht aufhören, Svanhilds Schönheit überall zu verkünden!“
Svanhilds grüne Augen schauten immer noch misstrauisch.
„Das möchte ich dir auch geraten haben!“
Raflan klopfte aufmunternd auf die Schulter Thures.
„Erkläre uns doch dein Begehr. Was lässt dich zu dieser ungastlichen Jahreszeit umtreiben und scheint dir so wichtig zu sein?“
Thure warf ihm einen dankbaren Blick zu.
„König Sigfridson schickt mich. Er sucht freie Männer, die in der Lage sind, eine Waffe zu führen!“
„Dann soll er weiter suchen!“ rief einer der Gäste. „So einen Scheiß brauche ich nicht. Wer soll das Land bestellen?“
„Wir sind doch ohnehin schon viel zu wenig Männer!“
„Ich wusste gar nicht, dass König Sigfridson einen Waffengang plant. Normalerweise ziehen doch schon einige Wochen vorher Gerüchte durch das Land.“
Sturluffson glotzte in seinen leeren Becher. Svanhild nahm den Krug mit Met vom Tisch. Zu oft war ihr Mann im Vollrausch Vereinbarungen eingegangen, die er im nüchternen Zustand niemals getan hätte.
„Der Met ist alle!“ verkündete Svanhild scharf. „Und ich glaube nicht, dass ich darüber sehr traurig bin.“
Schmollend zog Sturluffson seinen leeren Becher zurück.
„Ich habe auch keine Zeit für einen Waffengang. Wie stellt sich König Sigfridson das vor? Sollen wir im Herbst von Luft und Liebe leben?“
Er warf seiner Frau einen begehrlichen, verheißungsvollen Blick zu.
„Ich sage nicht, dass das eine schlechte Idee wäre, aber ich habe noch kleine hungrige Mäuler zu füttern und da funktioniert das leider nicht. Also muss ich das Angebot leider dankend ablehnen.“
Thure zog die Mundwinkel nachdenklich nach unten.
„Ich werde sehr gerne König Sigfridson ausrichten, dass es dir wichtiger ist, das Bett mit deiner Frau zu teilen, als dem König mit deiner Waffe zu dienen!“
Sturluffson war mit einem Schlage wieder nüchtern. Er sprang auf, schlug mit beiden Fäusten auf den Tisch, so dass die Becher umfielen und zu Boden fielen. Plötzlich hatte er seinen Dolch in der Hand und hielt ihn drohend hoch.
„Thure! Du bist Gast in meiner Halle! Du sitzt an meinem Tisch! Du frisst und säufst, als ob es das selbst verständlichste wäre, dass du meiner Vorratskammer den Garaus machst und wagst es mich zu beleidigen?“
Die kleinen Mädchen krochen schnell unter Svanhilds Rock und die Jungs warteten gespannt darauf, wie es wohl in dieser Auseinandersetzung weiter gehen würde.
Raflan spürte, dass die Situation kurz vor der Eskalation stand.
Thure und Sturluffson standen beide vor dem Tisch und sahen sich feindselig an. Svanhild hatte die Schnauze gestrichen voll.
„Alva nimm die Kinder aus der Halle und bring sie zu Bett.“
Sturluffsons Söhne und Raflans Lodnar protestierten ziemlich lautstark.
„Wir sind schließlich schon Männer und werden später berühmte Krieger werden. Und wir wollen auch so ein Schwert wie Thure haben. Wir prügeln uns immer nur mit Holzschwertern herum!“
„Eure Schwerter aus Holz genügen aber, dass ihr euch damit ziemliche Blessuren zufügen könnt. Außerdem seid ihr mit maximal sechs Jahren noch lange keine Männer!“
„Woher willst du das wissen?“
„Weil ich, außer bei Lodnar, eure Mutter bin und hier das Sagen habe! Und jetzt geht ihr brav mit Alva nach oben, weil ich nämlich sonst den hochherrschaftlichen Kriegern persönlich ordentlich den Hintern versohle! Und das gänzlich ohne Schwert, sondern nur mit der bloßen Hand auf den nackten Po. Na, wie gefällt euch das?“
Svanhilds Augen versprühten ein Feuer, vor dem nicht nur die Kinder Respekt hatten. Ziemlich kleinlaut zogen sich die Kinder unter der Führung von Alva zurück. Für einen Moment herrschte vollkommene Stille. Thure und Sturluffson standen sich immer noch feindselig gegenüber. Raflan stand ebenfalls auf, um die Streithähne zu beschwichtigen. Außerdem interessiert es ihn, ob König Sigfridson wirklich hinter den Absichten Thures stand.
„War es wirklich die Absicht von Thure dich zu beleidigen? War es das? Oder hat der gute Met nur unseren Verstand getrübt? Wäre es nicht besser, wenn wir uns alle hinsetzen und friedlich über alles sprechen?“
Sturluffsons Messer zeigte immer noch drohend auf Thure. Dieser hob entschuldigend beide Hände hoch.
„Ja, ja! Schon gut. Ich glaube auch, dass nach diesem Winter unsere Nerven etwas blank liegen. Vor wenigen Tagen war ich bei Ragnarson zu Gast. Seine kleine Tochter ist gestorben...Sie war gerade einmal vier Monate alt und das hat mich sehr betroffen gemacht.“
Sturluffson starrte Thure ungläubig an, der um Entsetzen zu zeigen, theatralisch sein Antlitz mit den Händen verbarg. Raflan hatte so seine Zweifel, dass Thures Trauer echt war.
„Ragnarsons Tochter ist tot? Das ist entsetzlich. Litt die Kleine unter einer schlimmen Krankheit? Oder hat sie das Fieber bekommen, das schon so viele Kinder von uns hinweg gerafft hat?“
„Nein.“
Thure spürte, dass er langsam wieder Oberwasser gewann.
„Seine Frau Hiltrud konnte die eigene Tochter nicht mehr stillen. Und wisst ihr warum?“
„Ich kann es mir denken,“ sagte Svanhild mit gesenktem Kopf.
„Hiltrud war vor Hunger so geschwächt, dass sie keine Kraft mehr in sich spürte. Geschweige denn, ein Kind zu nähren. Das Saatgut quoll auf und ist zu nichts mehr nütze. Das Korn verschimmelte und zu allem Überdruss brannte die Vorratskammer ab und vernichtete die ohnehin spärlichen Vorräte. Die Familie stand von einem zum anderen Tag ohne etwas zu essen da. Und wie das so ist, zahlen immer die Schwächsten die Zeche zuerst. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann Ragnarsons Frau der Tochter ins das dunkle Reich Hels folgen wird.“
Raflan gefiel diese Wendung des Gespräches nicht. Er spürte etwas, was er noch nicht in Worte fassen konnte. Aber als er Thure weiterhin zuhörte, wusste er, worauf er hin strebte. Und Raflan ahnte es schon, als er in die Gesichter der jungen Männer sah, die Thure begeistert ihre Aufmerksamkeit schenkten.
„Und das alles nur, weil er mit seinem Hof nicht genügend Vorräte erwirtschaften konnte,“ fuhr Thure jetzt mit donnernder Stimme fort. „Wisst ihr jetzt, was ich meine? Wie viele von euren Kindern müssen noch einen elendiglichen Hungertod sterben, obwohl sich doch andere, lohnenswertere Möglichkeiten ergeben?“
Raflan verschränkte seine Arme, um damit zu zeigen, dass er keines Falls damit einverstanden war.
„Du willst allen Ernstes, dass diese ehrbaren Männer hier Haus und Hof verlassen, um auf Viking zu gehen? Die meisten hier haben noch kein Schiff betreten und haben nur selten ihren eigenen Acker verlassen. Keiner von ihnen besaß jemals eine Waffe um damit zu kämpfen, sondern benutzte sie nur zur Jagd und sie wissen nicht, wie man mit einer Breidöx, also einer Dänen Axt, oder mit einem Schwert in den Kampf zieht. Auch glaube ich sagen zu dürfen, dass sie nicht darauf spezialisiert sind, ein „Strandhögg“ durchzuführen.“
Thure zeigte ein verschlagenes Grinsen.
„Was ist mit dir? Du scheinst dich mit Waffen bestens auszukennen. Du weißt auch Bescheid darüber, was ein „Strandhögg“ ist. Das schnelle anlanden, Beutezug machen und wieder weg sein, bevor Hilfe aus dem Innenland kommt. Das kann ich an deiner Haltung sehen und dein sarazenischer Dolch, den du an deiner Seite trägst, dient nicht nur zum Zwiebel schneiden.“
„Das gehört alles der Vergangenheit an.“
Raflan war böse, dass er so leicht zu durchschauen war. Thure ließ das Feuer nicht mehr ausgehen und hakte nach.
„Aber wer hat gesagt, dass es bei diesem Viking auf „Strandhögg“ geht? Ich glaube nicht, so etwas verlautet zu haben.“
„Das soll also heißen, dass die Männer länger unterwegs sind?“
„Was heißt schon länger, Raflan? Es kommt darauf an, wie man sich seine Zeit einteilt. Für die einen ist eine Woche eine lange Zeit und für die anderen sind zwei Monate auf Viking zu kurz.“
„Du willst nicht sagen, wohin die Viking geht?“
„Nein! Will ich nicht, Raflan. Du kennst das. Das nennt man Beutesicherung.“
„Aber diese jungen Männer haben keinerlei Erfahrung, was das...“
„Warum denn nicht?“ grölte ein angetrunkener, junger Mann. „Das kann man im Handumdrehen lernen! Ich habe es gründlich satt, bis ins Frühjahr hinein, immer nur das Allernötigste zu essen, um den nächsten Tag zu überleben.“
„Machen wir uns doch nichts vor,“ rief der Nächste. „Unsere Erträge werden immer dünner, die Äcker immer unergiebiger. Das ist doch nicht erst seit diesem Winter so!“
„Und bei vielen von uns ist es doch so, dass man als Zweitgeborener nichts auf der Hand hat. Nicht einmal heiraten und einen Hausstand gründen können wir. Da wäre es doch eine gute Möglichkeit, wenn man auf Viking Geld, Ruhm und Ehre erwerben könnte!“
Raflan war sich bewusst, dass es leider der Wahrheit entsprach, was der zornige, junge Mann wutentbrannt von sich gab. Viele junge Männer konnten kein Erbe erwarten und blieben für immer als Knecht auf den Höfen ihrer Eltern sitzen. Er war auch nicht in der Lage, den jungen Leuten eine vernünftige Lösung vorzuschlagen. Die Stimmung heizte sich auf und nacheinander pflichteten die jungen Männer Thure bei, tranken ihren letzten Met und ließen ihn mit Trinksprüchen hoch leben.
„Nach dem Viking werde ich mir das schönste Weib zulegen.“
„Mein Stehvermögen reicht für mehrere Weiber! Ich werde mir mindestens drei zulegen und sie mit Gold und Silber überhäufen.“
„Ich werde das bestimmt nicht tun.“
„Und warum nicht?“
„Weil ich dann drei Schwiegermütter bekäme und so etwas braucht kein Mensch, du hirnloser Depp.“
Die jungen Männer schwelgten in zukünftigen Phantasien, was sie mit dem erbeuteten Reichtum alles anstellten. Svanhild rammte Raflan ihren Ellbogen in die Seite.
„Bei allen Göttern! Wir müssen etwas tun, wir können sie doch nicht sehenden Auges ins Unglück rennen lassen!“
Raflan nickte und wartete bis sich die Jungs heiser gebrüllt hatten.
„Wollt ihr nicht zuerst mit euren Familien darüber sprechen? So etwas muss doch wohl bedacht sein und kann schwerwiegende Folgen für eure Zukunft haben.“
„Welche Folgen kann es denn haben? Dass ich verhungere? Tut mir Leid, Raflan, aber das schreckt mich auch nicht mehr ab.“
„Bei jedem Viking sterben Menschen! Die Beute bekommt man nicht geschenkt. Und so mancher Kamerad, der auf dem Schiff dein Freund wurde, kann neben dir ins nasse Grab sinken. Oder es trifft dich selbst und du liegst an fremden Gestaden und niemand wird deinen Tod beweinen.“
„Wäre das wirklich so schlimm? Wenn ich im Kampf sterbe, lande ich in Walhall. Dort sehe ich unsere berühmtesten Kämpfer und Helden und kann mich mit ihnen jeden Tag im Kampfe üben. Jeden Abend kann ich mich satt fressen und den Bauch mit gutem Met vollschlagen, bis ich im Vollrausch liege. Die schönsten Walküren, mit denen ich am Tage das Schwert geschwungen habe, teilen des Nachts mit mir das Lager und lassen keine Wünsche offen. Als Knecht bleibt mir nur Hels dunkles, kaltes Schattenreich.“
Als Raflan das Wort erheben wollte, kam ihm Thure zuvor.
„So eine Einstellung lobe ich mir! König Sigfridson wird begeistert sein. Ihr müsst euch nur noch in diese Rolle eintragen und dann kann es auch schon in wenigen Wochen, wenn die Winde günstig stehen, losgehen.“
„Kann ich die Rolle einmal sehen?“
„Aber gerne, Raflan. Zeigst du etwa doch Interesse?“
„Sagen wir, es ist Neugier.“
Raflan ließ die Rolle aus feinstem Pergament durch seine Hände gleiten. Sie beinhaltete den Aufruf zur Viking und war gekennzeichnet mit dem Siegel König Sigfridsons. Raflan war fassungslos. Es handelte sich um das echte Siegel seines Königs. In früheren Tagen war es sein ständiger Begleiter, wenn er für seinen König unterwegs war. Und auf der Rolle waren bereits zahlreiche Namen vertreten. Da die meisten allerdings des Lesens und Schreibens nicht mächtig waren, hatte Thure ihre Namen alle aufgeschrieben. Das war nichts außergewöhnliches.
„Aber was willst du mit all diesen unerfahrenen jungen Leuten? Es sind keine Seefahrer und sie werden auf einem Langboot hinderlich sein.“
„Ich sorge dafür, dass sie alle heil ans Ziel kommen. Der eine oder andere wird mehr kotzen, als er gefressen hat. Aber sie werden heil ankommen! Das verspreche ich bei Mjölnirs Hammer!“
„Bringt mir Feder und Tinte.“
„Du willst tatsächlich deinen Namen unter diesen Aufruf setzen? Das ist eine große Ehre für mich, dass ein feiner Herr mit so viel Erfahrung an dieser Viking teilnimmt. Unser Kriegsgott Tyr wird dir wohlgesonnen sein und du wirst reichlich Beute machen!“
Raflan wies auf die vielen Namen auf der Rolle „Tyr hat genug zu tun, diese Männer erfolgreich im Kampf zu unterstützen, damit ihnen Ruhm und Ehre zuteil wird. Allah wird für mich da sein und ihm obliegt es alleine, ob ich wieder heil nach Hause komme. Für unseren König bin ich immer zur Stelle und wenn er mich braucht, bin ich da. Schließlich habe ich in diesem Land eine neue Heimat gefunden.“
Thure überreichte ihm feierlich die Rolle, damit er seinen Namen darunter schrieb.
„Wohin soll denn die Viking gehen? Auf die Insel der Angeln und Sachsen? Oder hinüber ins Baltikum, zu den Reichen der Slawen?“
Über Thures Gesicht zog sich ein breites Grinsen.
„Ich werde rechtzeitig kundtun, wohin es geht. Nur so viel, die Runen haben gute Winde und noch bessere Beute versprochen.“
Die jungen Männer schrien aufgeregt alle durcheinander.
„Gute Winde heißt, schnelles Ziel erreichen und wir sind bald wieder Zuhause.“
„Wir werden reich sein.“
„Ich werde mir einen eigenen Hof kaufen.“
Raflan war entsetzt, dass die jungen Männer so leicht zu verführen waren.
„Gute Winde kann aber auch heißen, dass wir lange unterwegs sein werden, bevor es zur Viking kommt. Und haben die Runen auch gesehen, wenn es zurück nach Hause geht, dass wir dann auch gute Winde brauchen?“
Thure bedachte ihn mit einem nicht mehr ganz so freundlichen Blick.
Er rollte das Pergament zusammen und steckte es in ein Behältnis aus edlem Leder.
„Lasst euch überraschen!“
*
Die Reisekutsche blieb vor dem alten Gemäuer stehen. Der Mann auf dem Kutschbock sah in die grauen, verhangenen Wolken. In den Wipfeln der Bäume war zu sehen, wie sich ein starker Wind formierte, der die grauen Wolken vor sich her trieb. Die Türe der Kutsche öffnete sich und ein dicker, warmer Stoffvorhang wurde unwillig zur Seite geschoben.
„Warum bleiben wir stehen? Dieses alte Gemäuer kann ja wohl nicht das Ziel unserer beschwerlichen Reise sein.“
Der Mann auf dem Kutschbock deutete auf die Wolken.
„Ein Sturm zieht auf! Und wir haben noch mindestens eine halbe Tagesreise vor uns.“
Ein Herr in einem edlen Gewand stieg aus, um sich zu erleichtern.
„Verfügst du über die Gabe in die Zukunft zu sehen?“
„Nein, Halbrandt.“
„Dann fahre gefälligst weiter und höre auf hier herumzufaseln wie eine alte Wahrsagerin. Wo sollen wir denn hier übernachten? Und du weißt, dass wir heute noch ankommen müssen, egal was passiert.“
„Die Kutsche wäre doch gut geeignet, hinter dieser alten römischen Ruine das Wetter abzuwarten. Ich wollte dich doch nur vor der Gefahr eines Unwetters warnen, edler Herr. Es liegt mir fern...“
„Es reicht! Wir fahren weiter.“
Halbrandt wandte sich ab, um wieder in die Kutsche einzusteigen.
„Also, ich finde der Mann auf deinem Bock hat Recht. Wir werden ihn darin unterstützen, wo es nur geht.“
Neugierig ließ der Edelmann die Türe los, um zu sehen, wer das Wort ungefragt an ihn gerichtet hat. Hinter dem Gemäuer, durch einen verfallenen Torbogen, kamen vier schwerbewaffnete Reiter auf außergewöhnlich großen Pferden auf die Kutsche zu.
„A...ah die Panzerreiter des Kaisers! Hat man euch geschickt, um uns bis zur letzten Etappe sicher zu eskortieren?“
Einer der Panzerreiter nickte. Ein weiter Herr stieg aus der Kutsche und gesellte sich zu dem anderen.
„Hat euch Riedegard geschickt?“ rief der Mann auf dem Kutschbock.
„Aber ja,“ antwortete einer der Männer. „Schließlich sollen wir dafür sorgen, dass alles gut ankommt.“
„Ich wusste gar nicht, dass Riedegard schon wieder im Land ist.“ rief einer der Edelmänner.
„Keiner sollte wissen, dass wir unterwegs sind,“ entgegnete Halbrandt ungehalten.
„Dürfen wir erfahren, wer euch autorisiert hat, uns zu begleiten? Ihr könnt doch bestimmt ein Schreiben eures Dienstherren vorweisen?“
„Selbstverständlich!“
Einer der Panzerreiter griff in seinen Waffenrock und hielt ein Pergament in der Hand. Halbrandt studierte das Schreiben.
„Es ist eindeutig von Riedegard. Dann scheint alles in Ordnung zu sein, Gerhard.“
Der andere Herr mit selbigem Namen besah sich das Schreiben genauer.
„Ich verstehe das nicht, Halbrandt.“
Der Mann auf dem Kutschbock sprang behende herunter.
„Lasst uns die Reise fortsetzen. Es kommt ein Unwetter auf!“
„Nimm sofort wieder deinen Platz ein,“ forderte Gerhard. Ein starker Wind kam auf und Halbrandt und Gerhard wickelten ihre Mäntel enger um sich. Der Mann, der die Kutsche führte, blieb stehen und sah erwartungsvoll auf die Panzerreiter.
„Ich hielt es für besser, das Unwetter hier abzuwarten, weil die nächste Herberge viel zu weit entfernt ist. Wir werden diesem ankommenden Wetter schutzlos ausgeliefert sein.“
„Das sind nur Wolken und sonst nichts. Einen Regenschauer werden wir wohl noch überstehen. Und so viel ich weiß, sind unsere Pferde auch wasserdicht. Du brauchst dir also keine Sorgen zu machen.“
Gerhardt studierte nach wie vor das Schreiben.
„Wieso gibt Riedegard zweierlei Anweisungen? Das hier entspricht doch genau dem Gegenteil, was er mit uns abgesprochen hat.“
„Du stellst zu viele Fragen, Gerhard. Panzerreiter müssen sich nicht vor anderen rechtfertigen. Vielleicht hatte er Rücksprache mit unserem Kaiser und musste seine Anordnungen ändern.“
Zwei der Panzerreiter ritten weiter auf die Männer vor der Kutsche zu. Sie ließen die Speere in die Waagerechte fallen.
„Er hat vollkommen Recht,“ rief einer der Reiter. „Wir müssen mindestens bis an die nächste Straße kommen. Wenn uns das Unwetter hier überrascht, findet uns kein Mensch. Und wir haben die Aufgabe, euch sicher bis ans Ziel zu geleiten.“
Gerhard wandte sich an den penetranten Kutscher, der immer noch stocksteif auf der Straße stand.
„Du hast gehört, was dieser ehrenwerte Herr gesagt hat. Mach, dass du zurück auf deinen Platz kommst. Wir haben schon viel zu viel Zeit verschwendet!“
Widerwillig kletterte der Mann wieder auf den Kutschbock. Die Herren stiegen ein und die Panzerreiter eskortierten. Nach einer Weile, es war bereits schummriges, dämmriges Licht und es würde nicht mehr lange dauern bis das letzte Tageslicht der Nacht weichen würde, hielt die Kutsche wiederum an. Der Wind wurde stärker und heulte in den Bäumen. Es fielen erste Tropfen.
„Was ist denn jetzt schon wieder los?,“ polterte Halbrand.
„Ich kann nichts dafür,“ brüllte der Kutscher gegen den scharfen Wind. „Das Rad blockiert. Ich muss nachsehen.“
Der Kutscher rüttelte an dem Rad. Der Wind heulte um die Kutsche und zwischen dem eiskalten Regen waren einzelne Schneeflocken auszumachen.
„Da ist nichts mehr zu machen. Das Radlager ist heiß gelaufen. Und ich habe kein Fett mehr dabei, um es wieder gleitfähig zu machen.“
Die Herren stiegen aus der Kutsche, um sich den Schaden anzusehen.
Der eiskalte Wind wehte ihnen ins Gesicht.
„Aber wie ist denn das möglich? Bei dieser Kälte?“
Der Kutscher schüttelte den Kopf.
„Ich kann nur davon ausgehen, dass man uns ein defektes Rad bei diesem Wagner eingebaut hat.“
„Wo befinden wir uns überhaupt? Das ist doch nicht die Straße, die wir erreichen wollten.“
„Ich hörte die ganze Zeit schon, dass mit dem Rad etwas nicht stimmt und bin nur an die Seite gefahren. Die Straße liegt unmittelbar hinter uns.“
Ein Panzerreiter stieg ab und kam mit besorgter Miene auf die Herren zu.
„Wir hätten auf den Kutscher hören sollen. Gebt uns die Kiste. Wir werden dafür sorgen, dass sie pünktlich in Aachen ankommt.“
Halbrand hob entrüstet die Hände hoch.
„Und was wird mit uns? Sollen wir hier in diesem Wetter ausharren und verrecken? Das kommt überhaupt nicht in Frage!“
„Wir werden euch Hilfe zukommen lassen. Und jetzt gebt uns die Kiste, uns läuft die Zeit davon! Ihr wisst in welchen Schwierigkeiten wir uns derzeit befinden.“
„Das können wir nicht machen! Wir haben dem Kaiser einen Eid geschworen. Lasst uns gemeinsam das Unwetter abwarten und dann können wir entscheiden, wie es weiter geht.“
„Wir können uns nicht mit solchen Kleinigkeiten abgeben! Die Kiste muss auf alle Fälle pünktlich in Aachen sein. Ihr und euer marodes Equipment seid augenscheinlich dazu nicht in der Lage, den Auftrag des Kaisers zu erfüllen.“
„Es tut mit Leid. Aber wir sehen uns außerstande, euch gegen unseren Eid die Kiste auszuhändigen.“
Der Anführer der Panzerreiter warf Halbrandt einen spöttischen Blick zu.
„Der Kaiser wird es euch nicht danken, dass ihr lieber mit der Kiste hier im Ödland absauft, anstatt sie in sichere Hände an uns zu übergeben.“
Die Panzerreiter schlossen mit ihren riesigen Pferden einen Kreis eng um die Kutsche. Die Herren, den Verrat und das Unheil ahnend, gingen mit kleinen Schritten rückwärts auf die Kutsche zu. Sie zogen ihre Schwerter und hielten sie drohend vor sich.
„Was soll denn das? Wir sind die Eliteeinheit des Kaisers und keine Wegelagerer! Verharrt bei dem Wetter in der Kutsche und wir schicken euch Hilfe vorbei. Aber ihr wisst doch selbst, wie wichtig es für unseren Kaiser ist, dass jeder Denar pünktlich ankommt. Gebt uns die Kiste und wir vergessen, dass ihr die Panzerreiter des Kaisers mit dem Schwert bedroht habt!“
Die Herren Halbrandt und Gerhard waren jetzt doch verunsichert.
Einen Panzerreiter anzugreifen wurde mitunter sogar mit dem Tode bestraft. Die Lanzen waren immer noch auf ihn und Gerhard gerichtet..,
„Riedegard weiß doch, was er tut. Es wird seinen Grund haben, Gerhard.“
„Dann sollen sie die Kiste haben.“
Sie gingen zur Kutsche, zogen die schwere Kiste heraus und übergaben sie an die Reiter.
„So ist es besser. Und jetzt setzt euch in die Kutsche und so schnell wie irgend möglich werden wir euch Hilfe zukommen lassen.“
Der Kutscher arbeitete auf der anderen Seite des Gefährtes.
Anscheinend versuchte er, die Kutsche wieder fahrbereit zu machen.
Die Herren beachteten ihn nicht und stiegen ein. Aber anstatt sich auf den Weg zu machen, verharrten sie. Ein Panzerreiter ritt mehrmals um die Kutsche.
„Was soll das nun wieder?“
Halbrand wollte die Tür öffnen. Aber sie war verschlossen. Als er den Vorhang zur Seite zog sah er, dass stabile Lederriemen um die Kutsche geschlungen waren. Ein Sturm kam auf und heulte in den Baumwipfeln. Der Kutscher hatte unbemerkt die Pferde abgeschirrt und jagte sie in den Wald hinein. Ein seltsamer, übelriechender Geruch verbreitete sich. Es gab für die Insassen kein Entkommen.
„Das müsste genügen!“ brüllte einer der Panzerreiter.
„Hoffentlich macht uns das Wetter keine Probleme.“
„Und wenn es junge Hunde schneit wird das Ding brennen wie Zunder.“
Die Insassen spürten, dass die Kutsche in Bewegung geriet.
„Noch einen Ruck und der Rest kommt von ganz alleine!“ brüllte ein Panzerreiter.
Die Kutsche rollte führerlos einen Abhang hinunter und brannte lichterloh. Die Herren in der Kutsche schrien verzweifelt um Hilfe.
Der aufkommende Sturm sorgte dafür, dass die Flammen hungrig an der Kutsche ihr schauriges Werk vollbrachten. Die Schreie der verzweifelten Männer wurden leiser und erstarben schließlich ganz.
Die Kutsche überschlug sich und die brennenden Räder führten ein gespenstischen Eigenleben. Schließlich blieb die Kutsche am Ende des Berges liegen und brannte völlig aus.
„Warum haben wir diese Pfaue eigentlich nicht mit unseren Lanzen erledigt?“
Einer der Panzerreiter sah missbilligend in die Runde.
„Wir sollen keine Spuren hinterlassen. Also haben wir unsere Lanzen nicht benutzt. Hast du das vergessen? Nichts soll darauf hinweisen, wer diese schändliche und zugegebenermaßen, viel Geld bringende Tat vollbracht hat.“
„Eigentlich trifft uns keine Schuld.“
„Das ist jetzt selbst für mich schwer zu begreifen.“
„Ich kann mich erinnern, dass sie uns die Kiste freiwillig überlassen haben. Es war keine Gewalt nötig.“
„Ja, wenn man das von dieser Seite aus betrachtet...aber wir konnten sie trotzdem nicht am Leben lassen.“
„Natürlich nicht. Wer will denn so etwas?“
Die Kiste verstauten sie auf dem Ersatzpferd, auf dem der Kutscher sitzen sollte. Er sah dem brennenden Gefährt hinterher.
„Ihr habt alles was ihr wolltet. Wann bekomme ich nun meinen Anteil?“
Die Panzerreiter wechselten Blicke.
„Was sollen wir mit ihm machen?“
„Fragen wir lieber, was Riedegard an unserer Stelle mit ihm tun würde!“
„Er wäre sehr rücksichtsvoll und würde sagen, dass das Pferd mit der Kiste völlig ausgelastet wäre.“
Einer der Panzerreiter richtete mit einem hämischen Grinsen seinen furchterregenden Spieß auf den Kutscher. Voller Angst und mit weit aufgerissenen Augen versuchte er, seinen Hals aus der Schlinge zu ziehen. Die Entschlossenheit des Reiters ließ ihn vollends die Beherrschung verlieren. Dicke Tränen kullerten an seinen schmutzigen Wangen herunter.
„A...aber ohne mich wäre euer Vorhaben nicht von Erfolg gewesen.
Ich habe sie direkt in eure Arme getrieben. Riedegard wäre stolz auf mich.“
„Du hast schon meinen Silberreif bekommen! Wenn du vor ihm stehen würdest, dürftest du ihn noch nicht einmal ansprechen. Du bekommst, was alle Verräter verdienen.“
Der Kutscher erhob sein altes, rostiges Schwert. Aber dann wurde ihm bewusst, dass er die Leibgarde des Kaisers vor sich hatte, mit der besten militärischen Ausbildung. Nur mit ihnen war es dem Kaiser gelungen, solch ein großes Reich zu erobern. Daher entschloss sich der Kutscher zur Flucht. Seine Knie schlotterten erbärmlich vor Angst. Wenn er es bis zu den dichten Sträuchern am Wegesrand schaffen würde, wäre es für die Panzerreiter unmöglich, ihn mit ihren riesigen Jütländern zu verfolgen. Er bezwang seine Angst und das Zittern wurde weniger. Er rannte. Und er rannte schnell.
„Bloß nicht nach hinten sehen!“ sagte er sich immer wieder. Er hatte es fast geschafft. Die Sträucher kamen näher...Nur noch wenige Fuß trennten ihn vom vermeintlich sicheren Wald. Ein Pferd ohne Sattel rannte aus dem Wald heraus und kreuzte seinen Weg. Der Kutscher war gezwungen einen Moment inne zu halten, um nicht mit dem Pferd zu kollidieren. Erstaunt sahen die Panzerreiter dem dunkelbraunen Tier hinterher.
„Wo ist der Reiter von diesem durch gedrehten Vieh?“
„Wenn es einen gibt, müssen wir ihn finden.“
„Riedegard wäre nicht begeistert, wenn es von dieser Schweinerei hier Zeugen gäbe.“
Das Pferd rannte völlig kopflos über die angrenzende Weide und war bald im Nebel verschwunden. Ein Panzerreiter ritt an die Stelle, an der das Pferd aus dem Wald trat.
„Ich kann keine menschlichen Spuren finden. Das Pferd scheint aus einem Stall ausgebrochen zu sein. Aber habt ihr gesehen, wie bescheuert das Vieh ausgesehen hat? Und dieser dicke, runde Kopf? So etwas habe ich hier noch nicht gesehen.“
Der Kutscher nutzte die Gunst des Augenblicks, um den schützenden Wald zu erreichen. Aber die erfahrenen Panzerreiter hatten ihn nicht aus den Augen gelassen. Ein Panzerreiter setzte ihm nach und ohne sich groß anzustrengen, hieb er dem Kutscher den Arm samt Schwert noch vor dem Wald ab. Entsetzliche Schmerzensschreie ausstoßend brach der Mann zusammen. Der Panzerreiter stieg von seinem Pferd ab und durchschnitt die Kehle des vor Schmerzen brüllenden Mannes. Danach schleifte er ihn bis zu dem Abhang und schmierte ihn mit dem übrigen Pech voll. Es dauerte etwas, bis er den Kienspan entzündet hatte, aber dann stand der Mann lichterloh in Flammen.
Der Ritter versetzte dem brennenden Leichnam einen Tritt und er rollte brennend den Abhang hinunter. Der einsetzende Schneefall hüllte alles ein. Die Kutsche und der leblosen Körper brannten ungehindert weiter, auch wenn alles rings um in tiefem Schnee versank.
„Du hast vergessen, vorher deinen Reif wieder an dich zu nehmen!“
„Er wird mit verbrennen!“
„Das will ich doch hoffen, sonst verrät er dich!“
*
Es war bereits finsterste Nacht und der eisige Wind wehte ihm ins Gesicht. Die Schneekristalle waren wie boshafte kleine Messer, wenn sie auf das Gesicht des Mannes trafen. Seine Haare waren von Eisfäden durchzogen. Das Pferd zeigte schon seit einiger Zeit, dass es dringend eine Pause brauchte und schleppte sich nur noch mühsam vorwärts. Es ließ schließlich den Kopf hängen und blieb stehen.
„Wir müssen weiter, mein Freund! Was wir gesehen haben, war nicht für unsere Augen bestimmt! Ich kann dich so gut verstehen, dass du davon gelaufen bist! Aber das war auch sehr gefährlich, mein einfältiger Freund. Aber da du dich von der Angst regieren lässt, war das wohl nicht zu vermeiden. Irgendwann kostet dich das dein Leben!“
Aber auch zureden half nicht weiter. Der Mann musste erkennen, dass sein bester Freund und Begleiter am Ende war. Er stapfte mit dem völlig erschöpften Pferd in den Wald hinein, um dort Schutz zu suchen. Im Wald war das Schneetreiben einigermaßen erträglich. Die Umrisse der Bäume waren durch den weißen Schnee trotz der finsteren Nacht gut zu erkennen. Unter einem Tannenbaum blieb er schließlich stehen. Er nestelte an seinen Vorratstaschen herum und fand noch eine Brotrinde. Ein kleines Stück brach er für sich ab und den Rest gab er dem Pferd. Das Pferd rieb aus Dankbarkeit seinen Kopf an der Schulter des Mannes. Das Schneetreiben wurde immer dichter.
„Wie sollen wir bloß die Nacht überstehen? Wir hätten schon längst an dieser Hütte sein sollen! Wir müssen uns verirrt haben. Eine große Hilfe bist du nicht!“
Das Pferd wurde unruhig. Auf einer Seite der Tanne fiel eine Ladung Schnee herunter.
„Du bestehst nur aus Angst, mein Freund! Hier im Wald haben wir nichts als Kälte zu befürchten.“
Das Pferd stampfte mit den Hufen und stieg auf die Hinterhand.
„Ich habe dich verunsichert! Tut mir Leid. Diese Riesenpferde mit ihren apokalyptischen Reitern sind weit weg von uns! Aber wir müssen uns trotzdem ein wenig ausruhen. Träume von leckerem Hafer und versuche zu vergessen, was du gesehen hast, dann ist die Nacht schneller zu Ende.“
Der Mann legte Äste und Tannenzweige auf den Boden, um darauf die Nacht zu verbringen. Er setzte sich an den Stamm der Tanne und wickelte seinen Reiseumhang fest um sich. Das Wetter war umgeschlagen und der nasskalte Regen hatte sich in einen satten Schneesturm verwandelt. Draußen vor dem Wald war der peitschende, schneidende Wind zu hören, der die Schneewehen vor sich her trieb. Die Silhouette seines Pferdes war deutlich zu erkennen. Er band das Pferd an einer Tanne an, aber sein völlig erschöpfter Körper und die Müdigkeit forderten ihr Recht. Der Mann spürte keine Kälte mehr in seinen Gliedern und er schlief ein. In seinen wirren Träumen sah er einen brennenden Menschen, der Hilfe suchend die Arme nach ihm ausstreckte. Ungehindert fielen die Schneeflocken auf ihn herab und bald schon war er von der Umgebung nicht mehr zu unterscheiden.
*
Adriana hatte sich den Himmel genau angesehen.
„Es macht keinen Sinn, heute noch die nächste Etappe zu erreichen, sonst werde wir in der Nacht von einem Sturm überrascht. Wer hätte das gedacht, dass im Mai noch so eine Schneefront über uns zieht! Aber hier in dieser Gegend haben wir schon alles erlebt. Wir werden in diesem Wald unser Nachtlager errichten und morgen ist dieser Spuk hoffentlich vorbei. Ich hoffe, es kommt uns kein Auerochse in die Quere! Ich möchte schon, wenn es irgendwie geht, pünktlich in Bitburg sein.“
Bei ihrem letzten Kunden, auf der Höhe von Köln, hatte ein Durchreisender eine Nachricht von ihrem Vater hinterlassen. Er wollte sie in einer Herberge in Bitburg treffen, bevor sie weiter nach Hause fuhr. Auf ihrem schweren Gespann hatte sie eine gewachste Plane und darunter ließ sich gut die kalte Winternacht ertragen.
Adriana hatte aus dem Norden hervorragende Ware eingekauft, auf die sie in Tholey im Kontor schon dringend warteten. Wunderbare Töpferware, einige Stoffballen und herrliche Zierbänder, die dazu geeignet waren, jegliches Gewand zu verschönern. Jeder Frau gefiel das und wenn man geschickt mit Nadel und Faden umgehen konnte, war man als Frau in der Lage die spärliche Garderobe beträchtlich aufzuhübschen. Nichts davon interessierte Adriana. Im Gegenteil! Die Gewänder für Frauen engten sie ein und hätten sie in ihrer Arbeit nur behindert. Zumal sie sich, wenn sie mit dem Gespann unterwegs war, mit grauer Perücke und grauem Bart als alter Mann tarnte.
Jeglichen Zierrat, wie Schmuck und bunte Bänder hielt Adriana für lästigen Tand. Für die Kinder war es Adriana gelungen, zwei niedliche kleine Hasen aus Filz zu ergattern. Ihr Blick wanderte abermals zum Himmel. Im Osten zogen die Wolken mit atemberaubender Geschwindigkeit dahin und bauten sich dunkel und dräuend auf. Zuerst fiel ein nasskalter Regen, der sich nach und nach mit Schnee vermischte.
„Schluss für heute! Das wird mir zu gefährlich!“
Aber gegen einen anstehenden Sturm konnte auch sie nichts ausrichten. Hieronymus und Amadus, die beiden Zugochsen wurden ausgespannt und bekamen als Abendessen ihre Rüben schön in Stücke geschnitten. Für Hieronymus schnitt Adriana die Stücke noch etwas kleiner, weil durch sein hohes Alter seine Zähne schon arg in Mitleidenschaft gezogen waren. Alail, die kleine schwarze Katze, schüttelte immer wieder unwillig ihre Pfoten, wenn sie durch das nasse Laub, auf dem sich langsam immer mehr Schnee sammelte, stapfte. Aber es gelang ihr trotzdem, eine Maus zu fangen. Stolz präsentierte sie Adriana ihren Fang.
„Die darfst du ganz alleine essen.“
Für Alail war es absolut unverständlich, wie man frisches Muskelfleisch verschmähen konnte und statt dessen nur eine Suppe aus Weizenkörnern zu sich nahm. Hieronymus und Amadus verschmähten ebenfalls Fleisch, waren aber, für Alail vollkommen