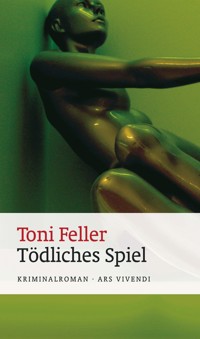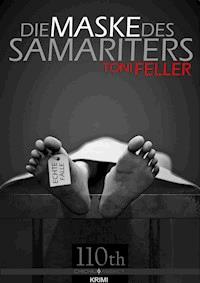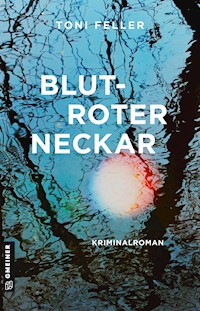
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissare Jürgen Nawrod und Nesrin Yalcin
- Sprache: Deutsch
Als ihm seine Familie genommen wird, verliert Frank Waldau das, was ihn vor Jahren von einem skrupellos mordenden Soldaten einer Eliteeinheit in einen scheinbar biederen Menschen verwandelte. Von Rache getrieben fällt er zurück in das Muster des kaltblütigen Mörders, der auf seinem blutigen Weg kein Erbarmen kennt. Kriminalhauptkommissar Nawrod und seine Kollegin Nesrin Yalcin erkennen erst spät, dass sie es mit einem Perfektionisten zu tun haben, der nicht einmal vor dem schlimmsten aller Verbrechen zurückschreckt. Eine gnadenlose Jagd beginnt …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 487
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Toni Feller
Blutroter Neckar
Kriminalroman
Impressum
Die Veröffentlichung dieses Werkes erfolgt auf Vermittlung von BookaBook, der Literarischen Agentur Elmar Klupsch, Stuttgart«
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2020 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2020
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Timmitom / photocase.de
ISBN 978-3-8392-6586-4
Haftungsausschluss
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
*
Hätte irgendjemand behauptet, Thorsten Roths verkorkstes Leben sei derart bedeutend, dass es gewaltsam beendet werden muss, hätte man diesen Jemand für verrückt erklärt. Nicht einmal Roth selbst wäre auf diesen absurden Gedanken gekommen, obwohl er nicht ungebildet war und über genügend Fantasie verfügte. Immerhin hatte er das Hölderlin Gymnasium in Heidelberg besucht. Ein paar Monate vor dem Abi hatte er hingeschmissen. Ab da war es mit ihm stetig bergab gegangen.
Jetzt war er 25 Jahre alt und am untersten Rand der Gesellschaft angekommen. Das Leben in der Gosse, Alkohol und Drogen hatten ein Wrack aus ihm gemacht. Seine Kleidung, seine Haut, alles an ihm war so grau wie die Straße, die er sein Zuhause nannte. Der Gestank, der ihn umgab, ließ keinerlei menschliche Berührungen mehr zu. Sie waren ihm genauso fremd geworden wie ein anständiges Essen.
Niemand würde es für möglich halten, dass an diesem Alkoholiker mit aufgedunsenem Gesicht ein von langer Hand vorbereiteter, nicht nur perfider, sondern auch absolut perfekter Mord begangen werden sollte. Man hätte diesen Versager wie einen räudigen Hund einfach erschlagen können. Immer wieder kam es vor, dass betrunkene Obdachlose in Streit gerieten, in dessen Folge einer zu Tode kam. Aber der, der es auf ihn abgesehen hatte, liebte die Perfektion. Er wollte jegliche Gegenwehr seines Opfers ausschließen und der Polizei nicht den Hauch einer Chance lassen, jemals auf seine Spur zu kommen.
Aus den Augenwinkeln sah Roth, wie der Mann auf ihn zuschwankte. Es war längst nach Mitternacht. Sterne funkelten, und der Mond spendete in dieser Nacht ungewöhnlich viel Licht. Doch aus der Ferne kündigte sich mit dumpfem Grollen ein Gewitter an.
Roth hatte sich in einen Schlafsack gehüllt und lehnte sich halb sitzend, halb liegend an den kalten Beton des Brückenpfeilers.
Er liebte diese Stelle. Sie blieb selbst bei Starkregen immer trocken. Überall lagen Glasscherben herum. Es stank bestialisch. Sowohl nach tierischen als auch nach menschlichen Exkrementen. An den nie enden wollenden Autolärm hatte er sich längst gewöhnt. Der Platz war sein Zuhause. Er wurde ihm von niemandem streitig gemacht. Von hier konnte er so lange auf das ruhig dahinfließende Wasser des Neckars schauen, bis ihm die Augen schwer wurden.
Je nachdem, wie viel Wodka er getrunken hatte, bekam er manchmal Wahnvorstellungen. Dunkle, schemenhafte Schatten verfolgten und quälten ihn. Dämonen mit speicheltriefenden Mäulern erhoben sich aus dem blutroten Wasser des Neckars und bissen sich wie eine Meute von Hyänen an ihm fest. Zerfetzten seine Beine. Von wilden Bestien angegriffen, starben um ihn herum kleine hilflose Kinder. Ihre grellen Schreie hallten über ganz Heidelberg und fraßen sich in sein Gehirn.
Gelegentlich ritt er auf einem pechschwarzen Pferd im gestreckten Galopp zum Heidelberger Schloss hinauf. Dort waren unschuldige Menschen gefangen, die er befreien wollte. Nie erreichte er die gewaltigen Mauern. Immer hielt ihn etwas anderes davon ab. Furchterregende Wesen mit bösen Fratzen stießen ihn vom Pferd, oder urplötzlich rissen tiefe, unüberwindbare Gräben vor ihm auf.
Es war nicht der kalte Nachtwind, der ihm vor drei Tagen Tränen in die Augen getrieben hatte. Selbstmitleid und die Erkenntnis, dass er nur noch ein Wrack war, ließen ihn still in sich reinweinen. Er ging hinunter zum Ufer des Neckars. Bis zur Hüfte schaffte er es. Als ihm das Wasser verführerisch zuraunte: »Lass los, ich nehme dich mit in die Tiefe, in der du keine Angst mehr zu haben brauchst«, verließ ihn der Mut. Er war noch nicht so weit. Oder er hatte nicht genügend getrunken? Vielleicht lag es daran, dass er in diesem Moment an seine Mutter dachte, die unheilbar an Krebs erkrankt war. Er wusste, dass es ihr größter Wunsch war, ihn noch einmal zu sehen. Aber so, wie er jetzt aussah? Niemals!
Heute Nacht, in der ihm ein anderer die Entscheidung abnehmen und ihn vom Leben in den Tod befördern wollte, hatte Roth zwar wie gewohnt Alkohol getrunken, aber nicht genug, um ihn als besoffen zu bezeichnen. Ganz im Gegenteil. Er konnte klare Gedanken fassen und genoss den Blick auf den Neckar. Die kleinen Wellen tanzten um die Wette. Jede wollte dabei mehr Mondlicht einfangen als die andere. Wie lange brauchte das Gewitter wohl noch, bis es das Spiel beenden würde?
Bereits aus der Distanz sah Roth, dass der Betrunkene ein feiner Pinkel war. Er trug einen dunklen Smoking mit Fliege, die allerdings verdammt schief am Hemdkragen hing.
Mehr noch als der Glanz der schwarzen Schuhe sprang Roth die Flasche ins Auge, deren oberes Ende der Mann zwischen Zeige- und Mittelfinger seiner rechten Hand geklemmt hatte. Als der Besoffene ihn erreicht hatte, warf Roth ihm seinen üblichen Spruch entgegen: »Hey, Kumpel, haste mal ne Kippe?«
Er stellte diese Frage allen, die vorbeikamen. »Haste mal ’nen Euro?«, fragte er immer dann, wenn es ihm nicht an Zigaretten mangelte. Wenn er um Geld bettelte, waren die Erfolgschancen jedoch viel geringer. Und jetzt, mitten in der Nacht, war es nur der Gewohnheit geschuldet, dass er es überhaupt versuchte. Er konnte nicht erwarten, dass irgendjemand im Halbdunkel des Mondes unter der Theodor-Heuss-Brücke bei ihm stehen blieb, um ihm ein Almosen zu geben. Schon gar nicht dieser besoffene Mensch im noblen Zwirn.
»Das Gleiche könnte ich dich fragen«, lallte der Mann zurück. Er roch stark nach Alkohol und hatte die Rolle des Betrunkenen präzise einstudiert. Sie war wichtiger Bestandteil seines Plans. Nichts durfte den Argwohn seines Opfers wecken. Er hätte Roth die Flasche einfach im Vorbeigehen in die Hand drücken können. Aber er wollte sein Vorhaben nicht nur perfekt durchziehen, sondern das langsame Sterben des Penners in vollen Zügen genießen.
Roth schaute zu dem Mann auf. »Ganz schön einen in der Krone, oder?«
Die Zunge des Fremden wirkte schwer wie Blei. »D… d… das kann man w… w… wohl sagen … hicks. A… a… aber mir ging es noch nie so … hicks … so gut wie heute Nacht, wenn m… m… man mal davon absieht … hicks, dass ich mich kaum auf den B… B… Beinen halten kann. Oh, ich gl… gl… glaube, ich muss … hicks … kotzen.«
»Nicht hier!« Roth wurde laut und zeigte schräg zum Neckarufer hinunter. »Da vorne kannste kotzen, so viel du willst.«
»Mach ich … hicks, mach ich doch gerne.«
Als der Mann sich bückte, um seine Flasche auf den Boden zu stellen, fiel er vornüber. Er rappelte sich auf, kniete sich hin und krabbelte auf allen vieren auf Roth zu.
»K… k… kannste mal … hicks … kannste mal einen Moment auf mein Baby aufpassen? Komm gleich wieder.« Er hielt Roth die halbvolle Flasche hin. Der Arm, mit dem er sich abstützte, knickte zweimal ein. Er schien den kümmerlichen Rest seiner Körperbalance aufbieten zu müssen, um nach mehreren Versuchen endlich auf die Beine zu kommen. Er torkelte ein paar Schritte weiter, hielt schwankend inne und öffnete seine Hose. Bevor er in den Neckar urinierte, tat er so, als ob er sich erbrechen würde.
Roth schüttelte den Kopf. Als er sich die Flasche genauer ansah, pfiff er durch die Zähne. »Was ist denn das für ein edles Tröpfchen?« Im fahlen Licht des Mondes konnte er das Etikett entziffern: »Remy Martin, Coeur de Cognac«. Er warf einen Blick auf den Fremden, der ihm den Rücken zugewandt hatte und offensichtlich damit kämpfte, sich zu übergeben, während er gleichzeitig urinierte.
Roth öffnete die bauchige Flasche und nahm hastig einen großen Schluck. Der fruchtig weiche Weinbrand verursachte in seiner Kehle ein unglaubliches Wohlgefühl. Er schloss die Augen und stieß ein lautes »Ahh« aus.
Der Fremde kam zurück. Stöhnend und schwer atmend ließ er sich neben dem jungen Penner nieder. »Jetzt ist mir wohler.«
»Wo haste die denn her?« Roth hob die Flasche in die Höhe.
»War auf einer Party. Lauter reiche Leute. Hab die Pulle mitgehen lassen, als ich mich verabschiedete. Stand ja ein Haufen von dem Zeug herum.« Die Stimme des Mannes klang immer noch ein wenig verwaschen, aber er konnte auf einmal wieder zusammenhängende Sätze formulieren. Roth nahm an, dass es dem Betrunkenen nach dem Pinkeln und Erbrechen tatsächlich besser ging.
»Auf so ’ner Party möcht ich auch mal sein.« Roth lachte rau und setzte die Flasche ein zweites Mal an. Er bemerkte nicht, wie der andere für einen Moment seine Augenlider zu Schlitzen verengte und die Fäuste zusammenballte, bis das Weiße an den Fingerknöcheln hervortrat.
»Wohl bekomm’s, Kumpel. Kannst sie ruhig leer saufen. Ich hab für heute genug.« Und du wirst auch bald genug haben, dachte er. Die Stunde der Rache ist gekommen. Endlich wirst du für das bezahlen, was du mir vor drei Jahren angetan hast.
Roth nahm wieder einen kräftigen Schluck, der noch besser schmeckte als der vorige. »Haste wirklich keine Kippe?«
»Wenn ich’s dir sage. Hab sie auf der Party alle gepafft. Tut mir leid.« Abermals ballten sich seine Hände zu Fäusten. Es war nicht das erste Mal, dass er einen Menschen eiskalt tötete. Er hatte keinerlei Skrupel. Ihm kam es einzig und allein darauf an, sich an dem Stadtstreicher zu rächen und den Mord so perfekt zu begehen, dass kein Polizist der Welt ihn als solchen erkannte.
Roth wandte sich dem Fremden zu, beugte sich ein wenig nach vorn und stutzte. »Hey, sag mal, kennen wir uns?«
Ein greller Blitz durchzuckte das Gehirn des Mannes. Verdammte Scheiße! Wie kommt dieser abgesoffene Typ darauf? Wir sind uns doch bisher nur einmal begegnet. Damals trug ich weder Bart noch Brille. Ich hätte vielleicht einen Hut aufsetzen sollen. Wenn sich das Schwein tatsächlich an mich erinnert, bleibt mir keine andere Wahl. Dann schneide ich diesem Abschaum von Mensch den Hals durch.
Er tastete unauffällig nach dem Springmesser, das er in der Hosentasche trug. »Wir uns kennen? Wäre mir neu.« Seine Hand strich über den kunstvoll angeklebten Kinn- und Oberlippenbart und rückte die schwarze Hornbrille zurecht.
Roth grübelte. »Ich dachte, ich hätte dich schon mal gesehen. Bin mir sogar ziemlich sicher.«
Bei aller Kaltblütigkeit spürte der andere, wie sich an Rücken und Stirn kleine Schweißtropfen bildeten. Nicht dass er einen Augenblick zögern würde, Roth blitzschnell eine tödliche Verletzung beizubringen. Nein! Aber verdammt noch mal, das würde seinen Plan völlig durcheinanderbringen.
»Ab und zu denke ich auch, jemanden schon mal gesehen zu haben, der mir zufällig über den Weg läuft. Das geht bestimmt jedem mal so. Liegt vermutlich in der Natur des Menschen. Oder hast du dich mal in der High Society herumgetrieben?«
Roth winkte ab. »Kack drauf! Willste ’nen Schluck von meinem Wodka? Bei ’ner Sauftour tut etwas Abwechslung manchmal ganz gut.« Roth kramte in seinem Schlafsack und zog eine Flasche hervor.
»Nein danke, Kumpel. Bin ziemlich fertig. Siehste ja.«
»Wie heißt du eigentlich?«
»Lorenz, und du?«
»Bin der Thorsten. Stell dich nicht so an, Lorenz! Wodka ist kein Alkohol. Das ist Medizin. Ich trink nichts anderes.« Als der andere nicht reagierte, verstaute Roth den Wodka wieder in seinem Schlafsack.
Lorenz grinste. »Nichts anderes? Das sehe ich.«
»Ausnahmen bestätigen die Regel. Remy! Ein feines Tonikum wie dieses darf man nicht verschmähen. Was meinst du, wie da meine Leber Beifall klatscht. Prost!« Genüsslich führte Roth die Flasche an den Mund. Nachdem er sie abgesetzt und mit dem Korken verschlossen hatte, nahm er sie wie einen Säugling in den Arm und wiegte sie hin und her.
»Haste kein Zuhause?« Lorenz rülpste laut.
»Dumme Frage! Fällt dir keine bessere ein?«
»Sorry, bin besoffen. Da funktioniert das Hirn nicht mehr besonders gut.«
»Es gibt kein Zuhause, Alter. Ist schon lange vorbei.« Roth klopfte auf seinen Schlafsack. »Hier, das ist mein Schlafzimmer. Zumindest bin ich nicht allein. Jede Menge Läuse leisten mir Gesellschaft. Doch meistens bin ich hackedicht und spüre nicht, wie sie mit mir knutschen.«
»Verträgst ziemlich viel, oder?«
»Es geht. Heute hab ich mich ein wenig zurückgehalten. Den Wodka habe ich kurz vor Ladenschluss mitgehen lassen. Bin fast erwischt worden. Hatte die Hosen gestrichen voll. Kann dir sagen, ’ne Ausnüchterung bei den Bullen ist der reinste Horror. Dreimal musste ich das über mich ergehen lassen. Werde vorsichtiger sein müssen und mit meiner Medizin nicht mehr so verschwenderisch umgehen. Dich hat also sozusagen der Himmel geschickt. Prost, Kumpel!«
»Wohl bekomm’s.«
»Danke.«
»Kannste gern behalten.« Lorenz schloss die Augen und legte seine Hände in den Schoß. Er ließ einige Zeit verstreichen, bevor er abermals zu sprechen begann. »Wieso machst du Platte? Bist doch noch jung und könntest arbeiten.«
»Können ja, wollen aber nicht. Ödet mich an, für einen Hungerlohn den Buckel krumm zu machen. Hab’s probiert. War Fliegenschiss. Dann ist das ’ne einfache Sache: nicht arbeiten, keine Moneten, keine Scheißmiete bezahlen können. Aus! Verstehste?«
»Ja, klingt irgendwie logisch. Heiliger Strohsack, bin hundemüde.« Lorenz gähnte laut und schloss die Augen. Der Geruch des Penners wehte ihm um die Nase. Abgrundtiefer Ekel stieg in ihm auf. Er hörte das leise Sirren einer Stechmücke. Sie ließ sich auf seiner linken Wange nieder. Lorenz’ blitzschnelle Reaktion hätte bei Roth Argwohn erwecken müssen, doch er war völlig auf den edlen Tropfen fixiert. Es war das Kostbarste, was er seit ewigen Zeiten in Händen hielt.
»Der Remy ist ein Traum. Aber er hat mich ganz schön platt gemacht.« Roth drückte sich mit dem Rücken vom Brückenpfeiler ab, legte sich langgestreckt hin und zog seinen Schlafsack bis zum Kinn hoch. »Oh mein Gott, ich kann nicht … Was ist mit mir …? Was …?«
Lorenz zerrieb in aller Ruhe die Stechmücke in seiner Hand. Ein Lächeln umspielte seinen Mund. Vorsichtig nahm er dem schlafenden Roth die Cognacflasche weg, die dieser umklammert gehalten hatte. Es war der einzige Gegenstand, auf dem er Fingerabdrücke hinterlassen hatte. Er warf die Flasche weit in den Neckar. Anschließend setzte er mit tiefer Befriedigung das Finale seines teuflischen Plans in die Tat um. Nur ein unliebsamer Zeuge könnte ihn noch daran hindern.
*
Sie feierten Wegners Abschied und die Aufklärung des grausamsten Verbrechens, das je in Heidelberg begangen worden war. Der Leiter des Morddezernats war in den letzten Wochen vor seiner Pensionierung sichtlich gealtert. Jeder wusste, dass ihm der Fall schwer zu schaffen gemacht hatte. Wie konnte es sein, dass ein intelligenter Mensch andere Menschen bestialisch tötete, nicht nur, um sich zu rächen, sondern auch, um die allmächtige Institution der katholischen Kirche in die Knie zu zwingen?
Ganz im Gegensatz zu früher und trotz einer stattlichen Größe von 1,90 Meter und 110 Kilogramm Körpergewicht wirkte Wegner an seinem letzten Tag im Polizeipräsidium zerbrechlich und angreifbar. Er saß abseits von den anderen in einer Ecke des großen Konferenzraumes. Mit seinen mächtigen Pranken umschloss er Halt suchend die Armlehnen des Stuhles. Gelegentlich fasste er sich an die linke Brustseite. Kollegen, die sich mit ihm unterhalten wollten, merkten schnell, dass er mit seinen Gedanken woanders war. Höflich beendeten sie das Gespräch und wandten sich jenen zu, die in bester Feierstimmung waren.
Kriminalhauptkommissar Nawrod schnappte sich einen freien Stuhl und ging damit zu Wegner. Wortlos nahm er neben ihm Platz. Die beiden sahen sich kurz in die Augen. Nawrod legte seine Hand auf Wegners Unterarm und nickte ihm kaum merklich zu.
Der Dezernatsleiter atmete tief durch. Er schien auf einen imaginären Punkt im Raum zu starren. Es dauerte einige Sekunden, bis er langsam zu sprechen begann. Seine Stimme war die eines gebrochenen Mannes. »Genug ist genug. Dieser Fall hätte mich um ein Haar das Leben gekostet. Er hat mich an eine Grenze gebracht, von der ich nicht einmal ahnte, dass es sie gibt.«
»Sie sind ein Chef, wie man sich ihn nur wünscht. Ich bedauere sehr, dass wir nicht länger zusammenarbeiten können.«
»Nawrod, Sie haben meinen Kopf gerettet. Wenn Sie und die Kollegin Yalcin den Fall nicht …«
»Wir hatten unverschämtes Glück, und ohne die Arbeit der Soko, ohne das Engagement jedes Einzelnen, ohne Ihren Mut hätten wir nie und nimmer …«
»Sie stellen Ihr Licht unter den Scheffel, ich bitte Sie! Als Sie in meinem Dezernat anfingen, eilte Ihnen ein Ruf voraus, dem Sie in vollem Umfang gerecht wurden. Sie sind kein einfacher Mensch, Nawrod. Und vor allen Dingen kein ›Untergebener‹, wie manche Führungsfiguren in unserem Laden ihre Mitarbeiter gerne nennen. Aber Sie sind ein Ermittler, von denen es in der Branche leider nur sehr wenige gibt. Ein Leitwolf, ein Alphatier, das sich ein Ziel setzt und es erreicht, egal was und wer sich ihm entgegenstellt.«
Nawrod lachte. »Sie übertreiben schamlos!«
»Ich habe Sie dem Polizeipräsidenten als meinen Nachfolger vorgeschlagen.«
»Aber …«
»Sagen Sie nichts!«
»Ich wollte nur …«
»Halten Sie einfach die Klappe. Bis Mitternacht bin ich immer noch Ihr Chef, und deshalb befehle ich Ihnen erstens, diesen Umstand geheim zu halten, und zweitens, mit den anderen zu feiern. Sie haben allen Grund dazu.«
Nawrod schluckte und berührte Wegners Schulter. Ein eigenartiges Gefühl machte sich in ihm breit, das ihn innerlich ins Wanken brachte. Er erinnerte sich an die Zeit, als er in Stuttgart Leiter des Rauschgiftdezernates gewesen war, wie es zu seinem Sturz in den tiefsten und schwärzesten Abgrund seines Lebens gekommen und wie schwer es ihm gefallen war, wieder einigermaßen Fuß zu fassen. Und nun sollte er abermals Dezernatsleiter werden?
»Nur wenn Sie mitfeiern. Schließlich waren Sie es, der Regie geführt hat.« Nawrod klang heiser. Er rang sich ein Lächeln ab.
»Jeder sollte auf seine Art feiern und so, wie ihm zumute ist. Nun hören Sie endlich auf mit dem Gequatsche, sonst rufe ich auf der Stelle Präsident Lehmann an und sage ihm, dass ich mich in Ihnen getäuscht habe. Dass Sie nichts als eine Quasselstrippe sind, die ständige heiße Luft herauspustet.«
Nawrod verstand. Wegner wollte allein sein. Kein anstrengendes Gespräch mehr führen. Einfach da sitzen und ein letztes Mal alles auf sich wirken lassen, bevor er endgültig seinen Hut nahm. Nawrod stand auf. Am liebsten hätte er Wegner umarmt. Doch das verkniff er sich. Wegner würde diese Geste nicht haben wollen. Und er selbst hatte etwas Derartiges noch nie getan. Nicht bei einem Mann.
»Danke für alles, Chef.«
»Keine Ursache, Nawrod. Verschwinden Sie endlich.«
Nawrod erhob sich und ging in Richtung Buffet. Obwohl er einen Bärenhunger hatte, drehte er sich nach zwei Schritten um, ging zurück zu Wegner und blieb dicht vor ihm stehen. »Was ist mit Faber?«
»Was soll mit dem sein?«
»Er ist immerhin Ihr Stellvertreter?«
»Na und?«
»Er macht sich bestimmt Hoffnung auf die Stelle des Dezernatsleiters.«
»Faber hat kein Rückgrat, kein Format. Die Mannschaft würde ihm auf der Nase herumtanzen. Der Mann hat nur eine einzige hervorstechende Eigenschaft: Er kann buckeln und schleimen wie kein anderer. Insofern ist er mir zwar keine große Hilfe gewesen, andererseits hatte ich auch nichts von ihm zu befürchten. Der hatte nie einen Dolch hinter seinem Rücken versteckt. Ich musste zunächst allerdings die Rangordnung wahren und ihm pro forma den Marschallstab übergeben, aber den wird er sehr bald an Sie weiterreichen. Wenn Sie klug sind, und davon gehe ich aus, ziehen Sie ihn auf Ihre Seite. Sollte er sich querstellen, servieren Sie ihn ab, denn Menschen wie er können, trotz ihrer Schwächen, gefährlich werden.«
»Verstehe.« Nawrod runzelte die Stirn, machte kehrt und ging zum Buffet, das ein Partyservice geliefert hatte. Er nahm sich Teller und Besteck. Erst jetzt fiel ihm auf, dass es hier relativ ruhig zuging. Die meisten der über 30 Anwesenden hatten sich auf das Essen konzentriert.
»Vögel, die fressen, pfeifen nicht«, murmelte Nawrod.
»Hey, Mister, darf ich dich ein bisschen verwöhnen?« Nesrin Yalcin stand plötzlich neben ihm und nahm ihm den Teller aus der Hand. Nawrod sah Yalcin verwundert an.
Die junge Kollegin hatte sich anlässlich der Feier wunderschön herausgeputzt. Ihr Make-up war dezent und dennoch umwerfend. Die getuschten Wimpern und dunkle Kajalstriche ließen ihre kastanienbraunen Augen noch größer und ausdrucksvoller erscheinen. Das zarte Rouge war perfekt auf die Farbe des Lippenstiftes abgestimmt. Es verlieh ihrem Gesicht Weiblichkeit und Charme. Durch die eng anliegende weiße Bluse kam ihr südländischer Teint noch besser zur Geltung. Die dunkelblaue Hose aus feinem Satin saß perfekt. Rote Pumps ließen sie um einiges größer erscheinen. Ihre langen pechschwarzen Haare hatte sie mit einer silbernen Spange hochgesteckt, sodass ihre kleinen, hübsch geformten Ohren zum Vorschein kamen.
Nawrods Blick wanderte auffällig von unten nach oben. Er pfiff leise durch die Zähne.
Yalcin wurde sich ihres Fauxpas bewusst. Sie grinste breit. »Mit Verwöhnen meine ich natürlich kulinarisch.«
»Klar, nur kulinarisch. An etwas anderes habe ich keinen Moment gedacht. Du etwa?«
»Deine Augen waren da offenbar anderer Meinung. Kann es sein, dass die dir manchmal nicht gehorchen?«
»He, Kleine, du hast noch Eierschalen hinter den Ohren und willst die Gedanken eines Mannes lesen können?« Nawrod lachte.
»Hatten wir uns nicht vor Wochen geeinigt, dass du mich nicht mehr ›Kleine‹ nennst?«
»Ach ja, damals. Das war eine Minute, nachdem du mir versprochen hattest, mich nicht mehr ›Mister‹ zu nennen. Und was haben meine Lauscher soeben vernommen? Mister! Dieses grässliche Wort.«
»Oh sorry, habe nicht dran gedacht. Ist ja auch irre, dass du dich dann immer mit einem Stallburschen vergleichst, der den Mist wegräumen muss.«
»Ich bin irre? Überlege dir, was du sagst, Kleine!«
Yalcin legte den Kopf schief. Sie lächelte so bezaubernd, dass Nawrod ihr nicht einmal im Ansatz böse sein konnte. Nur ein wenig musste sie sich strecken, um ihre flache Hand auf seine Stirn zu legen. »Friede sei mit dir, lieber Jürgen.«
Dann ballte sie die Faust und boxte ihn sanft in den Bauch. »Hey, Kumpel, heute feiern wir, dass die Balken krachen. Das ist das Mindeste, was wir uns für die geile Nummer gönnen, die wir beide abgezogen haben.«
»Pst! Nicht so laut. Wenn das jemand hört, werde ich spätestens morgen wegen Verführung Minderjähriger dem Haftrichter vorgeführt.«
»Wenn schon, wäre es Unzucht mit Abhängigen. Aber in welchen Sphären schwebst du? Habe mir sagen lassen, dass in deinem Alter ohne Viagra nichts geht. Von Verführung kann also keine Rede sein. Eher von Wollen und nicht Können.«
»Bilde dir ja nichts ein. Zugegeben, du bist die hübscheste Türkin, die mir je über den Weg gelaufen ist. Alle anderen haben mich allerdings nicht ›Mister‹ genannt. Und das macht eben den Unterschied.«
»Aber keine wird dir jemals einen Teller mit Köstlichkeiten so schön garnieren wie ich.« Als ob sie das Buffet selbst zubereitet hätte, wählte Yalcin zielgerichtet die leckersten Häppchen aus und platzierte sie dermaßen schnell auf dem Teller, dass Nawrod nur staunen konnte. Drei mit gebratenem Speck umhüllte Frischkäsestücken, eine kleine Weißbrotscheibe mit geräuchertem Lachs, garniert mit Dillspitzen und einem Klecks Sahnemeerrettich, verschiedene Käsepralinen und mehrere Kalbsmedaillons mit Röschen aus Thunfischcreme. »Voilà, der Herr. Ich hoffe, es mundet.«
»Drück dich nicht so geschwollen aus. Passt gar nicht zu dir.« Verwundert nahm Nawrod die Häppchen entgegen. »Du hast mich gar nicht gefragt. Woher wusstest du, was ich mag und was nicht?«
»Eine kluge Frau muss nicht lange fragen. Sie entscheidet in solchen Fällen für den dankbaren Mann.« In Verlängerung der Mundwinkel blitzten zwei zauberhafte Grübchen auf.
»Hey, Nesrin, was ist denn in dich gefahren? Du hast doch nicht etwa einen Schnellkurs in vornehmem Umgang mit den Herren der Schöpfung absolviert?«
»Wie kommst du darauf?« Sie deutete auf das Essen. »Das hier ist ein kleines Dankeschön für die lehrreichen Tage, die ich mit dir verbringen durfte.«
»Da hätte ich mehr Grund, mich zu bedanken. Schließlich hast du mich in letzter Sekunde von der Schippe des Teufels geschubst.«
»Du wärst bestimmt in den Himmel gekommen. Zu lauter hübschen Engeln, die dich von morgens bis abends umgarnt hätten. Aber halte jetzt keine Volksreden und schieb dir endlich das Zeug zwischen die Kiemen, damit wir zum gemütlichen Teil übergehen können.«
»Was ist mit dir? Warum isst du nichts?«
»Längst erledigt. Muss nur noch verdünnen.« Yalcin nahm sich ein Glas Sekt mit Orangensaft von einem Beistelltisch und prostete Nawrod zu.
»Ich dachte, Muslime trinken keinen Alkohol. Was sagt denn dein gestrenger Vater dazu?«
»Der bekommt es ja nicht mit und muss es auch nicht erfahren, oder?«
»Euer Prophet sieht es bestimmt, und der hat das streng verboten.«
»Woher weißt du das? Du bist zwar etwas älter, aber nicht so alt, dass du mit ihm gesprochen haben könntest.«
»Das weiß doch jedes Kind, sogar wir Ungläubigen. So nennt ihr alle, die nicht Muslime sind, oder etwa nicht?«
»Du siehst das zu eng, Herr Religionsprofessor. Ich lebe, wie ich es für richtig halte, und da gehört ein Schlückchen Sekt dazu. Der Koran wurde in einer anderen Zeit geschrieben. Heute würde Mohammed sicher anders denken, reden und schreiben, denn er war ohne Zweifel ein sehr kluger Mann. Ich denke, dass er nicht mehr von Ungläubigen sprechen würde, wenn es um Christen oder Angehörige anderer Religionen ginge.«
Nawrod pfiff leise durch die Zähne. »Dass du ein kluges Köpfchen bist, wusste ich gleich, als wir uns kennenlernten. Umso mehr freue ich mich, dass du offensichtlich einen größeren Horizont besitzt als die meisten eurer hochstudierten Glaubensführer. Und das meine ich ganz im Ernst.«
Nesrin lachte. »Danke, Herr Lehrer. Aus deinem Mund geht das runter wie Öl.«
Das laute Klingeln eines Telefons unterbrach das Stimmengewirr im Raum schlagartig. Die Anwesenden kannten den Ton. Er gehörte zum Diensthandy des Dezernatsleiters. Alle Augen richteten sich auf Wegner. Offiziell war längst Feierabend. Jedem war klar, dass der Anruf Arbeit bedeutete. Ohne sich zu bewegen, hielt Wegner den Blicken stand. Es klingelte abermals. Faber zuckte regelrecht zusammen, als er feststellte, dass das schnurlose Telefon in seiner unmittelbaren Nähe lag. Hastig griff er danach. Wegner hatte es ihm schon vor Stunden pro forma, sozusagen als Zepter, übergeben.
»Das Revier West ist dran«, brachte er unsicher hervor. Er nahm das Gespräch entgegen und bat einen der Umstehenden um Kugelschreiber und Papier. Während er in leicht gebückter Haltung mehrfach mit »Jawohl« antwortete, machte er sich Notizen. Dann beendete er das kurze Telefonat, ging zu Wegner und wollte ihm Bericht erstatten.
Bevor Faber etwas sagen konnte, machte Wegner eine abwehrende Handbewegung und führte den Zeigefinger an den Mund. »Pst, Faber. Ich will es gar nicht wissen. Das geht mich ab heute alles nichts mehr an.«
»Aber, Chef …«
»Haben Sie nicht gehört?« Wegners vorwurfsvolle Miene zeigte Wirkung.
Faber blickte in die Runde. »Unter der Theodor-Heuss-Brücke wurde ein Toter gefunden. Kunze, Hauk, Sie beide übernehmen den Fall. Die Schutzpolizei ist vor Ort und wartet auf Sie.«
Kriminaloberkommissar Kunze hob die Schultern. »Tut mir sehr leid, Herr Kollege, ich habe einiges getrunken. Außerdem haben wir Feierabend. Schlage vor, wir schicken den Kriminaldauerdienst hin.«
»Der ist wegen eines Raubüberfalls auf den Rewe-Markt im Mathematikon bereits im Einsatz. Herr Hauk, dann würde ich Sie bitten …«
»Ich habe mindestens so viel intus wie Kunze, wenn nicht noch mehr.« Hauks Mund umspielte ein triumphierendes Lächeln. »Außerdem gefällt es mir auf unserer Party.« Er hob sein Glas in die Höhe. »Prost, Herr Stellvertreter, oder müssen wir jetzt ›Chef‹ zu Ihnen sagen?«
Fabers Adamsapfel hüpfte zweimal hoch und runter. Hilfesuchend drehte er sich Wegner zu. Doch der zeigte keine Reaktion. In jeder Ecke des Raumes hätte man eine Stecknadel fallen hören können. Auf Fabers Stirn bildeten sich Schweißperlen. Ihm wurde bewusst, dass dies die erste Kraftprobe zwischen ihm und der Mannschaft war. Er sah auf die fast leere Flasche Wein und das halbvolle Glas, das vor ihm auf dem Tisch stand. Allen war klar, dass es ein großes, unkalkulierbares Risiko war, wenn Faber sich selbst ans Steuer setzen würde. Sein Blick wanderte abermals hilflos in die Runde.
»Wir übernehmen.« Nawrod stellte kauend seinen Teller weg. »Nesrin, würdest du dich um einen Dienstwagen kümmern, während ich die Kriminaltechnik verständige?«
Faber fiel sichtlich ein Stein vom Herzen. Er atmete laut durch. »Okay, Nawrod. Sie haben etwas gut bei mir. Wenn Sie Verstärkung benötigen, melden Sie sich bitte.« Fabers Stimme klang ungewohnt fest. Doch als er nach seinem Glas griff, zitterte seine Hand merklich.
*
Kurze Zeit später saß Yalcin am Steuer des Dienstwagens. In ihrem Büro hatte sie in Windeseile die Satinhose gegen eine Jeans und die Pumps gegen modische Sportschuhe getauscht.
Nawrods Brustkorb hob und senkte sich in auffälliger Weise, denn er wusste, was ihm bevorstand. Die junge Kollegin war eine exzellente Fahrerin. Doch sie unterschied bei solchen Einsätzen nicht zwischen einer Rennstrecke und den Straßen einer Innenstadt. Bei der ersten Blaulichtfahrt mit ihr vor wenigen Wochen hatte Nawrod Todesängste ausgestanden. Als er danach aus dem Auto gestiegen war, waren seine Beine eingeknickt. Um ein Haar wäre er zu Boden gestürzt, hätte er sich nicht im allerletzten Moment an der Beifahrertür festgekrallt. Seitdem versuchte er vergeblich, sich an Nesrins halsbrecherischen Fahrstil zu gewöhnen. Natürlich übernahm er immer das Steuer, wenn sie es nicht eilig hatten, denn ihm waren die meisten Straßen in Heidelberg noch fremd. Ganz anders Nesrin. Sie kannte ihre Geburtsstadt wie ihre Westentasche und wusste genau, wo sie das Gaspedal durchdrücken konnte und wo sie im höchsten Maße bremsbereit sein musste.
Nesrin hatte den Kojak auf das Autodach geklebt. Die starke Magnetplatte an der Unterseite hielt das Blaulicht selbst bei extremen Belastungen stabil. Kaum hatte sie den Motor gestartet, schaltete sie das Martinshorn ein. Nawrod wollte protestieren, ließ es dann jedoch sein, weil der Lärm des Martinshornes eine Verständigung Sprechen nur schwer möglich machte.
Von Weitem sah er der Römerkreis auf sich zukommen. Nesrin schaltete vom dritten in den zweiten Gang. Der Motor heulte auf. Herr im Himmel, die denkt überhaupt nicht daran, zu bremsen, schoss es ihm durch den Kopf. Von den Zehenspitzen bis zum Kopf verkrampfte sich sein Körper zu einer stahlharten langgestreckten Masse. Wie will sie in diesem Affentempo lebend über den Kreisel kommen?
»Nesrin … Nesrin … Nicht …! Oh mein Gott!« Nawrod hatte die Augen weit aufgerissen. Er wusste, würde er sie geschlossen halten, was durchaus angebracht wäre, müsste er sich innerhalb von Sekunden übergeben. »Es ist nur eine Leiche, Nesrin, nur eine Leiche. Sie rennt uns nicht davon. Kannst du nicht ein bisschen … langsamer … lang…? Vorsicht, da kommt einer von rechts!«, schrie Nawrod und riss in Todesangst seinen linken Unterarm schützend vors Gesicht, während sich die rechte Hand am Haltegriff oberhalb der Tür festkrallte.
»Den habe ich schon auf dem Radar.« Nesrin schenkte ihrem aschfahlen Beifahrer ein cooles Lächeln. Als sie auf den Adenauerplatz zuraste, zeigte die Tachonadel 110 Kilometer pro Stunde an. Mit quietschenden Reifen und zwei heftigen Schleuderbewegungen bog Nesrin in die Sofienstraße ein. Ein wütendes Hupkonzert begleitete sie. Auf der Theodor-Heuss-Brücke herrschte starker Verkehr, was Nesrin jedoch nicht davon abhielt, andere Fahrzeuge mal rechts, mal links in halsbrecherischem Tempo zu überholen.
Über die Brückenkopfstraße erreichten sie schließlich die Uferstraße. Schon von Weitem sahen sie, dass die Streifenbeamten den Leichenfundort mit Trassenband abgesperrt hatten. Etwa 20 Neugierige standen herum. Den ganzen Tag über hatte die Sonne geschienen. Es war trotz Spätherbst angenehm warm.
»Du darfst wählen: Möchtest du lieber die Leiche untersuchen oder Zeugen befragen?« Obwohl ihm von Nesrins Fahrstil speiübel war, versuchte Nawrod cool zu wirken. Ihm war klar, dass er beim Aussteigen aufpassen musste, nicht wieder umzukippen.
»Darf ich mir die Sache erst einmal anschauen?«
»No risk, no fun. Entscheide dich, so läuft es bei uns. Einer kümmert sich um die Leiche, der andere um die Zeugen. Und zwar ohne sich erst zu vergewissern, was weniger Arbeit bedeutet.«
»Hab ich mitbekommen. Aber ich … na ja, ich …«
»Willst du dich etwa drücken?«
»Nein, ganz und gar nicht. Es ist nur, wenn … wenn die Leiche schon stinkt, dann … Ich möchte den Leuten nicht unbedingt zeigen, was ich vor einer halben Stunde gegessen habe. Andererseits will ich auch etwas lernen und nicht kneifen, verstehst du?«
»Okay, ich will mal nicht so sein. Entscheide dich, wenn wir dort sind.«
Sie stiegen aus. Nawrod wollte Nesrin nicht zu viel zumuten. Immerhin befand sich die junge Kollegin noch in der Ausbildung. Sie hatte in den letzten Wochen genug an grässlichen Eindrücken wegstecken müssen. Sollte sie die Leichenuntersuchung übernehmen, würde er sie mit der schweren Aufgabe nicht allein lassen. Für ihn war es Routine, Zeugen vor Ort zu befragen und gleichzeitig ein Auge auf die Arbeit der Kommissaranwärterin zu werfen.
Der Tote lag unmittelbar vor einem breiten Brückenpfeiler und war mit einer weißen Plane abgedeckt. Nawrod und Yalcin grüßten die beiden Schutzpolizisten.
»Die da vorne hat ihn gefunden.« Der bullige Streifenbeamte zeigte in Richtung einer abseits stehenden Frau.
»Okay. Habt ihr sie schon vernommen?« Nawrod versuchte, die Zeugin aus der Entfernung einzuschätzen.
»Sie weiß so gut wie nichts, außer dass sie bereits heute Morgen hier vorbeikam und ihr dann vorhin auf dem Rückweg auffiel, dass der Mann in seinem Schlafsack immer noch genau gleich dalag wie in der Frühe. Erst habe sie ihn angesprochen. Als er sich nicht rührte, habe sie nachgeschaut und festgestellt, dass er tot war.«
»Na, das ist doch wenigstens etwas.«
»Und, ist er tot?« Yalcins Stimme klang heiser. Sie hatte während ihres Studiums von Fällen gelesen, in denen vermeintliche Leichen plötzlich wieder zu sich kamen. Insgeheim hoffte sie, es könnte hier auch so sein. Denn ein Toter war für sie ein schrecklicher Anblick.
»Toter als tot! Das sieht jedes Kind.« Der zweite Streifenbeamte war einen Kopf größer als sein Kollege, dafür wohl nur halb so schwer. Sein Tonfall war an Sarkasmus nicht zu überbieten. »Das ist nun der Vierte dieses Jahr, der sich am Neckarufer tot gesoffen hat.«
Nawrods Stirn legte sich in tiefe Falten. Vor nicht allzu langer Zeit hatte er selbst nahe am tödlichen Abgrund der Alkoholsucht gestanden. Er wusste, wie schnell es gehen konnte und dass kein Mensch davor gefeit war.
Ohne dass er sich dagegen wehren konnte, lief jener Film in seinem Kopf ab, der immer mit den gleichen Bildern begann. Charly, sein bester Freund und Kollege, sackt tödlich getroffen zusammen. Das Geschoss war in den Hinterkopf eingedrungen und an der Stirn ausgetreten. Er hätte Charlys Leben retten können. Doch aus falschem Ehrgeiz hatte er als Einsatzleiter zu spät den Befehl zum finalen Rettungsschuss gegeben. Schuldgefühle, Flucht in Psychopharmaka und Alkohol. Der Moment, als seine Frau sich von ihm trennte und die gemeinsame Tochter mitnahm. Er befand sich im freien Fall. Hatte keinen Fallschirm auf dem Rücken. Die schrecklichen Erinnerungen explodierten in seinem Gehirn. Sie kamen genauso schnell und unerwartet, so gewaltig, als ob er auf eine Mine treten würde.
Jetzt kippe ich gleich aus den Latschen, dachte er. Immer derselbe Film. Nur die Laufzeit wird kürzer. Anfangs eine komplette schlaflose Nacht und inzwischen sind es höchstens noch ein paar Sekunden. Die Wirkung bleibt jedoch die gleiche.
»Es war meine Schuld!« Wie in Trance starrte Nawrod auf die weiße Plane.
Der dicke Uniformierte winkte ab. »Kein Problem, Kollege. Wir sind es gewohnt, auf die Kripo zu warten.«
»Was …? Wie …?« Nawrod war wie paralysiert.
Die beiden Schutzpolizeibeamten warfen sich fragende Blicke zu.
Yalcin wusste sofort, was mit Nawrod los war. Sie kannte die Geschichte um Charlys Tod und welche Probleme Nawrod damit hatte. Geschickt überspielte sie die Situation. »Habt ihr schon den Amtsarzt verständigt?«
»Klar, machen wir doch immer.«
Yalcin zückte Kugelschreiber und Notizbuch und stellte die nächste Frage. Wie zufällig stieß sie Nawrod den Ellenbogen in die Seite. »Wie heißt ihr beiden noch mal?«
»Ist das wichtig?« Der Schlaksige verschränkte die Arme vor der Brust und hob sein Kinn an.
»Ich benötige das für meinen Bericht. Also bitte!« Yalcins Augen verengten sich zu Schlitzen. Knisternde Funken sprühten.
Der Dicke schaltete sich ein. »Ich bin Polizeihauptmeister Landig und mein Kollege heißt Kozek.«
Der Name passt zu ihm, dachte Yalcin. Sie konnte ein Schmunzeln nicht unterdrücken.
»Wann seid ihr hier eingetroffen und wie heißt die Zeugin?« Nawrods Stimme klang gefasst.
»Es war genau 17:15 Uhr. Wir haben den Toten sofort mit der Plane abgedeckt und keinerlei Veränderungen an ihm vorgenommen.«
»Gelernt ist gelernt.« Kozek hatte immer noch die Arme vor seiner geschwellten Brust verschränkt.
»Sehr gut, Herr Kollege.« Yalcin wusste um die Wirkung ihres Lobes. Deeskalation war wichtiger Bestandteil ihrer bisherigen Ausbildung gewesen. Ihr war klar, dass der Kollege es nicht böse meinte. Es war das übliche testosterongesteuerte Machogehabe. Ein Kräftemessen, das sie mit den richtigen Worten leicht für sich entscheiden konnte, ohne dass der andere es merkte.
Polizeiobermeister Kozek entspannte sich. Er ließ sein Arme sinken und hakte die Daumen lässig in den Hosengürtel. »Wir haben den Leichenfundort gleich mit Trassenband abgesperrt.«
»Bitte sorgt dafür, dass die Zeugin nicht verschwindet. Ihr würdet mir einen großen Gefallen tun, wenn ihr schon mal ihre Personalien aufnehmen könntet.« Nawrod schlug damit in dieselbe Kerbe wie Yalcin, an die er sich anschließend wandte. »Und wir sehen uns jetzt den Toten an.« Er hob das Absperrband in die Höhe, und beide schlüpften bequem darunter hindurch. Danach zogen sie Einmalhandschuhe aus den Taschen und streiften sie über. Auf etwaige Spuren am Boden achtend näherten sie sich der Plane, unter der die Leiche lag. Sie konnten unzweifelhaft erkennen, an welchem Ende sich die Füße befanden. Als Nawrod sich bückte, um die Abdeckung in Kopfhöhe zurückzuschlagen, nahm er den typisch süßlichen Leichengeruch wahr. In all den Jahren, in denen er unzählige Todesfälle untersuchen musste, hatte er stets gehofft, sich irgendwann daran zu gewöhnen. Doch das Gegenteil war der Fall. Bei jeder neuen Leiche verursachte der Geruch eine stärkere Wirkung als zuvor. Ekel stieg in ihm auf. Sein Magen grummelte. Die Speiseröhre förderte einen säuerlichen Geschmack nach oben. Ein Heer von Geruchsbakterien überfiel seine Mund- und Nasenschleimhäute. Dieses Mal war er sich sogar sicher, dass sie sich auf dem neuen Nährboden wie Heuschrecken vermehrten. Übelkeit stieg in ihm hoch. Doch er ließ sich nichts anmerken.
Das Gesicht des Toten war graugelb verfärbt. Seine braunen verfilzten Haare reichten bis zu den Schultern. Aus dem halboffenen Mund war hellbraune Flüssigkeit gesickert, die vom Mundwinkel bis zum Halsansatz angetrocknet war. Die Augenlider standen nur einen Spalt breit offen. An den Rändern hatten Fliegen Eier abgelegt, die wie feiner Grieß aussahen. Nawrod zog ein Lid nach oben.
»Was meinst du, Nesrin, wurde er erwürgt?«
»Sieht nicht danach aus. Keine Stauungsblutungen im Augapfel, keine Würge- oder Strangulationsmale am Hals.«
»Sehr gut, Frau Kollegin.« Nawrod lächelte zufrieden. Den ersten Test hatte die junge Kommissaranwärterin bestanden. »Möchtest du weitermachen?«
»Jürgen … ähm … der riecht echt gewaltig. Ich fürchte, dass …« Nesrins Gesicht hatte alle Farbe verloren. Sie starrte betreten zu Boden.
»Schon gut, Mädchen. Dann kümmere du dich bitte um die Zeugin.«
Nesrin atmete erleichtert auf. »Und du bist mir nicht böse?«
»Hau schon ab, ich übernehme das.«
Yalcin drehte sich um und ging in Richtung der Frau. Ihr Mageninhalt hob und senkte sich. Unwillkürlich drückte sie beide Händen gegen ihren Bauch. Nein, das darf nicht sein. Nicht hier! Nicht vor den Leuten! Nicht vor den Kollegen des Streifendienstes! Sie schluckte kräftig. Mehrmals. Vergeblich. Ihr blieb nichts anderes übrig, als ein paar Schritte zur Seite zu rennen und sich in hohem Bogen zu übergeben.
Sie schaute zurück. Alle sahen sie an. Die beiden Kollegen vom Streifendienst feixten schadenfroh. Mit dem Ärmel putzte sie sich den Mund ab. Sie kochte vor Wut und stapfte zur Leiche zurück. Nawrod suchte gerade in der Jacke des Toten nach Ausweispapieren.
»Okay, Jürgen, ich muss auf Leichenflecken, Leichenstarre, Hämatome oder sonstige Verletzungen achten. Dazu muss ich den Toten vollständig entkleiden und akribisch untersuchen. Richtig?« Ohne eine Antwort abzuwarten, fuhr sie fort: »Zusammen mit Arzt und Kriminaltechniker muss ich nach kleinsten Hinweisen suchen, die auf eine Fremdeinwirkung hindeuten könnten. Wo bleiben die, verdammt noch mal?«
»Hey, Nesrin, du musst nicht …«
»Spar dir die Spucke! Ich mach’s und damit basta! Deck ihn wieder zu, bis die Technik und der Arzt da sind!«
Nawrod zog die Plane über den Kopf des Toten und erhob sich. Tiefe Zufriedenheit erfüllte ihn, als er sah, wie entschlossen die junge Kollegin die Lippen zusammenpresste. Sie war eine gute Schülerin, vielleicht sogar die beste, die er jemals hatte. Ihr fahles Gesicht ließ jedoch das Schlimmste befürchten. Sollte sie es nicht durchstehen, würde es das Ende ihrer Laufbahn bedeuten. Sie würde zum Gespött des gesamten Polizeipräsidiums werden.
Fast zeitgleich trafen Notarzt, Rettungssanitäter sowie Susanne Bauer von der Kriminaltechnik ein.
»Dem ist nicht mehr zu helfen«, begrüßte Nawrod den Notarzt und zeigte auf die abgedeckte Leiche. »Sie können also wieder abrücken, Herr Doktor …«, Nawrods Blick richtete sich auf das Namensschild über der linken Brusttasche des Arztes, … »Herr Doktor Khalil. Wir warten auf den Polizeivertragsarzt.«
»Mir ist sehr wohl bekannt, dass hier ein Toter liegt. Ich erhielt über Funk die Order, nach Inaugenscheinnahme der Leiche den Totenschein auszustellen. Ihr Amtsarzt wurde nach Eppelheim zu einem tödlichen Arbeitsunfall gerufen.«
»Auch das noch«, murmelte Nawrod. Er kannte das Problem. Polizeivertragsärzte waren in Sachen Leichenschau geschult und verfügten über viel Erfahrung. Zusammen mit ebenfalls erfahrenen Leichensachbearbeitern der Kriminalpolizei entging ihnen kaum ein Detail, das auf ein begangenes Verbrechen hinweisen könnte.
Nawrod hatte unzählige Male erlebt, dass sich Notärzte gerne vor der genauen Untersuchung einer bereits verwesenden Leiche drückten. Zudem wussten Berufsanfänger oft nicht, auf was sie bei einer Leichenschau zu achten hatten.
Er zog seine Einmalhandschuhe aus und begrüßte Sabine Bauer per Handschlag. In den letzten Wochen hatte er überaus erfolgreich mit ihr zusammengearbeitet. »Schön, dich zu sehen.«
»Was liegt an?«
Ihre Hand fühlte sich warm und vertraut an. Und dann war da wieder dieser Blick, der ihn an die gemeinsame Nacht mit ihr erinnerte. Es fiel ihm schwer, sich zu konzentrieren.
»Ein junger Mann«, erklärte er. »Allem Anschein nach ein Obdachloser. Komische Sache. In dem Alter stirbt man nicht an Leberzirrhose. Die üblichen Untersuchungen also. Nesrin übernimmt alles, was mit der Leiche zu tun hat. Ich kümmere mich um die Zeugin.«
Sabine Bauer runzelte die Stirn. »Okay, wenn du meinst.«
Nawrod verstand. Es war klar, dass die Kriminaltechnikerin befürchtete, Yalcin könnte mit der Untersuchung der Leiche überfordert sein.
Nesrin räusperte sich und wandte sich mit fester Stimme an Sabine Bauer. »Bitte schieß zuerst ein paar Übersichtsaufnahmen, bevor du nach etwaigen Spuren in einem Umkreis von zehn Metern suchst. Anschließend befassen wir uns mit dem Toten. Wir müssen uns beeilen. Es wird bald dunkel.«
Ein erstauntes Lächeln huschte über Sabine Bauers Mund. Es war ungewöhnlich, von einer Kommissaranwärterin in diesem Ton angesprochen zu werden. Immerhin war Bauer über 15 Jahre älter als Yalcin und eine sehr erfahrene Kriminaltechnikerin, die genau wusste, was sie in einem solchen Fall zu tun hatte. Ihr musste man das nicht ausdrücklich sagen. Doch die Art, wie sich Yalcin gab, ließ auf viel Mut und Selbstbewusstsein schließen. Hinzu kam, dass ihr die junge Kollegin auf Anhieb sympathisch gewesen war, als sie das erste Mal miteinander zu tun gehabt hatten.
Bauer holte Kamera und Spurensicherungskoffer aus dem Wagen. Zuerst stellte sie einen kleinen Digitalthermometer in einigem Abstand zur Leiche auf den Boden. Danach fotografierte sie, suchte nach Spuren und sammelte mit einer Pinzette mehrere Zigarettenstummel vom Boden auf, die sie unter den neugierigen Blicken von Gaffern einzeln in kleine Plastiktüten verpackte.
»Keine sonderlich große Ausbeute.« Sie zuckte mit den Schultern. »Vielleicht haben wir mit der Leiche mehr Glück.«
Yalcin wandte sich an die Rettungssanitäter: »Würden Sie bitte einen Sichtschutz um den Toten bauen, damit wir mit der Untersuchung beginnen können?«
Es dauerte keine drei Minuten, bis der Leichenfundort abgeschirmt war. Als Yalcin die Plane von der Leiche zog, schlug ihr der übelste Geruch entgegen, den sie jemals in ihrem jungen Leben wahrgenommen hatte. Instinktiv hielt sie die Luft an. Muss ich mich noch mal erbrechen, schoss es ihr durch den Kopf.
»Geh mal bitte aus dem Weg und lass mich ein paar Fotos von dem Toten schießen.« Sabine Bauer berührte Nesrin an der Schulter und schob sie sanft zur Seite.
Dankbar erfüllte Yalcin die Bitte. Sie trat zurück und schnappte nach Luft. Der Abstand war jedoch nicht groß genug, um den Verwesungsgeruch nicht mehr wahrzunehmen. Er hatte sich an ihr festgekrallt und drang in jede Pore ihres Körpers.
Bauer machte in aller Ruhe Nahaufnahmen des nun freiliegenden Leichnams. Die anschließende Suche nach Spuren von Gewaltanwendung war erfolglos.
Nesrin versuchte, den Geruch zu ignorieren. Der Anblick des toten Mannes machte ihr sehr zu schaffen. Sie wusste, dass sie eine große Bewährungsprobe zu bestehen hatte.
Leise murmelte sie die Worte, die sie in ihr Notizbuch schrieb: »männlich, circa 35 Jahre, schlank, 180 cm, äußerst ungepflegt, dunkelblonde halblange Haare, klebrig verfilzt, in mit Flecken übersäten blauen Schlafsack gehüllt, darunter braune Wolldecke, neben Leiche zwei große Einkaufstüten mit Kleidern und anderen Utensilien, in Kopfhöhe geschlossene fast leere Wodkaflasche«.
Nesrin machte einen Strich unter den Eintrag.
Sabine Bauer hob die Flasche auf und packte sie in eine große Tüte, die sie mit den beiden Einkaufstüten zu ihrem Wagen trug. Währenddessen suchte Yalcin nach Ausweispapieren des Toten. Sie musste ein paarmal würgen. Der Gestank war nach wie vor unerträglich. In der Innentasche des olivgrünen Parkas fand sie eine speckige Brieftasche, in der sich neben einigen kleinen Zetteln und Bildern der Personalausweis des Verstorbenen befand. Der Mann hieß Thorsten Roth.
Yalcin staunte. »Der ist ja erst 25 Jahre alt.«
»Schlimm, was der Alkohol aus einem Menschen macht«, sagte Bauer lakonisch. Doch schwang auch ein gewisses Maß an Mitleid in ihrer Stimme mit. »Wir müssen prüfen, ob der Mann Verletzungen hat.«
Bauer fasste an einen Arm des Toten. »Die Leichenstarre ist an allen Gliedmaßen ausgeprägt. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als seine Kleidung aufzutrennen.«
Wie befürchtet, war Doktor Khalil keine große Unterstützung. Während Nesrin half, den Toten zu entkleiden, stand der Arzt nur untätig herum.
Obwohl Sabine Bauer Routine darin hatte, wunderte sie sich immer wieder aufs Neue, dass Tote, bei denen die Leichenstarre eingetreten war, sich derart stocksteif anfühlten, als seien sie tiefgefroren.
Yalcin konzentrierte sich einzig und allein darauf, nicht zu erbrechen. Mit jedem Kleidungsstück, das entfernt wurde, verstärkte sich der Geruch. Als sie die Unterhose des Toten herunterstreifte, wurde ihr klar, warum die Leiche bestialisch stank.
»Oh Gott, ich muss gleich wieder kotzen«, stöhnte sie und drehte ihr Gesicht abrupt weg.
»Das ist nicht dein Ernst, oder? Reiß dich zusammen! Das ist unser Job! Komm, ich helfe dir.« Sabine Bauer streifte die Unterhose des Toten weiter nach unten. »Der hat noch mal kräftig geschissen. Ist nicht ungewöhnlich bei Menschen, die sterben.« Sabine Bauers Stimme klang betont sachlich und dennoch einfühlsam.
Sicher war es nicht seine Absicht, aber Doktor Khalils Äußerung wirkte belehrend: »Das kommt meistens dann vor, wenn die Agonie des Darmes oder der Blase und die Erschlaffung der Schließmuskulatur symbiotisch wirken.«
»Ich weiß. Man hat es uns auf der Polizeiakademie gelehrt. Aber man hat wohl vergessen, zu erwähnen, wie furchtbar das stinkt.«
»In unserem Job sind Theorie und Praxis oft zwei Paar Stiefel.« Bauer schnitt die Unterhose vom Bund bis zum Schritt auf, weil sie nicht weiter als bis zwei Handbreit über den Knien heruntergezogen werden konnte. Die Leiche lag nun völlig nackt vor ihnen. Die Kriminaltechnikerin schoss ein paar Bilder. »Wie es aussieht, brauchen wir keinen Gerichtsmediziner zu rufen. Was meinst du, Nesrin?«
»Hast wahrscheinlich recht. Aber wir müssen ihn noch genauer untersuchen.«
Während Doktor Khalil den Leichenschauschein ausfüllte, drehten Bauer und Yalcin den Toten auf den Bauch.
»Die Leichenflecken sind ohne Ausnahme lagegerecht und sehr stark ausgeprägt.« Bauer drückte mit dem Daumen kräftig auf eine der großflächigen dunkelroten Hautverfärbungen am Rücken. »Außerdem sind sie nicht mehr wegdrückbar.«
Yalcin nickte zustimmend. »In Verbindung mit Leichenstarre und Umgebungstemperatur schätze ich, dass der Mann seit mindestens 15 Stunden tot ist. Und ganz sicher wurde er nicht umgelagert.«
»Der Meinung bin ich ebenfalls.« Bauer führte den Leichenthermometer in den Anus des Toten ein. Anschließend tastete sie den Kopf ab. Sie erhob sich. »Keine Deformierung der Schädeldecke. Das Hämatom am Ellenbogen ist uralt und rührt bestimmt von einem Sturz.«
»Ja, das denke ich auch.« Yalcin kniete noch neben dem Toten.
»Lassen Sie mich mal.« Doktor Khalil bückte sich und tastete die rechte Seite oberhalb der Hüfte ab. »Hm, die Leber ist nicht auffällig.« Er zog die Lider eines Auges auseinander. »Icterus vermutlich negativ.«
Yalcin hob die Schultern. »Geht das auch auf Deutsch, Herr Doktor?«
»Kein Hinweis auf Gelbsucht oder eine andere innere Krankheit. Gibt es Einstiche?«
»Nein, aber Sie können gerne selbst nachsehen.« Yalcin machte eine einladende Handbewegung.
»Ich glaube es Ihnen auch so.« Doktor Khalil lächelte charmant, wobei eine Reihe blendend weißer Zähne zum Vorschein kamen. Der Notarzt runzelte die Stirn. »Tut mir leid, für mich liegen keine eindeutigen Hinweise auf einen natürlichen Tod vor.«
»Das muss Ihnen nicht leidtun. Ich hätte aufgrund des Alters und der Auffindesituation der Leiche ohnehin einen richterlichen Beschluss zur Obduktion beantragt.« Yalcin wusste, dass kein Weg daran vorbeiführte. Wenn sie die Leichenöffnung nicht beantragte, würde es spätestens der zuständige Staatsanwalt tun, allerdings nicht ohne ihr nachlässige Arbeit vorzuwerfen. Außerdem wollte sie auch konkret wissen, an was der junge Mann gestorben war, obgleich es nicht die geringsten Anzeichen für ein Tötungsdelikt gab.
Bauer zog den Thermometer aus der Leiche und verglich es mit dem Digitalthermometer. »5,2 Grad Unterschied. Ziemlich ausgekühlt, würde ich sagen. Mit den 20 Stunden Liegezeit könntest du durchaus recht haben, Nesrin. Vielleicht sind es sogar mehr. Sobald wir im Präsidium sind, werde ich den Todeszeitpunkt mithilfe der Henßge-Formel genauer berechnen.«
»Da nimmst du ja der Gerichtsmedizin die ganze Arbeit ab.«
»Nein, bestimmt nicht. Ich habe es mir nur angewöhnt, selbst Berechnungen durchzuführen. Ist nämlich auch für einen Rechtsmediziner nicht einfach, und doppelt genäht hält besser.«
Yalcin zog die Plane über die Leiche. Danach holte sie ihr Handy aus der Tasche und rief die Funkleitzentrale an. Nach einem kurzen Bericht bat sie darum, möglichst schnell einen Bestatter zum Leichenfundort zu schicken.
Doktor Khalil streckte Yalcin den ausgefüllten Leichenschauschein entgegen. »Wenn Sie meine Dienste nicht mehr benötigen, würde ich mich gerne verabschieden.«
»Danke, Herr Doktor. Sie waren uns eine große Hilfe.«
»Gerne wieder.« Der Notarzt hatte Yalcins ironischen Unterton offenbar überhört. Er war zweifelsohne froh, seine Arbeit erledigt zu haben, und gab den beiden Sanitätern ein Zeichen. Kurze Zeit später fuhren die drei mit dem Rettungswagen davon.
Nawrod kam auf Bauer und Yalcin zu. »Und, was hat euch die Leiche erzählt?«
»Nicht viel.« Bauer packte ihre Sachen zusammen.
»Was hat die Vernehmung der Zeugin ergeben?«, fragte Yalcin in gespannter Erwartung.
»Nichts Besonderes. Ihr ist der junge Mann schon öfter unter dieser Brücke aufgefallen. Heute Morgen dachte sie, er schläft seinen Rausch aus. Er habe den Schlafsack bis über den Kopf gezogen gehabt. Als er heute Abend immer noch in der gleichen Stellung dalag, habe sie ihn mehrmals laut angesprochen – keine Reaktion. Da sie befürchtete, dem Mann könnte etwas zugestoßen sein, habe sie den Schlafsack ein wenig zurückgestülpt und sofort gesehen, dass er tot ist. Danach habe sie über Notruf die Polizei verständigt.«
»Möchte nicht wissen, wie viele Menschen im Laufe des Tages sonst noch hier vorbeigekommen sind. Aber außer der Zeugin kümmert es anscheinend kein Schwein, wenn ein Penner unter einer Brücke sein Leben aushaucht.« In Sabine Bauers Worten schwang bittere Erkenntnis.
»Er war gerade mal drei Jahre älter als ich. Ich habe nie daran gedacht, dass man in diesem Alter einfach sterben kann. Was werden seine Eltern zu dem schrecklichen, viel zu frühen Ende ihres Sohnes sagen?« Yalcin war nach wie vor auffallend blass im Gesicht.
»Vielleicht hat er sich buchstäblich zu Tode gesoffen. Das soll vorkommen. Die Wodkaflasche war fast leer.« Nawrod sah Bauer fragend an.
»In dem Alter säuft man sich nicht so schnell zu Tode. Nicht mit einer Flasche Wodka.«
Nawrod nickte. »Möglich ist alles. Wer weiß, wo und was der sonst noch geschluckt hat.«
»Wir lassen die Leiche auf jeden Fall zur Gerichtsmedizin bringen.« Nesrin hörte sich an, als ob sie seit Jahr und Tag Todesfälle bearbeiten würde. »Bin gespannt, was die Obduktion ergibt.«
*
Nesrin hatte noch nie eine Leichenmeldung geschrieben. Es war Freitagabend. Sie wusste, dass die Meldung spätestens am nächsten Morgen beim Bereitschaftsstaatsanwalt auf dem Tisch liegen musste. Nawrod zeigte der jungen Kommissaranwärterin Schritt für Schritt, was zu beachten war. Gegen 21 Uhr waren sie fertig. Stolz brachte Nesrin ihr kleines Werk zum Kriminaldauerdienst.
»Hallo, Frau Kollegin, was bringst du uns da Schönes?«
Nesrin stockte der Atem. Vor ihr stand Elyas M’Barek. Das kann nicht sein! Der ist doch kein Bulle. Der ist Schauspieler. Und was für einer! Wie der in »Fack ju Göhte« den Lehrer gegeben hat, war oscarreif. Röte schoss ihr ins Gesicht. Sie wollte antworten. Es kam jedoch kein Ton über ihre Lippen.
M’Barekwarf einen Blick auf die Akte, auf deren Deckblatt ein großes rotes Kreuz prangte. »Aha, eine Leichenmeldung. Ist das der, der unter der Theodor-Heuss-Brücke lag?«
»Wie …? Was …? Nein … doch, ja!«
»Bist du schon lange beim D 1? Wir sind uns hier noch nie begegnet.«
»Ja … Nein … Ich war … Nein, ich bin …«
M’Barekgrinste unverhohlen. »Ich bin es nicht, leider. Wäre ich sonst hier?« Er sah Nesrin direkt in die Augen. »Du bist nicht die Einzige, die mich mit Elyas M’Barek verwechselt. Der Typ ähnelt mir tatsächlich optisch. Aber ich habe zuerst so ausgesehen. Deshalb fällt mir nicht im Traum ein, mein Outfit zu ändern. Soll er es doch tun, wenn es ihn stört.«
»Das ist … das ist einfach unglaublich!« Nesrin war baff.
Er streckte ihr die Hand entgegen. »Maximilian Wolff! Und wie heißt du?«
Zaghaft gab sie ihm die Hand. »Nesrin Yalcin. Ich bin Türkin.«
Sie konnte sich nicht erinnern, dass sie jemals derart leise und schüchtern ihren Namen gesagt hatte. Nicht einmal als Sechsjährige bei ihrer Einschulung. Und wie konnte ihr herausrutschen, dass sie Türkin ist? Am liebsten hätte sie sich sofort in Luft aufgelöst. Das ist ja so was von oberpeinlich, dachte sie.
Wolff lachte laut. »Wirklich? Das hätte ich jetzt nicht gedacht.«
Ihr Körper vibrierte. Sie versuchte, sich zusammenzureißen. »Ich … Könntet ihr bitte die Meldung gleich morgen früh zur Staatsanwaltschaft bringen?«
»War ein Spaß. Natürlich ist mir sofort aufgefallen, dass du Türkin bist. Und was für eine!«
Wortlos verließ Nesrin den Raum. Sie hatte das Gefühl, mit glühenden Sohlen auf einem halben Meter Pulverschnee zu laufen. Jeden Moment rechnete sie damit, dass ihre Beine nachgeben und sie für immer in der weißen Masse versinken würde. Sie hielt inne, lehnte sich an die Wand des Flurs und versuchte durchzuatmen. Plötzlich drehte sie sich um und schlug mit beiden Händen zweimal so heftig gegen den Rauputz, dass ihr der Schmerz bis in die Schultergelenke fuhr.
»Wie kann man nur dermaßen blöd sein?« Ihre Stimme hallte über den langen Gang. Sie hatte Glück. Um diese Zeit befand sich außer dem Dauerdienst und Nawrod niemand mehr im Präsidium.
Als sie ihr Büro betrat, hatte sie sich wieder unter Kontrolle. Nawrod sah erstaunt zu ihr auf. »Hey, was ist mit dir passiert? Ist dir Mohammed persönlich erschienen?«
»Wie kommst du auf den Quatsch?« Nesrin quälte sich ein Lächeln ab.
»Du siehst irgendwie anders aus. Ist das …? Ach ja, du hast deinen ersten Todesfall bearbeitet. Bist mächtig stolz, oder? Mir ging es bei meiner ersten Leiche ähnlich. Ist schon ein komisches Gefühl, wenn man der absolut Letzte ist, der einem Dahingeschiedenen helfen kann.«
»Dem war bestimmt nicht mehr zu helfen.«
»Da irrst du dich gewaltig. Wenn nicht du, wer soll denn dann herausfinden, ob der Tote einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist oder nicht? Ich denke, jeder Mensch, der gewaltsam zu Tode kommt, würde es, wenn er denn könnte, liebend gerne sehen, dass sein Mörder gefasst wird.«
»Du hast recht. Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht Was meinst du, wann wir von der Gerichtsmedizin Bescheid bekommen?«
»Hängt davon ab, wie viele Leichen die am Wochenende auf dem Tisch haben und wie viel Arbeit damit verbunden ist. Die obduzieren ja nicht nur, sondern müssen für alle möglichen Stellen und Institute eine Unmenge von anderen Untersuchungen durchführen. Da es bei unserem Toten keine Hinweise auf ein Kapitalverbrechen gibt, werden sie es nicht sehr eilig haben. Ich denke, dass sie uns frühestens am Dienstag ein erstes Ergebnis mitteilen. Die toxikologischen Untersuchungen dauern ohnehin länger. Bis wir vollständige Klarheit haben, wird gut eine Woche vergehen.«
*
Als Nawrod gegen 22:30 Uhr seine Wohnungstür aufschloss, spürte er bleierne Müdigkeit in seinem Körper. Nach dem anstrengenden Tag hatte ihm die Heimfahrt nach Stuttgart den Rest gegeben. Aus der Gefriertruhe holte er sich eine Scheibe Brot, die er im Toaster auftaute. Dazu aß er zwei Landjäger und trank ein großes Glas Mineralwasser. Kurze Zeit später fiel er todmüde ins Bett.
Am nächsten Morgen nahm er sich den beträchtlichen Stoß von nicht geöffneten Briefen vor. Er hatte in der letzten Zeit einfach sehr viel um die Ohren und kam zu spät nach Hause, um sich noch um die Post zu kümmern. Das meiste waren Werbebriefe, die er ungeöffnet in den Papierkorb warf. Auf einem der Briefe stand »Rechtsanwälte Berger & Berger« als Absender. Nawrod ahnte sofort, was es damit auf sich hatte. Hastig riss er das Kuvert auf. Seine Hand zitterte, als er den Betreff las: »Scheidungssache Eva Nawrod / Jürgen Nawrod«.
Schnell überflog er das Schreiben. Sein Atem ging stoßweise. »Ganz ruhig«, murmelte er. Er las es ein zweites Mal und achtete auf jedes Wort.
Sehr geehrter Herr Nawrod,
hiermit zeigen wir an, dass wir Ihre Gattin, Frau Eva Nawrod, vertreten. Frau Nawrod hat um unseren familienrechtlichen Beistand nachgesucht und uns bei einem Erstgespräch mitgeteilt, dass Sie seit zehn Monaten getrennt leben. Die Hintergründe der Trennung sind Ihnen bekannt. Im Zusammenhang mit der dauerhaften Trennung besteht ein Regelungsbedarf hinsichtlich des von Ihnen geschuldeten Ehegatten- und Kindesunterhaltes. Nach Berücksichtigung Ihrer Einkommenssituation sowie des Umstandes, dass Sie die gemeinsame Wohnung allein nutzen, sind Sie zur Zahlung eines monatlichen Gesamtunterhaltes in Höhe von 1.435,00 € verpflichtet. Sie werden gebeten …
Nawrod verschwammen die Buchstaben vor den Augen. Gleichzeitig wurde ihm bewusst, wie sehr er in den letzten Monaten sein Privatleben vernachlässigt hatte. Die Arbeit in der Soko Päckchen und die Aufklärung des wohl spektakulärsten Heidelberger Mordfalles, den es je gegeben hatte, hatten nicht nur seine gesamte Energie beansprucht, sondern auch seine Freizeit bis auf ein Minimum reduziert. Sie diente eigentlich nur zum Schlafen und der viel zu kurzen Erholung. Immer wieder hatte er sich vorgenommen, Frau und Kind zurückzuholen, doch nie hatte er die nötige Zeit dafür gefunden. Denn eines war ihm bewusst: Er hatte nur eine Chance, wenn er behutsam und mit viel Gefühl vorging. Wenn er Eva davon überzeugen konnte, dass er sich wirklich ändern würde und die Familie für ihn das Wichtigste sei.
Heute wollte er den Anfang machen. Er würde sich mit den beiden treffen und in aller Ruhe reden. Sehnsucht nach seiner Familie ergriff ihn. Sie brannte wie Glut unter der Asche in seiner Brust. Ängste stiegen in ihm auf. Wie würde Samia reagieren? Sie war jetzt 13 und mitten in der Pubertät. Sicher das schwierigste Alter für ein junges Mädchen. Nawrod griff zum Telefon und wählte die Festnetznummer der beiden.
»Ich kriege das in den Griff«, murmelte er vor sich hin. »Wir sind eine Familie.«
Nawrod redete in der letzten Zeit öfter mit sich selbst. Am Anfang waren es nur einzelne Worte gewesen. Bald waren es kurze Sätze. Inzwischen führte er, meist unter der Dusche oder wenn er einmal kochte, richtige Selbstgespräche.