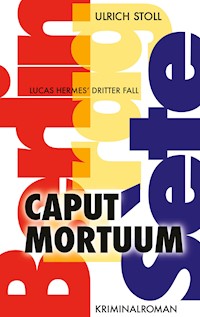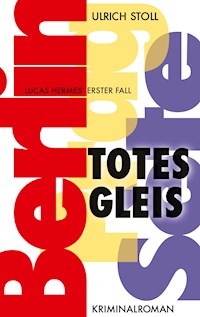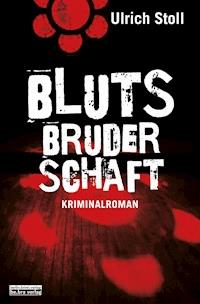
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: be.bra verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Berlin, im Wendeherbst 1989. Ein bizarrer Mord weckt das Interesse des Fernsehjournalisten Lucas Hermes. Im Zuge seiner auf eigene Faust unternommenen Ermittlungen kommt er einer schier unglaublichen Verschwörung auf die Spur. Doch bevor er seine Recherchen veröffentlichen kann, muss er seiner Kollegin und Geliebten Anna beistehen, die als Verdächtige eines Sprengstoffanschlags ins Visier der Mordkommission geraten ist. Erst allmählich wird den beiden klar, in welcher Gefahr sie schweben. Offenbar sind sie einer Macht in die Quere gekommen, die bereit ist, über Leichen zu gehen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2018
Sammlungen
Ähnliche
Ulrich Stoll
BLUTSBRUDERSCHAFT
Kriminalroman
Die Personen und Handlungen dieses Romans sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit tatsächlichem Geschehen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte vorbehalten.
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen, Verfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung auf DVDs, CD-ROMs, CDs, Videos, in weiteren elektronischen Systemen sowie für Internet-Plattformen.
© berlin.krimi.verlag im be.bra verlag GmbH
Berlin-Brandenburg, 2018
KulturBrauerei Haus 2
Schönhauser Allee 37, 10435 Berlin
Lektorat: Gabriele Dietz, Berlin
Umschlag: Ansichtssache, Berlin
ISBN 978-3-8393-6163-4 (epub)
ISBN 978-3-89809-551-8 (print)
www.bebraverlag.de
»Es gibt eine unsichtbare Welt, die die sichtbare durchdringt.«
Gustav Meyrink, Das grüne Gesicht
Samstag, 19. August 1961
Er hatte sich mit den Erzieherinnen in Zepernick darauf verständigt, den Übergang möglichst schmerzlos zu gestalten. Schon am Sonntag würde er Nina bringen, da war ein Ausflug ins Pionierlager geplant. Die Kleine würde gar nicht merken, dass der Koffer mit Wäsche für die ganze Woche gepackt war. Den Samstagnachmittag verbrachte er mit Nina im Tierpark. Sie quietschte vergnügt, als er sie auf die Schultern hob, damit sie die Bären im Gehege besser sehen konnte.
»Der Bär schläft!« Sie lachte und zeigte zum Eingang der Höhle.
»Nina«, sagte er bemüht heiter, »weißt du, was ich dir versprochen habe?«
»Dass ich morgen in einem echten Panzer fahren darf.«
Ihm saß ein Kloß im Hals. Würde sie begreifen, dass sie ohne ihn im Pionierlager übernachten sollte? Und dass dann eine ganze Woche ohne Papa auf sie wartete? In den letzten Monaten hatte er Nina immer wieder bei den Großeltern des Mädchens unterbringen können, doch das war auf Dauer keine Lösung. Die Thiedemanns hatten sicher Kontakt zu ihrer Tochter Christel, die in den Westen gegangen war. Und Westkontakte waren einem Tschekisten streng verboten. Nina musste dem Einfluss ihrer Großeltern und ihrer Mutter entzogen werden.
Sie war jetzt vier, und es war der Sommer der Entscheidung. Würde es Krieg geben? Seit einer Woche trennten Stacheldrahtrollen den Ostteil Berlins vom Westen ab. Ab morgen würde er in einer Kaserne am Rande von Berlin wohnen, ohne seine Tochter. Er würde sich wie ein DDR-Grenzsoldat kleiden und mit einem Trupp MfS-Spezialkräften an den Zaun verlegt. An die Stelle der Bernauer Straße, an der sie seit ein paar Tagen Fenster zumauerten und hinter dem Stacheldraht eine unüberwindliche Mauer hochzogen. Jurczik und seine Männer sollten nicht den Feind jenseits der Grenze in Schach halten, die Pöbler, die mit ihren »Mörder!«-Rufen die Grenzer verunsicherten. Die Männer der Einsatzkompanie hatten die Aufgabe, die eigenen Leute zu bewachen. Die Posten, die immer paarweise patrouillierten. Die Maurer, die Stein auf Stein schichteten und den antiimperialistischen Schutzwall errichteten. Jurczik und sein Trupp sollten schießen, wenn ein Maurer oder ein Grenzer nach drüben fliehen wollte. Sie hatten Befehl, auf den Oberkörper zu zielen, auf das Herz. Kein Flüchtling würde es lebend in den Westen schaffen, um dort den Geheimdiensten den geplanten weiteren Aufbau der Grenzanlagen zu verraten. Keiner.
Sonntag, 20. August 1961
Am Sonntagmorgen war Nina schon während des Frühstücks aufgeregt. Papa wollte ihr einen echten Panzer zeigen! Und was noch toller war: Sie würden im Pionierlager zelten.
»Papa«, fing Nina an und nahm einen Schluck Kakao. »Wenn wir im Lager zelten, wie kommen wir am Montag in den Kindergarten? Wir sind doch weit weg.«
»Du musst Montag nicht in den Kindergarten«, sagte er vorsichtig. Sie sah ihn mit großen Augen an.
»Aber ich spiele doch immer mit Irina und Hilde.«
»Nicht am Montag, da triffst du neue Freunde. Das Ferienlager geht dann weiter«, log er. »Die ganze Woche gibt es Spiele, aber in der Stadt.«
»Ich will aber in den Kindergarten.«
»Das kannst du auch, aber in einen neuen.« Er schluckte. Bisher hatte er es nicht fertiggebracht, ihr die Wahrheit über die Wochenkrippe zu sagen. Ab Montag, das hatten seine Vorgesetzten verlangt, würde Nina fünf Tage die Woche in der Obhut der MfS-Erzieherinnen verbringen. Andere Tschekisten müssten auch dieses Opfer bringen. Die Kinder wären in Zepernick in den besten Händen, hatte ihm Oberst Hertel, sein Vorgesetzter, versichert.
Jetzt kullerten die ersten Tränen.
»Ich will aber zu Irina und Hilde.«
Normalerweise wäre ihm jetzt die Hand ausgerutscht. Doch er nahm sich zusammen.
»Was war das eben?« Er legte ein bedrohliches Grollen in seine Stimme. Das wirkte. Nina schluckte die Tränen hinunter. Sie wusste, dass er so fest zuschlagen konnte, dass die Wange noch lange brannte. Und sie fürchtete nichts mehr als seinen Gürtel, den er aus der Hose zog, wenn sie ungezogen war. Und diese Schläge auf den Po brannten noch schlimmer als die Wange nach einer Ohrfeige.
»Du weißt doch«, begann er mit wieder sanfter Stimme, »dass es böse Menschen gibt.«
Sie nickte schniefend.
»Und die wollen nicht, dass wir in Frieden leben. Und darum muss der Papa die ganze Woche an der Grenze aufpassen, damit dir nichts passiert.«
»Bist du die ganze Woche an der Grenze?«
»Ja leider, ich muss doch mein Mädchen beschützen.«
Sie kämpfte wieder mit den Tränen. Jetzt durfte sie keine Schwäche zeigen, sonst würde sein Tonfall sich blitzschnell ändern und die Hand durch die Luft sausen.
»Was sind da für Kinder?«
»Viele Kinder von Freunden, auch ganz kleine Babys.«
Nina verzog ihren Mund, der ihn immer an Christel denken ließ, zu einem skeptischen Lächeln. Sie schien sich gefangen zu haben.
Christel war weit weg, in Köln, beim Feind. Was wohl aus dem Kind geworden war? Christel hatte sie Anna nennen wollen.
Sonntag, 7. Oktober 1962
Was ist ein Jahr für ein Kind? Ein unvorstellbar langer, träger Fluss aus Tagen, Stunden, Minuten, eine endlose Abfolge von Momenten der Furcht vor den Frauen, die Ninas Tagesablauf, Stunde um Stunde, bestimmten. Immerzu musste sie grübeln: Was hatte sie dieses Mal falsch gemacht? Was verärgerte die Tanten so sehr, dass wieder eine Bestrafung fällig war? Wie lange würde sie auf die Strafe warten müssen?
Sie saß auf dem Bett im leeren Schlafsaal, angezogen und reisefertig, den gepackten Koffer neben dem Nachttisch. Die anderen Kinder waren schon am Freitag abgeholt worden, doch ihr Vater hatte am Wochenende Dienst und konnte sie erst am 13. Geburtstag des ersten deutschen Friedensstaates aus der Wochenkrippe abholen. So viele Nächte hindurch hatte sie im Dunkeln in der Ecke gestanden, wenn sie wieder einmal im Waschraum erwischt worden war, wie sie hastig das feuchtwarme Laken trockenzureiben versuchte. Anfangs hatte sie sich bemüht, nach dem Lichtausschalten wach zu bleiben, um bloß nicht ins Bett zu machen, doch immer war die Müdigkeit stärker gewesen, waren ihr die Augen zugefallen. Dann plötzlich das warme Gefühl am Po, durch das Nachthemd hindurch. Für das Einnässen gab es Schläge auf den nackten Hintern. Dann das lieblose Abschrubben mit dem eiskalten Waschlappen von oben bis unten, das Abrubbeln mit dem kratzigen Handtuch. Du wirst es schon noch lernen, kleines Biest! Dann musste sie ein frisches Nachtkleid überstreifen und beim Beziehen des Bettes helfen. Ab in die Ecke, Gesicht zur Wand! Sie wusste, dass die anderen Mädchen wach in ihren Betten lagen, sich aber nicht trauten, sie jetzt schon, mitten in der Nacht, zu hänseln. Sie stellten sich schlafend, während Nina in der Ecke ihr Verbrechen büßen musste, mit nackten Füßen auf dem kalten Boden, endlose Minuten lang.
»Ab ins Bett«, sagte die Tante endlich. Nina lag dann wach, weil sie den Morgen noch mehr fürchtete als das Hochschrecken im nass gepinkelten Bett. Sie fürchtete die gemeinen Hänseleien.
»Pipi-Nina!«, riefen die Mädchen und lachten. »Pipi-Nina!«
Endlich stand der Vater im Schlafsaal. Komm her, meine Große! Er trug eine Uniform mit lauter Orden auf der Brust. Sie griff den Koffer und stürzte in seine Arme. Dann gingen sie zum Auto. Als sie in Berlin ankamen, musste der Vater den Wagen an der Weberwiese parken, denn die Karl-Marx-Allee war gesperrt. Sie eilten zur großen Straße, auf der Marschmusik aus Lautsprechern erklang. Die ersten Radpanzerwagen rollten vorbei. Hans-Peter Jurczik hob Nina auf seine Schultern. Nina sah die Soldaten auf ihren Motorrädern und in den Transportwagen, die kleine Kanonen hinter sich herzogen. War das ein Geknatter! Schwarzer Nebel kam aus den Auspuffrohren. Die Leute um sie herum winkten den Soldaten zu, also winkte Nina auch, hoch über den Köpfen der Erwachsenen.
Nach der Parade gab es Zuckerwatte, und dann liefen sie die Straße mit den hohen Häusern entlang, die mit Fahnen bunt geschmückt waren. Sie aßen an einer Bude eine Bockwurst. Dann ging es weiter bis Unter die Linden. Keine modernen Wohnhäuser mehr, sondern alte Gebäude mit verzierten Fassaden und mittendrin eine Ruine.
»Ist das das Schloss einer Prinzessin?«, fragte Nina. »Es ist hässlich.«
»Das war das Schloss des Kaisers, der den schlimmen Krieg angefangen hat«, sagte der Vater und hielt sie fest an der Hand. »Das machen die Arbeiter jetzt kaputt, damit nie wieder ein böser König drin wohnen und Krieg machen kann.«
Der Tag mit dem Vater ging viel zu schnell vorbei, und am Abend lag sie wieder mit offenen Augen im dunklen Schlafsaal.
Mittwoch, 19. Juni 1963
Auf dem kleinen Fahrrad fuhr sie immer wieder um die Sandkiste hinter dem Wohnblock herum, Runde um Runde. Da oben in einer der Wohnungen, die alle gleich aussahen, saß ihr Vati. Immer wieder musste sie den Satz murmeln: »Da oben sitzt Vati.« Er war am Morgen am Frühstückstisch im Wochenheim aufgetaucht und hatte sie breit angelacht. »Guck mal, Nina, ein Fahrrad für dich!« Sie war vom Tisch aufgesprungen, hatte die Milch diesmal nicht ausgetrunken und war zum Rad gestürzt. Und dann war sie um das Haus herumgefahren, ohne ihren Vater eines Blickes zu würdigen. Die Erzieherinnen hatten ihren braunen Pappkoffer schon am Vorabend gepackt und ihn am Morgen dem stämmigen Mann in der Lederjacke gereicht, als er Nina abholte. Martha, die dickste der Betreuerinnen, hatte das Kind zum Abschied hochgehoben, hatte es an ihren mächtigen, nach Schweiß riechenden Leib gepresst und ihm einen groben Kuss auf die Haare gedrückt. Nina fühlte nichts. Keine Zuneigung zu den Kittelschürzen-Frauen, die sie zwei Jahre lang versorgt hatten, die sie, immer in Eile, immer ruppig und lieblos, gefüttert, gewaschen, angezogen und auch geschlagen hatten.
Die Sache mit Gisela tat ihr nicht leid. Sie hatte sich erschrocken, als die nach dem Stich zurückgetaumelt war. Auf der weißen Kittelschürze zeigte sich ein kleiner blutroter Fleck. Warum gab Gisela ihr auch immer Kopfnüsse, wie sie es nannte, wenn Nina nicht gehorchte, wenn sie die Möhren nicht dünn genug schälte? Gisela ballte dann die Hand zur Faust und schlug mit den Knöcheln auf Ninas Kopf, immer wieder, und das nur wegen der Möhrenschalen! Es war nur ein Piekser mit der Spitze des Schälmessers gewesen, ein kleiner Piekser in den Bauch der Kittelschürzenfrau.
Nina saß mit trotziger Miene auf dem Beifahrersitz des Trabant-Kombi, in dessen Heck ihr Kinderfahrrad und der Koffer mit jedem Schlagloch klappernd auf und nieder hüpften. Das Wochenheim wurde im Rückspiegel immer kleiner. Zwei Betreuerinnen blickten ihr nach. Jetzt sollte das Kind bei ihm leben, beim Vati, der sich so lange nicht um sie kümmern konnte, weil er an der Grenze die Feinde in Schach halten musste. Im Schlafsaal hatte Nina sich manchmal ausgemalt, wie er da mit der Waffe im Staub lag und in die Nacht hineinhorchte. Die Feinde, die wollten sie holen, sie und die anderen Kinder aus dem Wochenheim. Und sie wollten ihnen Scheußlichkeiten antun, die Nina sich nicht vorstellen mochte. Dann schlug ihr Herz ganz wild. Wenn sie den Kopf abwechselnd von links nach rechts warf, wurde sie mit der Zeit ruhiger und konnte schließlich erschöpft einschlafen. Auch jetzt half es ihr noch, am Tisch vor und zurück zu wippen, damit die Stunden leichter vergingen. Samstags nach dem Frühstück holte Vati sie immer ab. Doch das Wochenende in der Wohnung, in der sie ein eigenes Zimmer hatte, ging viel zu schnell vorbei. Der Vater hatte auch nicht immer Zeit für sie. Er telefonierte und rauchte dabei, und Tante Karin oder eine andere Frau, die von Zeit zu Zeit mit ihnen in der Wohnung lebte, zerrte Nina auf Spielplätze oder in den Wildtierpark hinter dem Plattenbaugebiet. Dort dachte sie sich einsame Spiele aus. Immer wieder rauf auf die Rutsche, auf dem Hintern hinunter in den Sand, in ewigem Kreislauf. Mit den anderen Kindern spielte sie kaum.
Wenn Hans-Peter Jurczik getrunken hatte, wurde aus dem gemütlichen Vati ein Berserker. Dann störte ihn jedes Türenknallen, jedes Widerwort. Dann sauste die Hand. Wenn Nina besonders ungezogen war, zog der Vater langsam den Gürtel aus den Hosenschlaufen. Übers Knie legen nannte er die Folter, die er Nina dann antat. Er schob ihren Rock hoch und peitschte den Po, den nur noch der Schlüpfer schützte. In der Nacht wimmerte sie sich in den Schlaf, konnte nur auf der Seite liegen. Das war die Zeit, als Nina Jurczik hassen lernte. Nicht nur die Feinde jenseits des Schutzwalles, die Faschisten, sondern auch den eigenen Vater.
»Nina, komm hoch«, rief der Vater aus dem Fenster. Sie hielt an und blickte ratlos nach oben. Sie konnte das Fahrrad doch nicht im Hof lassen! Er schloss das Fenster und holte sie mitsamt dem Fahrrad ab. Karin war da. Hans-Peter Jurczik und die knochige Frau mit der Kurzhaarfrisur hatten sich wieder versöhnt. Jurczik stellte das Kinderrad neben der Garderobe ab. Karin hatte den Tisch im Wohnzimmer gedeckt und servierte das Essen. Nina aß ihre Wurst und den Kartoffelsalat schweigend, während der Vater und seine Freundin fröhlich auf sie einredeten. In den großen Tierpark in Friedrichsfelde könnten sie doch gehen! Oder ins Hallenbad! Der Juni war noch zu kühl für das Baden im See.
Nina aß auf, wie sie es gewohnt war. Zum Nachtisch bekam sie eine große Portion Eis, während die Erwachsenen Zigaretten rauchten und weiter Bier tranken.
Karin stand auf und nahm den alten Karabiner von der Wand.
»Weißt du, was man damit machen kann?«, fragte sie.
»Totschießen«, sagte das Kind. Die Erwachsenen lachten.
Karin schulterte das Gewehr und marschierte auf der Stelle.
»Stillgestanden!«, rief Jurczik. »Das Gewehr – über!«
Karin folgte glucksend den Befehlen.
»Jetzt du!« Sie reichte Nina die schwere Waffe.
»Präsentiert – das Gewehr!«, prustete Jurczik. Karin stellte sich hinter Nina und leitete sie beim Exerzieren an. Das Kind konnte die Waffe mit beiden Händen nur mühsam vor dem Körper halten.
Immer wieder musste sie die Bewegungen üben, bis der Vater zufrieden war. Nina stellte das Gewehr auf Befehl neben sich, riss es hoch und presste es an die linke Schulter. Dann alles rückwärts. Karin hatte sich neben sie gestellt und machte die Bewegungsabläufe mit einem Schrubber vor.
»Meine kleine Soldatin«, sagte der Vater und zog genüsslich an seiner Zigarette.
»Und jetzt in den Tierpark«, rief Nina und versuchte, die schwere Waffe wieder an den Wandhaken zu hängen.
Montag, 2. Oktober 1989
»Ich kriege immer noch Gänsehaut«, sagte der dicke Schmitt und leerte sein Bierglas. »Wir sind heute gekommen, um Ihre Ausreise …« Heiner C. Schmitt äffte den sächselnden Tonfall des Außenministers nach und blickte wieder auf den Bildschirm. In diesen Tagen liefen in den Berliner Kneipen ständig die Fernseher, die sonst nur zu Fußballspielen eingeschaltet wurden. Es war viel los, fand Lucas, und das war gut für sein Konto. Er sah die Bilder der jubelnden Menschenmenge im Garten der deutschen Botschaft in Prag, die in einer Endlosschleife in den Fernsehprogrammen gezeigt wurden. Auch die Redaktion »Im Visier« hatte Beiträge für die Sondersendungen geliefert. Lucas Hermes und Heiner C. Schmitt waren mittlerweile ein eingespieltes Autorenteam, das sogar in der Redaktion übernachtete, um rund um die Uhr Fernsehbeiträge aus den eintrudelnden Euronews zusammenzuschneiden und Filmtexte aus den Tickermeldungen zu machen. Für heute war die Arbeit getan und die beiden gönnten sich ein paar Biere im Lentz am Stuttgarter Platz.
»Wir müssten jetzt in Prag sein«, sagte Lucas. »Da sind schon wieder Tausende über den Zaun geklettert.«
»Vergiss es, das macht der Korrespondent«, sagte Schmitt und hob sein Glas in Richtung der Bedienung, um noch zwei Pils zu ordern.
»Für mich nicht!« Lucas hielt abwehrend die Hand über sein Glas. »Ich habe gleich noch ein Vorstellungsgespräch.« Schmitt starrte ihn aus seinen kleinen, engstehenden Augen ratlos an.
»Warte!« Lucas deutete mit dem Kopf in Richtung Bildschirm. Ess-Jott Stövenhagen, ihr Redaktionsleiter, blickte sie aus dem Fernseher über den Rand seiner Lesebrille an.
»Auf ein Wort!« Stövenhagen sprach mit seiner sonoren Raucherstimme die Worte, mit denen er stets seinen Kommentar begann, der diesmal nicht im Investigativmagazin »Im Visier« ausgestrahlt wurde, sondern am Ende der Sondersendung über die Ereignisse in Prag.
»Die Ausreise tausender DDR-Bürger ist ein Anlass zur Freude«, sagte der Redaktionsleiter mit mürrischer Miene, den Kopf auf die Brust gepresst, sodass er fast halslos erschien. »Freude für die, die sich nach der Ausreise aus der DDR gesehnt haben. Doch der massenhafte Exodus ist kein Grund für die kalten Krieger im Westen, in Triumphgeheul auszubrechen.«
»Ganz schön kess«, sagte Schmitt.
»Die DDR ist ein souveräner Staat und ihre Bürger wollen nicht alle rübermachen. Die meisten wollen bleiben, wollen eine bessere, eine demokratischere DDR aufbauen. Bejubeln wir also nicht nur die, die gehen, sondern auch die, die bleiben, um Veränderungen durchzusetzen, gegen die SED oder auch innerhalb der Staatspartei.«
»Noch ein Bier!« rief Schmitt der Bedienung zu, die seine pantomimische Bestellung nicht verstanden hatte. »Warum willst du nichts mehr trinken?«
»Ich will ein Zimmer in einer WG mieten«, sagte Lucas. »Und die machen ein Spielchen daraus und lassen die Bewerber antanzen, wie bei einem Bewerbungsgespräch.«
»Klingt blöd«, sagte Schmitt und ließ die letzten Tropfen aus seinem Glas in den Mund rinnen.
Im schummerigen Gaslaternenlicht der Nehringstraße fand Lucas die blau gestrichene Eingangstür, daneben ein unbeleuchtetes Klingelbrett mit lauter über- und nebeneinander geklebten Namensschildern. Das also war das berühmte Regenbogenhaus: ein wild bemalter, heruntergekommener Wohnblock aus der Zeit der Jahrhundertwende, der vor einigen Jahren besetzt worden war. Die neuen Bewohner zermürbten die Wohnungsgesellschaft so lange, bis die den Eindringlingen ordentliche Mietverträge gewährte. Der Kiez am Klausener Platz bestand aus zerfallenden Altbauten mit Kohleöfen, die ebenso gut im Ostteil der Stadt hätten stehen können. Die Anwohner hatten den Abriss einiger Hinterhofbauten nicht verhindern können, doch sie hatten die Baustellen so lange besetzt, bis der Senat die Hochhauspläne aufgegeben und eine behutsame Sanierung des Viertels versprochen hatte. Lucas musste ein Streichholz anzünden, um den Namen der WG-Bewohner neben der Klingel zu entdecken.
Der Surrer ging. Lucas tastete sich in das düstere Treppenhaus. Im ersten Stock fehlte die Glühbirne der Flurleuchte. Er hielt sich am Geländer fest und erreichte die zweite Etage.
»Du bist also Lucas«, sagte ein dicklicher junger Mann im braunen Nicki mit filzigen hellen Rastalocken, der in der Tür stand. »Dann komm mal rein.«
Am Küchentisch saß ein dunkelhaariger, schlaksiger Student, der eine Selbstgedrehte rauchte und sich als Tommy vorstellte. Der Dicke nannte sich Nick. Beide hatten zauselige Jünglingsbärte; der Dünnere trug die Aufschrift Motörhead auf dem schwarzen T-Shirt. Sie hatten nebeneinander Platz genommen. Lucas saß ihnen wie ein Prüfling gegenüber.
»Lucas«, fing Nick an und steckte sich eine Zigarette in den Mund. »Warum sollen wir dich als Mitbewohner nehmen?«
»Ich verstehe die Frage nicht so richtig …«
»Was spricht für dich? Was ist dein Ding?«, setzte Tommy nach.
»Ich suche ein Zimmer in einer netten WG. Ich habe schon früher gern in Wohngemeinschaften gelebt«, sagte Lucas. Das war gelogen. Und er hasste zugequalmte Wohnungen.
»Und wie stellst du dir das Zusammenleben vor?«
»Respektvoll«, sagte Lucas hastig. »Man geht sich nicht auf den Nerv, putzt Bad und Küche, und ab und zu sitzt man nett zusammen und zieht einen durch.« Lucas hoffte, dass das den beiden gefallen würde. Er hatte fast ein Jahr in Speditionskellern und Lagerräumen gehaust, weil er seine Wohnung nicht mehr bezahlen konnte. Als es im Sender wieder besser für ihn lief, hatte er sich in einer billigen Vertreterpension an der Beusselbrücke einquartiert – auf Dauer war das zu teuer. Er war schließlich nur freier Mitarbeiter, der sich von Auftrag zu Auftrag hangelte.
»Was meinst du mit einen durchziehen?« Tommy sah ihn streng an. »Macht man das noch in deinem Alter?«
»Oder ein Bier zusammen trinken«, schob Lucas nach. Er erzählte von seiner Arbeit im Sender; das schien die Maschinenbauer zu beeindrucken.
»Wartest du bitte kurz im Flur?« Die Jury wollte sich offensichtlich zur Beratung zurückziehen. Nach fünf Minuten ging die Küchentür wieder auf.
»Alles klar, du bist dabei!« Nick führte Lucas zum Zimmer, das in der Zitty als »heller 20-Quadratmeter-Raum mit Dielenboden« angepriesen worden war. Ein bisschen Farbe müsste an die Wände, auf denen noch die Tesafilmspuren von Postern zu sehen waren, und der abgewetzte Holzboden müsste abgezogen werden, fand Lucas. Sie wurden sich handelseinig: 200 Mark plus Nebenkosten.
Mittwoch, 4. Oktober 1989
Mit zitternden Fingern hob er die mit einer Nadel zusammengehaltenen Papiere aus der Mappe. Fast hätte er die in steiler Sütterlinschrift beschriebenen Seiten übersehen: Das erste Blatt haftete an der Rückseite eines anderen Manuskriptes. Vorsichtig trennte er die vermutlich vor langer Zeit durch Feuchtigkeit verklebten Seiten voneinander. »Der Club Amanita« stand als Kopfzeile über dem Text. Er fuhr behutsam mit dem Finger über die handschriftlichen Zeilen, murmelte langsam die Worte, die er nur mit Mühe entziffern konnte.
Ich konnte keinen Blick von dem Alten wenden, der in sich zusammengesunken da vor mir saß …
Es ist kein Ton, keine Farbe, kein Ding in unserer Sinnenwelt, worin nicht die verräterischen Spuren ›ihres‹ spukhaften Daseins ein immerwährendes Leben führten … Der Sturm der letzten Nacht hat von der alten gelben Mauer drüben den verwitterten Bewurf gepeitscht und es haben sich die scharfen Umrisse eines schreitenden menschenähnlichen Wesens mit glotzendem, vertiertem Blick dadurch gebildet. Man wird die Wand neu tünchen, das Bild wird verschwinden, doch hundert neue spöttische Grimassen werden an seiner Stelle herüber grinsen.
Die unsichtbare Welt, die nur wenige Eingeweihte wahrnehmen oder gar betreten können. Die Welt des Übersinnlichen, von denen auch die Romane des Schriftstellers handelten.
Seit Monaten durchforschte er in der Handschriftenabteilung der Bibliothek die grauen Pappkartons voller Briefe, Manuskripte und Notizzettel. Er hob den Blick in den stillen Lesesaal. Drei Forscher verloren sich in dem Raum, beugten sich über seltene Handschriften und machten sich Notizen zu den Manuskripten. Einer trug sogar weiße Handschuhe. Der blasse Doktorand mit dem schütteren Haar wertete offenbar ein besonders wertvolles altes Originaldokument aus. Hinter ihm saß eine Frau im Gegenlicht, ebenfalls über alte Papiere gebeugt. Sie schien die Wissenschaftlerin zu sein, die ebenfalls den Nachlass des Schriftstellers Meyrink durcharbeitete. Sie hatte sich nach ihm in der Bibliothek angemeldet und konnte jeweils nur die Kartons bestellen, die er zuvor gesichtet hatte. Thomas Heising blätterte die Manuskriptseiten um und blieb beim fünften Blatt hängen. Erregt las er:
Betrachte die Linien deiner Haut, ist es nicht, als seiest du gefangen und eingewickelt, in ein feines Netz gewebt von den Spinnen des Schicksals? So wirft der Tod um uns alle sein Netz in der Stunde, da wir diese Erde betreten.
Über ein Jahr lang hatte er bereits Archive abgeklappert, um sich ein vollständiges Bild vom Werk des Schriftstellers Gustav Meyrink zu machen. Jetzt wollte er am liebsten losschreien. Er hatte ein fast neunzig Jahre altes Manuskript entdeckt, das nirgendwo in der Fachliteratur erwähnt war, das in keiner Bibliographie auftauchte, das vielleicht kein Wissenschaftler vor ihm gelesen hatte. Er griff zum Karton, in dem das Manuskript mit vielen anderen Texten gelegen hatte, und ging das Inhaltsverzeichnis wieder und wieder durch. Tatsächlich: Das Manuskript war nicht aufgelistet, war offenbar beim Anlegen des Kartons übersehen worden. Er sah sich um. Die Frau hinter ihm schien aufmerksam geworden zu sein. Er ließ das Manuskript sinken. Hatte sie seine Erregung bemerkt?
Thomas Heising ordnete die vor ihm liegenden Papiere und legte sie in den Karton zurück. Aber nicht alle.
Auf der Potsdamer Straße fasste er sich in die Jackettinnentasche: Das Papier ist noch da, beruhigte er sich. Ich bin der Einzige, der von diesem Manuskript weiß, und ich werde der Einzige bleiben, bis ich meine Doktorarbeit vorlege. Diese Entdeckung sollte seine Dissertation krönen. Gnostische, rosenkreuzerische und kabbalistische Motive im Werk Gustav Meyrinks. Ein Titel, der seinen Professor beeindrucken würde. Hastig lief er weiter und stieg an der Kurfürstenstraße die Treppe zur U-Bahn hinunter. Er war zu aufgewühlt, um die Gestalt zu bemerken, die ihm gefolgt war, seit er die Staatsbibliothek verlassen hatte.
Freitag, 6. Oktober 1989
»Du wohnst wie ein Student«, murmelte sie und schmiegte ihren bettwarmen, üppigen Leib enger an ihn.
»Ist doch nur vorübergehend«, brummte Lucas und strich Margarethe durch das halblange Haar. Seit mehreren Monaten waren sie wieder zusammen: Margarethe van Oyen, die selbstbewusste Redakteurin der Fernsehsendung »Im Visier«, und Lucas Hermes, der freie Journalist, der seit langer Zeit mühsam um Aufträge kämpfte. Die erste Zeit hatten sie stets bei ihr übernachtet, in Margarethes geschmackvoll eingerichteter Altbauwohnung, in der das leicht abgenutzte Parkett unter jedem Schritt vornehm knarrte. Der zierliche Nussbaum-Sekretär in ihrem Schlafzimmer gab der Wohnung eine elegante Note, ebenso die Empire-Ottomane, auf der sie sich nach einem weinseligen Abend nähergekommen waren und sich zum ersten Mal nach Jahren wieder geliebt hatten. Margarethe hatte ihn immer wieder geneckt, weil er ihr partout seine Behausung nicht zeigen wollte, das schäbige Pensionszimmer. Er hatte die vergangenen Tage wie ein Wahnsinniger die Wände des neuen WG-Zimmers gestrichen und seine Möbel aus dem Lagerraum geholt. Jetzt, mit dem neuen Anstrich und den Gardinen, sah das Zimmer fast bürgerlich elegant aus. Ein Jahr lang hatte er seine Armut vor den Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion verbergen müssen. Vor allem Margarethe sollte nie erfahren, wie tief er gesunken war. Er hatte sich über Monate am Bahnhof Zoo in der Dusche gewaschen, die Penner und Junkies nutzten. Mühsam hatte er versucht, sich und seine Kleidung rein zu halten. Der Winter hatte ihn gezwungen, seine Schlafunterkunft, den kalten Lagerraum in der Sickingenstraße, aufzugeben. Er hatte seine Möbel im Lager gelassen und war in eine Pension in Moabit gezogen. Sein Scoop im vergangenen Jahr, die Enthüllung einer Bombenserie, in die der Staatssekretär Eckart Mölders verwickelt war, hatte ihm Folgeaufträge und ein bisschen Geld beschert. Zu wenig, um auf Dauer Hotelgast zu sein oder eine eigene Wohnung zu mieten, aber genug für ein WG-Zimmer im Charlottenburger Hausbesetzer-Kiez, in dem viele Arbeitslose und Studenten lebten. Lucas’ Mitbewohner Tommy und Nick hatten sich in der Mieterbewegung engagiert und waren so an die Altbauwohnung gekommen. Seit er die erste Miete im Voraus bezahlt hatte, ließen sie ihn in Ruhe, suchten keinen Kontakt zu dem über zwanzig Jahre älteren Reporter. Lucas war das recht. Er betrat die Wohnung nur zum Schlafen und Duschen und hatte sich eine zweiflammige Kochplatte und einen Kühlschrank angeschafft, um die Gemeinschaftsküche nicht nutzen zu müssen. Da sein Zimmer ein kleines Waschbecken hatte, konnte er sich dort auch säubern und Kaffee kochen. Margarethe schien die Aussicht auf eine Katzenwäsche nicht sonderlich zu gefallen.
»Ich gehe zu mir«, sagte sie und drückte ihm einen Kuss auf die Schulter. »Wir sehen uns dann in der Redaktion.« Sie stand auf, sammelte die auf dem Boden verteilten Kleidungsstücke ein, zog sich an und öffnete die Tür. Es war kurz nach acht; Lucas’ Mitbewohner schienen noch zu schlafen. »Bis dann!« Sie warf ihm eine Kusshand zu. Lucas sank stöhnend in das warme Bettzeug zurück.
»Um zehn ist Konferenz«, rief sie im Gehen.
Als er die Eingangsglastür zum Rundfunk im Britischen Sektor öffnen wollte, wurde sie schwungvoll von innen aufgestoßen. Sven-Jörgen Stövenhagen, sein Redaktionsleiter, den alle nur Ess-Jott nannten, stürmte mit rotem Blutdruckschädel und finsterer Miene hinaus und streifte Lucas an der Schulter.
»Guten Morgen!«
Sein Gruß blieb unbeantwortet. Stövenhagen stapfte mit wehendem Mantel davon, die braune Aktentasche unter den Arm geklemmt.
Im Konferenzraum waren die Redakteure und freien Mitarbeiter bereits versammelt, nur wenige Stühle waren noch frei. Die Stuhlreihe an der kurzen Seite der U-förmigen Tischanordnung waren dem Redaktionsleiter und der Chefin vom Dienst vorbehalten. Statt des üblichen Lärmpegels herrschte eine angespannte Ruhe. Lucas setzte sich auf einen freien Platz neben seinen Kollegen Heiner C. Schmitt.
»Ist irgendwas los?«
»Wirst du schon sehen«, murmelte der Dicke und fixierte angestrengt seine Unterlagen.
»Stövenhagen ist gerade rausgelaufen«, sagte Lucas.
»Sauerei«, knurrte Schmitt.
Britta Hensel, Chefin vom Dienst der Magazinsendung »Im Visier«, zog alle Blicke auf sich, als sie den Konferenzraum betrat. Hinter ihr huschte Margarethe in den Raum, perfekt geschminkt und in einem eleganten beigefarbenen Jackett. Hensel räusperte sich und versuchte, einen möglichst neutralen Gesichtsausdruck hinzubekommen.
»Ihr habt sicher schon gehört, dass Ess-Jott Stövenhagen nicht mehr Leiter der Redaktion ist. Ich habe die Entscheidung der Chefredaktion nicht zu kommentieren. Gibt es Fragen?«
Die Mitarbeiter hielten die Köpfe gesenkt.
»Vielleicht kannst du etwas zu den Gründen seiner Abberufung sagen«, brummte Heiner Schmitt in die unbehagliche Stille hinein. In der Redaktion duzten sich alle außer dem bisherigen Chef.
»Unser Chef wird auf eigenen Wunsch Korrespondent in Rio. Und darum« – sie atmete tief durch – »musste eine neue Leitung für das Magazin berufen werden. Es ist Gottlob Freese.«
Alle Blicke richteten sich auf den jungen Ehrgeizling, der auf seinem alten Stammplatz saß. Er hatte Lucas bei seinen Recherchen über die Bombenserie im vergangenen Jahr übel mitgespielt, hatte dessen Enthüllungen mit Gegenrecherchen zu stoppen versucht. Freese trug Anzug und Krawatte. Er sah aus, als wäre er frisch vom Friseur in die Redaktionssitzung gekommen, die Wangen rosig. Er lächelte leicht und neigte den dünn behaarten Kopf, als würde die Runde ihm applaudieren. Doch keine Hand rührte sich.
»Gottlob, dann darf ich dich bitten, neben mir Platz zu nehmen. Herzlichen Glückwunsch.« Jetzt folgten alle Britta Hensels Beispiel und klopften wie sie mit den Fingerknöcheln kurz auf die Tischplatte.
»Vielen Dank!« Freese strich das Jackett glatt und setzte sich an die Kopfseite des Konferenzraums.
»Für mich kam diese Berufung völlig überraschend«, begann er. »Ich wusste es schon seit gestern, war vom Fernsehrat aber gebeten worden, bis heute nichts zu sagen. Ich freue mich« – dabei nickte er Britta Hensel und Margarethe zu – »dass wir in der Redaktionsleitung Kontinuität wahren können. Britta Hensel wird meine Stellvertreterin, Margarethe van Oyen neue Chefin vom Dienst.«
Wieder schlugen die Knöchel der Mitarbeiter auf den Tisch.
»Kommen wir zur nächsten Sendung.« Er blätterte routiniert in den Themenplänen, als hätte er den Redaktionsleiterposten seit ewigen Zeiten inne.
»Wusstest du davon?« Lucas zog Margarethes Bürotür geräuschvoll hinter sich zu. Die neue Chefin vom Dienst drehte sich in ihrem Bürostuhl in seine Richtung.
»Nein, ich habe das bis eben nicht gewusst. Ich wusste nur, dass Stövenhagen abgesetzt werden sollte und dass sie mir den CvD-Posten anbieten würden.«
»Abgesetzt? Ich denke, er ist freiwillig gegangen?«
»Tu nicht so unschuldig. Er hat dir damals den Rücken freigehalten.« Ihre Stimme klang jetzt streng, nicht wie die der Frau, die er noch vor wenigen Stunden im Arm gehalten hatte. »Das hat nicht allen Parteifreunden von Mölders gefallen. Und sein letzter Kommentar hat das Fass wohl zum Überlaufen gebracht.«
Im Herbst 1988 hatten Lucas’ Enthüllungen zum Rücktritt des Innenstaatssekretärs Eckart Mölders geführt. Die Konservativen spielten in den Aufsichtsgremien des Senders RBS eine erhebliche Rolle bei der Berufung und Absetzung von Redaktionsleitern.
»Und jetzt« – Lucas’ Stimme wurde schrill – »übernehmen die die Redaktion?«
»Jetzt halt mal die Luft an! Gottlob Freese ist nicht mal Parteimitglied!«
Lucas biss sich auf die Lippen. Er war nicht in der Position, seinen künftigen Auftraggeber Freese und dessen rechte Hand Margarethe zu kritisieren. Er wollte nie wieder zurück in die Obdachlosigkeit, in den muffigen Speditionskeller. Folglich musste er akzeptieren, dass jetzt ein anderer Wind wehte. Auch Stövenhagen, beruhigte er sich, hatte es ihm nicht leicht gemacht. Und jetzt hatte er sogar eine Geliebte, die zur Redaktionsspitze gehörte. Margarethe hatte ihn über seinen größten Verlust hinweggetröstet. Monatelang hatte er versucht, die Beziehung zu Anna Rademacher wiederherzustellen. Doch Anna hatte ihn erst zappeln und dann abblitzen lassen. Dabei hatten sie im vergangenen Jahr zusammen ein paar aufregende Wochen erlebt, er hatte die fünfzehn Jahre jüngere Abendkurier-Reporterin sogar ins Bett bekommen, allerdings nur ein einziges Mal. Anna hatte Lucas bei seiner verdeckten Recherche über Mölders geholfen und war bei einer konspirativen Aktion von Unbekannten entführt worden. Erst nach über einer Woche hatte man sie freigelassen. Lucas war monatelang nicht an sie herangekommen. Anna hatte eine Weile in psychologischer Betreuung in einem Frauenhaus gelebt und war danach abgetaucht. Nach seinen erfolglosen Versuchen, sie wiederzutreffen, hatte er sich seinem früheren Flirt Margarethe zugewandt. Und die hatte nach hartnäckigem Werben angebissen. Sie fanden Gefallen aneinander, der 46-jährige Reporter und die 50-jährige Redakteurin, doch sie wussten beide, dass nicht die ganz große Liebe sie verband.
»Sehen wir uns heute Abend?«, fragte Lucas und öffnete die Bürotür.
»Eher nicht, zu viel zu tun.« Margarethe zeigte auf ihren übervollen Schreibtisch. »Bis bald, Lucas.« Sie warf ihm eine Kusshand zu.
* * *
»Hör ich die Soldaten singen, lass ich all mein Spielzeug stehn,
und ich renne auf die Straße, die Soldaten muss ich sehn.
Unsere Soldaten schützen alle Kinder vor dem Krieg,
meinen Vati, meine Mutti, jedes Haus und die Fabrik.«
Das alte Kinderlied, das sie so oft in der Schule und im Pionierlager gesungen hatte, ging ihr nicht aus dem Kopf. Sie saß an dem grauen Sprelacart-Tisch und blickte das vergilbte handschriftliche Papier an, ihre Verpflichtung zur konspirativen Zusammenarbeit mit dem Ministerium, die sie noch als Schülerin verfasst hatte. Auf dem Internat hatte sie sich immer wieder in dem kleinen Zimmer neben dem Direktorat mit ihrem Führungsoffizier getroffen und berichtet. Meist Belangloses, wie sie meinte. Liebesgeschichten und Intrigen ihrer Mitschülerinnen, aber auch das defätistische Gequatsche der renitenten Ärztesöhne. Die musste man im Auge behalten. Deren Helden waren Menschen wie Biermann, Fuchs und Bahro, die ihren Staat in den Dreck zogen und die Quittung dafür bekommen hatten. Die Feinde der Republik hatten alberne weiße Bändchen an ihre Autoantennen geknüpft, um allen zu zeigen, dass sie das Land schon bald verlassen würden in Richtung Kapitalismus, in Richtung Arbeitslosigkeit und Elend.
Sie wollte für die DDR kämpfen, aber anders als ihr Vater, der für das Ministerium dubiose Devisenbeschaffungsaktionen organisierte. Sie hatte sich immer als Außenseiterin unter Gleichaltrigen empfunden, aber dennoch hatten die anderen Mädchen im Internat um ihre Freundschaft gebuhlt. Die Jungs wickelte sie sowieso um den Finger, sie waren wie lästige Fliegenschwärme. Kaum hatte sie einen verscheucht, hing ihr schon der nächste an den Fersen. Und alle redeten, offenbarten Nina ihre kleinen Geheimnisse: ein illegales Westgeld-Depot im Spind, verbotene Bücher unter der Wohnheimmatratze.
Sie spielte ihr Spiel mit den Jungen. Sie genoss die verzweifelte Geilheit ihrer Mitschüler, die sie manchmal sogar handgreiflich abwehren musste, wenn die meinten, dass eine Knutscherei zu wildem Sex führen musste. Die gesamte Schulzeit über hinderte sie ein unbehagliches Gefühl daran, sich auf den einen oder anderen Fick einzulassen. Sie war nicht verklemmt, doch irgendwo in ihr steckte ein tiefer Widerwille gegen das andere Geschlecht.
Sie notierte alles, was ihre Verehrer und Freundinnen quatschten. Wenn einer vom Internat relegiert wurde, kam niemand auf die Idee, dass sie es gewesen war, die den entscheidenden Hinweis gegeben hatte.
Mit dem Ende der Schulzeit hatte sich der Griff des Vaters gelockert. Neben der Verpflichtungserklärung lag ein Arbeitsvertrag als Hauptamtliche in Eisenhüttenstadt, den sie als Zwanzigjährige unterschrieben hatte. Ihr Name war mit Schreibmaschinenschrift eingesetzt, darunter Rang und Gehalt.
»Stabsgefreiter«, murmelte sie lächelnd und strich das Blatt glatt. 522 Mark fünfzig, viel Geld damals. Das dritte Blatt war der neue Vertrag. Sie war jetzt Hauptmann, mit gerade einmal 32 Jahren. Sie griff zum Kugelschreiber und unterschrieb. Einsatzbereich: Hauptabteilung XX stand unter Dienstrang und Gehalt. Bekämpfung der politischen Untergrundarbeit (PUT). Ihr Dienstort war die Magdalenenstraße, die Zentrale. Hoffentlich würde sie dem Alten nicht über den Weg laufen. Sie hasste den Mann, unter dem sie als Kind gelitten hatte und der schuld daran war, dass sie erst mit zwanzig zum ersten Mal mit einem Mann hatte schlafen können.
Samstag, 7. Oktober 1989
Aus der Schwärze des Zimmers tauchte ein Kopf auf. Anna blickte in zwei weit aufgerissene blaue Augen. Obwohl sie auf dem Rücken lag, waren die Augen genau vor ihrem Kopf, als schwebte der fremde Körper über ihr. So sehr sie sich anstrengte, sie konnte das Gesicht des Mannes nicht erkennen. Trug er eine Maske? Sie wusste es nicht. Da waren zwei Augen und sonst nichts. Zwei Augen, die keine Regung zeigten, die sie ohne einen einzigen Wimpernschlag minutenlang anstarrten. Sie sah keine Augenbrauen, keine Nase, keinen Mund. Es gab nur diesen entsetzlichen durchdringenden Blick. Was wollte der Mann ohne Gesicht von ihr? Sie bewegte die Lippen, versuchte, eine Frage zu stellen, doch sie brachte keinen Ton heraus. Sie versuchte, seinem Blick standzuhalten, musste aber blinzeln. Er nicht. Er starrte ausdruckslos zurück.
Plötzlich hob er den Arm und hielt das silbern glänzende Messer vor ihr Gesicht, ohne dass sein kalter Blick von ihr abließ. Dann drehte er die Klinge leicht, senkte sie und zog das Metall mit einem scharfen, schneidenden Geräusch durch das Fleisch an ihrem Hals.
Anna wachte von ihrem eigenen Schrei auf. Ihr Körper war schweißnass. Sie setzte sich im Bett auf, suchte mit der Hand nach der Nachttischlampe und schaltete sie an. Anna Rademacher, sagte sie zu sich selbst, du bist in deinem Bett in Schöneberg und niemand sonst ist hier. Zum ersten Mal seit Monaten war er wieder da, der Traum mit den immer gleichen Bildern. Der Kopf ohne Gesicht mit dem stechenden Blick. Warum kamen die Bilder ausgerechnet jetzt zurück? Ihre Entführung war über ein Jahr her.
Alles hatte im letzten Sommer begonnen. Sie hatte ihrem Kollegen Lucas Hermes einen Gefallen tun wollen. Hermes wollte verdeckt im Haus der Burschenschaft Teutonia recherchieren und sie hatte mit versteckter Kamera bei einem Kameradschaftsabend im Haus gefilmt. Das war der Anfang ihrer tagelangen Tortur. Sie war bewusstlos geschlagen und von einem Unbekannten verschleppt worden.
In einem dunklen Raum war sie Stunden später erwacht, gefesselt an ein Gitterbett. Ihr Entführer hatte immer eine Sturmhaube getragen, sodass sie nur die Augen, blaue Augen, sehen konnte. Elf Tage lang hatte er sie festgehalten, ohne ein einziges Wort an sie zu richten. Und er hatte sie betäubt und ihr ein Zeichen in den Hals geritzt. Sie fuhr mit dem Zeigefinger über die Haut nahe der Halsschlagader. Die Narbe war noch immer spürbar. Nach langen Tagen der Gefangenschaft hatten er und ein zweiter Mann sie mit Chloroform betäubt und im Grunewald freigelassen. Seit damals gab es keine Spur von den Tätern. Die Polizei rätselte über ihre Motive. War sie von Agenten der DDR-Staatssicherheit verschleppt worden, weil sie in Ostdeutschland unerwünschte Recherchen über illegale Kunstgeschäfte unternommen hatte?
Anna hatte die ersten Tage nach ihrer Freilassung im Krankenhaus verbracht. Es war merkwürdig gewesen, den Tag angezogen auf einem Bett sitzend zu verbringen und wie eine Kranke behandelt zu werden. Dann hatte die Polizei sie in eine Art Frauenwohnheim verlegt, wo regelmäßige Therapiesitzungen mit der Polizeipsychologin Simone Kaschkat stattfanden.
Sie hatte geglaubt, dass sie ihre Angst mit der Zeit in den Griff bekommen würde. Die Panikattacken am Tag, wenn sie im Park vor dem Wohnheim spazieren ging, und die Albträume in der Nacht waren nach vier Wochen seltener geworden. Seit Januar wohnte sie in einem anonymen Mietshaus in der Motzstraße. Am Klingelschild stand ein falscher Name, und im Melderegister konnte man sie nicht ausfindig machen.
Sie sah sich im Zimmer um. Ein großzügiges Sechziger-Jahre-Appartement mit kleiner Kochnische und einer Schiebetür zum Balkon, auf dem sie im Sommer öfter gesessen hatte, wenn sie sich nicht vor die Tür traute. In die Redaktion musste sie nicht. Die Psychotherapeutin, die ihr die Polizeipsychologin empfohlen hatte und zu der sie zweimal in der Woche ging, hatte ihr ein Attest ausgestellt, das ihr die Arbeit von zu Hause aus ermöglichte. Sie schrieb Buchrezensionen und Artikel, für deren Recherche sie nicht herumreisen musste und die sie nach Fertigstellung zum Abendkurier faxte. Ihr Kontakt zur Außenwelt waren vor allem Telefon und Fax. Kaum jemand hatte ihre Nummer, nur die Polizei und der Ressortchef der Zeitung.
Wenn sie vor die Tür ging, setzte sie die Sonnenbrille auf und zog die Mütze tief ins Gesicht. Sie vermied Spaziergänge, wenn die Straßen zu leer oder zu voll waren. Ein paar Passanten konnte sie gut ertragen, Menschenmassen wie auf dem Ku’damm überhaupt nicht. Nach Einbruch der Dunkelheit wagte sie sich nicht nach draußen. Sie hatte sich vorgenommen, die wichtigsten Filmklassiker seit der Stummfilmzeit zu sehen und lieh sich regelmäßig Kassetten in einer nahe gelegenen Videothek aus.
Ab und zu telefonierte sie mit ihrer Mutter und ihrem Ex-Freund Achim. Auch Lucas Hermes hatte sie zwei, drei Mal angerufen. Keinem der drei hatte sie ihre neue Telefonnummer gegeben. Sie war es, die bestimmte, wann es Kontakt gab und wann nicht.
* * *
Er rollte auf das offene Tor zu und ließ mit einem Knopfdruck die Seitenscheibe herunter. Der junge Soldat vom Wachregiment legte die Hand an die Fellmütze. Lässig öffnete Hans-Peter Jurczik den kunstledernen Klappausweis und hielt ihn aus dem Fenster. Der Wachsoldat winkte ihn durch und blickte dem hellgrünen Citroën GS neidisch hinterher.
Der Parkplatz vor Haus 7 war um diese Zeit bereits gut gefüllt. Die Kollegen der AG BKK liebten es, bereits um halb acht am Schreibtisch zu sitzen und spätestens um vier in ihren Trabants wieder nach Hause zu fahren. Doch in diesen Zeiten war daran nicht zu denken. Auch am Wochenende taten viele Offiziere Dienst. Statt die Volkswirtschaft abzusichern, was eigentlich Jurcziks Aufgabe war, war jetzt jeder Mann zur Rettung der Republik gefordert.
Hans-Peter Jurczik grüßte den Wachhabenden und ging durch die Halle auf den Paternoster zu, der träge knarzend seine Runden drehte.
»Schwert und Schild der Partei« stand in großen gelben Buchstaben an der Wand. Darunter umklammerte eine Faust eine Stange, an der eine rote Fahne flatterte. Das Pathos, mit der der Geist Feliks Dzerdjinskis in den Treppenhäusern des Ministeriums beschworen wurde, passte nicht zur muffigen Behördenatmosphäre, die drückend über den langen Fluren lag.
Im dritten Stock sprang er aus dem Paternoster. Es war still, fast wie nach Feierabend. Sämtliche Türen zum Gang waren geschlossen, doch er wusste, dass an diesem Wochenende in allen Zimmern Menschen hockten, die eifrig Aktenvermerke schrieben, Papiere abhefteten oder neue operative Vorgänge anlegten, indem sie in ordentlicher Druckschrift Zahlen auf Aktendeckel malten.
Als er sich vor fast vierzig Jahren als junger Grenzsoldat vom MfS als Geheimer Informator anwerben ließ, geschah das aus einer Mischung von Abenteuerlust und politischer Überzeugung. Als Decknamen wähle ich den Namen Peter Haas, schrieb er in seiner Verpflichtungserklärung. Er wusste, dass der Feind tief in die bewaffneten Organe eingedrungen und es nötig war, Spione in den eigenen Reihen »hellzumachen« und den Genossen zu melden. Bei den Treffen in konspirativen Wohnungen genoss er es, als junger Soldat auf Augenhöhe mit einem Offizier der Staatssicherheit zu sprechen. Er machte seine Arbeit gut, zwei Jahre lang, schrieb Berichte über seine Stubenkameraden, wenn die heimlich RIAS hörten, und über die sexuellen Neigungen seiner Vorgesetzten. Das Angebot, als Hauptamtlicher mit festem Monatsgehalt angestellt zu werden, nahm er ohne Zögern an. Sie ließen ihn in Potsdam Jura an der Hochschule des Ministeriums studieren. Diesmal bespitzelte er seine Kommilitonen im Wohnheim. Das MfS konnte dank seiner Berichte so manchen faulen Apfel aussortieren. Seine Diplomarbeit zum Thema Einbringung operativer Erkenntnisse in das Strafverfahren brachte ihm die Note »Gut« ein. Mit Mitte zwanzig bewohnte er eine moderne Einraumwohnung und hatte gute Aussichten, in drei bis vier Jahren einen Trabant zugeteilt zu bekommen. Sein einziges Problem war die junge Frau, der er ein Kind verpasst hatte und die nach Ansicht leitender Genossen nicht geeignet war, Ehefrau eines MfS-Offiziers zu werden. Die Entscheidung fiel ihm schwer, war aber unausweichlich. Dabei liebte er es, am Wochenende mit ihr und dem Baby Familie zu spielen und am Montag dann in die Arbeit einzutauchen und wie ein Junggeselle zu leben. Als sie wieder schwanger war und einen Mann aus dem Westen kennengelernt hatte, war die Entscheidung nicht länger hinauszuschieben. Christel entschied sich für den Kölner Ingenieur und verließ die DDR, bevor ihr Bauch zu dick wurde. Und er hatte jetzt keine Frau, aber ein Kind. Nina.
»Guten Morgen, Genosse Oberst«, grüßte ihn Gisela Müller, bevor er ein freundliches Wort an seine Sekretärin richten konnte. Er lächelte zurück, griff ins Eingangskörbchen und nahm die Blätter mit in sein Büro. Die Tagesmeldungen waren ernüchternd. Die Inoffiziellen Mitarbeiter mehrerer Diensteinheiten berichteten, dass sich überall in den Bezirken konterrevolutionäre Elemente zusammengerottet hatten, um den vierzigsten Geburtstag der DDR zu sabotieren. Mit einem Maximalaufgebot an uniformierten und zivilen Kräften sowie mit IMs, die sich unter die Protestierenden mischen sollten, wollte das Ministerium für Staatssicherheit mit aller Macht verhindern, dass an diesem Ehrentag staatsfeindliche Parolen in die westlichen Kameras gebrüllt werden konnten. Mit aller verbliebenen Macht, dachte Jurczik finster. Zwar hatte die Polizei die üblichen Verdächtigen – Asoziale, Punker und so genannte Umweltaktivisten – vorsorglich schon am Vortag eingesammelt, doch Jurczik spürte, dass an diesem Abend eine entscheidende Kraftprobe zwischen Staatsmacht und den Feinden der Republik anstand.
Trotz einer immer aufwändigeren Sozialpolitik mit Neubauwohnungen und Familiendarlehen war die Zurückdrängung von Ausreisebegehren seit ein paar Jahren zur Hauptaufgabe des Ministeriums geworden, neben der Devisenerwirtschaftung. Anscheinend wollten Millionen DDR-Bürger nur noch raus. Was wollten die denn im Kapitalismus? Stempeln gehen?
Kampf gegen Ausreisewillige – so hatte er sich die Arbeit eines Geheimdienstes nicht vorgestellt. Spione jagen und vernichten, das sah er als seine Aufgabe an. Die Abteilung, die die Devisenbeschaffung der DDR-Wirtschaft absicherte, die »Kommerzielle Koordinierung« unter Leitung des Genossen Schalck-Golodkowski, hatte noch am ehesten mit dieser Geheimdienstarbeit zu tun. Seit Anfang der achtziger Jahre war das sein Job. Und er erfüllte ihn gut, wie er fand.
Nach dem Sommer waren viele Schulstühle und Werkbänke leer geblieben. Die Dagebliebenen rieben sich die Augen und schienen sich zu fragen, warum sie im Sommer nicht auch in Ungarn oder der CSSR über Botschaftszäune geklettert waren. Vor drei Tagen hatten in Dresden bürgerkriegsähnliche Zustände geherrscht, als Tausende versuchten, die nach Westen fahrenden Züge mit den Botschaftsflüchtlingen zu entern. Jurczik ahnte, dass es vielleicht schon an diesem Abend auf eine Entscheidung zulief, wie sie bereits zweimal nötig gewesen war: am 17. Juni 1953 und am 13. August 1961. Wenn die Staatsführung um ihre Herrschaft zu kämpfen bereit war, würde es nicht ohne Tote und Verletzte abgehen. Diesmal gab es keine russischen Freunde, die man zu Hilfe rufen konnte, die Russen hatten mit ihrer Perestroika die Autorität des Staates gründlich untergraben. Diesmal musste die SED allein die Herrschaft der Arbeiterklasse sichern. Jurczik war bereit, für seinen Staat zu kämpfen.
* * *
Das Klingeln riss Thomas Heising aus seiner Lektüre. Wer konnte das sein? Seit er an seiner Doktorarbeit saß, lebte der Literaturwissenschaftler völlig zurückgezogen. Je tiefer er in die Materie einstieg, umso fader erschienen ihm die Gespräche mit den wenigen Freunden oder Kommilitonen, mit denen er Umgang hatte. Er war so weit in der Erforschung des literarischen Werkes von Gustav Meyrink vorgedrungen, dass es eines ungeheuren Aufwandes bedurft hätte, anderen überhaupt noch Verständliches über seine Arbeit mitzuteilen. Er hatte aus hunderten von Briefen des Schriftstellers dessen Entwicklung zum Mystiker herausgearbeitet, die Bereiche wie die Gnosis, Theosophie, Hellseherei, Kabbala und Rosenkreuzerlehren berührte. Themen, über die er mit kaum einem normalen Menschen sprechen konnte.
Er blickte durch den Türspion seiner Zweizimmerwohnung. Draußen stand eine Frau in einem grünen Anorak mit streng zu einem Knoten hochgestecktem, von grauen Strähnen durchzogenem Haar.
»Ja bitte?«, rief Heising durch die Tür.
»Entschuldigen Sie die Störung, Herr Dr. Heising«, kam es in weichem Singsang zurück. »Ich muss Sie unbedingt wegen des Schriftstellers Gustav Meyrink sprechen!« Heising betrachtete die Besucherin und erkannte sie wieder: Es war die Frau, die in der Bibliothek oft hinter ihm saß und offenbar auch zu Meyrink forschte. Ein fast euphorisches Lächeln umspielte ihren Mund. Heising öffnete die Tür einen Spalt. Die Frau trat verlegen von einem Fuß auf den anderen.
»Ich überfalle Sie hier so einfach, aber es ist ungeheuer wichtig!« Sie sprach mit Akzent. Vermutlich eine Schweizerin.
»Wir kennen uns doch aus dem Lesesaal«, sagte Heising.
Sie nickte eifrig. »Ich gehöre einer Gruppe an, die vom Werk des Schriftstellers fasziniert ist. Wir planen ein Symposium an seiner ehemaligen Wirkungsstätte in Prag über die philosophisch-magische Gedankenwelt des Künstlers.«
»Was meinen Sie genau damit?«, fragte Heising misstrauisch.
»Wir wollen untersuchen, ob die jenseitige Welt, die Meyrink beschreibt, eher der kabbalistischen Gedankenwelt oder der Philosophie der Fraternitas rosae crucis entstammt.«
»Die Rosenkreuzer? Und wie sind Sie da auf mich gekommen?«
»Ihr Aufsatz in ›Wirkendes Wort‹ über Gustav Meyrinks Transzendenzbegriff – wirklich ausgezeichnet.« Sie lächelte selig.
»Donnerwetter, Sie sind ja eine echte Expertin! Kommen Sie doch herein.«
»Expertin – nein. Vielleicht eine Suchende.« Sie trat in den Flur. »Eine, die bemüht ist, die Pfade zu ergründen, die der Schriftsteller uns weist.«
»Sie meinen also, die Romane sind regelrechte Handlungsanleitungen?« Heising lehnte sich entspannt an die Wand.
»Nicht Anleitungen, sondern Hinweise. Wie laut muss der Vermummte Sie denn anschreien, damit Ihr Schicksal zu galoppieren beginnt?« Die Frau im Flur wurde immer lebendiger. Ihre Wangen glühten vor Eifer.
»Sie haben Ihren Meyrink ja gut gelesen.«
»Jede veröffentlichte Zeile«, hauchte die Fremde.
»Möchten Sie sich nicht setzen? Ich koche uns einen Tee.« Heising machte eine einladende Geste. Eine Kennerin! Ein Mensch, der, anders als sein Doktorvater, genau verstand, mit welchen esoterischen Lehren er sich beschäftigte. Die Schweizerin huschte an Heising vorbei und betrat sein Arbeitszimmer. Während sie ihren Anorak vorsichtig auszog, als wäre er zerbrechlich, blickte sie neugierig auf das große Bücherregal, das den Raum beherrschte.
»Erzählen Sie von Ihrem Symposium!« Nach wenigen Minuten balancierte Heising ein Tablett mit einer gläsernen Teekanne und zwei Tassen zum Esstisch, auf dem sich Bücher und getippte Manuskripte türmten.
»Du liebe Güte!« Die Schweizerin schlug sich in einer dramatischen Geste an die Stirn. »Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt: Emmanuela Sigele, Sekretärin der Loge zur Goldenen Dämmerung!«
Thomas Heising lächelte amüsiert. So musste sich der Schriftsteller Gustav Meyrink gefühlt haben, der ständig von Erleuchteten heimgesucht wurde, die ihm ihre Heilslehren verkünden wollten, die darauf hofften, in dem Schriftsteller einen Gleichgesinnten zu finden. Meyrinks geheimnisvolle Romane, die meist in Prag spielten, galten unter Esoterikern als verschlüsselte Anleitungen zum Erreichen eines höheren Bewusstseins. Heising sah die Werke als Literatur, die die verschiedensten Heilslehren erwähnte, um Spannung zu erzeugen – mehr nicht. Er wusste, dass viele Anhänger den Schriftsteller als Eingeweihten ansahen und versuchten, in den Erzählungen und Romanen den Schlüssel zum Übertritt in eine verborgene Welt, die »Andere Seite«, zu erkennen. Er nahm einen Schluck Tee und musterte den Gast aus der Schweiz. Frau Sigele schien eine dieser Theosophinnen zu sein, die Meyrink zu ihrem Guru auserkoren hatten.
»Das Symposium, das wir planen, ist streng wissenschaftlich«, begann sie. »Historiker, Germanisten und Philosophen werden in Prag sprechen. Und …« – sie blickte Heising vertrauensvoll in die Augen – »… hoffentlich auch Sie.«
Vielleicht würde diese Tagung ja doch ganz seriös sein, dachte Heising. Und er könnte dort vor einem größeren Fachpublikum seine Entdeckungen ausbreiten, für die sich in seiner Fakultät kaum jemand interessierte.
»Mir hat vor allem gefallen, wie Sie zwischen Scharlatanen und wirklich Wissenden unterscheiden«, fuhr die Schweizerin fort und nippte zur Bekräftigung am Tee.
»Ich verstehe nicht ganz …«
»Sie haben doch deutlich herausgearbeitet, dass der Meister – so darf ich ihn doch nennen – den wahren Weg weist und Betrüger wie die Anthroposophen scharf verurteilt.« Sigele schloss die Augen, hob den Kopf und spitzte die Lippen: »Den alten Mann, den ich immer in der Ferne sehe, soll ich krönen und ihn mit Purpur bekleiden. ER ist der Adept, er wird wachsen, ich aber werde schwinden.«
»Ein später Tagebucheintrag Meyrinks, in der Tat.« Heising wurde unruhig.
»August 1930«, erwiderte sie und sah Heising jetzt fest in die Augen. »Das ist es doch, was er meint!«
Der Blick der Besucherin wurde bohrender. Heising war unbehaglich zumute, aber zugleich durchströmte ein Gefühl von Wärme seinen Körper.
»Darf ich?« Sie deutete auf das auf dem Tisch liegende Manuskript, das er in eine Kunststoffhülle gesteckt hatte. Er legte die Hand wie zur Abwehr auf das Papier, um seinen Fund zu schützen.
»Ein unveröffentlichter Text Meyrinks«, stammelte er. »Der Club Amanita. Den dürfen Sie leider nicht …« Die Frau zog das Manuskript unter seiner kraftlosen Hand weg und nahm es an sich. Heising wollte protestieren, doch seine Zunge fühlte sich wie ein nasses Wollknäuel an, das er im Mund kaum bewegen konnte. Er lallte, dann gab er auf und sank in sich zusammen.
»Er wird wachsen, ich aber werde schwinden«, sagte die weiche Frauenstimme in weiter Ferne.
* * *
Hans-Peter Jurczik blickte missmutig aus dem Fenster und starrte auf den Alexanderplatz, der nur zur Hälfte mit Menschen gefüllt war. Die Dienststelle lag im Haus des Reisens im obersten Stock, direkt unter dem roten Interflug-Logo, das nachts von der Fassade leuchtete. Er drehte sich um und wandte sich der Monitorwand zu, die das Geschehen deutlich vergrößert zeigte. Der Diskjockey da unten mühte sich redlich, doch die von Wurst- und Bierbuden umstellte Tanzfläche auf dem Alexanderplatz blieb leer. Tausende Berliner kauten missmutig an ihren Würsten und waren nicht in Feierlaune. Zwischen den Buden drückten sich größere Gruppen Jugendlicher herum, die irgendetwas vorhatten. Jurczik ließ die Überwachungskameras langsam über den Platz schwenken. Es mussten mehrere hundert Rowdies sein, die sich zu irgendeiner Aktion verabredet hatten, um die Feiern zum Geburtstag der Republik zu stören. Die Männer des MfS standen in ihren Jeans- oder Lederjacken paarweise zwischen den Ständen und warteten auf Anweisungen. Selbst als die Jugendlichen ein Trillerpfeifenkonzert begannen und Hunderte sich in Richtung Palast der Republik in Bewegung setzten, griffen die Polizeieinheiten nicht ein. Die Stasi-Männer folgten dem Demonstrationszug unauffällig, bereit, jederzeit zuzuschlagen.
»Kein Zugriff«, sprach der neben Jurczik sitzende Offizier in sein Mikrofon.
»Schon über tausend Demonstranten«, krächzte es aufgeregt aus dem Lautsprecher. Nachdem die Volkspolizei die Jugendlichen vom Palast der Republik abgedrängt hatte, schleppte sich der Protestzug Richtung Prenzlauer Berg und wuchs immer mehr an.
»Wir bleiben hier«, brüllten vereinzelte Demonstranten so lange, bis ein vielstimmiger Chor in die Losung einfiel. Dann hörte man »Gorbi«-Rufe aus der Menge, die die Verkehrsüberwachungskameras nur unscharf in der Dunkelheit abbilden konnten.
»Wir machen nichts?«, fragte Jurczik den vor den Monitoren sitzenden Hauptmann.
»Solange Gorbatschow in der Stadt ist, haben die Narrenfreiheit«, brummte der Offizier. Irgendwo da unten war Nina, dachte Jurczik und suchte die Monitorwand ab. Sie hatte sich sicherlich unter die Protestierenden gemischt und beobachtete, wie sich die Stimmung unter den Gegnern der SED entwickelte. 27 Jahre war es her, seit er sie zum ersten Mal zum Republikgeburtstag mitgenommen hatte. Was war das für eine Aufbruchsstimmung damals! Der Schutzwall stand, und sie gingen daran, die Republik aufzubauen, ohne dass sie sich ständig mit Fluchtwellen beschäftigen mussten. Sie hatten damals an den Wochenenden viel gefeiert im Kreis der Kollegen, die Kinder immer dabei, bis die nicht mehr konnten und auf den Betten der Gastgeber zum Schlafen hingelegt wurden. Nachts war er dann mit der schlafenden Nina auf dem Arm irgendwie nach Hause gekommen, mitgenommen von Kameraden oder mit dem Taxi. Nina und er hatten mittlerweile kaum noch Kontakt, meist nur über Telefon. Beide vermieden es, über ihre Arbeit für das Ministerium zu sprechen. Seit Ninas Kindheit hatten sie sich voneinander entfremdet, behandelten einander wie entfernte Verwandte, die kaum etwas vom anderen wissen wollten. Ihre Dienststellen lagen im selben Dienstgebäude, doch sie waren sich nie über den Weg gelaufen. Und er suchte nicht nach ihr. Es war zu viel zwischen ihnen passiert. Nichts, das man durch Worte hätte heilen können.
»Gesicht zur Wand!«, schrie die Stimme hinter ihr, und Coco Schmidt gehorchte wie all die anderen, die am Abend vor der Zionskirche zusammengeprügelt worden waren und jetzt in Rummelsburg an einer Backsteinmauer aufgereiht stehen mussten. Immer neue Gruppen von Demonstranten wurden zugeführt, wie das im Polizeijargon hieß. Der Demonstrationszug war vor der Kirche zum Stehen gekommen, dort hatten sich ihnen viele Leute aus der Kirchenopposition angeschlossen. Das war der Moment, wo die Polizei endlich zuschlagen konnte, wie schon vor ein paar Tagen in Dresden. Lastwagenweise wurden die Protestierer zur Polizei in Marzahn oder ins Gefängnis Rummelsburg gefahren. Coco stand seit zwei Stunden in einer Reihe mit anderen jungen Leuten an der Mauer. Anfangs mussten sie die Arme so lange hochhalten, bis sie schmerzten.
»Beine auseinander!«
Nach einer Stunde ließ man sie endlich entspannter stehen, aber immer noch brüllte jedes Mal ein Volkspolizist, wenn einer der Festgenommenen es wagte, den Kopf zu drehen, um mitzubekommen, was hinter seinem Rücken passierte. Da fuhren die Pritschenwagen in langen Reihen in den Gefängnishof und entluden immer wieder Dutzende von verstört um sich blickenden jungen Leuten. Einige hatten Platzwunden am Kopf.
»Ich kann nicht mehr«, stöhnte ein dicklicher Junge neben ihr und schüttelte sich die Beine aus.
»Du weißt gar nicht, was du alles kannst«, sagte Coco und lächelte ihm zu. Sie war trainiert und konnte die quälende Herumsteherei viel besser aushalten als diese Bürgersöhnchen, die sich für Revolutionäre hielten. Es war wichtig, dass sie gesehen wurde. Coco Schmidt, die freche Brünette aus Prenzlauer Berg, im Rummelsburger Knast. Das war für ihre Glaubwürdigkeit entscheidend.
Die ganze Nacht sollten sie so in der Kälte verbringen. Stehend, ohne Chance auf Schlaf. Wer sich an die Mauer zu lehnen versuchte, wurde mit dem Gummiknüppel zurückgeschoben. Eine bittere Lektion, die die meisten sicher davon abhalten würde, noch einmal den Helden spielen zu wollen.
Sonntag, 8. Oktober 1989
Ernst Klamm war beim zweiten Klingeln wach. Er sah zu seiner Frau hinüber, die sich seufzend auf die andere Seite drehte, und sprang aus dem Bett. Er machte kein Licht, um Gertruds Schlaf nicht zu stören, tappte in den Flur und hatte den Hörer beim vierten Klingelton in der Hand. Klamm hielt es nicht für nötig, sich mit Namen zu melden. Es war klar, worum es ging, wenn mitten in der Nacht das Telefon klingelte.
»Mord in Kreuzberg, Waldemarstraße.« Der Anrufer kam gleich zur Sache.
»Ich komme«, antwortete Klamm und legte auf.