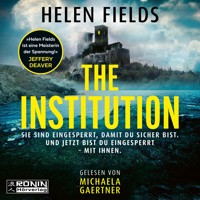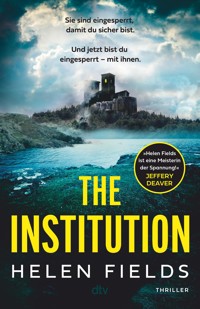12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
»Ein hervorragender Spannungsroman mit bizarrem Ausgang.« The Times Er beobachtet dich. Immer. Und überall. Ein junger Mann, erschlagen in einem Park. Ein Obdachloser, erstochen im Gewerbegebiet. Eine Hausfrau und Mutter, von einem rasenden Auto überfahren: In Edinburgh häufen sich innerhalb kürzester Zeit grausame Todesfälle. Jeder einzelne brutal, jeder einzelne rätselhaft. Es gibt nichts, was die grausamen Morde verbindet. Die Mordkommission um Detective Sergeant Sam Lively ruft deshalb eine Frau zu Hilfe, die für ihre außergewöhnliche Intuition bekannt ist: Dr. Connie Woolwine, forensische Profilerin mit einem untrüglichen Gespür für die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche. Gemeinsam mit dem Ermittlerteam sucht sie lange nach einem roten Faden. Bis die zufällige Beobachtung eines Patienten im St. Columba Hospital eine neue Perspektive eröffnet … Aus dem Auto heraus beobachtete er die Parkhauseinfahrt der Klinik. Dank Nummernschilderkennung würde sie ungehindert hineinfahren, ihren Wagen abstellen und durch eine Verbindungstür direkt das Gebäude betreten. Da kam sie. Er rutschte tiefer in den Sitz … Unterdessen kämpft Dr. Beth Waterfall, DS Livelys neue Freundin, mit ihren eigenen Dämonen: Ihre Tochter wurde Opfer eines Stalkers, der nie gefasst wurde. Als die renommierte Unfallchirurgin eines Morgens einen toten Vogel auf der Fußmatte hinter dem Haus findet, beginnt sie zu ahnen, dass die Vergangenheit nicht ruht … Der neue Psychothriller von UK-Bestsellerautorin Helen Fields: Hochspannung mit einem atemberaubenden Twist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 465
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
Im Jupiter Artland Park findet man die Leiche eines erschlagenen Mannes. Er ist nur das erste Opfer einer ganzen Reihe grausamer Todesfälle, die Edinburgh erschüttern. Jeder einzelne brutal, jeder einzelne rätselhaft. Edinburghs Mordkommission um Detective Sergeant Sam Lively tappt im Dunkeln, sodass man Dr. Connie Woolwine zurate zieht. Die scharfsinnige Profilerin ist für ihre unkonventionelle Herangehensweise bekannt, erkennt Muster, wo andere nur Zufall sehen. Bald ist sie sich sicher, es tatsächlich mit einem Serienmörder zu tun zu haben. Doch er ist den Ermittlern immer einen Schritt voraus …
Unterdessen kämpft Beth Waterfall, DS Livelys neue Freundin, mit ihren eigenen Dämonen: Ihre Tochter wurde Opfer eines Stalkers, der nie gefasst wurde. Als die Unfallchirurgin eines Morgens einen toten Vogel auf der Fußmatte hinter dem Haus findet, beginnt sie zu ahnen, dass die Vergangenheit nicht ruht. Jemand beobachtet sie …
Von Helen Fields sind bei dtv außerdem erschienen:
The Institution
The Killer Profile
Helen Fields
Body Number One
Thriller
Deutsch von Christine Blum
Für Sharon Avery Mit Dank an das Universum, dass unsere Wege sich wieder gekreuzt haben.
Kapitel 1
29. September
Der Tod trug keinen schwarzen Umhang mit tiefer Kapuze, als er Dale Abnay heimsuchte. Er schwang weder eine Sense, noch nahm er ihn an der Hand, um ihn ins tröstende Licht zu führen. Der Tod, erkannte Dale, während er bäuchlings an den Füßen weggeschleift wurde und sein Kinn immer mehr Laub mitnahm, war ein heimtückischer Mistkerl, der sich von hinten angeschlichen hatte. Das war nicht fair. Er hatte sich immer vorgestellt, er würde ihm ins Angesicht blicken und dürfte sich verteidigen. Aber der Tod war ein Feigling, hatte ihm, vermutete Dale, mit einem großen Stein eins über den Schädel gezogen und dabei keinen Ton von sich gegeben. Bastard.
Der Hieb hatte in Dale Abnays Kopf eine Bombe gezündet, und jetzt schoss ihm das Leben in blutigen Strömen aus Ohren und Mund. Sein Bewusstsein zog sich durch sämtliche Hirnwindungen zurück in einen kleinen, geborgenen Winkel des Gedächtnisses, der seinem alten Kinderzimmer verdammt ähnlich sah. Dem einzigen Ort auf der Welt, den er geliebt und an dem er sich sicher gefühlt hatte, vor allem seit jenem Tag, als sein Vater mit der Schwester der Mutter abgehauen war. Da war das Zimmer zum Rückzugsort geworden, wo er Ruhe fand vor seiner abwechselnd weinenden und schreienden Mutter. Sie bedachte ihre Schwester mit Ausdrücken, die Dale noch nie gehört hatte und die ihm damals, mit sieben, in der Schule ganz schöne Probleme einbrachten, als er sie einem Mädchen aus seiner Klasse nachrief.
Irgendwo hinter den Wänden des Kinderzimmers zog roter Dunst auf. Der Wind, der heranwehte, heulte wie ein Fuchs, der sich gegen die Meute wehrt, und trug den Gestank von madenzerfressenem Aas an seine Nase. Dale vergewisserte sich, dass die Tür seines Zimmers verschlossen war, und kroch unters Bett. Das war nicht mehr so leicht wie als Kind – seine Füße ragten hervor, und mit dem Rücken streifte er den Lattenrost –, aber das Wichtige war: Sein Tagebuch lag noch dort.
Darin, erinnerte er sich, stand alles, wovon sein präpubertäres Ich geträumt hatte: Profifußballer zu werden und zu Weihnachten sämtliche Computerspiele geschenkt zu bekommen, die neu auf dem Markt waren; eine Zeit lang hatte er sich auch einen Hund gewünscht. Dann hatte sich die Nachbarin einen angeschafft, und er bekam mit, wie sie jeden Tag mit dem zottigen Köter Gassi ging, seine dampfenden Hinterlassenschaften auflas, umständlich in kleinen schwarzen Plastiktüten sammelte und diese bis zum Ende des Spaziergangs in der Hand herumschlenkerte. Da hatte er seine Wunschliste nochmals überdacht. Das mit der Fußballkarriere war auch nichts geworden, er hatte es nicht einmal in die Schulmannschaft geschafft. Immerhin, als Erwachsener hatte er sich jedes Computerspiel leisten können, das er wollte.
Das Zimmer hüpfte auf und ab. Dales Kopf prallte so heftig gegen den Lattenrost, dass ihm die Ohren dröhnten, und jetzt erschien ein Riss im Boden. Das musste ein Erdbeben sein. Ein Erdbeben in Schottland, kaum zu glauben! Das erste, das er erlebte. Dale streckte die Hand nach der Bettdecke aus und zog sie über den Bettrand herunter wie einen Vorhang, damit er die Zerstörung nicht sehen musste. Vage war ihm bewusst, dass etwas wirklich Schlimmes vor sich ging, aber er war entschlossen, sein Tagebuch zu Ende zu lesen, komme, was wolle. Besser so. Warum sich Sorgen wegen Dingen machen, die man nicht ändern konnte? Das hatte seine Mutter auch immer gesagt, jedenfalls so ähnlich. Jetzt traf das zum ersten Mal auf eine Situation zu, in der er sich selbst befand, und er merkte, dass ihm das gar nicht gefiel.
Dale schlug das Tagebuch auf, rieb sich die Augen, schloss es wieder, wartete ein paar Sekunden und schlug das Buch von Neuem auf. Verschwunden waren die gekrakelten kindlichen Sehnsüchte eines Jungen, der ziemlich große Pläne hatte für jemanden, in dessen Zeugnissen oft stand, er sei unkonzentriert und im Unterricht aufsässig und frech. Verschwunden die kleinen Comicfiguren, die er so gern in die untere Ecke gezeichnet hatte, damit sie sich bewegten, wenn er die Seiten über den Daumen schnurren ließ. Verschwunden die Liste seiner Freunde mitsamt den Streichungen und Hinzufügungen. Und keine Spur mehr von dem ganz besonderen Namen, den er wieder und wieder notiert hatte: Lucy Ogunode.
Lucy, seine große Liebe. Sie war vom ersten Schultag an bis zum Abschluss mit achtzehn in seiner Klasse gewesen. Nicht ein einziges Mal hatte sie das Gesicht verzogen, wenn der Lehrer sie bat, sich neben ihn zu setzen, und sie hatte ihn nie gehänselt wie die anderen Kinder. Lucy war nett und lieb und wunderschön, und ihr Lächeln war wie ein Kerzenlicht in der Düsternis seiner Kindheit gewesen. Bis es eines Tages nicht mehr so war. Beim Gedanken daran brannten ihm die Wangen, und ihm zog sich der Magen zusammen, also beschloss er, nicht daran zu denken.
Dale sah sich nach einem Stift um. Irgendwo unter seinem Bett war immer einer gewesen, damit er spätabends noch etwas aufschreiben oder Notizen machen konnte, wenn er aus einem Traum erwachte. Heute jedoch nicht. Alles, was seine Finger zu fassen bekamen, waren Laub und Zweige. Eigentlich war das nicht möglich, denn seine Mutter hätte ihm die Hölle heiß gemacht, wenn er sein Zimmer derart verdreckt hätte, und nie, niemals, hätte er es mit Straßenschuhen betreten dürfen.
In seinem Kopf versuchten zwei Drähte fieberhaft, sich zu verbinden. Fast gelang es ihnen, da ging das Licht aus, und es war pechschwarz jenseits des Bettdeckenvorhangs. Trotzdem war er irgendwie noch in der Lage, die Seiten des Büchleins zu erkennen. Im schwachen Schein einer Taschenlampe hinter ihm, wie er feststellte. Bisher hatte er sie gar nicht bemerkt, aber sie spendete gerade so viel Licht, dass er nicht gezwungen war, sich zusammenzurollen und allein in der Finsternis zu warten.
Er lenkte den Blick zurück auf das Tagebuch und wünschte, er könnte Lucys Namen wieder hineinschreiben. Doch alles war mit dicken schwarzen Bleistiftstrichen überkritzelt, denen jeder gute Gedanke, den er notiert hatte, zum Opfer gefallen war und die jede Seite in einen bodenlosen Abgrund verwandelt hatten. Dale zog die Finger zurück im sicheren Wissen, dass seine Fingerspitzen bei der kleinsten Berührung der Graphitschicht darin verschwinden würden und er selbst als Ganzes gleich mit.
Vorsichtig, darauf bedacht, nur die äußersten Ecken der Seiten zu berühren, blätterte er weiter, bis von oben ein Tropfen auf ihn fiel und ihn ablenkte, sodass seine Hand versehentlich doch über die Seite glitt. Die Finger wurden nicht schwarz, sondern grün, ein ganz dunkles Moosgrün, und waren plötzlich beschaffen wie – er musste darüber nachdenken, und das Denken dauerte quälend lange – dieses Zeug, in das seine Mutter immer Blumen gesteckt hatte. Man kaufte es in Blöcken, und es bröckelte, wenn man es zu fest anfasste … Oasis, so hieß es. Er rieb mit den befallenen Fingern über den Boden, aber es ging nicht weg, also rieb er noch einmal. Jetzt tat sich etwas. Mit offenem Mund starrte er hin: Von den Fingern löste sich die Haut, als zöge er sie über eine Reibe. Es hätte wehtun müssen, aber dem war nicht so. An sich war das erfreulich, nur merkte er jetzt, dass er gar nichts spürte. Nicht das kleinste bisschen. Dale zwickte sich. Dann biss er sich auf die Unterlippe. Dann boxte er sich in den Oberschenkel.
»Nichts«, flüsterte er.
Von oben tropfte es weiter, und zwar ziemlich stark, dafür dass die Flüssigkeit durch Bettdecke, Laken und Matratze hindurchgesickert sein musste. Eiskaltes, schleimiges Wasser, das nach Erde und Würmern roch. Bis zu diesem Augenblick hatte er noch nie überlegt, wie Würmer wohl rochen, aber schlimmer war, dass sein Tagebuch nass wurde, das Einzige, woran er sich noch klammern konnte. Wenn ihm das entglitt, wäre es das Ende, dessen war er sich bewusst.
Auf den Seiten stand jetzt wieder Lucys Name, aber ohne die Herzchen und Blumen, mit denen er den Schriftzug immer verziert hatte. Stattdessen begannen die Buchstaben zu zerfließen und hinterließen graue Streifen wie von Tränen. Erschrocken ließ er das Buch fallen, weil es mit einem Mal nach Rauch roch und Flammen aus dem Buchrücken schlugen. Dieses Geschehen, erinnerte er sich, war keine Halluzination, sondern hatte sich wirklich ereignet, und das war gut, ja, besser als gut, denn vielleicht bedeutete das, dass er doch nicht den Verstand verlor. Vielleicht würde das Feuer dazu führen, dass er aus dem Albtraum erwachte und in die Wirklichkeit zurückkehrte.
Natürlich konnte er sein Tagebuch nicht vor sich haben, weil er es in der echten Welt verbrannt hatte. Zuerst hatte er es zerreißen wollen, aber dazu war es zu stabil gewesen. Frustriert hatte er es in den Kamin geworfen, Feuerzeugbenzin darübergegossen und sich an den Flammen erfreut, die daraus hochschlugen. Denn Lucy hatte alles verdorben. So viele Jahre lang hatte er sie aus der Ferne geliebt, immer auf Abstand, weil er genau wusste, dass er für einen Annäherungsversuch in der Hackordnung der Klasse viel zu weit unten stand. Dann, nach der Schulzeit, hatte er es endlich gewagt und alles versucht, um ihre Zuneigung zu gewinnen. Er hatte sogar den Mut aufgebracht, sie um eine Verabredung zu bitten. Lucy war die ganze Zeit über abweisend geblieben. Auf nette, höfliche Art zwar, aber das fand er viel schlimmer, als wenn sie ihm eine Ohrfeige verpasst oder ihm erklärt hätte, sie sei lesbisch oder habe zu Jesus gefunden und wolle in ein Kloster eintreten. Aber von ihr war gar nichts gekommen, und es war erstaunlich, wie erdrückend so ein Garnichts sein konnte.
Seit Lucy hatte er es natürlich noch bei anderen Frauen versucht, aber keine war es wert gewesen, dass er ihren Namen in dem Buch verewigte. Das war bereits zu Asche zerfallen, so schnell, wie es in Flammen aufgegangen war. Schwaden von Rauch und Rußpartikeln waberten im schwächer werdenden Lampenschein umher.
Es schien, als wäre Dale keine Frau beschieden. Entweder sie waren zu gut für ihn oder nicht gut genug. Irgendwo – in einem Film oder einer Serie? – hatte er gehört, man solle es bei den weniger guten versuchen, weil sie dankbarer und williger seien. Ihm widerstrebte diese Logik. Warum sollte er sich als junger Mann auf unattraktive Frauen beschränken? Würden ihn nicht auch schöne Frauen mit prallen, straffen Brüsten und schmalen Taillen begehren? In den Videos, die er spätnachts genau hier unter seinem Bett geschaut hatte, wenn seine Mutter fest schlief und ihn nicht erwischen konnte, begehrten solche Frauen doch auch jeden Mann.
Die Taschenlampe flackerte. Dale nahm sie und schüttelte sie in der Hoffnung, die Batterien würden sich noch einmal erholen, aber es nützte nichts. Jetzt war es ganz dunkel. Dale wollte um Hilfe rufen, aber Tropfen fielen ihm auf die Zunge, so bitter, dass er würgen musste. Von allen Seiten kroch nun das Wasser näher. Er wollte etwas sagen, hätte gern ein paar letzte Worte gesprochen, aber seine Zunge war ein nutzloses klobiges Ding im Mund. Und bildete er es sich ein, oder lastete das Bett immer schwerer auf ihm? Er verspürte Bedauern, dass er oftmals kein sonderlich netter Mensch gewesen war. Erst vor Kurzem hatte er sich vorgenommen, dem etwas entgegenzusetzen. Er hatte mehr gewollt, hatte daran gearbeitet, sich zu bessern. Jetzt war es zu spät.
Er versuchte, sich auf die Seite zu rollen, um die Knie an die Brust zu ziehen, ein letztes bisschen Trost in der Embryostellung zu finden, aber das Laub aus den Ecken war jetzt überall, häufte sich um ihn, umhüllte ihn wie eine feuchtkalte Decke. Die Luft, die er atmete, war schwer und roch nach Tod. In seinen letzten Sekunden, als sein Bewusstsein die Tür des Zimmers öffnete und ihm zu erkennen gestattete, wo sein sterblicher Leib sich in Wahrheit befand, kam ihm noch der Gedanke, ob Lucy Ogunode, wo sie auch sein mochte, je erfahren würde, dass er tot war. Und ob sie das überhaupt interessieren würde.
Nur wenige, aber viel zu lange Minuten später schied Dale aus der Welt, umringt und beweint von fünf Mädchen.
Kapitel 2
5. Mai
Detective Sergeant Lively vom Major Investigation Team Edinburgh saß in einer Kirche und hoffte, nicht spontan in Flammen aufzugehen nach allem, was er jahrzehntelang jedem gegenüber, der es hören wollte, zum Thema Religion von sich gegeben hatte. Doch es gab Zeiten, da forderte der Beruf seinen Tribut, und in der letzten Zeit hatte er ihm viel zu viele Menschen genommen, die ihm etwas bedeuteten. Deshalb war er nun hier. Er war noch nicht an dem Punkt angelangt, tatsächlich zu beten, als sein Handy »Black Hole Sun« zu spielen begann – ein Anruf vom Polizeirevier.
»Gib mir Kraft«, murmelte Lively. »Kann man nicht mal einen Moment Ruhe haben?« Er nahm an. »Nur gute Nachrichten gefälligst.«
»Okay, was heißt ›gut‹?«, gab Christie Salter zurück. Trotz des Altersunterschieds – er über fünfzig, sie in den Dreißigern – waren sie gleichrangig, aber er hatte ihr alles beigebracht, was sie konnte, und erinnerte sie immer wieder daran, was sie insgeheim genoss.
»Dass ich im Lotto gewonnen habe oder Schottland jetzt zu den Bahamas gehört und wir alle nach der Pensionierung dorthin ziehen dürfen.« Lively war schon auf dem Weg zum Friedhof hinter der Kirche, verärgert, dass ihm mal wieder die Freizeit gekürzt wurde. Auf einigen Grabsteinen standen die Namen von Kollegen, auch mit ihnen hatte er ein paar Minuten verbringen wollen. Ihnen Unehre erweisen, nannte er das immer für sich. Tote Freunde wollten nicht geehrt werden, sie wollten, dass man sich an schöne Momente mit ihnen erinnerte.
»Das viele Geld würde Sie irgendwann nur langweilen, und am Strand würden Sie sich einen Sonnenbrand holen. Außerdem brauchen wir Sie hier, jetzt, wo das Team so dezimiert ist. Tatsächlich hatte ich gehofft, Sie hätten Zeit, im St. Columba Hospital vorbeizuschauen. Da wird gerade ein Obdachloser mit mehreren Stichwunden eingeliefert zur Not-OP.«
»Mehrere Stichwunden, und er lebt noch?«
Lively beschleunigte seinen Schritt und wandte sich in Richtung Auto.
»Vermutlich weil er so viele Klamottenschichten am Leib trug, das scheint die Stiche abgebremst zu haben. Trotzdem muss es ein völlig enthemmter Angriff gewesen sein. Ist offenbar vergangene Nacht passiert. Er wurde heute Morgen von der Security eines Gewerbebetriebs in Bankside neben dem Zaun des Firmenparkplatzes gefunden.«
»In Ordnung, bin auf dem Weg. Was hab ich eigentlich getan, dass ausgerechnet Sie mir die A-Karte zuschustern?«
»Ich muss rausfahren zum Jupiter Artland«, sagte Salter. »In dem Park wurden menschliche Überreste gefunden, das ist bisher alles, was ich weiß, außer dass der Pathologe nicht glücklich mit der Leiche ist.«
»Nicht glücklich? Genau das ist doch seine berufliche Erfüllung, oder?«
Salter ignorierte ihn.
»Beeilen Sie sich, ja? Man weiß nicht, ob das Messeropfer überleben wird, und bis jetzt war kein verständliches Wort aus ihm herauszukriegen.«
»Ich brauche zehn Minuten«, sagte Lively. »Sagen Sie denen Bescheid, dass ich komme, dann schaue ich, was ich von ihm erfahre, bevor er anästhesiert wird. Tolle erste Woche für Sie nach der Rückkehr, was?«
»Edinburgh halt«, gab sie trocken zurück. »Ich hätte nichts anderes erwartet.«
Das St. Columba Hospital, ein Neubau, hätte leicht eine architektonische Scheußlichkeit werden können, aber von Stadtplanung verstand man in Schottland etwas. Das Einzige, woran es in guter alter Edinburgher Tradition mangelte, waren Parkplätze. Angesichts des Besucherparkplatzes, dem er sich näherte, gab Lively die Hoffnung gleich auf, stellte seinen Wagen auf einer Rasenfläche ab und zückte seinen Dienstausweis, bevor der Wachmann auch nur in Rufweite kam.
»Polizei«, sagte er. »Ich hab’s eilig.«
»Da ist ein Schild«, herrschte der Wachmann ihn an.
Lively drehte sich danach um.
»Aye, da steht aber: Rasen betreten verboten. Ich bin draufgefahren, das ist was ganz anderes.«
Der Wachmann sah ihn verzweifelt an.
»Der Rasen wurde erst kürzlich gesät, die machen mich rund.«
Lively seufzte, griff in die Tasche und warf ihm seinen Autoschlüssel zu.
»Na gut, ich will ja nicht, dass Sie Ärger kriegen. Fahren Sie ihn gern woandershin. Wenn ich fertig bin, hole ich den Schlüssel bei Ihnen ab. Wo geht’s zur Notaufnahme?«
Der Wachmann zeigte ihm die Richtung. Lively sah auf die Uhr, wollte schon losrennen, um die verlorene Zeit wettzumachen, ließ es dann aber bleiben. Bloß keinen Unsinn machen, sonst kam er noch auf einer Trage unter Herzdruckmassage in der Notaufnahme an. Er musste seine überschüssigen Pfunde (stone, flüsterte ein böses Stimmchen in seinem Hinterkopf) endlich loswerden, das hatte er schon … ach, keine Ahnung, wie lange er es schon vorhatte.
Die Fassade des Klinikums war im schottischen Baronial-Stil gehalten, weshalb sie aussah, als wäre sie jahrhundertealt mit all dem Sandstein, den Mini-Türmchen und der Unmenge an Fenstern und Verzierungen, die auch den gleichgültigsten Steinmetz zum Weinen gebracht hätten. Drinnen war es jedoch, als befände man sich auf einem anderen Planeten: ein luftiges Foyer über vier Etagen, Korridore mit bewegungsgesteuerter Beleuchtung, Ruhebereiche mit Designersofas und großen Grünoasen, jede mit eigener Benebelung, um die Erde feucht zu halten. Es roch nach Kiefernnadeln und Muskat, und aus unsichtbaren Lautsprechern erklang Vogelgezwitscher und das Summen von Bienen. Lively spürte, wie sich die altvertraute Düsternis des Reviers von ihm hob, während er, so schnell es ihm möglich war, auf die Suche nach dem Mann ging, der sich hoffentlich noch ans Leben klammerte.
Man schickte ihn durch eine Tür nur für Befugte und einen langen weißen Flur entlang in eine Umkleide, wo er mit Überschuhen, einer OP-Schürze und Handschuhen ausstaffiert wurde. So ein OP-Saal, dachte er, war einem modernen Tatort gar nicht so unähnlich.
»Dr. Hall, der Anästhesist, ist schon im Vorbereitungsraum, und die Chirurgin ist auf dem Weg«, informierte man ihn. »Sie dürfen rein, aber nur für eine Minute. Der Zustand des Patienten ist schlecht. Und fassen Sie ja nichts an, Sie tragen nur unzureichende Schutzkleidung.«
Lively trat durch eine automatische Tür. Hinter einer Scheibe links von ihm sah er, wie ein achtköpfiges Team die letzten Vorbereitungen traf – Instrumente einsortierte, Lampen justierte, sich die Schürzen enger schnürte und Monitore in Position brachte. Der Patient, der vor ihm auf einer fahrbaren Trage lag, bildete einen schroffen Kontrast zu der sterilen Welt. Er war zwischen vierzig und fünfzig mit einer wilden rotblonden Mähne und den unvermeidbaren Narben des langen Lebens auf der Straße auf Gesicht und Armen. Seiner Gesichtsfarbe nach zu schließen, hätte er auch schon tot sein können, und sein Atem klang wie eine verstopfte Trillerpfeife.
Während Lively sich dem Kopf des Patienten näherte, um ihm hoffentlich ein paar wichtige Informationen zu entlocken, trat eine Frau durch die Tür am anderen Ende des Raums. Sie hatte ein heiteres Lächeln auf den Lippen und strahlte vollkommene Gelassenheit aus.
»Vielen Dank zusammen, sind wir startklar? Wir haben Besuch, bitte lassen Sie ihn noch kurz seinen Job machen.« Sie nickte Lively zu.
Er konnte nicht umhin zurückzulächeln. »DS Lively.«
»Beth Waterfall, Unfallchirurgin und Notärztin. Ich fürchte, Sie haben nicht viel Zeit. Legen Sie los, aber versuchen Sie, den Patienten nicht zu sehr aufzuregen. Soweit ich informiert bin, ist er seit der Einlieferung nur sporadisch bei Bewusstsein.«
Die Augen des Patienten auf der Liege flogen auf. Er sah zum Anästhesisten auf, zu Lively und dann zu der Chirurgin hinüber. »Nein, nein, nein!«, schrie er, begann den Kopf zu schütteln, mit den Armen zu fuchteln und nach den Schläuchen zu greifen, die zu seinen Handgelenken führten. »Hilfe! Hilf mir doch jemand!«, lallte er undeutlich und speichelsprühend.
»Er ist tachykard, azidotisch, hat hohe Laktatwerte, und der HB im Keller«, drängte Dr. Hall. »Wir müssen anfangen.«
»Beeilen Sie sich, Detective«, sagte Beth Waterfall, »wir müssen in den OP-Saal und die Blutung stoppen.« Sie rückte ihren Mundschutz zurecht und beugte sich über den Bauch des Patienten, wo an drei Stellen bereits die Verbände durchbluteten.
Lively stellte sich rasch so über den Mann, dass er ihm ins Gesicht sah, und versuchte, Augenkontakt aufzunehmen. »Hallo, ich bin von der Polizei. Können Sie mir etwas über die Person sagen, die Sie angegriffen hat?«
»Scheiß-Idiot«, nuschelte der Mann. »Ich muss hier raus, die bringen mich um!«
»Egal was, bitte versuchen Sie, sich zu erinnern«, bat Lively.
»Blutdruck fällt«, mahnte Dr. Hall scharf.
»Er muss sofort operiert werden, er verliert zu viel Blut«, sagte Dr. Waterfall. »Zehn Sekunden, Detective.«
Lively beugte sich tiefer über den sich windenden Mann. »Was wissen Sie noch von dem Angriff? Egal was, bitte!«
Mit erstaunlicher Kraft angesichts seines schon halb narkotisierten Zustands packte der Mann Livelys Hand. Er öffnete den Mund, um etwas zu sagen, da verdrehten sich seine Augen, und sein Kopf fiel zur Seite.
»Patient ist bereit«, sagte der Anästhesist. »Blutdruck ist grenzwertig, Herz schlägt schwach. Längere Narkose ist hochriskant.«
»Nichts für ungut, Detective, aber Sie müssen jetzt gehen«, sagte Waterfall. »Sie können gern im Café warten, ich kann danach zu Ihnen kommen, wenn Ihnen das hilft.«
»Okay, wir haben ein Date«, sagte er.
»Oh, daten Sie bloß keine Chirurgin«, sagte sie, während eine Assistentin ihr ein Blatt Papier reichte, das sie zugleich zu überfliegen begann. »Chirurgen sind Workaholics mit gesellschaftsfeindlichen Arbeitszeiten, kommen nach Blut stinkend nach Hause und haben nur eklige Geschichten zu erzählen. – Verdammt, der Magen ist seit Stunden perforiert, hängen Sie noch eine Konserve an und machen Sie alles zum Absaugen bereit.«
»Klingt nach Seelenverwandtschaft.« Lively schickte Waterfall ein Lächeln hinterher, obwohl sie schon auf dem Weg in den OP war. »Ich warte auf Sie.«
Kapitel 3
5. Mai
Dr. Waterfall kam vier Stunden später. Das Haar fiel ihr in einem weichen Bob ums Gesicht, ihre braunen Augen schimmerten freundlich. Er schätzte sie auf ungefähr sein Alter, aber sie hatte sich weit besser gehalten. Lively marschierte schnurstracks zur Theke und besorgte ihr einen Kaffee, den sie dankbar annahm, nachdem sie sich gesetzt hatte.
»Ich würde ja fragen, ob er es geschafft hat, aber ich habe dreißig Jahre Erfahrung im Lesen von Gesichtern«, sagte er.
»Die Chancen standen von Anfang an extrem schlecht, aber mein Motto ist, gib nie die Hoffnung auf. Wir haben wirklich um sein Leben gekämpft, länger als angebracht, wenn ich ehrlich bin. Ich hasse es, aufgeben zu müssen. Mein erster Gedanke war, dass ich jetzt seine Angehörigen informieren muss. Es dauerte eine Weile, bis mir einfiel, dass ich das ja gar nicht kann, und das war irgendwie noch schlimmer.« Sie nippte an ihrem Kaffee. Lively gab ihr etwas Zeit, um ihn zu genießen. Beth Waterfall hatte ein sanftes Gesicht, das gar nicht zu ihrem fordernden Beruf zu passen schien, mit Lachfältchen, die von ihren Augen ausgingen wie die Strahlen der Sonne in einer Kinderzeichnung, und einer straffen Figur, der man ansah, dass sie viel auf den Beinen war. Zu sehen, wie unterschiedlich sie beide in Form waren, trieb ihm die Röte ins Gesicht. Schnell ging er zum Geschäftlichen über, um seine Verlegenheit zu verbergen.
»Was können Sie mir über seine Verletzungen sagen?«
»Ich bin keine Rechtsmedizinerin, also verlassen Sie sich nicht auf mein kriminalistisches Fachwissen. Aber medizinisch gesehen gab es drei Hauptwunden, alle etwa gleich tief und an der Eintrittsstelle gleich breit, dazu ein paar kleinere, die aussahen, als wäre die Waffe von dickeren Kleidungsstellen abgebremst worden, Taschen zum Beispiel. Seine Kleidung wurde eingetütet, die können Sie mitnehmen. Der Notarzt, der ihn erstversorgt hat, meinte, die vielen Schichten seiner Kleidung hätten wahrscheinlich dafür gesorgt, dass er so lange am Leben blieb, andererseits waren sie schlussendlich für seinen Tod verantwortlich. Wenn man ihm die Verletzungen deutlicher angesehen hätte, wäre er vielleicht schon eher jemandem aufgefallen.«
»Das klingt für mich aber ziemlich fachkundig.«
»Ich vermute, jede Medizinstudentin im Grundstudium würde dieselben Schlüsse ziehen.« Waterfall hatte eine sanfte, tiefe Stimme, und sie lächelte, wenn sie sprach. Lively bemühte sich, seine Kaffeetasse zu fixieren statt ihre Lippen. »Ich würde sagen, die Wunden waren schwer genug, dass er nicht aus eigener Kraft Hilfe suchen oder auch nur um Hilfe rufen konnte, je nachdem, ob er überhaupt an einem Ort mit Publikumsverkehr war. Aber sie waren nicht so tief, dass er sofort verblutete. Stattdessen blutete er über Stunden immer weiter aus.«
Lively seufzte. »Sind Ihnen vielleicht noch andere Verletzungen aufgefallen, an den Händen zum Beispiel?«
»So genau habe ich ihn mir nicht angeschaut, fürchte ich, aber auf keinen Fall so schwere, dass ein chirurgischer Eingriff erforderlich gewesen wäre. Ein Stich ging in eine Niere, der war im Großen und Ganzen in sich abgeschlossen. Der zweite hat eine Vene unter dem Bauchfett in der Pankreasgegend verletzt, die war für die langsame Blutung verantwortlich. Unser Problem bei der OP war, dass die dritte Wunde den Darm durchstochen und eine Peritonitis verursacht hatte. Allein wegen der Infektion war es unwahrscheinlich, dass er überlebt hätte. Mein Team hatte Anweisung, bei der OP so behutsam wie möglich vorzugehen, damit Sie noch Beweise sichern können, aber natürlich mussten wir die Umgebung der Stiche gründlich desinfizieren, genau wie die Stellen, wo wir ihm Infusionen angelegt haben, und sein Gesicht, an das der Anästhesist ranmusste. Falls Sie seine Angehörigen aufspüren, würde ich gern selbst mit ihnen reden. Ihnen die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen, damit sie sich nicht allein gelassen fühlen.«
»Wie lange hätte es gedauert, bis er am Blutverlust durch die Stiche gestorben wäre, was meinen Sie?«, fragte Lively.
Waterfall hob leicht die Schultern. »Schwer zu sagen. Einige Stunden, aber keinen vollen Tag. Gestorben ist er schlussendlich am Herzstillstand aufgrund einer schweren Blutung.« Waterfall streckte die Hand aus und legte sie sanft über seine. »Ich hoffe, Sie finden heraus, wer das war. Unter den Obdachlosen gibt es viel zu viele Todesfälle. Man müsste so viel mehr tun.«
»Aye, die Diätenerhöhungen der Politiker sind dringender«, brummte Lively. »Wie sollen sie sonst ihren Sommerurlaub auf den Malediven bezahlen?«
Langsam zog Waterfall ihre Hand zurück.
»Ich sollte gehen. Vielen Dank für den Kaffee, Detective.«
Lively merkte, dass er sich wünschte, sie ginge nicht, was sich merkwürdigerweise anfühlte, als steckte ihm ein Golfball in der Kehle.
»Ungewöhnlicher Name – Waterfall. Woher kommt er?«
»Mein Vater stammte aus Staffordshire, da gibt es ein Dorf, das so heißt. Dahinter steckt eine ganz spannende Geschichte. Meine Mutter war aus Portree. Sie haben sich im Studium auf einer Reise nach Paris kennengelernt, die sie beide bei einem Lyrikwettbewerb gewonnen hatten. Liebe auf den ersten Blick, sagte mein Vater immer. Meine Mutter behauptet, sie hätte es ihm nicht so leicht gemacht, aber ich glaube, seine Version stimmt schon.«
Lively spürte wieder seine Wangen brennen und fragte sich, ob er sich hier im Klinikum eine Art Virus eingefangen hatte. Er tastete in seiner Hosentasche nach einer Visitenkarte von sich und drückte ihr das ziemlich zerknautschte Kartonrechteck in die Hand.
»Falls Ihnen noch etwas einfällt.«
»Haben Sie einen Stift bei sich?«, fragte sie.
Lively gab ihr einen Kuli, und sie schrieb eine Telefonnummer auf eine Serviette.
»Hier, ich nehme an, Sie werden meine Aussage noch einmal offiziell aufnehmen wollen. Das ist dann aber schon unser zweites Date, da erwarte ich, dass Sie mir Blumen mitbringen.«
»Bin mir nicht sicher, ob ich das kann«, brummte Lively. »Dafür reicht unser Budget eigentlich nicht.«
»Schade aber auch.« Sie ließ ein Grinsen aufblitzen, und instinktiv zog Lively den Bauch ein und setzte sich gerader hin. »Lassen Sie auf alle Fälle von sich hören. Vorzugsweise unter anderen Umständen als heute.«
Bevor Lively eine Antwort einfiel, war sie schon aufgestanden und ging davon.
Kapitel 4
5. Mai
Jupiter Artland war ein Idyll. Der kunstvoll angelegte Park mit seinen geschwungenen, skulpturierten Rasen- und Wasserflächen war ein Ort der Erholung sowohl für Einheimische als auch für Touristen, die genug von den Souvenirshops voller Tartan und Plastik hatten. Von Oktober bis weit in den Frühling hinein blieb die außerhalb der Stadt gelegene Anlage geschlossen, damit die Natur in der Zeit des Frosts und Regens frei atmen konnte, ungestört vom Getrampel der Menschen.
Während Livelys Besuch im Klinikum war mit dem Park eine Veränderung vor sich gegangen. Weite Bereiche waren abgesperrt, Zelte aufgestellt und Ausrüstung herbeigeschleppt worden – zu Fuß, um Landschaft und Tatortarbeit möglichst wenig zu beeinträchtigen. Eine Leiche aus der freien Natur zu bergen, kostete Zeit. Man musste nicht nur den Körper selbst, sondern auch das umgebende Erdreich mitnehmen. Außerdem galt es, ein riesiges Gebiet minutiös abzusuchen, nach einer Waffe oder anderen Objekten, die mit der Tat in Zusammenhang standen und möglicherweise zurückgelassen worden waren. Lively war es ganz recht, dass er in der Zwischenzeit Innendienst im Klinikcafé geschoben hatte.
Gemächlich bummelte er entlang der gepflegten Wege zu dem schattigen Hain, in dem die »Weeping Girls« standen, fünf Skulpturen, die an Bäume gelehnt oder freistehend in so tiefe Verzweiflung versunken schienen, dass man ungeachtet ihrer kalten, steinernen Herzen glaubte, sie schluchzen zu hören. Schaudernd betrachtete er die Mädchen. Irgendwie ging ihr Anblick viel mehr unter die Haut als die Tatsache, dass hier, während der Winter sich vor dem keimenden Frühling zurückgezogen hatte, ein Mensch langsam verrottet war.
Beim Fundort abseits des Weges stand Christie Salter und beobachtete Dr. Nate Carlisle, den neuen Pathologen, bei der Arbeit. Er war nicht zu übersehen in der Menge der Spurensicherer, die emsig Beweise einsammelten, um den grausigen Fund in die Kriminalgeschichte Schottlands einzuschreiben.
»Na, stehen Sie auch auf ihn?«, flüsterte er ihr von hinten zu.
Erschrocken drückte Salter sich die Hand aufs Herz.
»Verdammt, Sarge, hier ist ein Mensch brutal ermordet worden, da schleicht man sich doch nicht an! Und fürs Protokoll, ich bin glücklich verpartnert.«
»Ach was, schauen darf man immer. Sie sind verheiratet, nicht tot.«
»Bisschen taktlos angesichts der Umstände«, brummte sie.
»Kommen Sie schon, das ist unser Job. Haben Sie sich noch nie überlegt, dass wir arbeitslos wären, wenn die Leute aufhören würden, sich gegenseitig den Schädel einzuschlagen?«
»Ich glaub’s nicht. Mord als Jobfaktor.«
»Ich spreche nur aus, wie es ist. Geben Sie zu, Sie haben mich vermisst, Salter.« Er gab ihr einen Rippenstoß.
Nate Carlisle – schwarz, weit über eins achtzig groß, schlank, sehnig, kahler Schädel – trat ein paar Schritte von der Leiche zurück, warf einen Blick auf Salter und Lively und winkte sie heran. »Aber bleiben sie auf den Trittplatten.«
Vorsichtig näherten sie sich, wie immer mit dem Schreckgespenst des Verteidigers vor Augen, der viel Wind um einen falsch gesetzten Fuß oder ein heruntergefallenes Handy machte.
»Na, wie tot isser, Doc?«, fragte Lively.
Nate Carlisle seufzte und sah ihn mit erhobenen Augenbrauen an, worauf Salter lächeln musste. Es war erfreulich, dass Carlisle dieses Jungsclique-Gehabe, das Polizisten bei der Arbeit so gern an den Tag legten, nicht lustig fand.
»Ich bin DS Christie Salter«, stellte sie sich vor. »Was können Sie uns sagen?«
»Die menschlichen Überreste wurden von einem Parkangestellten gefunden. Wir haben es mit einem Mann zu tun, ich schätze knapp eins achtzig groß. Die Leiche ist weitgehend skelettiert, folglich muss der Tod vor mindestens vier Monaten eingetreten sein. Da die sterblichen Überreste stark besiedelt sind, werde ich einen entomologischen Forensiker hinzuziehen, der wird uns mehr zu dem Thema sagen können. Den genauen Todeszeitpunkt können wir allerdings erst bestimmen, wenn wir wissen, seit wann der Mann verschwunden ist.«
»Lassen sich natürliche Todesursachen oder Suizid schon ausschließen?«, fragte Salter.
»Beugen Sie sich über ihn, aber passen Sie auf, dass Sie nicht das Gleichgewicht verlieren, und versuchen Sie, nicht zu atmen.«
Simultan holten Lively und Salter tief Luft und beugten sich über die Leiche. Carlisle hob mit behandschuhtem Finger ein Haarbüschel an und deutete auf einen Riss im Knochen des bereits dunkel verfärbten Schädels.
»Gebrochen?«, fragte Lively.
Carlisle nickte. »Das Schläfenbein. Bei einem deutlich erkennbaren Bruch wie diesem muss der Aufprall derart heftig gewesen sein, dass es zu einer Hirnblutung mit baldigem Bewusstseinsverlust kam. Diese Verletzung hätte der Mann sich nicht selbst beibringen können.«
»Könnte er gestürzt sein und sich den Kopf an einem Stein oder Baumstumpf aufgeschlagen haben?«, wollte Salter wissen.
»Ja, das wäre möglich, in etwa so wie bei einem tödlichen Skiunfall. Aber das würde nicht erklären, was danach passiert ist.«
Carlisle deutete auf ein Mitglied des Spurensicherungsteams, das mit einer Pinzette unendlich geduldig ein herabgefallenes Blatt nach dem anderen vom Boden auflas. Unter den Blättern waren in der feuchten Erde zwei Furchen zu sehen, die zu einem Busch führten. Ein weiteres Teammitglied fotografierte von einer Trittleiter aus die beiden Schleifspuren, die Schlittenspuren im Schnee ähnelten.
»Dort im Unterholz klemmt ein Paar halb vergrabener Wanderstiefel unter einem Ast, die Füße stecken noch darin. Ich nehme an, ein Tier hat die Leiche ein Stück weit hervorgezerrt, als sie schon so verwest war, dass die Sehnen und Bänder an den Fußgelenken nachgegeben haben. Dafür spricht, dass es überall Fraßspuren an den Überresten gibt.«
»Kleiner Snack am Abend, was?«, war von Lively zu vernehmen.
»Himmel, würden Sie mal aufhören? Tut mir leid«, schimpfte Salter.
»Sie müssen sich nicht entschuldigen. Ich habe schon mit DS Lively zusammengearbeitet«, sagte Carlisle. »Ich war beeindruckt von seinen kriminalistischen Fähigkeiten.«
»Schon gut, hab’s ja kapiert«, brummte Lively. »Wurde noch mehr Kleidung gefunden?«
»Keine Jacke, und alles andere war leichte Baumwolle. Soweit erkennbar, handelt es sich um ein T-Shirt und Shorts, beides weitgehend verrottet. Wir haben den Fundort bereits nach Hinweisen zur Identifizierung abgesucht. Bisher haben wir weder Handy, Geldbeutel noch Schlüssel gefunden.«
»Ist der Schädel gut genug erhalten für eine Gesichtsrekonstruktion?«, fragte Lively.
»Das kann ich erst nach der Obduktion mit Sicherheit sagen. Jetzt wollen wir die Leiche erst mal ins Zelt dort drüben bringen und für den Transport in die städtische Leichenhalle vorbereiten.«
Carlisle deutete Richtung Rasenfläche und ging den Kollegen entgegen, die dabei waren, eine spezielle Trage herbeizuschaffen. Lively drehte sich einmal um sich selbst, um sich zu orientieren, und steckte stirnrunzelnd die Hände in die Taschen.
»Der Park war monatelang geschlossen. Ich würde sagen, es ist letztes Jahr im Spätsommer oder Frühherbst, auf jeden Fall vor Oktober, passiert. Komische Gegend für einen Raubüberfall, finden Sie nicht?«
»Ganz meine Meinung«, sagte Salter. »Das war kein Raubüberfall, oder wenn, dann ging es nicht um etwas so Gewöhnliches wie Geld oder ein Handy. Ich hätte ja auf Drogen getippt, aber ich wüsste nicht, dass Wandern in der hiesigen Drogenszene sonderlich angesagt wäre. Haben Sie eine Idee?«
»Auf mich wirkt es wie ein Streit. Zwei Freunde, ein Paar, zwei Geschäftspartner. Vielleicht um Geld. Hey, Doc?«, rief er Carlisle zu. »Sie sagten, die Füße wären halb begraben gewesen. Wie tief?«
»Nur ein paar Zentimeter«, rief Carlisle zurück.
»Also eine Impulshandlung, kein geplanter Mord. Sonst hätten der oder die Täter eine Schaufel dabeigehabt und die Leiche vergraben, um die Spuren zu beseitigen. Kein schottischer Mörder, der was auf sich hält, wäre so schlampig, es nicht zu tun.«
»Nett«, bemerkte Salter. »Lassen Sie uns schon mal zum Zelt rübergehen, die Leute wollen hier ihre Arbeit machen.«
Carlisle und die Männer mit der Trage standen inzwischen bereit und machten sich daran, die Stiefel unter dem Busch zu bergen und vorsichtig die Leiche anzuheben.
Wenig später standen alle im Zelt um die Trage herum. Carlisle reichte den Ermittlern je ein Paar Handschuhe und einen Mund- und Nasenschutz und zog das Tuch beiseite, unter dem sich die Überreste des Opfers befanden.
Was Leichen anging, war das hier noch recht erträglich, fand Lively. Aus bitterer Erfahrung wusste er, dass frischere Tote einen sehr viel mehr mitnahmen. Sobald das Körpergewebe sich aufgelöst hatte, begann der Leichnam auszutrocknen, und erstaunlich schnell hatte er nicht mehr viel Ähnlichkeit mit einem lebenden Menschen.
Wer immer der Tote gewesen war, jetzt war nichts mehr von ihm zu erkennen. Unmöglich, ihn durch Angehörige oder Bekannte identifizieren zu lassen. Was noch übrig war, lieferte sicherlich brauchbare DNA und vielleicht einen Zahnstatus, aber ob sie das Opfer einwandfrei würden zuordnen können, stand in den Sternen.
Die Knochen waren teils zerbrochen und geknickt und wurden von ledrigen Hautstücken und braunen Sehnen zusammengehalten. Nur der Schädel war abgesehen von dem Riss intakt.
»Meinen Sie, der Kopf wurde sorgfältiger begraben?«, fragte Salter.
»Nein. Der Schädel ist deshalb in besserem Zustand als der Rest, weil die Kiefer unserer einheimischen Aasfresser nicht groß genug sind, um ihn zu knacken. Alle anderen Knochen wurden wie gesagt von Tieren angefressen.«
»Na gut«, sagte Lively. »Rufen Sie uns an, wenn Sie mit der Obduktion fertig sind, wir schauen schon mal die Vermisstenlisten durch. Todesursache war der Schlag auf den Kopf, ja?«
»Da würde ich keine voreiligen Schlüsse ziehen.« Carlisle zog das Tuch über die Leiche und streifte die Handschuhe ab. »Er könnte danach durchaus noch gelebt haben.«
»Ach du Scheiße«, murmelte Lively.
»Das heißt, er wurde womöglich noch lebendig unter diesem Busch begraben?«, fragte Salter leise.
»Ich fürchte, ja. Aber vom Lungengewebe ist so wenig übrig, dass ich das wahrscheinlich nicht genau bestimmen kann.«
»Sie meinen also, er bekam eins übergebraten, wurde in ein improvisiertes Grab unter den Busch dort gezerrt, mit Erde und Laub bedeckt und liegen gelassen, bis er erstickte?«, fasste Lively zusammen. »Das hätte die arme Sau sich morgens beim Frühstück nicht träumen lassen, was?«
Kapitel 5
10. Mai
Salter saß an ihrem Schreibtisch und fragte sich, ob ihre Entscheidung richtig gewesen war. Sie hatte ihre süße kleine Adoptivtochter zu einer Tagesmutter gegeben, um schneller wieder ins Arbeitsleben zurückkehren zu können. Egal wie oft sie sich sagte, dass es ihrer Tochter guttun würde, andere Menschen um sich zu haben und vom Schwimmkurs bis zum Frühballett lauter schöne Dinge machen zu können, fühlten sich jene langen Nachmittage mit einem schlafenden Kind auf dem Bauch doch noch immer an wie der beste Traum, den sie je hatte.
Jetzt lagen vor ihr Bilder von Insektenlarven, ein Bodengutachten und eine Liste von Geschäften, die Outdoorschuhe führten. Sie gähnte zum hundertsten Mal an diesem Morgen und streckte sich, als Lively in Jogginghosen, einem ehemals weißen T-Shirt und Laufschuhen keuchend in den Besprechungsraum getorkelt kam, kaum fähig, sich auf den Beinen zu halten.
»Einen Arzt, einen Arzt«, rief jemand aus dem Team und wurde mit Applaus belohnt.
»Defibrillator!«, schloss sich jemand an. »Schnell!«
Lively richtete sich mit Mühe auf, wischte sich den Schweiß aus den Augen und knurrte in die Runde.
»Ihr wisst, dass eure Freundinnen allesamt zu mir kommen, wenn sie Sexberatung brauchen, ja?«
Die Frauen im Raum verzogen das Gesicht und verkniffen sich ein Würgen, die Männer lachten.
»Okay, es reicht«, rief Salter. »Zurück an die Arbeit. Und Sie unter die Dusche, Sarge, oder muss ich Ihnen erst erklären, wie das mit der Hitzeregulierung des Körpers funktioniert?«
Lively schnupperte an einer seiner Armbeugen und rümpfte die Nase.
»Fünf Minuten, ja?«
Eine Viertelstunde später kam er mit einem schwarzen Kaffee in der Hand zurück. Bei jedem Schluck verzog er das Gesicht.
Salter grinste. »Ohne Milch und Zucker? Ich bin beeindruckt. Haben Sie Ihr Leben geändert?«
»Nur ein bisschen Richtung gesünder. Man weiß nie, ob nicht vielleicht mal ein Stresstest kommt, also körperlich gesehen. Mein Ruhepuls war in letzter Zeit nicht so niedrig wie früher.«
»Gute Sache. Irgendein besonderer Grund, weshalb Sie gerade jetzt damit anfangen?« Sie versuchte, ein Grinsen zu unterdrücken – vergebens. »Jetzt nach dem Duschen hab ich nämlich den Eindruck, als wären Ihre Haare ein bisschen dunkler als gestern noch.«
Lively schnaubte. »Ist das alles, was Sie heute an Ermittlungsarbeit zu leisten gedenken, oder versuchen wir, wenigstens in einem der beiden Mordfälle in unserem Revier weiterzukommen, bevor der Superintendent den nächsten Tobsuchtsanfall kriegt?«
Salter hob in gespielter Kapitulation die Hände.
»Schon gut. Will nur sagen, wenn Sie zufällig mal Rat in Sachen Frauen oder romantische Verabredung oder so brauchen sollten, fragen Sie nur. Ich werde mich auch nicht lustig machen.«
Lively kreuzte die Arme und lehnte sich zurück, die Lippen fest geschlossen.
»Na gut, ich gebe auf. Aber denken Sie daran, heutzutage herrschen in Sachen Körperpflege höhere Ansprüche als in den Neunzehnhundertachtzigern.« Sie nahm ihre eigene Kaffeetasse. »Übrigens, Ihr niedergestochener Obdachloser ist identifiziert. Archie Bass heißt er, ist in der Szene gut bekannt. Chronischer Alkoholiker, aber von anderen Drogen ist er wohl wieder weggekommen. Lebte seit Jahren auf der Straße, nur im Winter ging er ins Obdachlosenheim. Eine ehrenamtliche Helferin der Suppenküche hat ihn auf dem Foto erkannt, das wir rumgezeigt haben. Ich denke, entweder hat er sich mit jemandem in die Haare gekriegt, oder da draußen läuft wieder mal ein Psycho herum, der seine Triebe an Leuten auslebt, die er für wertlos hält. Wollen Sie mit, Aussagen aufnehmen? Ich hab Infos darüber, wo er üblicherweise abhing, und die Namen von ein paar seiner Saufkumpane.«
»Ich bin eigentlich, äh, also, ich treffe mich mit der Chirurgin, die ihn operiert hat, in der Leichenhalle. Sie hat angeboten, uns zu erläutern, was sie gemacht hat, um, na ja, einfach zur Sicherheit und so.«
Salter holte tief Luft und faltete die Hände im Schoß.
»Sie stottern ein bisschen mehr herum als sonst. Und wenn ich so darüber nachdenke, kann ich mich nicht erinnern, wann ich Sie zuletzt in einem Hemd gesehen habe. Und das hier sieht sogar gebügelt aus. Sie treffen sich jetzt also mit dieser Chirurgin, ja?«
»Ja, genau. Ich bin schon spät dran. Übrigens, heute Abend bei der Lagebesprechung verkneifen Sie sich bitte das blöde Gefasel. Wenn ich Ihnen all diese Fragen stellen würde, säße ich ratzfatz vor einer Disziplinarkommission wegen sexueller Belästigung.« Er stand auf und strich sich die Hose glatt.
Salters Lächeln war aufrichtig. »Also, wenn Sie mich fragen, Sie sehen sehr gut aus. Und ich will Sie ganz bestimmt nicht sexuell belästigen. Dafür werde ich nicht gut genug bezahlt.«
»Na, danke auch. Übrigens, erkundigen Sie sich, wie Archies Messer aussah. Lassen Sie es sich so gut beschreiben wie nur möglich.«
»Archies Messer?«
»Aye. Wer länger auf der Straße lebt, hat immer was dabei, um sich zu verteidigen. Sonst ist es da draußen zu gefährlich.«
Kapitel 6
DER BEOBACHTER
12. Mai
Aus dem Auto heraus, das er mit einem falschen, über das Internet bestellten Führerschein gemietet hatte, beobachtete er die Einfahrt zum Personalparkhaus des St. Columba Hospital. Er durfte sich nicht ablenken lassen oder auch nur kurz den Blick abwenden. Vorbei waren die Zeiten, als man vor der Schranke anhalten musste. Die neue Klinik war mit allen Schikanen ausgestattet. Dank Nummernschilderkennung würde die Frau, die er zu Gesicht zu bekommen hoffte, ungehindert hineinfahren, ihren Wagen auf einer der Ebenen abstellen und durch einen Verbindungsflur, zu dem er keinen Zugang hatte, vom Parkhaus direkt ins Gebäude gehen. Vor ein paar Jahren noch war alles so einfach gewesen. Heutzutage war die Zwei-Faktor-Authentisierung gang und gäbe, um sich in soziale Medien oder Mailaccounts einzuloggen, Laptops wurden durch Fingerabdruck entsperrt, und Sicherheitssysteme hatten Gesichtserkennung. Bei so viel Technologie machte das Stalken gar keinen Spaß mehr.
Sein Ziel fuhr einen Tesla. Modelle wie diese waren so leise, dass er inzwischen möglichst nur noch E-Autos mietete. Damit konnte man, wie er festgestellt hatte, einer Person, die zu Fuß unterwegs war, mit nur wenigen Metern Abstand folgen. Solange diese in Gedanken woanders war, merkte sie es überhaupt nicht, es sei denn, sie drehte sich zufällig um.
Da kam sie. Sie fuhr ganz langsam über das Klinikgelände, bestimmt aus Respekt gegenüber den Senioren, die hier ein und aus gingen im endlosen Bemühen, ihr nutzloses Leben zu verlängern, und aus Rücksicht auf die Schwerhörigen und Blinden und wer immer sonst mit Tatütata in diese von Steuergeldern bezahlte Einrichtung kutschiert wurde.
Er rutschte etwas tiefer in den Sitz, trotz der Baseballkappe und der Tatsache, dass er sich kürzlich den Kopf rasiert und außerdem beigebracht hatte, sein Gesicht mittels Schminke zu verfremden. Vor nicht mal einer Woche war es ihm gelungen, im Klinikcafé am Tisch neben ihrem zu sitzen, während sie sich mit einem Mann unterhielt, von dem schnell klar war, dass es sich um einen Polizeibeamten handelte. Unter den gegebenen Umständen war das nicht nur kühn, sondern geradezu ungeheuerlich. Es hatte ihm überhaupt nicht gefallen, wie freundschaftlich die beiden miteinander umgingen. Viel verstanden hatte er von ihrem Gespräch nicht, da um ihn herum mit Tassen geklappert und nach der Bedienung gerufen wurde, aber am Ende hatte es den Anschein gehabt, als verfiele Dr. Waterfall sogar ins Flirten, und der Polizist schmachtete sie geradezu an. Das war ihm gar nicht recht. Überhaupt nicht.
Falls in Beths Leben ein Polizeibeamter Einzug hielt, wäre es schwerer für ihn, nahe an sie heranzukommen, doch genau das war entscheidend. Um Pläne zu schmieden, musste er ihren Tagesablauf möglichst genau kennen, ihre Vorlieben, was sie erfreute und was sie ärgerte. Denn früher oder später würde er wirklich etwas unternehmen müssen, was sie betraf. Aber schon ihr nachzuspionieren, unbeachtet in einem Korridor an ihr vorbeizugehen oder ihr im Supermarkt irgendetwas Unwichtiges aus der Handtasche zu stehlen, half, seinen Zorn zu kontrollieren. In ihr Haus einzubrechen und sich unter ihre kühle Bettdecke mit dem Baumwollbezug zu legen, war noch besser.
Zorn, das wusste er inzwischen, war so viel mehr als bloße Wut. Wahrer Zorn war im Kern eiskalt, ein komplexes Gebilde, Eschers Relativity viel ähnlicher als Dantes Inferno. Es war unmöglich, sich von ihm freizumachen, weil seine Gravitationskraft einem Schwarzen Loch glich. Er musste diesen Zorn irgendwo loswerden, und die Besuche an ihrer Arbeitsstelle trugen entscheidend dazu bei.
Andererseits musste er zugeben, dass er das Klinikum mochte. Die Menschen, die er hier sah, waren schwach, und dadurch fühlte er sich stark. Die Sorgen anderer Leute mitanzusehen, gab ihm das Gefühl, menschlicher zu sein. Und das Beste war, dass er bei all der Geschäftigkeit um ihn herum nicht ins Grübeln kam.
Sein täglicher Kopfschmerz flammte auf, und er zuckte zusammen. Der Schmerz war ihm vertraut, nur die Übelkeit, die damit einherging, machte ihm zu schaffen. Die Medikamente, die er Tag für Tag schluckte, griffen seinen Magen immer mehr an. Doch ohne sie würde der Schmerz ihn ans Bett fesseln, ihn an der Arbeit mit dem Computer hindern. Er musste in der Lage bleiben, sich in sein Aktiendepot einzuloggen. Allein die Anteile, die er sich von der Lebensversicherung seiner Mutter gekauft hatte – geringes Risiko, stabile Rendite –, ermöglichten ihm seine Lebensführung. Das Pflegegeld für seinen Vater hätte nicht einmal gereicht, um die laufenden Kosten zu decken. Aber so musste er nicht ins Büro, hatte keinen Chef, keine geregelten Arbeitszeiten. Er konnte sich seine Zeit ziemlich frei einteilen, vorausgesetzt, er behielt die Marktentwicklung im Blick und richtete sein Portfolio entsprechend aus.
Wo er gerade an seinen Vater dachte: Er sollte sich langsam auf den Weg zurück zu ihm machen. Beth war ohnehin längst nach drinnen gegangen. Er musste zu Hause Dinge erledigen, bis die Pflegerin kam. Er hatte beschlossen, sich übers Darknet noch ein Deepfake-Video zu bestellen. Das hatte er schon einmal gemacht und gestaunt, wie einfach und günstig das war. Später, wenn er seine Haushaltspflichten erledigt hatte, würde er zum Haus der guten Frau Doktor fahren. Längst hatte er herausgefunden, wie er die Überwachungskameras umgehen konnte, die zwar den Bereich um Vorder- und Hintertür, aber nicht den gesamten Garten und den Wintergarten abdeckten. Die Alarmanlage auszuschalten, war viel leichter, als man glauben sollte, man musste lediglich bereit sein, sich alles über die Funktionsweise der Systeme anzueignen, die gerade am beliebtesten waren. Hereinkommen würde er mit den Dietrichen, mit denen er geübt hatte. Und dann etwas in der Wohnung umstellen, mitnehmen oder zurücklassen.
An manchen Tagen langweilte ihn sogar das, ja, gelegentlich kam es ihm vor wie eine gewöhnliche Arbeit. Früher, vor dem Tod seiner Mutter und dem Schlaganfall seines Vaters, hatte er durchaus einige Jobs gehabt. Er war ja nicht dumm. Gut, zum Chirurgen wie Dr. Beth Waterfall hätte er es vielleicht nicht gebracht, aber er lernte schnell und hatte einige Kenntnisse.
Vor allem aber hatte er eine Rechnung zu begleichen. Oder besser: mehrere Rechnungen.
Sie geriet immer mehr ins Trudeln, verlor sich tagtäglich etwas mehr, und da er schon ihre Tochter genommen hatte, sollte sie eigentlich nicht mehr viel zu verlieren haben. Er würde mit ihr abrechnen. Aber jetzt noch nicht.
Noch wollte er mit ihr spielen.
Kapitel 7
20. Mai
Das Auto schien ihr zu folgen. Divya Singh kam es so vor, als wäre es der Wagen, in den sie auf dem Parkplatz des Supermarkts hineingespäht hatte, aber im Dunkeln war sie sich nicht sicher. Er hatte dieselbe Farbe und etwa dieselbe Größe – auf Marken und Modelle achtete sie nicht sonderlich.
Sie war auf der Suche nach jemandem gewesen, den sie nach der nächsten Bushaltestelle fragen konnte. Seit der große Wohnblock fertiggestellt worden war, war die Busroute eine andere, und sie hatte nicht gewusst, wie sie an ihr Ziel gelangen sollte. Da sie wegen der getönten Scheiben und dem Licht der Straßenlampen nicht sehen konnte, ob jemand im Wagen saß, hatte sie sich wieder zurückgezogen und beschlossen, die drei Kilometer nach Hause zu laufen. Ihre Einkäufe waren nicht allzu schwer, und ausnahmsweise einmal regnete es nicht.
Auch nach fünfzig Jahren in Schottland fand sie die Kälte und den grauen Himmel immer noch unerträglich. Damals, als ihr künftiger Ehemann von Schottland nach Neu-Delhi gekommen war, um sie abzuholen, hatte sie die Aussicht auf ein besseres Leben und Frieden zwischen ihren Familien gereizt, genau wie ihre Eltern der Gedanke, dass ihre zwanzigjährige Tochter einen Büroangestellten heiraten würde, der ihnen einen Teil seines Gehalts für ihre Altersvorsorge schicken würde.
Während der Hochzeitsvorbereitungen war Schottland für sie nicht mehr als ein traumartiges fernes Land gewesen, und während der Flitterwochen im Sommer hatte sie die faszinierende Schönheit Edinburghs, die Freundlichkeit der Glasgower und die wilde Freiheit der Landschaft liebgewonnen. Doch dann hatte es angefangen zu regnen und schien bis auf den ein oder anderen seltenen Sonnentag nie wieder aufgehört zu haben. Sie fragte sich, ob sie ihren Mann jemals würde überreden können, den Rest ihres Lebens in Indien zu verbringen, wo die Arthritis in ihren Händen und Füßen vielleicht etwas weniger schmerzen und sie endlich wieder blauen Himmel sehen würde, nun ja, abgesehen vom Smog der Städte. Aber die Verwandtschaft ihres Mannes wohnte in Dundee, und Divya war klar, dass die Chance, je wieder die Straßen von Delhi zu sehen, mit jedem Monat kleiner wurde.
Das Auto fuhr jetzt genau hinter ihr. Divya wünschte, sie hätte sich doch einmal beigebracht, wie man so ein schreckliches Mobiltelefon benutzte. Genau jetzt war ihr Mann mit Freunden in Frankreich bei irgendeinem Sportereignis, ihr Sohn war in London, wo er von früh bis spät arbeitete, um seinen drei Kindern das Studium zu finanzieren, und sie ging ganz allein eine dieser Straßen entlang, an der die Häuser hinter hohen Hecken verborgen waren, damit die Bewohner nur ja keinen Blick auf die echte Welt jenseits ihrer Vorgärten werfen mussten.
Vielleicht suchte die Person im Auto nur nach dem Weg? Es war durchaus möglich, dass sie mit der neuen Verkehrsregelung nicht vertraut war. Wenn Divya stehen bliebe und sich umdrehte, würde das Auto vielleicht neben ihr halten, und die Person darin würde mit ihr sprechen.
Nein, sagte ihr eine innere Stimme. Tu das nicht. Du weißt, dass es nicht so ist. Geh weiter. Oder noch besser: biege in einen dieser hübschen Vorgärten ab, klingle und erkläre, dass du dich verirrt hast und dich verfolgt fühlst. Sicher wird dir jemand helfen. Die meisten Menschen sind nett.
Doch leider war das nach Divyas Erfahrung nicht unbedingt der Fall. Von Indien nach Schottland zu ziehen, war eine wahre Feuertaufe gewesen, und Leute, die glaubten, Rassismus sei kein Thema mehr, wussten nicht, was es bedeutete, einer Minderheit anzugehören. Meist waren es Jugendliche, die ihr Beleidigungen nachriefen oder ins Gesicht sagten, aber sie hatte auch erlebt, wie Mütter anderer Kinder vor dem Schultor miteinander über sie getuschelt hatten, sie vom Elternbrunch ausgeschlossen und ihren Sohn nicht zum Geburtstag ihres Kindes eingeladen hatten. Oder dieser Hausarzt, der sie endlos über ihre Körperhygiene und ihr Sexualleben ausgefragt hatte, als hätte er eine unerforschte Tierart vor sich. Der Nachbar, der nach zehn Jahren immer noch nicht ihren Namen kannte. Die Bank, in der man sie auffallend weniger höflich und freundlich angesprochen hatte als andere Kunden. Und immer wieder gab es Leute, die jede nicht weiße Person für kriminell hielten. Sie war schon angespuckt worden. Ihr Sohn verprügelt. Nein, Divya wollte nicht bei fremden Leuten klingeln.
Außerdem hatte sich das Problem inzwischen erledigt. Das Auto, das ihr gefolgt war, hatte am Straßenrand geparkt, und sie war nun ein ganzes Stück voraus. Offenbar hatte die Fahrerin oder der Fahrer nach einer bestimmten Adresse gesucht. Die Namen der Häuser waren nicht immer gut zu lesen (so etwas wie schnöde Hausnummern gab es an dieser Straße nicht). Divya bog in eine Querstraße ein, die sogar noch verlassener war, die Grundstücke riesig und die wenigen Häuser weit von der Straße entfernt hinter Bäumen verborgen. Sie stieß den Atem aus, den sie angehalten hatte; in der kalten Abendluft wurde daraus eine dramatische Dampfwolke. Selbst im Mai konnte es in Schottland noch kalt sein. Sie hätte Handschuhe mitnehmen sollen. Die Einkaufstaschen schnitten ihr in die Hände, und ihre Schultern schmerzten.
Während die Anspannung von ihr abfiel, erkannte Divya, wo sie war. In dem Haus dort vorn war sie einmal bei einem Treffen des Organisationskomitees für die Schulabschlussfeier gewesen. Sie hatte sich für das Dekorationsteam eingetragen, weil ihr Sohn sie gedrängt hatte, doch mitzumachen. Sie hatte gleich gewusst, wie es laufen würde in solchen Teams, deren übrige Mitglieder schon befreundet waren und durch Insiderwitze und verstohlene Blicke zu erkennen gaben, dass sie eigentlich niemanden sonst dabeihaben wollten. Es war keine schöne Erinnerung, und sie schämte sich ihrer negativen Gedanken. Für ihren Mann und den Sohn war Schottland gut gewesen, und als Familie hatten sie immer komfortabel leben können, wenngleich es für den Aufstieg ihres Mannes in der Firmenhierarchie eine natürliche Grenze zu geben schien. Ihr Sohn hingegen war in eine neue Zeit hineingewachsen, unbehindert von seiner Hautfarbe und frei von dem Akzent, den sie von der anderen Seite der Weltkugel mitgebracht hatte. Dass er Sport trieb, verhalf ihm zu einem soliden Freundeskreis, der auch Mädchen anzog. Edinburgh hatte er zwar gemocht, aber mit achtzehn hatte es ihn nach London gezogen. Er war auf die London School of Economics gegangen und nie zurückgekehrt.
Sie sah ihre Enkelkinder nicht allzu oft, aber sie konnte sich nicht beschweren. Ihre eigenen Eltern hatten ihren Enkel ebenfalls kaum gesehen. Das war nun mal der Preis für den Aufstieg der jeweils nachfolgenden Generation. Immerhin schickte die Frau seines Sohnes regelmäßig Fotos. In Divyas Wohnung gab es kein Regal und kein Fensterbrett, auf dem nicht silbern gerahmte Fotos von den Enkelkindern standen, wie sie Schulpreise oder Zeugnisse in der Hand hielten, mit einer Sportmannschaft den Sieg feierten oder kostümiert auf einer Bühne standen. Auf den Fotos war kein Staubkörnchen zu entdecken, so oft hielt Divya sie in den Händen und betrachtete sie. Es wurde Zeit, dass sie wieder einmal zu Besuch nach London reiste. Ihr Sohn lud sie ständig ein, aber sie hatte Angst, ihm und seiner Frau Umstände zu …
Das Auto traf sie so unvermittelt, dass sie nicht einmal Zeit hatte, die Augen zu schließen, während sie durch die Luft flog. So kam es, dass Divya Singh noch sah, wie einer ihrer schmucklosen Halbschuhe in einen Baum segelte. Sie sah die gerade gekaufte Packung Küchenrolle über die Straße schießen wie eine Rakete. Sie sah, wie sich ihre Handtasche am Himmel über ihr öffnete und so viele kleine, kostbare Dinge herausfielen, jedes einen Moment lang im Scheinwerferlicht funkelnd, wunderschön, wie menschengemachte Sterne – ein Lippenstift, den ihre Enkelin ihr zu Weihnachten geschenkt und den sie sich nie getraut hatte aufzutragen, ein Taschenspiegel, der ihrer Mutter gehört hatte, ein Schlüsselanhänger in Form eines Umrisses von Indien, der ihr für ein so billiges Plastikding erstaunlich ans Herz gewachsen war. Sie spürte, wie ihr Arm, als gehörte er jemand ganz anderem, gegen ihr Gesicht knallte und ihr das Nasenbein brach, noch ehe sie auf dem Boden aufkam. Das Krachen ihres brechenden Beckens pflanzte sich donnernd wie ein Gewehrschuss ihre Wirbelsäule hinauf in ihr Bewusstsein fort. Und da ihr Kopf so heftig in den Nacken geschleudert wurde, dass sie, hätte sie überlebt, fortan querschnittsgelähmt gewesen wäre, sah sie den Boden unter sich aus der denkbar unnatürlichsten Perspektive.