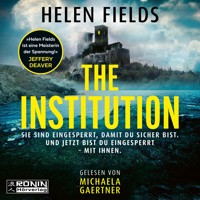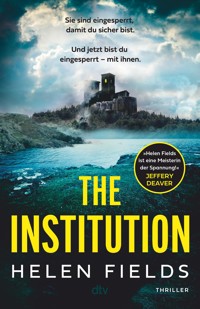9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Luc Callanach und Ava Turner
- Sprache: Deutsch
Bevor Stephen Berry von der Brücke in den Tod springen kann, rettet ihn eine Sozialarbeiterin. Eine Woche später ist Stephen dennoch tot. DI Luc Callanach und DCI Ava Turner müssen herausfinden, ob er gesprungen ist oder gestoßen wurde. Bald tauchen weitere Selbstmordopfer auf. Doch handelt es sich wirklich um die impulsiven Suizide, nach denen es aussehen soll? Oder um sorgfältig inszenierte Morde? Callanach und Turner ahnen nicht, wie nahe sie dem psychopatischen Killer sind, der mit jedem Mord an Selbstbewusstsein gewinnt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 616
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungKapitel einsKapitel zweiKapitel dreiKapitel vierKapitel fünfKapitel sechsKapitel siebenKapitel achtKapitel neunKapitel zehnKapitel elfKapitel zwölfKapitel dreizehnKapitel vierzehnKapitel fünfzehnKapitel sechzehnKapitel siebzehnKapitel achtzehnKapitel neunzehnKapitel zwanzigKapitel einundzwanzigKapitel zweiundzwanzigKapitel dreiundzwanzigKapitel vierundzwanzigKapitel fünfundzwanzigKapitel sechsundzwanzigKapitel siebenundzwanzigKapitel achtundzwanzigKapitel neunundzwanzigKapitel dreißigKapitel einunddreißigKapitel zweiunddreißigKapitel dreiunddreißigKapitel vierunddreißigKapitel fünfunddreißigKapitel sechsunddreißigKapitel siebenunddreißigKapitel achtunddreißigKapitel neununddreißigKapitel vierzigKapitel einundvierzigKapitel zweiundvierzigKapitel dreiundvierzigDanksagungÜber dieses Buch
Bevor Stephen Berry von der Brücke in den Tod springen kann, rettet ihn eine Sozialarbeiterin. Eine Woche später ist Stephen dennoch tot. DI Luc Callanach und DCI Ava Turner müssen herausfinden, ob er gesprungen ist oder gestoßen wurde. Bald tauchen weitere Selbstmordopfer auf. Doch handelt es sich wirklich um die impulsiven Suizide, nach denen es aussehen soll? Oder um sorgfältig inszenierte Morde? Callanach und Turner ahnen nicht, wie nahe sie dem psychopatischen Killer sind, der mit jedem Mord an Selbstbewusstsein gewinnt …
Über die Autorin
Helen Fields studierte Jura an der Universität von East Anglia in Norwich, lernte an der Inns of Court School of Law in London und arbeitete anschließend dreizehn Jahre als Anwältin. Nach der Geburt ihres zweiten Kindes widmete sie sich neuen Aufgaben und leitet heute mit ihrem Ehemann eine Filmproduktionsfirma. Sie arbeitet als Produzentin und Autorin für Drehbücher und Romane. DIE PERFEKTE GEFÄHRTIN ist ihr Debütroman. Fields lebt mit ihrem Ehemann und drei Kindern in Hampshire.
H E L E N F I E L D S
WO NIEMAND DICH RETTET
T h r i l l e r
Aus dem Englischen vonFrauke Meier
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2019 by Helen Fields
Titel der englischen Originalausgabe: »Perfect Crime«
Originalverlag: Avon, A division of HarperCollinsPublishers, London
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Alexander Groß, München
Umschlaggestaltung: Massimo Peter-Bille unter Verwendung von Motiven von © shutterstock.com: pupsy | schankz | Yeti studio
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-0354-3
luebbe.de
lesejury.de
Für meine Mum, Christine May Fields.
Mit gutem Beispiel vorangehen, durch harte Arbeit begeistern, liebevoll in Gesten, auch dann, wenn Worte schwer zu finden sind.
Kapitel eins
20. Februar
Es war eher unwahrscheinlich, dass von seinem Körper genug heil bliebe, um nach dem Sturz erneut verwendet zu werden, aber in einem letzten Akt des Optimismus hinterließ Stephen Berry am Straßenrand seinen Organspendeausweis unter dem Mobiltelefon, den Schlüsseln und der Brieftasche. Zwar würde er auf Wasser treffen, aber der Aufprall würde dennoch verheerend sein. Er würde schwere Quetschungen davontragen, vermutlich auch einen Hirnschaden, und sollte ihn die Wucht der Kollision mit dem Wasser nicht töten, dann würde die Temperatur das binnen Sekunden nachholen.
Er hatte seine Hausaufgaben gemacht. Wenn er von der Queensferry Crossing in den Fluss Forth stürzte, würde der Atem aus seinem Körper gepresst werden, die plötzliche Kälte würde ihn zum Keuchen bringen, und seine ganze Lunge würde sich mit Wasser füllen, ehe er Zeit hätte, an die Oberfläche zurückzukehren. Der Tod träte vielleicht nicht augenblicklich, aber doch ohne Zweifel schnell ein. Nichts, wovor man sich fürchten musste, sagte er sich. Furcht war lediglich eine Erwartungshaltung. Im entscheidenden Moment würde sein Gehirn sein Bewusstsein mit einer großen Dosis körpereigener Opiate fluten. Sollte er den Sturz überleben, würde er sich nicht daran erinnern können.
Das spektakulärste aller Gräber, Millionen Tonnen von Wasser, rauschte unter ihm dahin und forderte ihn heraus, zu ihm zu kommen. Ihm blieben nur ein paar Minuten, um es hinter sich zu bringen, und die Wahrheit lautete, dass er längst hätte zu klettern anfangen sollen. Nachdem er Spezialhandschuhe und Stiefel erworben hatte, die es ihm ermöglichen sollten, die Suizidpräventionsbarriere zu überwinden, gab es keine Ausrede mehr für seine Ambivalenz.
Als er das Taxi zu sich nach Hause bestellt hatte, war er bereit gewesen, es durchzuziehen. Der arme Fahrer hatte bereits eine Acht-Stunden-Schicht hinter sich und war auf dem Heimweg. Stephen hatte sich nur äußerst ungern das Messer an die eigene Halsschlagader gehalten und gedroht, sie durchzuschneiden, um den Fahrer zu zwingen, auf der Brücke zu halten – ein für Fußgänger strikt verbotener Bereich –, aber ihm war kein besserer Plan in den Sinn gekommen. Zumindest hatte er nicht den Fahrer mit dem Messer bedroht. Er hatte sich ein Dutzend Mal bei dem Mann entschuldigt, ehe der Wagen gehalten hatte, doch das würde das Trauma auch nicht lindern, das der Anblick der im Rückspiegel aufblitzenden Klinge bei ihm verursacht haben dürfte.
Er kletterte auf die leicht zu bewältigende lotrechte Absperrung und griff dann nach den scharfen Metallplatten, die gewährleisten sollten, dass niemand von der einen Seite auf die andere gelangte. Es tat ein bisschen weh, aber er war gut in Form. Physisch besser als psychisch, so viel stand wohl fest. Pro Tag eine Stunde im Fitnessstudio, das reichte ihm, um gut durchtrainiert zu sein, und eine Laufrunde zweimal pro Woche hatte sein Herz-Kreislauf-System fit gehalten. Wer ihn sah, merkte nichts von der bipolaren Störung, unter der er litt. Aber bei den Ermittlungen zu seinem Tod würde alles ans Tageslicht kommen. Sein lang andauernder Flirt mit Drogen, die geeignet waren, seine Stimmungen auszugleichen. Die Zeiten, in denen er seine Medikamente abgesetzt hatte, obwohl ihm ein Arzt nach dem anderen davon abgeraten hatte. Die Therapieversuche, nach denen er sich noch schwächer und jämmerlicher fühlte, als er es schon durch die Krankheit allein tat. Beziehungen, die dem Wüten seines hitzigen Charakters nicht standhalten konnten. Jobs, die er nicht so lange behalten hatte, wie er hätte sollen, weil er an manchen Tagen schon von der Vorstellung überfordert war, sich aus dem Bett zu bewegen.
Der Gerichtsmediziner würde annehmen, dass er sich mitten in einer schlechten Phase befunden hatte. Es würde Bedauern darüber geben, dass keine wirkungsvolleren Medikamente verfügbar waren oder dass er sich außerstande gefühlt hatte, sich an einen Freund zu wenden und um Hilfe zu bitten. Eine Überschrift in kleinen Lettern, irgendwo tief im Inneren der örtlichen Zeitung vergraben, würde die abgedroschene alte Wahrheit hervorkramen, der zufolge die Menschen einander zu wenig Achtsamkeit entgegenbrachten. Zwar hatte er sich entschieden, keinen Abschiedsbrief zu hinterlassen, um seinen Tod zu erklären, doch für einen Moment wünschte er sich, er könnte mit diesem albernen Trugschluss aufräumen. Auch die größte Achtsamkeit hätte ihn nicht davor bewahrt, an den Punkt zu kommen, an dem er heute war. Schon seit seinem fünfzehnten Lebensjahr hatte er gespürt, wie sein vorzeitiger Tod an ihm wie eine Kette zerrte. Die nächsten sechzehn Jahre hatte er damit zugebracht, gegen ihn anzukämpfen, aber heute würde er der Epilog zu seiner eigenen Geschichte werden.
Die Freundin, vor der er seine Krankheit so sorgsam hatte verbergen wollen, hatte am Ende doch erkannt, dass er ein wertloses Stück Scheiße war, das sie nur für den Rest ihres Lebens runterziehen würde, wenn sie bei ihm bliebe. Einer übertrieben langen Ansprache von der elenden Es-liegt-an-mir-nicht-an-dir-Sorte, auf die er gut hätte verzichten können, war eine unerträglich lange Zeit des Packens gefolgt. Es war nicht so wie in den Filmen, wo einer einfach einen Monolog hielt, dann eine Tür zuknallte und auf rätselhafte Weise für immer und ewig verschwand.
Er und Rosa hatten ein Jahr zusammengelebt, und es war bemerkenswert, welche Komplexität die Struktur zweier miteinander verwobener Leben in zwölf kurzen Monaten annehmen konnte. Töpfe und Pfannen, Bilder, Dekor, Bücher, scheiße noch mal, sogar Verlängerungskabel. Sie hatten sich darüber gestritten, wer das Verlängerungskabel am Bett gekauft hatte. Nicht – das wäre ja albern – wegen der Kosten, sondern aus Fairness. Sie wollte sich erinnern, damit sie nicht später irgendwann erkennen musste, dass sie sich etwas unberechtigt angeeignet hatte. Miststück. Selbst am verdammten Ende der Beziehung konnte sie ihn nicht dadurch befreien, dass sie selbstsüchtig und unfair war. Wie fies war das denn? Sie war so ein guter Mensch, dass die Schuld – wie immer – allein bei ihm lag. Bei seinen Stimmungen, seinen Bedürfnissen, seiner gespaltenen, gebrochenen Psyche.
Ein vorüberfahrender Wagen hupte langanhaltend, und jemand brüllte etwas aus dem Fenster. Der Wind verschluckte die Worte, was ihm nur recht war. Es gab Zeiten, zu denen der Rest der Menschheit sich einfach rauszuhalten hatte, und die sechzig Sekunden vor dem Selbstmord gehörten eindeutig dazu. Er kletterte einen Schritt höher, als ihn plötzlich mit absoluter Klarheit eine Erinnerung durchzuckte und ihm verriet, dass er das Verlängerungskabel für Rosa gekauft hatte, als er ihr einen neuen Fön besorgt hatte. Er hatte sofort erkannt, dass das Kabel nicht bis zu ihrem Frisiertisch und an der Rückwand entlang reichen würde, also hatte er die Verlängerungsschnur als funktionelles Extra mit auf die Weihnachtsliste geschrieben.
»Ach, um Himmels willen«, murmelte er. Das Kabel steckte immer noch in der Wandsteckdose. Ein dummes Relikt aus einem guten Abschnitt seines Daseins, in dem es ihm gelungen war, aufmerksam zu sein und sein Leben ganze vier Monate am Stück außerhalb der Fallstricke seines eigenen Geistes zu führen. Für eine Sekunde dachte er daran, Rosa anzurufen und ihr die Geschichte der Verlängerungsschnur ins Gedächtnis zu rufen. Sie sollte sie beanspruchen, wenn die Wohnung ausgeräumt wurde. Aber dann würde er erklären müssen, wo er war und was er vorhatte, und sie könnte es ihm ausreden. Rosa wäre der einzige Mensch, der das konnte. Zu spät, dachte er. Es war schließlich nur ein Verlängerungskabel. Die verschlagene Schlange von einem Gehirn hatte einfach diesen Moment für den Versuch gewählt, es in eine Rettungsleine zu verwandeln.
Andere Fahrzeuge hupten, als er den letzten Schritt aufwärts und über das Geländer tat. Schwankend stand er in dem stürmischen Wind. Autos hielten, bildeten eine inoffizielle Barriere. Türen wurden zugeschlagen. Langsam drehte Stephen sich um. Ein Halbkreis aus Menschen hatte sich mehrere Meter von ihm entfernt zusammengefunden. Er war nicht sicher, ob sie so viel Abstand hielten, weil sie dachten, er könnte einen von ihnen packen und mitnehmen, oder weil sie fürchteten, sie könnten ihn nur umso schneller zum Sprung treiben, wenn sie näher herankämen.
Am Ende schob sich ein Mann zwischen zwei anderen Zuschauern hindurch, die Hände in den Taschen vergraben, lässig-locker wie du und ich, und schlenderte herbei, um sich direkt unter ihm an der Brüstung aufzubauen.
»Ist es okay, wenn ich hier stehe und mit Ihnen rede?«, fragte er.
»Bringt nicht viel«, murmelte Stephen. »Sie sollten vielleicht ein Stück zurücktreten.«
»Warum?«, wollte der Mann wissen.
»Ich werde springen, und ich will nicht, dass Sie sich verantwortlich fühlen. Außer mir sollte niemand etwas damit zu tun haben.«
»Das ist wirklich rücksichtsvoll von Ihnen …« Der Mann ließ den Satz für einen Moment in der Luft hängen. »Das ist die Stelle, an der Sie Ihren Namen hätten hinzufügen müssen«, erklärte er dann, als er keine Reaktion erhielt.
»Oh, tut mir leid«, murmelte Stephen und kam sich dumm und ungehobelt vor. »Stephen.«
Er hatte keine Ahnung, warum er sich verpflichtet fühlte, in so einem lebensentscheidenden Moment sozialen Gepflogenheiten nachzukommen. Jahrelange Konditionierung, nahm er an.
»Cool. Nett, Sie kennenzulernen, Stephen. Ich bin Rune Maclure.« Sirenengeheul hallte über das Wasser. »Das dürfte die Polizei sein. Sind Sie bereit, mit denen zu reden, oder soll ich sie bitten, ebenfalls zurückzubleiben?«
»Halten Sie sie fern von mir«, sagte Stephen, atmete ein paarmal tief durch und konzentrierte sich auf den Fluss. Das Muster der Wellen machte ihn schwindelig, aber vielleicht lag es auch am Adrenalin. Wie dem auch sei, er war nicht überzeugt, dass er sich noch lange würde aufrecht halten können.
»Fühlen Sie sich wackelig?«, fragte Maclure.
Er antwortete nicht.
»Entspannen Sie ein Bein, bis Sie wieder im Gleichgewicht sind. Ist das hier unten Ihr Zeug?«
»Ja«, brummte Stephen.
Maclure bückte sich, um die Sachen aufzuheben, steckte Schlüssel und Mobiltelefon ein, hielt die Brieftasche in der Hand und betrachtete den Organspendeausweis. »Hey, Mann, Sie wollen Spender sein? Das ist toll. Diese Möglichkeit nehmen viel zu wenig Leute wahr. Nicht zu fassen, dass Sie noch an andere Menschen denken, während es Ihnen so mies geht. Das ist ziemlich beeindruckend.«
Stephen starrte ihn an. Der Trick, ein Bein zu entspannen, hatte funktioniert. Er stand wieder sicher auf den Füßen.
»Hat vermutlich eh keinen Sinn. Wahrscheinlich finden die nicht mal meine Leiche.«
»Das wäre eine Schande. Sie sehen aus, als wären Sie gut in Form. Viele Leute könnten von diesen Organen profitieren. Es ist erstaunlich, was man heutzutage alles transplantieren kann. Die Stelle, an der sie einen fragen, ob man seine Augen spenden will, haut mich immer um. Wie merkwürdig muss das sein, wenn man nach so einer Operation aufwacht, in den Spiegel guckt und sich selbst durch die Augen eines anderen sieht? Wirklich unglaublich.«
Durch die zunehmende Menge schoben sich allmählich vier Polizisten, die in ihre Funkgeräte flüsterten und Leute zurückdrängten, fort von einem Bereich, von dem Stephen annahm, dass sie ihn schon jetzt als »Tatort« bezeichneten. Er hasste das. So ein Drama zu veranstalten. Und in dessen Mittelpunkt zu stehen. Alles, was er immer gewollt hatte, war, mit der Menge zu verschmelzen.
»Machen Sie sich keine Gedanken, ich kriege das schon hin«, sagte Maclure und reckte die Hände zu einer Geste hoch, die absolut gelassen sagte, ganz ruhig, ich habe alles im Griff. Dann entfernte er sich, um mit der Polizistin zu sprechen, die ihm am nächsten war. Er begrüßte sie mit Handschlag.
Stephen sah ihm nach und fragte sich, warum Maclure so entspannt wirkte. Wenn jemand, der nur Sekunden von einem Selbstmord entfernt war, vor ihm gestanden hätte, wäre er außer sich gewesen. Aber Maclure hatte nicht einmal seine Schultern hochgezogen. Seine Stimme war so leise, dass sie kaum zu hören war. Nichts an ihm deutete auf eine Notlage oder irgendwelche Hektik hin. Dieser Mann, dachte Stephen, war garantiert nicht bipolar. Er selbst war während seiner ganzen verdammten Existenz nicht eine Sekunde lang so entspannt oder selbstsicher gewesen.
»Sie lassen uns ein bisschen Raum, wenn Sie mir nur einen Riesengefallen tun könnten und ihre Beine wieder auf diese Seite des Geländers bringen würden. Sie müssen nicht runterklettern, Sie haben jedes Recht, zu tun, was immer Sie wollen. Bleiben Sie ruhig da oben, aber ich wüsste gern, was ich mit Ihren Sachen machen soll. Können Sie noch eine Minute für mich erübrigen?«
Stephen rieb sich die Augen. Noch eine Minute? Er war auf die Brücke gekommen, um das Leiden zu beenden, nicht, um es zu verlängern.
»Es muss doch jemanden geben, der wissen wollen würde, was aus Ihnen geworden ist. Haben Sie einen Abschiedsbrief hinterlassen, damit Ihre Hinterbliebenen verstehen, wie es Ihnen ergangen ist? Wenn Sie das getan haben, ist das toll. Sie können mir die Adresse geben, und ich sorge dafür, dass sie ihn bekommen. Wenn nicht, nennen Sie mir einen Namen und eine Telefonnummer. Dann sage ich ihnen, dass Sie mit ihrer Entscheidung im Reinen und bei Verstand waren und dass Sie keine Angst hatten. Das wird es dem, wen immer Sie zurücklassen, leichter machen.«
»Warum denken Sie, ich hätte keine Angst?«, platzte Stephen heraus. Die Absurdität dieser Andeutung traf ihn härter, als ihm lieb war.
Selbstmord war nicht einfach. Das war nichts, was man einfach so aus einer Laune heraus tat. Natürlich hatte er Angst.
»Das tut mir leid. Sie wirken nur so … Mann, der Gedanke, dass Sie da oben so empfinden, gefällt mir gar nicht. Hören Sie, ich kann die Polizei nicht länger als eine Minute hinhalten, und ich möchte wirklich gern wissen, was mit Ihnen los ist. Kommen Sie einfach wieder auf diese Seite, solange wir uns unterhalten. Wenn Sie es nicht für sich tun wollen, dann vielleicht für mich? Sie scheinen ein toller Kerl zu sein. Wer sonst hätte einen Organspendeausweis hinterlassen, wenn er vorhat, sich umzubringen?«
Stephen überdachte seine Möglichkeiten. Ihm blieb wohl nur zu springen oder einen Schritt zurückzutreten und mit dem Mann zu reden. Und vielleicht würde Rosa ja gern ein paar letzte Worte von ihm hören. Ihre Trennung war noch so frisch, dass sie sich bestimmt verantwortlich fühlen würde. Wenn er sonst schon nichts tat, konnte er ihr wenigstens etwas Gewissheit verschaffen, dass er, Trennung hin oder her, auf jeden Fall an diesen Punkt gekommen wäre. Der Gedanke, sie könnte sich ihr Leben lang Vorwürfe machen, war unerträglich. Er mochte ja im Oberstübchen völlig verkorkst sein, aber er war nicht grausam.
Maclure stand da, wirkte nach wie vor lässig, hatte die Hände wieder in die Taschen geschoben und schien so unaufgeregt, als würde er lediglich auf den Bus warten.
Stephen verlagerte ein Bein über den oberen Rand des Geländers zurück auf die andere Seite, sehr zur Freude der Menge, die in Jubel ausbrach, als befände sie sich in einem Stadion. Wie sich herausstellte, war Selbstmord ein Zuschauersport. Wer hätte das gedacht?
»Gut gemacht!«, lobte Maclure und wedelte mit der Hand vage in Richtung der Polizisten. »Rauchen Sie?«
»Nein«, sagte Stephen.
»Ich auch nicht. Ich schätze, es ist Standard, jemandem in Ihrer Situation eine Zigarette anzubieten, was?«
»Schätze schon«, antwortete Stephen.
Es war wirklich lachhaft, so eine hirnverbrannte Unterhaltung zu führen, während er auf der Suizidpräventionsbarriere einer Brücke stand.
»Also, können Sie mir sagen, aus welchem Grund Sie das tun wollen? Das dürfte das sein, was alle, die es interessieren könnte, fragen werden. Nicht, dass es einen Grund geben muss. Mir ist schon klar, dass es manchmal auch einfach nur auf einem Gefühl beruht.«
Stephen dachte darüber nach. Die Wahrheit lag irgendwo dazwischen. Der Wille zu leben entglitt ihm seit einer Weile jeden Tag, und auf lange Sicht hatte er schlicht keine Hoffnung, dass seine bipolare Störung je wirkungsvoll behandelt werden könnte. Er sah den Mann an, der ihm all diese Fragen stellte. Gut aussehend, athletisch, schwarz, schlank, leichter Bartwuchs, der das kantige Kinn noch mehr betonte. Die Art Mensch, die man zugleich hasste und selbst sein wollte.
»Ich bin bipolar«, lautete die Antwort, für die Stephen sich schließlich entschied.
Maclure nickte. »Das ist hart. Und durch die Behandlung fühlt man sich an guten Tagen wie Scheiße, und dann hört man auf, die Medikamente zu nehmen, und all die guten Tage werden zu schlechten Tagen. Kommt das ungefähr hin?«
»So in der Art.«
Doch die Wahrheit lautete, es war exakt so, und wenn es ihn auch ärgerte, er selbst hätte das nie derart kurz und prägnant ausdrücken können, obwohl er derjenige war, der damit lebte.
»Aber Sie sind immer noch am Leben. Sie kriegen es hin. Sie haben ein Mobiltelefon, was bedeutet, Sie haben Kontakt zu Menschen. Das ist ein guter Anfang. Diese Brieftasche ist ziemlich dick, was heißt, Sie führen ein ziemlich normales Leben – Kreditkarten, Banknoten, Führerschein, schätze ich. Sie können sich Bares verschaffen. Sie sind nicht zu einem Leben auf der Straße gezwungen. Ziemlich bewundernswert, wenn man bedenkt, was Sie durchmachen. Eine Menge Leute in Ihrer Lage sind nicht fähig, innerhalb der üblichen sozialen Schranken zurechtzukommen. Sie sollten stolz auf sich sein.«
Das war definitiv ein neuer Blickwinkel zur Betrachtung seines Lebens. Stolz. Das war etwas, was nicht gerade viele Leute mit ihm in Verbindung bringen würden, wie kreativ sie auch denken mochten. Rune Maclure wusste mit Worten umzugehen.
»Sie müssen Rosa sagen, dass das nicht ihre Schuld ist«, sagte Stephen.
Es war Zeit, Nägel mit Köpfen zu machen. Außerdem machte es ihm keine Freude, hier draußen in der Kälte zu stehen.
»Rosa – Ihre Freundin, nehme ich an. Ich werde ihren Nachnamen brauchen, wenn ich Sie aufspüren soll.«
»Ihre Kontaktdaten sind in meinem Telefon. Der Code lautet 1066. Und Sie können ihr sagen, das Verlängerungskabel gehört ihr. Sie wird wissen, was ich meine. Es ist mir gerade wieder eingefallen.«
»Dann haben Sie sich getrennt?«, fragte Maclure.
»Sie hat es nicht mehr ausgehalten«, murmelte Stephen.
»Tut mir leid, bei diesem Wind kann ich Sie nicht verstehen. Ich komme ein bisschen näher zu Ihnen, okay? Aber ich lasse die Hände in den Taschen.«
Er stellte sich direkt unter Stephen, der sich noch weiter zum Innenbereich der Brücke drehte, um sich Gehör zu verschaffen.
»Ich sagte, sie hat es nicht mehr ausgehalten«, rief er. »Sie hat getan, was sie konnte. Ich bin nicht wütend auf sie. Es ist wichtig, dass sie das weiß.«
»Okay. Das klingt aber nicht, als wäre in dieser Beziehung alles geklärt worden. Vielleicht sollten Sie ihr den Gefallen tun und ihr das selbst sagen. Was meinen Sie?« Er zog Stephens Mobiltelefon aus der Tasche.
»Nun spring endlich! Ich komme jetzt schon zu spät zur Arbeit!«, brüllte jemand aus den Reihen der Zuschauer.
»Achten Sie nicht darauf«, sagte Maclure rasch und streckte eine Hand nach Stephen aus.
Der betrachtete sie stirnrunzelnd und schüttelte den Kopf. »Ich bringe jeden gegen mich auf«, klagte er und schwang sein Bein über die Barriere, sodass er wieder ganz auf der Wasserseite stand.
»Glauben Sie mir, so einen gibt es immer, okay? Einen kranken Mistkerl, der nur Blut sehen will. Ignorieren Sie ihn. Lassen Sie uns Rosa anrufen. Sie wird Ihre Stimme hören wollen. Tief im Herzen wissen Sie selbst, dass das der Grund ist, warum Sie wollten, dass ich an Ihrer Stelle mit ihr rede. Ich komme zu Ihnen, damit ich Ihnen das Telefon geben kann.«
»Sie tragen keine Handschuhe«, bemerkte Stephen flüchtig, während die Schmerzen in seinem eigenen Körper ihn zu überwältigen drohten. Es kostete so viel Kraft, das Gleichgewicht zu halten. »Sie werden sich die Hände aufreißen …«
Maclure hatte bereits angefangen zu klettern. Stephen überlegte, ob er ihn aufhalten sollte, indem er drohte zu springen, aber er wollte Rosas Stimme wirklich noch ein letztes Mal hören. Während Maclure sich näherte, studierte Stephen das Meer der Gesichter hinter der improvisierten Tatortabsperrung aus Flatterband, das die Polizei in aller Eile angebracht hatte. Ein Mann stand da, die Hände in den Taschen vergraben, und grinste ihn mit leuchtenden Augen an. Eine Frau schnauzte einen Polizisten an. Eine ältere Dame war in Tränen aufgelöst. Obwohl er es nicht für möglich gehalten hatte, hasste Stephen sich tatsächlich noch ein bisschen mehr, weil er solch einen Kummer verursacht hatte.
Der grinsende Mann fing an zu lachen, er brüllte es regelrecht hinaus, sodass Stephen es nicht überhören konnte. Es klang so entsetzlich wie ein Nagel auf einer Schiefertafel. Er schlug die Hände über die Ohren, stürzte voran und verfing sich mit einem Stiefel zwischen zwei Metallstangen.
Er kippte kopfüber, griff nach dem Geländer, schlug sich erst das Knie und dann die Hüfte an dem Metall an, rollte auf den Bauch, bis sein Kopf über dem Wasser hing. Der lachende Mann lachte noch lauter. Trotz des Windes, des tosenden Wassers und der Schreie aus der Menge war das Gegacker alles, was er hören konnte.
Mit beiden Händen griff er nach dem Zaun, kämpfte gegen das Bestreben seines Körpers, sich aufzurichten, und die Stimme in seinem Kopf, die ihm sagte, er solle loslassen. Binnen Sekunden wäre alles vorbei. Er musste kein letztes Mal mit Rosa sprechen. Das würde mehr Probleme aufwerfen, als es lösen konnte. Die Luft würde an ihm vorbeirauschen, wenn er fiel, er hatte die Chance, den freien Fall zu erleben, und dann vielleicht ein flüchtiges Gefühl von Kälte oder einem Aufprall, aber das würde nicht lange genug vorhalten, damit er es verarbeiten oder Schmerz empfinden konnte.
Stephen ließ mit einer Hand los und schloss die Augen.
»Er wird loslassen!«, schrie eine Frau.
Da waren laute Rufe, das Hämmern von Stiefeln, die hart auf Beton prallten, und ein aufgeregtes Kreischen. Das war der Mann mit den leuchtenden Augen, dachte Stephen. Er war hier, um ihn sterben zu sehen. Vielleicht war er der Tod. Stephen war nie religiös oder abergläubisch gewesen, aber vielleicht sah er nun endlich die Welt ohne Scheuklappen. All die Horrorfilme, die Geschichten über Begegnungen mit dem Übernatürlichen, die Kindermärchen waren real.
Eine Hand schloss sich mit hartem Griff um das Fußgelenk über seinem eingeklemmten Stiefel.
»Ich habe Sie«, sagte Maclure. »Reden Sie mit mir, Stephen. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt für Entscheidungen.«
»Der Tod ist hier«, sagte Stephen und verdrehte sich den Hals, um Maclure in die ruhigen braunen Augen zu blicken.
»Wenn er hier ist, dann nicht Ihretwegen. Nicht heute. Kommen Sie, halten Sie sich am Geländer fest und ziehen Sie sich mit ihren Bauchmuskeln ein Stück weit hoch. Ich muss nur Ihren Gürtel greifen können.«
»Ich weiß nicht«, sagte Stephen.
»Na gut, aber ich bin jetzt auf Ihrer Seite der Barriere. Wenn Sie jetzt den Fuß rausziehen, dann nehmen Sie mich mit in die Tiefe.« Maclure lächelte sanft.
Das war weder eine Drohung noch irgendein Getue. Stephen erkannte die Wahrheit in seinen Worten.
Als Maclure mehr von dem Stoff von Stephens Jeans packte, fiel ein Mobiltelefon aus seiner Tasche und stürzte in die eiskalte Strömung unter ihnen, verschwand im Wasser, als hätte es nie existiert.
»Mist, das tut mir leid. Ich wollte Ihnen die Chance geben, mit Rosa zu sprechen. Ich kaufe Ihnen ein neues, wenn ich Sie damit wieder hier rauflocken kann. Was halten Sie davon?«
Stephen starrte dem Telefon nach. So wollte er nicht gehen. Er wollte nicht einfach aufhören zu existieren – aus der Welt gelöscht werden, ohne eine Spur zu hinterlassen, würde sein ganzes Leben sinnlos machen. Er spannte seinen ganzen Körper an, begriff plötzlich, warum Sit-ups doch keine Zeitverschwendung gewesen waren, packte die unterste Stange des Geländers und erkannte erstmals, was die Kletterei über die Suizidpräventionsbarriere mit den Händen seines Retters angestellt hatte. Blut troff aus tiefen Schnitten in seinen Handflächen, und die Haut flatterte im Wind, als er die Hand ausstreckte, um nach Stephens Gürtel zu greifen.
»Ich wollte nicht, dass Sie verletzt werden«, sagte Stephen. »Danke.«
Er schaffte es, ein Knie in die Lücke zwischen den Metallstreben zu zwängen, und drückte den Körper weit genug hoch, damit Maclure ihn packen konnte.
»Danken Sie mir später«, sagte Maclure. »Jetzt sollten wir erst mal weg von den Zuschauern und eine Tasse Kaffee für Sie besorgen.«
Gebrüll brandete auf, als die Polizei Seile über die Barriere warf, die sie sich um die Taille binden sollten, und einen Polizeiwagen auf die anderen Enden rollte, um sie unter den Reifen zu sichern.
»Warum haben Sie Ihr eigenes Leben aufs Spiel gesetzt?«, fragte Stephen, als er endlich auf einer Höhe mit Maclure war und ihm direkt in die Augen sah.
»Wir haben alle unsere Dämonen«, sagte Maclure. »Jeder Einzelne von uns. Wer etwas anderes behauptet, hat lediglich besser zu lügen gelernt als Sie und ich. Meine Art, mit meinen umzugehen, ist, mein Bestes zu tun, um anderen Menschen zu helfen. Das ist purer Egoismus, wenn man es genau betrachtet.«
Stephen legte einen Arm um Maclures Nacken und zog ihn für einen Moment fest an sich. »Ich schulde Ihnen mein Leben«, sagte er.
Und er meinte es auch so, aber alles, woran er denken konnte, waren die Dämonen, die Maclure erwähnt hatte, und der Mann in der Menge, der ihn immer noch beobachtete. Er lachte nicht mehr. Nicht einmal die Spur eines Lächelns zeigte sich in seinem Gesicht.
Kapitel zwei
3. März
Detective Inspector Luc Callanach stand da, starrte den Mann in dem zerschlissenen Lehnsessel an und dachte über Leute nach, die beteuerten, jenen zu vergeben, die ihnen schwerstes Leid zugefügt hatten. Eltern, die willkürlich Bomben legenden Terroristen vergaben, dass sie ihnen auf grausamste Art die Kinder geraubt hatten. Trauernde, die kein böses Wort über den betrunkenen Fahrer verloren, der für ihren Kummer verantwortlich war. Nie im Leben wäre Luc fähig, in seinem Herzen genug Raum für solch eine Geste zu finden.
Der Mann blickte zu ihm auf und öffnete den Mund, als wollte er etwas sagen. Stattdessen blies er eine Kaugummiblase und schlug danach, ehe er die Hand wieder in den Schoß sinken ließ. Bruce Jenson litt an Alzheimer. Zu gut für ihn, dachte Luc und schaute zum Fenster hinaus auf den ausgedehnten Rasen des Pflegeheims, während das letzte Licht des Tages erlosch. Jede Krankheit, die es solch einer Bestie gestattete, zu vergessen, was sie getan hatte, war zutiefst ungerecht.
Luc trat einen Schritt vor, ging in die Knie und studierte die wässrig-blauen Augen, die sehend waren und doch nichts sahen.
»Waren Sie derjenige, der meine Mutter vergewaltigt hat?«, fragte er. »Oder haben Sie nur zugesehen, während Ihr Geschäftspartner sie geschändet hat? Haben Sie gedroht, meinen Vater zu feuern, wenn meine Mutter ihm erzählt, was passiert ist? Wer ist zuerst auf die Idee gekommen, Sie oder Gilroy Western?«
Jenson gab ein ersticktes Ächzen von sich, und seine Schultern erbebten unter der Mühe, die es ihn kostete, einen Laut zu erzeugen.
Luc nahm ein Foto von seiner Mutter und seinem lange verstorbenen Vater aus der Tasche und hielt es Jenson vors Gesicht. Der ließ den Kopf hängen. Luc ergriff sein Kinn und hielt ihm erneut das Foto vor die Augen. Er wusste, dass das, was er tat, falsch war. Bruce Jenson würde auf nichts reagieren, wie sehr er sich auch bemühte. Sechzig Sekunden nachdem er den Raum verlassen hätte, würde sich der Mann, der vor so vielen Jahren der Chef seines Vaters gewesen war, nicht einmal mehr daran erinnern, dass ein anderer Mensch dort drin bei ihm gewesen war.
Trotzdem konnte er sich nicht zurückhalten. All die Jahre hatte die Vergewaltigung nachgehallt, die seine Mutter erlitten hatte. Das Trauma war so schlimm gewesen, dass sie Luc, als er fälschlich des gleichen Delikts beschuldigt worden war, im Stich gelassen hatte. Doch Jenson und Western hatten für das, was sie getan hatten, nie bezahlt.
Luc hatte sein Bestes getan, um sie nicht zu verfolgen, hatte sich gesagt, es wäre besser, gar nicht an die Vergangenheit zu rühren, hatte gewusst, dass er die Nerven verlieren würde – womöglich auf verhängnisvolle Weise –, wenn er je mit einem der Männer in Kontakt käme. Aber er hatte gerade eine Woche in Paris mit seiner Mutter verbracht, und wieder in Frankreich zu sein hatte all den Schrecken seiner eigenen Haft und das Ende seiner Karriere bei Interpol wieder aufleben lassen.
Er hatte alles zurücklassen müssen, was ihm lieb und teuer gewesen war, weil eine Kollegin, die regelrecht besessen von ihm war, die schlimmste Lüge vorgebracht hatte, die man über einen Mann erzählen konnte, und doch war der Vergewaltiger seiner Mutter immer noch auf freiem Fuß. Wie sehr er sich auch bemüht hatte, die beiden Männer in Ruhe zu lassen, die einst eines der erfolgreichsten Unternehmen von Edinburgh geleitet hatten, war ihm doch klar geworden, dass er diese Schlacht längst verloren hatte. Und hier war er nun – benutzte seinen Dienstausweis als Polizist, um in das Pflegeheim zu gelangen, in dem Bruce Jenson früher oder später sterben würde – und verlangte immer noch nach Antworten. Gierte immer noch nach Rache.
»Erkennen Sie sie? Ist da drin noch irgendein Teil von Ihnen aktiv? Sie haben ihr Leben zerstört, und dann haben Sie auch meins zerstört. Und das Schlimmste ist …« Luc spie die Worte hervor, und ein Schluchzen stieg tief aus seiner Kehle empor, als er weitersprechen wollte. »Das Schlimmste ist, dass einer von euch verdammten Scheißkerlen mein beschissener Vater sein könnte.«
Bruce Jensons Mundwinkel zuckten aufwärts. Nur ein Zufall, sagte sich Luc. Nichts weiter als ein unwillkürliches Muskelzucken. Aber hatte er nicht zugleich den Blick weiter nach oben gerichtet, versucht, Luc in die Augen zu sehen, auch wenn es ihm nicht ganz gelungen war?
»Mein Vater hat jahrelang für Sie gearbeitet. Er hat zu Ihnen aufgeblickt, hat Ihnen vertraut. Sie haben ihn während der Weihnachtsfeier losgeschickt, damit er einen liegen gebliebenen Laster abholt, und dann haben Sie gemeinsam meine Mutter vergewaltigt. Ihr Name war Véronique Callanach, und wenn Sie jetzt wieder lächeln, dann, das schwöre ich, werde ich Sie erwürgen.«
Ein Speichelfaden rann über Jensons Unterlippe und glitt langsam an seinem Kinn herab. Callanachs Magen krampfte sich zusammen. Er konnte seine Mutter in dem Kleid, auf das sie so stolz gewesen war, das sie aber für viel zu teuer für so eine einfache Person wie sich gehalten hatte, regelrecht vor sich sehen, konnte zuschauen, wie sie mit einem Sack über dem Kopf in Jensons Büro zu Boden gedrückt wurde. Er konnte ihre Schreie hören, ihren Schmerz und ihren Abscheu spüren. Und dann die Scham, gefolgt von dem Entsetzen, als sie erkannte, dass sie mit ihrem ersten und – wie sich herausstellen sollte – einzigen Kind schwanger war, und wusste, dass sie Lucs Vater niemals erzählen konnte, was passiert war.
Dass er seinen Job verloren hätte, wäre noch das kleinste Problem gewesen. Er hätte sowohl Jenson als auch Western getötet für das, was sie ihr angetan hatten, und dann hätte sie die nächsten zwanzig Jahre damit verbracht, einen guten Mann, der sonst nie jemandem etwas zuleide getan hatte, im Gefängnis zu besuchen. Der Speicheltropfen lief in die runzligen Furchen an Jensons Hals. Als wäre er dabei gewesen, stellte Luc sich vor, wie er auf den Körper seiner Mutter gesabbert hatte, als entweder Jenson selbst oder sein Partner sie geschändet hatten, sie, wo es ihnen gefallen hatte, angefasst und verletzt hatten.
Das Kissen lag in Lucs Händen, ehe ihm bewusst wurde, was er tat. Ein Knie auf eine Armlehne des Sessels gestützt, hob er es mit zitternden Fäusten, unter deren Haut sich weiß die Knöchel abzeichneten, die Zähne gebleckt, jeden Muskel im Körper gespannt, bereit, seinem Zorn freien Lauf zu lassen. Er schrie auf und warf das Kissen mit aller Kraft gegen die Wand. Als es abprallte und herunterfiel, stieß es gegen eine Vase, die auf dem Boden aufschlug und ein Durcheinander aus Keramikscherben und schleimig-grünem Wasser hinterließ.
Hastig wich er zurück, weg von Jenson, stolperte gegen die Terrassentür, die in den Garten führte. Die Stirn an das Glas gelegt, die Fäuste auf Schulterhöhe erhoben, trat er gegen den unteren Teil der Tür. Der Sprung im Glas bildete sich bemerkenswert langsam, begleitet von einem Geräusch, das eher ein Knirschen als ein Splittern war, und zeichnete eine Spur wie von einem gegabelten Blitz auf die untere Scheibe.
Callanach seufzte. Er verhielt sich erbärmlich, ließ seine Wut an einem Mann aus, der keinerlei Kampfgeist mehr in sich hatte. Die Gerechtigkeit nahm auf natürlichem Weg ihren Lauf. Jenson würde nie seine Enkel aufwachsen sehen, würde sich nie in eine Eigentumswohnung in Spanien zurückziehen können, wo sein ehemaliger Geschäftspartner offenbar inzwischen residierte. Er war siebzig und im Grunde schon tot. Was immer Callanach ihm auch antäte, es würde sein Leiden nicht verschlimmern.
Er atmete einige Male tief durch und sah sich im Zimmer um. Es war billig und schäbig ausstaffiert. Dies war kein luxuriöses Pflegeheim. Am Bett war ein Gitter angebracht, damit der Patient nicht hinausfallen konnte, aber die Decken sahen dünn aus. Die Bilder an den Wänden waren billige Drucke von der Sorte, wie man sie in einem 1-Pound-Shop kaufen konnte. Von einigen alten staubigen Familienfotos abgesehen, war nirgends eine persönliche Note wahrnehmbar. Jenson war hier regelrecht entsorgt worden. Das war so gut wie eine Verurteilung, auch wenn ihn dieses Schicksal erst recht spät ereilt hatte. Langsam ging Callanach zu dem Durcheinander am Boden, sammelte die Scherben ein und warf sie in den Papierkorb. Dann nahm er ein paar Papierhandtücher aus dem Spender an der Wand und wischte das Wasser auf, so gut es ihm möglich war, ehe eine ahnungslose Schwester hereinkommen und ausrutschen konnte. Anschließend wischte er das Kissen mit der Hand ab und stopfte es zwischen Jenson und die Sessellehne.
Als er überzeugt war, dass der Raum wieder in Ordnung war, holte er ein Paar Handschuhe und einen sterilen Beutel aus der Tasche. Dann beugte er sich über Bruce Jenson, riss ihm einige der verbliebenen Haare vom Kopf und versiegelte sie sorgsam in dem Beutel, um jeglicher DNA-Kontaminierung vorzubeugen, ehe er die Handschuhe abstreifte und in den Papierkorb warf.
Er sah ein, dass es nicht in seiner Macht stand, diesen Mann dafür, dass er sich an seiner Mutter vergriffen hatte, zur Verantwortung zu ziehen, aber er musste wissen, ob er sein Vater war. Diese Entscheidung hatte er sich lange und gut überlegt, doch auch jetzt fühlte er sich nicht dafür gewappnet, sich dem Ergebnis zu stellen. Sollte Jenson sein Vater sein, würde das alles zerstören, was er je als seine Identität wahrgenommen hatte. Seine Mutter war Französin, er war bei ihr in Frankreich aufgewachsen und hatte nie erwartet, dass seine Zeit dort ein Ende finden würde. Sein Vater jedoch war ein stolzer Schotte gewesen, geboren in Edinburgh. Luc konnte sich kaum an die ersten paar Jahre seines Lebens erinnern, doch sein Dad war ihm als warmherziger Mann mit großen Händen und einem stets paraten Lächeln im Gedächtnis geblieben; ein Mann, der gern lachte und einen oft und herzlich in die Arme schloss. Nachdem sein Vater viel zu früh gestorben war, hatte seine Mutter es schwer gehabt, allein mit einem kleinen Kind zurechtzukommen, und war zu ihrer Familie zurückgekehrt.
Luc sah sich erneut im Raum um, um sich zu vergewissern, dass er ihn so sauber und ordentlich wie möglich zurückließ, warf noch einen letzten Blick auf das Gesicht des Mannes, den er für alle Zeiten hassen würde, und ging. Als er am Schwesternzimmer vorbeikam, hielt er inne und beugte sich über den Tresen.
»Ich habe versehentlich mit dem Ellbogen eine Vase umgeworfen«, sagte er leise. »Tut mir leid. Kann ich Ihnen Geld dalassen, damit sie ersetzt wird?« Er ließ seinen französischen Akzent in seinen Worten anklingen und stellte Augenkontakt zu der Pflegerin her.
»Ach, nein, machen Sie sich keine Gedanken. So etwas passiert eben. Wir haben haufenweise Vasen im Lager. Ich gehe schnell vorbei und mache sauber.« Sie lächelte süß und strich verlegen eine Haarsträhne zurück, die sich aus ihrem Pferdeschwanz gelöst hatte.
»Keine Sorge, ich habe darauf geachtet, dass der Boden trocken ist«, sagte Callanach. »Sie haben bestimmt Wichtigeres zu tun. Mr Jenson hat gar nicht darauf reagiert. Wie Sie sagten, er hat im Grunde gar nicht gemerkt, dass ich dort war. Es ist tragisch.«
»Ich weiß. Seinem Sohn Andrew fällt es auch schwer, ihn zu besuchen. Was meinen Sie, müssen Sie noch einmal herkommen?«, fragte sie.
Luc schluckte seine Schuldgefühle hinunter. Er flirtete aus Eigennutz mit ihr und war sich der Wirkung, die er auf Frauen hatte, wenn er nur seinen Charme anschaltete, vollkommen bewusst. Sein Aussehen hatte ihm Modelverträge und eine ganze Reihe reicher, gut aussehender Freundinnen eingebracht, bis er schließlich erwachsen geworden war und beschlossen hatte, etwas mit seinem Leben anzufangen. Nun, da er in Schottland lebte, nahm er an, dass er beinahe exotisch wirkte mit seinem dunklen Teint und den immer noch hörbaren Schwierigkeiten, seine Zweitsprache in den Griff zu bekommen. Zwar war er seit seiner Kindheit zweisprachig, aber das hieß nicht, dass er den schottischen Akzent oder die umgangssprachlichen Wendungen beherrschte.
»Ich weiß es nicht genau. Vielleicht komme ich in ein paar Tagen noch einmal her«, sagte er und zeigte ihr seine perfekt weißen Zähne. »Hoffentlich haben Sie dann auch wieder Dienst.«
»Schon möglich«, antwortete sie kichernd.
Er hatte getan, als wäre er in einer offiziellen polizeilichen Angelegenheit hergekommen, und so vermieden, sich in das Gästebuch einzutragen. Niemand hatte auch nur daran gedacht, sich seine Daten zu notieren. Es war erschreckend, wie schnell die Leute sämtliche Regeln vergaßen, wenn man mit einer Dienstmarke vor ihnen wedelte. Er winkte der Schwester noch einmal zu und ging den Korridor zum Parkplatz hinunter.
Sollte sich herausstellen, dass Jenson sein Vater war, ging es nicht nur um die Erkenntnis, dass er die Gene eines Monsters in sich trug. Da war auch das Problem erblich bedingten Alzheimers zu bedenken. Schlimmer noch, er musste entweder seiner Mutter offenbaren, dass ihr Vergewaltiger sie tatsächlich geschwängert hatte, oder den Rest seines Lebens damit verbringen, sie in diesem Punkt zu belügen. Keine dieser Aussichten war besonders erfreulich. Dann wären da die Verwicklungen, die potenzielle Halbgeschwister mit sich brachten. Würde er mehr über Andrew Jenson erfahren wollen, oder ginge das einen Schritt zu weit?
Falls Jenson nicht sein biologischer Vater war, müsste er Gilroy Western in Spanien aufspüren. Eine belastbare DNA-Probe von einem Mann zu ergattern, der sich durchaus an Callanachs französische Mutter erinnern mochte, könnte sich als erheblich schwieriger erweisen.
Seufzend stieß Callanach die Doppeltür zum Parkplatz auf. Er wollte das alles nicht. Er sehnte sich nach einer einfacheren Zeit, der Zeit, in der er zu wissen geglaubt hatte, wer sein Vater war, auch wenn es ihn sein Leben lang geschmerzt hatte, dass er ihn schon so jung verloren hatte. Wenn jedoch ein lebender, atmender, Golf spielender Gilroy Western sein Vater sein sollte, wie sollte er dann sicherstellen, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wurde?
Seine Mutter weigerte sich hartnäckig, die lange zurückliegende Vergewaltigung bei der Polizei anzuzeigen. Es gab keine stützenden Beweise. Western könnte sogar behaupten, der Sex wäre einvernehmlich gewesen, und das würde seine Mutter gleich noch einmal traumatisieren. Was bedeutete, er musste es entweder dabei belassen, wohl wissend, dass der Vergewaltiger seiner Mutter ungestraft davonkäme, oder er würde sein eigenes Leben ruinieren, indem er die Sache selbst in die Hand nahm.
Die Chancen, dass eine Fortsetzung seiner Nachforschungen ein positives Ergebnis für ihn haben würde, waren nicht allzu hoch, und dennoch war er jetzt auf dem Weg nach Hause, um Jensons Haare in einen Umschlag zu legen und zu einem forensischen Test einzuschicken, zusammen mit einem Haar von seinem eigenen Kopf. Er verzweifelte an sich selbst. Er hatte gehofft, der Urlaub in Paris würde die Dinge zwischen ihm und seiner Mutter wieder in Ordnung bringen. Und tatsächlich hatten sie nach langer Trennung Frieden miteinander geschlossen. Der Urlaub war emotional so anstrengend wie angenehm gewesen. Luc hatte sich außerstande gefühlt, mit ihr über die Vergewaltigung zu sprechen, und seiner Mutter war offensichtlich das Mitgefühl, das er für sie empfand, nicht entgangen. Den Schmerz, den ein sexueller Übergriff mit sich brachte, konnte auch die Zeit nicht heilen.
Er startete den Wagen und schaltete im abnehmenden Tageslicht die Scheinwerfer an, als er das Mobiltelefon in seiner Tasche vibrieren spürte. Er ging dran und legte dabei den Gurt an.
»Luc, Ava hier«, sagte eine Frau, ehe er sich melden konnte. »Hör mal, tut mir leid, ich weiß, du hast noch bis morgen Urlaub, aber ich bin gerade im städtischen Leichenhaus. Ein Mann wurde nach einem Sturz von einem Turm auf Tantallon Castle tot aufgefunden. Wie schnell kannst du hier sein?«
Sein Urlaub, wenn man das so nennen konnte, war definitiv vorbei.
Kapitel drei
3. März
Detective Chief Inspector Ava Turner hatte die Arme vor der Brust verschränkt und musterte die Leiche. Die traumatische Wirkung dieser Szenerie wurde nur geringfügig dadurch gelindert, dass die Verletzungen entsetzlich genug waren, um beinahe irreal zu erscheinen. Dr. Ailsa Lambert, Edinburghs leitende Pathologin, eine kleine falkenartig aussehende Frau, die eine starke Böe einfach davontragen könnte, bewegte sich mit der gewohnten Geschwindigkeit und Professionalität durch den Autopsiesaal.
»Ihr erster Toter, der aus großer Höhe abgestürzt ist?«, fragte sie Ava.
»Ja«, entgegnete Ava, hob mit behandschuhter Hand einen Arm des Toten und schaute darunter. »Sind all diese Verletzungen post mortem entstanden, oder gibt es irgendwelche Hinweise auf einen Angriff vor seinem Sturz? Diese Einschnitte sehen aus wie Messerwunden.«
»Bemerkenswert, nicht wahr? Ich fürchte aber, ich muss Ihnen sagen, dass bei einem so tiefen Fall physikalisch betrachtet ballistische Kräfte auftreten. Diese großen spaltförmigen Wunden kommen zustande, wenn die Kraft nach außen drängt und einen kritischen Punkt überschreitet, sodass der Körper des Mannes die Energie nicht mehr in seinem Inneren bündeln kann.«
Sie ergriff das Laken und legte eine weitere Risswunde frei, die sich um die Seite des Mannes zog und beinahe bis zum Nabel reichte. Eine andere verlief auf der Rückseite seines linken Beins. Es war, als hätte ihn jemand mit einem Fleischerbeil bearbeitet. Ava nahm Ailsa die Stoffecke aus der Hand und legte das Laken wieder ab.
»Also wie bei stumpfer Gewalt?«, fragte sie.
»Gewissermaßen, nur dass die Gewalt hier von innen nach außen wirkt. Er hat multiple Frakturen, wie man es erwarten sollte. Dieser Mann ist flach auf dem Rücken gelandet. Sein Rückgrat ist an vier Stellen durchtrennt worden, seine Leber ist geplatzt und beide Lungenflügel wurden von gebrochenen Rippen durchbohrt.«
»Hat er gelitten?«
»Physisch nicht, das kann ich mit großer Gewissheit sagen. Wir wissen von Menschen, die einen Sturz aus großer Höhe überlebt haben, dass ihr Gehirn sie unmittelbar vor dem Aufprall schützt. Sie verlieren das Bewusstsein, oder sie geraten in einen traumatisch bedingten dissoziativen Zustand. Nur sehr wenige haben irgendeine Erinnerung an den Aufprall. Im Fall dieses Mannes kann ich Ihnen verraten, dass der Tod so abrupt eingetreten ist, dass er keine Zeit mehr gehabt hat, Schmerz wahrzunehmen. Sein Hinterkopf ist hart genug auf den Beton aufgeprallt, dass dieser Teil seines Schädels regelrecht eingeebnet wurde. Soll ich ihn umdrehen, damit Sie es sich ansehen können?«
»Nicht nötig. Ich verlasse mich auf Ihr Wort«, murmelte Ava.
»Das ist sehr weise, allerdings fürchte ich, ich habe hinsichtlich Ihrer Frage, ob er gelitten hat, einen Vorbehalt, und der hat etwas mit dem Grund dafür zu tun, warum Sie überhaupt hier sind.« Die Tür wurde geöffnet, und eine weiß gekleidete Gestalt trat ein. »Luc! Kommen Sie rein, gesellen Sie sich zu uns. Wir waren gerade dabei, zum Kern der Sache vorzustoßen.«
»Hey.« Ava lächelte ihn an. »Tut mir leid, dass ich Ihnen die letzten freien Stunden verweigern musste. Habe ich Sie bei irgendwas Vergnüglichem gestört?«
Luc schüttelte den Kopf. »Ich war im Fitnessstudio. Ich habe in Paris zu viel gegessen und muss wieder in Form kommen.«
Das war eine Lüge, aber Ava ließ es ihm durchgehen. Callanach hatte die Art schlanker Gestalt samt Waschbrettbauch, von der die meisten Männer nur träumen konnten.
»Als ich in Ihrem Alter war, gab es keine Fitnessstudios«, grollte Ailsa, als sie eine Lampe mit Lupe an einem flexiblen Arm heranzog. »Wir haben lange Spaziergänge gemacht, statt stundenlang vor Monitoren zu sitzen, und wir haben unser gespartes Geld ganz bestimmt nicht für Essen rausgeschmissen, das mehr gesättigte Fettsäuren als Protein enthält.«
Callanach grinste Ava an. Ailsa war eine hervorragende Pathologin, aber sie nahm nie ein Blatt vor den Mund, ganz gleich, worum es ging.
»Also, bei Opfern eines tiefen Sturzes haben wir es mit Unfall, Suizid oder einer kriminellen Handlung zu tun. Sehen Sie hier.« Sie ergriff die rechte Hand des Toten und legte die Finger flach auf ihre eigene Handfläche. »Er hat eine Menge Schmutz unter den Fingernägeln – drei von fünf sind beim Sturz abgebrochen, dadurch hat sich frisches Blut darunter gemischt und ist dann getrocknet. Dieser Schmutz besteht aus Ziegelstaub und Erde.«
»Demnach hat er sich festgeklammert«, schloss Callanach daraus.
»Höchstwahrscheinlich«, stimmte Ailsa zu. »Und deshalb schließe ich Selbstmord aus.«
»Sie denken nicht, er könnte es sich anders überlegt haben? Ich meine, vielleicht ist er raufgeklettert, um zu springen, und als er dann tatsächlich gefallen ist, hat er nach der Wand gegriffen, vielleicht auch einfach nur aus Instinkt?«, hakte Callanach nach.
»Das ist kein normales Muster. Selbstmörder springen gewöhnlich ein Stück weit weg, wenn sie zu gehen beschlossen haben, und er hätte zurückspringen müssen, um die Mauer zu erreichen. Hätte er das versucht, dann hätte die Schwerkraft ihn vermutlich schon sehr weit oben auf den Rücken gedreht und es ihm unmöglich gemacht, sich mit den Fingernägeln an der Mauer festzukrallen.«
»Wenn ich beschlossen hätte, draußen am Tantallon Selbstmord zu begehen, würde ich von den Klippen ins Meer springen, nicht von den Burgmauern auf den Boden. Zu scheußlich«, fügte Ava hinzu.
»Also kein Selbstmord. Dann vielleicht ein Unfall?«, fragte Callanach.
»Das ist schon erheblich wahrscheinlicher«, sagte Ava. »Etwas, das ich nach wie vor in Betracht ziehe. Möglicherweise ist er ausgerutscht, hat sich für eine Weile festhalten, aber nicht wieder hinaufziehen können, dafür sprechen auch die abgerissenen Fingernägel. Andererseits ist es gar nicht so leicht, von den Mauern von Tantallon zu stürzen. Wäre es das, dann würde man niemanden mehr in irgendeinen Teil der Burg lassen. Er musste auf die Außenseite der Mauer klettern.«
»Vielleicht ein Missgeschick«, schlug Callanach vor. »Möglicherweise war er ein bisschen übermütig, ist raufgeklettert, hat sich festgehalten, und dann ist alles schiefgegangen. Irgendwelche Hinweise auf Alkohol oder Drogen?«
»Als ich Gehirn und Magen geöffnet habe, ist kein Geruch freigesetzt worden, der auf ernsthaften Alkoholkonsum schließen ließ, und ich weiß normalerweise sehr schnell, ob das ein Thema ist. Was Drogen betrifft, so habe ich Proben für einen Tox-Screen entnommen und sie mit Dringlichkeitsvermerk weitergeleitet. Was ich Ihnen zeigen wollte, ist das hier …«
Ailsa legte die Hand des Mannes wieder zurück auf die Metallpritsche, positionierte das Vergrößerungsglas über seinem Mittelfinger und richtete das Licht so aus, dass es direkt von oben darauffiel.
»Schauen Sie hier«, sagte sie.
Ava und Callanach beugten sich vor, um besser sehen zu können, und drehten die Köpfe hin und her, um die Sache aus verschiedenen Winkeln zu betrachten.
»Ich gebe auf«, sagte Ava schließlich. »Die Hand ist übel zerschlagen und stark aufgeschürft. Ich kann drei abgerissene Fingernägel sehen. Das ist alles erwartungsgemäß.«
»Gut, was Sie nicht wissen, ist, dass nur einer dieser Finger gebrochen ist. Der Mittelfinger, gleich an der Spitze, in der distalen Phalanx, nahe der Nagelbasis.«
Callanach schob einen durch einen Handschuh geschützten Finger unter den Bereich und betastete den Knochen. »Ich kann nichts fühlen«, gestand er.
»Es handelt sich nicht um eine verlagerte Fraktur, also war das auch nicht zu erwarten. Der Bruch ist nur auf dem Röntgenbild erkennbar, aber es gibt noch keine Anzeichen für Heilung, und Finger heilen schnell, also muss das ein frischer Bruch sein, doch er wurde nicht durch den Sturz verursacht. Er unterscheidet sich deutlich von den anderen Brüchen.«
»Eingetreten, als er sich an dem Stein festgehalten hat?«, fragte Ava.
»Das dachte ich erst, aber dann habe ich das gesehen …« Ailsa führte das Vergrößerungsglas noch näher an die Mittelfingerspitze heran und zeigte auf ein winziges purpurnes V, das vor dem fahleren Fleisch der Hand gerade noch sichtbar war. »Dieses Mal wurde nicht von einem Stein verursacht. Zunächst ist es auf der falschen Seite der Hand. Als er auf dem Boden aufgekommen ist, war die Handfläche nach unten gerichtet, das weiß ich durch das Aufprallmuster. Diese Quetschung ist tief und frisch. Ich habe die Haut herausgeschnitten und daruntergeschaut. Frische Gewalteinwirkung, heftig. Die hat vermutlich auch den darunterliegenden Bruch herbeigeführt.«
»Was könnte Ihrer Meinung nach die Ursache dafür sein?«, wollte Ava wissen.
Ailsa verschränkte die Arme vor der Brust und neigte den Kopf zur Seite. »Ich bin unschlüssig«, sagte sie. »Das ist etwas weit hergeholt.«
»Aber es ist der Grund, warum wir hier sind, richtig?« Ava musterte sie mit hochgezogenen Brauen.
»In der Tat. Diese scharfe Begrenzung und die Form sind außergewöhnlich. Wäre da nicht die Fraktur, dann wäre ich nicht so überzeugt, aber hier wurde eine Menge Gewalt angewandt, also muss der Finger schwer belastet worden sein. Für mich sieht das aus wie die Spitze eines Stiefelabdrucks. Das würde auch den Bruch erklären. Wie gesagt, ich kann das durch nichts anderes belegen. Es gibt keine anderen Verletzungen, die nicht durch den Sturz erklärbar wären. Unter diesen Umständen, ohne Zeugen oder ein klareres Bild davon, was da passiert ist, könnte ich darauf keinen Fall aufbauen.«
»Lasst uns einfach hoffen, dass es dafür eine harmlose Erklärung gibt. Wir hatten in Edinburgh keinen Mord mehr seit diesem Gang-Racheakt im Braidburn Valley Park zu Weihnachten. Ich hatte gehofft, wir würden es noch ein paar Monate länger ohne neue Mordermittlungen schaffen.«
»Ich sage Ihnen nur, was ich sehe«, murmelte Ailsa. »Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten fällt in Ihr Fachgebiet.«
»Nicht so ganz. Meine Truppe darf immer nur aufräumen, nachdem die gesellschaftlichen Normen dahingerafft wurden. Wie auch immer, hier herumzustehen wird uns keine Antworten liefern«, konstatierte Ava. »Vielleicht bekommen wir, wenn wir ihn identifiziert haben, ein klareres Bild. Schicken Sie mir Ihren Bericht. Ich werde eine Untersuchung einleiten, bleibe aber auch aufgeschlossen für andere Möglichkeiten. Klingt das vernünftig?«
»Das tut es allerdings.« Ailsa lächelte. »Dieser Mann ist erst Anfang dreißig. Ich glaube, das zumindest schulden wir ihm. Das ist kein Alter zum Sterben, egal unter welchen Umständen.«
»Das ist es definitiv nicht«, stimmte Ava zu und ging zur Tür des Autopsiesaals. Dort zog sie Haube und Handschuhe aus und deponierte sie im Mülleimer, ehe sie die Arme ausstreckte und Ailsa an sich drückte. »Wie halten Sie sich?«, fragte sie, als sie sich aus dem sterilen Anzug schälte.
»Sie meinen, für eine alte Frau?« Ailsa grinste.
»Tsts«, machte Ava.
»Gut. Weniger gestresst als Sie beide. Und ich freue mich zu hören, dass Luc sich eine Weile freigenommen hat. Wann waren Sie das letzte Mal im Urlaub, Mädchen?«
Ava lachte. Ailsa, seit vielen Jahren eine Freundin ihrer Eltern, würde nie aufhören, von ihr zu sprechen wie von einem Kind, ganz egal, wie alt sie wurde oder welchen Rang sie bekleidete.
»Ich nehme mir bald eine Auszeit, ich verspreche es. Wir haben endlich einen neuen Detective Inspector ernannt, das dürfte alles etwas leichter machen. Wir fahren jetzt raus nach Tantallon. Gibt es irgendwas Spezielles, worauf wir achten sollten?«
»Das ist eine Nadel im Heuhaufen, aber ich würde mir gern die fehlenden Fingernägel ansehen. Sie könnten vielleicht ein paar Zellen liefern, die uns helfen, das Bild etwas weiter auszumalen«, sagte Ailsa.
»Machen Sie sich nicht zu viele Hoffnungen«, warnte Ava. »Der Schauplatz wurde nicht wie ein aktueller Tatort von Forensikern abgesperrt. Wie sieht es aus, Luc? Bereit für einen Nachtspaziergang an den Burgmauern?«
»Das perfekte Ende für einen perfekten Urlaub.« Callanach lächelte. »Ich hole meinen Mantel.«
Kapitel vier
4. März
Bei einem Zwischenstopp am Polizeirevier schnappten sich Ava und Callanach ihre Schlechtwetter-Ausrüstung, bessere Taschenlampen als die im Kofferraum ihrer Fahrzeuge und informierten die Leitstelle über ihr Vorhaben. Als sie auf der gewundenen Fahrbahn, die von der Hauptstraße abzweigte und hinunter zur Landspitze an der Küste führte, endlich mit gehörigem Respekt vor Regen und Wind Richtung North Berwick fuhren, war es kurz nach Mitternacht.
Schweigend saßen sie in Lucs Wagen. Den Parkplatz am Ende der Straße hatten sie hinter sich gelassen und stattdessen direkt vor der Mischung aus Ticketschalter und Andenkenladen gehalten. Während sie hinaus auf die ausgedehnte Ringmauer blickten, die die Burg einst vor Marodeuren geschützt hatte, lauschten sie dem zunehmenden Dröhnen des Regens.
»Als Kind bin ich mal für ein Wochenende zu einem Kurs im Bogenschießen hergekommen.« Ava lächelte. »Am Ende des ersten Tages dachte ich, ich wäre unsterblich in den Lehrer verliebt.«
»Und was ist passiert?«, fragte Luc.
»Ach, weißt du, wie es bei den meisten Schwärmereien so läuft, wenn man selbst zehn und der Lehrer fünfundzwanzig ist, hat es damit geendet, dass er mir den Kopf getätschelt und gesagt hat, ich hätte mich wirklich sehr bemüht, und dann ist seine blonde Freundin in ihrem Minirock aufgetaucht, und mein Herz brach in tausend Stücke.«
»Bist du inzwischen darüber hinweg?«
»Na ja, ich habe immer noch Schmetterlinge im Bauch, wenn ich einen Mann mit einem Langbogen sehe, aber davon abgesehen habe ich, glaube ich, das Schlimmste überstanden. Glaubst du an Gespenster?«, fragte sie.
»Nein. Das ist simple Statistik. Wie viele Menschen haben die Erde bewohnt und sind gestorben? Wenn es Gespenster gäbe, dann hätten uns die ruhelosen Geister doch längst überrennen müssen.«
»Zyniker«, konterte sie. »Ich dachte, Franzosen wären so romantisch.«
»Hast du mich deshalb hergebracht? Wegen der Romantik? Ich bin aber nicht so überzeugt, dass die Suche nach den Fingernägeln eines kürzlich verstorbenen Mannes als Date durchgehen würde.«
»Idiot. Wenn das ein Date wäre, dann hätte ich meine guten Socken angezogen.« Grinsend beugte sie sich vor, um zur Krone der Burgmauer hinaufzublicken. »Aber nebenbei bemerkt, ich stimme dir zu. William Wordsworth hat geschrieben: ›I look for Ghosts; but none will force, Their way to me; ’t is falsely said, That there was ever intercourse, between the living and the dead.‹ Ist das nicht wunderschön?«
»Bestimmt, aber ich hätte vermutlich Probleme, es direkt zu übersetzen. Mein Englisch ist immer noch ziemlich buchstabengetreu, und die meisten Worte haben für mich nur eine Bedeutung.«
Für einen Moment runzelte Ava verständnislos die Stirn, dann, als ihr die anzügliche Doppeldeutigkeit von »intercourse« bewusst wurde, schloss sie die Augen und schüttelte mit gespielter Entrüstung den Kopf. »Vergiss es, Romeo. Wenn dir nichts Besseres einfällt, nachdem ich dir schon den poetischen Hintergrund geliefert habe, dann solltest du lieber den Mund halten.« Sie schloss den Reißverschluss ihrer wasserfesten Jacke und versuchte, die Tür zu öffnen, doch der Wind schlug sie hart gegen ihr Schienbein, als sie Anstalten machte, auszusteigen. »Au! Verdammter Mist!«, knurrte sie.
»Stimmt, du bist heute wirklich sehr poetisch«, kommentierte Callanach. »Lass mich die Tür für dich öffnen.« Er stieg aus und lief um den Wagen herum, um ihr die Hand zu reichen, während sie noch ihr geprelltes Schienbein rieb. »Bist du sicher, dass du das jetzt machen willst?«
»Nein, aber sollte hier noch irgendwas zu finden sein, dann ist es, so heftig, wie der Sturm hereinbricht, morgen weg. Es heißt jetzt oder nie. Komm schon.«
Sie gingen durch das Besucherzentrum, in dem ein unglücklicher örtlicher Uniformierter bei einem Mitarbeiter stationiert worden war, der ihnen Zugang verschaffen sollte, und weiter zum Vordereingang der Burg, der, obwohl halb verfallen, immer noch imposant wirkte. Ein heftiger Wind blies von Norden herbei, und der Regen war nur ein Grad davon entfernt zu gefrieren. Ava zog sich die Kapuze über und schüttelte sich die nassen, langen dunklen Locken aus den Augen.
Sie nahmen die hölzerne Fußgängerbrücke über den alten Burggraben und traten durch den Torbogen eines grünlichen Ziegelgemäuers. Unter ihnen und auf der rechten Seite waren ein Bereich mit lose herumliegenden Gesteinsbrocken und ein Teil des Burggrabens mit Tatortabsperrband gekennzeichnet worden. Dahinter trafen sie auf rutschiges Kopfsteinpflaster, ehe sich schließlich das Burggelände vor ihnen ausbreitete. Direkt vor ihnen führte eine Grasfläche zu den Klippen, die allmählich ins Meer bröckelten. Ein schrilles Pfeifen hallte durch die alten Mauern, und es war leicht vorstellbar, warum Besucher sich eingebildet hatten, Geister zu sehen und hundert Jahre in der Zeit zurückzureisen. Es war klar erkennbar, dass sich von der Seeseite kein Angreifer hätte nähern können, und es war ebenso klar, dass Ava recht hatte. Für einen Selbstmord wären die Klippen die naheliegendere Wahl gewesen.
Luc sah, wie Ava auf eine innere Tür zeigte, und sie gingen hinein und hatten eine steinerne Wendeltreppe vor sich, die ohne große Schutzvorkehrungen, von einem Seil an dem zentralen Gemäuer abgesehen, nach oben führte. Callanach folgte ihr auf dem Fuße, beobachtete jeden ihrer Schritte und kämpfte mit dem Bedürfnis, die Hand auszustrecken, um sie zu stützen. Ava war nicht die Art Frau, die besonders viel Hilfe wollte oder brauchte, aber das machte es ihm auch nicht leichter, den Beschützerinstinkt, den er ihr gegenüber empfand, abzuschalten. Sie war seine engste Freundin in Schottland, was nicht immer einfach war, denn sie war außerdem seine Vorgesetzte.
Sie duckten sich unter weiterem Absperrband hindurch und betraten einen ebenen Vorsprung mit einer Informationstafel für Besucher. Der Bereich war mindestens einen Meter breit und eben genug, um hoch oben auf der Mauer mit Blick auf die Brücke und den Burggraben sicheren, wenn auch nicht empfehlenswerten Stand zu gewährleisten. Über ihnen hielten höhere Mauern einen Teil des Windes ab, schützten sie aber nicht vor dem Regen.
»Das ist offensichtlich der Vorturm. Wann genau ist unser Mann gefallen?«
»Er wurde am Fuß der Mauer gefunden, als das Personal heute früh hergekommen ist. Die Burg öffnet zu dieser Jahreszeit nicht vor zehn Uhr morgens, und die Tür, durch die wir gekommen sind, ist über Nacht verschlossen. Wir werden erst erfahren, wann genau er gefallen ist, wenn Ailsa ihren Bericht mit einer Einschätzung des Todeszeitpunktes fertig hat. Es muss aber zwischen sieben am Abend und acht am folgenden Morgen passiert sein. Im Besucherzentrum gibt es Kameras. Wir haben nachgesehen, aber die liefern keine ausreichend guten Nachtaufnahmen, um irgendwas zu erkennen«, brüllte Ava gegen den Wind an.
»Ist er eingebrochen?«, fragte Callanach.
»Was?«, schrie Ava und drängte sich an ihn, um ihn besser verstehen zu können.
Callanach legte den Arm um ihre Schultern und umschloss mit einer Hand ihr Ohr, um sich Gehör zu verschaffen. »Ich sagte, ist er eingebrochen, oder ist er einfach hiergeblieben, als das Zentrum geschlossen wurde?«