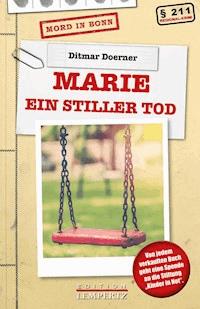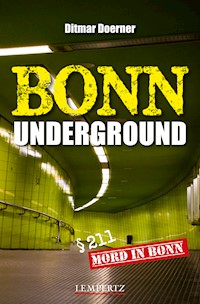
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Lempertz
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Eine mysteriöse Postkarte in den Wohnungen zweier getöteter Frauen bringt die beiden Kommissare Margot Lukas und Fabian Faust auf die Spur eines kaltblütigen Mörders. Dieser scheint es auf alleinstehende Frauen abgesehen zu haben. Während Margot Lukas durch einen Undercover-Einsatz versucht, den Täter einzukreisen, versetzt ein anderes Ereignis Bonn in Angst: Der Braunbär eines durchreisenden Zirkus ist aus seinem Käfig entflohen und in den Ennertwald geflüchtet. Polizei und Feuerwehr versuchen ihn einzufangen, ehe unvorsichtige YouTuber mit dem Raubtier Bekanntschaft machen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 307
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ditmar Doerner lebt in Bornheim und schreibt dort seit rund zehn Jahren Kriminalromane. Zumindest, wenn er nicht als Autor für das WDR-Studio Bonn unterwegs ist. Die Hauptfigur seiner Krimis, Margot Lukas, arbeitet als Zugezogene in Bonn. Sie respektiert die Eigenarten der Rheinländer, ohne sie zugegebenermaßen zu verstehen. Wie der Autor mag sie Mettbrötchen. Allerdings nur, solange sie nicht gegessen werden müssen.
Besuchen Sie den Autor auf folgenden sozialen Netzwerken oder auf seiner Homepage:
https://www.instagram.com/bonnkrimi
https://www.facebook.com/DitmarDoerner
https://ditmardoernerkrimis.wordpress.com
Ditmar Doerner
Impressum
Math. Lempertz GmbH
Hauptstraße 354
53639 Königswinter
Tel.: 02223 / 90 00 36
Fax: 02223 / 90 00 38
www.edition-lempertz.de
Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigungdes Verlages ist es nicht gestattet, das Buch oder Teile daraus zuvervielfältigen oder auf Datenträger aufzuzeichnen.
1. Auflage – September 2021
© 2021 Mathias Lempertz GmbH
Text: Ditmar Doerner
Umschlaggestaltung: Kerstin Pfeiffer
Satz: Hilga Pauli
Lektorat: Philipp Gierenstein, Eva Weigelt
Titelbild: Pixelements – stock.adobe.com
Icon S. 2: martialred – stock.adobe.com
Druck: Alfred Nordmann
Printed and bound in Israel
ISBN: 978-3-96058-401-8
eISBN: 978-3-96058-434-6
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Prolog
Das Geplapper des Tagesthemen-Moderators ist laut, aber trotzdem hört sie das Aufgleiten der Türen des Fahrstuhls im Etagenflur, ohne es allerdings bewusst wahrzunehmen. Der Aufzug wandert so gut wie jeden Tag bis spät in der Nacht zwischen dem ersten und ihrem Stock, dem sechsten, auf und ab. Zwei ihrer Wohnungsnachbarn besitzen die nervende Angewohnheit, fast jeden Abend sehr spät heimzukommen. Oder sehr früh, wie man’s nimmt. Zurück von Freunden, von einer Kneipentour, vielleicht von der Schichtarbeit. Annie Welder weiß es nicht genau, ihr Kontakt mit den Wohnungsnachbarn beschränkt sich auf ein hastig gelächeltes „Hallo“ im dunklen Flur oder einer verlegenen Begegnung im Aufzug.
Nun aber schreckt sie doch hoch. An ihrer Tür hat es geklingelt. O Gott!, ist ihr erster Gedanke, während ihre Augen weiter den Bewegungen des smarten Schlacks im Fernsehen folgen. Prüfend schaut sie an sich herunter, als ob sie sichergehen wolle, dass sie nicht gerade zufällig nackt ist. Dabei trägt sie immer noch ihre besten Sachen: Den knielangen braunen Rock, die helle Bluse, und sogar die neuen Schuhe hat sie noch nicht abgestreift. Und das, obwohl sie sonst immer sehr pingelig ist und jeden ihrer (seltenen) Besucher bittet, sie an der Eingangstür neben der Welcome-Strohmatte auszuziehen. Heute hat sie tatsächlich ein wenig über die Stränge geschlagen und selbst die Schuhe anbehalten. Vielleicht, weil sie immer noch so voller Glück ist, so ungläubig, dass auch ihr etwas so Wunderbares und Schönes passieren kann.
In der Ferne sind die Fenster im Steigenberger auf dem Petersberg hell erleuchtet. Erst vergangene Woche war sie dort gewesen, ein wenig spazieren, nachdenken, Ruhe finden. Hinaufgefahren ist sie allerdings mit dem Auto, der zwei Kilometer lange Anstieg zu Fuß ist ihr dann doch zu mühselig erschienen.
Vielleicht macht sie demnächst wieder mehr für ihre Fitness. Vielleicht ein Abo in der Sportfabrik? Alles ist möglich. Jetzt zumindest.
Erneut klingelt es, diesmal länger, fordernder, ungeduldiger. Wahrscheinlich möchte ihr jemand gratulieren. Allerdings wüsste sie jetzt nicht auf Anhieb, wer das sein könnte. Besuch? So spät? Sie fährt sich mit der Hand durch die Haare, steht weiter unschlüssig mitten im Wohnzimmer, den Blick immer noch Richtung Siebengebirge.
Besuch? Aber … warum nicht? Zu zweit trinken macht sicherlich mehr Spaß. Sie betrachtet das Sektglas auf dem niedrigen, quadratischen Wohnzimmertischchen. Sorgsam auf der Fernsehzeitschrift abgestellt, damit das Glas keine Ränder auf der kleinen, runden Holzplatte hinterlässt. Nur noch vereinzelte Sektperlen trudeln an die Oberfläche. Kein Wunder, den Crémant hat sie seit einer halben Stunde nicht mehr angerührt, kaum daran genippt, obwohl sie es sich fest vorgenommen hatte. Alkohol war nie ihres gewesen, schon zu Jugendzeiten nicht. Auf Klassenfeten, Geburtstagen, später bei Firmenfeiern, immer war sie die Nüchterne, diejenige, die die Kollegen und Kolleginnen nach Hause gefahren hat. Zuerst auf dem Fahrrad, später mit dem Auto. Die liebe Annie, die harmlose Annie, die nüchterne Annie. Hinter ihrem Rücken auch die verlachte Annie. Auch heute, mit 53, fühlt sie sich häufig noch so.
In der Dunkelheit zieht ein Flugzeug über den Himmel, ist jetzt genau über dem Petersberg. Eine Frachtmaschine? Eine dieser FedEx-Riesen, die jeden Tag in Köln/Bonn starten und landen? Oder ein Touristenbomber? Voll gepresst mit gestressten, bleichhäutigen Büromenschen, die nach einer Woche Sonne gieren, nach blauem Meer und endlosen Buffets. Wo es wohl hingeht für die dort oben? Bali? Thailand? Oder – deutlich näher – Fuerteventura? Urlaub! Kein schlechter Gedanke. Wie gesagt: Alles ist möglich. Alles ist möglich jetzt!
Ein Blick auf den Fernseher verrät ihr, dass irgendwo auf der Welt wieder einmal die Erde gebebt hat. Asien? Südamerika? Irgendwo, wo die Menschen braun sind, schwarz fast, auch wenn man das heute nicht mehr sagen darf. Sie findet das übertrieben. Was soll das? Sie ist eine Weiße, na und? Das ist nun einmal so. Dadurch ist sie nicht besser und nicht schlechter als jemand mit brauner Hautfarbe. Oder schwarzer. Entscheidend ist, was im Kopf ist, hat ihre Mutter immer gesagt. Und das stimmt.
Bevor sie die Wohnungstür öffnet, stellt sie in der engen, schlauchartigen Küche den Schalter am Herd auf eine kleinere Stufe. Das Öl in der Pfanne soll langsam heiß werden und nicht anbrennen. Sonst bekommt sie es nicht herunter, unmöglich. Dann könnte sie auch glühende Lava schlucken. Jeden Abend trinkt sie ein Schnapsgläschen der hellgrünen Flüssigkeit. Als Medizin. Sie schwört darauf, seit sie gelesen hat, Olivenöl senke den Cholesterinspiegel. Eigentlich ein Männerleiden, aber vor einem halben Jahr ist ihrer Hausärztin bei einer routinemäßigen Blutuntersuchung ihr hoher Wert aufgefallen. Nicht weltbewegend hoch, 140 :100, aber Dr. Skorapka hat ihr dennoch zu Tabletten geraten. Was Annie verweigerte.
Keine Medikamente! Wenn möglich, sollte man so lange wie irgend möglich auf Chemikalien im Körper verzichten, hatte sie ihrer Ärztin mitgeteilt. Die ließ das ausgestellte Rezept, begleitend von einem ein wenig unecht wirkenden Nicken in ihrem Papierkorb unter dem Mahagonischreibtisch verschwinden.
Der Flur ist dunkel. Sie muss achtgeben auf den großen, dunkelblauen Läufer, den sie über den grauen Teppich gelegt hat. Er wellt sich an einer Ecke, und vor zwei Monaten, als Annie einmal in besonderer Eile war, um ein seit langem erwartetes Paket entgegenzunehmen (ein selbst zusammengestelltes Fotoalbum ihres ein halbes Jahr zuvor verstorbenen Katers Michel), ist sie darüber gestolpert. Gerade noch hatte sie sich an der Wand abfangen können, sonst wäre sie möglicherweise mit dem Kopf gegen die Kante des Schuhschranks gefallen. Wer weiß, was sie sich hätte brechen können! Und die Eile hatte sich noch nicht einmal gelohnt, weil vor ihrer Wohnungstür nur der Hausmeister wartete, um ihr wieder einmal zu sagen, dass sie ihr Fahrrad nicht an der Laterne direkt gegenüber der Haustür festmachen dürfe.
Sie schließt ein Auge und blinzelt durch das runde Fischauge in der Wohnungstür. Annie erkennt einen dunklen Mantel, dann ein bekanntes Gesicht, das ihr keck entgegenlächelt. Wie nett!, denkt sie freudig, gleichzeitig dreht sie den Schlüssel im Schloss und drückt die Türklinke hinunter. Mit dir hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet.
Die Gestalt lächelt sie an, gekünstelt, was Annie im schummrigen Flurlicht aber nicht wahrnimmt. Das Lächeln ist wie ein Zähnefletschen, breit und verbissen. Die Person im Flur flüstert ein paar falsche Worte, das Wispern hallt durch den leeren, langen Flur. Getuschel fast, das an Kinderstimmen erinnert, die an Heiligabend aufgeregt auf das Christkind warten.
Annie tritt etwas beiseite, bittet die Gestalt herein und knipst gleichzeitig das Licht im Flur an.
Wie schön, so spät noch Besuch!, denkt sie wieder. Krönender Abschluss eines wunderschönen Tages! Annie wendet sich Richtung Wohnzimmer: Aufgeräumt ist ja! Aus der Küche wird sie noch ein Sektglas holen, zur Feier des Tages.
Sie hört das Klacken des zugehenden Schlosses der Wohnungstür, Schritte hinter ihr. Langsam geht sie vorwärts. Vielleicht sollte sie noch ein paar Kanapees herrichten? Irgendwo müssen noch Cracker sein, dazu etwas Frischkäse. Weintrauben liegen im Kühlschrank.
Aber zuerst einmal den Besuch ins Wohnzimmer bitten.
Mit einem Mal bleibt sie stehen. Etwas stimmt nicht. Etwas macht ihr … Angst? Ungläubig schaut sie auf ihren rechten Arm: Die kleinen Härchen haben sich aufgestellt, aufgeplustert wie bei einem Vogel im Winter. Oder liegt es an der Kälte, die vom offenen Hausflur in die Wohnung geströmt ist?
„Was …?“, beginnt sie den letzten Satz ihres Lebens, da spürt sie unterhalb ihres linken Schulterblattes plötzlich ein unerträglich starkes Brennen, heiß und scharf. Sie atmet stöhnend aus, verkrampft sich, röchelt, versucht sich umzudrehen, als sie einen dunklen, kupferartigen Geschmack im Mund bemerkt. Sie verschluckt sich, hustet, Blutblasen platzen auf ihren Lippen. Ungläubig starrt sie auf Dutzende winzige dunkle Tropfen an der Wand. Wie dunkelrote Sterne in einem weißen Universum.
Hat sie die … da … gerade …? Nein!, denkt sie, das kann nicht sein!
Schwindel überkommt sie. Noch nicht wegen des Blutverlustes – es ist die Panik, die sie ergreift. Ihre Hand sucht den Türrahmen zum Wohnzimmer, aber sie rutscht ab und hinterlässt eine blutige Spur auf dem weißen Kunststoff. Einen klaren Gedanken kann sie nun nicht mehr fassen. Alle ihre Instinkte sind darauf ausgerichtet, am Leben zu bleiben. Sie schaut an sich herunter. Ungläubig betrachtet sie in Brusthöhe eine merkwürdige Erhebung unter ihrer Bluse. Die Stofffarbe verändert sich, denkt sie ungläubig, wird dunkler. Gleichzeitig spürt sie eine Flüssigkeit (Blut?) ihre Bauchdecke herablaufen. Dann verschwindet die Erhebung plötzlich, gleichzeitig wieder dieser brennende Schmerz. Die Bluse wird nun viel schneller viel dunkler.
Sie presst ihre Hand auf die Wunde, aber zwischen ihren Fingern pulsiert das Blut weiter aus ihrem Körper. Sie fühlt sich schwach. Allmählich werden ihre Bewegungen ruhiger und sie beginnt, zusammenzusacken.
Die Gestalt hinter ihr tritt bedächtig zurück, würdevoll fast, als sei es dem Geschehen angemessen, drei, vier Schritte. Sie beobachtet Annie, deren Hand sich nun von ihrem Bauch löst. Annie sinkt auf den Teppich und gleitet dabei so anmutig auf ihre linke Seite, wie sie das lebendig nie erreicht hätte: Das rechte Bein perfekt angewinkelt, die Arme ausgestreckt, den Kopf seitlich gelegt. Sie stirbt.
Die Gestalt an der Wohnungstür nähert sich ihr nun erneut, beugt sich herab zu ihr, betrachtet sie zehn, fünfzehn Sekunden. Lächelt erneut, nur diesmal nicht zähnefletschend, sondern erfreut. Hastet dann zurück zur Wohnungstür und blinzelt durch den kleinen Spion, genau wie Annie vor nicht einmal zwei Minuten. Der Hausflur liegt bereits wieder im Dunkeln, das Deckenlicht ist aus, der Aufzug nicht zu hören. Alles in Ordnung.
Ohne noch einmal auf die tote Annie zu schauen, betritt die Gestalt das kleine Badezimmer. Nur wenige Cremes und Tuben liegen auf dem Bord unter dem mittlerweile schon etwas matten Spiegel über dem Waschbecken. Dazu Zahnseide, Deo, ein Parfüm. Gründlich wäscht sich die Gestalt Hände und Gesicht. Wasser und Blut vermischen sich in den unterschiedlichsten Farben im Becken und verschwinden im Abfluss.
Durch den weißen Schein der Badezimmerlampe wirkt die Gestalt im Spiegel müde und blass, aber das täuscht. Sie ist hellwach. Und erstaunt, wie einfach alles gewesen ist. So einfach! Mit den nassen Händen streicht sie sich eine Strähne aus der Stirn. Und lächelt. So einfach.
Mit Toilettenpapier säubert sie das Waschbecken, schrubbt es gründlich, mehrere Minuten lang. Danach spült sie das Papier die Toilette hinunter, mit einem weiteren Stückchen Papier drückt sie den Abzug. Das Papierchen steckt sie in eine ihrer Taschen.
Ein letztes Mal betrachtet sich die Gestalt im Spiegel. Nichts hat sich verändert. Es ist alles dasselbe, natürlich. Keine große Sache, wirklich nicht.
Dann macht sich die Gestalt auf die Suche. Nach zehn Minuten ist sie fündig geworden. Sie verlässt die Wohnung.
In der kleinen Küche von Annie Welder beginnt das Öl in der Pfanne zu brennen.
Kapitel 1
Der Weg durch die Kälte, vom Parkhaus bis zum Terminal 1, macht mich endgültig wach. Es riecht nach Schnee, denke ich und lächle, weil ich mir einen Augenblick wie Fräulein Smilla vorkomme. Die Nachtluft zieht kalt in meine Lunge, der kondensierte Atem zeigt mir, dass die Temperatur in den vergangenen 24 Stunden tatsächlich um mehr als zehn Grad gesunken ist, wie es die Meteorologen vorhergesagt haben. Verwunderlich.
Meine Schritte hallen auf dem dunklen, fleckigen Betonboden wider und werden von den hunderten Autos, an denen ich entlanghaste, zurückgeworfen. Unzählige Deckenleuchten lassen die meist dunklen Limousinen teuer und neu erscheinen. Mitten in diesem riesigen stählernen Kubus frage ich mich: Wo ist der verdammte Ausgang? Und seit wann besitzen Parkhäuser diese unverwechselbare Ähnlichkeit mit riesigen Legebatterien?
Dort! Ich haste auf den gläsernen Aufzug zu, versuche die Kälte daran zu hindern, unter meine Jacke zu kriechen, und ziehe mein peinliches Rollwägelchen hinter mir her. Eine schwarz glänzende Kunststoffbox auf winzigen Rollen, die bei der kleinsten Unebenheit des Betonbodens blockieren. Ungeduldig ziehe ich an dem Mistding, als müsste ich einen unwilligen Esel den Drachenfels hinaufschleifen.
Um nicht mit einer dieser Businessfrauen verwechselt zu werden, trage ich meine älteste Jeans, ein verwaschenes Sweatshirt, das irgendwann in den 2000ern einmal rot gewesen sein muss, und ein paar Converse-Turnschuhe. Und natürlich meine Winterjacke. Die habe ich mir gestern noch schnell in der Bonner Innenstadt gekauft. Leider, ohne sie vorher anzuprobieren. Gegenüber der jungen blonden Verkäuferin, die mich misstrauisch beäugte und gleichzeitig versuchte, ihren Kaugummi zu vergewaltigen, habe ich so getan, als würde ich mindestens einmal im Monat Jacken kaufen. Jetzt frage ich mich, seit wann es diese Dinger ohne jegliches Wärmepolster gibt? Schon jetzt spüre ich, wie mein Rücken langsam zu Eis wird. Und meine Nieren. Meine Oma ermahnte mich früher immer, auf meine Nieren aufzupassen. „Pass auf, dass du dir nicht die Nieren verkühlst!“, rief sie mir auch hinterher, wenn ich im Sommer auf dem Weg ins Freibad war. Bei 30 Grad Celsius.
Der Aufzug gleitet fast lautlos nach unten. In den Ecken vergammeln Zigarettenstummel. Es riecht nach Urin und kaltem Rauch. Plattgetretene Kaugummis haben den Boden in ein stümperhaftes Mosaik verwandelt. Der Blick in die Glasscheibe zeigt eine große, dunkelhaarige Frau in den Vierzigern, die dringend Urlaub braucht. Mich.
Vor der riesigen Parkhaus-Legebatterie legt der kalte schneidende Wind noch einmal zu. Ich drücke meinen Kopf stärker in den kaum vorhandenen Kragen meiner Jacke. Ein echter Fehlkauf! Drei Meter entfernt schimpft ein älterer Mann mit Strohhut (!) auf seine Frau ein, weil sie das Parkticket, das sie während des Urlaubs aufbewahren sollte, nicht sofort findet.
Ich bin versucht, ihm zu raten, sich zu entspannen, lasse es dann aber doch. Ich habe mir vorgenommen, meinen Urlaub in dem Augenblick beginnen zu lassen, in dem ich die Wohnungstür hinter mir zugezogen habe. Das ist jetzt eine gute halbe Stunde her, also befinde ich mich definitiv im Entspannungsmodus.
Der Blick der Frau trifft meinen, und ein millisekundenlanges Verstehen lässt uns beide kurz zu Verbündeten werden. Dann hält sie, gelassen lächelnd, ihrem immer noch keifenden Ehegatten das Ticket entgegen.
Ich atme tief durch, sauge die kalte Luft ein, als machte ich mich bereit für einen Tauchgang ohne Sauerstoffmaske.
Erst einmal weg hier, denke ich, und ziehe fröstelnd mein lächerliches Köfferchen Richtung Abflughalle.
*
Auch jetzt noch friere ich, während ich in der Flughafenbar auf meinen Espresso warte. Bestellt habe ich ihn bei dem wortkargen Mann im weißen Hemd hinter dem Tresen. Wegen seiner schmalen Schultern und dem ziegenähnlichen Gesicht erinnert er mich an einen der beiden Killer aus Fargo. An denjenigen, der am Ende im Häcksler endet.
In der Spiegelwand hinter ihm erkenne ich mein müdes Gesicht und versuche, milde mit mir zu sein. Wie soll eine Frau mittleren Alters, ungeschminkt und unausgeschlafen, um diese Zeit schon aussehen? Wie Grace Kelly? Jacqueline Bisset?
Ich versuche, meine Frisur zu bändigen, zupfe hier die dunklen Strähnen zurecht, streiche sie dort zur Seite und versuche vergeblich, die müden Augen mit den dunklen Rändern darunter zu ignorieren. Schön war ich nie, vielleicht hübsch, aber … ist das wichtig … jetzt?
Daniel findet, ich sehe blendend aus. Zumindest hat er mir das gestern zum Abschied gesagt. Aber er hat dabei gelacht – ein Lachen, das ich nicht deuten konnte. Meine Augen sind hübsch, denke ich, dunkel und tief. Und jeder, der etwas anderes denkt oder sagt, ist im Unrecht.
Ich warte darauf, endlich durch die Passkontrolle zu kommen. Der Flug geht in zwei Stunden, das dauert noch. Ungefähr ein Dutzend anderer Verbindungen steht vor meinem Abflug auf der riesigen Anzeigetafel, die mitten im Terminal irgendwie fehl am Platz wirkt. Eine rechteckige Monstrosität auf zwei Stelzen.
Trotzdem, ich mag unseren Flughafen. Er ist nicht so groß, dass man sich langfristig verlaufen könnte, aber auch nicht so provinziell, dass man an jeder Ecke einem Bekannten begegnet.
Natürlich bin ich zu früh, aber das ist mir lieber, als nach Ende der Check-in-Frist mit der Bundespolizei endlose Diskussionen führen zu müssen, um meinen Flieger überhaupt noch zu erreichen. Das ist mir einmal auf dem Weg nach Kreta passiert. Am Ende des Disputs mit den beiden Zollbeamten hätte ich wahrscheinlich meine Dienstwaffe gezückt und in die Luft geschossen, wenn ich sie dabeigehabt hätte.
Damit an dieser Stelle keine Fragen aufkommen: Mein Name ist Margot Lukas, Kriminalhauptkommissarin im Polizeipräsidium Bonn, in den Vierzigern, wie bereits gesagt, und wieder einmal, nach einem anstrengenden Jahr mit viel Arbeit und wenig Schlaf, todmüde und ausgelaugt. Und endlich auf dem Weg in den Urlaub!
„Spa total“ auf Fuerteventura, was immer das heißen mag. Wahrscheinlich werde ich die einzige Giraffe unter Antilopen sein, womit ich sagen möchte, dass ich mir bis vor Kurzem nicht hätte vorstellen können, einen Pauschalurlaub zu buchen. Aber nun bin ich müde und möchte einfach nur verwöhnt werden.
Fabian Faust, mein Kollege und Partner im PP Bonn, hatte die Idee für meine Auszeit. Nur relaxen, essen, trinken, schlafen. Vielleicht noch ein wenig lesen, wer weiß. Fabians Idee war deswegen so wunderbar, weil ich in Erwartung der anstehenden Karnevalstage wohl besonders niedergeschlagen gewirkt habe. Mir liegt diese fünfte Jahreszeit, wie sie heißt, einfach nicht, sie widerspricht meinem Naturell. Ich gehe lieber auf Abstand, vor allem an Tagen, an denen es jedem angetrunkenen 80-Jährigen erlaubt ist, mir seine Zunge ins Ohr oder sonst wohin zu stecken.
Mein Blick fällt auf die Headline des „Express“ auf dem Hocker neben mir. Irgendjemand hat die Zeitung liegen gelassen. Vielleicht ein Geschäftsreisender auf dem Weg nach Berlin oder ein Familienvater, der seiner dreijährigen Tochter hinterher eilen musste, bevor sie am Ende mit vielen Unbekannten nach Bangkok eincheckte.
Belustigt lese ich die Schlagzeile: „Papst entlässt Vertrauten!“ Wer das wohl gewesen sein mag, dieser Vertraute?, frage ich mich. Jesus?
Ich greife mir die Zeitung. Ein langjähriger und enger Vertrauter des Papstes soll Geld unterschlagen haben (Das ist eine Schlagzeile wert?, frage ich mich verwundert). Vom Geld, das Hungernden in Afrika zugutekommen sollte, hat der Papstvertraute im Namen des Vatikans für mehrere hundert Millionen Euro eine Luxusimmobilie in London gekauft.
Etwas angewidert werfe ich die Zeitung zurück auf den Hocker. Vielleicht sollten wir endlich den Vatikan stürmen, denke ich, Gott würde es uns danken.
Wobei man dem Vatikan ja immerhin eine gewisse Daseinsberechtigung zubilligen muss. Im Gegensatz zur „Gorch Fock“ oder der Bonner BaFin.
Die Lounge-Bar mitten im Terminal fügt sich mit ihren diversen Grautönen nahtlos in das nächtliche Dunkel der gesamten Abflughalle. Sogar der Lederimitat-Bezug des Hockers, auf dem ich sitze, wirkt traurig grau. Von draußen versucht noch mehr Schwärze zu uns zu dringen, die Morgendämmerung ist noch Stunden entfernt.
Der Killer aus Fargo schubst mir ein winziges weißes Tässchen, halb gefüllt mit einer kakaoähnlichen Flüssigkeit, über den Tresen. Ich schaue ratlos in die braune Brühe und hoffe, dass sie sich noch verfärbt – und sei es nur aus lauter Scham, ein so schlecht aussehender Espresso zu sein. Aber schwärzer wird sie nicht. Oder öliger. Oder sogar beides. Nichts passiert. Betont ausdruckslos betrachte ich den Kellner.
Die Margot der vergangenen Tage hätte augenblicklich losgepoltert, hätte den Mann sarkastisch darüber informiert, dass sie nicht bereit sei, die Kaffeefilterreste des vergangenen Tages hinunterzuwürgen. Sie hätte den Pächter der Bar, wenn nicht sogar den Flughafenchef verlangt. Aber nicht so die Margot von heute, nein! Schließlich ist der nette Kellner auch nicht zum Spaß hier. Er wird mich nicht vorsätzlich verärgert haben wollen, es ist ihm sicherlich ein Missgeschick unterlaufen. Es ist ja noch früh am Tage.
Genau aus diesen Gründen säuselt die neue Margot nun: „Entschuldigen Sie bitte, aber ich hatte einen Espresso bestellt.“ Mehr nicht.
Der schmale Mann ohne Namensschildchen auf seinem weißen Hemd hält mit dem Trocknen der Tassen, die er aus einer kleinen Spülmaschine holt, inne. Er rührt sich nicht, fast so, als sei er eingefroren. Tatsächlich: Seine Augen sind ähnlich groß wie die von – ja, jetzt fällt mir der Name wieder ein – Steve Buscemi, dem Schauspieler aus Fargo. Mein Kellner hier wirkt auch genauso fragil, genauso ansatzweise vernachlässigt mit seinem Haarschnitt, bei dem er sich sicher das Geld für einen anständigen Friseur gespart hat, und der zu weiten, schlotternden Hose um seine magere Hüfte.
„Wie meinen?“, fragt er gedehnt, fixiert mich kurz und beginnt dann erneut, die Tasse mit seinem rotweißen Trockentuch zu polieren.
„Ich sagte, ich wollte gerne einen Espresso. Ich hatte einen Espresso bestellt.“ Ich schiebe die Tasse ein paar Zentimeter in seine Richtung, und die hellbraune Flüssigkeit schwappt fast über den Rand. „Und das hier ist eher … Kakao. Oder vielleicht … Caro-Kaffee?“ Mit Grauen erinnere ich mich an diesen Abschnitt meiner Kindheit. „Oder irgendetwas anderes Abscheuliches, das kein Mensch um diese Uhrzeit in den Mund nehmen könnte.“ Jetzt bin ich doch wieder ausführlicher geworden als gewollt, aber hey, unfreundlich war das nicht, oder?
Steve verharrt weiter, als überlege er, was er antworten solle. Sein Gewicht verlagert er von einem Bein auf das andere, er taxiert mich. „Gnädige Frau, das ist ein Espresso.“
Ich schaue erst ihn an, dann die Tasse. Von irgendwo fordert die 007-Stimme (Dietmar Wunder) auf, das eigene Gepäck nicht unbeobachtet stehen zu lassen. Danke, James!
Ich seufze. „Ernsthaft?“ Nun wird es doch wieder soweit kommen, dass ich mich ärgern muss. Und? Kann ich etwas dafür? Mal ehrlich, wie würden Sie reagieren?
Wieder betrachte ich die braune Flüssigkeit, dann erneut ihn.
„Was, ernsthaft?“ Steve stellt die polierte Tasse in einen Glasschrank rechts hinter sich.
Kurz blicke ich wieder in mein Spiegelbild. Ruhig bleiben, sagt es, aber das gelingt mir nur noch halb.
„Glauben Sie ernsthaft, das hier“, ich deute auf die Tasse, als sei der Sud mindestens so giftig wie der Bio-Apfel, von dem Schneewittchen einst gekostet hat, „das hier ist ein Espresso? Ein Getränk, bei dem die Kaffeebohnen dunkler als bei einem normalen Kaffee geröstet sind.“ Ich schiebe das Tässchen weiter in seine Richtung. „Und? Ist das hier dunkel? Oder sogar dunkler als ein Kaffee? Aus welchem Land, werter Herr, kommen Sie denn?“
Steve schüttelt den Kopf und sein Lächeln wird noch gehässiger. „Rassistin oder was?“ Er wirft sein Trockentuch auf den Tresen und stützt beide Hände in die Hüften, provokant, angriffslustig, kampfbereit.
Rassistin?, wiederhole ich in Gedanken. Hat er mich gerade als „Rassistin“ bezeichnet? Ich starre ihn an und warte auf ein entwaffnendes Lächeln, einen kleinen Fingerzeig, ein winziges Zeichen, dass er nicht von allen guten Geistern verlassen ist. Aber da kommt nichts. Er meint es tatsächlich ernst.
„Wie bitte!?“, frage ich entgeistert. Ich stütze mich mit beiden Armen auf den Tresen, um ihm zu zeigen, dass er mich nicht einschüchtern kann. Gleichzeitig bin ich von mir selbst beeindruckt, wie schnell ich es wieder einmal geschafft habe, meine Mitmenschen zu Äußerungen zu bewegen, an die sie vor wenigen Minuten vermutlich nicht einmal gedacht hätten. Eine richtige Menschenfängerin bin ich, ehrlich.
Ohne ein Wort schnappt sich Steve meine Tasse. Jetzt schwappt die wässrige Brühe wirklich über, auf die Untertasse und auf den Tresen. Und fast auf meine Jacke! Er hat Glück, dass das nicht passiert ist, denn der Tresen ist nicht hoch, und in zwei Sekunden wäre ich auf seiner Seite gewesen – Urlaub hin oder her.
Stattdessen rutsche ich von meinem kleinen Hocker, schnappe mir mein Ziehköfferchen und verlasse Steve. Ohne ein weiteres Wort. Sonst hätte er vermutlich noch etwas entgegnet und wäre dann möglicherweise doch noch in einem Häcksler gelandet. Oder in einer Turbine. Wir sind ja hier auf einem Flughafen.
Ich betrachte die Anzeigetafel. Mein Flug ist eine Position nach oben geklettert. Mein Mobiltelefon klingelt.
Kapitel 2
Margot?“ Fabians Stimme klingt gehetzt. Als würde er im Laufen telefonieren.
„Was gibt’s?“, frage ich ohne jeden vorgetäuschten Ansatz von Begeisterung. Ich kann nicht glauben, was gerade passiert. Denn ein Anruf von Fabian, der genau weiß, wo ich bin und warum ich dort bin, zeigt nur, dass der Grund dieses Telefonats so wichtig ist, dass es mich vermutlich daran hindern wird, das zu tun, was ich vorhabe: in Urlaub zu fliegen.
„Margot, hörst du mich? Ich versteh dich nicht.“
„Das sagst du mir jeden Tag“, gebe ich gelangweilt zurück. „Niemand versteht mich.“
Aber so gelangweilt, wie ich mich gebe, bin ich nicht. Wenn Fabian so hektisch wirkt wie gerade, ist etwas passiert. Denn üblicherweise ist er die Ruhe selbst. Im Gegensatz zu mir.
Ich stehe jetzt fast genau unter der riesigen Anzeigetafel, auf der mein Flug noch etwas weiter nach oben gerutscht ist. Warum hat Fabian nicht eine Stunde später anrufen können?
Eine ältere Dame in einem grauen Kostüm und einem kleinen dunkelroten Hut mit einer Feder kommt auf mich zu, aber als sie bemerkt, dass ich telefoniere, wendet sie sich wieder ab. Ich schaue ihr nach und sehe, dass sie nun auf den Infoschalter zustrebt.
Fabian ignoriert meinen kleinen Scherz mit dem Nicht-Verstehen. „Tut mir leid, Margot, dass ich dich anrufe, aber ich – “
Kurz ist die Verbindung schlecht. Dann höre ich ihn wieder.
„… in der Pariser Straße. Auerberg.“
Der Lärm bei Fabian ist mittlerweile so laut, dass ich denke, er steht mitten in einer Baustelle. Männerstimmen.
„Und …?“, frage ich, immer noch betont gelangweilt „Was gibt’s da?“
Irgendjemand spricht ihn an, in unmittelbarer Nähe. Fabian entgegnet etwas, das ich nicht verstehe. Dann sagt er zu mir: „Du musst kommen!“
Natürlich will ich ihn fragen, warum ich das tun sollte – schließlich bin ich gerade auf dem Weg in den Urlaub, mein peinliches Köfferchen ist voller Sommersachen. Aber ich höre Fabian schnaufen und weiß, dass er es ernst meint.
Auf der Anzeigetafel ist mein Flug noch einen Platz nach oben geklettert, aber das ist nun egal. „Bin schon unterwegs“, höre ich mich sagen. „Ich ruf dich von meinem Wagen wieder an.“ Damit drücke ich ihn weg. Statt Fuerteventura nun also Auerberg.
*
Ich presse mir das Mobiltelefon ans Ohr. Die Schranke öffnet sich und ich verlasse die riesige Legebatterie Richtung Autobahn. Mein kleiner Simca ist fast sofort wieder warm, als ich die Heizung hochdrehe.
Was hat Fabian gerade gesagt? Etwas vorschriftswidrig habe ich ihn gerade wieder angerufen.
„Was hast du gerade gesagt?“
Ein dunkler Mercedes, der aus der Tankstelle auf den Zubringer einbiegt, übersieht mich. Ich hupe empört.
„Du bist was? Zufällig vorbeigekommen?“
Ich verstehe im Augenblick nicht viel von dem, was er sagt, hoffe aber, dass es allemal so wichtig ist, dass ich meinen Urlaub dafür sausen lasse.
„Ja, ich bin zufällig vorbeigefahren.“ Der Lärm im Hintergrund wird wieder so laut, dass Fabian schreien muss. Wieder Männerstimmen. „Und da war Feuer in einer der Wohnungen. Ich habe angehalten und bin jetzt drin. Mit der Feuerwehr.“
„Wo drin?“ Fabian spricht immer noch in Rätseln. „Was meinst du? Wo bist du drin?“
„Na, in der Wohnung. Weil … hier liegt jemand.“
„Tot?“, frage ich.
„Ja, tot. Mausetot.“
„Verbrannt?“, frage ich, obwohl ich das nicht glaube. Dafür hätte Fabian mich nicht angerufen.
Wieder ist die Verbindung kurz unterbrochen. Ich kann seine Antwort nicht hören.
„Wer liegt in der Wohnung?“, frage ich weiter.
Jetzt ist Stille. Vielleicht ist er an einen anderen Ort gegangen, wo er in Ruhe telefonieren kann.
„Bist du allein, Fabian? Woher weißt du, dass –“
Fast verpasse ich die Auffahrt Richtung Bonn und muss den Wagen hinter mir schneiden. Der Fahrer hupt empört. Ich winke zur Entschuldigung, was der Fahrer aber in der Dunkelheit natürlich nicht sehen kann.
„Himmel!“ Fabian ächzt, als wäre er gerade im achten Stock eines Hochhauses angekommen.
„Und du bist jetzt alleine oder was? Wo bist du?“
„Scheiße!“, höre ich ihn fluchen. Er stößt Luft aus. „Jesus, Maria!“
Ich klemme mir das rutschende Telefon fester zwischen Ohr und Schulter, um die lange Rechtskurve schneller nehmen zu können. „Fabian, sag mir doch bitte, wo genau du bist. Und was dort passiert ist.“
Auf dem Beschleunigungsstreifen drücke ich das Gaspedal meines kleinen Oldtimers weiter durch – zumindest so weit, wie ich es verantworten kann. Auf den Wagen bin ich stolz, er ist mein kleines Juwel, und selbst wenn ein gigantisches Urzeittier hinter mir her wäre, würde ich meinen Simca nicht über 100 km/h beschleunigen.
„Oh Mist!“, höre ich Fabian wieder, „Mist, Mist, Mist! Was für eine Sauer-“
Ich warte, dass Fabian weiterspricht, aber plötzlich wird es still. Sein Atmen höre ich kurz, dann Poltern, als sei ihm das Handy aus der Hand gefallen.
Ich warte. Fabian ist nicht gerade der Geschickteste. Es vergeht kaum eine Woche, in der er nicht irgendetwas im Büro fallen lässt. Akten, Kugelschreiber, Kaffeetassen – mit Vorliebe volle oder zumindest halbvolle. Eigentlich alles, was sich bewegen lässt.
„Fabian?“ Ich warte immer noch.
Die Autobahn ist so gut wie leer, aber ich halte mich penibel an meine selbst auferlegte Geschwindigkeitsbegrenzung. Die Begrenzungsstreifen leuchten fluoreszierend, werfen das Licht meiner kleinen Scheinwerfer hell zurück. Rechts und links huschen Lagerhallen und Bürocontainer des Troisdorfer Gewerbegebietes vorbei – zum Teil hell angestrahlt, zum Teil in der Dunkelheit verborgen. Die Silhouetten dreier Baukräne erinnern mit ihren langen Auslegern tatsächlich an lauernde Dinos.
„Fabian?“, frage ich noch einmal.
Keine Antwort.
„Fabian?“ Wenn er nicht mehr mit mir reden will, soll er sich gefälligst verabschieden. Ich habe gerade seinetwegen meinen Urlaub sausen lassen!
Wahrscheinlich hat er sein Handy irgendwo hingelegt und vergessen, es auszuschalten.
„Fabian, was soll –?“
Plötzlich vernehme ich ein Atmen. Ein Geräusch, das mir eine Gänsehaut auf die Arme treibt. Das ist nicht Fabian.
„Hallo?“, frage ich, jetzt beunruhigt. „Hallo?“ Ich drücke den Hörer fester an mein Ohr. „Fabian, was soll der Quatsch? Das ist nicht witzig.“
Gleichmäßiges Atmen, ganz nah. Als würde jemand lauschen. Einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen.
„Hallo?“
Stille.
„Hallo, wer ist denn da?“ Ich werde wütend. Dann horche ich wieder, ob jemand etwas sagen will – aber bis auf das Atmen bleibt es still.
„Wer ist denn da?“, frage ich erneut. „Verdammt nochmal, das ist nicht lustig!“
Im Gegenteil: Das ist gruselig! So etwas gehört in die alten Scream-Filme, aber nicht hierher.
„Fabian?“, frage ich ein letztes Mal, diesmal leiser, und lausche wieder diesem Atmen.
Atmen, ruhiges Atmen. Mehr nicht.
Ich drücke den Aus-Knopf, murmele meinem Simca eine Entschuldigung zu und drücke das Gaspedal bis zum Anschlag durch.
Kapitel 3
Auf der Pariser Straße donnert mir in der Dunkelheit ein rotweißes Ungetüm entgegen. Riesige Scheinwerfer blenden mich und tauchen das Innere meines Simca kurz in weißes Licht. Kompakt und riesig drängt mich das Monster an den Straßenrand. Wahrscheinlich hat mich der Fahrer des Feuerwehrwagens nicht einmal bemerkt – die Scheinwerfer meines kleinen Oldtimers besitzen ungefähr die Strahlkraft einer ausgehenden Kerze.
Ich weiche dem Ungetüm aus, fahre Schrittgeschwindigkeit und suche zwischen den zahlreichen am Straßenrand abgestellten Autos einen freien Parkplatz.
Drei Hochhäuser ragen rechts hell erleuchtet in die dunkle Nacht. 18, 20 Stockwerke hoch, riesige Zeugnisse einer zu Recht vergangenen Architektur.
Vor den Wohntürmen stehen zehn weitere Fahrzeuge der Feuerwehr, fünf Notarztwagen, Polizei und diverse zivile Pkw. Wahrscheinlich Polizeireporter. Ein alter, zerbeulter Golf steht schräg auf dem Bürgersteig. Hinter der Windschutzscheibe prangt das helle Kunststoffschild eines Fernsehsenders. Ein Notarztwagen schießt plötzlich aus der Einfahrt rechts, gleichzeitig schaltet der Fahrer das Martinshorn an. Blaulicht kreist gespenstisch durch die Dunkelheit. Ich schließe meinen Wagen ab. Im Laufen fische ich meinen Polizeiausweis aus der Jackentasche. Der Platz vor den Hochhäusern ist hell erleuchtet und erstrahlt wie ein Fußballstadion im Flutlicht.
Ich grüße die Kollegen vom Streifendienst, husche unter dem Absperrband hindurch, komme aber nur drei Meter weit: Mein Chef steht vor mir. Sein Seidentüchlein streichelt ihm das Kinn, ein Großteil seiner Gestalt ist in einem Kamelhaarmantel versteckt. Besser so!
Dazu muss ich erklären, dass mein Chef zu den Menschen zählt, die niemals einen Schritt umsonst tun. Sogar den Weg zur Etagenküche, in der sich Friedhelm von Blasierow jede zweite Stunde neuen Kaffee aufsetzt (eine Spezialmischung, die er in einer seiner Schreibtischschubladen aufbewahrt), absolviert er meines Erachtens nur deswegen, weil er ohne Kaffee an seinem Schreibtisch einschlafen und vom Stuhl rutschen würde.
„Sie hier?“, frage ich mehr als verdutzt. Meinen adligen Vorgesetzten hätte ich um diese Zeit überall vermutet, nur nicht hier. Es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich ihn an einem Einsatzort sehe.
Mühsam verzieht er seinen Mund zu einem gequälten Lächeln. „Sehr witzig, Frau Lukas.“ Zwei-, dreimal rümpft er kurz hintereinander seine lange, schmale Nase. Tatsächlich wirkt er adlig, vornehm, das kann ich ihm nicht absprechen. Wahrscheinlich haben seine Vorfahren tausende Bauern geknechtet und erpresst, um an ihren Wohlstand zu gelangen. Ich müsste das einmal recherchieren.
Ich will weiter, aber von Blasierow packt mich am Arm, so dass ich stehen bleibe. „Wir haben jetzt wirklich keine Zeit für Ihre Späßchen oder Ihren Sarkasmus.“
Was? Wie, welcher … Sarkasmus? Ich habe doch gar nichts gesagt! Egal. Ich will weiter. Aber wenn ich schon einmal hier bin, kann ich auch versuchen, mehr zu erfahren.
„Was ist passiert?“, frage ich, auch wenn ich nicht wirklich eine Antwort erwarte. Das würde mich extrem überraschen.
„Ihr Kollege Faust wurde angegriffen.“ Blasierows Augen taxieren mich streng, als sei ich daran schuld. Diesen Blick kenne ich: Wenn ich jetzt überdrehe und mich doch noch zu einer frechen Bemerkung hinreißen lasse, bekommt er wieder einen seiner ungesunden Anfälle, wird laut, unerträglich und läuft rot an. Aber die Lust auf ein Wortgeplänkel ist mir ohnehin vergangen.
„Was ist mit Fabian?“ Ich drehe mich zu den Schaulustigen auf der schmutzigen, nassen Wiese rechts neben uns. Irgendjemand aus der Menge hat geklatscht. Ich frage mich, warum. Alle schauen nach oben. Die Drehleiter eines dieser roten Monstren dreht sich vom vordersten der Hochhäuser weg. Ob jemand dort oben im Korb steht, kann ich nicht erkennen, aber ich denke schon. Anders würde es keinen Sinn ergeben.
Blasierow schaut zu den Mietern, die auf der anderen Seite des kleinen Fußwegs stehen, der zum Hochhaus führt. Auch dort stehen rund 15 bis 20 Anwohner im Schein der aufgestellten Feuerwehrscheinwerfer und taxieren uns, als würden sie schon Widerstand leisten, sobald wir sie nur fragten, ob sie etwas gesehen haben. Die meisten sind in der Nachtkälte dick eingemummt, haben einen Mantel oder einen Parka übergeworfen, andere wenige stehen nur in Pullover und Trainingshose herum und rauchen eifrig. Alle wirken, als seien wir persönlich schuld, sie in ihrer Nachtruhe gestört zu haben.
Eine junge Frau in einem dünnen, hellgrünen Mantel schaukelt ihr schreiendes Kind im Arm. Unsere Blicke treffen sich, dann wendet sie sich zu einem jungen Mann, der als einziger nur in kurzer Turnhose und weißem Unterhemd dort steht. Durch die Scheinwerfer werfen alle Personen lange, unheimliche Schatten.
„Ein Feuerwehrmann hat ihn gefunden. In der Wohnung der Toten.“
„Bitte was?“ Ich habe nicht zugehört, meine Gedanken waren noch bei dem kleinen, schreienden Baby. „Was meinen Sie?“
Von Blasierow verdreht die Augen. Eine seiner Lieblingsgesten. Er verzweifelt täglich am Unvermögen seiner Mitmenschen, die ihm nicht genügend Aufmerksamkeit schenken.
„Ich sagte, Frau Lukas, ein Feuerwehrmann hat ihn gefunden. In der Wohnung der Toten.“
Ich starre ihn an. Um was geht es hier eigentlich? „Welche Tote?“, frage ich ungläubig. „Und Fabian? Was ist mit ihm? Ich habe vorhin noch mit ihm tele-“
Blasierow kommt etwas näher. Ich rieche ein Hustenbonbon. Oder den Duft von Zahnpasta?
„Frau Lukas, konzentrieren Sie sich!“ Von Blasierows Blick wandert an der Fassade des vorderen Hochhauses hoch, als hinge Fabian an der Balkonbrüstung im zehnten Stock. „Jemand hat ihm einen Schlag auf den Hinterkopf versetzt. Soweit ich das zum jetzigen Zeitpunkt sagen kann.“ Er räuspert sich. „Also, soweit mir das die Kollegen erklärt haben. Er –“
„Wie schlimm ist es?“, unterbreche ich meinen Chef. „Ist er noch oben?“
„Nein, gerade weg.“ Blasierow schaut in die Richtung, in der mich vor zwei Minuten der Krankenwagen geschnitten hat. „Aber ein paar der Notärzte sind noch da.“ Er seufzt. „So wie es aussieht, hat er eine Gehirnerschütterung. Oder Schädel-Hirn-Trauma oder wie man das heute nennt.“ Mein Chef hält sich eine Hand vor den Mund und gähnt.
Unglaublich! Ich ignoriere sein Desinteresse am Gesundheitszustand einer seiner Mitarbeiter, denn ich habe nichts anderes erwartet. „War er bei Bewusstsein?“, frage ich nur.
Von Blasierow nickt blinzelnd.
Vier Feuerwehrleute mit Atemschutzmasken kommen aus dem Haus und werden von den Bewohnern aufgehalten. Zwei junge Männer stellen sich den Vieren in den Weg, gestikulieren und fragen etwas, das ich auf die Entfernung nicht verstehe. Die Feuerwehrleute schütteln den Kopf und gehen ruhig weiter.