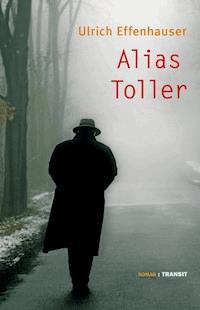15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Transit
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
1985, kurz vor Tschernobyl, wird ein russischer Kernphysiker in Mexiko erschossen. Er hatte an der sowjetischen Atombombe gearbeitet, war dann in der Reaktorsicherheit tätig. Warum war er in Mexiko, war es Verrat, steckte der KGB oder die amerikanische Atomindustrie dahinter? Und was hatte sein Tod mit der späteren Reaktorkatastrophe zu tun? Nach 1989 gibt es brisante Spuren – in Kiew, München und Harrisburg ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 148
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
© 2016 by : TRANSIT Buchverlag
Postfach 121111 | 10605 Berlin
www.transit-verlag.de
Umschlaggestaltung, unter Verwendung
eines Fotos von der Duga-Radarstation in
Tschernobyl, Ukraine, und Layout: Gudrun Fröba
Druck und Bindung: CPI Group, Deutschland
ISBN 978-3-88747-338-9
Ulrich Effenhauser
BRAND
ROMAN : TRANSIT
INHALT
Schreiben an Dr. Ziemer
Notiz 71 »Suchomi«
Mexiko 1985
Unglück
Golubewa
Anatoli Lebedew I
Anatoli Lebedew II
Elena
Wiktor
Prypjat
München
Genf
Zeta
Sensoren
Mexiko 1992
Kerstin
2013
02.08.2013
Sehr geehrter Herr Dr. Ziemer,
im Zusammenhang mit meinem Antritt als Nachfolger von Herrn Heller habe ich eine Bitte: Herr Heller hat mich vorgestern wie vereinbart eingeführt, seine persönlichen Gegenstände mitgenommen und mir das Büro übergeben. Kurz darauf habe ich festgestellt, dass sich in seinem Schreibtisch noch Unterlagen befanden. Herr Heller ist bereits abgereist und telefonisch nicht zu erreichen. Es scheint, als habe er das Material absichtlich hinterlassen. In einer Akte (Kennzeichen A1-BKA.DF-A.H.-15/2013-»Brand«) befinden sich Notizen und Aufzeichnungen, die zu einem Bericht zusammengefasst sind. Der Bericht enthält zahlreiche Fakten, allerdings auch Persönliches. Offenbar handelt es sich um einen Fall aus den achtziger und neunziger Jahren, der nirgendwo dokumentiert ist. Wenn sich die Ereignisse, die Herr Heller beschreibt, tatsächlich so zugetragen haben, dann haben wir es mit einem politisch brisanten Fall zu tun. Ich möchte Sie daher bitten, die Akte zu prüfen und mitzuteilen, wie wir weiter verfahren sollen.
Christoph Jelinka
Notiz 71: "Suchomi"
Hauptstadt Abchasiens, am Schwarzen Meer. Bedeutender Hafen, subtropisches Klima, Wein, traditioneller Kurort, heiße Quellen, Schwefelbäder seit der Antike.
1945 wurden deutsche Wissenschaftler (Kernphysiker, Techniker) in S. interniert (beschlagnahmte Apparate und Materialien in Sonderzügen angeliefert).
Das Forschungszentrum wurde in einem ehemaligen Sanatorium eingerichtet (Bauarbeiten durch Gulag-Gefangene).
Ziel: Trennung der Uran-Isotope zur Gewinnung von bombenfähigem Material.
Forscher: Gustav Hertz (Physiknobelpreisträger 1925), Manfred von Ardenne, Gernot Zippe, Max Steenbeck, Heinz Barwich, Nikolaus Riehl, Max Volmer, Werner Hartmann (insgesamt etwa 300 Pers.)
Oberaufsicht: Stalins Geheimdienstchef Beria.
Strenge Überwachung (Papier-Registrierung, Bestrafung von Verstößen, Kontakt mit Einheimischen nur innerhalb der abgeriegelten Zone etc.)
Ansonsten: hohe Gehälter, komfortables Leben, mildes Klima (Palmen, Oleander, Strandfeste, Verbrüderungen etc.)
Zit.: S. "als zweite Heimat" (Ardenne-Sohn Thomas); als "goldener Käfig" (Riehl)
Zippe und Steenbeck: durchschlagender Erfolg bei der Konstruktion einer Gaszentrifuge (Aufstellung wie bei Spielzeugkreisel; Entwicklungsvorsprung gegenüber USA).
Apotheker Reichmann: Paste aus Nickel und Nelkenöl (gebacken), ergeben Trennrohre mit perfekter Porosität (Stalin-Preis).
50er Jahre: Rückkehr der meisten Forscher nach Dtl. (DDR, BRD); manche nach USA; nur wenige bleiben.
Zit.: "Als am 29. August 1949 im kasachischen Semipalatinsk die erste sowjetische Atombombe gezündet wurde, war dies unter anderem auch ein Erfolg der Wissenschaftler aus Hitlerdeutschland. Die Folgen waren weitreichend."
MEXIKO 1985
Im November 1985 war meine Frau Kerstin im vierten Monat schwanger. Eine schwierige Zeit. Zwei Tage vor dem Abflugtermin teilte ich ihr mit, dass ich die Dienstreise zum jährlich stattfindenden Ermittlertreffen in New York trotz ihrer Bedenken antreten würde. Das war am 25. November 1985.
Der Rückflug von der Tagung am 29. November ging ausgerechnet über Mexiko City, das zwei Wochen zuvor von einem heftigen Erdbeben erschüttert worden war. Der Zwischenstopp zog sich in die Länge. Draußen herrschte Chaos, während ich in der Wartezone amerikanische Zeitungen las (viel über die Abrüstungsverhandlungen mit Gorbatschow in Genf).
Obwohl ich wusste, dass sich meine Frau Gedanken machte, rief ich sie nicht an. Plötzlich wurde mein Name über die Lautsprecher ausgerufen. Im ersten Moment dachte ich, es sei etwas mit Kerstin. Am Schalter stand aber überraschenderweise mein mexikanischer Kollege Juan Valverde.
Valverde hatte nicht nach New York kommen können, aber von einem Kollegen erfahren, dass ich über Mexiko zurückfliege. An diesem Tag werde ohnehin kein Flieger mehr starten, meinte er, ich solle mit ihm aufs Präsidium kommen und könne dann bei ihm übernachten.
Der Anblick der Stadt war verheerend. Häuser in sich zusammengefallen, so viele Menschen verschüttet. Straßen voller Trümmer, doch der Verkehr pulsierte, als ob nichts gewesen wäre. Man ging über Leichen, buchstäblich. An einer Ecke eine umgestürzte Betonwand, darunter zusammengequetschte Autos; abgeknickte Strommasten, davor ein Lieferwagen, der Wäsche ausfährt; Menschen mit Mundschutz, die auf Schutthaufen stehen und graben; davor, mit Cola-Flaschen, zwei Helfer, die sich krümmen vor Lachen. Eine Plaza mit Geschäftsleuten und bunten Reklamen; Hochhäuser ohne Fassaden, mit Blick in die Wohnungen; auf dem Bürgersteig ein Stapel Särge und parkende Limousinen.
Ich rief Kerstin an und sagte ihr, dass ich einen Tag länger in Mexiko bleiben müsse. Sie sagte, es würde ihr nichts ausmachen, aber es klang wie ein Vorwurf.
Die Leiche hatte nichts Besonderes: mittelgroßer Mann, um die sechzig, graue, kurze Haare, breite Nase, die schon einmal gebrochen war, grauweißer Vollbart, hohe Wangenknochen, osteuropäischer Typ, leptosom, blass. Die Todesursache: präziser Herzdurchschuss, ein Profi also. Kugel Fehlanzeige, Projektil Fehlanzeige, Fundort vermutlich nicht identisch mit Tatort.
Ein Sanitäter hatte den Mann hinter einem Schutthaufen entdeckt (nackt, ohne persönliche Gegenstände, Herkunft unbekannt). Ich wollte von Valverde die Autopsie-Ergebnisse haben, aber er musste vorher noch ein Formular abzeichnen lassen – sein Chef sei in diesem Punkt sehr bürokratisch geworden, nachdem ein paar seiner Kollegen sich von Drogenbossen hatten bestechen lassen.
Da Valverdes Vorgesetzter nicht erreichbar war, gingen wir in die Stadt und waren nach wenigen Minuten in einem Park – eine Oase, keinerlei Zeichen von Zerstörung. Wir erreichten die Universitätsbibliothek, einen quaderförmigen Bau, der bunt bemalt war mit indianischen Gottheiten und mythologischen Szenen.
Da Valverdes Chef später immer noch nicht da war, gingen wir gegen 18 Uhr in eine Taberna um die Ecke. Valverde redete pausenlos über die Familie, über das Land, über die Präsidenten. Wir lachten sehr viel an diesem Abend.
Am nächsten Morgen weckte mich Valverde, indem er mit Papieren vor meiner Nase herumwedelte. Seine Frau Lorena begrüßte mich wie einen Familienangehörigen. Sein Chef hatte endlich die Erlaubnis gegeben; am Wohnzimmertisch übersetzte Valverde den vorläufigen Bericht: Das Opfer wurde hinter einem Schutthaufen im äußeren Zentrum der Stadt entdeckt. Nur ein Schuss wurde abgegeben: Er durchbohrte die rechte Herzkammer. Dem Einschusskanal zufolge stand der Täter frontal vor dem Opfer. Die Kugel trat durch den Rücken wieder aus. Da sie trotz mehrstündigen Suchens nicht aufgefunden wurde, war von postmortaler Verbringung der Leiche auszugehen. In der Wunde entdeckte man Überreste von Baumwollfasern, die mit der Kugel in den Körper eingedrungen waren. Laut mikroskopischer Analyse waren die Fasern blau. Das Opfer musste nach der Tat entkleidet worden sein, offenbar hätten die Textilien Beweiskraft gehabt.
Den Todeszeitpunkt hatte der mexikanische Pathologe sehr unpräzise angegeben: Am 27. November hatte man die Leiche gegen 8 Uhr 45 entdeckt, der Mord muss »ein bis vier Stunden vorher« erfolgt sein. Zumindest war der Mann relativ schnell obduziert worden, was einen entscheidenden Hinweis gerettet hatte: Im Magen des Toten hatte man neben Brotresten ein kleines, zusammengeknülltes Stück Papier gefunden, hellgrün, weitgehend unverdaut, das Mordopfer musste es in den letzten Minuten seines Lebens verschluckt haben (der Mann wusste also um die Gefahr, möglicherweise war er vor der Tat gekidnappt worden). Bei dem Papier handelte es sich um eine Busfahrkarte. Die Magensäure hatte die Druckerschwärze aufgelöst, man konnte nichts mehr erkennen.
Valverde zögerte zunächst, die Schrift mit Chemikalien sichtbar zu machen, das Ticket hätte dabei zerstört werden können.
Um 11 Uhr 25 tränkten wir im Labor des Präsidiums das Beweisstück mit Spiritus, legten es unter eine kleine Glashaube, an der wir oben eine Vakuumpumpe befestigten. Valverde schaltete auf mein Zeichen die Pumpe ein. Ich zündete eine Lunte an. Hinter dem Glas entstand eine Flamme, die sogleich wieder erstickte. Auf dem versengten Papier zeigten sich dort, wo die Fasern noch von Druckerschwärze gesättigt waren, etwas heller als beim verbrannten Rest, Buchstaben und Zahlen:
Ciudad de Mexiko/estación central – Tula/excavacion arqueológica Tula/excavacion arqueológica – Ciudad de Mexiko/estación central 23 de noviembre 1985
Valverde hätte auch ohne mich nach Tula fahren können. Aber er wusste genau, dass ich Feuer gefangen hatte.
Zuerst fand ich Tula unspektakulär. Doch als wir oben auf der Pyramide ankamen, war ich sprachlos. Riesige Menschensäulen standen da, fünf Meter hoch, die Krieger der Tolteken. Glatt herausgemeißelt aus schwarzem Vulkangestein, in Tracht, bewaffnet, mit unheimlichen Grimassen, weit offenen Augen und Mündern.
Unten lagen die Ballspielplätze. An den Seiten der Pyramide waren mehrere Reliefs angebracht: ein Vogelmensch, der aussieht wie eine Medusa; Jaguare und Kojoten mit übergroßen Zähnen; Adler, die Herzen auffressen; und immer wieder eine gefiederte Schlange, mit gespaltener Zunge, ein Wesen von zweierlei Gestalt, Leben und Tod. Valverde erklärte mir all diese Götter.
Nach längerem Schweigen sagte er: »Vielleicht ist er hier ermordet worden. Vielleicht wusste er, was auf ihn zukommt.«
Im Tourismusbüro zeigten wir der Angestellten das Foto des Mordopfers. Sie hatte den Mann noch nie gesehen. Valverde bat sie, das Foto ihren Kollegen zu zeigen und sich zu melden, falls ihn jemand erkennen sollte. Das Gleiche sagte er später dem Busfahrer.
Wir fuhren auf der gleichen Strecke zurück wie der Getötete. Valverde war eingeschlafen. Weite Teile der Landschaft waren ausgedörrt, überall vulkanisches Gestein, überall Staub, dann auf einmal Gewitterwolken. Der Bus stoppte. Keine Häuser weit und breit, aber die meisten Fahrgäste stiegen aus. Ich bat den Fahrer, einen Moment zu warten und folgte ihnen. Nach etwa zwanzig Metern, hinter einer Anhöhe, tauchte eine Industrieanlage auf (Fertigungshallen, Fahrzeuge, Gasflaschen, Leute mit Schutzhelmen und Schutzanzügen). Ich kehrte um, steckte dem schlafenden Valverde eine kurze Nachricht in die Brusttasche und ließ den Bus ohne mich weiterfahren.
Ich mischte mich unter die Arbeiter und gelangte, nachdem das Firmentor geöffnet worden war, auf das Gelände. Was hier hergestellt wurde, ließ sich nicht erkennen, die gelagerten Materialien (Kupferrollen, Kunststoffbahnen, verschieden große Gehäuse aus Metall) gaben keinerlei Hinweis. Es begann zu donnern und blitzen, der Regen prasselte, die Leute rannten in die Hallen. Neben einem mit Plastikschrott gefüllten Container befand sich das Büro. An der Tür das Firmenlogo: ein Schwan mit Flügeln wie Feuerzungen. Ich klopfte an, öffnete die Tür, hinter dem Schreibtisch saß eine Mestizin, an ihrem Hals ein hühnereigroßes Geschwür, ansonsten war sie auffallend hübsch.
Sie konnte kein Englisch. Ich zeigte ihr das Bild des Toten, das sie eingehend betrachtete; sie schüttelte den Kopf. Ein merkwürdiger Geruch lag in der Luft, und die Gelassenheit der Frau (sie lächelte, während sie das Foto in der Hand hielt) befremdete mich. Beim Verlassen des Büros erkannte ich den Geruch: Pfeifentabak; er drang durch die Tür, die an der anderen Seite des Büros einen Spaltbreit geöffnet war.
In der Fertigungshalle lagerten in einem Gitterkasten Hunderte von Platinen, wie sie in elektrischen Geräten Verwendung finden. Vielleicht war die Firma ein Zulieferbetrieb für die Herstellung von Radios oder Kassettenrekordern, vermutete ich damals.
Um 17 Uhr 30 war ich zurück im Präsidium und staunte nicht schlecht, dass sich Dutzende von Leuten vor Valverdes Tür drängten, angeblich alles Zeugen des Mordfalls. Ein älterer Mann wurde gerade befragt. Nach kurzer Vernehmungsdauer unterschrieb Valverde ein Formular, das er dem Zeugen aushändigte. Er sagte mir, dass der Alte eine Drogenübergabe beobachtet habe; ein Schwarzer hätte einem bärtigen Mann ein Messer in die Brust gestoßen.
Ich schüttelte den Kopf, Valverde sagte, es sei eine Anordnung von ganz oben, er habe die Aussage als sachdienlich einzuordnen. Dann erklärte er mir den üblichen Ablauf: Nach jedem Mord versammelte sich das halbe Viertel auf dem Präsidium und tischte den Beamten Verbrechermärchen auf. Der zuständige Polizist unterschrieb ein Formular, die Leute brachten es zur Zahlstelle, wo sie ein paar Pesos bekamen, mit denen sie sich etwas zu essen kaufen konnten. Wenn sie wieder Hunger hatten, kamen sie ein zweites Mal, in der Regel mit einer anderen Geschichte.
Von den 29 Zeugen, die bislang in unserem Fall ausgesagt hatten, hatten 29 angegeben, es sei um Drogen gegangen. Den Grund dafür formulierte Valverde so: »Wenn es um die Drogenmafia geht, dann werden die Gelder schnell ausgezahlt. Wir lassen uns sagen, was wir hören wollen – und jedem ist damit gedient.«
Eine andere Aussage stammte von einem Mädchen (zehn oder elf Jahre alt): Der Mörder habe dem Opfer zwischen zwei Schutthaufen mit einer kleinen Pistole in den Kopf geschossen. Dann sei er weggerannt und in ein Auto gestiegen, das schnell davongefahren sei. Auf die Frage nach dem Aussehen des Ermordeten gab das Mädchen an, dass er einen Anzug getragen habe. Als es hinausging, blieb es kurz stehen und sagte wörtlich: »El asesino parecía un gigante sin cabellos.« Hinter dieser Äußerung habe ich damals ein Fragezeichen gemacht, sie schien mir unglaubwürdig. Dass der Mörder »wie ein Riese ohne Haare« ausgesehen haben soll, war bis zu diesem Zeitpunkt von keinem anderen Zeugen behauptet worden. Auch wurde dem Opfer nicht in den Kopf, sondern in die Brust geschossen.
Kurz darauf erhielten wir den Laborbefund. Die Blutuntersuchung hatte ergeben, dass das Mordopfer an Leukämie erkrankt war. Der Mann hatte nicht mehr lange zu leben.
Ein Geräusch, wie ich es noch nie gehört hatte, erfüllte im gleichen Moment den Raum und wurde immer lauter. Die Wände wackelten, das gerahmte Bild des Staatspräsidenten fiel herab und zerbrach. Valverde war aufgesprungen und zerrte mich zur Tür: »El sismo, el sismo«. Ich weiß nicht, wie lange das Beben dauerte. Mit einem plötzlichen Ruck war es wieder vorbei.
Es war das fünfte Nachbeben gewesen. Draußen lagen Leute auf dem Boden, die Stille war gespenstisch. Eine Schwangere blutete aus der Nase; ein Mann stand auf und stimmte ein Lied an. Ein dicker Beamter mit Krawatte rannte die Treppe herunter, drückte Valverde Papiere in die Hand und brüllte ihn an. Dann lief er nach draußen und fuhr in seinem Wagen, einem roten Chevrolet Corvette, mit hoher Geschwindigkeit davon. »Das war mein Chef«, sagte Valverde trocken.
In seinem Büro herrschte absolutes Chaos. Nachdem Valverde den Schreibtisch an seinen ursprünglichen Ort zurückgeschoben hatte, unterschrieb er den Bericht – ich war ziemlich erstaunt, dass er den Fall abschließen wollte. Aber Valverde sagte: »Der Mann war ohnehin so gut wie tot. Opfer der Drogenmafia, vermutlich selbst kriminell, fast alle Aussagen gehen in diese Richtung.« Er entschuldigte sich noch bei mir, dass er mir meine Zeit gestohlen hab, und fuhr mich zum Flughafen.
UNGLÜCK
Beim Abflug hatte ich den Fall eigentlich abgehakt. Es war nicht absehbar, dass ich mich noch einmal damit beschäftigen würde. Aber offenbar hatte ich in Mexiko einen Fluch auf mich geladen. Über dem Atlantik bekam ich von einem Moment auf den anderen eine Panikattacke (zitternde Hände, Lähmungserscheinungen in den Beinen, Atemnot, Herzrasen). Je mehr ich versuchte, dagegen anzukämpfen, desto schlimmer wurde es. 1985 hatte es eine extreme Häufung von Katastrophen gegeben, mit Hunderten von Toten (Hungersnot in Äthiopien; mehrere Flugzeugabstürze; Feuersbrunst im Fußballstadion von Bradford; verheerende Flutwelle im Stavatal; Eisenbahnkollision in Portugal; das Erdbeben von Mexiko). Das alles verdichtete sich in meinem Kopf zu einem Bilderkarussell, das sich immer schneller drehte.
Typischerweise ging die Panikattacke über in einen tiefen Schlaf, aus dem ich kurz vor der Landung wieder erwachte. Ich hatte geträumt: Der mexikanische Gott der Morgenröte bildet mit seinem Rücken einen Berg, an dem Flugzeuge zerschellen. Mit den Händen zerrt er die Sonne in Richtung Erde, und in Afrika verdorren die Felder. Mit seinem Finger kippt er einen Staudamm um, und eine Flut ergießt sich über das Land. Mit aufgeblähten Backen bläst er gegen Holztribünen, und die Flammen lodern in den Himmel. Mit nackten Füßen stampft er seinen Totentanz, und eine Millionenstadt fällt in sich zusammen. Zuletzt schießt er einen Pfeil ab. Was das Ziel war, konnte ich nicht erkennen; aber ich ahnte, dass die Pfeilspitze ein Leben beendete, das mir wichtig war.
Als ich am Abend des 2. Dezember nach Hause kam, war Kerstin nicht da. Sorgen machte ich mir nicht, ich dachte, sie sei noch in der Praxis. Erst später bemerkte ich das Blinken des Anrufbeantworters. Die Worte werde ich nie vergessen: »Ich bin im Krankenhaus … Es geht uns nicht gut … Bitte komm schnell.«
Ich fuhr sofort los. Kerstin wirkte erstaunlich ruhig, sie begrüßte mich mit einem Scherz. Am Tag zuvor war es zu einer Blutung gekommen, bei der sie das Kind beinahe verloren hätte. Man hatte ihr strikte Bettruhe verordnet, bis zum Ende der Schwangerschaft.
Dann wollte sie jedes noch so kleine Detail meiner Reise wissen, auch der Mordfall schien sie zu interessieren. Natürlich war ich erleichtert, dass sie mir keine Vorwürfe machte.
Schon drei Tage später, wegen einer Nichtigkeit, kam dann die große Aggression. Ich hatte gefragt, ob ich Blumen kaufen soll. Diese Frage löste eine wahre Gefühlslawine aus: »Warum bist du weggefahren? Ich hätte dich gebraucht!«
Reflexartig formulierte ich Rechtfertigungen. Dass sie Kerstins Wut nur vergrößerten, habe ich nicht gleich realisiert. Ihr Vorwurf, das Kind sei mir ja ohnehin vollkommen egal, hat mich sprachlos gemacht. Sie wollte allein sein, ich solle gehen. In den folgenden Tagen lag ich starr und bewegungslos in unserer Wohnung auf dem Sofa.
Am 8. Dezember kam Kerstin nach Hause. Zum ersten Mal seit langer Zeit nahm ich Urlaub. Wenn ich früher von der Arbeit weg war, wurde ich unruhig. Ständig musste ich im Dezernat anrufen, den neuesten Stand wissen. Das Büro war wirklich meine Heimat. Kerstin hatte das immer verstanden, sie war ja selbst so. Eingefleischte Psychologin, mit den Gedanken so gut wie immer in der Praxis, das gefiel mir gerade an ihr. Die Jahre, in denen wir uns ganze Abende lang unsere Fälle erzählten, waren die besten unserer Ehe.
Da mein Chef mich kannte, hatte er mir verboten, während des Urlaubs ins Dezernat zu kommen oder anzurufen. Ich habe mich daran gehalten. Ich gab mir alle Mühe, Kerstin gegenüber den Eindruck zu erwecken, dass mir die Familie wichtiger war als die Arbeit – mit der Zeit glaubte ich sogar selbst daran. Unsere Stimmung war gut in diesen Wochen, auch wenn Kerstin das Liegen Probleme bereitete. Wir sahen uns stundenlang Videos an. Manchmal streichelte ich vorsichtig über Kerstins Bauch.
Dann kam der 28. Januar 1986. In meinem Notizbuch nimmt der Tag zweieinhalb Seiten ein: Wir sind früh zu Bett, sahen noch ein wenig fern, schliefen dabei ein. Mitten in der Nacht wachte ich auf. Im Fernsehen die Spätnachrichten: Das amerikanische Spaceshuttle Challenger war kurz nach dem Start explodiert, alle Astronauten tot.