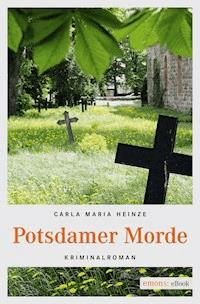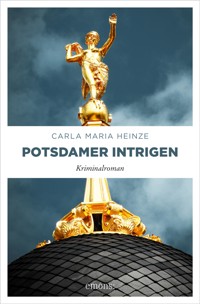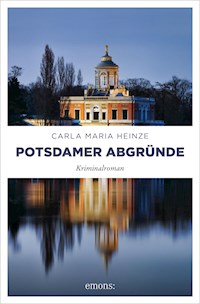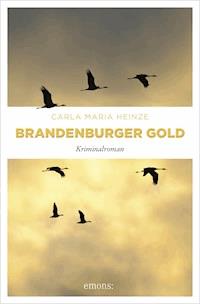Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Enne von Lilienthal
- Sprache: Deutsch
Zwei Leichen im barocken Kloster Neuzelle geben Enne von Lilienthal, der ehemaligen Fall-Analytikerin des LKA Berlin, Rätsel auf. Warum wurde einer der Toten in Büßerpose auf dem Kirchenboden platziert? Welche Verbindung besteht zwischen den beiden Mordopfern, einem Pfarrer und einem renommierten Professor? Schritt für Schritt kommt Enne gemeinsam mit ihrem Sohn Maik, Kommissar in Potsdam, einem Familiengeheimnis auf die Spur - doch damit ist der Fall noch lange nicht gelöst. Als Enne erkennt, wie tief sie in die Vergangenheit eintauchen muss, ist sie längst in tödlicher Gefahr.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 461
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carla Maria Heinze, geboren in Kleinmachnow, einem Vorort von Berlin, mag alles, was nicht in eine Schablone passt. Menschen, Meinungen und Lebensentwürfe. Ihre Kriminalromane handeln davon. Viele Reisen führten sie über alle fünf Kontinente. Heute lebt sie in Stahnsdorf, zwischen Potsdam und Berlin.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2015 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: photocase.com/[martin] Umschlaggestaltung: Tobias Doetsch Lektorat: Jutta Schneider eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-914-1 Originalausgabe Wir danken der Essex Musikvertrieb GmbH Hamburg für die Abdruckgenehmigung des Liedtextes »Sag mir, wo die Blumen sind«.
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons:
Für Bodo
Ohne dich wäre ich…
Sag mir, wo die Blumen sind,
wo sind sie geblieben?
Sag mir, wo die Blumen sind,
was ist geschehen?
Sag mir, wo die Blumen sind,
Mädchen pflückten sie geschwind.
Wann wird man je verstehen,
wann wird man je verstehen?
Sag mir, wo die Gräber sind,
wo sind sie geblieben?
Sag mir, wo die Gräber sind,
was ist geschehen?
Sag mir, wo die Gräber sind,
Blumen wehen im Sommerwind.
Wann wird man je verstehen,
wann wird man je verstehen?
Originaltext: »Where Have All the Flowers Gone« von Pete Seeger, 1955,
Prolog
Er blickte ihn an. Lächelte. Es war so tröstlich. Wurde größer, überragte ihn. Alles war so einfach. So leicht. Ruhe. Schutz. Geborgenheit. Das Licht brach sich im Gold. Wurde heller, strahlte, dann verblasste es und verschwand. Akkorde erklangen. Fügten sich zu einer gewaltigen Sinfonie. Das Buch glitt ihm aus der Hand.
Von weit her hörte er: »Denn so wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, haben wir fürder kein anderes Opfer mehr für die Sünden.«1
Das war es, was er hatte sagen wollen. Aber jetzt war alles gut. Ego sum resurrectio et vita.2 Er bemerkte nicht mehr das erstaunte Aufblitzen in den Augen seines Gegenübers. Fühlte nicht die fahrigen Finger, die nach seinem Puls suchten. Dunkel und volltönend läuteten die Glocken zur sechsten Abendstunde.
1
18.April– Kloster Neuzelle
»Er ist heimgegangen.«
Thomas Gruber, Sakristan von St.Marien, blickte von seiner Checkliste für die heutige Abendandacht hoch. »Wie bitte?« Kerstin Lubbien öffnete den Mund, aber kein Wort drang zu ihm. Seine Stellvertreterin, Sakristanin in der Neuzeller Klosterkirche, die sonst so ausgeglichen war und fest in sich ruhte, sah ihn mit leerem Blick an. Das bäuerlich runde und gewöhnlich so rosige Gesicht war jetzt ohne jede Farbe.
»Thomas, ich brauche deinen Beistand«, flüsterte sie und fing ohne jede Vorwarnung an zu weinen. Wie ein Kind. Haltlos. Laut. Sie griff nach seinem Arm und zog ihn mit sich hinaus.
Der Wagen fuhr so dicht an ihr vorbei, dass Enne erschrocken auswich. »Notarzt« stand in roten Lettern an der Seite des hellen Golfs. Er hielt direkt vor dem Portal. Ein korpulenter Mann mühte sich heraus, öffnete die hintere Tür, zog eine Arzttasche hervor, lief hastig über das unebene Kopfsteinpflaster des Vorplatzes und verschwand in der Kirche.
Enne schob den Ärmel ihrer Jacke hoch und schaute auf die Armbanduhr. Viel Zeit blieb ihr nicht mehr. Sie ging hinüber zur Klosterbrauerei. »Himmlisch gut seit 1589« las sie über dem Eingang des Klosterladens. Es war noch geöffnet. Im Inneren des Ladens mit seiner niedrigen Decke stapelten sich an den Wänden Kästen mit den verschiedensten Biersorten. Auf einem Regal an der Seite standen Bierkrüge, verschiedene Accessoires und Geschenkverpackungen. Die Neuzeller Brauerei war berühmt für ihre Biere, nicht nur in der Region.
Enne blickte um sich. Dann sah sie ihn. Den kleinen schwarzen Mönch auf der Flasche. Sie griff zu dem Geschenkkarton »Schwarzer Abt«, dem Spezialbier der Neuzeller Brauerei. Gebraut nach den überlieferten geheimen Rezepten der Zisterziensermönche.
»Eine gute Wahl«, sagte die Verkäuferin, als Enne ihren Karton auf die Theke legte. »Gesund und bekömmlich.«
Enne kramte in ihrer Tasche nach dem Portemonnaie. »Das hoffe ich doch sehr«, erwiderte sie. Nahm das Wechselgeld, das ihr die Verkäuferin reichte, stopfte es in ihre Jackentasche, klemmte sich den Karton unter den Arm und ging hinaus zum verabredeten Treffpunkt, der Christussäule aus dem Jahr 1735, direkt vor den alten Backsteingebäuden der Brauerei.
Friedrich war noch nicht da. Sie sah sich um. Der letzte Reisebus mit Touristen verließ den Parkplatz neben dem Kloster und schaukelte um die Ecke. Enne schlenderte am Karpfenteich vorbei bis zu der dreiflügeligen Toranlage mit dem Strahlenkranz über dem Portal und dem Christusmonogramm IHS3, wo zwischen den beiden Aposteln Petrus und Paulus Jesus mit den Emmausjüngern abgebildet war. Mit dem Bierkarton im Arm, ihrer apfelgrünen Barbour-Jacke und den dunkelblauen Leinenhosen wirkte Enne von Lilienthal wie eine gut situierte Touristin. Das Bier »Der schwarze Abt« war für Friedrich bestimmt. Es sollte ein ironischer Hinweis auf sein Referat bei dieser Veranstaltung sein. Enne selbst war weder Mitglied bei der veranstaltenden Partei noch bei einer der christlichen Religionsgemeinschaften und fühlte sich in dieser Umgebung wie aus der Zeit gefallen. Die von Lilienthals gehörten, so lange sie denken konnte, dem lutherisch-evangelischen Glauben an. Sie selbst hatte zeit ihres Lebens um die Kirche einen Bogen gemacht, lehnte aber die Institution als solche nicht ab. Enne fand sie unentbehrlich in der heutigen Zeit, in der die einfachsten Regeln des Anstandes, von christlicher Wertevermittlung ganz zu schweigen, bei vielen Leuten kaum noch Beachtung fanden.
Die Veranstaltung der Christlich Demokratischen Union Brandenburg, an der sie auch eben teilgenommen hatte, war zu Ende gegangen. Einige Teilnehmer, überwiegend mittelständische Unternehmer aus der Umgebung, winkten ihr zum Abschied zu, bevor sie in ihre Autos stiegen. Die Partei hatte zum Dialog eingeladen. Auf der heutigen Tagung war es um Optionen der wirtschaftlichen Entwicklung mit Hilfe des Länderfinanzausgleichs in der Niederlausitz gegangen, insbesondere um die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Referent Friedrich Schönburg, emeritierter Professor an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder, war ein alter Freund von ihr.
Wo bleibt Friedrich nur?, dachte Enne mit leichtem Unwillen. Sie hier warten zu lassen sah ihm so gar nicht ähnlich. Sie wollten anschließend ins »Forsthaus Siehdichum« ins Schlaubetal fahren und dort etwas essen. Enne wandte sich nach links zum Klausurgebäude, stieg die Treppen hoch und ging bis zum Refektorium, dem Raum, in dem die Veranstaltung stattgefunden hatte. Das zweischiffige Kreuzgewölbe mit Mittelsäulen aus dem 14.Jahrhundert fungierte mittlerweile nicht mehr als Speisesaal für die Mönche, sondern als Schauplatz von Veranstaltungen oder Konzerten. Vor dem Eingang standen zwei Männer, die sie als Mitarbeiter des Stifts Neuzelle wiedererkannte.
»Michaelis ist tot«, hörte sie im Vorübergehen den jüngeren der beiden sagen. Mittelblond, mit akkuratem Scheitel und einem glatten Gesicht, sah er sein Gegenüber mit erschrockenen Kinderaugen an.
»Jesus Christus«, flüsterte der andere, älter und von kräftiger Statur. »Was ist denn passiert?«
»Kerstin hat ihn gefunden, als sie die Abendmesse vorbereitete. Direkt gegenüber dem Kreuzaltar in einem der alten Kirchenstühle.«
»Aber er war doch noch nicht so alt?«
»Noch nicht mal fünfzig«, murmelte der jüngere. »Der beste Pfarrer, den wir seit Langem hatten.«
Enne betrat den Veranstaltungsraum. Die meisten Teilnehmer hatten das Refektorium bereits verlassen. Ihre Sitznachbarin von eben, eine kompakte Mittfünfzigerin mit pflegeleichtem grau gesprenkeltem Herrenschnitt, nickte ihr zu.
Enne ging zu ihr. »Haben Sie Professor Schönburg gesehen?«
»Der ist nicht mehr hier. Ex und hopp, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich hatte mir noch einige Fragen notiert. Während der Pause hat er mich auf später vertröstet. Und jetzt? Darf ich die mir selbst beantworten, oder was? Ich komm doch nicht extra hierher, um im Regen stehen gelassen zu werden. Das Honorar war ihm wohl das Wichtigste.« Sie musterte Enne mit Wieselaugen. »Sie kannten den Professor doch näher, oder?«
»Ich schau noch mal draußen nach«, erwiderte Enne rasch, bevor die andere sie in ein langatmiges Gespräch verwickeln konnte. Sie lief hinaus. In der Eile stieß sie einen der Männer an der Tür mit dem Bierkarton in die Seite. »Entschuldigung, ich suche Professor Schönburg.«
»Professor Schönburg wollte noch in die alte Sakristei«, antwortete der andere. »Aber ob das so gut ist, jetzt…«
Das Ende des Satzes hörte sie schon nicht mehr. Friedrich hatte in der Kaffeepause von der Stiftskirche geschwärmt und zum Abschied noch einen letzten Blick hineinwerfen wollen. Er hatte sie aufgefordert, mitzukommen. Zu dumm, das hatte sie total vergessen. Der Nachmittag hatte sich zäh wie Gummi hingezogen. Die Probleme der Mittelständler interessierten sie eher am Rande. Aber seit ihrer Pensionierung im Landeskriminalamt Berlin war ihr jeder Anlass recht, um unter Menschen zu kommen. Als ehemalige Fallanalytikerin hatten sie in ihrer aktiven Zeit eher die Auswirkungen der Wirtschaftskriminalität interessiert, aber das lag nun hinter ihr.
Enne klemmte den Karton fester unter den Arm und lief hinüber zur Kirche, öffnete die schwere Eingangstür und trat durch die Schwingtür in den Altarraum, ohne das monumentale Wandgemälde mit dem Stifter von Neuzelle in der Vorhalle eines Blickes zu würdigen. Im vorderen Teil des Kirchenschiffs erblickte sie eine Gruppe von Menschen. Jemand weinte.
»Bitte warten Sie draußen. Wir haben hier einen Notfall.« Ein hochgewachsener Mann mit schütterem Haar, dessen dunkler Anzug seine hagere Gestalt noch betonte, kam auf sie zu. Seine hellen blauen Augen wanderten zu ihrem Bierkarton. Missbilligend verzog er die Mundwinkel.
»Entschuldigung.« Enne versuchte, über seine Schulter zu spähen. »Ich suche Professor Schönburg. Wir sind verabredet.«
»Den Dozenten?« Enne nickte. »Den habe ich hier nicht gesehen.«
Er schaute zurück zu den anderen und zuckte mit den Schultern. »Entschuldigung, aber ich werde gebraucht. Tut mir leid, da kann ich Ihnen nicht helfen. Gehen Sie zur Information und sagen Sie, Herr Gruber hätte Sie geschickt. Vielleicht weiß man dort, wo Herr Schönburg ist.«
»Danke, ja, das wird das Beste sein«, erwiderte sie. Als Gruber außer Sichtweite war, lief sie– einer Eingebung folgend– zur anderen Seite und schlüpfte in einen der Beichtstühle, die die rechte Nordwand des westlichen Seitenschiffs einnahmen. Von hier aus konnte sie besser sehen, was dort vorn vor sich ging. Neugierig beugte sie sich vor. Gruber redete auf eine Frau ein. Ein Mann telefonierte. Enne beugte sich noch etwas weiter vor.
Dann sah sie es. Schwarze Hosenbeine ragten in den Gang. Jemand sprach das Vaterunser. In einer Kirche zu sterben, war das ein Vorteil oder ein Nachteil? Das kam immer auf den Standpunkt an, ging es ihr durch den Kopf. Unwillkürlich musste sie lächeln. Schnell biss sie sich auf die Lippen. Wenn man sie hier im Beichtstuhl sah. Als Grinsekatze und mit dem Bierkarton. Peinlich. Vor allem vor Friedrich. Der legte immer Wert auf angemessenes Verhalten oder was er dafür hielt. Vielleicht war Friedrich immer noch in der Sakristei? Aber dann hätte er doch die Leute vorn im Kirchenschiff hören müssen.
Sie hatte ihm von der Darstellung der Passionsgeschichte aus dem Jahr 1751 erzählt. Aber natürlich war sie Friedrich bereits bekannt, und vor allen Dingen wusste er immer alles besser, und ehe man sich’s versah, erhielt man, ob gewollt oder nicht, einen Vortrag darüber. Bemalte Leinwände auf Keilrahmen und Holztafeln als Bühnendekoration. Eine solche Fülle an Szenen und Inhalten war völlig einzigartig in der Kunstgeschichte. »Die Neuzeller Passionsdarstellungen gelten heute als einmalig in Europa«, hatte er doziert. Vorsichtig spähte sie nach draußen. Vor dem Annen-Altar in der Nähe befand sich niemand. Jedes Geräusch vermeidend, stand sie auf und huschte aus dem Beichtstuhl.
Der Eingang der alten Sakristei war mit einem Vorhang verhüllt. Sie schob das schwere dunkelrote Tuch beiseite und trat in den mittelalterlichen, mit Kreuzrippen gewölbten Raum. Schummriges Licht umgab sie. Ihr Fuß stieß gegen etwas. Sie blickte nach unten. Dumpf schlug der Bierkarton auf den Steinplatten auf. Eine dunkle Lache bildete sich zu ihren Füßen.
Lang ausgestreckt, das Gesicht am Boden, die Arme weit geöffnet, lag Friedrich Schönburg vor ihr. Der Vorhang wurde beiseitegezogen.
»Oh mein Gott!«, sagte jemand. Enne fühlte eine Hand auf ihrem Arm. Behutsam führte sie jemand nach draußen zu einer der Kirchenbänke.
»Kommen Sie, setzen Sie sich.« Es war Gruber.
»Friedrich«, flüsterte sie. »Es ist Professor Schönburg.« Gruber nahm ihre Hand, und da erst merkte Enne, dass sie unkontrolliert am ganzen Körper zitterte.
»Warten Sie einen Moment. Ich bin gleich wieder bei Ihnen.« Wenig später eilte der Mann, den sie vorn in der Gruppe eben schon gesehen hatte, an ihr vorbei und verschwand in der Sakristei. Zwei junge Männer, bekleidet mit rot-weißen Westen über ihren Overalls, auf denen das Wort »Sanitäter« stand, liefen durch den Hauptgang zum Kreuzaltar.
»Heute liegt kein Segen über St.Marien«, murmelte Gruber neben ihr, der wieder zurück war. Besorgt sah er sie an. »Ich hole Ihnen etwas zu trinken.«
Enne nickte dankbar. Sie war froh, einen Augenblick allein zu sein. Warum Friedrich?, dachte sie. Er war doch eben noch lebendig gewesen, so witzig und schlagfertig, mit seinem spöttischen Blick unter den buschigen Brauen.
Die beiden Sanitäter kamen vom vorderen Teil des Kirchenschiffs an Enne vorbei; auf der Trage zwischen ihnen lugten unter der Decke schwarze Hosenbeine hervor. Eine kräftige, hochgewachsene Frau, deren blondes Haar wie eine Kappe den Kopf bedeckte, folgte ihnen. Mit ihren halb geschlossenen Augen schien sie ihre Umgebung kaum wahrzunehmen.
»Er ist bei unserem Herrn«, hörte Enne sie murmeln. Ihre Augen füllten sich mit Tränen. Sie versuchte, ein Schluchzen zu unterdrücken, zog ein Taschentuch aus ihrer Jacke und presste es sich auf den Mund. Die Frau war neben ihr stehen geblieben. Aus einem Impuls heraus berührte Enne ihren Arm. Die Blonde wich zurück, starrte sie für den Bruchteil einer Sekunde entsetzt an. Dann rannte sie hinaus.
Wieso zwei Tote?, dachte sie verwirrt. Enne schloss die Augen. Sie hatte das Gefühl, als wenn ihr Kopf platzen würde.
»Herzversagen«, hörte sie jemanden sagen.
»Wie bei Pfarrer Michaelis«, erwiderte eine andere Stimme.
Enne putzte sich die Nase, wischte die Tränen von den Wangen, stand entschlossen auf und ging zurück in die alte Sakristei. Sie vermied es, auf den leblosen Körper zu schauen, der noch bis vor Kurzem ihr alter Freund, der eloquente Friedrich Schönburg, gewesen war. Charmant und mit einem beinahe enzyklopädischen Wissen. Hochgewachsen, mit markanten Zügen, vollen weißen Haaren, kaum Bauchansatz, trotz seiner beinahe siebzig Jahre. Sie hatten sich vor einer Ewigkeit an der Freien Universität Berlin kennengelernt. Damals hatten sie Sitzblockaden für alles und jedes oft gemeinsam absolviert. Nächtelang hatten sie über Politik diskutiert. Über den NATO-Doppelbeschluss und die Bedrohung durch die SS-20-Raketen der Russen debattiert. Beide wollten ein besseres Deutschland. Enne war jünger als er. Schon damals fielen ihm die Mädels reihenweise in den Arm. Er war mit einer anderen abgezogen. Sie war damals noch zu unerfahren gewesen. Später lernte Enne ihren Mann kennen, aber die Freundschaft zu Friedrich hatte Bestand über alle persönlichen Schiffbrüche hinweg.
Friedrich Schönburg, inzwischen CDU-Mitglied in Potsdam-Mittelmark, konservativ bis in die Knochen, ließ kein Fettnäpfchen aus, wenn es galt, seine Meinung durchzusetzen. Durch die Zeitung hatte sie von der Tagung im Stift Neuzelle erfahren und ihn kurzerhand angerufen und sich mit ihm verabredet. Sie hatte sich im »Forsthaus Siehdichum«, dem ehemaligen Sommersitz der Äbte des Neuzeller Klosters, ein Zimmer gemietet. Zu DDR-Zeiten ein Gästehaus des Staatsrates und nicht für jedermann zugänglich, erstrahlte das Interieur immer noch im Charme der achtziger Jahre.
»Wie Herzversagen?«, wiederholte Enne, als sie zu dem Arzt trat. »Professor Schönburg hat sich erst vor wenigen Tagen einem Gesundheitscheck unterzogen, der ihm beste Werte bescheinigte. Könnten Sie ihn bitte noch einmal untersuchen?«
»Sind Sie Ärztin?«
»Nein«, antwortete Enne und merkte, dass sie anfing, sich über den Ton des Mediziners zu ärgern.
»Verwandt?«, fragte der Notarzt knapp, der mit hoch sitzenden Geheimratsecken und fahlen Haupthaaren deutliche Alterserscheinungen zeigte.
Enne schüttelte den Kopf. »Ich bin eine Freundin«, erklärte sie und merkte sofort, dass das ein Fehler war.
»Dann mischen Sie sich bitte nicht in meine Untersuchungen ein. Glauben Sie mir einfach.« Der Mediziner nahm einen Bogen Papier aus seiner Arzttasche und trug Daten darauf ein. Er wandte ihr den Rücken zu und beachtete sie nicht weiter. Enne ging um ihn herum und stellte sich direkt vor ihn. Auch wenn sie nur hunderteinundsechzig Zentimeter maß, so konnte sich niemand ihrer Autorität entziehen.
»Finden Sie die Stellung, in der der Tote liegt, nicht merkwürdig?«, insistierte sie.
»Raus«, knurrte der Arzt und fixierte sie aus zusammengekniffenen Augen.
Enne lächelte. Na also, dachte sie, kalt erwischt. »Zwei Männer werden beinahe zeitgleich tot aufgefunden. Das ist doch ungewöhnlich, oder?«
Der Arzt steckte die Unterlagen in seine Tasche, und ohne Enne eines Blickes zu würdigen, ging er an ihr vorbei.
»Fertig«, sagte er zu den beiden Sanitätern, die den ersten Toten bereits weggebracht hatten und gerade hereinkamen. In aller Eile zog Enne ihr iPhone aus der Jackentasche und machte aus verschiedenen Blickwinkeln Aufnahmen von dem Leichnam. Maik hatte ihr das Telefon letzte Weihnachten geschenkt. Erst hatte sie sich vehement gesträubt, so ein teures Ding zu benutzen. Ihr zwei Jahre altes Klapphandy sei total ausreichend für ihre Bedürfnisse, hatte sie argumentiert. Aber jetzt war sie froh über das Gerät, mit dem sie schnell und unkompliziert gute Aufnahmen gemacht hatte. Die Sanitäter stellten die Trage auf den Boden, legten den Toten auf eine Folie, bedeckten den Körper damit und trugen ihn hinaus.
Gruber stand neben ihr und hielt ihr ein Glas mit Wasser entgegen.
»Ich glaube, ich brauche jetzt etwas Stärkeres«, sagte Enne.
»Wie Sie wollen.« Grubers eben noch mitfühlender Blick verwandelte sich in ein herablassendes Lächeln.
Der denkt, ich bin Alkoholikerin, ging es ihr durch den Kopf. Aber das war ihr egal. Sie fühlte sich immer noch ausgesprochen zittrig, und ein Cognac, mindestens aber ein Glas Weinbrand, würde ihr wieder auf die Beine helfen. Sie bückte sich und wollte den Bierkarton aufheben. Dunkle Flüssigkeit hatte einen Schatten um die Verpackung gebildet. Sie zog eine Packung Papiertaschentücher hervor und wollte die Spuren auf dem Boden beseitigen.
»Lassen Sie nur, das mache ich gleich sauber«, entgegnete Gruber spitz.
Sie nahm den Karton in beide Hände und hielt ihn von sich weg, um sich nicht schmutzig zu machen, bedankte sich und verließ die Kirche.
Draußen auf dem Stiftsplatz umgab sie der unbeschwerte Abendchoral der Vögel. Die Klostermauern erstrahlten im rötlich goldenen Abendlicht.
»Hallo Maik«, sagte Enne, als Lilienthal sich am anderen Ende gemeldet hatte, »was macht deine Autoschieberbande?« Für eine Sekunde blieb es still am anderen Ende.
»Was ist der Grund deines Anrufs, Mutter? Grenzüberschreitende Kriminalität hat dich doch noch nie sonderlich interessiert.«
Sie zögerte, dann sagte sie: »Friedrich ist tot.«
»Friedrich Schönburg?«
»Ja, ich habe ihn gefunden.«
»Wo bist du denn?«
»Im Kloster Neuzelle.«
»Makabrer Ort zum Sterben«, bemerkte Lilienthal und fügte nach einer kurzen Pause hinzu: »Entschuldige bitte, es tut mir leid.«
»An Friedrichs Tod stimmt etwas nicht.« Wieder blieb es einen Moment still in der Leitung, dann antwortete ihr Sohn, Hauptkommissar von der Kripo Potsdam, in strengem Ton: »Mutter, Friedrich war beinahe siebzig, wenn ich mich recht erinnere, da darf man schon mal sterben.«
»Friedrich war topfit. Erst gestern hat er mir stolz von seinen phantastischen Blutwerten erzählt. Seine Cholesterin- und Leberwerte waren so gut wie die eines jungen Mannes. Mein Blutbild ist nicht annähernd so gut.«
»Weniger trinken, weniger rauchen«, hörte sie ihren Sohn murmeln. Typisch, dachte sie grimmig, mit siebzig galt ein Mann in den Augen eines Mittdreißigers schon beinahe als scheintot. Da sollte er sich mal bei den Politikern umsehen. Die stemmten immer noch ein Tagespensum, das viele Jüngere nicht durchhalten würden. Sie schluckte ihre Verärgerung hinunter.
»Maik, Friedrich lag in ritueller Demutsgeste auf dem Boden, weißt du, so wie die Priester bei ihrer Weihe vor dem Altar. Wenn man einen Herzinfarkt bekommt und umfällt, liegt man nicht kerzengerade da und streckt die Arme wie zum Kreuz aus. Das habe ich auch dem Notarzt gesagt, aber der hat mir überhaupt nicht zugehört.«
»Also, ich würde das nicht überbewerten. Vielleicht wollte er sich einfach noch mal hochstemmen und ist dann zusammengebrochen, so was kann doch mal vorkommen«, kam es vom anderen Ende. Dann versöhnlicher: »Es tut mir sehr leid um Friedrich, aber kann es sein, dass du in deiner Trauer seinen natürlichen Tod einfach nicht wahrhaben willst? Wenn ich mich recht erinnere, war Friedrich ein Perfektionist. Dem würde ich zutrauen, dass er gerade an so einem Ort das versucht hat auszuprobieren.«
»Was auszuprobieren?«, fragte Enne irritiert.
»Na, das mit der rituellen Demutsgeste. Vielleicht hat er sich selbst so hingelegt und dabei den Infarkt bekommen.«
»So ein Blödsinn, Maik. Friedrich hätte sich nie und nimmer in einer Kirche auf den Steinfußboden gelegt. Der war so etwas von etepetete, was seine Kleidung anging. Aber da ist noch was.« Sie wartete seine Frage gar nicht ab, sondern fuhr fort: »Der Pfarrer von St.Marien wurde beinahe zeitgleich in der Kirche gefunden. Angeblich auch Herzversagen, und der war noch nicht alt«, fauchte sie empört.
»Zur gleichen Zeit?«, fragte Lilienthal überrascht.
»Ja, der Pfarrer vor dem Kreuzaltar und Friedrich in der alten Sakristei. Das ist doch merkwürdig, oder?« Sie hörte ihn rascheln, dann mit jemandem sprechen.
2
Ein alter Jaguar in Britisch-Grün kam über die Klosterallee gefahren und hielt vor dem Portal. Hauptkommissar Maik von Lilienthal öffnete die Tür, stieg aus und blickte sich um. Susanne Riemeister, seine Kollegin von der Polizeidirektion Frankfurt(Oder), folgte ihm sportlich auf der anderen Seite. Mit dem hellen Alabasterteint der Rotblonden und einer knabenhaften Figur, trug sie über der Jeans nur eine schwarze Jacke mit Kapuze über einem weißen Shirt. Lilienthal hingegen war mit einem hellblauen Hemd mit dezent gemusterter Krawatte unter einer Pilotenlederjacke etwas gediegener gekleidet. Riemeister trat zu ihm. Ihr Kopf reichte ihm knapp bis zur Schulter.
Enne, die hier auf ihren Sohn gewartet hatte, ging zu ihnen.
»Hauptkommissarin Susanne Riemeister, meine Mutter«, stellte Lilienthal beide vor. Er wollte sie gerade in den Arm nehmen und ihr nochmals sein Beileid über Friedrichs Tod ausdrücken, aber sie hatte sich bereits seiner Kollegin zugewandt.
Enne lächelte die Kollegin ihres Sohnes warmherzig an. Die junge Frau gefiel ihr auf Anhieb. Ohne weitere Vorreden lieferte Enne eine kurze Zusammenfassung der Ereignisse. Anschließend holte sie ihr iPhone heraus und zeigte die Aufnahmen, die sie von Friedrich Schönburg in der alten Sakristei gemacht hatte.
»Die Stellung des Toten ist ungewöhnlich, da muss ich Ihnen recht geben, Frau von Lilienthal«, meinte Riemeister nachdenklich, nachdem sie sich die Bilder angesehen hatte.
»Und wer hat den Pfarrer gefunden?«, fragte Lilienthal.
Enne zuckte mit den Schultern. »Das müsste Gruber, der Sakristan, wissen.«
»Also, der erste Tote war der Pfarrer?«, hakte Riemeister nach.
»Jedenfalls habe ich Professor Schönburg erst danach gefunden. Wer als Erster verstorben ist, kann nur die Rechtsmedizin klären.«
»Dann wollen wir mal hören, was uns der Herr Gruber zu erzählen hat«, meinte Lilienthal aufgeräumt.
Riemeister biss sich auf die Lippe. »Kann ich Sie mal kurz unter vier Augen sprechen?«
Überrascht schaute er sie an.
Sie ging ein paar Schritte zur Seite. »Damit die Kompetenzen klar geregelt sind«, wandte sie sich an Lilienthal, der, ohne eine Miene zu verziehen, zu ihr getreten war, »das hier fällt in meinen Zuständigkeitsbereich. Im Klartext: Befragungen und gegebenenfalls weitere Ermittlungen führe ich.«
Lilienthal zauberte ein verbindliches Lächeln in sein Gesicht. Dieses Landei hatte ein Autoritätsproblem. Das war ihm schon in Frankfurt aufgefallen. Er war daran gewöhnt, im Team zu arbeiten. Ließ selten den Vorgesetzten heraushängen. Aber ihr albernes Gehabe, wenn er Anordnungen traf, ohne sich vorher lang und breit bei jeder Kleinigkeit mit ihr abzusprechen, ging ihm gehörig auf den Senkel. Aus dem Kollegenklatsch hatte er erfahren, dass Riemeister von einem Bauernhof aus der Uckermark stammte. Für ihn, als gebürtigen Berliner, lag das beinahe hinter dem Ural. »Der Pfarrer ist ihr Baby, Frau Riemeister. Der Professor wohnte in Potsdam. Gehörte zur Politprominenz im Brandenburger Landtag. Mein Ressort. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es zu Überschneidungen bei den beiden Todesfällen kommt. Warum sollen wir uns das Leben unnötig schwer machen? Wäre es nicht vernünftiger, wir würden die Sache von Anfang an gemeinsam angehen?«
»Ich denke, Vernunft ist nicht nur Ihr Alleinstellungsmerkmal«, antwortete Riemeister kühl. »Ich werde das mit der zuständigen Staatsanwaltschaft abklären.«
»Wollen Sie den Sakristan allein vernehmen?« Sein Ton war provozierend neutral.
Ihre Augen schossen Blitze. »Begleiten Sie mich«, sagte sie spröde und folgte Enne, die bereits zum Eingang des Klostergebäudes gegangen war. Lilienthal schlenderte hinterher. Zum Glück konnte Riemeister seinen zufriedenen Gesichtsausdruck nicht sehen.
Enne ließ Riemeister und Lilienthal den Vortritt. Vor dem Tresen stand Gruber und unterhielt sich mit einer fülligen Frau mit aschblondem Kurzhaarschnitt.
»Sind Sie Herr Gruber?« Überrascht blickte er auf den Polizeiausweis, den ihm Riemeister hinhielt. »Ich habe ein paar Fragen zum Tod des Pfarrers.«
»Ja bitte?«, sagte Gruber reserviert.
»Wer hat den Leichnam gefunden?«
»Das ist ja schrecklich«, mischte sich die Füllige ein. Eine Mittfünfzigerin im lindgrünen Twinset, die Gruber mit glänzenden Augen ansah.
Die ist scharf auf Gruber, ging es Enne durch den Kopf.
»Frau Lubbien wollte den Blumenschmuck vor dem Hauptaltar überprüfen, dabei hat sie Pfarrer Michaelis gefunden«, antwortete Gruber kühl. »Kerstin Lubbien ist meine Stellvertreterin. Aber sie ist nicht mehr hier. Ich habe sie nach Hause geschickt. Der Tod unseres verehrten Herrn Pfarrers hat sie sehr mitgenommen.«
Die Füllige bückte sich und holte eine Thermoskanne und Becher unter dem Tresen hervor und bot allen Anwesenden Tee an.
»Eine gute Idee, Ruthchen«, murmelte Gruber und griff nach einem Becher.
Riemeister lehnte ab, aber Lilienthal nahm dankend an und trank einen Schluck. Er hatte schon schlechteren Tee getrunken. Lächelnd nickte er der Frau zu, dann fragte er Gruber: »Wo wurden die Leichen hingebracht?«
»Nach Fürstenberg zum Bestatter«, mischte sich die Aschblonde wichtig ein.
»Aber nicht unser Herr Pfarrer, Ruth. Der wird hier bei uns aufgebahrt.«
»Wie alt war denn Pfarrer Michaelis?«, fragte Enne und ignorierte den erstaunten Blick Riemeisters.
»Ende vierzig. Ein außergewöhnlich lebensfroher Mensch, fest im Glauben, verständnisvoll allen menschlichen Schwächen gegenüber. Engagierte sich in der Jugendarbeit. Jeder mochte ihn«, antwortete Gruber.
Aber einer nicht, dachte Enne.
»So jung und schon tot.« Ruthchen schluchzte geziert auf.
»Die Besten holt der Herr zuerst«, bemerkte Gruber.
Schwachsinn, dachte Enne, nahm einen Schluck Tee, verschluckte sich und wurde von einem Hustenanfall geschüttelt.
Ruthchen kam um die Theke herum, klopfte ihr so fest auf den Rücken, dass ihr die Luft wegblieb. »Aber das kommt bestimmt nicht von meinem Tee«, meinte sie vorwurfsvoll.
»In welcher Stellung wurde der Leichnam des Pfarrers gefunden?«, setzte Riemeister die Befragung fort.
Gruber überlegte einen Moment. »Als ich kam, saß er zusammengesunken im Gestühl vor dem Kreuzaltar. Wenn Kerstin mir nicht vorher gesagt hätte, er ist tot, hätte ich gedacht, er sei im Gebet versunken. Seine Bibel lag zu seinen Füßen.«
»Wo ist die Bibel jetzt?«, unterbrach ihn Lilienthal.
Gruber zog unter dem Tresen eine in schwarzes Leder gebundene Bibel mit goldenem Buchschnitt hervor.
Riemeister ergriff sie vor Lilienthal. »Da steckt ein Lesezeichen drin?«
»An der Stelle war sie aufgeschlagen, als ich sie fand. Es war wohl das Letzte, was der Pfarrer gelesen hatte.«
Riemeister öffnete das Buch an der markierten Stelle. »Hebräer10,26. Mutwillige Sünden«, las sie vor.
»Denn so wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, haben wir fürder kein anderes Opfer mehr für die Sünden«, psalmodierte Gruber.
Lilienthal streckte die Hand aus. Unwillig gab Riemeister ihm die Bibel. Er schlug die Stelle auf, in der das Lesezeichen steckte, las. Dann blätterte er weiter, hielt inne. »Hier ist eine Seite eingeknickt«, meinte er. Dann deutete er auf die Seite. »Ein Satz ist unterstrichen.« Er rezitierte: »Aber einer von euch ist ein Teufel.«
»Johannes-Evangelium6«, erklärte Gruber. »Es geht um Judas. Und Jesus antwortete ihnen, dass einer ihn verraten werde.«
Riemeister hatte sich Notizen gemacht.
Kaum dass sie draußen waren, platzte Enne heraus: »Eine Stelle in der Bibel, die sich auf Judas bezieht, also auf Verrat. Angekreuzt durch den Pfarrer. Das ist doch merkwürdig, oder?«
Lilienthal nickte.
Riemeister lächelte spöttisch. »Am Gründonnerstag vor Ostern wird immer das letzte Abendmahl von Jesus mit seinen Jüngern und der Verrat des Judas thematisiert. Ich würde dem nicht so viel Bedeutung beimessen. Aber um ganz sicherzugehen, sollte sich die Rechtsmedizin die beiden Leichname bei dem Bestatter ansehen.«
»Die sind im Rotkreuz-Auto, hinter der Klosteranlage. Ich habe die Sanitäter gebeten, bis ihr kommt, zu warten«, erklärte Enne.
»Wie bitte?« Lilienthal blickte seine Mutter ungläubig an. »Das war Amtsanmaßung. Außerdem hättest du uns sofort informieren müssen.«
»Na, jetzt wisst ihr es ja«, entgegnete Enne kühl. »Ich fahre ins Hotel. Du weißt ja, wo du mich findest.« Hocherhobenen Hauptes ließ sie ihn stehen. Nur keine Schwäche zeigen, befahl sie sich.
Verärgert sah er ihr hinterher. Würde sie denn nie lernen, dass sie raus aus dem Geschäft war? Keine ermittelnde Funktion mehr innehatte. Peinlich war das auch vor der Kollegin. Er atmete tief durch und wollte schon zu einer Erklärung ansetzen, aber Riemeister telefonierte bereits mit der Rechtsmedizin.
Ein Dr.Enderlein, der vertretungsweise für seinen Kollegen in Frankfurt eingesprungen war, wollte in zehn Minuten vor Ort sein, teilte sie Lilienthal mit.
Schweigend liefen beide Kommissare zum Parkplatz hinter der Klosteranlage. Die Sanitäter standen rauchend vor den Einsatzfahrzeugen. Riemeister informierte sie. Lilienthal war weitergegangen. Das Kloster Neuzelle lag auf einem Hügel, von dem man weit hinein in das Oderbruch sehen konnte. Letzte Sonnenstrahlen ließen das Mauerwerk der Kirche wie einen Leuchtturm in einem weiten grünen Meer in warmem Gelb erstrahlen.
»Barockwunder Brandenburg«, sagte Riemeister, die ihm gefolgt war. »So wird das hier allgemein genannt. Aber als Wunder würde ich es nicht bezeichnen. Der Fortbestand des Klosters ist der damaligen politischen Lage geschuldet.« Als sie Lilienthals verständnislosen Blick bemerkte, erklärte sie: »Die Niederlausitz gehörte nach der Reformation nicht zum protestantischen Preußen, sondern zu Böhmen und Sachsen, war also dem katholischen Glauben zugehörig. Dadurch konnte das Kloster auch nach der Reformationsbewegung noch weiter bestehen.«
»Aber es ist doch schon lange kein aktives Kloster mehr«, stellte Lilienthal fest.
»Das stimmt. 1815 musste Sachsen, als Verbündeter von Napoleon, nach dem verlorenen Krieg fast die Hälfte seines Territoriums an Preußen abtreten. Obwohl eigentlich der Fortbestand der geistlichen Stiftungen vertraglich garantiert war, ließ der damalige preußische König das Kloster aufheben.4«
»Sie kennen sich gut aus in der Klostergeschichte.«
»An der Information finden Sie genügend Literatur über Neuzelle«, erwiderte sie spöttisch.
Ein silberfarbener BMW hielt direkt vor ihnen. Eine hagere Gestalt schob sich aus der Fahrertür. Scharfe Falten hatten sich um seine Mundwinkel eingegraben. Der kurz geschorene Schopf schimmerte fahl im Abendlicht. Missmutig sah er sich um.
»Seit wann treiben Sie sich an Orten mit diesem fortschrittsfeindlichen Mummenschanz herum?«, wandte er sich statt einer Begrüßung an Lilienthal. Der Hauptkommissar kommentierte die eher rhetorische Frage nicht, sondern stellte Dr.Enderlein, Rechtsmediziner am Potsdamer Polizeipräsidium, seiner Kollegin Riemeister vor. Der Mediziner war als eine Kapazität weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Trotz Enderleins berüchtigtem Sarkasmus freute Lilienthal sich, den verschrobenen Kauz hier zu sehen. Wenn irgendetwas an dem Tod der beiden Männer nicht natürlich war, dann würde der Rechtsmediziner es herausfinden.
Enderlein nahm eine Packung Gauloises aus seiner Manteltasche und zündete sie an. Er blies den Rauch in die laue Abendluft. »Lüge, Verrat und Betrug. Gern auch mal Folter, das drängt sich mir auf, wenn ich das hier sehe.«
»Traurig, wenn das alles ist, was Ihnen dazu einfällt.« Riemeister sah ihn herausfordernd an. Enderlein musterte sie aus schmalen Augen.
3
18.April, 19.55Uhr– Neuzelle
Lilienthal tat Riemeister beinahe leid. Der normale Umgangston bei der Kriminalpolizei war nicht der eines Mädchenpensionats, aber Enderleins Art hatte schon manche Kollegin empört. Was den Rechtsmediziner eher nicht störte. Er genoss es, zu provozieren. Von Enne, seiner Mutter, die Enderlein noch aus ihrer beruflichen Zeit beim Landeskriminalamt Berlin her kannte, hatte Lilienthal gehört, dass Enderleins große Liebe, eine junge Ärztin, nach einem morgendlichen Jogginglauf im Spandauer Forst ermordet aufgefunden worden war. Den Täter hatte man bis heute nicht gefasst. Damals war Enderlein wochenlang nicht ansprechbar gewesen, hatte sich in seinen Katakomben, wie der pathologische Bereich intern genannt wurde, vergraben. Das war auch der Grund, warum sich der Rechtsmediziner von Berlin nach Potsdam hatte versetzen lassen.
Lilienthal begleitete Enderlein zu den Rotkreuz-Fahrzeugen. Riemeister war ihnen schweigend gefolgt. Der Rechtsmediziner hatte sich jede Störung bei seiner Untersuchung verbeten. Nach kurzer Zeit öffnete er die Tür des Wagens und kletterte schwerfällig heraus.
»So, Herzversagen wurde diagnostiziert?«, brummte er, und man konnte den Hohn in seiner Stimme heraushören. »Professor Schönburg starb mit ziemlicher Sicherheit nach meiner ersten, noch nicht umfassenden Untersuchung garantiert nicht an Herzversagen. Wobei«, er grinste diabolisch, »Herzversagen natürlich immer todesursächlich ist.«
»Und was war die Todesursache?«, fragte Lilienthal.
»Fraktur des Dens axis. Die oberen Kopfgelenke oder Atlanto-okzipital-Gelenke liegen zwischen den beiden Kondylen des Hinterhauptes und der Fovea articularis cranialis des Atlas.«
»Also Genickbruch?«, unterbrach ihn Lilienthal.
»Laiensprachlich ausgedrückt, ja«, erwiderte Enderlein. »Wobei ich zugegebenermaßen hinzufügen muss, dass diese Todesursache bei einer Routineuntersuchung kaum erkennbar ist. Aber bitte immer unter Vorbehalt– bevor ich den Leichnam nicht auf meinem Tisch habe, ist das lediglich eine erste Einschätzung.«
Riemeister hatte Enderleins Ausführungen interessiert zugehört. »Könnten Sie auch den Pfarrer untersuchen, Herr Enderlein?«
»Dr.Enderlein, wenn ich bitten darf, Frau Kommissarin, so viel Zeit muss sein«, korrigierte er kalt.
»Hauptkommissarin«, entgegnete Riemeister spitz.
»Und wieso noch ein Toter?«, fragte Enderlein gereizt. »Mir wurde nur von Professor Schönburg berichtet.«
»Wir haben hier in der Tat zwei Leichen«, erklärte Lilienthal. »Der Pfarrer befindet sich in dem anderen Fahrzeug.« Er deutete auf den zweiten Wagen, der etwas abseits stand.
Enderlein zündete sich eine weitere Gauloises an, inhalierte, dann wandte er sich an Lilienthal, und seine Augen funkelten. »Sagt man nicht, Pfarrer wechseln nur ihren Standort und verlagern ihren Tätigkeitsbereich weiter nach oben, wenn ihre weltliche Hülle versagt?« Er wedelte mit Zeige- und Mittelfinger, in der er die Zigarette hielt, in Richtung Wolken. Lilienthal verzog keine Miene, registrierte aber erleichtert, dass Riemeister sich nicht provozieren ließ. Der Rechtsmediziner warf den halb aufgerauchten Zigarettenstummel auf den Boden, trat ihn aus und ging zum anderen Rotkreuz-Wagen. Wenig später steckte er seinen Kopf aus der Tür.
»Haben Sie etwas gefunden, Dr.Enderlein?«, fragte Riemeister mit Betonung auf seinem Titel.
»Mit ziemlicher Sicherheit Herzstillstand durch Schlag auf die Arteria carotis«, dozierte er. »Ein Schlag auf die Arterie senkt den Puls enorm, und als Folge kann es zum Herzstillstand kommen.«
»Tod durch Gewalteinwirkung«, murmelte Lilienthal.
»Was denn sonst, oder konnten Sie meinen Ausführungen nicht folgen?«, erwiderte Enderlein. Steifbeinig kletterte er aus dem Fahrzeug. »Alles Weitere später.« Er ging zu seinem Wagen. Bevor er einstieg, drehte er sich um: »Wie lange sind Sie noch in Frankfurt?«
»Bis der Fall geklärt ist«, antwortete Lilienthal.
Riemeister sprach bereits mit den Sanitätern, dass beide Leichen in die Rechtsmedizin nach Frankfurt gebracht werden müssten. Als sie wenig später zum Klosterbüro gingen, meinte sie: »Ihre Mutter hatte den richtigen Riecher, das muss man ihr lassen.«
»Zwei Leichen am selben Ort, das hätte jeden stutzig gemacht. Beide Männer wurden durch einen gezielten Schlag getötet. Das deutet auf einen Täter hin. Nur wo ist der gemeinsame Nenner? Was verbindet einen politisch engagierten Professor mit einem katholischen Geistlichen? Die CDU?«
Riemeister schüttelte den Kopf. »Ich denke, wir sollten uns zuallererst auf die persönliche Umgebung konzentrieren, Freunde, Verwandte. Wo sind da Gemeinsamkeiten?« Sie überlegte einen Moment. »Frauen kann man wohl ausschließen.«
»Ein katholischer Pfarrer und sein Keuschheitsgelübde«, entgegnete Lilienthal spöttisch, »Frauen schließen Sie von vornherein aus? Aber hoppla– ein Priester hat sein Sexualleben nicht vor dem Altar abgegeben.«
»Statistisch gesehen haben wir es bei dieser Todesart in der Mehrzahl mit Männern zu tun. Nur deswegen habe ich Frauen ausgeschlossen.« Riemeisters Wangen überzog eine zarte Röte. »Ich finde es kleinkariert, wenn ein katholischer Geistlicher sofort unter Generalverdacht gestellt wird, wenn es um Sexualität und Frauen geht.« Eine rotgoldene Locke hatte sich aus ihren zurückgebundenen Haaren gelöst und fiel über ihre Wange.
Reizvoll, ging es Lilienthal durch den Kopf. Blöd nur, dass es eine Kollegin war und, noch blöder, eine richtige Zicke. Provozierend fragte er: »Sind Sie in diesem Fall etwa befangen?«
Sie ging einfach weiter. Als er sie einholte, sagte sie kalt: »Ich schließe nie etwas aus, Herr Kollege.«
Sie hatten den Verwaltungstrakt erreicht und stiegen die Treppe hinauf in den ersten Stock. Riemeister klopfte an die erste Tür, neben der sich ein kleines Schild mit dem Aufdruck »Administration« befand, und ohne auf eine Antwort zu warten, traten sie ein. Ein karg eingerichteter Raum mit hohen Fenstern. Ein einfacher Schreibtisch und an beiden Wänden Metallschränke. Drinnen war niemand. Gerade als sie sich wieder zum Gehen wandten, erschien ein junger, hochgewachsener Mann, korrekt gekleidet im dunklen Anzug mit silberner Krawatte, mittelblond, mit akkuratem Scheitel. Riemeister zeigte ihren Polizeiausweis und stellte Lilienthal vor. Sie würden wegen der nicht natürlichen Tode von Pfarrer Michaelis und Professor Schönburg ermitteln. Als Erstes benötigten sie die Unterlagen inklusive Teilnehmerliste der heutigen Veranstaltung.
»Nicht natürlich?«, fragte der Stiftsmitarbeiter, der sich als Jens Hofer vorgestellt hatte, ungläubig. »Aber woran sind sie dann verstorben?«
»Bei laufenden Ermittlungen unterliegen die Ergebnisse der Schweigepflicht«, erklärte Riemeister.
»Schweigepflicht«, murmelte Hofer und kramte ratlos in dem Stoß Papier, der auf seinem Schreibtisch lag. »Die Namen der Teilnehmer unterliegen dem Datenschutz«, sagte er auf einmal erleichtert. »Die Stiftsleitung muss unterrichtet werden. Ich fühle mich nicht befugt, Ihnen ohne Rücksprache Unterlagen herauszugeben.«
»Ihnen ist aber klar, dass es sich hier nach Paragraf227StGB um Körperverletzungen mit Todesfolge handelt und Sie zur Mitarbeit verpflichtet sind«, erwiderte Lilienthal ungehalten. Das nervöse Gefummel von Hofer ging ihm auf die Nerven. Der Mann schien offensichtlich mit der Situation überfordert zu sein.
Hofer blickte ihn ängstlich an. Dann griff er nach einem Ordner und zog mehrere Blätter hervor. »Das Programm mit der Teilnehmerliste.«
»Geht doch«, brummte Lilienthal.
Riemeister nahm die Bogen und überflog die Namen. Sie blätterte zurück zum Tagungsprogramm. »Ab neunzehn Uhr geselliges Zusammensein im Hotel-Restaurant ›Prinz Albrecht‹«, las sie vor.
»Das ›Prinz Albrecht‹ befindet sich gegenüber, direkt am Klosterteich«, erklärte Hofer.
4
18.April– Schlaubetal, »Forsthaus Siehdichum«
An einem Tisch neben dem Kamin, in dem die Glut noch wohlige Wärme verströmte, saß Enne. Vor ihr stand ein Glas Rotwein. Maik hatte angerufen und sein Kommen angekündigt. Sie freute sich, dass er doch noch zu ihr ins »Forsthaus Siehdichum« kommen würde, obwohl es bereits spät war und er einen langen Arbeitstag hinter sich hatte. Nachdem er sie so vor seiner Kollegin abgekanzelt hatte, hatte sie nicht mehr damit gerechnet. Den frischen Spargel mit einer vom Haus selbst gemachten Sauce hollandaise hatte sie nicht angerührt. Ihr Magen streikte. Keinen Bissen hatte sie herunterbekommen, was ihr eine vorwurfsvolle Bemerkung der Bedienung einbrachte.
Wie hatte sie sich heute Morgen auf das Essen mit Friedrich gefreut. Ein Rheingau-Riesling wurde auf der Speisekarte angeboten. Bevor sie nach Neuzelle gefahren war, hatte sie darum gebeten, einige Flaschen davon kalt zu stellen. Vor vielen Jahren hatte es ihr auf einer Fortbildung im Bundeskriminalamt in Wiesbaden der Rheingau mit seiner lieblichen Landschaft angetan. Sie mochte diese kleinen Winzerorte und besonders den Riesling. Damals hatte sie Friedrich dort mit ihrem Besuch überrascht. Er hielt einen gut dotierten Gastvortrag an der renommierten European Business School in Oestrich-Winkel, und im Gegenzug lud er sie zu einer Weinprobe ins Schloss Vollrads ein. Graf Matuschka-Greiffenclau, aus der alten Dynastie der Greiffenclaus, begleitete die Weinprobe persönlich. Selten hatte Enne so guten Riesling verkostet und dabei so viel gelacht. Natürlich bemerkte sie auch, wie Friedrich sich in den bewundernden Blicken sonnte, die man ihr zuwarf. Aber ein Paar waren sie nie gewesen. Immer nur Freunde, im besten Sinne des Wortes. Nach der Weinprobe entführte er sie zum ältesten erhaltenen Steinhaus Deutschlands. Zum Grauen Haus in Winkel. Dort hatten sie auf das Köstlichste gespeist.
Enne seufzte. »Prost, Friedrich, auf dass es dir, wo immer du jetzt bist, gut ergehe«, flüsterte sie und trank den Rest des Weins aus. Der dicke Wohlstandsbürger mit seiner dauergewellten Gattin am Nachbartisch blickte sie missbilligend an.
»Heute schon gelacht?«, fragte Enne provozierend. Das Paar sah demonstrativ in die andere Richtung.
Lilienthal kam auf sie zu. Er sah müde aus. Kaum dass er sie begrüßt und sich gesetzt hatte, griff er nach der Speisekarte. Sie empfahl ihm den frischen Spargel. Als die Bedienung kam, bestellte er ein alkoholfreies Bier und ein Schnitzel, allerdings mit drei Stangen Spargel als Beilage. Fleisch war eher sein Gemüse. Enne beäugte misstrauisch das Bier. Entweder oder, dachte sie. Aber Bier ohne Alkohol schloss sich gegenseitig aus. Sie unterdrückte den Wunsch, nach den Ergebnissen der rechtsmedizinischen Untersuchung zu fragen. Erkundigte sich nur, wie die Zusammenarbeit mit den Kollegen in Frankfurt wäre.
»Alles gut, danke«, antwortete er wortkarg zwischen den einzelnen Bissen. Als er fertig gegessen hatte und sich zum Abschluss noch einen Espresso bringen ließ, bestätigte er, dass sie mit ihren Vermutungen recht gehabt hatte. Er erwähnte Enderleins vorläufige Diagnose. Enne hörte gespannt zu. Nachdem er seine Ausführungen beendet hatte, bestellte sie sich einen Grappa. An seiner Miene konnte sie erkennen, dass er ihre Trinkgewohnheiten missbilligte. Aber das war ihr egal. Außerdem passte es zu Wein. Grappa, ein Tresterbrand, war ein Abfallprodukt aus der Weinherstellung. Kaum dass der Schnaps serviert wurde, trank sie genüsslich einen Schluck.
»Warum warst du nach der Tagung nicht bei dem Abendessen im Hotel ›Prinz Albrecht‹?«
»Ach, das hatte ich ganz vergessen. Friedrich und ich wollten im ›Forsthaus Siehdichum‹ essen gehen«, sie zögerte, »ich wollte nicht all die Leute noch einmal sehen.«
Lilienthal rührte nachdenklich in der Espressotasse. »Riemeister und ich waren vorhin dort. Natürlich ging es bei den Anwesenden nur noch um Friedrichs Tod. Warum hast du mir nichts von dem Streit zwischen Friedrich und einem der Teilnehmer, einem gewissen Stetter, erzählt?«
»Was soll das jetzt? Verhörst du mich etwa? Du kanntest Friedrich doch auch. Er ging keiner Auseinandersetzung aus dem Weg und provozierte gern. Ich habe dem keine Bedeutung beigemessen.«
Lilienthal schob nachdenklich die Espressotasse auf dem Unterteller hin und her. »Außerdem waren wir vorhin in Friedrichs Apartment in Frankfurt. Wenig Privates. Alles sehr penibel aufgeräumt. Hast du eine Ahnung, wo er seine persönlichen Unterlagen aufbewahrt haben könnte?«
»Friedrich hatte seinen Hauptwohnsitz in Babelsberg. Die Wohnung in Frankfurt hat er nur genutzt, wenn er in der Viadrina Vorlesungen hielt.« Sie kramte in ihrer Handtasche und gab ihm eine alte Visitenkarte von Friedrich Schönburg, auf der die Adresse stand. Nachdenklich steckte er sie ein.
»Das Einzige, was ich in dem Apartment gefunden habe, war ein schmaler Hefter mit Schriftverkehr. Wusstest du, dass Friedrichs Familie Grundbesitz hier in der Gegend hatte?«
»Ja, irgend so ein Anwesen, das der Familie früher gehörte. Er hatte einen Antrag auf Rückübertragung gestellt. Aber Genaues weiß ich nicht. Es hat mich nicht sonderlich interessiert. Friedrich hatte eine Art, sich mit allem, was seine Familie betraf, wichtigzumachen. Das ging mir gegen den Strich.«
»Hast du Kontakt zu seiner Familie?«
»Kontakt ist übertrieben. Ich kenne seinen jüngeren Bruder, Johannes. Ihn und seine Tochter Carlotta habe ich hin und wieder auf Festen bei Friedrich getroffen. Warum fragst du?« Dabei kannte sie die Antwort bereits.
»Ich wüsste gern mehr über den Streit mit diesem Stetter. Vielleicht weiß sein Bruder etwas darüber.«
Enne schaute ihn scheinbar empört an. »Freunde aushorchen, ich bitte dich, Maik.« Aber natürlich hatte sie bereits mit dem Gedanken gespielt. »Ist Johannes denn inzwischen über Friedrichs Tod informiert worden?«
»Meine Kollegin hat das übernommen. Ich denke, es ist besser so. Schließlich kannte ich Friedrich, wenn auch nur flüchtig.«
»Aber raushalten wirst du dich nicht können, wenn du weiter ermitteln wirst, und davon gehe ich aus, oder?«
Er nickte, sah auf seine Armbanduhr und winkte der Bedienung zu, um zu zahlen.
»Lass man, das übernehme ich«, sagte sie.
»Danke«, murmelte er. »Ich fahre gleich weiter nach Babelsberg. Will mir noch seine Wohnung ansehen. Die Spurensicherung werde ich auch gleich informieren.«
»Die Wohnung liegt in der Karl-Marx-Straße, in einer alten Gründerzeitvilla. Direkt am Griebnitzsee.«
»Nicht schlecht, und das alles mit der BesoldungsgruppeH4, wenn ich mich nicht irre.«
»Seine Vorträge waren gefragt. Die hat er sich gut bezahlen lassen«, verteidigte ihn Enne.
»Ruf mich an, wenn du etwas von seinem Bruder erfahren solltest.« Er unterdrückte ein Gähnen und verabschiedete sich.
Sie sah ihm hinterher, als er den Gastraum verließ. Dabei zog er das eine Bein leicht hinterher. Die Behinderung war eine Folge eines schweren Fahrradunfalls in seiner Kindheit. Sein Leben hatte damals an einem seidenen Faden gehangen. Danach hatte sie ihn behütet wie eine Glucke. Sich immer zu sehr in sein Leben eingemischt. Erst seit einem heftigen Ausbruch von ihm, wo es beinahe zu einem Bruch zwischen ihnen gekommen war– sie hatten zusammen an einem spektakulären Fall auf dem Stahnsdorfer Südwestkirchhof gearbeitet–, hatte sie eingesehen, dass sie sich zurücknehmen musste. Nicht nur, was seine Arbeit, sondern auch, was sein Leben anbetraf. Aber es fiel ihr immer noch schwer.
Nur noch wenige andere Gäste saßen im Restaurant. Sie bestellte einen weiteren Grappa und versuchte sich zu erinnern, was Friedrich ihr über seine Familienverhältnisse erzählt hatte. Seine Mutter war vor einigen Jahren verstorben. Zusammen mit einer Schwester und einer Nichte hatten sie in einer Etagenwohnung in einem großbürgerlichen Altbau in Berlin-Friedenau gelebt. Friedrichs Vater war zum Ende des Zweiten Weltkrieges gefallen. Johannes kam im Herbst 1945 zur Welt. Friedrich hatte den kleinen Bruder geliebt. Enne fand es schon erstaunlich, wie unterschiedlich die beiden Brüder waren. Friedrich, mit einer Körperhöhe von über einem Meter neunzig, mit vollen dunklen Haaren, die nur einige weiße Strähnen aufwiesen, dunklen Augen und einer natürlichen Autorität, war bis zu seinem Tod schlank gewesen.
Johannes dagegen, weizenblond, feingliedrig, mit hellen Augen, erreichte bei Weitem nicht das Gardemaß seines älteren Bruders. Er hielt sich lieber im Hintergrund, wahrte Distanz und beobachtete seine Umgebung. Enne mochte Johannes. Er war ungewöhnlich musikalisch. Der Einzige in dieser Familie Schönburg, soweit sie wusste. Schon als Kind fing er an, Violine zu spielen, und bekam Unterricht in der Meisterklasse der Musikhochschule. Die Familie war überzeugt, dass er später eine Karriere als Solist vor sich hätte. Zur Überraschung aller entschied er sich nach dem Abitur für das Studienfach Maschinenbau. Und noch größer war die Überraschung, als er eigene Erfindungen machte und sie sich patentieren ließ. Friedrich hatte ihr gegenüber einmal erwähnt, dass Johannes mit seinen Patenten wieder Wohlstand in die Familie gebracht hatte.
Enne bestellte noch einen Grappa. Inzwischen war sie der letzte Gast. Es war noch nicht besonders spät, aber hier war man an andere Zeiten gewöhnt, als sie es von Berlin und auch von Potsdam her kannte. Sie trank aus und fühlte endlich ihre Glieder schwer werden. Der pochende Schmerz in ihrem Kopf ließ nach. Sie bat die Bedienung, die hinter der blank geputzten Theke bereits auf sie wartete, alles auf ihre Zimmerrechnung zu setzen. Vor der breiten Holztreppe, die zu den Gästezimmern führte, blieb sie unschlüssig stehen. Einem plötzlichen Impuls folgend wandte sie sich zur Eingangstür und ging hinaus.
Die Mondsichel des zunehmenden Mondes schimmerte hinter einer dunklen Wolke hervor. Der Wald ringsherum hatte seine eigenen Geräusche. Die Äste in den alten Bäumen knarrten. Blätter raschelten nach einem Windstoß. Ein Käuzchen schrie. Gerade wollte sie zurück ins Haus gehen, da erklang das lang gezogene Tirili der Nachtigall. Der Antwortruf ertönte aus dem Dickicht neben dem Haus. Ach Friedrich, dachte sie, das wirst du nun nie mehr hören. Und ohne dass sie es verhindern konnte, strömten die Tränen über ihre Wangen. Still stand sie da. Sie weinte um ihren Freund und ein bisschen auch über sich selbst. Wie schnell waren die Jahre vergangen. Nur eine kurze Spanne Zeit ist uns beschieden, dachte sie wehmütig.
5
16.April– Seelower Höhen
Dunkle Wolken zogen über das Oderbruch, türmten sich zu bizarren Gebilden, veränderten sich und wuchsen wieder zusammen. Ein Netz von Blitzen überzog den Himmel, verdrängte die Dunkelheit und tauchte die Landschaft in schwefelgelbes Licht. Der Sturm nahm an Stärke zu. Die Bäume an der Kante des Bruchs ächzten unter der Wucht des Unwetters. Dumpf grollte der Donner. Dann krachte es. Für den Bruchteil einer Sekunde fraß sich der grelle Schein eines Blitzes in einen Baum. Regen setzte ein. Die schweren Tropfen vermischten sich mit Hagelkörnern. Wer jetzt noch keinen Unterschlupf gefunden hatte, war den Naturgewalten hilflos ausgeliefert. Erst in den frühen Morgenstunden beruhigte sich die Natur.
Albrecht Franke, Revierförster, seit vielen Jahren für das Gebiet zuständig, schritt durch den Waldabschnitt. Sein dichtes graues Haar lugte unter einer dunkelgrünen Filzkappe hervor. Unwetter hatte er sein Leben lang gekannt, aber dieser Orkan in der vergangenen Nacht war anders gewesen. Bedrohlicher, ein anderes Wort fiel ihm dazu nicht ein. Die harte Arbeit der Forstleute, das Aufforsten des Bestandes, die Pflege der Junggehölze, um von dem einheitlichen Kieferbestand wegzukommen, nachhaltiger zu wirtschaften– die Arbeit der letzten Jahrzehnte hatte das Unwetter in einer Nacht zunichtegemacht. Wo er auch hinsah, türmten sich großflächige Erdballen, wie von einer Riesenfaust aus dem Boden gerissen, Wurzeln streckten sich wie Finger zum Licht. Alte Fichten waren mitten am Stamm geborsten und damit für die Forstwirtschaft verloren. Kreuz und quer lagen die Stämme und versperrten den Weg. Fritz, seine belgische Bracke, einem großen Dackel nicht unähnlich, schnürte einige Schritte neben ihm im Unterholz. Hin und wieder hob er den Kopf und vergewisserte sich, dass sein Herrchen in der Nähe war. Franke blieb immer wieder stehen, machte sich in einer Kladde Notizen über das Ausmaß des Schadens. Nach einer Weile steckte er das Klemmbrett zurück in seinen Rucksack. Einen ersten Eindruck hatte er sich verschafft. Nun war es Zeit für den Rückweg. Die Forstverwaltung musste sofort über die Schäden informiert werden. Er pfiff nach seinem Hund. Aus dem Unterholz hörte er ihn bellen. Sonst parierte Fritz aufs Wort. Er musste etwas entdeckt haben. Vermutlich ein verendetes Tier, dachte Franke und rief ihn beim Namen. Aber der Hund gab nur Laut. Franke wartete einen Moment, lauschte. Er hörte den Hund ganz in der Nähe knurren.
»Fritz«, rief er noch einmal. Aber wieder gab das Tier nur kurz Laut. Franke verließ den Pfad und bahnte sich einen Weg ins Unterholz. Er stolperte über eine hochstehende Wurzel.
»Verdammt«, fluchte er. Vor ihm versperrten knorrige Äste einer entwurzelten Eiche ein Durchkommen. Direkt dahinter hörte er Fritz knurren. Er bog das Astwerk so gut es ging zur Seite und schob sich darunter durch. Jammerschade, mehr als zweihundert Jahre hatte der Baum bestimmt auf dem Buckel, dachte er.
Vor dem hoch aufragenden Wurzelballen bewachte Fritz etwas. Als Franke sich herangearbeitet hatte, wedelte Fritz mit dem Schwanz.
»Aus«, befahl Franke und bückte sich. Er hob das längliche, stockähnliche Ding auf. Rieb die Erde ab. »Guter Hund«, murmelte er und zog aus seiner Jacke ein Leckerli. Fritz schnappte gierig danach. Franke betrachtete den Fund, wischte mit dem Jackenärmel darüber. Von einem Tier? Eher nicht, überlegte er. Der Hund war in die Vertiefung zwischen den Wurzeln geklettert und fing an, mit den Vorderpfoten zu buddeln. Erdklumpen flogen dem Förster um die Beine. Dabei knurrte der Hund erregt.
»Aus, Fritz«, sagte Franke und kniete sich vor dem Erdloch nieder. Der Hund gehorchte. Mit der Hand schob Franke die Erde beiseite. Fritz stand mit gesträubtem Nackenfell hechelnd neben ihm. Franke bückte sich tiefer.
Augenhöhlen starrten ihn an. Ein Regenwurm wand sich aus dem Nasenbein, darunter befand sich ein noch gut erhaltenes Gebiss.
»Gut gemacht, Fritz«, murmelte Franke. Er legte das Erdreich um den Schädel frei. Halswirbel kamen zum Vorschein. Knochen ragten aus der dunklen Erde. Der Hund hatte einen davon herausgezerrt. Franke stand auf, öffnete seinen Rucksack und zog ein Stück rotes Tuch hervor. Er rollte es zu einer Kordel und band es an einen Ast. Dann klopfte er sich den Sand von den Hosenbeinen. Er nahm sein Handy aus der Jackentasche und tippte eine Nummer ein.
»Tach, Klaus«, begrüßte er den anderen, als der sich meldete. »Bin im Seelower Forst. Schlimmer als befürchtet.« Er nickte zu der Antwort des anderen. »Habe eine grobe Schätzung der Schäden vorgenommen. Ja, ich denke, in einer Stunde bin ich im Büro.« Er lachte: »Trink mir nicht den ganzen Kaffee weg. Und benachrichtige gleich mal die WASt5.« Er lauschte einen Moment. »Ja, die Wehrmachtauskunftsstelle. Ich habe schon wieder eine alte Leiche gefunden.«
6
19.April– »Forsthaus Siehdichum« und Neuzelle
Enne von Lilienthal köpfte ihr Frühstücksei. Wie von ihr gewünscht, war es fünf Minuten gekocht, das Eiweiß fest und das Eigelb noch etwas flüssig, so wie sie es liebte. Sie streute Salz und Pfeffer auf das Häubchen. Seit der Zeit, als es noch Herrn Lottchen, ihren Papagei, gegeben hatte und der Vogel strikt darauf bestanden hatte, von jedem Ei das Obere zu bekommen, hatte sie, allen Benimmregeln zum Trotz, dieses Ritual beibehalten. Die Frühlingssonne wärmte bereits, und sie hatte sich für einen Tisch auf der Terrasse entschieden. Hinter ihr an der Hauswand hatte man einen Nistkasten angebracht. Zwei kleine Kohlmeisen wechselten sich emsig beim Brüten ab. Als Service des Hauses hatte man ihr die »Märkische Oderzeitung« auf den Tisch gelegt.
Sie schob den Teller zur Seite, schlug die Zeitung auf und blätterte zum Lokalteil. Friedrichs Tod wurde mit keiner Notiz erwähnt. Der Orkan mit seinen verheerenden Schäden, der vor einigen Tagen das Oderbruch verwüstet hatte, war der Aufmacher des Tages. Enne belegte eine Brötchenhälfte mit frischem Wildschweinschinken. Während sie aß, überflog sie den Artikel.
»Wieder Weltkriegsleiche gefunden– wie viele Soldaten liegen noch in märkischer Erde?« war der Artikel übertitelt. Enne blickte auf ihre Armbanduhr. Um elf Uhr war sie mit Johannes in Neuzelle verabredet. Sie hatte ihn noch gestern Nacht angerufen. Er war bereits durch die Polizei von Friedrichs Tod unterrichtet worden. Über die Einzelheiten hatte die Beamtin jedoch kein Wort verloren.
Johannes hatte Enne gebeten, ihn zu begleiten. Er wollte sich in der Stiftskirche den Ort ansehen, wo sie seinen Bruder gefunden hatte. »Weißt du, allein schaffe ich das nicht«, war seine Begründung.
Johannes erwartete sie vor dem Eingangsportal des Klosters. Neben ihm stand eine junge Frau. Enne winkte ihnen zu und parkte ihren Golf auf dem Klosterparkplatz. Sie lief zurück, und erst als sie beinahe vor ihnen stand, erkannte sie Carlotta, Johannes’ Tochter. Weizenblondes Haar fiel seidig glatt über die Schultern der jungen Frau. Ihre Augen leuchteten noch intensiver als die ihres Vaters. Seine Tochter sieht aus wie ein lichter Sommertag, ging es Enne unwillkürlich durch den Kopf. Spontan umarmten sie sich, und Enne spürte, dass seine Schultern bebten.
»Ach Johannes«, murmelte sie, »es tut so weh.«
Er richtete sich auf. In seinen Augen schimmerte es feucht. »Warum Friedrich, Enne? Was hat er getan? Ich verstehe es nicht.«
Sie schloss für einen Moment die Augen, schluckte den Kloß herunter, der in ihrer Kehle saß, dann sagte sie mit fester Stimme: »Ich werde es herausfinden, versprochen.«
»Kennst du mich nicht mehr?«
Die weiche Stimme Carlottas riss Enne aus ihren Gedanken. Sie wandte sich ihr zu. »Wie schön, dich zu sehen, Carlotta, auch wenn der Anlass so traurig ist.«
Die junge Frau war größer als ihr Vater. Carlotta, der Liebling der Familie Schönburg, machte es allen leicht, sie zu mögen. Auch Friedrich hatte seine einzige Nichte geliebt wie ein eigenes Kind. Friedrich, zeitlebens mit Frauen verbandelt, war nie eine Ehe oder längere feste Bindung eingegangen.
Carlottas Mutter hatte Enne nie kennengelernt. Sie wusste nur, dass sie aus einer wohlhabenden Mailänder Familie stammte und Johannes in München während seiner Arbeit bei Siemens kennengelernt hatte. Die Ehe hatte nur wenige Jahre gedauert. Carlottas Mutter war früh verstorben und das Kind bei der Großmutter aufgewachsen. Die Musikalität hatte sie von ihrem Vater geerbt und im Gegensatz zu ihm zu ihrem Beruf gemacht. Die Harfe war ihr Instrument. Sie galt als eine der Besten in ihrem Fach. Inzwischen gab sie mit renommierten Orchestern Gastspiele nicht nur in Deutschland, sondern tourte durch die ganze Welt.
Arm in Arm ging Enne mit Johannes zur Stiftskirche. Als sie den Innenraum von St.