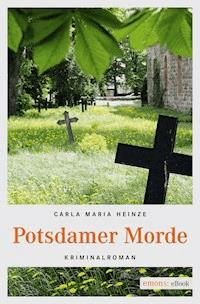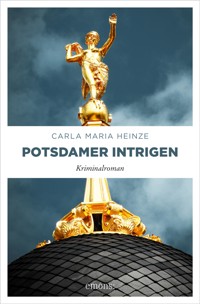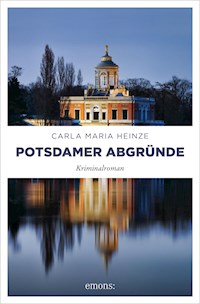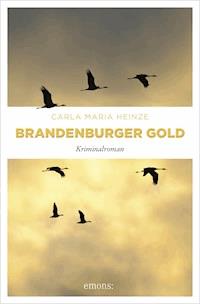
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Enne von Lilienthal
- Sprache: Deutsch
Eine dramatische Geschichte über Vergessen und Schuld In der Potsdamer Pirschheide wird ein Mann durch eine Weltkriegsbombe getötet, kurz darauf gibt es weitere Tote. Eine Spur führt Kriminalhauptkommissar Maik von Lilienthal in die Zeit des Zweiten Weltkriegs und zu drei Männern, die vor über siebzig Jahren eine folgenschwere Entscheidung getroffen haben, die sie bis zu ihrem Tod miteinander verband. Als sich Lilienthals Mutter Enne, Fallanalytikerin im Ruhestand, auch noch gegen seinen Willen in die Ermittlungen einmischt und in Lebensgefahr gerät, zählt jede Sekunde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 461
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carla Maria Heinze, geboren in Kleinmachnow, einem Vorort von Berlin, mag alles, was nicht in eine Schablone passt. Menschen, Meinungen und Lebensentwürfe. Ihre Kriminalromane handeln davon. Viele Reisen führten sie über alle fünf Kontinente. Heute lebt sie im Land Brandenburg, zwischen Potsdam und Berlin.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2018 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: mauritius images/imageBROKER/Erhard Nerger
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Susanne Bartel
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-315-8
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Wir waren jene, die wussten, aber nicht verstanden,voller Informationen, aber ohne Erkenntnis,randvoll mit Wissen, aber mager an Erfahrung.So gingen wir, von uns selbst nicht aufgehalten.
Roger Willemsen (aus seiner Rede»Wer wir waren« im Juli 2015)
Für Bodo
Prolog
März 1945
Seine Augen suchten den Himmel ab. Sternenklar. Auch das noch. Er rückte das Koppel zurecht, straffte die Schultern und ging mit forschem Schritt auf das Tor zu. Seine Erscheinung strahlte Autorität aus. Am Pförtnerhäuschen erstattete er Meldung. Der Wachhabende winkte ihn durch. Aus einer Nebentür des Gebäudes trat ein junger Gefreiter, salutierte und stellte sich als Begleitschutz vor. Oh mein Gott, dachte er, der ist ja noch ein halbes Kind.
Sie überquerten den großen betonierten Platz. Kaum sichtbar zwischen anderen Gebäuden lag der Eingang. Zum Hauptquartier vom Dicken. Versteckt bei Potsdam Wildpark.
»Hier entlang, Herr Hauptmann«, meldete der Gefreite. Er wies auf eine unscheinbare Tür zwischen den Erdhügeln, öffnete sie und ließ ihm den Vortritt. Hinter ihnen fiel die schwere Stahltür mit einem dumpfen Laut ins Schloss.
Die Luft drinnen war erstaunlich frisch. Gasschleusenanlagen, fiel es ihm ein. Er folgte dem vorauseilenden Soldaten die Treppen hinunter. Tiefer und immer tiefer gingen sie in den unterirdischen Riesenbunker. Bis auf das Geräusch ihrer schweren Stiefel auf den Betonstufen drang kein anderer Laut zu ihnen.
Im Geiste rekapitulierte er noch einmal, was er bisher erfahren hatte. Wegen eines Führerbefehls. Deshalb war er hier. Jeder Deutsche wusste seit seiner Schulzeit, dass die zwei Sarkophage der beiden Preußenkönige in der Potsdamer Garnisonskirche standen. »Üb immer Treu und Redlichkeit!« Beinahe hätte er aufgelacht. Nicht fröhlich. Nein. Die Fröhlichkeit war ihm schon seit Langem vergangen. Nicht erst seit Stalingrad. Mein Gott, das ahnten doch alle, dass das nicht gut gehen konnte. Unser Paule, dachte er und musste sich für einen Augenblick am kalten Stahlgeländer festhalten. Paule mit den gutmütigen Augen. Ein Kerl, riesig wie ein Grizzly. Immer zu einem Scherz aufgelegt. Und lachen konnte er. So ansteckend, auch über sich selbst. Aber seit Stalingrad – aus und vorbei. Er atmete tief ein. Versuchte, den Druck auf der Brust loszuwerden. Wenigstens Kulle war noch da. Sein Bruder im Geiste, Pendant seit Kindertagen. »Mensch, mach endlich, Arne«, hatte Kulle damals heiser geflüstert. In der Ferne hörten sie bereits das Rollen der anfliegenden Flugzeuge. Sie standen dicht beieinander an der Brandmauer einer ausgebrannten Ruine in der Prinzenstraße. Die Luftschutzsirenen waren gerade verstummt. Die Straßen menschenleer. Nur sie beide. Wie in einem Vakuum. Kulle und er. »Biste besoffen, oder was? Mach schon. Überleben will ick. Verstehste? Du bist mein Freund. Nur du kannst mir aus der Scheiße raushelfen.« Da trieb er ihm die Axt mit der stumpfen Seite in die Schulter. Fing den keuchenden Körper auf. Rieb Erdklumpen und Ziegelstaub über den Stoff. In der Ferne hörte er bereits die Flak losballern. Wartete wachsam auf die ersten Einschläge. Als die Bomben auf den Potsdamer Platz niedergingen, schleifte er den Freund zum nächsten Bunker. Der Sani blickte kaum auf, sagte nichts, verband nur die Wunde. Am nächsten Morgen verließ der Transport den Lehrter Bahnhof und Berlin Richtung Osten ohne den Feldwebel. Erst viel später hatten sie erfahren, dass Paule in einem der Waggons war.
Er tastete nach dem Foto in seiner Brusttasche. Das Einzige, was ihm von Paule geblieben war. Und immer noch Krieg. »Wir leben provisorisch, die Krise nimmt kein Ende«, fiel ihm ein Zitat von Erich Kästner ein. Den durfte heute auch keiner mehr lesen.
Fanatiker, Bauernfänger waren sie, die Nazis. Nach der Niederlage von Stalingrad hatte Goebbels die Männer auf den totalen Krieg eingeschworen. Noch heute wurde ihm schlecht, wenn er daran dachte. Dicht an dicht hatten sie gestanden. Kein Radrennen, keine Boxkämpfe mehr im Sportpalast. Nur das Kreischen von dem ausgemergelten Dünnen da vorn. Am liebsten hätte er sich die Ohren zugehalten. Und die Gesichter der Männer um ihn herum, begreifen die denn gar nichts?, hatte er gedacht. Gebrüllt hatten sie. Alle. »Ja, wir wollen den totalen Krieg!«
In Gruppen verpuffen individuelle Wert- und Verhaltensmaßstäbe, war ihm damals wieder eingefallen. Der Erklärungsversuch seines ehemaligen Geschichtslehrers, als sich beinahe sämtliche Mitschüler seiner Klasse gegen den Schwächsten unter ihnen wandten. Der dicke Hartmut mit der Stahlbrille, die ihm immer von der Nase zu rutschen drohte. Der sich vor allem und jedem fürchtete. Und er? Hatte sich nicht eingemischt. Das war das Schlimmste. Sich nicht einmischen.
Schon einmal hatte er vor den beiden Sarkophagen gestanden. Damals, als die Särge aus der Garnisonskirche in das Objekt »Kurfürst« verlegt wurden. In den unterirdischen Bunker in Eiche bei Potsdam. Die Befehlszentrale des Oberbefehlshabers der Luftwaffe. Göring. Das Bunkerlabyrinth galt als absolut bombensicher. Natürlich rechnete man mit verstärkten Luftangriffen auf Potsdam.
War der schwer gewesen, der Sarg. Nur in zwei Teilen konnten sie ihn aus der Gruft der Kirche nach oben transportieren. Potsdam und seine Könige, dachte er. Sein Leben lang hatte er die Monarchie verachtet. Die Parks, die Schlösser, den Prunk. Aufgewachsen in Kreuzberg. Erster Hinterhof. Drei Treppen. Der Abort unten in einem separaten Gebäude im Hof. Der Vater ein Stiller. Herrenschneider. War in jungen Jahren aus Bayern nach Berlin gekommen. Seine Mutter aus Pommern. Eine kluge, resolute Person, die dem Vater den Rücken frei hielt. Ein älterer Bruder, eine Schwester und er. Immer die Besten in der Schule. Er bekam eine Empfehlung für das Gymnasium. Eine gnadenlose Zeit. Nicht wegen des Lernens. Wissen hatte er stets aufgesogen wie ein Schwamm. Aber die Klassenkameraden. Mit keinem hatte er sich angefreundet. Eingebildete Herrchen, die verächtlich auf ihn herabblickten. Aber er hatte es geschafft. Einser-Hochschulreife. Das war er den Eltern schuldig gewesen. Durchzuhalten.
Und jetzt musste er retten, was ihm widerstrebte. Die ganze Preußenherrlichkeit mit ihrem Tschingderassa. Scheißkrieg, dachte er. Auch noch die Särge des Ehepaars von Hindenburg. Die hatte man auf die Schnelle von Ostpreußen über die Ostsee nach Kiel und von dort nach Potsdam in diesen Bunker geschafft.
Der Geheimbefehl steckte in der Brusttasche. Mehr als zwei Stunden lang hatten sie ihn mit dem Sachverhalt vertraut gemacht. Danach Vereidigung und Unterschrift aller Anwesenden. Ordnung. Klar. Ganz wichtig. Er verzog die Mundwinkel, sodass seine ernsten, regelmäßigen Gesichtszüge mit den wachen dunkelgrauen Augen spöttisch wirkten. Deutsche Bürokratie. Die musste sein.
Der Gefreite vor ihm wartete. Sie waren angekommen. Die Luft, immer noch frisch. Tolle Ingenieurleistung, dachte er. Aber der Gang. Schmal wie ein Handtuch. Das würde schwierig werden. Genau wie vor zwei Jahren in der Garnisonskirche. Hochkant. Na dann, prost Mahlzeit! Wenn das die beiden Majestäten wüssten. Unwillkürlich musste er grinsen. Gut, dass der andere vor ihm lief. In der Bevölkerung erfuhr kaum jemand etwas von der Umbettung. Die Potsdamer, königstreu wie eh und je. Wenn er nur an seinen alten Klassenlehrer dachte, der hatte jedes Mal feuchte Augen bekommen, wenn er von »seinen« Hohenzollern erzählte. Und jetzt, dachte er, ist die Kacke am Dampfen.
Sie betraten den hallenartigen Raum. Die Kisten waren gepackt. Über zweihundert Fahnen aus der Schlacht bei Tannenberg. Messkelche, Wandteppiche, ein japanisches Teeservice und die Bibliothek Friedrichs des Großen. Herr im Himmel, dachte er, und wer kümmert sich um die Menschen da draußen? Die können verrecken. Endsieg. Das Wort krallte sich in seine Gedärme.
Der Transport sollte in Etappen verlaufen. Vom »Kurfürst« über Magdeburg nach Naumburg zum Heeresfeldzeugamt und weiter nach Bernterode. Nach jeder Teilstrecke war ein Fahrerwechsel vorgesehen. Keiner durfte das Endziel kennen. Nur er wusste über den gesamten Ablauf von Anfang bis Ende Bescheid. Bernterode im Eichsfeld war zwanzig Kilometer von Nordhausen entfernt. Ein stillgelegtes Kalibergwerk. Sie durften keine Zeit verlieren.
Steifbeinig kletterte er aus dem Fahrzeug. Sie waren endlich am Zielort angekommen. Er reckte sich. Die Fahrt war kein Zuckerschlecken gewesen. Sie waren nachts gefahren. Tagsüber immer wieder raus und ab in den Straßengraben wegen der Bedrohung durch Tieffliegerangriffe. Zum Glück kein Feindbeschuss. Er blickte sich um. Hohe Tannen. Hügelige Wiesen. Beinahe romantisch, wenn man nicht wüsste, was sich hier abspielte. Das ganze Werk war ein Munitionsdepot. Tonnenweise wurden hier immer noch Granaten produziert. Zwei Teile Steinsalz, ein Teil Pulver. Und das alles nur mit Kriegsgefangenen und ein paar wenigen deutschen Feuerwerkern, dachte er.
Er durfte keine Zeit verlieren. Alles musste in dieser Nacht in die nicht mehr benutzten Stollen transportiert werden. Er ließ die Lastwagen entladen. Die Männer arbeiteten schnell, verloren keine überflüssigen Worte dabei. Zuerst mussten die Särge hinunter. Aber der Förderkorb war zu klein. Also wieder hochkant. Der Zinnsarg vom Alten Fritz zuerst. Auch als Leichnam hatte der seine Eigenarten, ging es ihm durch den Kopf. Nach mehr als zwei Stunden hatten es seine Männer endlich geschafft. Und ab dafür. Fünfhundertdreiundsechzig Meter. So tief waren die Könige noch nie gewesen, dachte er.
Fertig. Bald Mitternacht. Seine Männer hatten die Särge und die Kisten in einem Nebengewölbe vom Hauptgang untergebracht. Er überprüfte akribisch anhand der Listen noch einmal alle Behältnisse. Dann ließ er den Eingang mit Steinsalz verschließen. Danach Vereidigung auf Geheimhaltung aller Anwesenden mit Handschlag und Unterschrift. Ordnung, das können wir Deutschen, dachte er erschöpft.
Die neue Order für den nächsten Einsatz steckte bereits hinter der alten in seiner Brusttasche. Weiter ging es nach Schlesien, in die Landeshauptstadt Breslau. Jetzt ab zum Bahnhof. Die Lok stand schon unter Dampf. Hoffentlich klappte alles. Der wichtigste Teil lag nun vor ihm. Er betrat sein Abteil. Langsam verließ der Zug den Bahnhof. In Gedanken ging er den Ablauf immer wieder durch. Wenn ihr wüsstet, dachte er, als die Gebäude von Bernterode in der Dunkelheit verschwanden.
Teil I
1
23. Juli – Potsdam-Pirschheide
Konzentriert blickte Hartwig auf die Anzeige seines IMP-Metalldetektors. Ohne Vitamin B biste aufgeschmissen, dachte er. Harald vom Kampfmittelräumdienst hatte er erst weichkochen müssen, damit der ihm das Gerät gab. »Entwickelst du dich jetzt zum Sondengänger?«, hatte der ihn gefragt und »Du weißt aber schon, dass Raubgrabungen den Sachbestand der Unterschlagung erfüllen, oder?« nachgeschoben. »Nicht dass du mich in irgendetwas mit hineinziehst, Kumpel.«
»Samstag geb ich einen aus, okay?«, hatte er nur erwidert. Ohne das Minensuchgerät zur Punktortung hätte er das Ganze knicken können. Immer noch kein Ausschlag auf der Skala. Seine Geduld ging bereits gegen null. »Wo seid ihr, verdammt noch mal?«, brummte er. Clärchen, sein Berner Sennenhund, bewegte die Ohren, blieb aber angeleint gehorsam am Rand der Lichtung sitzen. Nur seine große schwarze Gumminase vibrierte, nahm Witterung auf. Die zwei Mettwurstbrötchen würde er erst nach getaner Arbeit mit Clärchen teilen. Mit der freien Hand zog er den Plan aus der Jackentasche. Wind zerrte am Papier. Er hatte aufgefrischt. Eine Wohltat nach der Hitzewelle der vergangenen Tage. Trotzdem klebte ihm das ärmellose T-Shirt, das er über der Trekkinghose trug, am Körper. Am Himmel zogen sich dunkle Wolken zusammen und wanderten in wechselnden Formationen schnell weiter. Das sah verdammt noch mal nach einem Sommergewitter aus. Missmutig blickte er auf das alte Stück Papier. Die Skizze war kaum brauchbar. Der Wald ringsum hatte sich verändert, Gebüsch das Unterholz völlig überwuchert. Er hatte die Schritte vom Hauptweg genau gezählt, wie auf dem Plan angegeben. Irgendwo hier musste es sein. Er betastete die Schwellung am Kinn. Tat immer noch weh. Aber das Arschloch würde sein Fett abbekommen, schneller, als der überhaupt denken konnte. Die Nadel bewegte sich. Tanzte auf der Skala hin und her. »Na also«, bemerkte er. Zog eine Farbspraydose aus der Tasche seiner Hose und markierte die Stellen, bei der ein Ausschlag erfolgte. Zufrieden betrachtete er das weiße Rechteck auf dem Waldboden. Clärchen winselte. »Aus, du Pfeife!«, befahl Hartwig. »Papi arbeitet.« Der Hund drehte sich mehrmals im Kreis, kratzte mit den Vorderpfoten im Sand und ließ sich mit einem Seufzer auf die Erde fallen.
Hartwig stellte den Metalldetektor zu seinen anderen Arbeitsgeräten, steckte die Karte in den Rucksack und griff nach dem Spaten. Die Kante hatte er vorsorglich scharf angeschliffen und zusätzlich zu der grünbraunen Bundeswehrplane noch eine Grabegabel und eine Schaufel mitgenommen. Er blickte sich um. Hatte da nicht ein Ast geknackt? Windböen fuhren durch die Kronen der Kiefern. Nicht einmal die Vögel sangen bei dieser Wetterlage. Entfernt hörte er das Rauschen des Autoverkehrs zwischen Potsdam und Geltow. Da, da war es wieder. Schlich hier jemand rum und beobachtete ihn? Auch Clärchen spitzte die Ohren und knurrte leise. Hartwig zog eine zerdrückte Zigarettenpackung aus dem Rucksack, nahm eine Zigarette heraus und ließ das Feuerzeug schnappen. Gierig inhalierte er den ersten Zug, hustete und nahm, ohne sich darum zu scheren, den nächsten. Als die Zigarette halb aufgeraucht war, warf er sie auf den sandigen Waldboden, trat sie aus und schob mit dem Fuß etwas Sand über den Stummel. »Na dann«, murmelte er.
Mit der Grabegabel kennzeichnete er die Stelle. Brummte mehr, als dass er sang: »Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor.« Wechselte das Arbeitsgerät, stach mit dem Spaten Vierecke heraus und trug das Erdreich ab. In der Ferne hörte er Donnergrollen, dann erklang das Trommeln von »Little Drummer«. Hartwig zog sein Smartphone aus der Hemdtasche. Als er die Nummer auf dem Display erkannte, wischte er sie weg und schaltete das Gerät aus. Grub weiter. Clärchen schlug an. Verdammt, warum hatte er den Hund nicht zu Hause gelassen? Das Bellen konnte Leute anlocken. Er stieß den Spaten so tief in den Boden, dass er stecken blieb, lief zu seinem Rucksack, zog einen Blechnapf heraus, füllte ihn mit Wasser aus einer Flasche und stellte ihn vor das Tier. Dankbar blickte Clärchen ihn an und schlabberte das kühle Nass. Erste Regentropfen klatschten auf Hartwigs nackte Arme.
»Na siehste«, brummte er und strich dem Tier über den Kopf. Das Gewitter kam näher. Er musste sich beeilen. Nur noch eine Viertelstunde, dann würde er Schluss machen. Das dauerte ihm alles viel zu lange, und er hatte noch jede Menge zu tun. Zu Hause stapelte sich das Material. Erneut griff er nach dem Spaten, als der Hund lang gezogen heulte. »Aus!«, brüllte Hartwig. Schwankte, griff sich an die Brust. Schaute auf seine Hand. Sie war blutverschmiert. Der Boden unter ihm bewegte sich. Brennende Hitze umschloss ihn. Er riss den Mund auf, doch der Schrei kam nicht mehr über seine Lippen. Sein Kopf kippte nach vorn wie der einer Gliederpuppe. Und da, wo einmal sein Arm gewesen war, schoss an den Schulterknochen Blut hervor. Wie eine Fontäne. Clärchen hatte sich losgerissen, humpelte. Eine Pfote hing kraftlos herab. Trotz der nur noch drei intakten Beine schoss der Hund wimmernd durch das Dickicht.
2
24. Juli – Potsdam
Auf Hauptkommissar Maik von Lilienthals Schreibtisch verquirlte ein Tischventilator die schwüle Luft, was nur bedingt den Eindruck von Frische erweckte. In allen Räumen des Potsdamer Polizeipräsidiums herrschte im wörtlichen Sinne dicke Luft.
»Wie weit sind wir mit dem Todesfall in der Pirschheide?«, fragte Lilienthal.
Leo Kalumet, Kommissar und noch nicht lange im Team, blickte auf seine Notizen. »Der Tote«, er räusperte sich, »also, was von dem Leichnam noch übrig ist, konnte identifiziert werden. Es handelt sich um einen gewissen Jens Hartwig, fünfundzwanzig Jahre alt, geboren in Neuruppin und Doktorand der Tiermedizin.«
»Hat er im Wald empirische Studien betrieben?«, kommentierte Lilienthal nicht besonders witzig den Fundort der Leiche, während er sich mit einem Blatt Papier zusätzlich Luft zufächelte. Dabei wechselten seine dunkelbraunen Haare je nach Richtung des Ventilators ihre Frisur.
»Hartwig war einer der Initiatoren der Volksbefragung gegen Massentierhaltung.«
»Ein sensationeller Erfolg mit beinahe hundertviertausend gültigen Stimmen«, ergänzte Heike Mohn, Kriminalassistentin. Wegen der Hitze hatte sie ihre langen blonden Haare zu einem hohen Pferdeschwanz gebunden. »Das Landwirtschaftsministerium versucht, das herunterzuspielen, und der Bauernverband verbreitet gerade ein Drohszenario. Brandenburger Bauern würden bankrottgehen, sollten die Forderungen der Initiative umgesetzt werden.«
»Aha«, murmelte Lilienthal. Sein Interesse hielt sich in Grenzen. »Wie konnte Hartwig anhand der Restmenge an Körperteilen eigentlich identifiziert werden?«
Heike verzog das Gesicht. Sie fand die Formulierung ihres Chefs offensichtlich nicht angebracht.
Kalumet blätterte in den Papieren. Sein durchtrainierter Oberkörper zeichnete sich unter dem eng anliegenden dunkelblauen T-Shirt ab. »Anhand eines IMP-Minensuchgerätes zur Punktortung, von dem man allerdings auch nur noch wenige Teile gefunden hat«, sagte er. »Durch die Kennzeichnung konnte die Kriminaltechnik den Kampfmittelräumdienst als Besitzer ausmachen. Ein Harald Rubens hat zugegeben, das Gerät seinem Freund Jens Hartwig geliehen zu haben.«
»Und wofür?«
»Wusste er nicht. Erwähnte aber, dass Hartwig sehr geheimnisvoll getan habe.«
»Der Rubens, immerhin Beamter, hat das Gerät einfach mal an eine polizeifremde Person verliehen?« Lilienthal zog den Ventilator näher zu sich heran. »Demnächst verborgt man noch Einsatzfahrzeuge. Gern auch mal eine Dienstwaffe«, fügte er sarkastisch hinzu, öffnete einen weiteren Knopf an seinem Hemd, beugte sich vor und ließ die kühle Luft über seine Haut streichen, sodass sich der Hemdstoff wie ein Segel blähte.
»Rubens ist bereits vom Dienst suspendiert«, informierte Kalumet.
»Na, wenigstens etwas«, knurrte Lilienthal.
»Interessant ist in dem Zusammenhang der Bericht der Kriminaltechnik«, sagte Heike.
Lilienthal goss sich Eistee aus einem Tetra Pak in seinen Kaffeebecher, starrte missmutig in die Tasse und trank einen Schluck. »Lass hören, was sagen die Spusinasen?«
»Hartwig ist durch die Explosion einer Kampfmittelaltlast umgekommen. Dabei handelt es sich um einen Blindgänger einer englischen Weltkriegsbombe mit einem ungewöhnlichen Zündmechanismus. Zu den im Vergleich sonst üblichen Zündkörpern verfügte diese sowohl über einen Heck- als auch über einen Kopfschlagzünder.«
»Ich tippe mal auf unseren außergewöhnlichen Leiter der Kriminaltechnik mit Erfahrungen als ehemaliger Bombenentschärfer als Informationsgeber?«
Heike nickte. »Manni Langer war hellauf begeistert, weil Bombentypen wie diese kaum noch vorkommen. Ihr wisst ja, wie er sich in alles Technische hineinarbeitet. Aber interessanter ist das hier.« Sie nahm den Bericht der Rechtsmedizin in die Hand. »Schlüsselbeindurchschuss.«
»Wie jetzt? Doppelt gemoppelt, oder was?«
»Kann man so sagen, Chef. Kurz bevor die Bombe hochging, wurde auf Hartwig geschossen.«
»Das ist doch mal was.« Jetzt war Lilienthal hellwach. »Also, Kollegen, dann mal hopphopp. Heike, du überprüfst alle Kontakte von diesem Hartwig. Familie, Freunde, Umfeld. Wer wollte unserem angehenden Doktor der Tiermedizin und ehrenamtlichen Tierschützer an den Kragen? Und wir beide, Leo, werden uns Hartwigs Wohnung ansehen.«
Das Telefon klingelte. Kalumet nahm den Anruf entgegen und hörte konzentriert zu. »Wir kommen«, sagte er und legte auf. »Anruf von unserer Polizeiwache Potsdam-Mitte. Ungeklärter Todesfall im noblen Seniorenstift Havelaue.«
»Kann das nicht jemand anders übernehmen?«, fragte Lilienthal.
»Nein. Das andere Team ist gerade mit einer Schlägerei mit schwerer Körperverletzung in der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in der Heinrich-Mann-Allee beschäftigt, und der Rest hat Urlaub.« Kalumet griff nach dem kleinen schwarzen Koffer, im Polizeijargon »Tatortköfferchen« genannt. Er enthielt die Standardausrüstung der Mordkommission mit Einmalhandschuhen, Laptop, Drucker und Papier für sofortige Zeugenaussagen.
»Wenigstens liegt das Seniorenstift am Wasser«, merkte Lilienthal an, dem das Hemd sofort wieder am Rücken klebte, als sie den Raum verließen.
3
Am selben Tag – Zürich-Kloten
Wie Ameisen, denen jemand ihren Bau zerstört hatte, hasteten die Menschen an Enne von Lilienthal vorbei. Gestern hatte ein Unwetter den Flugverkehr am Zürcher Flughafen Kloten lahmgelegt, doch an diesem Morgen sollten wieder Maschinen starten. Durch die dicken Glasscheiben der Abflughalle blickte sie Richtung Himmel. Immer noch jagten unförmige Wolkengebilde wie von einer Riesenfaust zusammengeballt einander. Ob ihre Swissair-Maschine nach Berlin die Startfreigabe bekommen würde, war nicht sicher. Ihr gegenüber auf dem Hallenfußboden saß eine junge Frau mit langen blonden Haaren und trotz der heruntergekühlten Raumtemperatur nur mit einem weißen Top und Shorts bekleidet. Die Beine zum Schneidersitz gekreuzt, den Rücken an einen Pfeiler gelehnt, balancierte sie unbeeindruckt von der Hektik um sich herum einen Laptop auf ihren Knien und hackte, Ohrstöpsel im Ohr, konzentriert auf die Tastatur ein.
Schön waren die letzten Tage in Kilchberg gewesen. Ihr längst fälliger Besuch bei Emmi und ihrem Mann Andreas. Traumhaft, der Blick auf den Zürichsee von ihrer Terrasse aus. Jedes Mal, wenn sie bei ihren Verwandten weilte, kam sie sich wie im Urlaub vor. Richard Körner hatte über das ganze Gesicht gestrahlt, als sie ihm von ihrer geplanten Reise erzählte, denn seine Tagung, ausgerichtet von Europol, fand zeitgleich in Zürich statt. Fröhlich hatte er ihr Argument beiseitegewischt, dass es für ihn doch Arbeitstage seien, und entgegnet: »Alles zu seiner Zeit, Ennekin«, und sie dabei so intensiv angesehen, dass sie gespürt hatte, wie ihre Wangen sich röteten. In letzter Zeit zog Körner wieder einmal alle Register. Seine so offensichtliche Zuneigung schmeichelte ihr. Aber wollte sie wirklich eine feste Bindung? In den letzten Tagen waren sie und Emmi wie früher als junge Studentinnen allein losgezogen. Auf die Piste gegangen. Ins Niederdörfli mit seinen gewundenen Gassen. Keine Bar hatten sie ausgelassen und waren erst, als das frühe Licht des Morgens sich ankündigte, mit einem Taxi zurück ins beschauliche Kilchberg gefahren. Sie fühlte sich so voller Leben wie schon lange nicht mehr. Körner, eingebunden in viele Workshops, konnte sich nur an einem verlängerten Vormittag von der Tagung absetzen. Sie waren hinauf zum Uetliberg gefahren, hatten im »Uto Kulm« Aperol getrunken und das Bergpanorama des Albis bestaunt. Danach waren sie ins »Odeon« am Limmatquai gegangen, das im Stil der Wiener Kaffeehäuser erbaut war. Seit sie das erste Mal vor vielen Jahren in Zürich gewesen war, liebte Enne das Café. Sie fühlte sich dort in eine andere Zeit versetzt. Körner hatte einen Tisch am Fenster in einer kleinen Nische reserviert und zeigte ihr stolz eine antiquarische Ausgabe von James Joyce, die er am Tag zuvor in einer winzigen Buchhandlung entdeckt und sofort gekauft hatte. Immer wieder überraschte er sie mit seinem literarischen Wissen. Natürlich wusste sie, dass viele berühmte Persönlichkeiten im letzten Jahrhundert das »Odeon« besucht hatten, aber Körner schnurrte die Namen nur so herunter – Werfel, Zweig, Tucholsky, Remarque – und sonnte sich in ihrer Bewunderung. Als er auch noch Einstein, Mussolini und Lenin erwähnte, bekam sie einen Lachanfall, allerdings waren sie da bereits beim dritten Schümli Pflümli angelangt. Ihren Abschiedsabend verbrachten sie auf der Terrasse vom »Storchen«. Malerisch spiegelten sich die erleuchteten Fassaden der alten Bürgerhäuser am anderen Ufer im dunklen Wasser der Limmat. Körner hatte liebevoll ihre Hand genommen und wehmütig bemerkt, wie schnell die Tage vergangen waren und er, bis auf die zwei Mal, keine Zeit gefunden hatte, mit ihr zusammen die Stadt zu erkunden.
Körner überragte die Menschenmassen, die vor dem Gate warteten. Der sommerlichen Hitze angepasst trug er nur ein weißes Hemd über einer Leinenhose, was seine kräftige Gestalt schlanker wirken ließ. Ihre Maschine war nahezu ausgebucht. Nur mit Hilfe eines Schweizer Kollegen hatte er für sie beide noch Plätze bekommen. Grund für seinen vorzeitigen Rückflug war ein Toter bei einer Bombenexplosion in Potsdam. Enne wiederum hatte die Gastfreundschaft ihrer Cousine nicht länger strapazieren wollen. Körner winkte mit den Bordkarten. Sie griff nach ihrer Tasche, warf sich das hellblaue Seidentuch über das ärmellose dunkle Top, strich ihren hellen Baumwollrock glatt und drängte sich durch zum Counter.
Körner hatte ihr galant den Sitz in der zweiten Reihe überlassen, er würde weiter hinten sitzen. Enne wollte gerade ihre Reisetasche ins Gepäckfach hieven, da erhob sich blitzschnell ihr Sitznachbar. Dichtes weißes Haar umrahmte ein großflächiges Gesicht mit gerader Nase und attraktiv geschwungenen Lippen. Als er sich aus dem Sitz geschält hatte, bemerkte sie, dass er sie nur um wenige Zentimeter überragte. Sein freundliches Lächeln aus sanften braunen Augen nahm Enne sofort für ihn ein, und gern akzeptierte sie seine Hilfe. Kaum saß sie neben ihm, plauderte er bereits über alles Mögliche. Intelligent und witzig parierte er Ennes Bemerkungen über die Anstrengungen von Flugreisen und lud sie, als sie die Reiseflughöhe erreicht hatten, zu Champagner ein. Selten waren die anderthalb Stunden von Zürich nach Berlin so amüsant und schnell vergangen. Der Pilot leitete bereits den Sinkflug ein, als ihr Sitznachbar erwähnte, dass er gute Beziehungen zu dem Direktor des Bankhauses Justus Adler habe. »Andreas Renner ist Experte für hervorragende Anlagemöglichkeiten.« Er zwinkerte ihr diskret zu. »Falls Sie Interesse haben, könnte ich den Kontakt herstellen.«
Sie lachte und prostete ihm zu, was er offensichtlich als Einverständnis wertete. Andreas Renner war ihr angeheirateter Cousin. Aber das behielt sie lieber für sich.
Der Pilot legte eine Ehrenrunde ein, überflog den Fernsehturm am Alex, kreiste um die Kuppel des Bundestages und setzte die Maschine kurz danach sanft holpernd auf der Runway auf. Enne beobachtete nicht zum ersten Mal amüsiert, wie sich die meisten Passagiere fluchtbereit aus ihren Sitzen drängelten, ihre Gepäckstücke aus den Stauräumen über ihren Sitzen zerrten, um dann dicht an dicht stehend minutenlang genervt auf das Öffnen der Türen zu warten.
Ennes Sitznachbar reichte ihr seine Visitenkarte. »Ich hoffe, wir sehen uns bald einmal wieder. Es war mir ein Vergnügen, mit Ihnen zu reisen«, verabschiedete er sich lächelnd von ihr mit blitzenden Augen.
Sie wartete auf Körner, der bereits sein Smartphone ans Ohr hielt. Sein Gesichtsausdruck lag auf einer Befindlichkeitsskala von eins bis zehn im Minusbereich.
»Ärger?«, fragte sie, als sie vor dem Terminal auf ein Taxi warteten.
»Der reinste Kindergarten«, bollerte er los. Diplomatisch wartete Enne ab, und Körner setzte auch sofort nach: »Enderlein hat sich mit Maik gestritten. Ganz großes Kino laut Hella.«
»Soll vorkommen«, murmelte Enne, die ihren Sohn, Hauptkommissar bei der Potsdamer Kripo, kannte und in ihrer aktiven Zeit beim Landeskriminalamt Berlin auch des Rechtsmediziners Befindlichkeiten zur Genüge kennengelernt hatte.
»Das gibt Ärger«, fauchte Körner und stellte sich demonstrativ vor die nächste Taxe auf die Fahrbahn.
4
Am selben Tag
Lilienthal stand vor dem Schreibtisch des Alten. Aufgeplustert wie ein Truthahn nahm Körner den Stuhl in seiner ganzen Breite ein. Gerade erst von seiner Tagung in Zürich zurückgekehrt, las er einen Bericht und ließ ihn warten. Wie einen Berufsanfänger. Nicht einmal einen Stuhl hatte er ihm anbeboten.
»Dienstaufsichtsbeschwerde, ja habt ihr sie noch alle?«, grollte er, nachdem er fertig war. »Unser Herr Doktor fühlt sich von dir persönlich angegriffen. Bist du etwa aggressiv geworden?«
Lilienthal atmete durch. Erst mal den Alten sich abreagieren lassen, dann konnte er mit den Fakten kommen. Er wartete auf sein Stichwort.
»Und?«, kam es auch schon von der anderen Seite des Schreibtischs.
»Herzversagen mit anschließendem multifunktionalen Organversagen«, fing Lilienthal an.
Körner musterte ihn mit zusammengezogenen Augenbrauen. »Und?«, fragte er erneut.
Lilienthal bemühte sich, ruhig zu bleiben. Aber wenn er an den Streit mit Enderlein dachte, stieg schon wieder Empörung in ihm hoch. »Das ist eine allgemeingültige Formulierung, wenn ein Mensch stirbt. Als ich ihn um eine präzisere Angabe bat, hat er mich angebrüllt. Vor dem gesamten Team. Ob ich an seiner Fachkompetenz zweifeln würde.«
»Hier steht, du hättest gesagt, wenn das seine Diagnose sei, dann könne er, also Enderlein, sich langsam auf die Altersteilzeit vorbereiten.«
»War vielleicht nicht gerade diplomatisch«, gab Lilienthal zu. »Aber der alte Mann lag verdreht und mit weit aufgerissenen Augen in seinem Bett. Engstellung der Pupillen. Das ganze Gesicht verschmiert mit Tränen- und Speichelflüssigkeit. Das war sogar für mich als medizinischen Laien auffällig. Nachvollziehbar, dass der behandelnde Arzt auf dem Totenschein ›nicht natürlicher Tod‹ angekreuzt hat. Folgerichtig wurde daraufhin sofort die Polizei verständigt.«
»Erster Zugriff erfolgt?«
»Der Bereitschaftsdienst der Schutzpolizei hat sofort das Nötigste veranlasst. Info an MK1 und Tatortsicherung; das normale Prozedere. Das alles war Enderlein vorher bekannt, und dann kommt er mit so einer Einschätzung.«
»Bist du unter die Hellseher gegangen?«, knurrte Körner. »Immerhin ist Enderlein eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Und hier steht, du hättest ihn auch verbal bedroht.«
»Er hat die Hand erhoben, als ich mich vor ihn stellte. Da habe ich nur angemerkt, dass ich den fünften Dan in Karate habe.«
»Und hast du wirklich?«
Lilienthal nickte.
»Mit dem fünften Dan überschreitet der Meister die Schwelle zum höheren Wissen«, zitierte Körner zum Erstaunen Lilienthals aus dem Buch der japanischen Kampfkünste. »Aber bei deinem Verhalten kommen mir berechtigte Zweifel.« Er trommelte mit den Fingern auf die Arbeitsplatte und zog den Bericht zu sich heran. »Und wie kommen wir aus der Nummer jetzt wieder raus, Herr Chefermittler?«
Lilienthal presste die Lippen aufeinander. Umgekehrt wurde ein Schuh daraus. Er fühlte sich angegriffen. Einen Rückzieher machen? Nein, auf keinen Fall. Was bildete sich Enderlein eigentlich ein? Koryphäe hin oder her. Außerdem war der bekannt für seine sarkastische, meist unter die Gürtellinie gehende Art. Und er, Lilienthal, hatte diesmal nur die gleiche Tonart gewählt.
Körners Handfläche klatschte auf das Papier. »Du wirst um eine Entschuldigung nicht herumkommen.«
Lilienthal verschränkte die Arme vor der Brust, schüttelte den Kopf.
»Dann muss ich dich von dem Fall suspendieren.«
Lilienthal starrte Körner an. Waren hier alle inzwischen komplett verrückt geworden?
»Ich erwarte deine Antwort bis morgen. Und wie die ausfallen wird, ist dir hoffentlich klar.« Körner griff zu einer Akte und fing an zu lesen. Lilienthal war entlassen.
5
Am selben Tag
Enne trank von ihrem Aperol. Bei der Hitze genau das Richtige. Sie hatte draußen auf dem Bürgersteig im Schatten der Bäume noch einen freien Tisch gefunden. Sie liebte das »Levy«. Ein kleines, feines Restaurant, das frisch zubereitete Spezialitäten servierte. Entspannt sah sie den Passanten zu, die über die Potsdamer Einkaufsmeile, die Brandenburger Straße, bummelten. Maik und sie waren zu einem schnellen Imbiss verabredet. Sie wollte ihm von ihrem Besuch in Kilchberg erzählen, war aber natürlich seit Körners Bemerkung am Flughafen auch neugierig. Nicht nur wegen des Toten in der Pirschheide, sie wollte auch wissen, was zu der Auseinandersetzung zwischen ihm und Enderlein geführt hatte.
Lilienthal, hochrot im Gesicht, ließ sich auf den Stuhl ihr gegenüber fallen. Holland in Not! Er bestellte ein großes Glas Wasser mit einer Zitronenscheibe, trank, und langsam kehrte seine normale Gesichtsfarbe zurück.
Sie plauderte über Zürich und die Verwandtschaft, und als von seinem Salat mit frischen Kräutern, Serranoschinken, Ziegenkäse und Pinienkernen beinahe nichts mehr übrig war, konnte sie nicht mehr länger an sich halten. »Seid ihr mit dem Toten aus der Pirschheide weitergekommen?«, fragte sie möglichst harmlos.
Lilienthal schmunzelte. »Du kannst es nicht lassen, was, Mutter?«
Enne grinste. »Muss ich das denn?«, erwiderte sie.
Er seufzte übertrieben. »In deinem Alter glaube ich kaum noch an Besserung. Bevor du also weiter versuchst, mich auszuhorchen: Fakt ist, dass auf den Toten in der Pirschheide, bevor er sich durch eine Explosion in seine Bestandteile auflöste, geschossen wurde. Sein Name ist Jens Hartwig.«
»Ach was, der Hartwig von der Volksinitiative?«
»Genau der.«
Enne gab der Kellnerin ein Zeichen und bestellte noch einen weiteren Aperol für sich und ein Wasser für ihren Sohn.
»Mit dem Hartwig habe ich mich mal ganz interessant in der Fußgängerzone unterhalten«, klärte sie ihn anschließend auf. »Damals, als es um die Unterschriften gegen Massentierhaltung ging. Ein sympathischer und intelligenter junger Mann. Erzählte mir, Brandenburger Seilschaften im Landwirtschaftsministerium seien für die Initiative das Hauptproblem, aber er werde dranbleiben. Das hat mir imponiert. Der war heiß auf das Thema und ließ sich nicht einschüchtern.«
»Namen hat er nicht genannt, oder?«
Enne schüttelte den Kopf. »Nein. Aber ich glaube, er sagte etwas über einen Betreiber von mehreren Megaställen, der ans Kreuz genagelt werden müsste. Gut, die Formulierung war nicht besonders taktvoll, aber er hatte es auch nicht so mit Political Correctness.«
Lilienthal schaute auf seine Uhr. »Ich muss gleich wieder los. Übrigens hat Enderlein eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen mich in Aussicht gestellt, falls ich mich nicht bei ihm entschuldige. Körner hat mich auch dazu aufgefordert.«
»Zoff im Team kommt immer mal wieder vor. Nicht schön, aber menschlich. Was ist denn vorgefallen?«
Er erzählte ihr kurz, wie es dazu gekommen war.
»Die neutrale Einschätzung einer Todesursache sieht Enderlein so gar nicht ähnlich. Genauso wenig wie seine überzogene Reaktion auf deine Nachfrage«, bemerkte sie, nachdem er fertig war.
Lilienthal wirkte nach ihrem Kommentar sichtlich erleichtert und verabschiedete sich.
Enne blickte ihrem Sohn hinterher, wie er schnell, dabei das eine Bein leicht hinterherziehend, zurück zum Präsidium eilte. Die in Aussicht gestellte Dienstaufsichtsbeschwerde ging ihm sichtlich an die Nieren. So etwas vergiftete die Atmosphäre. Und Körners Reaktion? Ungewöhnlich. War sie der Hitze geschuldet, oder was war da los im Potsdamer Polizeipräsidium?
Heike winkte ihm zu, als Lilienthal ins Büro kam. »Der Assi von Enderlein hat angerufen. Du möchtest sofort in die Rechtsmedizin kommen. Wichtig.«
»Schickt der Herr Doktor jetzt seinen Assistenten vor?«, bemerkte er bissig. Aber gut, dachte er und war bereits wieder auf dem Weg, den Stier bei den Hörnern zu packen und gleichzeitig zu versuchen, die Wogen zu glätten. Dazu war jetzt die beste Gelegenheit.
»Leo ist übrigens zur Wohnung von dem Hartwig gefahren!«, rief Heike ihm noch hinterher.
6
Das Institut für Rechtsmedizin lag an der Lindstedter Chaussee. Alle Fenster geöffnet, damit die Hitze im Wageninneren sich verflüchtigte, fuhr Lilienthal vorbei am Schloss Lindstedt, auf dessen gegenüberliegender Seite Enderlein sein Reich hatte. Als er eingelassen wurde, empfand er die niedrige Temperatur im Institut als angenehm. Dr. Malte Görlitz, dünn und drahtig wie eine Weidengerte, hob grüßend die Hand, als er dessen Büro betrat, und wies auf den Bildschirm vor sich. Lilienthal beugte sich vor, als er hinter sich Enderleins heisere Raucherstimme vernahm.
»Ach, Herr Kommissar Schlaumeier.«
Lilienthal fuhr herum. Mit seiner auch sonst nicht gerade rosigen Gesichtsfarbe und dem Alter entsprechenden Gebrauchsspuren im Antlitz sah Enderlein heute verändert aus. Aufgedunsene Gesichtszüge, Tränensäcke, dazu verquollene Lider. Seine Handbewegungen, als er an den Computer trat, wirkten fahrig. »Um es kurz zu machen, Lilienthal, meine Diagnose, wegen der wir eine kleine Meinungsverschiedenheit hatten …«
Lilienthal hörte verblüfft zu. Was war denn mit dem auf einmal los? Kleine Meinungsverschiedenheit? Stand der unter Drogen?
»Der Hochbetagte in dem schönen Seniorenstift Havelaue, dem jeder ein natürliches Ende gewünscht hätte, starb an einer sogenannten endogenen Vergiftung mit Acetylcholin. Einer toxischen Schädigung mit Wirkung auf Lunge, Leber, Nieren, das Herz-Kreislauf- und das zentrale Nervensystem.« Er musterte Lilienthal kurz durch seine dicken Brillengläser, räusperte sich und fuhr fort: »Sein vorzeitiges Ableben erfolgte aufgrund eines Phosphorsäureesters, der gern als Insektizid in der Landwirtschaft und im Gartenbau verwendet wird.« Er machte eine theatralische Pause, ignorierte seinen Assistenten, der genervt die Augen verdrehte, zog eine zerdrückte Packung Gauloises aus seiner Kitteltasche, betrachtete sie ratlos, steckte sie zurück und sagte dann heiser: »Dimethoat.«
»Aha«, kommentierte Lilienthal nicht besonders gescheit.
Enderlein blickte ihn nachdenklich an, wandte sich ohne weitere Erklärung um und verschwand so leise und schnell in seinem Büro, wie er gekommen war.
Lilienthal überlegte. Der Rechtsmediziner hatte weder ihren gestrigen Streit noch seine in Aussicht gestellte Dienstaufsichtsbeschwerde erwähnt. Im Gegenteil, er hatte die Angelegenheit bagatellisiert.
»Auf welcher Basis dem Opfer das Gift zugeführt wurde, ist noch nicht hundertprozentig geklärt. Sie erhalten umgehend Bescheid, wenn wir die Analysen abgeschlossen haben. Das möchte ich hier nur der Ordnung halber noch anmerken, Herr Hauptkommissar«, murmelte Görlitz.
Als Lilienthal wieder auf den Gang trat, stand dort eine junge Frau mit den weichen Gesichtszügen einer Anfang Zwanzigjährigen. Voller Ernst blickte sie ihn an.
»Dr. Görlitz hat die Obduktion durchgeführt und anschließend mit dem Chemiker die Analysen ausgewertet. Ich«, sie räusperte sich, »wir alle schätzen den Chef.« Sie biss sich auf die Lippen, fuhr dann hastig fort: »Aber seit ein paar Tagen ist Dr. Enderlein wie verwandelt. Kommt spät, verschwindet in seinem Büro und verbittet sich jede Störung, obwohl wir dringende Fälle haben. Erst als der Anruf wegen des Toten im Seniorenstift hereinkam, hat er an diesem Tag sein Büro verlassen.« Sie blickte Lilienthal beschwörend an. »Bitte behalten Sie das für sich.« Dann fügte sie leise hinzu: »Ich habe das von der Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Sie gehört. Das ist nicht in Ordnung, finde ich. Darum habe ich Ihnen das erzählt.«
Lilienthal nickte und verließ nachdenklich das Gebäude. Als er in seinem Wagen saß und losfahren wollte, klingelte sein Smartphone. Kalumet bat ihn, dringend in Hartwigs Wohnung zu kommen. Er habe dort etwas Interessantes gefunden.
7
Hartwigs Wohnung lag im Ortsteil Drewitz. Das Haus aus den dreißiger Jahren des letzten Jahrhunderts benötigte dringend eine Fassadenrenovierung.
Als Lilienthal durch die offen stehende Wohnungstür im Erdgeschoss eintrat, erinnerte ihn das Ambiente an seine WG-Phase mit Lorenz, seinem malenden Jugendfreund. Beherrschbares Chaos, Lorenz’ Glaubenssatz, wenn Lilienthal sich über die Schlamperei in Küche und Bad mokiert hatte. Vor dem endgültigen Bruch suchte Lorenz sich eine andere Bleibe, und Maja, Lorenz’ finanzstarke ältere Muse, mietete ihm ein Atelier und kam großzügig für seinen Lebensunterhalt auf. Lilienthal war ihr aus tiefster Seele dankbar gewesen. Dadurch hatte jeder sein Leben weiterführen können, ohne dass ihre Freundschaft Risse bekam.
An der Garderobe von Hartwigs Wohnung hingen diverse Kleidungsstücke. Darunter lagen kreuz und quer Sportschuhe, Gummistiefel und ausgetretene Flipflops.
Kalumet rief Lilienthal in eines der Zimmer. Eine großflächige Arbeitsplatte auf zwei Holzböcken, darauf Laptop, Tablet-PC und drei Fotoapparate mit verschieden großen Objektiven. Überall stapelten sich Papiere, Bilder und Zeitungsausschnitte. Die Kollegen der Kriminaltechnik, trotz der Hitze in weißen Schutzanzügen, packten alles in Kisten. Im angrenzenden Zimmer lag auf einer großen Matratze dunkelblaues Bettzeug. Dem Aussehen und dem Geruch nach zu urteilen, nicht mehr taufrisch. Auf dem Fußboden stapelten sich diverse Bücher, Fachliteratur, wie Lilienthal nach einem flüchtigen Blick darauf registrierte, dazwischen, nahe der Matratze, stand in einem Holzrahmen die Fotografie einer jungen Frau. Kalumet hob eine Ecke der Matratze an und zog eine Segeltuchtasche hervor.
Lilienthal kniete sich auf den Boden, öffnete sie und zog einen Schnellhefter hervor. Dabei rutschte ein Stick heraus und fiel vor seine Füße.
Kalumet bückte sich, hob ihn auf und holte aus dem Nebenraum den Tablet-PC.
»Deutsches Institut für Ernährungsforschung Potsdam-Rehbrücke – Gutachten«, stand auf dem Deckblatt des Schnellhefters. Lilienthal blätterte durch die Seiten. »Es geht um Schweinefleischproben, die zur Begutachtung eingeschickt wurden«, informierte er den Kollegen. Kalumet hatte bereits den Stick mit dem Tablet-PC verbunden und startete den Film, der sich darauf befand.
Auf dem Bildschirm erschien in Großaufnahme ein längliches graues Gebäude, keine Fenster, nur Lüftungsrohre ragten aus dem mit Wellplatten gedeckten Dach. Die Kamera schwenkte zu einer Tür. Schnitt. Im Inneren erkannte man in grelles Licht getauchte Boxen, getrennt durch massive Metallgitter. Das Kameraauge fuhr heran. Getrocknetes Blut an den kotverschmierten Stäben. In den Boxen lagen apathisch Schweine in ihren Exkrementen. Zoom. Schmeißfliegen, Maden, Kakerlaken, tote Mäuse, deren Kadaver am Boden festgetreten waren. Die Kamera holte ein Tier näher heran. Das Schwein versuchte, sich hochzustemmen, aber seine Beine waren zu dünn. Es knickte ein, sank zur Seite und blieb liegen. Die Box war so schmal, dass sich die Gitterstäbe an seinen Körper pressten. An der Bauchseite erkannte man einen offenen Abszess. Die Kamera ging in die Totale. Fast überall das gleiche Bild. Viele der Tiere waren übersät mit entzündeten Geschwüren, teilweise abgebissenen Schwänzen, deformierten Ohren und verkümmerten Klauen. In der letzten Sequenz blickte ein mächtiges Schwein aus trüben Augen den Betrachter an, bevor der Bildschirm schwarz wurde.
»Großer Gott«, murmelte Lilienthal. »Das kann man, ohne Medikamente einzuwerfen, kaum ertragen.«
Kalumet, den eine verstümmelte menschliche Leiche nicht erschüttern konnte, schien plötzlich unter Blutarmut zu leiden. Sein gebräuntes Gesicht war kreidebleich, er entfernte den Stick vom Gerät und legte ihn zurück in die Tasche. Griff noch einmal hinein und tastete das Innere ab. Aus einer Seitentasche zog er ein offenes Briefkuvert hervor.
Lilienthal hatte währenddessen die Fotografie aufgehoben und betrachtete sie: Madonnengesicht, höchstens fünfundzwanzig Jahre alt, schätzte er, dunkle, ernste Augen, nachtschwarzes Haar, das bis auf die Schultern fiel.
»Schau mal, Maik!« Kalumet wedelte mit mehreren Papierbögen. »Das sind Kopien eines Briefes an den rbb, das Ministerium für Landwirtschaft und an mehrere Tageszeitungen. Alle beziehen sich auf die katastrophale Tierhaltung in den Betrieben eines Clemens Scherny in Potsdam-Mittelmark. Und auf exorbitante Fördergelder. Genehmigt durch das Landwirtschaftsministerium.«
»Sauber, der Hartwig«, bemerkte Lilienthal. »Der hat Nägel mit Köpfen gemacht. Wenn das veröffentlicht wird, geht das hoch wie die Bombe in der Pirschheide. Alles mitnehmen zum Auswerten.«
In der Tür tauchte Manni Langer, Leiter der Kriminaltechnik, auf. Schweißperlen bedeckten sein Gesicht unter der Kapuze des weißen Schutzanzuges. »Bei der Hitze wäre mir eine Wasserleiche eindeutig lieber, als hier in der Wohnung rumzusuchen.«
»Da musst du durch, mein Lieber.« Lilienthal blickte sich um. »Seht auch im dazugehörigen Keller und auf dem Dachboden nach.«
»Darauf wäre ich jetzt nie gekommen«, erwiderte Langer pikiert.
Heike schaute Hartwigs Videofilm an. Ihre Miene war ausdruckslos, nur die zusammengepressten Lippen verrieten ihre Anspannung.
»In nächster Zeit esse ich kein Steak mehr«, brummte Kalumet.
»Wenn man sich für seine Lebensmittel und deren Herkunft interessiert, weiß man, dass es seit Langem Organisationen gibt, die auf die katastrophalen Zustände bei der Massentierhaltung hinweisen, Leo«, entgegnete sie. Und ehe er etwas darauf erwidern konnte, fügte sie spitz hinzu: »Die Deutschen essen im Vergleich zu ihren europäischen Nachbarn das meiste Schweinefleisch. Aber dem Großteil ist es so was von egal, wie die Tiere gehalten werden. Nur der Preis zählt.«
»Aber –«, setzte Kalumet zu einer Erwiderung an.
Heike fiel ihm ins Wort: »Ein Kilo Hackfleisch für drei Euro vierzig, das ist doch nur noch pervers.« Ihre Wangen überzog eine leichte Röte. »Ohne eure Schnitzelchen«, sie betonte das Wort, »würdet ihr doch nie und nimmer überleben. Hier.« Sie zog ein Blatt aus dem Schnellhefter, den Lilienthal mitgebracht hatte, wobei ein Zeitungsausschnitt herausrutschte. »Letztes Jahr wurden acht Millionen Tonnen Fleisch erzeugt. Das bedeutet, dass pro Jahr allein in Deutschland etwa neunundfünfzig Millionen Schweine geschlachtet wurden.«
Kalumet schielte zu Lilienthal, der nur mit den Schultern zuckte.
Heike redete sich immer mehr in Rage. »In den letzten Jahren haben die Züchter die Fruchtbarkeit der Sauen gesteigert. Ihnen gleichzeitig mehr Zitzen angezüchtet. Unsere ehemaligen Hausschweine hatten ursprünglich zwölf, die Sauen aus Dänemark, die heute als die fruchtbarsten gelten, haben sechzehn. Problematisch wird es, wenn die Sauen mehr Ferkel werfen, als sie säugen können. Bis zu vierundzwanzig pro Wurf. Das heißt im Klartext, dass täglich frisch geborene Ferkel im fünfstelligen Bereich sterben.« Kampfeslustig blickte Heike ihre Kollegen an. »Und noch ein Wort zum Thema Wirtschaftlichkeit«, fuhr sie fort, »der durchschnittliche Bruttolohn der Bauern liegt bei tausendeinhundert Euro im Monat. Wir reden hier von ganz normalen Bauern. Von Familien, die in der Regel kein Wochenende kennen. Das sind die wahren Opfer der Ernährungsindustrie.« Heike holte Luft, dann fauchte sie: »Und der Politik.«
»Wie jetzt?« Kalumet legte die Stirn in Falten. »Täglich sterben mehr als zehntausend kleine Ferkel?«
Heike lachte böse auf. »Eher das Doppelte. Und ›sterben‹«, fügte sie hinzu, »ist nett ausgedrückt. Die kleinen rosigen Schweinchen werden entsorgt. Und wir Verbraucher«, ihre Worte kamen jetzt im Stakkato, »haben uns schon viel zu lange an die obszön niedrigen Preise gewöhnt. Denken nicht mehr darüber nach, dass Lebensmittel, die unter anständigen Bedingungen erzeugt werden, ihren Preis haben müssen. Die meisten von uns haben das Gespür für den Wert von Nahrungsmitteln verloren. Und die EU«, knurrte sie, »fördert die industrielle Landwirtschaft auch noch verstärkt. Auf Deutsch: Wer mehr Land hat, bekommt mehr Geld. Wachse oder weiche, das ist die neue Devise.« Hochrot im Gesicht stand sie auf. An der Tür drehte sie sich noch einmal um und blickte zu den beiden Männern, die sie sprachlos ansahen: »Und unser vielversprechendes Landwirtschaftsministerium bremst das Aktionsbündnis Agrarwende eher, als eine Umsetzung der vorgeschlagenen Kompromisse voranzutreiben.«
»Lass gut sein, Heike«, brummte Lilienthal. »Wir haben ja verstanden.«
Sie senkte den Blick, dann hob sie den Kopf, schaute ihre Kollegen ernst an und betonte jedes Wort einzeln: »Der Wert einer Kultur misst sich daran, wie sie sich gegenüber ihren Tieren verhält.« Bevor sie die Tür hinter sich zuzog, fügte sie noch hinzu: »Der Gedanke ist nicht von mir, sondern von Mahatma Gandhi.«
»Und ich war immer der Meinung, Bio sei dafür da, dass wir gesund sterben«, murmelte Kalumet mit schiefem Grinsen.
Lilienthal dachte bekümmert an seine Vorliebe für Wiener Schnitzel. Und Kalumet? Nein, den konnte er sich auch nicht als Vegetarier vorstellen. Bei dem stellte sich erst nach mindestens drei Currywürsten ein Sättigungsgefühl ein, wusste er.
Sein Kollege hob den Zeitungsausschnitt auf, der unter den Tisch gerutscht war. Zwei Männer im Golfdress. Bei dem einen, der siegesgewiss in die Kamera schaute, waren Tätowierungen auf dem Handgelenk zu erkennen. Der Mann daneben überragte ihn um Haupteslänge. Seinen Kopf bedeckte stacheliges weißblondes Haar. »Clemens Scherny und Ralf Pistorius, Sieger des diesjährigen Potsdamer Golfturniers«, informierte die Bildunterschrift. Lilienthal und Kalumet betrachteten das Foto.
Als Heike mit einem Glas Eistee zurückkam, nahm sie die Fotografie der Frau, löste das Bild aus dem Rahmen und schob es Kalumet hin.
Eine Versöhnungsgeste, registrierte Lilienthal, der schon seit Längerem bemerkte, dass die beiden Probleme hatten. Von der unbeschwerten Verliebtheit vor einigen Monaten war nicht mehr viel übrig.
»›In Liebe, deine Alina Nymczek‹, steht hinten drauf«, unterrichtete ihn Heike.
Kalumet gab den Namen im Computer ein. »Alina Nymczek, Potsdam-Babelsberg, Rudolf-Breitscheid-Straße«, las er vor. »Da fahren wir jetzt gleich mal hin.« Er wirkte erleichtert. Auch wenn Heike die Themen Massentierhaltung und Fleischkonsum nicht weiterverfolgte, schien er froh, die Flucht ergreifen zu können.
Das Haus nahe dem Bahnhof Potsdam Medienstadt machte frisch verputzt einen properen Eindruck. Im Gegensatz zu seinem Inneren. Hinter der Eingangstür Metallbriefkästen, vollgestopft mit Werbung, auf den Treppenstufen abgewetztes Linoleum. Der Geruch von gebratenen Zwiebeln durchzog das Treppenhaus. Die Wohnung lag im Hochparterre.
Lilienthal drückte auf den Klingelknopf. Nichts rührte sich. In der Tür eine altmodische metallene Briefklappe.
Kalumet ging in die Hocke, beugte sich vor und versuchte hindurchzusehen.
»Seid ihr Räuber?«, erklang es hinter ihnen. Ein kleines blondes Mädchen, nur mit einem bunten Höschen bekleidet, beobachtete sie aus der gegenüberliegenden offen stehenden Wohnungstür. Gleich darauf erschien hinter ihr eine dickliche junge Frau, blickte kurz zu den beiden Kommissaren, zog das Kind zurück in die Wohnung und schloss die Tür.
Lilienthal wandte sich um und klingelte bei der Nachbarin. Sie hörten hinter der geschlossenen Tür das Mädchen plappern, aber die junge Frau öffnete nicht.
Als Lilienthal in sein Auto steigen wollte, ertönte über ihm ein Stimmchen. Er blickte hoch.
Das Kindergesicht schob sich über das Fensterbrett. »Alina ist arbeiten!«, rief ihm das kleine Mädchen zu.
»Und wo?«
»Na, bei Opa. Der hat Schokolade. Ganz viel. Die bringt Alina immer mit, weil der Opa sonst zu dick wird«, fügte es altklug hinzu. Das Kind wurde zurückgezogen und das Fenster krachend geschlossen.
Kalumet telefonierte mit Heike, als Lilienthal sich in den Wagen setzte. »Rate mal, wo die Nymczek arbeitet?«, fragte er, als er aufgelegt hatte.
»Na, bei Opa«, erwiderte Lilienthal.
»Und der wohnt im Seniorenstift Havelaue.«
8
Am selben Tag
Enne war noch eine Weile durch die Geschäfte gebummelt und hatte eine weiße Seidenbluse mit aufgesetzten Taschen im Schlussverkauf erstanden. Auf einmal erblickte sie Enderlein. Einen Panamahut tief in die Stirn gezogen, in verwaschenen Jeans und einem dunkelblauen Leinenhemd saß er an einem Tisch vor einem Lokal. Vor sich ein großes Glas Wasser und daneben, Enne kniff die Augen zusammen, unzweifelhaft ein volles Schnapsglas. Nie zuvor hatte sie ihn bisher salopp gekleidet und noch dazu in dieser Umgebung gesehen. Irgendetwas stimmte nicht mit dem Rechtsmediziner. Entschlossen ging sie hin und setzte sich auf den freien Stuhl ihm gegenüber.
Er schaute hoch. »Aha, die Frau von Lilienthal«, nuschelte er. Blickte an sich hinunter und fügte hinzu: »Bitte, mein derangiertes Äußeres zu entschuldigen.«
Enne winkte der Bedienung und bestellte das Gleiche wie er.
»Soso«, kommentierte er ihre Bestellung. »Wer Sorgen hat, hat auch Likör, wie?« Er versuchte ein Lächeln, was danebenging. Zog eine zerdrückte Packung Gauloises Blondes aus der Hemdtasche und bot ihr eine an.
Enne nahm eine Zigarette, und Enderlein, ganz alte Schule, zückte das Feuerzeug.
»Alles eine Sache der Erziehung«, bemerkte er, steckte beides zurück, ohne sich selbst zu bedienen, hob sein Glas und prostete Enne zu.
Sie nippte nur. Bei der Hitze nicht gerade die gesündeste Flüssigkeitszufuhr.
Enderlein rülpste verhalten. Fummelte in seiner Hosentasche, zog ein blütenweißes Taschentuch hervor und wischte sich über das Gesicht. »Wie ich schon sagte, Erziehung, die einen prägt, nicht wahr, meine Gnädigste?« Er schielte zu ihr hinüber.
Sie nickte. Verstand zwar nicht, worauf er hinauswollte, aber das würde sich demnächst zeigen, mutmaßte sie.
»Natürlich habe ich recht«, murmelte er. Erhob sich, schwankte, griff nach der Tischkante und fiel zurück auf den Stuhl.
»Was halten Sie davon, wenn wir zusammen etwas essen, Herr Dr. Enderlein?«
Er musterte Enne, als hätte sie ihm ein unsittliches Angebot gemacht. »Warum?«, fragte er misstrauisch.
»Hunger?«, erwiderte Enne lakonisch.
»Mmh. Interessant.«
Sie drückte die halb gerauchte Zigarette im Aschenbecher aus.
»Spionieren Sie mir nach?« Dabei blickte er sie forschend an.
»Ich habe nur Hunger. Ganz profan«, erwiderte Enne harmlos.
Er wackelte mit dem Kopf. Erst nach einer Weile, Enne hatte entspannt den vorbeieilenden Passanten nachgeblickt, zog er einen größeren Schein hervor, klemmte ihn unter das Wasserglas, erhob sich, verbeugte sich schwankend und sagte förmlich: »Es wäre mir eine Ehre, Sie einzuladen.«
9
25. Juli
Enne stieß die Fensterläden auf. Die sengenden Sonnenstrahlen überzogen die Blätter der Bäume und Sträucher wie am gestrigen Tag. Seit Wochen hatte es nicht mehr als ein paar Tropfen geregnet. Kaum ein Lüftchen regte sich. Von unten hörte sie Geräusche. Sie schlüpfte in eine helle Leinenhose, nahm ein weißes T-Shirt aus dem Schrank, zog es über und lief ins Erdgeschoss.
Nach einem leichten Essen im »Drachenhaus«, von dem sie sich Besserung für sein Befinden versprach, waren sie gestern auf Enderleins Drängen hin weitergezogen. Das Nachtleben in Potsdam war überschaubar, nicht vergleichbar mit der Berliner Szene, trotzdem war Enderlein in der Bar »Fritz’n« schließlich wie ein Häufchen Elend zusammengesackt. Da sie weder seine Adresse kannte noch ihn allein lassen wollte, hatte sie ihn kurz entschlossen im Taxi mit zu sich genommen, ins Haus bugsiert und ihm auf der Couch ein Nachtlager bereitet, bevor sie in ihrem Schlafzimmer ins Bett gefallen war.
Enderlein telefonierte auf der Terrasse. Als er sie erblickte, beendete er das Gespräch und kam zu ihr ins Haus. »Ich hoffe, ich habe mich gestern nicht allzu peinlich aufgeführt?«
»Kaffee?«, entgegnete sie und schaltete die Maschine an. »Wir hatten einen netten Abend. Sie waren erschöpft, ich kannte Ihre Adresse nicht, darum habe ich Sie zu mir mitgenommen. Nicht mehr und nicht weniger.« Sie füllte ein Glas mit Wasser, warf zwei Alka-Seltzer hinein und reichte es ihm.
»Frau von Lilienthal«, er ließ sich auf einen Stuhl sinken und trank langsam von dem Wasser, »jede Leiche verbirgt etwas. Bei jeder bin ich auf der Suche nach besonderen Details. Auch um daraus zu lernen. Das, was ich tue, ist nicht nur mein Beruf, sondern auch Berufung. Aber«, er blickte auf den Boden, vermied es, sie anzusehen, »ich habe Fehler gemacht. Und meine Mitarbeiter wissen es. Das bedrückt mich und ist mir peinlich. Mehr kann ich im Augenblick dazu nicht sagen.« Er erhob sich, stellte das Glas auf den Tisch, verbeugte sich leicht, murmelte: »Ich danke Ihnen. Für alles«, und verließ ohne weitere Erklärung das Haus.
»Hast du schon die Zeitung gelesen?«
»Ich bin im Dienst, Mutter. Melde mich später.« Lilienthal beendete Ennes Anruf abrupt. Natürlich lagen auch vor ihm die aktuellen Tageszeitungen aus Potsdam. »Unhaltbare Zustände in Schweinemastbetrieben«, »Brandenburger Betreiber Clemens Scherny erhielt jahrelang Fördergelder im sechsstelligen Bereich«, titelten die wichtigsten Medien. »Hartwig muss die Informationen, die wir gefunden haben, noch kurz vor seinem Tod verschickt haben«, kommentierte er.
Heike tippte auf einen Absatz. »Es kommt noch besser, Maik. Hier: Jörg Wieland, der agrarpolitische Sprecher, ist in Personalunion Vorsitzender des mächtigen Bauernverbandes und befürchtet natürlich gleich den Verlust von Arbeitsplätzen. Die Keule wird immer aus dem Sack geholt, wenn es ernst wird. Dabei wird in diesen Artikeln auf eines der Hauptprobleme überhaupt nicht eingegangen.«
Kalumet hätte sich am liebsten Ohropax in die Ohren gesteckt, so elend fühlte er sich, wenn Heike über die Problematik der Massentierhaltung redete.
»Gülle!« Heike stieß das Wort wie eine Fanfare aus. »Die Megaställe produzieren mehr Fäkalien, als das Land darum herum aufnehmen kann. Sie verseuchen den ganzen Boden. Da wächst nichts mehr.« Empört ließ sie sich in ihren Stuhl zurücksinken. »Und hier«, sie tippte auf die Zeitung vor sich, »steht, dass die Fördergelder jahrelang immer durch ein und denselben Staatssekretär im Landwirtschaftsministerium genehmigt wurden.«
»Überprüfe bitte, wer das ist, Heike. Hier geht es um viel Geld. Leo und ich fahren noch mal zum Seniorenstift Havelaue. Alina Nymczek arbeitet dort. Ich bin sicher, Hartwigs Freundin wird so einiges wissen.«
Der Schweiß rann ihnen von der Stirn, als sie auf den Eingang des Seniorenheims zugingen. Lilienthals alter Jaguar verfügte über keine Klimaanlage. Die großflächigen Fensterfronten der Eingangshalle schirmten dunkelgrüne Markisen vor dem Sonnenlicht ab.
Nach einigen Minuten Wartezeit am Empfang erschien die Leiterin des Heimes. Lilienthal vermied es, ihr die Hand zu geben. Bei seinem ersten Besuch wegen des Todes des Rentners Preuss hatte sie ihm wie mit einer Schraubenpresse die Finger gequetscht. Weiblicher Sumoringer, Kalumets Kommentar.
Nein, Alina Nymczek sei nicht im Haus, beantwortete die Leiterin ihre Frage. Sie habe kurzfristig um zwei Tage Urlaub gebeten. Aus familiären Gründen. Wolle nach Polen fahren. Da habe sie nicht Nein sagen können, obwohl sie zurzeit mit einem Personalengpass klarkommen müsse. Krankmeldungen der extremen Hitze wegen, die macht nicht nur unseren Bewohnern zu schaffen. Worum es denn gehe? Frau Sumoringer musterte Lilienthal aus flinken, kleinen Mausaugen.
Lilienthal gab ihr seine Karte und bat, Frau Nymczek auszurichten, sie möge sich umgehend bei ihm melden, wenn sie zurückkäme.
Als sie wieder draußen standen, schaute Kalumet sehnsüchtig auf das glitzernde Wasser der Havel, die an dem parkähnlichen Gelände des Seniorenstiftes vorbeizog. »Vielleicht macht die Nymczek einfach nur blau«, mutmaßte er. »Bei der Hitze könnte ich es ihr nicht mal verdenken.«
»Deine Arbeitsauffassung lässt zu wünschen übrig, Leochen«, ermahnte ihn Lilienthal. Aber anstatt zum Parkplatz zu gehen, spurtete er an Kalumet vorbei direkt hinunter zum Havelufer, entledigte sich noch während des Laufens seiner Mokassins, zog das Hemd über den Kopf, warf es zusammen mit seinen Jeans auf eine Bank und sprang nur mit Boxershorts bekleidet ins Wasser.
Kalumet folgte ihm Sekundenbruchteile später. Prustend tauchten sie unter und kraulten dann weit in die Bucht hinaus. Lilienthal fühlte sich wie beim Schuleschwänzen.
»Survival training on the job«, keuchte er, als sie tropfnass das Ufer erklommen und zurück zu ihren Kleidungsstücken liefen.
Eine betagte Dame im luftigen Kittel, den Rollator wie einen Sportwagen dirigierend, kam auf sie zu. Aus der Tasche zog sie ein Papiertaschentuch und reichte es Lilienthal. »Hier, mein Kind, immer schön abtrocknen, sonst schimpft die Mutti.«
Kaum waren sie angekleidet, rief Heike an. Gegen Hartwig liege eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch und Beleidigung in Tateinheit mit Körperverletzung vor. Der Kläger sei Clemens Scherny.
»Der Schweinebaron?«
»Genau der und der Herr wohnt am Schwielowsee.«
»Dem werden wir gleich mal auf den Zahn fühlen. Nach dem heutigen Artikel in den Medien ist der bestimmt nicht amused.«
»Geil«, kommentierte Kalumet, als sie vor Schernys Haus standen.
»Protz in Reinkultur«, korrigierte ihn Lilienthal. Nachempfundene korinthische Säulen, üppig verziert mit künstlichem Blattwerk, an den Hausseiten ausladende Erker mit bodentiefen Sprossenfenstern. Die Fassade strahlte schweinchenrosa und wurde durch das mit glasierten schwarzen Ziegeln gedeckte Dach noch betont, das in der Sonne wie flüssiger Teer glänzte. Ein hoher Zaun mit vergoldeten Metallspitzen ergänzte das wie aus Disneyland importierte Anwesen. Kaum hatte Lilienthal geklingelt, erschienen wie aus dem Nichts mehrere kälbergroße Hunde und fixierten lautlos die Besucher.
»Kampfmaschinen«, stellte Kalumet fest.
Lilienthal hielt seinen Polizeiausweis gegen das Kameraauge, das in einer der Eingangssäulen eingelassen war.
Wenig später kam ein blonder Klitschko aus dem Haus. Die auffallende Tätowierung einer Raubkatze bedeckte seinen muskulösen Arm bis zum Handgelenk. Er schnippte mit dem Finger, und die Hunde verschwanden so still, wie sie gekommen waren.
Lilienthal stellte Kalumet und sich vor. Es gehe nur um einige Informationen wegen seiner Anzeige gegen Jens Hartwig. Klitschko alias Scherny öffnete das Tor und ließ sie hinein. Sie umrundeten das Gebäude, bis sie zu einem überdimensionierten himmelblau gefliesten Swimmingpool vor einer mit weißem Marmor bedeckten Terrasse kamen. Scherny, immer noch schweigsam, ließ sich in eine ausladende Rattancouch mit hellen Leinenpolstern sinken und bot lässig den beiden Kommissaren Platz auf zwei kleinen Hockern gegenüber an. Er griff nach einem mit Orangenscheiben und einer rötlichen Flüssigkeit gefüllten Glas, das vor ihm auf einem Bambustisch stand, und trank, ohne den beiden Kommissaren etwas anzubieten.