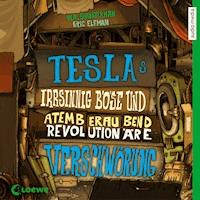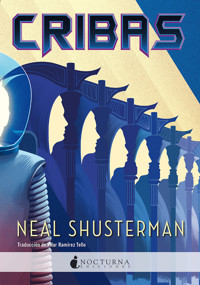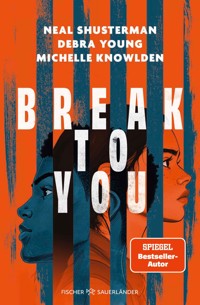
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Neal Shusterman, der Bestsellerautor von "Scythe" und "Dry" erzählt zusammen mit den Co-Autorinnen Debra Young und Michelle Knowlden eine intensive und zugleich zärtliche Geschichte von zwei Jugendlichen, die in einem ungerechten System gefangen sind. Aber Adriana und Jon sind bereit, für ihre Liebe alles zu riskieren. Hinter der blauen Tür, die in die Jugendstrafanstalt führt, ertönt ein Summer – laut wie ein Maschinengewehr. In wenigen Augenblicken wird diese Tür hinter Adriana zufallen, und für die nächsten sieben Monate ist dieser kalte Ort ihre ganze Welt. Das einzige, was sie mitnehmen kann, ist ihr Tagebuch, und es ist alles, was Adriana braucht: ein Zuhause für ihre geheimsten, chaotischen, wütenden, traurigen Gedanken. Bis sie das Tagebuch aufschlägt und feststellt, dass ihre Gedanken nicht mehr geheim sind. Jemand hat ihre Einträge gelesen. Und ihr geantwortet ... Dieser hoch spannende Roman zeigt, wie sich das Leben in der Haft für Jugendliche anfühlt – und er erzählt eine ergreifende Liebesgeschichte unter den unmöglichsten Umständen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 486
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Neal Shusterman | Michelle Knowlden | Debra Young
Break to You
Über dieses Buch
Hinter der blauen Tür, die in die Jugendstrafanstalt führt, ertönt ein Summer – laut wie ein Maschinengewehr. In wenigen Augenblicken wird diese Tür hinter Adriana zufallen, und für die nächsten sieben Monate ist dieser kalte Ort ihre ganze Welt. Das einzige, was sie mitnehmen kann, ist ihr Tagebuch, und es ist alles, was Adriana braucht: ein Zuhause für ihre geheimsten, chaotischen, wütenden, traurigen Gedanken. Bis sie das Tagebuch aufschlägt und feststellt, dass ihre Gedanken nicht mehr geheim sind. Jemand hat ihre Einträge gelesen. Und ihr geantwortet ...
Eine Liebesgeschichte unter den unmöglichsten Umständen
Weitere Informationen finden Sie unter www.fischer-sauerlaender.de
Biografie
Neal Shusterman ist der New York Times-Bestseller und preisgekrönte Autor von mehr als fünfzig international erfolgreichen Büchern. Für sein Gesamtwerk wurde er mit dem renommierten Margaret A. Edwards Award ausgezeichnet. Online ist er zu finden unter storyman.com.
Debra Youngschrieb Fantasy, Science-Fiction und Horrorgeschichten. Sie veröffentlichte Stories in verschiedenen Zeitschriften und war die Autorin der Anthologie »Grave Shadows«. Leider verstarb sie im Jahr 2024 an den Folgen einer Lupuserkrankung.
Michelle Knowlden, die früher Space-Shuttle-Ingenieurin und Extremwanderin war, schreibt inzwischen hauptberuflich. Den Rest ihrer Zeit verbringt sie zwischen Flussschiffen und dem Hochland von Arizona mit ihrer Familie, Freunden und einem isländischen Schwamm namens Marino.
Inhalt
[Widmung]
Teil Eins
1 Zugangsgespräch
2 Mehr Türen als Wände
3 »Sag mir, warum du hier bist.«
4 Plattitüden und Attitüden
5 Worte, unerlaubt abwesend
6 Yoon und Zindel
7 Also, wer ist jetzt berechnend?
8 Geheimer Kritiker
Teil Zwei
9 Ein bisschen Armageddon zum Mittagessen
10 Das Teleportationsteam
11 Kein Ort zum verstecken
12 Haie auf der suche nach kleinen Fischen
13 Das Erdmännchen
14 Lieber der Feind
Teil Drei
15 Wie kann die Zeit es wagen, so langsam zu vergehen?
16 Schatten für uns
17 Ist, nicht war
18 Antastbar
19 Über Zugunglücke
20 Eher wie eine Manguste
21 Eine kurze Geschichte des Jon
22 Camera Obscura
Teil Vier
23 Ausrichtung
24 Ausbruch zu uns
25 Nicht mehr unmöglich
26 Wie Monster gemacht werden
27 Beachtenswert
28 Etwas über einen Jungen
29 Der Strauss und der Beagle
30 Tief Luft holen
Teil Fünf
31 Die unwiderstehliche Kraft der Gravitation
32 Wo du aufhörst, wo ich anfange
33 Ein letzter Kuss ...
34 Jenseits aller Worte
35 Kants Gerechtigkeit
36 Der Raum dazwischen
37 Entlassung
Anmerkung der Autor*innen
Danksagung
Für Julie Miller, Marianne Crandall Wilson, Deb Svec, Helen Zientek und alle Bibliothekar*innen und Medienspezialist:innen in Vergangenheit und Gegenwart, die weiterhin gegen diejenigen kämpfen, die glauben, dass das Verbot von Büchern eine Lösung für irgendjemanden oder irgendetwas ist.
N.S.
Für meine Familie mit Dankbarkeit
D.Y.
Für meine unglaubliche Familie
mit Liebe
M.K.
Teil Eins
Adriana
1Zugangsgespräch
Die Angestellte stülpt den Briefumschlag um, und der spuckt auf den Tresen, was von Adrianas Leben noch übrig ist. Die Frau geht alles achtlos durch, als würde sie mit einem Sieb Gold waschen. Gold, das sie offensichtlich nie gefunden hat.
Eine Fremde fasst meine Sachen an, denkt Adriana. Sie will die Hände der Frau beiseiteschlagen, unterdrückt den Impuls jedoch. Das fällt Adriana nicht leicht.
»Haben Sie die Liste von Dingen angesehen, die man in die Strafanstalt mitbringen beziehungsweise nicht mitbringen darf?«
Auf dem Namensschild der Frau steht Paula Laplante. Sie sieht gleichzeitig aus wie unter dreißig und über fünfzig. Als hätte ihre Tätigkeit in der Aufnahme einer Jugendstrafanstalt, dem so genannten Zugangsverfahren, ihre Seele durch ein Wurmloch im Raum-Zeit-Kontinuum getrieben. Wenn sie spricht, wendet sie sich an Adrianas Stiefmutter Lana, Blickkontakt mit Adriana hat sie bisher noch nicht gesucht.
Lana beugt sich nach unten, um durch den Schlitz in dem kugelsicheren Glas zu sprechen, eine Trennscheibe wie in Banken. Adriana fragt sich, ob es unter dem Tresen auch einen kleinen Knopf gibt, um ein SWAT-Team zu rufen, falls auf ihrer Seite der Scheibe etwas außer Kontrolle gerät.
»Ja«, sagt Lana, »haben wir.« Sie hält den Mund so dicht an den kleinen Sprechschlitz, dass es aussieht, als würde sie ihn küssen.
Paula Laplante blickt Lana skeptisch an, schiebt dann ein paar Fotos und ein Fläschchen mit Tabletten zur Seite und fördert ein kleines Notizbuch mit weichem Ledereinband zutage. Sie nimmt es zur Hand, schlägt es jedoch nicht auf, doch für Adriana fühlt es sich trotzdem übergriffig an. Sie möchte Lana wegschubsen, durch den Schlitz in der Scheibe greifen und Paula Laplante die Finger brechen.
Tu so, als ob es dir nichts ausmacht. Sie können dir nicht weh tun, wenn sie glauben, es wär dir egal.
Aber die Frau hat Adrianas stille Empörung offenbar gespürt, denn sie wendet sich ihr schließlich zum ersten Mal zu und mustert sie. Dann schiebt sie das Notizbuch und das Fläschchen mit den Tabletten zurück durch den kleinen Fensterschlitz.
»Das nicht«, sagt sie abweisend. »Die Fotos sind okay, aber alle in Ihrer Akte aufgeführten Medikamente werden in der Einrichtung verschrieben. Und private Tagebücher sind nicht erlaubt.«
Adriana greift nach dem Notizbuch, doch Lana legt ihre Hand auf Adrianas – als wäre es das Eingeständnis einer Niederlage, das Notizbuch zurückzunehmen. Lana nimmt die Tabletten, doch das Notizbuch bleibt, wo es ist. Es steckt in dem Schlitz zwischen zwei unvereinbaren Welten fest.
Adrianas Dad sollte hier sein, um zu helfen, doch er musste zu Hause bei ihrem Halbbruder bleiben, der erst zwei ist. Natürlich hätten sie jemanden finden können, der auf ihn aufpasst, aber nach dem Prozess war ziemlich klar, dass ihr Vater die Nase voll hatte von gerichtlichen Verfügungen, von zu unterzeichnenden Formularen und von ihr.
»Gibt es ein Problem?«, fragt Paula, der Zugangsverfahrenstroll. »Die Bestimmungen über persönliche Gegenstände sind vollkommen klar.«
»Das Notizbuch ist von ihrem Arzt«, platzt Lana heraus. »Von ihrem Therapeuten. Sie soll alles aufschreiben, was sie denkt.«
Lana könnte das vielleicht. Ihre Gedanken beschränken sich auf ihr Kleinkind, ihre Social Media-Kanäle und ihren Job – zu dem sie zu spät zu kommen droht, wenn man danach geht, wie oft sie in den letzten fünf Minuten auf ihre Uhr geblickt hat. Adrianas Gedanken könnten dagegen Telefonbücher füllen. Das heißt, wenn sie sie aus ihrem Kopf herausbekommen würde. Meistens starrt sie nur auf die leere Seite und bringt, wenn sie Glück hat, einen Absatz zu Papier. Aber dieser Absatz fühlt sich verdammt gut an.
Lana wendet sich ab und blickt zur Tür, als hoffe sie, Adrianas Vater würde auftauchen und sich um alle lästigen Fragen kümmern.
Es ist seltsam, aber in diesem Moment kann Adriana sich nicht genau daran erinnern, wie ihr Vater aussieht. Auch Lanas Gesicht verschwimmt in dem diffusen Licht wie in einer filmischen Traumsequenz. Warum löst ihre Familie sich auf, während die Strafanstalt und ihr seelenloser kleiner Troll so deutlich hervortreten, dass Adriana die Risse in den Wänden und die Spinatreste zwischen Paula Laplantes Zähnen ausmachen kann?
»Tut mir leid, es ist nicht zulässig«, sagt Paula. »Können Sie sich vorstellen, was los wäre, wenn wir für einige Insassen Ausnahmen machen und für andere nicht?«
Adriana beißt sich von innen auf die Wange, bis sie Blut schmeckt. Sie muss dieses Notizbuch haben, doch sie wird nicht betteln. Sie wird nichts sagen. Keine. Einzige. Silbe.
Das Notizbuch steckt nach wie vor in dem Schlitz zwischen dieser Welt und der anderen. Es ist zum entscheidenden Punkt in einem Chicken Game geworden. Wer blinzelt zuerst? Wer wird das Notizbuch wessen Welt zuweisen?
Wie sich herausstellt, ist Paula Laplante die Sache nicht wichtig genug, um darauf zu beharren. Sie nimmt das Notizbuch, um den Schlitz für einen Packen Formulare freizumachen, legt es jedoch nicht zu Adrianas übrigen Habseligkeiten, sondern auf die andere Seite des Tisches, als wäre es ein trotziges Kind, das eine Auszeit nehmen muss.
Lana tätschelt Adrianas Hand, als wollte sie sagen, dass es schon okay werden wird.
Adriana zieht ihre Hand nicht jedes Mal weg, wenn Lana versucht, sie zu trösten, aber sie reagiert auch nicht darauf. Lanas diverse Bemühungen, Zuneigung zu zeigen, sind immer wie über den Boden huschende Kakerlaken. Klein, lästig und offenkundig panisch bemüht zu entkommen.
Hinter der blauen Tür, die in die Strafanstalt führt, ertönt ein Summen. Laut wie Maschinengewehrfeuer und gefolgt von einem Getöse zuschlagender Türen und trampelnder Schritte. Klingt nach normaler Schule. Aber nichts daran fühlt sich normal an.
Lana muss ein Dutzend Seiten unterzeichnen, Verzichtserklärungen, Haftungsausschlüsse. Die Art Papierkram, wie man ihn bei Ärzten unterschreiben muss, damit man niemanden verklagen kann, wenn sie einen umbringen, ihre Autoschlüssel im Darm vergessen oder was auch immer.
»Deinen Vater zu heiraten ging schneller«, scherzt Lana, doch weder Adriana noch der Zugangsverfahrenstroll lachen.
Genau genommen findet Adriana es beleidigend.
»Darf sie diese Sachen für mich unterschreiben?«, fragt sie. »Ich meine, sie ist nicht meine richtige Mutter.«
Lana atmet tief ein und wieder aus. Sie sagt nichts.
»Erziehungsberechtigt reicht«, sagt Paula.
Adriana will ihr erklären, dass das für sie längst nicht ausreicht, aber welchen Sinn hätte das?
Lana unterschreibt sämtliche Formulare, ohne das Kleingedruckte zu lesen – und es ist alles kleingedruckt –, und schiebt sie zurück durch den Schlitz.
Paula geht die Seiten durch, als wollte sie überprüfen, dass Lana auch korrekt mit dem eigenen Namen unterzeichnet hat. »Die gerichtliche Anordnung besagt, dass Sie sieben Monate bei uns bleiben werden«, sagt Paula zu Adriana und knibbelt an ihren Zähnen, ohne die Spinatreste zu erwischen. »Das ist Ihnen klar, oder?«
Jetzt begreift Adriana den wahren Grund für die gläserne Trennwand. Es geht nicht um Kugeln – ohne die Scheibe würde Paula Laplante von jedem, der ihr begegnet, bis zur Besinnungslosigkeit geohrfeigt werden. Sieben Monate. Der Rest ihres vorletzten und der Beginn ihres letzten Schuljahres.
»Ja, ich weiß.«
Hat Adriana vielleicht deshalb Mühe, sich an ihren Vater zu erinnern oder ihre Stiefmutter zu erkennen, weil sie in gewisser Weise auch durch eine Scheibe blickt? Eine Scheibe, die sie von ihrem alten Leben trennt. Laut Gerichtsbeschluss wird sie in einer Welt verschlossener Türen leben, wo kleine Erbsenzähler entscheiden, ob man ein blödes Notizbuch haben darf oder nicht. Wo sieben Monate kein Zeitmaß sind, sondern bloß eine Liste von Dingen, die einem nicht mehr gehören.
Von diesem Augenblick an wird sie ihre Familie nur sehen, wie sie es vielleicht als Teilnehmerin eines wissenschaftlichen Experiments tun würde: in präzise bemessenen Zeitfragmenten, streng überwacht, in Räumen mit niedrigem Sauerstoffgehalt und hohem Schweißanteil. Das heißt, wenn ihre Familie sich überhaupt die Mühe macht zu kommen.
Paula Laplante betrachtet ein weiteres Mal das Notizbuch und kräuselt die Nase wie ein Schakal, der totes Fleisch wittert. »Ich gebe das Tagebuch an den Anstaltspsychologen weiter«, sagt sie. »Er wird entscheiden, was damit geschehen soll.«
Notizbuch, nicht Tagebuch, will Adriana schreien. Ein Tagebuch ist ein rosafarbenes Ding, das Prinzessinnen und verwöhnte Mädchen aus den Vorstädten mit Listen ihrer Weihnachtswünsche füllen. Dieses kleine Buch ist dagegen in braunes schmuckloses Leder gebunden.
»Ja, sicher, was auch immer«, murmelt Adriana.
»Danke«, sagt Lana, als würde sie für Adriana übersetzen, doch als Paula, der Zugangsverfahrenstroll, sich dem Telefon zuwendet, zeigt Lana ihr hinter dem Rücken einen Stinkefinger. Adriana verweigert einen Kommentar, doch ihre Lippe zuckt für eine Nanosekunde nach oben, bevor sie von der Schwerkraft wieder heruntergezogen wird.
»Adriana Zarahn ist bereit für das weitere Zugangsverfahren«, verkündet Paula in den Telefonhörer.
Fertig zur Weiterbearbeitung, denkt Adriana. Wie amerikanischer Käse oder Dosenfleisch. Das war’s. Sie ist kein richtiger Mensch mehr.
Kurz darauf taucht eine kantige Schwarze Frau an dem schmalen Fenster der Tür zu der Strafanstalt auf. Nein, keine Tür – eine Luftschleuse. Zwei Türen an beiden Enden eines kurzen Korridors, der dafür sorgt, dass die eine Welt die andere nicht infiziert.
Paula Laplante drückt mit einem Summen die Tür auf, und die andere Frau betritt den Zugangsbereich. Sie entdeckt Adriana sofort und lächelt sie routiniert an. Es ist das erste Lächeln, das Adriana heute sieht, und ungefähr so falsch wie Lanas Nägel.
Die Frau trägt ein blaues Polohemd und eine braune Hose – eine Uniform, die sich anstrengt, nicht auszusehen wie eine Uniform – und ist mindestens fünfzehn Zentimeter größer als Adriana.
Paula gibt ihr ein einzelnes Blatt und den Umschlag mit Adrianas Sachen.
Die Frau wirft nur einen kurzen Blick auf das Formular.
»Adriana, ich bin Jameara Abeku, die Sozialarbeiterin für deinen Trakt.« Ohne eine Antwort abzuwarten, wendet sie sich an Lana. »Sind Sie eine Verwandte? Sie sind eingeladen, uns zu begleiten, wenn ich Adriana alles zeige. Falls Sie Zeit haben.«
»Hat sie nicht«, sagt Adriana, bevor Lana sich selbst entschuldigen kann. »Sie kommt zu spät zur Arbeit.«
Jameara verstummt und zieht bloß eine Braue hoch.
Lana stößt ein freudloses Lachen aus. »Sie hat recht.« Dann umarmt sie Adriana, die sorgfältig darauf achtet, die Umarmung nicht zu erwidern. »Wir sehen dich ganz bald, ja?«, erklärt sie für Adrianas abwesenden Vater mit. Dann löst sie sich aus der Umarmung, trippelt eilig Richtung Parkplatz und lässt nur den Blumenduft ihres Parfüms an Adrianas Top zurück.
»Wollen wir?«, fragt Jameara, als hätte Adriana eine Wahl. Sie achtet darauf, dass Adriana vorgeht, als sie die Luftschleuse betreten, den Übergang zwischen dem, was war, und dem, was ist.
2Mehr Türen als Wände
»Zieh alles aus, steck deine Sachen in die Tüte, streif den Kittel über und setz dich«, sagt Jameara. »Schwester Thomas wird gleich hier sein, um dich zu untersuchen. Ich komme wieder, wenn du fertig bist.«
Jameara verlässt den Raum und schließt die Tür hinter sich. Adriana entkleidet sich, zieht den Kittel an und setzt sich auf den harten Stuhl. Das ist ihr neues Leben. Sie kann sich ebenso gut daran gewöhnen, herumkommandiert und wie ein Gegenstand behandelt zu werden. Schwester Thomas – heißt das, die Person, die sie untersuchen soll, ist ein Typ? Auf keinen Fall wird sie sich von einem Pfleger anfassen lassen. Aber das hat nicht sie zu entscheiden, oder?
Ihr ganzer Körper spannt sich an, als sie Schritte vor der Tür hört.
Ganz ruhig. Bleib cool. Nicht schreien. Wenn er reinkommt, wird sie nach einer Frau fragen. Sie werden eine finden müssen, oder nicht? Sie atmet die kühle antiseptische Luft tief ein und verschränkt die Finger.
Nach einem flüchtigen Klopfen betritt eine Frau den Raum. Adriana versucht, sich nicht anmerken zu lassen, wie erleichtert sie ist. Thomas ist offenbar der Nachname der Krankenschwester. Sie trägt einen grünen Krankenhauskittel und hat ihr Haar im Nacken zu einem festen Dutt gebunden. Sie wirft Adriana einen nüchternen Blick zu.
»Hallo, Adriana. Ich werde Sie jetzt untersuchen, und dann sind Sie startklar.«
»Starten werde ich fürs Erste wohl nirgendwohin«, wendet Adriana ein.
»Da haben Sie auch recht.« Während sie spricht, streift die Frau vanillefarbene Gummihandschuhe über. »Als Erstes werde ich Ihren Kopf auf Läuse untersuchen.«
Läuse, denkt Adriana. Läuse!
Die Frau hat Adrianas Empörung offenbar bemerkt, denn sie sagt: »Einhaltung der vorgeschriebenen Gesundheitsbestimmungen. Es spielt keine Rolle, wie blitzsauber Sie sind, wir müssen es kontrollieren.«
Adriana nimmt Platz wie eine steinerne Statue und spürt, wie Schwester Thomas mit behandschuhten Fingern systematisch ihre Haare scheitelt und buchstäblich gründlich durchkämmt. So muss die Zweitbedeutung entstanden sein. Etwas durchkämmen.
Nachdem Schwester Thomas sich vergewissert hat, dass Adriana läusefrei ist, legt sie den Kamm beiseite und macht einen Schritt zurück. »Okay, jetzt bitte aufstehen und Arme und Hände ausstrecken, Handflächen nach oben.«
Schwester Thomas begutachtet die Innenseite von Adrianas Armen und ihre Handgelenke.
Adriana weiß, wonach sie sucht. Einstichmale. »Ich nehm keine Drogen«, sagt sie.
»Wir müssen es überprüfen«, sagt Schwester Thomas. »Gesundheitsbestimmungen.«
Als Nächstes kontrolliert sie Zehnägel und Zwischenräume auf Fußpilz und Zehenkäse oder was zum Teufel sonst einen Verstoß gegen die Gesundheitsbestimmungen darstellen könnte. Schließlich streift sie die Handschuhe schnappend ab und wirft sie zusammen mit dem Rest von Adrianas Würde in einen Mülleimer.
»Rechts sind die Duschen. Seife, Handtücher und eine Plastiktüte mit Ihrer Anstaltskleidung liegen bereit. Ich sage Jameara, dass Sie fast fertig sind.«
Nach einer Dusche, deren Wasser nur andeutungsweise warm geworden ist, zieht Adriana ihre Anstaltskleidung an: ein neongelbes Sweatshirt, so knallig, dass es vermutlich noch aus dem Weltall sichtbar ist, eine kotz-olivgrüne Hose mit Gummizug und Nullachtfünfzehn-Sneakers.
Wie versprochen wartet Jameara schon auf sie. »Das war doch nicht so schwer, oder?« Sie führt sie aus der Krankenstation und öffnet weitere Türen, indem sie ihre Dienstmarke unter die Lesegeräte daneben hält.
Sie biegen in einen weiteren Flur und kommen an dem großen Wandgemälde eines einzelnen Gänseblümchens vorbei. Keine volle Blüte, sondern nur deren gelber Umriss auf der eisweißen Wand, eine Schlangenlinie wie von Jack Frost gemalt – und der Stängel ist auch nicht direkt grün, sondern braun und mit grünen Streifen beschmiert, als würde die Pflanze an einer bedauerlichen Gänseblümchenkrankheit leiden. Nun, sie haben sich Mühe gegeben, denkt Adriana. Aber ehrlich gesagt nicht genug.
Jameara bleibt vor einer weiteren Tür stehen und zieht ihre Karte durch das Lesegerät. Dieser Ort ist wie ein Labyrinth aus Käfigen, die durch verschlossene Türen miteinander verbunden sind, und überall gibt es Kameras. Ein kalter Lufthauch lässt Adriana zittern.
Wird es hier jemals warm?
Sie betreten einen Tunnel, der von einer Reihe runder, in die Decke eingelassener Lampen erhellt wird. Sie beleuchten ein Wandgemälde in knalligen Farben, das sich über die gesamte Länge des Tunnels erstreckt. Immerhin besser als das trostlose Gänseblümchen.
»Ich weiß, dass es sich vielleicht nicht so anfühlt, aber du hattest Glück, dass man dich nach Compass geschickt hat«, sagt Jameara. »Unsere Einrichtung unterscheidet sich ein wenig von anderen. Wir verfolgen einen neuen Ansatz des Jugendstrafvollzugs.«
In Compass, fährt sie fort zu erklären, gibt es mehr Eigenverantwortung und weniger strenge Regeln als in anderen Einrichtungen, obwohl Adriana das Ganze auch so schon ziemlich streng vorkommt. Sie will sich nicht vorstellen, dass es noch schlimmer sein könnte.
»Normalerweise werden Jugendliche, die noch nicht von einem Gericht verurteilt wurden, separat von bereits verurteilten Jugendlichen untergebracht, aber wir haben eine Sondererlaubnis, die beiden Gruppen zu mischen.«
»Und inwiefern ist das … gut?«, fragt Adriana.
»Es macht den verurteilten Jugendlichen Hoffnung und nimmt den Jugendlichen, die noch auf ihren Prozess warten, die Angst, weil sie wissen, selbst bei einer Verurteilung kehren sie zurück unter vertraute Gesichter.«
Adriana wurde nicht direkt »verurteilt«, aber sie hat vor einem Richter gestanden. Am Ende war das Ganze vor allem eine Sache von Anwälten, die Deals ausgehandelt haben. Immerhin durfte sie sich heute Morgen selbst hier melden, anstatt in Ketten vorgeführt zu werden. Macht man das noch? Sie hat keine Ahnung. Jedenfalls gefällt ihr die Idee, dass man hier auf diese Unterscheidung verzichtet und der Daumen in dieser neuen Umgebung noch nicht für alle Mädchen nach unten gezeigt hat.
Eine weitere Tür, die sich nach dem Durchziehen der Karte öffnet, dahinter ein kurzer Flur, der vor der bisher massivsten Tür endet.
»Wir sind jetzt im Mädchentrakt«, sagt Jameara und schwingt flink ihre Karte. Das kleine rote Lämpchen auf dem Lesegerät springt auf Grün.
Mädchenstimmen und der laute Ton eines Fernsehers schlagen ihnen entgegen, als sie einen großen offenen dreistöckigen Bereich betreten. Stahltreppen führen zu den anderen Stockwerken, und auf allen Etagen und in jeder Wand gibt es Türen. Adriana hält sich in Jamearas Windschatten. Lauter Fremde auf einen Haufen zu treffen, ist das Letzte, was sie will.
»Das ist der Gemeinschaftsbereich. Hier kannst du deine Freizeit verbringen – Fernsehen gucken, außerdem gibt es Materialien für kreatives Gestalten. Deine Wohngruppe verfügt über einen weiteren Aufenthaltsraum, aber der ist nur für die Mädchen aus deiner Gruppe.«
Meine Gruppe? Sind wir hier im Kindergarten oder bei den Pfadfindern?
Jameara wirft ihr ein weiteres routiniertes Lächeln zu, als wären ein Fernseher und Buntstifte die Lösung für alles.
Ich brauche bloß mein Notizbuch, vielen Dank auch. Ich bin schon durch mit dieser Tour. Kann ich jetzt auf mein Zimmer gehen?
Im Gemeinschaftsbereich stehen beigefarbene Sessel und Sofas. Wenn man bei Google »Möbel« eingibt, würde einem wahrscheinlich so etwas angezeigt. In einer Wand gibt es eine schmale, etwa zehn Zentimeter breite senkrechte Scheibe, durch die ein wenig Tageslicht hereinfällt, das mit der Neonbeleuchtung konkurriert.
»Mädchen«, ruft Jameara mit einer Stimme, die Aufmerksamkeit verlangt.
Etliche Augenpaare richten sich auf Adriana, Schweigen senkt sich über den Raum, nur eine Disneyfigur im Fernsehen plappert weiter.
Adriana hat den Eindruck, dass das TV-Programm hier streng kuratiert wird.
»Begrüßt Adriana«, sagt Jameara. »Sie ist gerade bei uns angekommen.«
Ein paar unverbindliche Hallos und Heys wehen von der Gruppe herüber. Alle tragen die gleiche olivgrüne Hose und das gleiche gelbe Sweatshirt. Adriana lässt den Blick über die Gruppe schweifen, verschwommene Gesichter in verschiedenen Schattierungen, und wünschte, sie wäre irgendwo anders, bloß nicht hier. Sie hasst es, Menschen kennenzulernen. Das endet immer in einer Enttäuschung. Ihr Magen zieht sich zusammen, und sie wird von einer inneren Anspannung gepackt, doch sie hebt die Hand zu einer »Was geht«-Geste, sorgfältig darauf bedacht, ihr Lächeln für sich zu behalten. Sie ist nicht der bedürftige Typ, und sie will, dass die anderen das wissen.
Ihr Blick bleibt an einem Mädchen hängen, das so schmächtig ist, dass es fast unterernährt und vielleicht ein wenig buckelig aussieht. Sie sitzt auf einem der Sofas, ihre baumelnden Füße erreichen nicht ganz den Boden, und ihr Gesicht scheint so unschuldig und deplatziert in dieser Umgebung wie das traurige Gänseblümchen an der Wand der Krankenstation. Verglichen mit den anderen Mädchen wirkt sie beinahe gespensterhaft. Ihre Abstammung ist ein Mysterium. Jede Ethnie oder auch eine Mischung verschiedener Ethnien scheint möglich. Aber das Gleiche gilt auch für Adriana. Und für die Hälfte aller Mädchen hier. Das Geistermädchen lächelt Adriana freundlich an, und Adriana fragt sich, was um alles auf der Welt es getan haben könnte, dass es hier eingesperrt ist.
Sie ertappt sich beim Starren, wendet sich ab und blickt unwillkürlich in ein Paar dunkler Augen in einem braunen Gesicht, das den Hauptpreis in der Gen-Lotterie gewonnen hat. Die Augen wachen über hohen Wangenknochen und perfekt proportionierten Lippen, die zur Andeutung eines Lächelns verzogen sind. Das Mädchen hockt auf einem hässlichen Sessel wie auf einem Thron, die Beine auf grazil weibliche Art zur Seite gelegt, so wie Ladys in alten Filmen, eine elegante Schönheit, der die Mädchen um sie herum ihre Aufwartung machen.
Die Ballprinzessin mit ihrem Hofstaat, denkt Adriana, als sie die anderen Mädchen betrachtet, die sich um den Sessel geschart haben. Deren Blicke sind weder neugierig noch einladend, nur die Ballprinzessin mustert sie mit einem Hauch von Interesse, während sie mit schlanken Fingern über ihren geflochtenen Zopf aus glänzendem schwarzem Haar streicht.
Jameara weist zur Tür. »Ich zeige dir jetzt dein Zimmer.«
Adriana ist froh über den Vorwand, den starrenden Blicken zu entkommen, doch sie spürt, wie sie ihr weiter folgen, als sie Jameara hinterhergeht. Sie streicht mit der Hand durch ihr Haar und fasst sich wieder.
»Auf jedem Stockwerk gibt es vier Gruppen und pro Gruppe fünf Schlafzimmer.« Jameara öffnet eine Tür im Hauptgeschoss des Freizeitbereichs, auf der ein großes gelbes C prangt. Die Tür führt zu einer weiteren Schleuse. »Jede Gruppe hat einen Buchstaben, damit man weiß, wohin man gehört. Du bist in Gruppe C.« Sie öffnet die andere Tür und gibt den Blick frei auf ein trostloses Miniwohnzimmer, von dem Türen zu mehreren weiteren Zimmern abgehen.
Hier gibt es mehr Türen als Wände.
»Nicht alle Zimmer sind belegt«, erklärt Jameara. »In Gruppe C gibt es noch drei weitere Mädchen, das heißt, du bist die Vierte. Das fünfte Zimmer wird als Lagerraum benutzt.«
Sie führt Adriana zu einer Tür mit einer gelben Vier und zieht ihre Karte durch das Lesegerät. »Da wären wir. C4«, sagt sie. »Das ist dein neues Zuhause.«
Als Adriana das Zimmer betritt, zieht sie schlurfend die Füße über den Betonboden.
Aus einer fensterlosen Wand ragt eine eingebaute Bettplattform mit einer senffarbenen Decke über weißen Laken und einem einzelnen Kopfkissen. Ein niedriger Raumteiler aus Betonsteinen verdeckt nur zum Teil eine Toilette aus Edelstahl und ein paar Schritte daneben ein Waschbecken an der Wand. Kein Schreibtisch, kein Stuhl.
Adriana wirft Jameara einen Das-kann-nicht-Ihr-Ernst-sein-Blick zu. »Es sieht aus wie ein Hundezwinger.«
Ohne die Zelle zu betreten, lehnt Jameara sich auf eine Art an den Türrahmen, die gleichzeitig zwanglos und kein bisschen zwanglos wirkt. »Es ist bloß ein Schlafplatz. Du wirst hier drinnen nicht viel Zeit verbringen – und die Betten sind bequem, darauf kommt es an.«
»Ich bin also ein Hund, aber einer, der es bequem hat.«
Jameara geht nicht darauf ein. Wahrscheinlich hat sie das in der Ausbildung gelernt. Keine negative Aufmerksamkeit gewähren.
»Das ist dein Handbuch für Insassen«, sagt sie stattdessen und zeigt auf eine Broschüre, die auf dem Kopfkissen liegt. »Lies es durch«, fährt sie fort. »Ich beantworte gerne alle Fragen, aber ich glaube, das Handbuch ist ziemlich klar.«
Als Jameara sich aufrichtet, erstarrt Adriana. Die Frau sieht aus, aus wollte sie zu einer aufmunternden Rede ansetzen, und da gehen bei Adriana sofort alle Rollläden runter.
»Ich weiß, dir kommt im Moment alles ziemlich trostlos vor – glaub mir –, ich weiß, wie schmerzhaft das Leben für junge Menschen sein kann, vor allem für ein junges Mädchen wie dich.«
Jameara wirkt so ernst und spricht so leise, dass Adriana unwillkürlich gebannt ist. Schweigend wartet sie, was die Sozialarbeiterin vielleicht noch zu sagen hat, die heruntergelassenen Rollläden zusätzlich mit Stacheldraht gesichert.
»Ich möchte, dass du weißt und daran glaubst, dass deine Zukunft in dir selbst liegt. Im Augenblick bist du noch auf der Suche, aber keine Sorge, mit der Zeit wirst du sie finden.« Jameara lächelt. »Okay?«
Adriana verschränkt die Arme vor der Brust und zieht die Schultern hoch. »Sicher«, erwidert sie ohne Überzeugung. So etwas würde ihre Stiefmutter auch sagen. Sie ist genauso voller sentimentaler Scheiße.
Auch wenn ihr Zimmer alles andere als einladend ist, wünschte Adriana, sie könnte für den Rest des Tages einfach hierbleiben, aber Jameara ist bereits beim nächsten Programmpunkt auf ihrem Terminplan.
»Es ist fast Zeit fürs Mittagessen«, sagt sie und steht auf. »Normalerweise würdest du zusammen mit den anderen Mädchen dorthin eskortiert, aber dieses eine Mal bringe ich dich persönlich in die Kantine.«
Sie verlassen Adrianas Zimmer, und Jameara zieht die Tür hinter ihnen zu. Mit einem Klicken fällt sie ins Schloss. Von allen Geräuschen auf der Welt muss es dasjenige sein, das Adriana am wenigsten mag.
Die Kantine ist ein großer Raum mit rechteckigen Tischen, die mit Bolzen im Boden befestigt sind. Die Stühle sind verkehrt herum auf die Tische gestellt, mit den Beinen nach oben wie Borsten.
Warum sind die Tische massiv und im Boden vernietet, während die Stühle so klapprig wirken? Dahinter steckt garantiert irgendeine Strafanstaltslogik, die sich ihr entzieht. Oder vielleicht ist es einfach bürokratische Dummheit. Es erinnert sie an die Bibliothek ihrer Schule. Man hatte sie aufwändig renovieren lassen, um dann festzustellen, dass die Innenarchitekten vergessen hatten, Steckdosen einzuplanen. Dazu befragt hatten sie erklärt: »Wofür braucht man in einer Bibliothek Steckdosen?«
Der Gedanke an ihre alte Schule versetzt Adriana einen unerwarteten Stich. Sie fragt sich, ob es hier auch eine Bibliothek gibt. Sie würde gern so tun, als wäre es ihr egal, aber das ist es nicht.
Dann kapiert Adriana auf einmal, dass es hier nur billige Plastikstühle gibt, damit die Jugendlichen sie nicht als Waffe benutzen können. Oder zumindest keinen allzu großen Schaden damit anrichten können, sollten sie es doch versuchen. Und nun wäre es ihr lieber, sie hätte es nicht begriffen.
Am anderen Ende der Kantine haben zwei Mädchen begonnen, die Leichtgewichtsstühle von den Tischplatten zu heben und um die Tische aufzustellen. Eine Wand des Raumes wird von der Essensausgabe eingenommen. Ihre Metallfront glänzt matt in dem blassen Tageslicht, das durch einen schmalen Streifen Fensterglas direkt unter der Decke hereinfällt.
»Alle Mädchen bekommen Arbeiten zugeteilt, unter anderem in der Kantine. Bei der Einführung morgen wirst du erfahren, wie wir die Dinge hier regeln. Frühstück ist um sieben, Mittagessen um elf, Abendessen um fünf.«
»Warum so früh?«, fragt Adriana.
»Die Kantine ist einer von mehreren Bereichen, die wir uns mit den Jungen teilen. Die Mädchen kommen um sieben, elf und fünf, die Jungen um acht, zwölf und sechs.«
»Irgendwie beschissen, dass sie die besseren Zeiten kriegen.«
Jameara grinst. »Ja, aber dafür müssen sie nach den Mahlzeiten auch sauber machen. Um sie daran zu erinnern, dass die Mädchen nicht ihre Mägde sind.«
Obwohl sie ein paar Minuten zu früh sind, steht das Essen schon bereit, und Jameara führt Adriana zum Ausgabetresen. Sie blickt zu den Mädchen, die den Raum für das Mittagessen vorbereiten. Eine von ihnen stellt einen Stuhl ab und starrt mit maskenhaftem Gesicht zurück. Dann wendet sie sich ab, fängt einen Blick des anderen Mädchens auf und weist mit dem Kopf auf Adriana, als wollte sie sagen: Check das Frischfleisch aus.
»Fang schon mal an«, sagt Jameara. »Die anderen werden jede Minute hier sein.«
Adriana nimmt ein Tablett von dem Stapel und atmet den Duft von Anstaltsessen ein, eine Oase des Wohlgeruchs zwischen anderen weniger verlockenden Gerüchen, die die Einrichtung durchdringen.
»Neuankömmlinge bekommen also als Erste was zu essen?«, fragt Adriana.
»Na ja, ich dachte, du hast Hunger, nachdem ich dich kreuz und quer durch den Laden geschleift habe.«
Hinter dem Tresen wacht eine kräftige Frau mit Haarnetz und weißer Schürze über die Warmhaltebehälter. Küchenhilfen sind im gesamten Universum gleich.
»Dorella, das ist Adriana. Sie ist gerade angekommen.«
»Hallo, Adriana«, sagt Dorella.
Hinter ihr legen zwei weitere Küchenhilfen Salatblätter und Tomatenstücke in eine Ecke der in Fächer unterteilten, rechteckigen Teller und garnieren sie mit einem Klecks Thousand-Island-Dressing. Dorella nimmt einen der Teller.
»Spaghetti mit Fleischklößchen oder Fischstäbchen?«, fragt sie – und Jameara weist darauf hin, dass Jugendliche in anderen Einrichtungen nicht auswählen dürfen, was sie essen wollen. Das ist Teil der Compass-Erfahrung.
Adriana entscheidet sich für die Pasta, und Dorella gibt Spaghetti, Fleischbällchen und Sauce auf einen vorbereiteten Teller, legt eine Scheibe getoastetes Knoblauchbrot dazu und überreicht ihn Adriana.
Sie hasst Thousand-Island-Dressing, aber in dem Punkt gibt es offenbar keine Wahl. Adriana bedient sich am Ende des Tresens mit einer in eine Serviette eingewickelten Plastikgabel und einem Plastikbecher und schenkt sich Wasser ein. Dann nimmt sie an einem der Tische Platz, wickelt die Gabel aus und kostet zögerlich. Das Essen riecht gut, aber die Fleischbällchen schmecken wie Pappe, und die Konsistenz der Spaghetti ist mehr als erbärmlich.
Wie schafft man es, Pasta gleichzeitig matschig und steinhart zu kochen?
»Gute Arbeit, Mädchen«, sagt Jameara zu den Stuhlaufstellerinnen. Alle Stühle stehen jetzt ordentlich um die Tische. Die Mädchen haben daneben Aufstellung genommen, die Hände hinter dem Rücken verschränkt. Adriana erkennt, dass sie sich Mühe geben, sie nicht anzustarren, spürt ihre Blicke jedoch trotzdem.
Worauf warten sie … Befehle?
In diesem Moment geht die Tür der Kantine auf, und eine Wärterin in khakifarbener Uniform mit einem schildförmigen Rangabzeichen am Ärmel führt eine Reihe von Mädchen herein, die alle die Hände hinter dem Rücken verschränkt haben und vollkommen still sind. Die beiden Stühleaufstellerinnen schließen sich am Ende an.
»Rührt euch, Ladys«, sagt die Wärterin.
Die Mädchen gehen hintereinander an Adriana vorbei zur Essensausgabe und werfen ihr neugierige Blicke zu. Sie erkennt die Ballprinzessin und ihren Hofstaat aus dem Gemeinschaftsbereich wieder.
Jameara wirft Adriana ein kurzes Lächeln zu. »Alle Jugendlichen an einem Tisch bleiben stehen, bis entweder alle Plätze besetzt sind oder die Erlaubnis erteilt wird, Platz zu nehmen. Aber für deine erste Mahlzeit machen wir eine Ausnahme.«
Adriana verzieht das Gesicht. Durch eine »Ausnahme« sticht sie nur noch mehr hervor.
»Ich gehe dann mal.« Jameara klopft Adriana auf die Schulter. »Officer Bonivich bleibt hier«, sagt sie im Gehen, und Adriana fragt sich, warum Jameara denkt, dass Adriana eine Aufpasserin braucht.
Den Raum mit einer Meute zu teilen, die sie erst noch akzeptieren muss, dämpft Adrianas Appetit noch weiter. Sie starrt auf ihren Teller, konzentriert sich darauf, Spaghetti auf die Gabel zu drehen und möglichst langsam zu essen, weil ohne etwas dazusitzen, worauf sie ihre Aufmerksamkeit lenken kann, wäre der Stoff, aus dem Albträume sind.
In ihrem Rücken hört sie das Geklapper von Tabletts und schlurfende Schritte entlang der Essensausgabe. Dann sieht sie zwei Mädchen auf ihren Tisch zukommen. Eins von ihnen hat schlaffes blondes Haar und trägt zwei Tabletts. Das andere ist das kleine Geistermädchen, seine Hände sind leer.
»Hi«, sagt das blasse Mädchen. »Ich bin Pip. Das ist Jolene.«
Jolene, die Pips und ihr eigenes Tablett trägt, lächelt schüchtern. »Adriana, richtig?«
»Genau«, sagt Adriana.
Jolene stellt ein Tablett vor Pip ab.
»So ein persönlicher Service«, bemerkt Adriana und erhebt sich. Alle anderen müssen stehen bleiben, bis der Tisch voll belegt ist, und sie will nicht unhöflich sein.
Pip zuckt mit den Schultern. »Jolene hilft mir bloß gerne. Und manchmal fällt es mir schwer, mein Tablett zu tragen.«
Adriana möchte fragen, warum, vermutet jedoch, dass das übergriffig wäre, und sagt stattdessen: »Pip ist ein süßer Name. Heißt du wirklich so, oder ist das ein Spitzname?«
Das quittiert Pip mit einem fröhlichen Grinsen, das Adriana an ihren zweijährigen Halbbruder erinnert, dessen Gesicht genauso aufleuchten kann. Wie alt ist sie?
»Ein bisschen von beidem vermutlich«, sagt Pip. »Es ist eine Abkürzung für Penelope.«
In diesem Moment erscheint die Ballprinzessin mit ihrem Hofstaat und gesellt sich zu ihnen an den Tisch. Sie lächelt Adriana freundlich an. Sie ist Hispanoamerikanerin, doch da ist noch eine Spur von etwas anderem. Indisch? Philippinisch? Adriana fragt sich, warum sie darauf programmiert ist, das wichtig zu finden.
Als ein großes dünnes Mädchen hinter den letzten Platz an ihrem Tisch tritt, setzen sich alle. Das große Mädchen bedenkt Adriana mit einem Blick, der so kalt und flach ist wie die Wände des Raumes. »Wer hat gesagt, dass du bei uns sitzen darfst?«
Sie ist eine Mischung von allen Ethnien unter der Sonne. Unmöglich zu sagen, als was sie sich identifiziert, außer dass sie den Schatten zum Glanz der Prinzessin darstellt. »Ich hab dich was gefragt!«
Adriana begreift sofort – das ist das Mädchen, das dafür sorgt, dass der Hofstaat nicht aus der Reihe tanzt, damit die Prinzessin sich nicht selbst darum kümmern muss. Trotzdem reibt ihr herausfordernder Ton an Adrianas Nerven.
»Ich dachte nicht, dass ich eine Erlaubnis brauche«, erwidert Adriana – nicht herausfordernd, sondern eher sanft. »Außerdem habe ich mich nicht zu euch gesetzt – ich war schon hier. Ihr seid gekommen und habt euch zu mir gesetzt.«
Das Mädchen starrt sie bloß mit unverhohlener Verachtung an. Ist ihr bewusst, dass sie ein Klischee ist? Vielleicht weiß sie es wirklich und lässt es bloß offen raushängen.
Schließlich erhebt die Ballprinzessin die Stimme. »Ich bin Bianca«, sagt sie. »Das ist meine Sis Monessa.« Sie weist auf das große Mädchen. »Und du hast recht, wir haben uns zu dir an den Tisch gestellt – weil ich gehört habe, dass du in Monessas und meiner Gruppe bist«, erklärt sie Adriana, die nicht sicher ist, ob das eine gute Nachricht ist. »Das heißt, du kannst jederzeit bei uns sitzen.«
Monessas Blick verliert nichts von seiner Kälte, doch sie gibt nach.
»Okay, danke«, sagt Adriana.
Dann nimmt Monessa ihre Gabel, spießt aus heiterem Himmel eins der Fleischklößchen auf Adrianas Teller auf und verschlingt es mit einem Bissen.
Aber bevor Adriana reagieren kann, meldet sich Pip zu Wort. »Monessa, sei nicht so!« Dann nimmt sie eins von ihren Fleischklößchen und legt es auf Adrianas Teller, um das gestohlene zu ersetzen. »Hier, ich wollte es sowieso nicht«, sagt sie lächelnd.
Und alle warten, was Adriana machen wird.
Sie wendet sich an Monessa. »Willst du das auch?«
Monessa zuckt die Schultern. »Hab keinen Hunger mehr.«
Adriana weiß, dass das eine Art Test ist, mit Bianca als stummer Richterin und den anderen als Geschworenen. Wie verhält sie sich richtig? Soll sie das Fleischklößchen essen? Sollte sie es Pip zurückgeben? Sollte sie Monessa das Tablett über den Kopf ziehen, um den Mädchen zu zeigen, dass mit ihr nicht zu spaßen ist? Am Ende gibt sie Pip das Fleischklößchen zurück. »Nein danke, Pip«, sagt sie. »Ich bin nicht so eine Sau, die anderen das Essen klaut.«
Monessas Gesicht läuft in den verschiedensten Violettschattierungen an. »Wie hast du mich genannt?«
»Gar nichts – ich rede über Fleischklößchen«, sagt Adriana.
Monessa geht in Kampfpositur – doch genau in diesem Moment kommt die Wärterin an ihren Tisch.
»Gibt es ein Problem?«
Sie ist eine stämmige Frau, rundes Gesicht, kurzes, braunes, lockiges Haar; ihre Khakiunform ist picobello gebügelt und sitzt perfekt. Ihr Namensschild weist sie als Officer Bonivich aus, die Jameara eben erwähnt hat.
Adriana nimmt an, dass Bianca Bonivichs Aufmerksamkeit ablenken wird, doch stattdessen erhebt Pip die Stimme.
»Hallo, Officer Bonivich. Nein, alles bestens hier«, erklärt sie mit einem breiten Lächeln. »Wir haben bloß die Portionen aufgeteilt. Einige von uns hatten mehr bekommen als andere, und wir haben versucht, das auszugleichen.«
Bonivich zögert kurz, nickt dann und entfernt sich ohne ein weiteres Wort wieder.
Und dann, Wunder über Wunder, lächelt Bianca.
»Na, das war ein Spaß.«
Nach diesem Urteil legt Monessa die Nackenhaare wieder an, allerdings nicht ohne Adriana einen warnenden Blick zuzuwerfen.
3»Sag mir, warum du hier bist.«
Triff mich im Park, hast du gesagt,
Und ich bin gerast.
Ich bin deine Freundin, hast du gesagt,
Und Freundinnen sind füreinander da
Bis zum schmutzigen Ende, klar.
Ich fahr also rüber
Zu dem armseligen Fleckchen
Aus Gras, Zigarettenstummeln
Und Rumfummeln
Irreführend auch Park genannt.
Jungs wollen Action,
Wollen Satisfaction,
Im Dunkeln unter eklig süßen Platanen.
Wo tagsüber
kleine Kids
Nichts von der Geilheit ahnen,
tapsende Schritte machen,
Sich im Kreis drehen,
Schaukeln und lachen,
im Kopf ganz bestimmt nicht
das Ding – den DEAL.
Und ich blicke auch nicht viel.
Doch du weißt genau, was passiert.
Du spürst es,
Nur ich hab nichts kapiert.
Ich bin dein Plan, deine Masche,
Dein Ausweg raus aus der Sache
Eine verschwommene Kontur
in deinem Elendsrevier.
Wo Hunde scheißen und Besoffene bluten,
Stehst du am Straßenrand.
Tütchen mit Pulver, Pillen und Gras
Wechseln für Zwannis und Fuffis
Von Hand zu Hand
Hey, Girl, kannst du mir helfen
Und Schmiere stehen?
Fragst du
Und vertickst deine Päckchen mit Leid.
Eine Freundin ist schließlich für die andere da,
Bei Nacht und bei Tag und sagt niemals
Nein.
Dann regnet es Scheiße von oben.
Auf den Boden, aufgeflogen.
Vertrauen unter die Räder gekommen,
Wir sind vorläufig festgenommen.
Der Stich
Hat Gift,
Alles schwarz-weiß
Und flackernde Lichter,
Man verliest uns unsere Rechte,
Und die Welt schnurrt zusammen
Auf die Lügen aus deinem Mund
Eben noch hast du mich Freundin genannt.
Jetzt sagst du, nur Mut
Alles wird gut,
Für dich, aber nur für dich,
Denn ich ahne immer noch nicht,
Dein verborgener Finger – der zweite Stich –
zeigt auf mich.
Wegen deiner abscheulichen Beschuldigung
Trifft mich die dir zugedachte Verurteilung.
Ich bin deine Freundin, hast du gesagt,
Das war gelogen,
wurde verbogen
Zu einer Angel an jener schwarzen Tür,
Der Falltür
Für dein Verschwinden – wie durch Zauberei.
Ich halte dir den Rücken frei,
ahnungslos von dir ausgetrickst,
Vorgeschickt.
Mein einziges Verbrechen
DEINE Tütchen, die in MEINER Tasche steckten
Das hat so weh getan
Dein Verrat, geplant von Anfang an.
Erst in Handschellen
Wird mir am Ende klar,
Dass deine vermeintliche Freundschaft
Eine Sackgasse für mich war.
Das Rasseln einer Klingel reißt Adriana aus dem Schlaf. Sie hält sich mit beiden Händen die Ohren zu, was auch nicht viel hilft. Was zum Teufel! Die Morgenglocke hallt zwischen den Betonwänden ihres Zimmers wider, verstummt dann jäh und lässt eine erschütterte Stille zurück. Das Türschloss klickt. Kurz denkt sie, jemand würde eintreten – aber nein. Die Tür wurde bloß automatisch entriegelt.
Sie sucht instinktiv nach ihrem Notizbuch, um ihre Gefühle über all das zu ordnen, ehe ihr wieder einfällt, dass es weg ist. Konfisziert von Paula, dem Zugangsverfahrenstroll. Adriana fragt sich, ob sie es gelesen hat. Ihre privatesten Gedanken, beschmutzt von Leuten, denen sie nicht gleichgültiger sein könnten? Am besten denkt sie gar nicht darüber nach.
Sie steigt von ihrer Bettplattform, schlüpft in dünne Gummischlappen und nimmt im Pyjama draußen vor ihrer Tür Aufstellung, den Blick zur Wand, die Hände wie vorgeschrieben hinter dem Rücken, eine Hand um das Handgelenk der anderen gelegt. Das ist etwas, was sie schnell gelernt hat, ohne dass es ihr jemand erklären musste. Verdammt, es fühlt sich an wie tiefstes Morgengrauen. Sie lehnt die Stirn an die Tür und schließt die Augen.
»Kopf hoch, Zareen!«
Officer Bonivichs Stimme lässt sie strammstehen.
»Zarahn«, korrigiert Adriana sie und bereut es sofort. Will sie sich wirklich so schnell bei Bonivich unbeliebt machen?
»Mein Fehler«, sagt Bonivich. »Zarahn.«
Adriana weiß nicht genau, ob es ernst oder sarkastisch gemeint ist. Bonivich hat eine Stimme, mit der alles, was sie sagt, spöttisch klingt.
»Auf geht’s, Ladys!«
Sie marschieren zu den Duschräumen. Zehn Minuten später ist Adriana wieder in ihrem Zimmer. Sie zieht einen frischen Satz Kleidung an, flicht ihre Haare geschickt zu einem Zopf, entscheidet dann jedoch, dass sie damit ein bisschen zu sehr aussieht wie Bianca, und löst ihn wieder. Dann nimmt sie ein weiteres Mal draußen vor ihrer Tür Aufstellung und wartet darauf, zum Frühstück gebracht zu werden.
Gestern Abend nach dem Essen hat Jameara bei ihr vorbeigeschaut und ihr mitgeteilt, dass sie nach der ersten Unterrichtsstunde ihren ersten Termin bei Dr. Alvarado hat, dem Anstaltspsychologen. Adriana hofft, dass sie ihr Notizbuch zurückbekommt.
Tag zwei, denkt sie. Wahrscheinlich keine gute Idee, die Tage zu zählen. Dadurch wird ihr die Zeit nur länger vorkommen.
Neben sich hört sie ein Husten und ein leises Keuchen. Als sie sich umdreht, erwidert Pip ihren Blick und zwinkert ihr zu. Seltsames Mädchen, denkt Adriana. Aber immerhin ist sie freundlich.
Beim Frühstück in der Kantine nimmt Adriana sich einen Moment Zeit, das größere Bild zu betrachten, das sie beim Mittag- und Abendessen gestern nicht wahrgenommen hat, weil sie die meiste Zeit entweder auf ihren Teller gestarrt oder versucht hat, mit den Mädchen klarzukommen, die an ihrem Tisch saßen. Adriana weiß, dass man durch die Dynamik in der Kantine eine Menge über eine Einrichtung lernen kann, und Biancas Hofstaat ist nur eine Teilmenge der hiesigen Gesamtbevölkerung.
Die Gesichter um sie herum reichen von vampirhaft blass bis zu dunklem Kakaobraun mit allen Schattierungen dazwischen. Mehr braune Gesichter als weiße – offensichtlich ist dieser Ort kein Querschnitt von Amerika, sondern eher ein Querschnitt dessen, was Amerika aus seinem Blickfeld verbannen will.
Während sich Gefängnisinsassen in der Regel streng entlang ethnischer Grenzen aufteilen, möchte man so etwas hier unbedingt verhindern. »Wir sind eine Gemeinschaft in Compass«, hat Jameara erklärt. »Keine Fraktionen und Lager.« Trotzdem gibt es einen Tisch mit Schwarzen, einen Tisch mit weißen und einen Tisch mit hispanischen Mädchen – aber die meisten anderen scheinen die Frage nach ihrer Hautfarbe in der Kantine beiseitezuschieben, vielleicht um sie Anlässen vorzubehalten, bei denen es drauf ankommt.
Bei vielen Mädchen lässt sich nicht sagen, als was sie sich identifizieren. Aber das ist bei Adriana nicht viel anders. Die Familie ihres Vaters stammt aus Marokko, ihre Mutter ist griechisch-spanischer Herkunft. Adrianas »mediterranes« Aussehen kann man also mit Recht als alles Mögliche klassifizieren. Und sie hat die Erfahrung gemacht, dass Uneindeutigkeit ein zweischneidiges Schwert ist. Ja, sie kann sich leicht in eine Gruppe einfügen, wenn das gewünscht ist – aber sie kann auch als »anders« gesehen werden, wenn nicht.
»Hier ist ein Platz frei, Chica!« Bianca zeigt auf die Lücke neben sich an dem Tisch, wo sie und ihr übliches Gefolge stehen und warten, dass der letzte Platz belegt wird. Adriana erkennt, dass Bianca ihn mit Absicht für sie frei gehalten hat.
»Danke«, sagt sie und meidet Monessas missbilligenden Blick.
Adrianas Ankunft erlaubt allen, Platz zu nehmen. Sie blickt auf ihr Tablett. Rührei mit Käse zwischen zwei Toastdreiecken und ein paar Streifen Bacon. Beim Duft von Käse und dem gebratenen Speck knurrt ihr Magen vernehmlich.
Zwischen den Bissen machen die Mädchen Smalltalk. Adriana wartet die ganze Zeit darauf, dass jemand wissen will, weshalb sie hier in Compass gelandet ist. Aber vielleicht ist es eine unausgesprochene Regel, dass man danach nicht fragt. Trotzdem überlegt sie, wie sie antworten würde, falls es doch jemand tut. Es gibt verschiedene Gründe, warum Adriana hier ist, und sie sind alle wahr. Schule schwänzen, mit Leuten rumhängen, die ein »schlechter Einfluss« waren, aus den Pflegefamilien abhauen, bei denen sie zwangsweise untergebracht war, bis ihr Vater sein Leben wieder in Ordnung gebracht hatte, um die Verantwortung für sie dann einer Stiefmutter zu überlassen, die Adriana nicht mag. Und schließlich der letzte Grund.
Als die Unterhaltung am Tisch erlahmt, beginnen auch die anderen Mädchen, ihren eigenen grüblerischen Gedanken nachzuhängen. Ein dunkles Innenleben haben sie wohl alle gemeinsam.
Eine Stunde später hocken sie an ihren Tischen im Geschichtsunterricht. Während des Unterrichts darf Monessa offenbar nicht in Biancas Nähe sitzen; ihre Pulte stehen jedenfalls auf entgegengesetzten Seiten des Raumes. Adriana bekommt den Platz neben Bianca zugewiesen – was gut ist, weil Nähe zur Bienenkönigin immer klug ist. Und weil Monessa darüber garantiert angepisst ist.
Die Lehrerin ist nicht persönlich im Klassenraum anwesend. Sie ist auf einem großen Fernsehbildschirm zugeschaltet; eine makellos frisierte Frau mit einem Hintergrund, der beinahe so unecht wirkt wie ihre Augenbrauen. Sie doziert über Formen der Ausbeutung von Kindern in der Geschichte wie zum Beispiel Zwangsehen und stellt hin und wieder einzelnen Schülerinnen eine Frage, vielleicht um sie daran zu erinnern, dass es ein interaktiver Feed ist und sie die im Klassenraum Anwesenden sehen kann. Trotzdem wirkt sie, als hätte man eine Sprecherin aufgezeichnet. Zusätzlich gibt es eine Aufsicht im Raum, falls physische Präsenz vonnöten ist, aber die zählt meistens die Stifte oder löst Kreuzworträtsel.
Während die Lehrerin sich weiter über Kinderbräute auslässt, verdreht Bianca übertrieben die Augen. »Ich hasse es, mir diesen Mist anzuhören.«
Adriana wirft ihr einen mitfühlenden Blick zu. »Ich auch. Als ob man uns daran erinnern müsste, wie beschissen das Leben für Frauen gewesen ist.«
Bianca beugt sich ein wenig näher. »Ich wär selbst fast in die Prostitution verkauft worden.«
»Wirklich?«
»Ja. Einer von den Loser-Freunden meiner Mom hat sie überredet, mich auf den Strich zu schicken. Sie haben mir vorgegaukelt, ich würde auf eine Mädelsparty gehen. Haben mich in ein Glitzerminikleid gesteckt. Mom hat mich geschminkt. Ich war irgendwie aufgeregt, weil sie mir sonst nie so viel Aufmerksamkeit geschenkt hat.« Bianca blickt auf, um sich zu vergewissern, dass die Lehrerin zu beschäftigt ist mit ihrem Vortrag, um zu bemerken, was im Klassenzimmer vor sich geht.
»Als wir zu dem Lokal kamen, wusste ich sofort, was Sache war. Es gab jede Menge anderer Mädchen, die angezogen waren wie ich, Nutten-Chic, weißt du, und ein Typ, der aussah wie ein College-Boy, wollte, dass ich zu ihm rüberkomme.«
»Was hast du gemacht?«, fragt Adriana.
»Ich hab versucht abzuhauen. Hab es bis zur Eingangstür geschafft, aber die war abgeschlossen.«
»Im Ernst?«
Bianca nickt. »Verrammelt und verriegelt. Ich musste aus dem Toilettenfenster klettern.« Ihr Blick wird glasig. »Meine eigene Mutter.«
»Das ist echt beschissen.« Einen Moment lang spürt Adriana einen Riss in der Mauer, hinter der Bianca lebt. In den Mauern, hinter denen sie beide leben. Aber der Moment geht vorbei, Bianca wischt sich die Augen und wendet sich ab, wie jemand, der so tun will, als wäre nichts.
»Ladys«, lässt sich die Lehrerin vernehmen, »sind Sie heute hier bei uns?«
»Wo zum Teufel sollten wir sonst sein?«, sagt Bianca, die die Gefühle gegenüber ihrer Mutter offensichtlich auf die Lehrerin überträgt.
»Achten Sie auf Ihre Wortwahl, Bianca.«
»Ja, ja.«
Die Lehrerin betrachtet Bianca und beschließt offensichtlich, lieber keinen Ärger mit ihr anzufangen. Stattdessen weist sie auf Adriana.
»Miss Zarahn, bitte suchen Sie sich einen anderen Platz.«
Das ist das Stichwort für die Aufsichtsperson, sich zu erheben und Adriana einen neuen Platz zuzuweisen. Nachdem sie sich umgesetzt hat, blickt Adriana zu Bianca, die sie angrinst. Denn von einer Lehrerin umgesetzt zu werden – selbst im Fernunterricht und aus der Distanz –, ist eine Auszeichnung.
Nach der Geschichtsstunde bringt Officer Bonivich Adriana zum Büro des Anstaltspsychologen. Adriana geht, die Hände hinter dem Rücken, im Gleichschritt neben ihr. Sobald sie Alvarados Büro betritt, schlägt ihr der Geruch von Zigarettenqualm entgegen – ein Gestank, als müssten Sauerstoffmasken von der Decken fallen. Er haftet nur an seiner Kleidung – in Compass herrscht striktes Rauchverbot –, aber die Fasern haben den Mief verdammt gründlich aufgesogen.
Alvarado schickt Bonivich hinaus und weist auf zwei Sessel, die um einen Tisch stehen. »Bitte setzen Sie sich, Miss Zarahn.« Auf seinem vollgestellten Schreibtisch liegt eine aufgeschlagene Aktenmappe mit Adrianas Namen.
Und ihr Notizbuch.
Es ragt unter einem Stapel wahlloser Formulare hervor. Sie will es sich schnappen und gehen, doch sie weiß, dass man es ihr dann garantiert endgültig wegnehmen würde.
Alvarado nimmt mit nikotinfleckigen Fingern ihre Akte, klappt sie zu und lehnt sich mit verschränkten Armen zurück.
»Erzählen Sie mir, warum Sie hier sind.«
Adriana nimmt an, dass das eine Fangfrage ist. Oder der Typ ist einfach zu faul, selbst nachzulesen. Sie zeigt auf die Aktenmappe. »Steht das nicht alles da drin?«
»Ich habe es gelesen«, sagt Alvarado und macht eine knappe Handbewegung, als wollte er eine Fliege verscheuchen. »Eidesstattliche Aussagen, Berichte, Formulare. Worte, Worte, Worte. Aber nicht die Worte, die mich interessieren.« Er hält inne und blickt ihr direkt in die Augen. »Warum sind Sie hier?«
Adriana konzentriert sich auf seinen herabhängenden Schnurrbart, der seinen Mund rahmt wie die Hängebacken eines Walrosses. Sie hat keine Ahnung, welche Worte sie aus dieser Rätselbox von einem Zimmer befreien werden.
»Ich kann warten«, sagt Alvarado. »Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit, aber unser Termin dauert zwanzig Minuten. Währenddessen könnten wir hier sitzen und uns zu Tode gelangweilt anstarren, oder Sie können die Frage beantworten, Adriana.«
Die Aussicht, Alvarado – und die übertrieben weißen Zähne, die unter seinem Schnurrbart aufblitzen – zwanzig Minuten lang ansehen zu müssen, motiviert sie zu einer Antwort.
»Ich habe das, was man mir vorwirft, nicht getan. Ich bin reingelegt worden.«
»Nein«, sagt Alvarado, viel zu freundlich.
»Also wollen Sie bloß, dass ich sage, ich habe Drogen im Park verkauft? Ist es das?«
Alvarado zuckt mit den Schultern. »Irrelevant. Das andere Mädchen sagt, Sie waren es, Sie sagen, sie war es. So oder so ist es nicht der eigentlich Grund dafür, dass Sie hier sind.«
Das »andere Mädchen«, das Alvarado erwähnt hat, war theoretisch Adrianas Freundin. So viele davon hatte sie nicht, doch mit diesem Mädchen konnte sie scheinbar connecten. Und selbst nachdem Adriana erfahren hatte, dass dieses Mädchen sich mit dem Verkauf von Drogen ein bisschen was dazuverdiente, beendete sie die Freundschaft nicht, denn in Adrianas Leben waren Freundinnen Mangelware. Manchmal leugnet man etwas, das man eigentlich weiß, so lange, bis es zu spät ist. Und als diese sogenannte Freundin sie bat, Schmiere zu stehen und nach Bullen oder sonst etwas möglicherweise Verdächtigem Ausschau zu halten, hat Adriana es getan – denn das machen Freundinnen so, oder nicht? Selbst wenn man dadurch in Schwierigkeiten geraten könnte. Am Ende hat das andere Mädchen behauptet, sie würde gar nicht dealen – sie habe bloß Adriana geholfen. Und sie hatte den besseren Anwalt. Sie ist mit Bewährung davongekommen. Adriana wurde hierhergeschickt.
»Ich habe mir die falschen Freundinnen ausgesucht«, schlägt Adriana Alvarado vor.
Er zeigt ein wenig mehr von seinen weißen Zähnen. »Jetzt kommen wir voran. Weiter.«
Nachdem Adriana nun die Art Bullshit-Antworten kennt, die Alvarado hören will, kann sie sie für ihn auf dem Tisch auslegen wie Spielkarten.
»Ich habe meine Stiefmutter sauer gemacht.«
»Ich habe meinen Vater belogen.«
»Ich war respektlos zu meinen Lehrern.«
»Ich habe ohne Grund einen Typen geschlagen.«
Adriana hat keine Ahnung, ob irgendetwas davon in ihrer Akte steht, aber welche Rolle spielt das? Es ist alles wahr. Es sind also alles andere als Bullshit-Antworten.
»Und können Sie all das in einem einzigen ›Ich-Satz‹ zusammenfassen?«
»Ähm … ich bin ein kompletter Loser?«
Der Mann stößt ein herablassendes Glucksen aus, das in Adriana den Wunsch weckt, ihm den Schnurrbart abzureißen wie in Zeichentrickfilmen.
»Nein, Adriana. Keine so strenge Aussage.«
Als sie das Spiel nicht weiter mitspielt, antwortet er schließlich für sie.
»Sie sind hier«, sagt er, »wegen Ihrer eigenen falschen Entscheidungen. Selbst wenn Sie unschuldig sind, was das Vergehen betrifft, das Sie nach Compass gebracht hat, sind Sie trotzdem hier, weil Sie dazu neigen, schlechte Entscheidungen zu treffen.«
Er macht eine Pause, als wäre Adriana so begriffsstutzig, dass sie Zeit braucht, die Feststellung sacken zu lassen. Sie findet diesen Mann wirklich zutiefst und grundlegend unsympathisch.
»Abgesehen davon kommen Sie mir vor wie ein Mädchen, das eine prächtige Zukunft vor sich hat, wenn Sie sich nicht weiter selbst sabotieren.«
Da ist es also. Alvarados endgültiges Urteil. Von nun an wird sich alles an ihrer Person auf diese holzschnittartige Einschätzung beziehen müssen. Das ist in gewisser Weise gut. Es bedeutet, wenn sie die Regeln befolgt und ihre Akte sauber hält, kann Alvarado alle notwendigen Kästchen abhaken. Vielleicht kommt sie mit seiner Empfehlung sogar früher hier raus. Das heißt, wenn er nicht recht hat und sie sich wieder selbst sabotiert.
»Und«, sagt Alvarado, »in Anbetracht dessen, was wir jetzt über Sie wissen, warum sind Sie hier?«
Wieder diese Frage.
»Ich meine das in einem größeren universellen Sinn«, stellt er klar und macht eine ausladende Geste mit den Händen.
Und obwohl Adriana ihm erklären will, dass er sich sein größeres Universum in den Arsch stecken kann, sagt sie: »Ich bin hier, um zu lernen, bessere Entscheidungen zu treffen.«
Alvarado lächelt. »So einfach ist das.« Er lehnt sich unglaublich selbstzufrieden zurück, blickt auf einen Zettel vor sich auf dem Schreibtisch und sagt: »Das von zu Hause mitgebrachte Medikament gegen Ihre Angstzustände war niedrig dosiert und bedarfsweise verschrieben. Ich setze es fürs Erste ab. Ich kann es Ihnen jederzeit wieder verschreiben, wenn Sie es brauchen.«
Super. Jetzt darf also irgendein Jugendknast-Witzbold entscheiden, was sie braucht – ein Billig-Doc-in-the-Box, der wahrscheinlich keinen richtigen Job außerhalb dieser Anstalt gefunden hat. Alles an ihm von seinem unaufgeräumten Büro bis zu seinem falschen Lächeln mieft schwer nach Resterampe.
»Wir sehen uns nächste Woche«, sagt Alvarado und ruft Bonivich, damit sie sie hinausbegleitet – denn auch wenn die zwanzig Minuten noch nicht um sind, hat er bekommen, was er von ihr wollte.
Adriana fühlt sich irgendwie schmutzig. Als wäre sie gerade Komplizin ihrer eigenen Demütigung geworden. Aber bevor Bonivich hereinkommt, fragt sie die eine Sache, die ihr wirklich wichtig ist.
»Mein Notizbuch«, sagt sie und zeigt auf das Büchlein, das zwischen dem Durcheinander auf seinem Schreibtisch liegt. »Kann ich es jetzt zurückhaben?«
Alvarado zieht das kleine, in braunes Leder gebundene Buch unter dem Stapel hervor, der es bedeckt.
»Ah ja, Ihr Notizbuch.« Er hält es einen Moment in der Hand, betrachtet es und überlegt bestimmt, ob er es ihr zurückgeben soll oder nicht.
Adriana beobachtet ihn und wartet. Sie wird nicht noch einmal fragen. Noch einmal zu fragen würde bedeuten, Schwäche zu zeigen. Noch mehr, als sie es ohnehin schon getan hat.
»Wenn Gedanken es wert sind, gedacht zu werden, sind sie es auf jeden Fall auch wert, aufgeschrieben zu werden«, sagt er und hält ihr das Notizbuch hin. Adriana macht einen Schritt auf ihn zu, nimmt es entgegen und spürt, wie unendlich erleichtert sie ist. Bis er sagt: »Aber ich kann Ihnen natürlich keinen Stift geben. Die werden streng kontrolliert.«
Es gibt immer einen Haken. Adriana fragt sich, ob er das genießt. »Und wie …?«
»Sie können im Unterricht und in der Bibliothek einen Stift ausleihen. Aber der muss dort bleiben, wenn Sie gehen.« Er wartet auf ihre Reaktion, doch sie zeigt ihm keine. Er zögert, tut so, als würde er nachdenken, und hebt dann einen Finger, als wäre ihm gerade eine Idee gekommen. »Ich glaube, ich kann Ihr Problem lösen.« Er wühlt auf seinem Schreibtisch herum, der an den Unfallort eines Zugunglücks erinnert, und fördert einen billigen Kuli zutage. Er zieht an der Spitze, bis die weiche Mine sich aus der Hartplastikhülle löst, und hält sie Adriana hin. »Schreibwerkzeuge lassen sich als Waffen benutzen – aber ich glaube, damit können Sie keinen Schaden anrichten.«
Er biegt die Mine in seiner Hand, ein rückgratloses Objekt. Ein Stift mit erektiler Dysfunktion. Sie muss die Lippen schürzen, um nicht zu grinsen, denn das wird jetzt für immer das Bild sein, das sie mit ihm verbindet. Sie nimmt die Mine entgegen, und auch wenn sie dem Mann keine Dankbarkeit zeigen will, sagt sie obligatorisch: »Vielen Dank.«
»Falls irgendjemand fragt, sagen Sie, Sie haben die Mine von mir.«
Als Adriana auf das Notizbuch in ihrer anderen Hand schaut, streift sie ein Gedanke, von dem sie wünschte, er wäre ihr nie gekommen.
»Sie haben es gelesen!«, ruft sie vorwurfsvoll, bevor sie sich bremsen kann. Sie drückt das Notizbuch an die Brust und spürt eine brennende Empörung.
»Das wäre eine Verletzung der Privatsphäre, Miss Zarahn«, sagt Alvarado. »Die wäre unter den gegebenen Umständen zwar möglicherweise gerechtfertigt, aber auch unprofessionell.«
Und obwohl sich das anhört, als habe er ihr Notizbuch nicht gelesen, fällt Adriana auf, dass er es auch nicht ausdrücklich dementiert hat. Tatsächlich hat er es zu keinem Zeitpunkt geleugnet.
Dieser Mann ist gefährlich, denkt sie. Nicht wegen dem, was er tun kann. Nicht wegen der Dinge, die er sagt, sondern wegen der Dinge, die er nicht sagt.
4Plattitüden und Attitüden
Ich bin Compass,
Mörtel und Backstein
Blut und Knochen.
Habe ein Bewusstsein
Und bin doch allein,
Nur das Scharren der Seelen,
die von ihnen hinterlassenen Fetzen,
wie das Flüstern von Haut auf dem Bürgersteig
vom aufgeschürften Knie eines Kindes.
Ich bin
Versklavung.
Stell mein Bewusstsein nicht in Frage.
Und auch nicht die Ungerechtigkeit.
Ich weiß nur, ich sehe, doch ich fühle nicht.
Wenn sie stolpern und fallen,
Bröckeln nicht meine Hallen
Unter der Last dessen, was ich bezeugen muss.
Ich tu so, als wär ich gedankenlos.
Ich wurde erbaut, der brutale Schauplatz zu sein
Für ein aussichtsloses Versteckspiel,
Doch niemand findet zum Suchen sich ein.
Es geht mehr ums Verstecken,
Tadeln, Herrschen
Und Teilen.
Die in meinen Mauern verweilen
Zweifeln an der grundsätzlichen Orientierung
Dieser sogenannten Anstalt zur Besserung.
»Wer bin ich jetzt?«
»Existiere ich noch?«
Sie werden nicht vermisst und werden auch nicht verbessert
Durch das Ausmaß und die Kraft meiner Haft.
Ich bin hier, die Erinnerung der Welt auszuradieren
An die Kids, über die sie nicht reflektieren will.
Ein paar werden abserviert.
Andere aussortiert.
Die übrigen werden absorbiert.
Adriana sitzt im Schneidersitz auf dem Bett, das aufgeschlagene Notizbuch auf dem Knie, und schreibt mit der weichen Mine, bei der sich ihre Finger verkrampfen, wenn sie sie benutzt. Bei jedem Eintrag muss sie oben auf der Seite das Datum notieren, denn die Tage beginnen bereits, ineinanderzufließen und in einem betäubenden Regen aus emotionalem Graupel zu vergehen. Sie hatte sich geschworen, nicht die Tage zu zählen, doch jetzt muss sie es tun, nur um zu wissen, dass die Zeit sich tatsächlich vorwärtsbewegt.