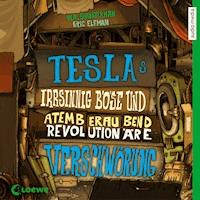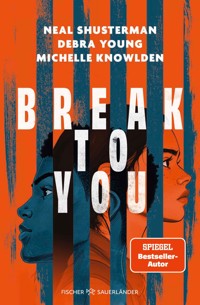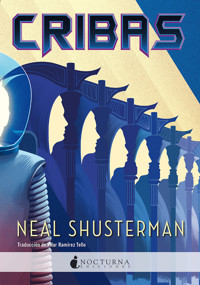9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Scythe
- Sprache: Deutsch
Unsterblichkeit, Wohlstand, unendliches Wissen. Die Menschheit hat die perfekte Welt erschaffen – aber diese Welt hat einen Preis. Citra und Rowan leben in einer Welt, in der Armut, Kriege, Krankheit und Tod besiegt sind. Aber auch in dieser perfekten Welt müssen Menschen sterben, und die Entscheidung über Leben und Tod treffen die Scythe. Sie sind auserwählt, um zu töten. Sie entscheiden, wer lebt und wer stirbt. Sie sind die Hüter des Todes. Aber die Welt muss wissen, dass dieser Dienst sie nicht kalt lässt, dass sie Mitleid empfinden. Reue. Unerträglich großes Leid. Denn wenn sie diese Gefühle nicht hätten, wären sie Monster. Als Citra und Rowan gegen ihren Willen für die Ausbildung zum Scythe berufen werden und die Kunst des Tötens erlernen, wächst zwischen den beiden eine tiefe Verbindung. Doch am Ende wird nur einer von ihnen auserwählt. Und dessen erste Aufgabe wird es sein, den jeweils anderen hinzurichten … Der erste Band der internationalen Bestseller-Trilogie! Schutzumschlag mit Metallic-Folien-Veredelung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 518
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Neal Shusterman
Scythe
Die Hüter des Todes
Über dieses Buch
Unsterblichkeit, Wohlstand, unendliches Wissen – Citra und Rowan leben in einer Welt, in der Armut, Kriege, Krankheit und Tod besiegt sind. Aber auch in dieser perfekten Welt müssen Menschen sterben, und die Entscheidung über Leben und Tod treffen die Scythe – eine Dienstleistung, für die sie hoch geachtet und gleichzeitig gefürchtet sind.
Die Scythe erweisen der neuen Welt einen unentbehrlichen Dienst. Sie sind auserwählt, um zu töten. Sie entscheiden, wer lebt und wer stirbt. Und sie erfüllen damit eine Art heiliger Mission. Aber die Welt muss wissen, dass dieser Dienst sie nicht kalt lässt, dass sie Mitleid empfinden. Reue. Unerträglich großes Leid. Denn wenn sie diese Gefühle nicht hätten, wären sie Monster.
Als Citra und Rowan gegen ihren Willen für die Ausbildung zum Scythe berufen werden und die Kunst des Tötens erlernen, wächst zwischen den beiden eine tiefe Verbindung. Doch am Ende wird nur einer von ihnen auserwählt. Und seine erste Aufgabe wird es sein, den jeweils anderen hinzurichten …
Weitere Informationen finden Sie unter www.fischer-sauerlaender.de
Biografie
Neal Shusterman, geboren 1962 in Brooklyn, USA, studierte in Kalifornien Psychologie und Theaterwissenschaften. Alle seine Romane sind internationale Bestseller und wurden vielfach ausgezeichnet. In Deutschland liegt bisher seine »Vollendet«-Serie vor. Mit »Scythe – Die Hüter des Todes« startet Shusterman eine neue Trilogie über den Preis der scheinbar perfekten Welt.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel Scythe – Arc of a Scythe bei Simon & Schuster Books for Young Readers, an imprint of Simon & Schuster Children's Publishing Devision, New York
Text copyright © 2016 by Neal Shusterman
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2017 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Zero Werbeagentur, München,nach einer Idee von Chloë Foglia unter Verwendung einer Illustration von Kevin Tong
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-7336-5015-5
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
Teil Eins Robe und Ring
1 Kein Verdunkeln der Sonne
2 0,303 %
3 Die Macht des Schicksals
4 Lehrlingserlaubnis zum Töten
5 »Aber ich bin doch erst sechsundneunzig …«
Teil Zwei Nur die folgenden Gesetze gelten
Die Gebote der Scythe
6 Eine Elegie der Scythe
7 Die Kunst des Tötens
8 Eine Frage des Ermessens
9 Esme
10 Verbotene Antworten
11 Unbesonnenheiten
12 Kein Platz für Mittelmäßigkeit
13 Frühlingskonklave
14 Eine kleine Bedingung
15 Der Zwischenraum
16 Pool-Boy
17 Das Siebte Gebot
Teil Drei Die alte Garde und die neue Ordnung
18 Falling Water
19 Ein schreckliches Vergehen
20 Ehrengast
21 Gebrandmarkt
22 Zeichen des Zweizacks
23 Der virtuelle Kaninchenbau
24 Eine Schande für alles, was wir sind und darstellen
25 Hüter des Todes
26 Nicht wie die anderen
27 Herbstkonklave
28 Wasserstoff, der im Herzen der Sonne brennt
29 Früher hieß es Gefängnis
Teil Vier MidMerikanischer Flüchtling
30 Dialog mit den Toten
31 Eine Ader unbeugsamer Torheit
32 Pilgerreise mit Hindernissen
33 Botin und Nachricht zugleich
34 Das Zweitschmerzhafteste, das du jemals wirst tun müssen
35 Auslöschung ist unser Markenzeichen
36 Die dreizehnte Jagdbeute
Teil Fünf Scythetum
37 Am Baum rütteln
38 Die letzte Prüfung
39 Winterkonklave
40 Die Ordinierten
Danksagung
[Leseprobe]
Charta des Lebens
Teil eins In dreifacher Ausfertigung
1. Connor
Für Olga (Ludovika) Nødtvedt, Fan und Freundin in der Ferne
Teil EinsRobe und Ring
Wir müssen von Rechts wegen Buch führen über die Unschuldigen, die wir töten.
Und in meinen Augen sind sie alle unschuldig. Sogar die Schuldigen. Jeder trägt irgendeine Schuld, und jeder hat noch eine Erinnerung an die Unschuld der Kindheit, egal wie viele Schichten von Leben sich darumgewickelt haben. Die Menschheit ist unschuldig, die Menschheit ist schuldig, und beide Zustände sind unbestreitbar wahr.
Wir müssen von Rechts wegen Buch führen.
Es beginnt mit dem ersten Tag unserer Lehre – aber offiziell nennen wir es nicht töten. Diese Bezeichnung ist gesellschaftlich und moralisch inkorrekt. Von Anfang an und bis heute heißt es nachlesen, nach der Art, wie die Armen in biblischen Zeiten den Wegen der Weinbauern gefolgt sind, um einzelne vergessene Reben aufzulesen. Es war die früheste Form der Wohlfahrt. Genauso ist die Arbeit eines Scythe. Sobald ein Kind alt genug ist zu verstehen, wird ihm erklärt, dass Scythe einen unentbehrlichen Dienst für die Gesellschaft leisten. Unsere Arbeit kommt einer heiligen Mission so nahe, wie die moderne Welt sie überhaupt kennt.
Vielleicht müssen wir deshalb von Rechts wegen Buch führen. Ein öffentliches Protokoll, das Zeugnis ablegt, warum wir Menschen die Dinge tun, die wir tun – für jene, die niemals sterben, und jene, die noch geboren werden. Wir sind angehalten, nicht nur unsere Taten, sondern auch unsere Gefühle aufzuschreiben, weil bekannt sein muss, dass wir Gefühle haben. Bedauern. Reue. Trauer, zu groß, um sie zu ertragen. Denn wenn wir diese Gefühle nicht hätten, was für Monster wären wir?
Aus dem Nachlese-Tagebuch der E.S. Curie
1Kein Verdunkeln der Sonne
Der Scythe kam spät an einem kalten Novembernachmittag. Citra saß am Esstisch und quälte sich mit einer besonders kniffligen Mathematikaufgabe, schob Variablen hin und her, ohne eine Lösung für X oder Y zu finden, als diese neue, sehr viel bösartigere Variable in die Gleichung ihres Lebens trat.
Die Terranovas hatten oft Besuch, deshalb gab es kein Gefühl von Vorahnung, als es an der Wohnungstür klingelte – kein Verdunkeln der Sonne, das die Ankunft des Todes vor ihrer Tür angekündigt hätte. Vielleicht sollte das Universum sich dazu herablassen, solche Warnungen zu erteilen, doch im großen Plan der Dinge waren Scythe nicht übernatürlicher als Steuereintreiber. Sie tauchten auf, gingen ihrem unangenehmen Geschäft nach und waren wieder verschwunden.
Ihre Mutter machte die Tür auf. Citra sah den Besucher nicht, weil er zunächst durch die geöffnete Tür verdeckt war. Sie sah bloß, wie ihre Mutter dastand, plötzlich unbeweglich, als hätten ihre Blutbahnen sich verfestigt und sie würde, wenn man ihr einen Stoß versetzte, umfallen und auf dem Boden zerschellen.
»Darf ich hereinkommen, Mrs Terranova?«
Die Stimme des Besuchers verriet ihn. Volltönend und unausweichlich wie der dumpfe Ton einer eisernen Glocke, voller Zuversicht in die eigene Fähigkeit, all jene zu erreichen, die erreicht werden sollten. Noch bevor sie ihn sah, wusste Citra, dass er ein Scythe war. Mein Gott! Ein Scythe ist zu uns nach Hause gekommen!
»Ja, ja, natürlich, kommen Sie herein.« Citras Mutter trat beiseite, um ihn vorgehen zu lassen, als wäre sie die Besucherin und nicht er.
Er trat über die Schwelle, seine weichen, slipperartigen Schuhe machten kein Geräusch auf dem Parkett. Seine vielschichtige Robe war aus glattem elfenbeinfarbenem Leinen, und obwohl ihr Saum über den Boden streifte, war sie absolut makellos. Scythe konnten die Farbe ihrer Robe frei wählen, wie Citra wusste – alles bis auf Schwarz, denn das galt als unangemessen für ihre Profession. Schwarz, das war die Abwesenheit von Licht, und Scythe waren das Gegenteil. Sie waren lichtvoll und erleuchtet, sie galten als Krone der Menschheit – deshalb wurden sie auch für ihren Beruf erwählt.
Manche Scythe-Roben leuchteten, andere waren eher matt. Wie die üppigen fließenden Roben von Renaissance-Engeln schienen sie gleichzeitig schwer und leichter als Luft. Unabhängig von Stoff und Farbe, waren Scythe am einzigartigen Schnitt ihres Gewandes in der Öffentlichkeit leicht zu erkennen, so dass man ihnen gut aus dem Weg gehen konnte – wenn man denn wollte. Ebenso viele fühlten sich von ihnen angezogen.
Die Farbe der Robe sagte häufig etwas über die Persönlichkeit eines Scythe aus. Das elfenbeinfarbene Gewand dieses Scythe war angenehm, weit genug entfernt von einem echten Weiß, das die Augen mit seiner Helligkeit schmerzte. Aber das änderte nichts daran, wer und was er war.
Er schlug seine Kapuze zurück und enthüllte sauber frisiertes graues Haar, ein trauriges Gesicht mit von der Kälte roten Wangen und dunklen Augen, die für sich schon fast wie Waffen wirkten. Citra erhob sich. Nicht aus Respekt, sondern aus Angst. Unter Schock. Sie versuchte, nicht zu hyperventilieren, gab sich alle Mühe, keine weichen Knie zu kriegen, die sie jedoch mit ihrem Zittern verrieten. Sie spannte mit aller Kraft ihre Muskeln an. Was immer der Scythe hier wollte, er würde sie nicht zusammenbrechen sehen.
»Sie dürfen die Tür schließen«, sagte er zu Citras Mutter. Citra sah, wie schwer es ihr fiel. Solange die Tür offen stand, konnte ein Scythe im Flur noch umkehren. In dem Moment aber, in dem sie geschlossen wurde, war er endgültig bei einem zu Hause.
Der Scythe sah sich um und entdeckte Citra sofort. Er lächelte. »Hallo, Citra«, sagte er. Die Tatsache, dass er ihren Namen kannte, ließ sie genauso erstarren wie seine Erscheinung zuvor ihre Mutter.
»Sei nicht so unhöflich«, sagte ihre Mutter zu hastig. »Begrüße unseren Gast.«
»Guten Tag, Euer Ehren.«
»Hi«, sagte ihr jüngerer Bruder Ben, der an die Tür seines Zimmers gekommen war, nachdem er die tief dröhnende Stimme des Scythe gehört hatte. Er brachte die einsilbige Begrüßung nur mit Mühe und einem Quieken hervor, blickte von Citra zu seiner Mutter und dachte das Gleiche wie sie. Für wen ist er gekommen? Werde ich es sein? Oder werde ich zurückbleiben, um den Verlust zu betrauern?
»Ich habe im Flur einen einladenden Duft gerochen«, sagte der Scythe und atmete tief ein. »Nun sehe ich, dass ich richtig vermutet habe, dass er aus dieser Wohnung kommt.«
»Ich habe gerade einen Makkaroni-Auflauf gemacht. Nichts Besonderes.« Bis zu diesem Moment hatte Citra nicht gewusst, dass ihre Mutter so ängstlich sein konnte.
»Das ist gut«, sagte der Scythe, »denn ich brauche nichts Besonderes.« Dann setzte er sich auf das Sofa und wartete geduldig auf das Abendessen.
War es zu viel zu glauben, dass der Mann lediglich wegen einer Mahlzeit hier war? Schließlich mussten auch Scythe irgendwo essen. In Restaurants wurde ihnen das Servierte üblicherweise nicht in Rechnung gestellt, doch das bedeutete nicht, dass Hausmannskost zur Abwechslung nicht begehrenswerter sein konnte. Es gab Gerüchte von Scythe, die von ihren Opfern verlangten, ihnen eine Mahlzeit zu bereiten, bevor sie nachgelesen wurden. War es das, was hier passierte?
Was immer die Absichten des Scythe sein mochten, er behielt sie für sich, und sie hatten keine andere Wahl, als ihm zu geben, wonach er verlangte. Würde er jemanden verschonen, wenn das Essen nach seinem Geschmack war?, fragte Citra sich. Kein Wunder, dass die Leute sich überschlugen, um einem Scythe in jeder erdenklichen Weise gefällig zu sein. Hoffnung im Schatten von Angst ist die stärkste Motivation auf der Welt.
Auf seine Bitte hin brachte Citras Mutter ihm etwas zu trinken und gab sich nun alle Mühe, damit das heutige Abendessen das köstlichste werden würde, das sie je zubereitet hatte. Sie war keine leidenschaftliche Köchin. Normalerweise kam sie gerade rechtzeitig von der Arbeit nach Hause, um schnell irgendetwas zusammenzurühren. Aber heute Abend könnte ihr Leben von ihren fragwürdigen Kochkünsten abhängen. Und was war mit ihrem Vater? Würde er rechtzeitig heimkehren, oder würde die Nachlese in der Familie in seiner Abwesenheit stattfinden?
Trotz ihrer Furcht wollte Citra den Scythe nicht mit seinen Gedanken allein lassen, also ging sie mit ihm ins Wohnzimmer. Ben, der offensichtlich ebenso fasziniert wie verängstigt war, setzte sich neben sie.
Der Mann stellte sich schließlich als Ehrenwerter Scythe Faraday vor.
»Ich … ähm … hab in der Schule mal ein Referat über Faraday gehalten«, sagte Ben, und seine Stimme brach nur einmal. »Sie haben sich nach einem coolen Wissenschaftler benannt.«
Scythe Faraday lächelte. »Ich hoffe, einen angemessenen historischen Patron gewählt zu haben. Wie viele Wissenschaftler wurde Michael Faraday zu Lebzeiten zu wenig geschätzt, doch ohne ihn wäre unsere Welt nicht, was sie ist.«
»Ich glaube, ich habe Sie in meiner Scythe-Sammlung«, plapperte Ben weiter. »Ich habe fast alle midMerikanischen Scythe –, aber auf dem Bild waren Sie noch jünger.«
Der Mann sah aus wie etwa sechzig, sein Haar war schon völlig ergraut, sein Kinnbärtchen jedoch noch grau-schwarz meliert. Es war selten, dass ein Mensch sich so alt werden ließ, ohne sich auf ein jüngeres Ich zu resetten. Citra fragte sich, wie alt er tatsächlich war. Wie lange war er schon damit beauftragt, Leben zu beenden?
»Sehen Sie so alt aus, wie Sie wirklich sind, oder sind Sie aus eigener Wahl am fortgeschrittenen Ende der Zeitskala?«, fragte sie.
»Citra!« Ihre Mutter hätte um ein Haar die Auflaufform fallen lassen, die sie gerade aus dem Ofen nahm. »Wie kannst du so etwas fragen?«
»Ich mag direkte Fragen«, sagte der Scythe. »Sie zeugen von einem ehrlichen Geist, also werde ich ehrlich antworten. Ich gestehe, dass ich viermal über den Berg gekommen bin. Mein natürliches Alter liegt irgendwo bei einhundertachtzig, die exakte Zahl habe ich vergessen. Seit neuerem habe ich mich für diese ehrwürdige Erscheinung entschieden, weil ich feststelle, dass es für die Menschen, die ich nachlese, tröstlicher ist.« Dann lachte er. »Sie halten mich für weise.«
»Sind Sie deshalb hier?«, platzte Ben heraus. »Um einen von uns nachzulesen?«
Scythe Faraday schenkte ihm ein unergründliches Lächeln.
»Ich bin zum Abendessen hier.«
Citras Vater kam, als das Essen gerade aufgetragen werden sollte. Ihre Mom hatte ihn offenbar über die Situation informiert, so dass er emotional besser darauf vorbereitet war als sie vorhin. Sobald er die Wohnung betreten hatte, ging er zu Scythe Faraday, schüttelte ihm die Hand und gab sich viel jovialer und gastfreundlicher, als ihm zumute sein musste.
Die Mahlzeit verging hauptsächlich in verlegenem Schweigen, unterbrochen von Kommentaren des Scythe. »Sie haben ein wunderschönes Zuhause.« »Was für eine geschmackvolle Limonade!« »Das muss der beste Makkaroni-Auflauf in ganz MidMerica sein!« Und obwohl alles, was er sagte, ein Kompliment war, löste der Klang seiner Stimme bei allen jedes Mal ein seismisches Beben die Wirbelsäule hinunter aus.
»Ich habe Sie noch nie in der Gegend gesehen«, sagte Citras Vater schließlich.
»Ich wüsste auch nicht, wie und wann«, antwortete er. »Ich bin keine öffentliche Figur, so wie manch andere Scythe es anstreben. Einige Scythe suchen das Rampenlicht, aber um die Aufgabe angemessen zu erledigen, bedarf es einer gewissen Anonymität.«
»Angemessen?« Die bloße Vorstellung empörte Citra. »Es gibt eine angemessene Art nachzulesen?«
»Nun«, erwiderte er, »es gibt auf jeden Fall eine falsche.« Mehr sagte er nicht dazu, sondern aß bloß seine Makkaroni.
Als das Essen fast beendet war, sagte er: »Erzählen Sie mir etwas über sich.« Es war keine Frage oder Bitte. Man konnte es nur als Befehl deuten.
Citra war sich nicht sicher, ob es Teil seines kleinen Todestanzes war oder ob es ihn ehrlich interessierte. Ihre Namen kannte er schon, bevor er die Wohnung betreten hatte, also wusste er wahrscheinlich auch alles, was sie ihm erzählen konnten. Warum dann fragen?
»Ich arbeite in der historischen Forschung«, sagte ihr Vater.
»Ich bin Ingenieurin für Nahrungsmittelsynthese«, sagte ihre Mutter.
Der Scythe zog die Augenbrauen hoch. »Und doch haben Sie dieses Gericht selbst zubereitet.«
Sie legte ihre Gabel ab. »Alles aus synthetisierten Zutaten.«
»Aber wenn wir alles synthetisieren können«, erwiderte er, »wozu brauchen wir dann noch Ingenieure für Nahrungsmittelsynthese?«
Citra konnte förmlich sehen, wie das Blut aus dem Gesicht ihrer Mutter wich. Es war ihr Vater, der sich aufraffte, die Existenz seiner Frau zu verteidigen. »Es gibt immer Raum für Fortschritt.«
»Ja – und Dads Arbeit ist auch wichtig!«, sagte Ben.
»Was, historische Forschung?« Der Scythe wedelte abschätzig mit der Gabel. »Die Vergangenheit ändert sich nie – und die Zukunft nach allem, was ich sehe, auch nicht.«
Während die Bemerkung ihre Eltern verwirrte und beunruhigte, begriff Citra, was er sagen wollte. Die Entwicklung der Zivilisation war abgeschlossen. Das wusste jeder. Was die Menschheit betraf, gab es nichts Neues mehr zu erfahren. Nichts an ihrer Existenz musste noch enträtselt werden. Und das bedeutete, dass kein Mensch wichtiger war als irgendein anderer. Im großen Plan der Dinge war vielmehr jeder gleich nutzlos. Das wollte er ihnen sagen, und es machte Citra wütend, weil sie wusste, dass er in gewisser Weise recht hatte.
Citra war berüchtigt für ihre Wutausbrüche. Oft war ihr Zorn schneller als ihr logischer Verstand und verrauchte erst wieder, wenn der Schaden angerichtet war. Der heutige Abend sollte da keine Ausnahme bilden.
»Warum tun Sie das? Wenn Sie hier sind, um uns nachzulesen, dann bringen Sie es einfach hinter sich und hören auf, uns zu quälen!«
Ihrer Mutter stockte der Atem, ihr Vater schob seinen Stuhl zurück, als wollte er aufspringen und sie aus dem Zimmer werfen.
»Citra, was tust du?!« Die Stimme ihrer Mutter zitterte jetzt. »Zeig ein wenig Respekt!«
»Nein! Er ist hier, er wird es tun, also lasst ihn. Es ist schließlich nicht so, als hätte er sich nicht längst entschieden. Ich habe gehört, dass Scythe sich immer festlegen, bevor sie ein Haus betreten, ist das nicht so?«
Der Scythe wirkte von ihrem Ausbruch in keiner Weise beunruhigt. »Manche schon, andere nicht«, sagte er sanft. »Jeder von uns hat seine eigene Art.«
Ben hatte angefangen zu weinen. Dad legte seine Arme um ihn, doch der Junge war nicht zu trösten.
»Ja. Scythe müssen nachlesen«, sagte Faraday, »aber wir müssen auch essen und schlafen und einfache Unterhaltungen führen.«
Citra zog ihm seinen leeren Teller weg. »Nun, die Mahlzeit ist beendet, Sie können also gehen.«
Ihr Vater stand auf und fiel vor dem Scythe auf die Knie. Ihr Vater kniete tatsächlich vor dem Mann! »Bitte, Euer Ehren, vergeben Sie ihr. Ich übernehme die volle Verantwortung für ihr Benehmen.«
Der Scythe stand auf. »Eine Entschuldigung ist nicht nötig. Es ist erfrischend, zur Abwechslung mal Widerspruch zu hören. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie öde das wird, die Appelle und unterwürfigen Komplimente, die endlose Parade von Kriechern. Eine Ohrfeige ist stärkend. Sie erinnert mich daran, dass ich ein Mensch bin.«
Der Mann ging in die Küche und nahm das größte und schärfste Messer, das er finden konnte. Er schwang es durch die Luft, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich damit zustechen ließ.
Bens Jammern wurde lauter, die Umarmung seines Vaters fester. Der Scythe ging auf ihre Mutter zu. Citra war bereit, sich vor sie zu werfen, um die Klinge abzuwehren, doch anstatt das Messer zu heben, streckte der Mann seine andere Hand aus.
»Küssen Sie meinen Ring.«
Das hatte niemand erwartet, am allerwenigsten Citra.
Citras Mutter starrte ihn an und schüttelte ungläubig den Kopf. »Sie … Sie … verleihen mir Immunität?«
»Für Ihre Freundlichkeit und das Essen, das Sie mir serviert haben, gewähre ich Ihnen ein Jahr Immunität gegen Nachlese. Kein Scythe darf Sie anrühren.«
Aber sie zögerte. »Gewähren Sie sie lieber meinen Kindern.«
Der Scythe hielt ihr den Ring weiter hin. Es war ein Diamant von der Größe seines Fingerknöchels mit einem dunklen Kern, der gleiche Ring, den alle Scythe trugen.
»Ich biete sie Ihnen an, nicht Ihren Kindern.«
»Aber –«
»Jenny, mach es einfach!«, drängte ihr Vater.
Also tat sie es. Sie kniete nieder und küsste den Ring, ihre DNA wurde gescannt und an die Immunitäts-Datenbank des Scythetums übertragen. In einem Lidschlag wusste die ganze Welt, dass Jenny Terranova für die nächsten zwölf Monate vor Nachlese sicher war. Der Scythe blickte auf seinen Ring, der jetzt blass-rot leuchtete, um zu zeigen, dass die Person vor ihm Immunität genoss, und grinste zufrieden.
Und schließlich erzählte er ihnen die Wahrheit.
»Ich bin hier, um Ihre Nachbarin Bridget Chadwell nachzulesen«, informierte er sie. »Aber sie war nicht zu Hause. Und ich hatte Hunger.«
Scythe Faraday legte sanft eine Hand auf Bens Kopf, als würde er ihn irgendwie segnen, und offenbar beruhigte es den Jungen. Mit dem Messer in der Hand ging der Scythe zur Tür und ließ keinen Zweifel daran, wie er ihre Nachbarin nachlesen wollte. Bevor er ging, wandte er sich an Citra.
»Du schaust hinter die Fassaden der Welt, Citra Terranova. Du würdest eine gute Scythe abgeben.«
Citra wich entsetzt zurück. »Das würde ich nie sein wollen.«
»Das«, sagte er, »ist die wichtigste Voraussetzung.«
Dann ging er, um ihre Nachbarin zu töten.
Sie redeten an jenem Abend nicht darüber. Niemand sagte etwas von Nachlesen – als könnte man sie durch das bloße Aussprechen des Wortes heraufbeschwören. Von nebenan hörte man keinen Mucks. Keine Schreie und flehenden Klagen – oder vielleicht war der Fernseher der Terranovas auch zu laut gestellt. Das war das Erste, was Citras Vater machte, nachdem der Scythe gegangen war – er schaltete den Fernseher ein und drehte ihn laut, um das Nachlesen auf der anderen Seite der Wand zu übertönen. Es erwies sich jedoch als unnötig, denn wie immer der Scythe seine Aufgabe auch erledigte, es geschah leise. Citra ertappte sich dabei, die Ohren zu spitzen, um irgendetwas mitzukriegen. Sowohl sie als auch Ben entdeckten eine morbide Neugier in sich, die beide insgeheim beschämte.
Eine Stunde später kam der Ehrenwerte Scythe Faraday zurück. Diesmal öffnete Citra die Tür. Auf seiner elfenbeinfarbenen Robe war nicht der kleinste Blutspritzer. Vielleicht hatte er eine Robe zum Wechseln dabei. Vielleicht hatte er nach dem Nachlesen die Waschmaschine der Nachbarin benutzt. Auch das Messer, das er Citra zurückgab, war sauber.
»Wir wollen es nicht zurück«, erklärte sie und war sich ziemlich sicher, in diesem Punkt auch für ihre Eltern zu sprechen. »Wir werden es nie wieder benutzen.«
»Aber ihr müsst es benutzen«, beharrte er, »damit ihr euch daran erinnert.«
»Woran?«
»Ein Scythe ist nur das Werkzeug des Todes, doch ihr seid es, die meinen Arm bewegt. Du und deine Eltern und jeder andere auf dieser Welt führen die Hand der Scythe.« Dann legte er das Messer behutsam in ihre Hände. »Wir sind alle Komplizen. Diese Verantwortung müsst ihr teilen.«
Das mochte wahr sein, aber nachdem er gegangen war, warf Citra das Messer trotzdem in den Müll.
Es ist das Schwierigste, worum man einen Menschen bitten kann. Und das Wissen, dass es zum Nutzen eines größeren Guten ist, macht es nicht leichter. In früheren Zeiten sind die Leute eines natürlichen Todes gestorben. Alter war ein tödliches Gebrechen, kein vorübergehender Zustand. Es gab unsichtbare Mörder namens Krankheiten, die den Körper unwiderruflich niederstreckten. Altern ließ sich nicht rückgängig machen, und es gab Unfälle, von denen man nicht zurückkehrte. Flugzeuge fielen vom Himmel. Autos kollidierten. Es gab Schmerz, Leid, Elend und Verzweiflung. Vielen von uns fällt es schwer, sich eine derart unsichere Welt vorzustellen, in der an jeder Ecke unbemerkte, unvorhergesehene Gefahren lauern. All das liegt nun hinter uns, aber eine schlichte Wahrheit bleibt. Menschen müssen sterben.
Es ist nicht so, als könnten wir irgendwo anders hingehen, das haben die Katastrophen auf den Mond- und Mars-Kolonien bewiesen. Uns steht nur eine sehr begrenzte Welt zur Verfügung, und obwohl der Tod so vollständig besiegt worden ist wie die Kinderlähmung, müssen Menschen trotzdem sterben. Früher lag es in der Hand der Natur, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Aber wir haben es ihr abgenommen. Und nun haben wir das Monopol auf den Tod. Wir sind seine Hüter.
Ich verstehe, warum es Scythe gibt und wie wichtig und notwendig ihre Arbeit ist, aber ich frage mich oft, warum ich auserwählt werden musste. Und ob es nach dieser eine ewige Welt gibt und welches Schicksal die, die Leben beenden, dort erwartet.
Aus dem Nachlese-Tagebuch der E.S. Curie
20,303 %
Tyger Salazar hatte sich aus einem Fenster im neununddreißigsten Stock gestürzt und eine Riesensauerei auf der Marmorplaza hinterlassen. Seine eigenen Eltern waren so verärgert, dass sie ihn nicht besuchten. Aber Rowan besuchte ihn. Rowan Damisch war einfach so ein Freund.
Er saß an Tygers Bett im Revival-Zentrum und wartete, dass er aus der Turboheilung erwachte. Es machte Rowan nichts aus. Das Revival-Zentrum war still. Friedlich. Eine angenehme Erholung von dem Tumult bei ihm zu Hause, wo sich in jüngster Zeit mehr Verwandte drängten, als man einem Menschen zumuten sollte. Cousins und Cousinen ersten und zweiten Grades, Geschwister, Halbgeschwister. Und nun war auch noch seine Großmutter heimgekehrt, nachdem sie zum dritten Mal über den Berg gekommen war, mit neuem Mann und einem Baby unterwegs.
»Du wirst eine neue Tante bekommen, Rowan«, hatte sie verkündet. »Ist das nicht wundervoll?«
Die ganze Geschichte hatte Rowans Mutter verärgert – weil sich Grandma diesmal bis zurück auf fünfundzwanzig hatte resetten lassen und damit jetzt zehn Jahre jünger war als ihre Tochter. Nun fühlte Mum sich unter Druck, ebenfalls über den Berg zu kommen, und sei es nur, um mit Grandma mitzuhalten. Grandpa war da viel vernünftiger. Er war in EuroSkandia, charmierte die Damen und hielt sein Alter bei anständigen achtunddreißig.
Rowan, der jetzt sechzehn war, hatte beschlossen, dass er erst graue Haare kriegen wollte, bevor er zum ersten Mal über den Berg kommen würde – und dann würde er sich auch nicht so weit zurück resetten lassen, dass es peinlich war. Manche Leute ließen sich auf einundzwanzig resetten, das jüngste Alter, auf das die genetische Therapie einen Menschen zurücksetzen konnte. Allerdings gab es Gerüchte, dass an Verfahren gearbeitet wurde, sich auf unter zwanzig zu resetten – was Rowan lächerlich fand. Warum sollte irgendjemand mit gesundem Verstand sich wünschen, noch einmal ein Teenager zu sein?
Als er wieder zu seinem Freund blickte, waren Tygers Augen offen und sahen Rowan an.
»Hey«, sagte Rowan.
»Wie lange?«, fragte Tyger.
»Vier Tage.«
Tyger reckte triumphierend die Faust. »Ja! Neuer Rekord!« Er musterte seine Hände, als wollte er mögliche Schäden begutachten. Aber es war natürlich keiner geblieben. Man erwachte erst aus der Turboheilung, wenn es nichts mehr zu heilen gab. »Glaubst du, es lag am Stockwerk oder an dem Marmor auf der Plaza vor dem Gebäude?«
»Wahrscheinlich an dem Marmor«, erwiderte Rowan. »Wenn man die Endgeschwindigkeit erreicht hat, spielt es keine Rolle mehr, von wo man gesprungen ist.«
»Und hat es Risse gegeben? Musste der Marmor erneuert werden?«
»Ich weiß nicht, Tyler – mein Gott, es reichte auch so.«
Ungeheuer zufrieden mit sich, lehnte Tyger sich auf dem Kissen zurück. »Der beste Platscher aller Zeiten!«
Rowan merkte, dass er zwar ruhig hatte warten können, bis sein Freund aufwachte, aber nachdem jener nun wieder bei Bewusstsein war, hatte er keine Geduld mit ihm. »Warum machst du das überhaupt? Ich meine, es ist so eine Zeitverschwendung.«
Tyger zuckte die Achseln. »Ich mag das Gefühl auf dem Weg nach unten. Außerdem muss ich meine Eltern daran erinnern, dass das Salatblatt noch da ist.«
Darüber musste Rowan kichern. Er war es gewesen, der den Begriff Salatblatt-Kid erfunden hatte, um sie zu beschreiben. Beide waren irgendwo in der Mitte einer Schar von Kindern geboren und weit davon entfernt, die Lieblinge ihrer Eltern zu sein. »Ich habe ein paar Brüder, die sind das Fleisch, ein paar Schwestern, die sind Käse und Tomaten, also bin ich wohl das Salatblatt.« Die Idee hatte Anklang gefunden, und Rowan hatte einen Club namens Eisberg Heads gegründet, der sich inzwischen fast zwei Dutzend Mitglieder rühmte … obwohl Tyger oft scherzhaft drohte, demnächst abtrünnig zu werden und eine Romana-Revolte zu starten.
Mit dem Platschen hatte Tyger vor ein paar Monaten angefangen. Rowan hatte es einmal ausprobiert und fand, dass es ein Riesengenerve war. Am Ende war er mit den Aufgaben für die Schule in Rückstand geraten, seine Eltern hatten ihm alle möglichen Strafen auferlegt – und gleich wieder vergessen –, einer der Vorteile, ein Salatblatt zu sein. Trotzdem war der Kick beim Sturz den Preis nicht wert. Tyger hingegen war ein echter Platsch-Junkie geworden.
»Du musst dir ein neues Hobby suchen, Mann«, erklärte Rowan ihm. »Ich weiß, die Wiederbelebung ist kostenlos, aber der Rest muss deine Eltern doch ein Vermögen kosten.«
»Ja … und so müssen sie ihr Geld ausnahmsweise mal für mich ausgeben.«
»Wäre es dir nicht lieber, sie würden dir ein Auto kaufen?«
»Wiederbelebung ist verpflichtend«, sagte Tyger. »Ein Auto ist freiwillig. Wenn sie nicht gezwungen werden, Geld für mich auszugeben, tun sie es nicht.«
Dem konnte Rowan nicht widersprechen. Er hatte auch kein Auto und bezweifelte, dass seine Eltern ihm je eins kaufen würden. Die Publicars seien sauber und funktionierten einwandfrei, vollautomatisch und fahrerlos, hatten seine Eltern argumentiert. Wozu gutes Geld für etwas ausgeben, was er nicht brauchte? Derweil warfen sie ihr Geld in alle Richtungen aus dem Fenster, nur nicht in seine.
»Wir sind Ballaststoffe«, sagte Tyger. »Wenn wir nicht hin und wieder ein paar Darmprobleme verursachen, merkt keiner, dass wir da sind.«
Am nächsten Morgen begegnete Rowan von Angesicht zu Angesicht einem Scythe. Es konnte schon vorkommen, dass man in seinem Viertel einen Scythe traf, bisweilen kreuzte man zwangsläufig ihren Weg – aber in einer Highschool tauchten sie nur selten auf.
Rowan war selbst schuld, dass es zu der Begegnung kam. Pünktlichkeit war nicht seine Stärke – vor allem seit man von ihm auch noch erwartete, seine jüngeren Geschwister und Halbgeschwister zu ihrer Schule zu bringen, bevor er in ein Publicar sprang und zu seiner eigenen hetzte. Er war dort gerade eingetroffen und ging auf das Anwesenheitsfenster zu, als der Scythe mit wehender elfenbeinfarbener Robe um eine Ecke kam.
Auf einer Wanderung mit seiner Familie war Rowan einmal auf eigene Faust losgelaufen und einem Berglöwen begegnet. Damals hatte sich seine Brust genauso eingeschnürt angefühlt, seine Eingeweide genauso schwach. Kämpfen oder flüchten, hatte seine Biologie gesagt. Aber Rowan hatte keins von beidem getan. Er hatte diese Instinkte überwunden und ruhig die Arme gehoben, um sich größer zu machen, wie er es irgendwo gelesen hatte. Es hatte funktioniert, das Tier war davongelaufen und hatte ihm einen Trip ins örtliche Revival-Zentrum erspart.
Als er sich jetzt unvermittelt dem Scythe gegenübersah, drängte es Rowan, das Gleiche zu tun – als ob über den Kopf erhobene Hände einen Scythe verscheuchen könnten. Der Gedanke ließ ihn unwillkürlich laut lachen. Was vor einem Scythe wahrscheinlich auch keine gute Idee war.
»Könntest du mir den Weg zum Sekretariat weisen?«, fragte der Mann.
Rowan überlegte kurz, ihm den Weg zu erklären und dann in die andere Richtung zu verschwinden, doch das kam ihm feige vor. »Ich bin auch auf dem Weg dorthin«, sagte er. »Ich bringe Sie.« Der Mann würde seine Hilfsbereitschaft zu schätzen wissen – und sich mit einem Scythe gutzustellen konnte nicht schaden.
Rowan ging voran, vorbei an anderen Schülern in der Halle, die wie er zu spät gekommen waren oder irgendetwas zu erledigen hatten. Alle gafften und versuchten, mit der Wand zu verschmelzen, als er mit dem Scythe vorüberging. Irgendwie machte es ihm weniger Angst, mit dem Scythe durch die Flure zu laufen, wenn es andere gab, die die Furcht übernahmen – Rowan musste zugeben, dass er es sogar ein wenig berauschend fand, als Wegbereiter eines Scythe zu fungieren und auf dem Strahl des Respekts zu schweben, der jenem entgegenschlug. Erst als sie im Sekretariat ankamen, wurde ihm schlagartig bewusst, dass der Scythe heute einen seiner Mitschüler nachlesen würde.
Im Sekretariat sprangen alle sofort auf, als sie den Scythe sahen, und er verschwendete keine Zeit. »Bitte lassen Sie unverzüglich Kohl Whitlock ins Sekretariat rufen.«
»Kohl Whitlock?«, fragte die Sekretärin.
Der Scythe wiederholte sich nicht, weil er wusste, dass sie ihn verstanden hatte – sie wollte es bloß nicht glauben.
»Ja, Euer Ehren, sofort.«
Rowan kannte Kohl. Verdammt, jeder kannte Kohl Whitlock. Er war erst im vorletzten Jahrgang und schon zum Quarterback der Schule aufgestiegen. Er würde sie zum ersten Mal seit Ewigkeiten zur Meisterschaft führen.
Die Stimme der Sekretärin bebte heftig, als sie die Durchsage machte. Als sie den Namen nannte, hustete und verschluckte sie sich.
Dann wartete der Scythe geduldig auf Kohls Eintreffen.
Einen Scythe gegen sich aufzubringen war bestimmt das Letzte, was Rowan wollte. Deshalb hätte er sich einfach zum Anwesenheitsfenster verdrücken sollen, sich die Wiederzulassung abholen und in seine Klasse gehen sollen. Aber er musste unbedingt seine Stimme erheben. Es war ein Moment, der sein Leben verändern sollte.
»Sie wissen hoffentlich, dass Sie unseren Star-Quarterback nachlesen.«
Das einen Augenblick zuvor noch so freundliche Gebaren des Scythe schlug ins Grabsteinartige um. »Ich kann nicht erkennen, dass dich das etwas angehen würde.«
»Sie sind in meiner Schule«, sagte Rowan. »Ich denke, dadurch geht es mich schon was an.« Erst dann schaltete sich sein Selbsterhaltungstrieb ein. Er murmelte leise: »Dumm, dumm, dumm«, schlenderte zu dem Anwesenheitsfenster knapp außerhalb des Blickfelds des Scythe und gab die gefälschte Entschuldigung ab. Zum Glück war Rowan nicht in einer Zeit geboren, in der es noch einen natürlichen Tod gab, weil er es sonst wahrscheinlich nie bis ins Erwachsenenalter geschafft hätte.
Als er das Sekretariat gerade verlassen wollte, sah er, wie der trübe dreinblickende Kohl Whitlock von dem Scythe in das Büro des Direktors geführt wurde, das jener freiwillig räumte. Er sah seine Angestellten fragend an, erhielt jedoch nur ein tränenreiches Kopfschütteln zur Antwort.
Niemand schien zu bemerken, dass Rowan immer noch herumlungerte. Wen kümmerte das Salatblatt, wenn das Fleisch gefressen wurde?
Er drückte sich an dem Direktor vorbei, der ihn jedoch noch entdeckte und eine Hand auf seine Schulter legte. »Da willst du lieber nicht reingehen, Junge.«
Er hatte recht. Rowan wollte nicht reingehen. Aber er tat es trotzdem und schloss die Tür hinter sich.
Vor dem aufgeräumten Schreibtisch des Direktors standen zwei Stühle. Auf dem einen saß der Scythe, auf dem anderen, zusammengesunken und schluchzend, Kohl. Der Scythe warf Rowan einen wütenden Blick zu.
Der Berglöwe, dachte Rowan. Nur dass dieser hier tatsächlich die Macht hatte, ein menschliches Leben zu beenden.
»Seine Eltern sind nicht hier«, sagte Rowan. »Jemand sollte bei ihm sein.«
»Bist du mit ihm verwandt?«
»Spielt das eine Rolle?«
Dann hob Kohl den Kopf. »Bitte, zwingen Sie Ronald nicht zu gehen«, flehte er.
»Ich heiße Rowan.«
In Kohls Miene machte sich schieres Entsetzen breit, als hätte sein Irrtum die Sache irgendwie endgültig besiegelt. »Das wusste ich! Wirklich! Ich wusste es wirklich!« Trotz seiner imposanten Statur und seiner Großspurigkeit war Kohl Whitlock im Grunde nur ein verängstigtes kleines Kind. Wurde das vor seinem Ende jeder? Rowan nahm an, dass diese Frage nur ein Scythe beantworten konnte.
Anstatt Rowan zum Verlassen des Raumes zu zwingen, sagte der Scythe: »Dann setz dich. Mach’s dir bequem.«
Rowan ging um den Schreibtisch, um sich den Stuhl des Direktors vorzuziehen, und fragte sich, ob der Scythe ironisch oder sarkastisch war oder schlicht nicht wusste, dass man es sich in seiner Gegenwart nicht bequem machen konnte.
»Das können Sie mir nicht antun«, bettelte Kohl. »Meine Eltern werden sterben! Sie werden einfach sterben!«
»Nein, werden sie nicht«, korrigierte der Scythe. »Sie werden weiterleben.«
»Können Sie ihm wenigstens ein paar Minuten zur Vorbereitung lassen?«, fragte Rowan.
»Willst du mir erzählen, wie ich meinen Beruf ausüben soll?«
»Ich bitte Sie um ein wenig Gnade!«
Wieder starrte der Scythe Rowan wütend an, doch diesmal war es irgendwie anders. Er wollte ihn nicht bloß einschüchtern, sondern ihm auch etwas entlocken. Er blickte tief in sein Inneres. »Ich mache das schon seit vielen Jahren«, sagte er. »Meiner Erfahrung nach ist eine schnelle und schmerzlose Nachlese die größte Gnade, die ich gewähren kann.«
»Dann nennen Sie ihm wenigstens einen Grund! Sagen Sie ihm, warum er es sein muss!«
»Es ist willkürlich, Rowan!«, rief Kohl. »Das weiß jeder! Einfach scheißwillkürlich!«
Aber der Blick des Scythe sagte etwas anderes. Also drängte Rowan weiter.
»Da steckt mehr dahinter, oder?«
Der Scythe seufzte. Er musste nichts sagen … als Scythe stand er in jeder Weise über dem Gesetz. Er schuldete niemandem eine Erklärung. Aber er entschied sich, eine zu geben.
»Laut Statistiken aus der Sterblichkeitsära kam es, wenn man Tod durch Altersschwäche herausrechnet, zu 7 Prozent aller Todesfälle im Straßenverkehr. Bei 31 Prozent dieser Unfallopfer war Alkoholgenuss ein Faktor, und davon waren wiederum 14 Prozent Teenager.« Er warf Rowan einen kleinen Taschenrechner vom Schreibtisch des Direktors zu. »Rechne es selbst aus.«
Rowan nahm sich Zeit, die Zahlen einzugeben, weil er wusste, dass jede Sekunde, die er brauchte, ein Sekunde Leben bedeutete, die er für Kohl herausschund.
»0,303 Prozent«, erklärte er schließlich.
»Das bedeutet«, sagte der Scythe, »dass von tausend Seelen, die ich nachlese, drei diesem Profil entsprechen. Einer von dreihundertdreiunddreißig. Dein Freund hier hat gerade einen neuen Wagen bekommen, sein exzessiver Alkoholgenuss ist aktenkundig. Und unter allen Teenagern, die diesem Profil entsprechen, habe ich eine willkürliche Wahl getroffen.«
Kohl vergrub das Gesicht in den Händen, seine Tränen flossen reichlicher. »Ich bin so ein IDIOT!« Er presste seine Handballen auf die Augen, als wollte er sie tief in seinen Kopf drücken.
»Und sag mir«, wandte sich der Scythe ruhig an Rowan, »hat diese Erklärung seine Nachlese erträglicher oder sein Leiden schlimmer gemacht?«
Rowan schrumpfte ein wenig auf seinem Stuhl.
»Genug«, sagte der Scythe. »Es ist Zeit.« Dann zog er aus einer Tasche seiner Robe einen gepolsterten Handschuh, den er überstreifte. Die Rückseite war aus Stoff, die Handfläche aus einem glänzenden Metall. »Kohl, ich habe für dich einen Schock ausgewählt, der zum Herzstillstand führen wird, schmerzlos und nicht annähernd so brutal, wie es der Autounfall gewesen wäre, den du in der Sterblichkeitsära erlitten hättest.«
Kohl streckte plötzlich den Arm aus, packte Rowans Hand und hielt sie fest. Rowan ließ ihn. Er war kein Verwandter, bis heute war er nicht einmal Kohls Freund gewesen – aber wie lautete die Redensart? Der Tod macht alle Menschen gleich. Er drückte Kohls Hand fester – ein stummes Versprechen, dass er nicht loslassen würde.
»Soll ich den Leuten irgendwas sagen?«, fragte Rowan.
»Eine Million Sachen«, antwortete Kohl. »Aber sie fallen mir alle nicht ein.«
Rowan beschloss, dass er Kohls letzte Worte erfinden würde, um sie mit seinen Lieben zu teilen. Und es würden schöne Worte sein. Tröstende. Rowan würde einen Weg finden, dem Sinnlosen einen Sinn zu geben.
»Ich fürchte, für die Prozedur musst du seine Hand loslassen«, sagte der Scythe.
»Nein«, erklärte Rowan ihm.
»Der Schock könnte auch dein Herz aussetzen lassen«, warnte ihn der Scythe.
»Na und?«, gab Rowan zurück. »Man wird mich wiederbeleben. Wenn Sie nicht beschlossen haben, mich gleich mit nachzulesen«, fügte er hinzu.
Rowan war sich bewusst, dass er gerade einen Scythe herausgefordert hatte, ihn zu töten. Trotz des Risikos war er froh, es getan zu haben.
»Also gut.« Und ohne einen Augenblick länger zu warten, drückte der Scythe den Handschuh auf Kohls Brust.
Vor Rowans Augen wurde es erst weiß und dann schwarz. Sein ganzer Körper krampfte sich zusammen. Er wurde rückwärts aus seinem Stuhl gegen die Wand hinter ihm geschleudert. Für Kohl war es vielleicht schmerzlos, aber nicht für Rowan. Es tat mehr weh als alles andere – mehr, als ein Mensch ertragen sollte –, doch dann schütteten die mikroskopisch kleinen, schmerzstillenden Naniten in seinem Blutsystem ihre betäubenden Opiate aus. Als sie wirkten, klarte sich Rowans Blickfeld, und er sah Kohl zusammengesunken auf seinem Stuhl sitzen. Der Scythe streckte die Hand aus und schloss seine blicklosen Augen. Die Nachlese war abgeschlossen. Kohl Whitlock war tot.
Der Scythe erhob sich und bot Rowan eine Hand an, um ihm aufzuhelfen. Rowan nahm sie nicht, sondern rappelte sich aus eigener Kraft auf die Füße und sagte, obwohl er keinen Funken Dankbarkeit empfand: »Vielen Dank, dass ich bleiben durfte.«
Der Scythe betrachtete ihn ein wenig zu lange und erwiderte: »Du hast dich starkgemacht für einen Jungen, den du kaum kanntest. Du hast ihn im Moment seines Todes getröstet und den Schmerz des Stromstoßes ertragen. Du hast etwas mit angesehen, obwohl niemand dich dazu aufgefordert hat.«
Rowan zuckte die Schultern. »Ich habe bloß getan, was jeder gemacht hätte.«
»Hat sich sonst jemand angeboten?«, gab der Scythe zu bedenken. »Dein Direktor? Das Büropersonal? Einer der Dutzend Schüler, an denen wir im Flur vorbeigekommen sind?«
»Nein …«, musste Rowan zugeben. »Aber was für eine Rolle spielt es, was ich getan habe? Er ist trotzdem tot. Und Sie wissen ja, was man über gute Absichten sagt.«
Der Scythe nickte und blickte auf den Ring, der fett an seinem Finger prangte. »Ich nehme an, nun wirst du mich um Immunität bitten.«
Rowan schüttelte den Kopf. »Ich will gar nichts von Ihnen.«
»Na gut.« Der Scythe wandte sich zum Gehen, blieb an der Tür jedoch noch einmal stehen. »Aber sei gewarnt, dass du für das, was du hier heute getan hast, von niemandem außer mir Freundlichkeit zu erwarten hast«, sagte er. »Und vergiss nicht: Gute Vorsätze und Absichten pflastern viele Wege. Nicht alle von ihnen führen in die Hölle.«
Die Ohrfeige tat fast so weh wie der Elektroschock – oder noch mehr, weil Rowan sie nicht hatte kommen sehen. Sie erwischte ihn kurz vor dem Mittagessen, als er vor seinem Spind stand, und traf ihn mit solcher Wucht, dass er gegen die Reihe von Schränken hinter ihm prallte, die wie eine Steel Drum widerhallten.
»Du warst dabei und hast es nicht verhindert!« Marah Pavliks Blick loderte vor Trauer und rechtschaffener Empörung. Sie sah aus, als wollte sie ihre langen Fingernägel in seine Nasenlöcher bohren und sein Gehirn herauszerren. »Du hast ihn sterben lassen.«
Marah war seit mehr als einem Jahr Kohls Freundin gewesen. Wie er war sie im vorletzten Jahrgang und immens beliebt, deshalb würde sie normalerweise jeden Umgang mit dem Pöbel aus dem Jahrgang darunter wie Rowan und seinesgleichen aktiv vermeiden. Aber dies waren außergewöhnliche Umstände.
»So war es nicht«, brachte Rowan hervor, bevor sie erneut ausholte. Diesmal konnte er ihre Hand abwehren. Dabei brach einer ihrer Fingernägel ab, was ihr jedoch offenbar egal war. Kohls Nachlese hatte ihr zumindest einen großen Auftritt beschert.
»Es war genau so! Du bist da reingegangen und hast zugeguckt, wie er gestorben ist!«
Andere Schüler hatten sich um sie geschart, angelockt von der Witterung des Streits. Rowan suchte ein mitfühlendes Gesicht in der Menge – jemanden, der sich auf seine Seite schlagen könnte –, doch in den Mienen seiner Mitschüler lag eine gemeinschaftliche Verachtung. Marah sprach und schlug für sie alle.
Das hatte Rowan nicht erwartet. Er hatte sich kein allseitiges Schulterklopfen erhofft, weil er Kohl in seinen letzten Momenten zu Hilfe gekommen war, doch auf eine so undenkbare Anschuldigung war er nicht vorbereitet.
»Bist du verrückt oder was?«, brüllte er Marah und alle anderen an. »Man kann einen Scythe nicht davon abhalten, nachzulesen.«
»Das ist mir egal!«, jammerte sie. »Du hättest irgendwas machen können, aber du hast nur zugeguckt!«
»Ich habe etwas getan! Ich … ich habe seine Hand gehalten.«
Mit mehr Kraft, als sie eigentlich in sich haben konnte, stieß sie ihn noch einmal gegen den Spind. »Du lügst! Er hätte nie deine Hand gehalten. Er hätte dich überhaupt nicht angefasst!« Und dann: »Ich hätte seine Hand halten sollen!«
Die anderen Kids um sie herum starrten Rowan wütend an und flüsterten sich Dinge zu, die er offensichtlich mitkriegen sollte.
»Ich habe gesehen, wie er mit dem Scythe durch die Halle gegangen ist, als wären sie beste Freunde.«
»Sie sind heute Morgen zusammen in die Schule gekommen.«
»Ich habe gehört, dass er dem Scythe bei der Auswahl geholfen hat, wen er nachlesen soll.«
»Ich habe gehört, er hätte sogar bei der Nachlese geholfen.«
Rowan stürzte auf den Jungen zu, der die letzte Anschuldigung geäußert hatte – Ralphy soundso. »Von wem hast du das gehört? Es war sonst niemand im Raum, du Hirni!«
Aber das spielte keine Rolle. Gerüchte folgten keiner Logik außer ihrer eigenen.
»Kapiert ihr nicht? Ich habe nicht dem Scythe geholfen, ich habe Kohl geholfen!«, beharrte Rowan.
»Ja, ins Grab«, sagte jemand, und alle murmelten zustimmend.
Es war zwecklos – man hatte ihm den Prozess gemacht und ihn für schuldig befunden –, und je heftiger er leugnete, desto mehr würde sie das von seiner Schuld überzeugen. Sie hatten keinen Bedarf an seiner Heldentat, sie brauchten jemanden, dem sie die Verantwortung zuschieben, den sie hassen konnten. An dem Scythe konnten sie ihren Zorn nicht auslassen, doch Rowan Damisch war der perfekte Kandidat.
»Ich wette, er hat für seine Hilfe Immunität gekriegt«, sagte ein Junge, der immer sein Freund gewesen war.
»Hab ich nicht!«
»Gut«, sagte Marah mit absoluter Verachtung. »Dann hoffe ich, der nächste Scythe kommt deinetwegen.«
Er wusste, dass sie es ernst meinte – nicht nur in dem Moment, sondern für immer –, und wenn der nächste Scythe seinetwegen kommen würde, würde sie sich freuen, von seinem Tod zu erfahren. Es war ein düster, ernüchternder Gedanke, dass es nun Menschen auf der Welt gab, die seinen Tod wünschten. Unbemerkt zu bleiben war eine Sache, Objekt der Feindschaft einer ganzen Schule zu sein eine vollkommen andere.
Erst da fiel ihm die Warnung des Scythe wieder ein, dass er für das, was er für Kohl getan hatte, keine Freundlichkeit erwarten dürfte. Der Mann hatte recht gehabt – und dafür hasste Rowan den Scythe, so wie die anderen ihn hassten.
2042. Es ist eine Jahreszahl, die jeder Schüler kennt. Es war das Jahr, in dem die Rechenkraft der Computer unendlich wurde – oder so nahe an unendlich, dass man die Differenz nicht mehr messen konnte. Es war das Jahr, in dem wir … alles wussten. Die Cloud entwickelte sich zum Thunderhead, und nun ruht alles, was es über alles zu wissen gibt, in seinem beinahe unendlichen Speicher, wo jeder, der mag, darauf zugreifen kann.
Aber wie bei so vielen Dingen wurde das unendliche Wissen, nachdem wir es einmal besaßen, plötzlich anscheinend weniger wichtig. Ja, wir wissen alles, doch ich frage mich oft, ob irgendjemand sich die Mühe macht, all dieses Wissen zu betrachten. Natürlich gibt es Akademiker, die studieren, was wir schon wissen, aber wozu? Die ureigentliche Idee von Bildung bestand früher darin, etwas zu lernen, damit wir unser Leben und die Welt besser machen konnten. Aber eine perfekte Welt braucht keine Verbesserung. Wie fast alles, was wir tun, ist Bildung von der Grundschule bis zu den höchsten Universitäten nur etwas, um uns zu beschäftigen.
2042 ist das Jahr, in dem wir den Tod besiegt haben, und auch das Jahr, in dem wir aufgehört haben zu zählen. Sicher, für ein paar Jahrzehnte haben wir die Jahre weiter nummeriert, doch in dem Moment, in dem wir Unsterblichkeit erlangten, war das Verstreichen der Zeit belanglos geworden.
Ich weiß nicht genau, wann wir auf den chinesischen Kalender umgestellt haben – das Jahr des Hundes, das Jahr der Ziege, das Jahr des Drachen und so weiter. Und ich kann auch nicht sagen, wann genau Tieraktivisten auf der ganzen Welt begannen, gleiches Recht für ihre eigene Lieblingsgattung zu fordern und ein Jahr des Otters, des Wales und des Pinguins hinzufügten. Und ich könnte auch nicht sagen, wann ganz mit den Wiederholungen aufgehört und verfügt wurde, dass fortan jedes Jahr nach einer anderen Spezies benannt werden sollte. Sicher weiß ich nur, dass dies das Jahr des Ozelots ist.
Was die Dinge betrifft, die ich nicht weiß, stehen sie bestimmt alle im Thunderhead für jeden, der nachgucken will.
Aus dem Nachlese-Tagebuch der E.S. Curie
3Die Macht des Schicksals
Die Einladung erreichte Citra Anfang Januar. Sie kam mit der Post – das erste Anzeichen dafür, dass sie außergewöhnlich war. Es gab nur drei Arten von Sendungen, die mit der Post zugestellt wurden: Pakete, offizielle Dokumente und Briefe von Exzentrikern – die einzigen Menschen, die noch Briefe schrieben. Diese Sendung schien in die dritte Kategorie zu fallen.
»Nun mach schon auf«, sagte Ben, gespannter wegen des Umschlags als Citra. Die Adresse war handgeschrieben, was das Ganze noch seltsamer machte. Zwar gab es Handschrift noch als Wahlfach in der Schule, doch niemand, den Citra kannte, hatte es belegt. Sie riss den Umschlag auf, zog eine Karte im selben eierschalfarbenen Ton heraus und las sie erst still, bevor sie die Nachricht laut wiederholte.
Das Vergnügen Ihrer Gesellschaft wird erbeten am 9. Januar um sieben Uhr abends in der Grand Civic Opera.
Die Nachricht war nicht unterschrieben und hatte auch keinen Absender. Der Umschlag enthielt allerdings eine einzelne Eintrittskarte.
»In die Oper?«, fragte Ben. »Bäh.«
Citra war ganz seiner Meinung.
»Könnte es irgendeine Schulveranstaltung sein?«, fragte ihre Mutter.
Citra schüttelte den Kopf. »Dann würde es irgendwo stehen.«
Ihre Mutter nahm Citra den Umschlag ab, um ihn selbst zu betrachten. »Nun, was immer es ist, es klingt interessant.«
»Wahrscheinlich irgendein Loser, der mich auf diese Art um ein Date bittet, weil er Angst hat, mich direkt zu fragen.«
»Glaubst du, du wirst hingehen?«, fragte ihre Mutter.
»Mom … ein Junge, der mich in die Oper einlädt, macht entweder Witze oder leidet unter Wahnvorstellungen.«
»Oder er will dich beeindrucken.«
Citra verließ grunzend das Zimmer, verärgert über ihre eigene Neugier. »Ich gehe nicht!«, rief sie aus ihrem Zimmer, wohl wissend, dass sie es doch tun würde.
Die Grand Civic Opera war einer der Orte, wo jeder, der jemand war, hinging, um gesehen zu werden. Bei den Vorstellungen kam nur die Hälfte der regelmäßigen Besucher für die aufgeführte Oper. Der Rest wollte an dem großen Melodrama von gesellschaftlichem Aufstieg und Karrierebeförderung teilhaben. Sogar Citra, die sich in keinem dieser Kreise bewegte, kannte das Spiel.
Sie trug das Kleid, das sie für den Abschlussball im vergangenen Jahr gekauft hatte, als sie sicher gewesen war, dass Hunter Morrison sie einladen würde. Stattdessen hatte Hunter Zachary Swain eingeladen, was offenbar jeder außer Citra hatte kommen sehen. Die beiden waren noch immer zusammen, und bis heute hatte Citra keine Verwendung für das Kleid gehabt.
Als sie es anzog, war sie sehr viel zufriedener, als sie erwartet hatte. Mädchen im Teenageralter verändern sich im Laufe eines Jahres, und nun passte ihr das Kleid – das im Jahr zuvor mehr Wunschdenken gewesen war – wie angegossen.
Im Kopf hatte sie den Kreis ihrer geheimen Verehrer auf fünf eingegrenzt, und mit zweien von ihnen würde sie gern einen Abend allein verbringen. Die anderen drei würde sie um der Ungewöhnlichkeit des Anlasses willen ertragen. Schließlich konnte man durchaus Spaß dabei haben, einen Abend lang so tun, als würde man das Getue mitmachen.
Ihr Vater bestand darauf, sie zu fahren. »Ruf mich an, wenn du wieder abgeholt werden willst.«
»Ich nehme ein Publicar nach Hause.«
»Ruf mich trotzdem an«, sagte er. Er erklärte ihr zum zehnten Mal, dass sie wunderschön aussah, dann stieg sie aus, und er fuhr weiter, um Platz für die Limousinen und Bentleys in der Schlange vor dem Haltepunkt zu machen. Citra atmete tief ein und ging die Marmortreppe hinauf, sie fühlte sich so verlegen und fehl am Platz wie Cinderella bei dem Ball.
Als sie die Oper betrat, wurde sie weder zum Parkett noch zu der Treppe gewiesen, die zu den Rängen führte. Stattdessen studierte der Platzanweiser ihre Eintrittskarte, sah sie an und betrachtete erneut ihre Karte, bevor er einen zweiten Platzanweiser rief, der sie persönlich begleiten sollte.
»Was hat das alles zu bedeuten?«, fragte sie. Ihr erster Gedanke war, dass das Ticket gefälscht war und sie zum Ausgang eskortiert werden würde. Vielleicht war das Ganze doch ein Scherz gewesen. Im Kopf ging sie bereits die Liste der Verdächtigen durch.
Aber dann sagte der zweite Platzanweiser: »Für die Logen ist eine persönliche Eskorte üblich, Miss.«
Logenplätze, erinnerte Citra sich, waren das Nonplusultra der Exklusivität. In der Regel waren sie für Leute reserviert, die zu vornehm waren, um bei der Masse zu sitzen. Normale Menschen konnten sie sich nicht leisten, und selbst wenn, bekamen sie keinen Zugang. Als sie dem Platzanweiser die schmale Treppe hinauf zu den Logen auf der linken Seite folgte, bekam Citra allmählich Angst. Sie kannte niemanden, der so viel Geld hatte. Was, wenn ihr die Einladung irrtümlich zugestellt worden war? Oder wenn wirklich eine große bedeutende Persönlichkeit auf Citra wartete, was um alles in aller Welt waren ihre Absichten?
»Da wären wir!« Der Platzanweiser zog den Vorhang der Loge zurück und gab den Blick auf einen Jungen ihres Alters frei, der schon Platz genommen hatte. Als er sie sah, stand er auf, und Citra bemerkte, dass die Hosenbeine seines Anzugs ein wenig Hochwasser hatten.
»Hi.«
»Hallo.«
Dann ließ der Platzanweiser sie allein.
»Ich habe dir den Platz näher an der Bühne frei gelassen«, sagte er.
»Danke.« Sie setzte sich und versuchte zu begreifen, wer er war und warum er sie hierher eingeladen hatte. Sein Gesicht kam ihr nicht bekannt vor. Sollte sie ihn kennen? Sie wollte sich jedenfalls nicht anmerken lassen, dass sie nicht wusste, wer er war.
Dann sagte er aus heiterem Himmel: »Vielen Dank.«
»Wofür?«
Er hielt eine Einladung hoch, die genauso aussah wie ihre. »Ich steh nicht so auf Oper, aber hey, besser als zu Hause rumhängen und nichts machen. Also … sollte ich dich, ähm, kennen?«
Citra lachte laut. Sie hatte keinen mysteriösen Verehrer. Offenbar hatten sie beide einen mysteriösen Kuppler, was Citra sofort eine neue Liste im Kopf erstellen ließ – auf der ihre Eltern ganz oben standen. Vielleicht war er der Sohn einer ihrer Freunde, obwohl ein solcher Vorwand selbst für ihre Eltern ziemlich bescheuert wäre.
»Was ist so komisch?«, fragte der Junge, und sie zeigte ihm ihre identische Einladung. Er fand es nicht zum Lachen, sondern wirkte ein wenig beunruhigt, ohne zu sagen, warum.
Er stellte sich als Rowan vor, und sie gaben sich die Hand, während die Lichter im Saal erloschen, der Vorhang hochgezogen wurde und eine so schwelgerische und laute Musik einsetzte, dass eine weitere Unterhaltung unmöglich war. Die Oper war Verdis La Forza del Destino, die Macht des Schicksals, doch es war ganz offensichtlich nicht das Schicksal, das diese beiden zusammengeführt hatte, sondern eine planvoll handelnde Hand.
Die Musik war üppig und süß, wurde Citras Ohren jedoch irgendwann zu viel. Und obwohl man der Handlung auch ohne Italienischkenntnisse leicht folgen konnte, berührte sie sie kaum. Schließlich war es ein Werk aus der Sterblichkeitsära. Krieg, Rache, Mord – alle Themen, um die die Geschichte gewoben war – waren so weit entfernt von der modernen Realität, dass kaum jemand etwas damit anfangen konnte. Ihre Katharsis konnte sich also nur um das Motiv der Liebe drehen, und für zwei Fremde, die in einer Opernloge eingesperrt waren, war das weniger kathartisch als vielmehr unbehaglich.
»Und was glaubst du, wer uns eingeladen hat?«, fragte Citra, sobald die Lichter für die Pause nach dem ersten Akt angingen. Rowan hatte ebenso wenig eine Ahnung wie sie, also tauschten sie alles aus, was ihnen helfen könnte, eine Theorie zu entwickeln. Sie waren beide sechzehn, hatten jedoch ansonsten wenig gemeinsam. Sie wohnte in der Stadt, er in der Vorstadt. Sie hatte eine kleine Familie, er eine große, und die Berufe ihrer Eltern hätten nicht unterschiedlicher sein können.
»Was ist dein genetischer Index?«, wollte er wissen – eine recht persönliche Frage, doch vielleicht war sie von Bedeutung.
»22–37–12–14–15.«
Er lächelte. »37 Prozent afrikischer Abstammung. Gut für dich! Das ist ziemlich viel!«
»Danke.«
Er erklärte ihr, dass sein Index 33–13–12–22–20 war. Sie überlegte, ihn nach dem Subindex seiner sonstigen Komponente zu fragen, die mit 20 Prozent recht hoch war, doch wenn er es nicht wusste, könnte ihn das in Verlegenheit bringen.
»Wir haben beide zwölf Prozent panasiatische Vorfahren«, bemerkte er. »Könnte es etwas damit zu tun haben?« Aber er klammerte sich an einen Strohhalm – es war reiner Zufall.
Denn am Ende der Pause trat die Erklärung hinter ihnen in die Loge.
»Schön zu sehen, dass ihr euch schon miteinander bekannt gemacht habt.«
Obwohl ihre Begegnung mehrere Monate zurücklag, erkannte Citra ihn sofort. Der Ehrenwerte Scythe Faraday war keine Gestalt, die man so schnell vergaß.
»Sie?«, sagte Rowan mit einer Vehemenz, die deutlich machte, dass auch er dem Scythe schon einmal begegnet war.
»Ich wäre schon früher gekommen, doch ich hatte … noch andere Geschäfte zu erledigen.« Er führte das nicht weiter aus, worüber Citra froh war. Trotzdem konnte seine Anwesenheit nichts Gutes bedeuten.
»Sie haben uns eingeladen, um uns nachzulesen.« Es war keine Frage, es war die Feststellung einer Tatsache, von deren Wahrheit Citra überzeugt war, bis Rowan sagte: »Ich glaube nicht, dass es darum geht.«
Scythe Faraday machte auch keinerlei Anstalten, ihr Leben zu beenden. Stattdessen zog er sich einen leeren Stuhl heran und setzte sich neben sie. »Die Loge hat mir die Operndirektorin zur Verfügung gestellt. Die Leute glauben immer, wenn sie einem Scythe Gaben darbieten, würde sie das davor schützen, nachgelesen zu werden. Ich hatte gar nicht die Absicht, sie nachzulesen, doch jetzt glaubt sie, ihr Geschenk hätte eine Rolle gespielt.«
»Die Menschen glauben, was sie glauben wollen«, sagte Rowan mit einer Autorität, die Citra verriet, dass er die Wahrheit des Satzes am eigenen Leib erfahren hatte.
Faraday zeigte auf die Bühne. »Heute Abend werden wir das Drama menschlicher Torheit und Tragödien anschauen«, sagte er. »Morgen werden wir es leben.«
Seit zwei Monaten war Rowan der Paria der Schule – ein Außenseiter höchster Ordnung. Normalerweise wäre das eine Weile so gegangen und irgendwann wieder vergessen worden, doch das war nach der Nachlese von Kohl Whitlock anders. Jedes Footballspiel streute neues Salz in die kollektive Wunde – und weil alle Spiele verloren wurden, verdoppelte sich der Schmerz. Rowan war nie besonders beliebt gewesen, allerdings auch keine Zielscheibe von Spott, aber nun wurde er regelmäßig in die Ecke getrieben und verprügelt. Man ging ihm aus dem Weg, selbst seine Freunde mieden ihn. Tyger machte da keine Ausnahme.
»Schuldig durch Umgang«, hatte er gesagt. »Ich kann deinen Schmerz nachfühlen, aber ich will ihn nicht leben.«
»Es ist eine unglückliche Situation«, erklärte der Direktor Rowan, als jener in der Mittagspause im Krankenzimmer der Schule darauf wartete, dass ein paar frisch zugefügte Wunden verheilten. »Vielleicht möchtest du die Schule wechseln.«
Eines Tages gab Rowan dem Druck schließlich nach. Er stellte sich auf einen Tisch in der Cafeteria und verkündete allen die Lügen, die sie hören wollten.
»Der Scythe war mein Onkel«, erklärte er. »Ich habe ihm gesagt, dass er Kohl Whitlock nachlesen soll.«
Natürlich glaubten sie ihm jedes Wort. Schüler begannen, ihn mit Essen zu bewerfen, bis er sagte:
»Ich möchte, dass ihr alle wisst, dass mein Onkel zurückkommen wird – und er hat mich gebeten auszuwählen, wer als Nächstes nachgelesen werden soll.«
Die Nahrungsmittel hörten auf zu fliegen, es war vorbei mit wütenden Blicken und Schlägen. Gefüllt wurde die Leere von … nun … einer Leere. Niemand wagte es noch, ihn anzusehen. Nicht einmal seine Lehrer – einige begannen sogar, ihm Einsen zu geben, obwohl die vorgelegten Arbeiten höchstens eine Zwei oder Drei verdient hätten. Er fühlte sich mehr und mehr wie ein Geist in seinem eigenen Leben, der gezwungenermaßen in einem blinden Fleck der gesamten Welt lebte.
Zu Hause blieb alles normal. Sein Stiefvater hielt sich komplett aus Rowans Angelegenheiten heraus, und seine Mutter war mit zu vielen anderen Dingen beschäftigt, um seinen Sorgen große Aufmerksamkeit zu widmen. Sie wussten, was in der Schule passiert war und was jetzt geschah, doch sie taten es auf die verbreitete eigennützige Art von Eltern ab, die vorgaben, dass alles, was sie nicht lösen konnten, eigentlich kein richtiges Problem war.
»Ich möchte auf eine andere Highschool wechseln«, erklärte Rowan seiner Mutter, den Rat seines Direktors schließlich befolgend.
Ihre Reaktion war schmerzhaft neutral. »Wenn du das für das Beste hältst.«
Er war sich ziemlich sicher, wenn er ihr erklären würde, dass er aussteigen und sich einem Tonkult anschließen wollte, würde sie auch erwidern: Wenn du das für das Beste hältst.
Deshalb war es Rowan auch egal gewesen, wer ihm die Einladung in die Oper geschickt hatte. Was immer es zu bedeuten hatte, es war eine Erlösung – zumindest für einen Abend.
Das Mädchen, das er in der Loge traf, war nett. Hübsch, selbstsicher – der Typ Mädchen, das wahrscheinlich schon einen Freund hatte, obwohl sie keinen erwähnte. Dann war der Scythe aufgetaucht, und Rowans Welt war zurück an einen dunklen Ort gerutscht. Dies war der Mann, der für sein Elend verantwortlich war. Wenn Rowan damit davongekommen wäre, hätte er ihn über das Geländer gestoßen, aber Angriffe auf Scythe wurden nicht geduldet. Zur Strafe wurde die gesamte Familie des Täters nachgelesen, eine Konsequenz, die die Sicherheit der verehrten Überbringer des Todes garantierte.
Nach dem Ende der Oper gab Scythe Faraday ihnen eine Karte und sehr eindeutige Anweisungen.
»Ihr werdet mich morgen früh um Punkt neun Uhr an dieser Adresse treffen.«
»Was sollen wir unseren Eltern über heute Abend erzählen?«, fragte Citra. Offenbar hatte sie Eltern, die es interessierte.
»Erzähl ihnen, was du willst. Es spielt keine Rolle, solange du morgen früh da bist.«