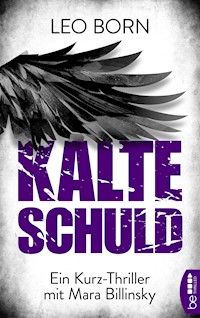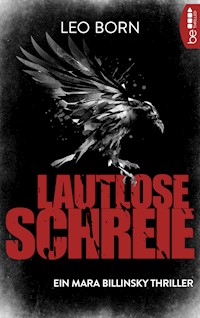9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Mara Billinsky
- Sprache: Deutsch
Mara "die Krähe" Billinsky in ihrem bislang persönlichsten Fall!
Die Vergangenheit lässt Kommissarin Mara Billinsky keine Ruhe: Sie will endlich die Mörder ihrer Mutter zur Rechenschaft ziehen. Und auch im Job findet Mara keine ruhige Minute. Eine bestialisch ermordete Edel-Prostituierte und ein Bombenanschlag auf der Autobahn halten die gesamte Frankfurter Mordkommission in Atem. Doch plötzlich wird aus der Jägerin die Gejagte, als ein geheimnisvoller Anrufer die Kommissarin warnt, dass der "Wolf" in der Stadt ist und sie im Visier hat! Als Mara endlich erkennt, dass sie und ihre Kollegen nur Spielfiguren in einem kaltblütigen Krieg sind, ist es für "die Krähe" fast zu spät ...
Atemlos, spannend, erschreckend: Mara Billinsky ermittelt in ihrem dritten und persönlichsten Fall!
Leserstimmen zur Mara-Billinsky-Thriller-Reihe
"Die Mara Billinsky Bände gehören für mich ganz oben auf die Liste der besten deutschen Thriller." (Bambarenlover, Lesejury)
"Generell sehr gut ausgearbeitete und gut vorstellbare Charaktere, die sich im Verlauf des Thrillers entwickeln und gut greifbar sind. Es ist spannend, ihnen zu folgen, vor Allem auch, da niemand einfach platt "gut" oder "böse" ist, sondern jeder seine Facetten hat." (SEEKING_ZAMONIA, Lesejury)
"Die Spannung beginnt auf der ersten Seite und lässt bis zum Ende des Buches nicht nach (...)." (SAINT_GERMAIN, Lesejury)
"Leo Born gelingt es, die Räume, die Ängste und andere Gefühle und Eindrücke der einzelnen Personen erschreckend authentisch zu beschreiben. Man fühlt in vielen Situationen mit den Opfern und anderen Beteiligten mit und steht quasi direkt daneben ..." (Sandra8811, Lesejury)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 498
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelImpressumTeil 1: Der Biss der Ratte1234567891011121314151617Teil 2: Die Beute des Wolfs1819202122232425262728293031323334Teil 3: Das Geheimnis des Schwans353637383940414243444546474849Teil 4: Das Gespür der Krähe505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879Über dieses Buch
Mara »die Krähe« Billinsky in ihrem bislang persönlichsten Fall! Die Vergangenheit lässt Kommissarin Mara Billinsky keine Ruhe: Sie will endlich die Mörder ihrer Mutter zur Rechenschaft ziehen. Und auch im Job findet Mara keine ruhige Minute. Eine bestialisch ermordete Edel-Prostituierte und ein Bombenanschlag auf der Autobahn halten die gesamte Frankfurter Mordkommission in Atem. Doch plötzlich wird aus der Jägerin die Gejagte, als ein geheimnisvoller Anrufer die Kommissarin warnt, dass der »Wolf« in der Stadt ist und sie im Visier hat! Als Mara endlich erkennt, dass sie und ihre Kollegen nur Spielfiguren in einem kaltblütigen Krieg sind, ist es für »die Krähe« fast zu spät …
Über den Autor
Leo Born ist das Pseudonym eines deutschen Krimi- und Thriller-Autors, der bereits zahlreiche Bücher veröffentlicht hat. Der Autor lebt mit seiner Familie in Frankfurt am Main. Dort ermittelt auch – auf recht unkonventionelle Weise – seine Kommissarin Mara Billinsky.
beTHRILLED
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Die Kooperationsausgabe erschien 2018 bei Thalia Bücher GmbH, Hagen
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Projektmanagement: Lukas Weidenbach
Covergestaltung: Massimo Peter-Bille
Titelillustration: © shutterstock/Dmitriev Lidiya;© Midiwaves/shutterstock; © KHIUS/shutterstock
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-6518-4
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Teil 1
Der Biss der Ratte
1
Vor Denise breitete sich ein Meer aus Lichtern aus.
Da waren die prachtvoll illuminierten Bankentürme und die gewaltigen Bürokästen in der City, umgeben von den schier endlosen, starren Wellen aus Wohnblöcken. Etwas abseits, im Osten der Stadt, erhob sich der eigenwillig geformte Keil der Europäischen Zentralbank. Auch kurz nach Mitternacht waren noch etliche Fenster erleuchtet.
Es kam ihr vor, als betrachtete sie ein grelles, scheinbar wogendes Ungetüm aus Beton und Stahl, in der Mitte klaffend durchschnitten vom schwarzen Band des Mains.
Ein flüchtiges Lächeln huschte über ihre rot leuchtenden Lippen. Sie hatte Frankfurt seit vielen Jahren durchschaut, die Stadt, die sich gern mit dem Glitzerkleid einer Metropole schmückte, während in ihrem tiefsten Inneren doch das Herz eines Dorfes schlug. Kurze Wege, enge Gassen, Vetternwirtschaft, Filz. Selbst der Dialekt, der hier gesprochen wurde, klang nach ruppiger, hemdsärmeliger Provinz.
Denise hatte Kunden, die Obst- und Gemüsehändler waren. Aber auch Banker, Rechtsanwälte, hochrangige Bullen. Denise kannte sie alle gut, und viele von ihnen wiederum kannten sich untereinander, persönlich oder mindestens vom Hörensagen.
Sie trat ein Stück zurück von der großflächigen, bodentiefen Glasfront, die sie von der Stadt zehn Stockwerke unter ihr trennte. Einen langen Moment betrachtete sie ihr Spiegelbild, das kupferfarbene Haar glühend über dem zarten Teint ihrer Wangen und dem makellosen Weiß des flauschigen Bademantels. Sie ließ auch dieses Bild auf sich wirken, als müsste sie es unbedingt im Gedächtnis behalten. Denn schon bald würde es einen Einschnitt geben. Sie stand kurz davor, ihr altes Leben abzustreifen wie eines ihrer vielen kostspieligen, aufreizend engen Kleider.
Ihre Kunden hatte Denise bereits deutlich reduziert. Es gab nur noch ein paar ausgewählte Herren, die besonders gut bezahlten und die sie vielleicht sogar ein wenig mochte. Oder zumindest respektierte. Bald würde das alles vorbei sein, das große Geld, der Sex mit all diesen Fremden, die Nächte in dem Apartment, für das bereits ein Nachmieter gesucht wurde. In den langen Jahren, die von enormer Disziplin und Professionalität geprägt gewesen waren, hatte sie genug zusammengespart.
Nur noch für einen Mann wollte sie da sein. Für einen, der sie nicht bezahlen würde. Mit dem sie Urlaubsreisen unternehmen, den sie jeden Tag sehen, mit dem sie sogar unter einem Dach leben würde. Ein merkwürdiges Gefühl, sich zu binden. Jedenfalls für Denise. Immer noch musste sie sich an diesen Gedanken erst einmal gewöhnen.
Sie trat einen weiteren Schritt zurück, und sofort verschwamm ihr Spiegelbild, die Konturen lösten sich auf, als gäbe es sie gar nicht mehr.
Eine Viertelstunde später, beim Empfangen ihres letzten Gastes in dieser Nacht, trug Denise nicht mehr den Bademantel, sondern nur noch hochhackige Schuhe und einen Hauch von Parfüm. Sie wusste, wie sehr er das mochte, es gehörte zum Service.
Er war ein Mann von Welt, elegant, mit reichlich Vermögen, jedoch in die Jahre gekommen, die Frauen, der Alkohol, der Job, und damit war er im Grunde ziemlich repräsentativ für ihre Kunden. Männer mit Anspruch, die wussten, was sie wollten, die niemals Ärger machten, die auf ihre Art so professionell waren wie Denise auf ihre.
Nicht allein ihre spärliche Bekleidung, alles hatte sie auf seine Wünsche abgestimmt. Es lief Dvořák, Sinfonie Nr. 9. Auf einem Chromtisch in Griffnähe neben dem Bett befanden sich Champagner aus Frankreich, Moliterno al Tartufo aus Italien, Obst aus Chile, Koks aus Marokko. Und eine Flasche teuren Rums aus Costa Rica. Der Mann hatte ihn nur einmal beiläufig erwähnt, aber mehr war nicht nötig. Denise war immer aufmerksam, ihr entging nichts, sie wusste, wie sie punkten konnte. Wer Kunden mit Stil wollte, musste sich selbst Stil angeeignet haben. Klassische Musik, Kleidung der Luxusmarken, Eloquenz, vortreffliche Manieren, zumindest wenn man angezogen war. Sie hatte Jahre gebraucht, um das zu sein, was sie jetzt darstellte: von einem Niemand zu einer Frau, der man die Türen aufhielt.
Sie nippten an dem Champagner, er registrierte den Rum mit einem anerkennenden Heben der Augenbraue. Sie hatten Sex, routiniert, aber nicht ohne dass sie ihn auf Touren gebracht hätte. Manchmal stand er auf ein paar Extras, heute allerdings nicht. Danach streckte er sich bequem auf dem seidenen Laken aus, er gehörte nicht zu denen, die quatschen oder ihr Herz ausschütten wollten.
Denise schenkte ihm ihr Lächeln und erhob sich, um ins Bad zu verschwinden. Sie war sich bewusst, dass er eingehend ihren Hintern betrachtete, wie er es immer tat. Dann stand sie vor dem marmornen Waschbecken und sah sich im großen Ovalspiegel an. Ja, es war genau der richtige Moment, um den Absprung zu machen und mit diesem Leben aufzuhören; auf einmal war sie erfüllt von einer tiefen Zuversicht.
Sie senkte die Lider und genoss die Stille, Dvořáks temperamentvolle Musik war längst verstummt. In diesem Augenblick angenehmer Gelassenheit hätte sie sich niemals vorstellen können, dass sie nur kurz darauf in einen verzweifelten Todeskampf verwickelt sein würde. Dass Fäuste auf sie einschlagen, Hände sie niederdrücken, an ihr reißen, sie fesseln würden. Dass sie gefoltert werden würde, vergewaltigt, dass Finger ihr die Zunge brutal aus dem Mund zerren würden, um ihr innerhalb von Momenten dieses glitschige Körperteil mit einem Messer abzuschneiden.
Niemals hätte sie sich vorstellen können, was ein Mensch alles zu erleiden vermochte, bevor er starb.
2
Beiläufig betrachtete Mara Billinsky durchs Fenster den wolkenverhangenen Frankfurter Himmel, aus dem die letzten Tropfen eines Frühlingsschauers fielen. Sie hatte den Telefonhörer dicht am Ohr und nippte rasch an ihrem Kaffeebecher.
Der Anrufer sagte ein Wort, das sie nicht verstehen konnte.
»Was?« Skeptisch betrachtete sie die Mobilfunknummer, die auf dem Display ihres Bürotelefons angezeigt wurde und die sie sich sicherheitshalber auf einem Zettel notiert hatte.
»вoлк«, wiederholte der Mann den Begriff. »Das heißt Wolf auf Russisch.«
Fünf Minuten dauerte das Gerede schon an, doch mit den angekündigten, angeblich brandheißen Informationen rückte der Kerl nicht heraus.
»Ich bin nicht interessiert an einem Fremdsprachenkurs.«
Der Fremde quittierte Maras Antwort mit einem rauen, spöttischen Lachen, das ihr unangenehm unter die Haut kroch.
»Dafür habe ich etwas«, erklärte er mit einer jähen Schärfe, »das Sie ganz bestimmt interessieren wird.«
»Das haben Sie schon mal gesagt.« Mara versuchte cool und sachlich zu klingen, doch unwillkürlich setzte sie sich aufrecht. Ein Spinner, hätte sie normalerweise gedacht, allerdings war etwas an ihm, das ihre inneren Alarmlämpchen leuchten ließ.
»Spedition Stoberg«, kam es von dem Mann. »Sagt Ihnen das etwas?«
»Das sagt mir einen Scheißdreck. Und wenn Sie jetzt nicht zum Punkt kommen, komme ich zum Ende.«
»Drogen. Eine ganze Menge davon.«
»Wirklich?«, antwortete Mara betont misstrauisch, tippte aber sofort Spedition Stoberg über die Laptoptastatur in eine Suchmaschine ein. Das erste Ergebnis zeigte die Website einer kleinen Firma am Stadtrand von Frankfurt.
»Na, sind Sie jetzt doch interessiert?«
Sein Akzent war nicht zu überhören. Osteuropa, vermutete Mara. Auch wegen des angeblich russischen Worts, das er gebraucht hatte. Sein Alter war ebenfalls schwer einzuschätzen. Auffallend war der heisere Ton, der seiner Stimme etwas Schneidendes gab.
»Ich zähle bis drei, dann lege ich auf«, kündigte sie entschieden an. »Eins …«
»Das gefällt mir«, gab er spöttisch zurück.
»Zwei …«
»Selita.«
»Wie bitte?«
»Sie haben mich genau verstanden. Ich sagte Se-li-ta.«
Endgültig hellhörig geworden, hielt Mara den Atem an. Selita hieß ein Bezirk der albanischen Hauptstadt Tirana. Einige Männer, die in dringendem Verdacht standen, eine wichtige Rolle im internationalen Drogenhandel zu spielen, stammten von dort. Und kürzlich war dieser Ausdruck als interner Codename für eine größere Operation des Drogendezernats verwendet worden. Wie kam der Fremde ausgerechnet auf diesen Begriff?
»Was meinen Sie damit?«, fragte Mara.
»Dass es sich für Sie lohnen wird. Morgen, gegen Mitternacht, Spedition Stoberg.«
Eilig forschte sie weiter im Internet nach der genannten Spedition und fand heraus, dass das kleine Unternehmen im Vorjahr pleitegegangen war. »Ich mag keine Spielchen.«
»Dieses Spielchen sollten Sie mögen. Es wird zu Ihrem Vorteil sein.«
»Aus welchem Grund wollen Sie mir helfen?«
»Weil ich ein guter Mensch bin«, erwiderte er mit hämischem Unterton. Und dann ergänzte er: »Ein Lkw mit Münchner Kennzeichen. Natürlich ein falsches Kennzeichen. Der Lkw kommt nämlich nicht aus Bayern, sondern hat einen viel weiteren Weg hinter sich.«
»Sie behaupten also, es geht um Drogen?«
»Wie ich schon sagte: um eine ganze Menge davon.«
»Ich nehme an, Sie möchten mir nicht mitteilen, mit wem ich gerade das Vergnügen habe.«
»Schön, dass es ein Vergnügen für Sie ist.« Ein abschätziger Laut folgte auf diese Worte, und Mara spürte, dass ein kalter Schauer über ihren Rücken rieselte. Nein, das war kein Spinner, das war jemand, der genau wusste, was er tat und weshalb.
»Ich brauche mehr Informationen.«
»Mehr Informationen kriegen Sie nicht.«
»Woher kommen die Drogen?«
»Von irgendwoher.«
»Wer liefert sie?«
»Irgendwer.«
»Wer nimmt sie in Empfang?«
»Das werden Sie feststellen, wenn Sie vor Ort sind.«
Mara bemerkte, dass ihr Vorgesetzter, Hauptkommissar Klimmt, im Türrahmen ihres Großraumbüros erschienen war. Er starrte sie mit seinem üblichen grimmigen Gesichtsausdruck an und bedeutete ihr, in sein Büro zu kommen.
Sie gab ihm ein rasches Handzeichen, dass sie verstanden hatte, worauf er sich umdrehte und wieder davonstiefelte.
»Welche Drogen sind geladen?«, wollte Mara von dem Fremden wissen.
»Lassen Sie sich überraschen.« Betont wiederholte er den Begriff vom Anfang des Gesprächs: »вoлк. Wissen Sie noch, was das heißt?«
»Das russische Wort für Wolf.«
»Sehr gut aufgepasst.« Mit einem drohenden Unterton fügte er hinzu: »Der Wolf treibt sich in Frankfurt herum. Er will Beute machen. Und ich verspreche Ihnen etwas: Am Ende wird er seine Beute kriegen.«
»Hat der Wolf einen Namen?«
»Ja, aber den kennt niemand außer mir. Glauben Sie mir, der Wolf dreht seine Runden in dieser Stadt. Viele wird er fressen. Vielleicht auch Sie, kleine Polizistin.«
Ein Knacken – und die Verbindung war unterbrochen.
Mara rief sofort Hauptkommissar Meichel von der Drogenabteilung an. Er hatte die Aktion Selita geleitet, die nicht von dem erhofften Erfolg gekrönt gewesen war. Zwar konnte man einen großen Vorrat an Heroin und Cannabis sicherstellen, nicht jedoch die Verdächtigen aus Tirana festnehmen. In präzisen Sätzen gab Mara die Informationen des anonymen Anrufers weiter.
»Wir werden der Sache auf jeden Fall nachgehen«, kündigte Meichel nachdenklich an. »Es wundert mich nur, dass der Unbekannte sich ausgerechnet bei Ihnen gemeldet hat.«
»Da wären wir schon zwei.«
Gleich darauf wies Mara mit einem weiteren Anruf einen Spezialisten an, ihren Büroanschluss zu überprüfen und die Herkunft des Fremden anhand seiner Handynummer zu ermitteln – auch wenn ihre Hoffnung nicht gerade riesig war, dass das gelingen würde.
Sie hatte gerade aufgelegt, als ihr Kollege Jan Rosen neben ihrem Schreibtisch auftauchte, zwei Becher Kaffee vom Automaten in den Händen. Einen davon stellte er vor ihr ab.
»Den kann ich brauchen. Danke!« Mara trank einen Schluck und verbrannte sich die Zunge. »Allerdings muss ich jetzt erst mal zu unserem Herrn und Meister.«
»Klimmt? Der hat ja wieder mal eine Stinklaune.« Rosen ließ sich auf dem Drehstuhl des gegenüberliegenden Schreibtischs nieder. Er trug einen bordeauxroten Rollkragenpullover und senffarbene Stoffhosen. Die auffallend schreienden Farben seiner Kleidung passten eigentlich so gar nicht zu seiner zurückhaltenden, fast scheuen Art, die ihm in seinem Job nicht gerade eine große Hilfe war.
Als Mara kurz darauf Klimmts Büro betrat, bestätigte die düstere Miene des Hauptkommissars Rosens Worte.
»Sie wollten mich sprechen, Chef.« Mara blieb vor Klimmts Schreibtisch stehen und sah auf den Mann herunter, wie immer, auch wenn sie wusste, dass ihm das auf die Nerven ging. Oder gerade deswegen.
Zu Beginn waren sie und er häufig aneinandergeraten, inzwischen jedoch hatte sich Mara im gesamten Team einiges an Respekt erworben. Und der anfänglich aufgrund ihrer stets dunklen Aufmachung spöttische Spitzname Krähe hatte sich in eine Art Markenzeichen verwandelt. Die bislang letzte von mehreren eindrucksvollen Tätowierungen auf Maras heller Haut war dann auch tatsächlich eine Krähe gewesen.
Klimmt klebte in seinem Stuhl wie ein angeschlagener Boxer. Er wirkte erschöpft, gereizt, knurrig. Wie meistens. »Mit wem haben Sie gerade telefoniert? Sie hatten schon wieder diesen Billinsky-Blick.«
Sollte Mara ihn daran erinnern, dass es auch einen Klimmt-Blick gab? Sie verzichtete darauf und schilderte stattdessen lieber den Anruf.
»Seltsame Geschichte«, lautete Klimmts sparsamer Kommentar.
»Das finde ich auch.«
»Am Ende wahrscheinlich doch bloß ein Rohrkrepierer, das Ding mit den Drogen.«
»Ich habe Meichel informiert, er wird sich darum kümmern.« Mara straffte sich. »Was gibt’s?«
»Setzen Sie sich endlich auf Ihren verdammten Hintern!« Klimmts Stimme hatte einen alarmierenden Unterton, den alle bestens kannten, besonders Mara.
»So schlimm?«, fragte sie lässig, nahm aber auf einem der beiden Besucherstühle Platz.
Er fuhr sich über seinen ungepflegten, buschigen Walrossschnauzbart und musterte sie aus blutunterlaufenen Augen. Bis vor Kurzem hatte er an einer hartnäckigen Lungenentzündung gelitten und war nach Ansicht der meisten Kollegen viel zu früh wieder im Dienst erschienen. Ein alter, abgekämpfter Bulle, der langsam die Zielgerade seiner Laufbahn erreichte. Aber dennoch einer, der seinen Dickschädel mit einem gewissen Stolz auf den Schultern trug und der es hasste, klein beizugeben. Zumindest in dieser Hinsicht hatten er und Mara also etwas gemeinsam.
Er faltete die Hände hinter seinem breiten Nacken. Im zerknitterten Stoff seines Leinenhemdes zeigten sich unter den Achseln dunkle Halbmonde aus Schweiß. »Gernot Grigoleit«, knurrte er.
Unwillkürlich wappnete sich Mara für das, was kommen würde. Sie presste die Lippen aufeinander.
»Fällt Ihnen nichts ein zu diesem Namen, Billinsky?«
»Jedenfalls nichts Gutes.«
»Da sind Sie so ziemlich die Einzige. Denn es gibt in der juristischen Inzuchtwelt dieser Stadt kaum eine Person, die einen so guten Ruf genießt wie Grigoleit. Ein früher überaus erfolgreicher Staatsanwalt, bereits seit Jahren im Ruhestand, aber immer noch sehr präsent bei den Kollegen. Er hält Vorträge und ist Gastredner im Fachbereich Rechtswissenschaft an der Goethe-Uni.«
»Vielen Dank für den kleinen Steckbrief.«
»Gern«, gab er säuerlich zurück. »Was ich weniger gern habe, ist die Tatsache, dass dieser scheißehrenwerte Ex-Staatsanwalt sich über eine meiner Mitarbeiterinnen beschwert hat. Ausdrücklich beschwert.«
»Sagen Sie ihm, das ist mir wurscht«, erwiderte Mara bissiger als gewollt. »Und zwar ausdrücklich wurscht.«
»Ihm sage ich gar nichts, sondern Ihnen.« Der berüchtigte Klimmt-Blick loderte jetzt erst so richtig. »Treiben Sie’s nicht zu weit! Der feine Herr war sauer, verflucht sauer. Er ist bei mir reingerauscht, um deutlich zu machen, dass das eine rein inoffizielle Beschwerde ist. Aber sollten Sie ihn nicht in Frieden lassen, wird er nicht zögern, andere Geschütze aufzufahren.«
»Grigoleit macht mir keine Angst.«
»Ein bisschen Angst würde Ihnen in diesem Fall nicht schaden, Billinsky. Oder nennen wir es lieber Grips. Der Typ ist nicht mehr aktiv an der Front, aber eine kleine Bullenkarriere kaputt zu machen, das wäre für ihn ein Kinderspiel.«
»Sonst noch was?« Mara starrte demonstrativ an Klimmt vorbei. »Oder kann ich gehen?«
»Klar, Sie können gehen.«
Sie erhob sich.
»Aber«, bemerkte Klimmt, »Sie können mir auch sagen, was da eigentlich los ist. Was steckt hinter der Grigoleit-Sache?«
Mitten in der Bewegung hielt Mara inne. »Das hat er Ihnen nicht erzählt?«
»Würde ich sonst fragen?«
Sie setzte sich wieder. »Grigoleit war der leitende Staatsanwalt bei den Ermittlungen zum Mord an meiner Mutter.«
»Und weiter?« Klimmt runzelte die Stirn, als ahnte er, was er gleich hören würde – und als freute er sich keineswegs darauf.
»Alles, was ich möchte, ist Grigoleit ein paar Fragen zu dem Fall stellen.«
Er machte eine vage Handbewegung. »Das muss jetzt zwanzig Jahre her sein.«
»Nur ein paar lausige Fragen«, betonte Mara. Nie hatte sie Klimmt gegenüber den Mord erwähnt, der ihr die Mutter genommen und sich als Wundmal auf ihrer Seele eingebrannt hatte. Der sie wie ein dunkler Schatten begleitete, was sie auch tat, wohin sie auch ging.
»Wenn er sich nicht dazu äußern will«, sagte Klimmt verhaltener, »können Sie nichts dagegen tun, Billinsky. Es ist keine offizielle Ermittlung. Ein Fall, der vor Ewigkeiten zu den Akten gewandert ist.«
»Nur ein paar lausige Fragen«, wiederholte Mara mit diesem schneidenden Tonfall, den niemand sonst aus dem Team Klimmt gegenüber an den Tag legte.
»Soviel ich weiß, war der Mordfall Katharina Billinsky eine der letzten großen Ermittlungen, mit der Grigoleit betraut gewesen ist. Und er hat es nicht geschafft, den Täter zu finden. Er wird wohl nicht gern daran erinnert.«
»Mir kommen gleich die Tränen.«
Klimmt beugte sich vor und nahm sie mit düsterem Blick aufs Korn. »Hören Sie, Billinsky, ich bin nicht gerade berühmt für meinen Takt.«
»Ach, tatsächlich?« Mara zuckte ironisch mit einer Braue.
»Und deshalb werde ich es Ihnen auf ganz direkte Art mitteilen: Hier ist kein Platz für privaten Müll. Weder für meinen noch für Ihren. Gerade Sie sorgen ja schon dienstlich für genügend Unruhe. Spielen Sie nicht mit dem Feuer, was diesen Grigoleit betrifft.«
Mara antwortete nichts.
»Sehen Sie, das meine ich mit Billinsky-Blick.«
Noch immer sagte sie nichts.
»Also, haben Sie das kapiert, Billinsky?«
Sekundenlang herrschte eine dumpfe Stille.
»Kapiert?«, wiederholte Klimmt bissig.
Ein Klopfen ertönte, beide sahen zur Tür, die sich öffnete. Rosens Kopf kam zum Vorschein.
»Hab ich ›Herein‹ gesagt?«, schnarrte Klimmt ihn an.
Rosen lief knallrot an. »Äh …«
»Raus mit Ihnen, Rosen!«
»Sorry, aber … ein Mord. Eine wirklich abscheuliche Sache.«
3
Wie Tiere waren sie zusammengepfercht worden. Wie Tiere glotzten sie vor sich hin, ausdruckslos und stumm. Wie Tiere wurden sie von einem Ort zum anderen gekarrt und von einem Besitzer an den nächsten weiterverkauft.
Sie waren ein Dutzend, sie hockten auf dem Boden der Ladefläche, Körper an Körper, vor sich Taschen mit ihren wenigen Habseligkeiten.
Das monotone Gebrumm des Kastenwagens hatte eine einschläfernde Wirkung auf Timea. Sie ließ den Kopf hängen, genau wie die anderen Frauen, dachte an nichts, fühlte nichts; sie verspürte keinen Hunger, keinen Durst, in ihr flackerte das Leben auf kleiner Flamme.
Wohin mochte die Fahrt gehen, fragte sie sich. Zuletzt war Timea in Kassel gewesen, einige Monate wohl schon, obgleich ihr Zeitgefühl abzusterben schien. War es nicht vor dem Beginn des Winters gewesen, als sie verkauft worden war? Und nun kam der Frühling, ja, mehrere Monate in Kassel. Damals hatte man sie von Anyana getrennt, der einzigen der Frauen, die für sie zu einer Freundin geworden war. Seither war sie wieder einmal auf sich allein gestellt gewesen, schutzlos, hilflos.
Vor dem Wechsel nach Kassel hatte sie in Frankfurt gelebt, auch wenn sie ihr Dasein nicht als Leben bezeichnet hätte. Und nun? Womöglich ging es zurück nach Frankfurt. Sie hatte Bemerkungen der beiden Männer aufgeschnappt, die sie und die Frauen, ohne die Waffen aus dem Hosenbund ziehen zu müssen, in den Wagen verfrachtet hatten, um dann in die Fahrerkabine einzusteigen und die Fahrt zu beginnen.
Zum ersten Mal seit etlichen Minuten spähte Timea nach oben zu den von Schmutz verschmierten Fenstern des Wagens. Die Wolkendecke riss auf, ließ hier und da das zarte Blau des Himmels erkennen. Wie sehr hatte sie sich früher immer auf den Frühling gefreut! Heute hatten Jahreszeiten keine Bedeutung mehr für Timea. Kaum etwas hatte noch eine Bedeutung für sie. Außer den Tag lebend zu überstehen, doch vielleicht nicht einmal das.
Ja, ganz bestimmt würde sie wieder in Frankfurt landen.
Diese gnadenlose Stadt. Die erste, die Timea in Deutschland kennengelernt hatte, vor ein paar Jahren, als sie durch eine einzige falsche Entscheidung und das Vertrauen in die falschen Personen in einem Sumpf gelandet war, der sie langsam immer tiefer nach unten zog und ihr die Luft zum Atmen nahm.
Frankfurt war besonders schlimm, ein einziger Albtraum. Das wussten alle, selbst die, die noch nie dort gewesen waren. Noch härtere Arbeitsbedingungen, mehr Gewalt, unter der die Frauen und Mädchen zu leiden hatten, psychische wie physische.
Vielleicht würde Timea wenigstens Anyana wiedersehen. Das wäre schön. Anyana. Wie sehr sie sie vermisste. Sie wieder in die Arme schließen zu können, war ihre einzige Hoffnung, so vage und klein sie auch sein mochte.
Doch ansonsten war nichts als Dunkelheit in ihrem Innern. Ihr Leben war ein Teufelskreis geworden. Es war ihr bewusst, wie abgestumpft sie war, und dennoch fühlte sie eine nagende Furcht in sich. Angst vor dieser Stadt.
So saß sie also da, auf der eiskalten Ladefläche dieses Wagens, inmitten der kleinen Viehherde, der sie von ihrem Besitzer zugeteilt worden war. Jetzt würde ein neuer Besitzer auftauchen – das hatte man ihr nicht gesagt, sie spürte es einfach. So war es schließlich auch beim letzten Wechsel der Stadt gewesen.
Ansonsten wusste sie nichts. Außer dass es immer noch ein Stück weiter bergab gehen konnte, dass jede Hölle doch nur das Vorzimmer einer größeren Hölle war.
Timea spähte noch einmal zum Himmel, an dem sich immer mehr blaue Flecken zeigten, und plötzlich zerriss ein gewaltiger Donnerschlag die Eintönigkeit um sie herum. Es war ein derart mächtiger Knall, dass er alles und jeden in Fetzen riss, dass er die ganze Welt zerstörte.
4
Es roch nach Parfüm, dessen verführerischer Duft sich auf dem Teppich, den Tapeten, den Möbeln festgesetzt hatte. Nach Alkohol, der als abgestandener Rest noch in den Gläsern schimmerte. Nach dem Kunststoff der Anzüge, Hauben, Handschuhe und Überschuhe, die von den Männern der Spurensicherung getragen wurden.
Es roch nach Tod. Schwer und endgültig, wie etwas, das man mit den Händen greifen konnte. Es roch nach Blut, nach verzweifelter, nackter Furcht, nach unvorstellbaren Schmerzen.
Und da schwebte noch ein Aroma in der Luft. Es kribbelte Mara Billinsky in der Nase, süßlich, schwach, doch sie kam einfach nicht darauf, um was es sich bei diesem Geruch handelte.
Ein paar Seitenblicke der Kriminaltechniker streiften Maras Aufzug, ihre schwarze Motorradlederjacke, das schwarze Oberteil mit Totenkopfmuster, die knallengen schwarzen Jeans und die Doc-Martens-Stiefel. Auch die Piercings an Oberlippe und Braue, die mit Kayal betonten dunklen Augen, ihr blasser Teint und ihr glattes, pechschwarz glänzendes Haar fielen auf.
Doch diese stumme, misstrauische Art der Aufmerksamkeit ließ nach; es hatte sich herumgesprochen, wie die Kommissarin aussah, die immerhin schon seit einem Dreivierteljahr wieder für die Frankfurter Mordkommission tätig war, nachdem sie zuvor einige Zeit in Düsseldorf gelebt und gearbeitet hatte. Auch dass sie die Krähe genannt wurde, war bekannt.
Mara stand etwas abseits, um alles in Ruhe betrachten und die Eindrücke in sich aufnehmen zu können, gut zwei Meter von dem breiten Bett entfernt, auf dem noch der Leichnam lag. Geknebelt, gefesselt, entblößt, geschunden. Ein grauenvoller Anblick.
Sie war so gefangen im Moment, dass sie es fast nicht wahrnahm, als Jan Rosen wieder auftauchte und sich neben sie stellte. Er hatte mit der Putzfrau gesprochen, die das Apartment seit Jahren in Schuss hielt und die Leiche entdeckt hatte.
»Diese vielen kleinen Wunden«, sagte Mara leise, mehr zu sich selbst als zu ihm. »Sie sind eigenartig.«
»Stimmt«, kam es gepresst über Rosens Lippen.
»Wie hat man sie der Frau zugefügt? Hm. Zuerst dachte ich, mit einem kleinen Messer. Aber die Wundränder wirken dafür zu ausgefranst. Sehr merkwürdig.«
»Ja. Merkwürdig.« Noch gepresster stieß er die paar Silben hervor.
Mara taxierte ihn und hob eine Augenbraue. »Alles okay?«
»Bestens«, sagte er, ohne ihren Blick zu erwidern. Auch an dem Bett sah er konsequent vorbei. Seine blaue Outdoorjacke und die schreiende Farbe des Pullovers ließen ihn noch bleicher wirken, als er tatsächlich war.
»Was hat die Frau gesagt?«
»Sie hat einen eigenen Schlüssel. Kommt jeden Tag um die Mittagszeit, außer sonntags. Als sie den Raum betrat, sah sie sofort …« Er schluckte. »Die Tote.«
»Wie lange ist die Putzfrau hier schon tätig?«
»Über drei Jahre.«
»Das einzige Apartment des Gebäudes, in dem sie sauber macht?« Maras Fragen kamen stichwortartig, im Stakkato, was typisch für sie war.
Rosen nickte, wie so oft etwas überfahren von ihrer Art. »Äh, ja. Das einzige. Ich, äh, habe sie gebeten, in dem kleinen Foyer oder Vorraum des Apartments zu warten, falls du auch noch mit ihr sprechen willst. Die Ärmste ist vollkommen fertig mit den Nerven.«
»Und der Name der Toten?«
»Denise Dorlac. Mehr weiß die Putzfrau nicht. Sie hat keinen Arbeitsvertrag. Den Job hat sie aufgrund einer Zeitungsannonce bekommen.«
»Dorlac? Eine Französin?«
»Möglich. Wir haben keinen Ausweis gefunden, nicht mal in ihrer schicken Handtasche. Nur ihr Handy, aber das muss erst noch ausgewertet werden. Sie besitzt ganz sicher irgendwo eine größere Unterkunft.«
Mara verfolgte, wie der Leichnam der Frau nach der ersten Untersuchung abtransportiert wurde. Erst die Obduktion würde mehr Klarheit bringen. Weiterhin wunderte sie sich über die vielen auffälligen kleinen Verletzungen, die gewiss nicht für den Tod verantwortlich gewesen waren, aber neben weiteren Spuren von Gewalt deutlich machten, dass das Opfer gequält worden war, wohl über einen längeren Zeitraum. Nach wie vor fragte sie sich, welcher Geruch das war, der sie schon beim Betreten des Apartments irritiert hatte.
Kurz darauf, nach einem weiteren Gespräch mit der Putzfrau, befanden sie und Rosen sich wieder auf dem Bürgersteig vor dem Block, der Wohlstand, Sterilität und eine gewisse Anonymität ausstrahlte. Nur ein paar Fußminuten weiter nahm die City ihren Anfang, eine ideale Lage. Verkehrslärm dröhnte, Fußgänger eilten vorbei, Fahrräder waren an Straßenlaternen gekettet.
Maras Blick wanderte an den Dutzend Stockwerken des Gebäudes nach oben. »Wir werden alle Personen befragen müssen, die hier wohnen oder arbeiten oder sonst etwas zu tun haben.«
»Dann lass uns am besten gleich damit anfangen.«
Er war noch immer bleich wie ein Laken.
»Vielleicht gehen wir erst ein paar Schritte, um ein bisschen Sauerstoff zu tanken. So einen Anblick muss man ja erst mal verdauen.«
»Wie du meinst.«
Auch wenn er es sich nicht anmerken lassen wollte: Mara sah, dass ihn der Vorschlag erleichterte.
»Die Tote ist eine Nutte gewesen«, sagte Mara nach ein paar Schritten. »Und das hier war ihr Arbeitsplatz. Die beiden oberen Schubladen der Kommode sind voll mit Sexspielzeug und die unteren mit Reizwäsche. Ziemlich teurer Schnickschnack, wie’s aussieht, kein Ramsch.« Sie brachte ein schiefes Grinsen zustande. »Auch wenn ich da keine Expertin bin.«
»Alles in dem Apartment ist teuer«, bestätigte Rosen. »Die Kommode sieht durch den Used-Look alt aus – aber das ist ein edles Stück, ganz bestimmt ein Unikat. Ich kenne solche Dinger. Das ist China-Lack, in mehreren Schichten aufwendig aufgetragen. Mehr als zwei Tausender muss man dafür hinblättern, würde ich schätzen.«
»Die Lady hat zur oberen Lohnklasse gehört, das steht fest.«
Der Himmel klarte weiter auf, es war auch nicht mehr so kalt wie zuletzt. Trotz des Grauens, das sich ihnen in dem Apartment offenbart hatte und wie ein scharfer Felssplitter in ihrem Innern festsaß, konnte Mara nicht verhindern, dass sich ihre Gedanken zu der Unterredung mit Klimmt zurückschlichen.
Sie hatte durchaus Verständnis für den Hauptkommissar. Grigoleits Beschwerde über Mara passte ihm nicht in den Kram, bei keinem Vorgesetzten wäre das anders gewesen; er hatte schon genug mit den Dingen zu tun, die offiziell auf seinem Schreibtisch landeten. Und an seiner Stelle hätte sie denselben Rat ausgesprochen: Ruhe geben. Doch ihr war nur zu klar, dass dies unmöglich für sie sein würde. Sie hatte zu viele Jahre damit verschwendet, so zu tun, als könnte sie das Ereignis verdrängen, das sich zwanzig Jahre zuvor im Haus ihrer Eltern abgespielt hatte. Es brannte in ihr wie eine Narbe, die immer wieder aufs Neue schmerzte.
Rosen hielt plötzlich inne, sein Gesicht, noch bleicher als zuvor, verzerrte sich.
Mara deutete vielsagend auf die Zufahrt zu einem Hinterhof. »Da hinten kann man dich nicht so gut sehen.«
Er eilte dorthin, beugte sich nach vorn und übergab sich würgend.
Sie schenkte ihm einen sanften Blick, dann wandte sie sich von ihm ab. Nicht das erste Mal, dass ihm das passierte. Im Präsidium würde sie kein Wort darüber verlieren, gab es doch auch so schon viele dumme Sprüche, dass weder Rosens Magen noch sein Nervenkostüm robust genug für diesen Job wären. Es machte ihn ja bereits wahnsinnig, dass er von manchen Kollegen boshaft Spatz genannt wurde, seit er Mara, der Krähe, zugeteilt worden war.
Er war immer noch dabei, das kurz zuvor eingenommene Kantinenmittagessen in der Hofzufahrt zu verteilen, als Mara einen Anruf von Klimmt erhielt. Das Handy am Ohr, stand sie am Rand des Bürgersteigs dicht neben einer Hauswand. »Was gibt’s, Chef?«
»Zu viel von allem«, brummte er in allzu vertrauter Manier. »Was ist los bei euch, Billinsky?«
»Genau wie Rosen gesagt hat: eine wirklich abscheuliche Sache.« Leiser fügte sie an: »Mord an einer Edelprostituierten. Die blutigen Details liefere ich Ihnen, wenn wir unter vier Augen sind.« Sie stutzte. »Weshalb rufen Sie an?«
Er überging ihre Frage: »Was haben Sie und Rosen als Nächstes vor?«
»Mögliche Zeugen auftreiben in dem Betonklotz, in dem es passiert ist. Vielleicht hat ja jemand etwas gesehen oder gehört.«
»Schleyer ist krank. Stanko und Patzke gehen einer Sache in Offenbach nach. Und ich kann nicht weg.«
»Noch mal, Chef: Weshalb rufen Sie an?«
»Kann Rosen allein mit der Suche nach Zeugen anfangen, Billinsky?«
»Hört sich so an, als müsste er das. Also: Was ist los?«
Während Mara ungläubig Klimmts knapper Schilderung zuhörte, verfolgte sie, wie sich Rosen wieder näherte und sich dabei mit einem Papiertaschentuch über den Mund wischte.
Als sie sich gleich darauf von Klimmt verabschiedete, war ihr die Fassungslosigkeit anzusehen.
»Was ist denn los?«, wollte Rosen erstaunt wissen.
»Ich muss zur A 661.«
Er zog eine Grimasse. »Was? Wieso?«
»Diese verfluchte Stadt spielt anscheinend schon wieder völlig verrückt.« Sie wühlte den Schlüssel ihres Alfa Romeos aus der Jackentasche. »Schaffst du das erst mal allein, Rosen?«
»Äh, na klar«, erwiderte er, ohne dass es ihm gelang, seine jäh einsetzende Unsicherheit zu verbergen.
»Sorry, ich melde mich nachher bei dir.«
Er musterte sie. »A 661?«
Mara setzte sich bereits in Bewegung. »Eine Bombe«, stieß sie noch hervor. »Hat wohl eine ganze Menge Leute erwischt. Sie wurden regelrecht in Stücke gerissen.«
5
Das Rauschen der S-Bahn erklang, ein lang gezogener, laut vorbeiwischender Ton, der Workan an früher denken ließ. Doch nur ganz kurz, dann war er zurück in der Gegenwart.
Noch immer raste Adrenalin durch seinen Körper, das Hochgefühl hielt unvermindert an, selbst Stunden, selbst Tage später. So war es jedes Mal, wenn er einen Auftrag erfüllt, wenn er die Angst eines Menschen beinahe körperlich gespürt hatte, wie einen wärmenden Lufthauch. Wenn er jemandem in dem Moment in die Augen gesehen hatte, in dem ihn das Leben verließ.
Er saß auf dem Bett, senkte die Lider, und in Gedanken sah er sofort wieder das zunächst noch makellose weiße menschliche Fleisch, das sich rasch violett verfärbte und so anschwoll, als würde es gleich platzen. Er hörte das dank des Knebels nur gepresst ausgestoßene Wimmern, er erinnerte sich an die flehenden Blicke und die Schweißperlen, das Blut, rot und ebenso makellos. Das roteste Rot der Welt. Er hatte extra kurz den Plastikhandschuh ausgezogen, um seinen Zeigefinger einzutauchen und den Geschmack auf der Zunge auszukosten. Das süßeste Süß der Welt.
Es fiel ihm schwer, sich von den Eindrücken zu lösen, doch es wurde Zeit, sich zu melden. Workan nahm das Mobiltelefon in die Hand, um seinen Boss anzurufen, doch er erreichte ihn nicht. Dann eben später, sagte er sich ohne Ungeduld. Er drehte den Kopf und betrachtete Rasputin, der auf dem Bett schlief. Mit den Fingerspitzen streichelte Workan ihm sanft über den Rücken. Er zog ein paar Salzcracker aus der angefangenen Packung und legte sie neben Rasputin, der sich gleich nach dem Aufwachen darauf stürzen würde. Ein zärtliches Lächeln huschte über Workans Gesicht.
Er trat ans geöffnete Fenster des kleinen Durchschnittshotels, das in einem unauffälligen Teil Frankfurts versteckt war. Kaum Gäste. Kein aufmerksames Personal. Stille. So wie er es bevorzugte.
Vor ihm tat sich die unspektakuläre Aussicht auf die erhöht liegenden Gleise und eine Straße mit hässlichen Wohnblöcken auf. In der Nähe befand sich der Westbahnhof, zur Autobahn war es auch nicht weit. Einige Zeit würde er hier verbringen, anschließend weiterziehen, wo auch immer er hingeschickt werden mochte. Hauptsache, es dauerte nicht allzu lange. Er war ein Mann, der Stillstand nicht mochte. Ein Mann, der agierte, vorwärtsging, immer ein Ziel hatte, der tagelang in Leihautos unterwegs sein konnte, von Stadt zu Stadt, von Auftrag zu Auftrag. Je nachdem in welchem Teil Europas sein Boss Blut vergießen wollte.
Die nächste S-Bahn rauschte heran, und abermals zog Workan der lang gezogene Laut in die Vergangenheit. Zurück nach Moskau, in die Kälte, in die Finsternis.
Auf einmal setzte sich das Bild dieses Pärchens in seinem Gedächtnis zusammen. Es hatte sich offensichtlich in Workans Moskauer Viertel verirrt. Ein junger Mann und eine junge Frau, die an ein paar Straßenkreuzungen unaufmerksam gewesen waren und völlig unvermutet in diese Sackgasse geraten waren.
Sie waren zu fünft oder sechst gewesen, Workan – der damals noch nicht Workan hieß – und die anderen. Keiner älter als fünfzehn. Aber sie waren längst keine Jungs mehr. Workan, mit zwölf der Jüngste, durfte zum ersten Mal dabei sein, er war aufgeregt. In der Sekunde, als dem Pärchen klar wurde, dass es in der Klemme steckte, und sich in den Gesichtern der beiden Panik abzeichnete, fühlte Workan zu seinem Erstaunen einen wohligen Schauer über seinen Rücken rieseln.
Das war etwas vollkommen Neues für ihn. Die eigene Macht. Die Furcht der anderen.
Sie schlugen mit Fahrradketten auf die beiden ein, traten zu, wedelten ihnen mit Schnappmessern vor der Nase herum. Innerhalb von zwei oder drei Minuten hatten sie das Paar bis auf die Unterhosen ausgezogen. Bei mindestens zwanzig Grad minus. Geld, Uhren, Klamotten, die identischen Halsketten mit den herzförmigen Anhängern, sogar die Pudelmützen vergaßen sie nicht. Sie stoben bereits auseinander, um sich später in ihrem üblichen Versteck zu treffen. Doch etwas hielt Workan zurück. Er blieb bei dem Pärchen stehen, das Messer erhoben. Er musste zusehen, wie sie sich vor Schock und Kälte aneinanderklammerten, wie ihre Haut blau anlief, ihre Lippen alle Farbe verloren, musste die gelblich-grünen Schwellungen anstarren, wo die Fahrradketten das Fleisch getroffen hatten.
So oft hatte er Schläge einstecken müssen. Früher war er bis zu dessen Unfalltod von seinem versoffenen Vater verprügelt worden, später von den anderen Mitgliedern der Bande, bei der er gelandet war, als seine Mutter ihn in einem Heim abliefern wollte und er vor Angst einfach getürmt war. Er war der Kleinste, der Schwächste. So oft verspotteten und schikanierten ihn die Größeren.
Nicht an diesem Tag. Er war nicht das Opfer, nein.
Das verzweifelte, geschockte, frierende Pärchen klammerte sich noch immer aneinander fest, und plötzlich wurde Workan von etwas gepackt, einem ganz und gar irren Drang, dem er nachgeben musste. Mit seinem rostigen Schnappmesser stach er zu, erwischte den Mann im Bauch, genoss den Anblick des Blutes auf der fahlen Haut, und erst jetzt rannte er los, das Kreischen der Frau im Ohr.
Er würde die beiden nie vergessen – sie hatten ihm das Gefühl von Macht beschert.
Die Bande, die Workan bei sich aufgenommen hatte, lebte in einem stillgelegten Abschnitt eines U-Bahn-Schachts. Ab jetzt war sein Leben so wie dieser Tunnel: dunkel, geradlinig, ohne Möglichkeit auf eine Umkehr. Sie bildeten eine Welt für sich, sie legten sich Spitznamen zu, sie wurden alle gemeinsam älter und härter.
Workan blieb der Kleinste. Die paar Jahre, die ihm zu den anderen fehlten, würde er nie aufholen können. Und das ließen sie ihn spüren. So zog er sich oft zurück, ganz hinten in den toten Schacht, freundete sich mit den Ratten an, denen er ein paar Brocken Brot oder Käse hinwarf oder was er sonst hatte. Er begann mit den Tieren zu sprechen. Sie machten einen schlauen Eindruck auf ihn, er meinte, mit der Zeit erkannten sie ihn und strömten auf ihn zu.
Die Bande ging zusehends dreister und rücksichtsloser vor. Nächtliche Überfälle auf Erwachsene führten sie nun mit Routine durch. Sie vergaßen, dass sie ein Gewissen besaßen, und sie verlernten es, vor der eigenen Brutalität zu erschrecken.
Der Boss hieß Wassiliew, einfach Wass genannt, ein Junge von siebzehn Jahren. Er war der Erste, der ein Mädchen vergewaltigte, er war der Erste, der eines Tages mit einer Waffe anmarschierte, einer richtigen Waffe. Es war eine 9 mm Glock. Wass präsentierte sie stolz, zeigte die Munition, lud die Pistole, entlud sie wieder. Alle verlangten aufgeregt, er solle damit herumballern, aber er erklärte, er habe nicht vor, wegen ein paar Idioten seine Munition zu verschwenden.
Workans dunkle Augen ruhten auf der Waffe, seine erste Begegnung mit einer Glock. Er wollte sie haben, genau so eine. Das wollten sie alle. Wass schob sich die Glock hinten in den Hosenbund.
Sie fingen an, Geldboten zu überfallen und Autos zu klauen, um mit ihnen durch die Nacht zu rasen. Je stärker Workan von den anderen verlacht wurde, desto öfter zog er allein durch die Straßen, ließ seine Wut an Kindern aus, die er verprügelte, an alten, gebrechlichen Menschen, die er mit einem Knüppel niederschlug, trat, ausraubte.
Der Tunnelabschnitt blieb ihr Wohnzimmer, der Ort, an den man sich zurückziehen konnte. Zigaretten rauchen, dösen, Klebstoff schnüffeln, Steine gegen die Wände werfen und dem dumpfen Hall lauschen. Sie erzählten sich nicht von früher, von dem Leben, das sie vor dem Tunnel gehabt hatten. Die U-Bahnen donnerten ganz in der Nähe vorbei, voll mit Menschen, die nicht ahnten, dass es außer ihrer Welt im Untergrund noch eine andere gab. Die schlechte Luft des Tunnels kroch in Workans Hals, legte sich auf seine Stimmbänder, und er merkte, dass sich in seine Stimme ein heiserer Klang mischte. Nur bei ihm war das so.
Einmal nahmen ein Fernsehreporter und sein Kamerateam aus Deutschland Kontakt zu der Bande von Wass auf. Sie wurden in ihrem Tunnel gefilmt, wie sie rauchten und grinsend von ihrem Alltag erzählten. Wass fuchtelte großspurig mit seiner Waffe herum und zielte zum Spaß auf seine Gang. Workan war der Einzige, den Wass nicht vor die Kamera ließ. Er blieb bei seinen Ratten.
Sie stahlen weiterhin Autos, verkauften sie jetzt sogar. Hierbei durfte auch Workan mitmachen. So lernte er mit Autos umzugehen. Er verbrachte keine einzige Stunde seines Lebens in einer Fahrschule. Der Führerschein, den er später mit sich herumtragen sollte, würde eine Fälschung sein, genau wie alle seine anderen Papiere. Er würde nie versichert sein, nie offiziell eine Wohnung beziehen, nie eine Arbeitsstelle haben oder irgendwo registriert sein. Er würde die Existenz eines Unsichtbaren führen.
Eigentlich lebe ich immer noch in einem Tunnel, dachte Workan, als er in dem Hotel in Frankfurt am offenen Fenster stand.
Was mochte aus den anderen Jungs geworden sein? Wollte er das überhaupt wissen?
Wass war damals immer schlimmer geworden, hinterlistiger, selbstherrlicher. Insbesondere Workan hatte darunter zu leiden. Einmal trieb Wass es noch übler als sonst, begleitet vom Gelächter der übrigen. Er verspottete Workan nicht nur, sondern traktierte ihn auch mit Tritten in den Hintern. Und plötzlich hielt Wass einen Gasanzünder in der Hand. Er setzte ihn auf die Wange des Kleineren – und brennender Schmerz durchfuhr Workan. Immer wieder. Zack, zack, zack! Sein Gesicht schien in Flammen zu stehen, es tat höllisch weh. Wass grölte, Workan weinte. Er rutschte auf den Knien vor Wass herum, der immer weitermachte, manche Stellen mehrfach erwischte.
»Steh auf!«, brüllte Wass ihn an.
Workan kam auf die Beine, zitternd, heulend, mit bebenden Schultern, er konnte die verbrannte Haut in seinem Gesicht riechen, ihm wurde übel.
Der Gasanzünder verschwand, ein kurzer Moment der Erleichterung, die sich sofort in Angst verwandelte. Denn jetzt hatte Wass die Glock in der Hand. Die Mündung war auf Workans Stirn gerichtet.
Die Jungen lachten nicht mehr, eine elektrisierende Stille kehrte ein.
Wass spannte die Waffe.
Workan weinte nicht mehr. Der Stoff seiner Hose, an den Innenseiten der Beine, wurde dunkel. Zwischen seinen ausgelatschten Turnschuhen sammelte sich eine kleine Pfütze. Keiner der anderen machte sich darüber lustig, sie nahmen es einfach aufmerksam zur Kenntnis.
»Lass ihn in Ruhe!«, ertönte plötzlich eine Stimme. Ganz ruhig.
Verblüffung stellte sich in der Runde ein.
Wass wandte sich etwas von Workan ab, der vor sich auf die Erde sah und nicht wagte, den Kopf zu heben.
»Lass ihn in Ruhe!«
Einer von ihnen trat aus dem Kreis in den Vordergrund, ein schweigsamer Kerl, den Workan kaum kannte. Er hieß Novorenkow. Er war so neu bei ihnen, dass er noch nicht einmal einen Spitznamen hatte. Seine Augen waren dunkel und unergründlich, wie die eines Erwachsenen, der schon vieles gesehen hatte.
Wass sah Novorenkow an. »Bist du wahnsinnig?«
Novorenkow blieb stehen. Er öffnete den Reißverschluss seines abgewetzten Anoraks. Im Hosenbund steckte eine Pistole. Dabei hatten alle gedacht, nur Wass besäße eine.
»Du musst wahnsinnig sein.«
Novorenkow stand einfach nur da und hielt es nicht einmal für nötig, seine Pistole zu ziehen. »Wenn du dem Kleinen etwas antust, mach ich dich fertig.«
Wass wusste, dass das nicht nur eine Provokation war. Da stand viel mehr auf dem Spiel. Man konnte es in seinem Gesicht lesen, sogar Workan, der von allen am meisten überrascht war, konnte das.
Wass schoss. Dreimal, viermal, fünfmal. Der Lärm war ohrenbetäubend. Der Hall innerhalb des Tunnels vermittelte den Eindruck, als würden mindestens hundert Waffen abgefeuert. Die Kugeln zischten durch die fade Luft, prallten hinter Workan auf die in dauernder Dunkelheit liegenden Wände und verhallten irgendwo im Nichts.
Novorenkow zog seinen Reißverschluss wieder zu, ohne dass auch nur das leichteste Zittern in seinen Fingern erkennbar gewesen wäre. »Du hast hier nichts mehr zu sagen, Wass. Verpiss dich!«
Workan starrte den Jungen an, den er zuvor überhaupt nicht beachtet hatte. Alle starrten ihn an. Nur nicht Wass, in dessen Augen ein konsterniertes Flackern schien. Seine Zeit war vorbei. Sie hatten jetzt einen neuen Anführer.
Sechzehn Jahre später, in dem Hotelzimmer in Frankfurt, hörte Workan noch den Klang von Novorenkows Stimme.
Er sah dabei in sein eigenes Gesicht, das den Blick im Spiegel erwiderte. Die Narben, die der Gasanzünder hinterlassen hatte, waren nach wie vor erkennbar, hässliche, raue Krater. Hinter ihm ertönten vom Bett her leise Geräusche. Er drehte sich um und lächelte.
Rasputin war aufgewacht und machte sich über die Salzcracker her.
6
Der Abend senkte sich über die Stadt, langsam und machtvoll. Wie ein Leichentuch, dachte Mara Billinsky bitter, als sie nach draußen zum dunkler werdenden Himmel sah, in der Hand einen Plastikbecher mit Kaffee. Vielleicht half er ein wenig gegen das matte, taube Gefühl, das sie erfasst hatte. Sie gähnte und nahm noch einen Schluck von dem dünnen Getränk, das der Automat ausgespuckt hatte.
Ihre Gedanken waren ein einziges Durcheinander, ein dickes Knäuel, das erst wieder entwirrt werden musste. Bilder huschten an ihrem inneren Auge vorüber, schemenhaft, unzusammenhängend. Der von Wunden übersäte Leichnam der rothaarigen Frau in dem Apartment. Die Wrackteile des Opel-Kastenwagens. Die großen Blutlachen im Staub der Straße. Die Leichenteile, die von der Spurensicherung zusammengetragen werden mussten, hier ein Unterarm, da ein Fuß, der noch in einem Sneaker steckte. Die geschockten, entsetzt gaffenden Gesichter der Menschen, die sich auf der in einer Richtung gesperrten A 661 aus ihren abgestellten Autos schälten und mit einigem Abstand zum Tatort reglos dastanden.
Mara erschauerte und versuchte die Eindrücke dieses Tages, der einen ganz normalen Anfang genommen und sich dann zu einem Albtraum entwickelt hatte, irgendwie beiseitezuschieben. Auch wenn sie wusste, dass das unmöglich war.
Sie warf den leeren Becher in einen Abfalleimer und machte sich auf den Weg zurück in ihr Großraumbüro. Über drei Stunden war sie an der Autobahn gewesen, eine Szenerie wie in einem Kriegsgebiet. Anschließend hatte sie in der City Jan Rosen bei den mühsamen Versuchen unterstützt, Zeugen zu finden, die etwas zum Mordfall an der Prostituierten beitragen konnten.
Niemand hatte etwas gesehen oder gehört, niemand kannte die Frau, die auf derart grausame Weise gestorben war. Sicher, man war dieser auffallend attraktiven, aber auch sehr auf Anonymität bedachten Dame ab und zu im Aufzug oder Eingangsbereich begegnet. Offenbar hatte keiner der Befragten jemals auch nur ein einziges Wort mit ihr gewechselt.
Am Schreibtisch angekommen, nahm sie Platz und legte die Beine hoch. Wieder warf sie einen leeren Blick aus dem Fenster. In den paar Sekunden seit dem letzten Schluck Kaffee war es noch einmal dunkler geworden.
Rosens Platz gegenüber war nicht besetzt. Er trieb sich noch irgendwo in dem sechsgeschossigen Kasten herum, in dem das Präsidium untergebracht war und der auf Mara immer wie eine Kriegsfestung aus einer vergangenen Epoche wirkte.
Erneut ein Gähnen. Mara konnte es nicht leiden, wenn Müdigkeit sie befiel; sie brauchte für gewöhnlich keine langen Ruhepausen und war es gewohnt, unter Strom zu stehen, sie verlangte das gewissermaßen von sich. Eine Mahlzeit, wenigstens eine kleine Stärkung, wäre jetzt sicher sinnvoll gewesen, aber die Ereignisse der letzten Stunden ließen nicht einmal den Gedanken daran zu.
Um ihre grauen Zellen wieder auf Trab zu bringen, rief Mara Hauptkommissar Meichel an. Er wirkte beschäftigt und ließ durchblicken, dass er gerade Vorbereitungen traf, um mit seinen Leuten die Spedition Stoberg unter die Lupe zu nehmen. »Mitternacht war ja die angekündigte Zeit. Bis dahin haben wir zum Glück noch ein bisschen Luft.«
»Ich drücke euch die Daumen«, sagte Mara.
»Wahrscheinlich ist es doch nur ein Schuss in den Ofen«, meinte er.
Klimmt hatte sich ja ähnlich ausgedrückt.
»Aber es wäre auch zu ärgerlich«, fuhr er fort, »wenn da ein Ding abgezogen würde – und ich wäre brav zu Hause im Bettchen.«
Nachdem sie sich verabschiedet hatten, checkte Mara, ob ihr Handy irgendwelche Nachrichten empfangen hatte, was nicht der Fall war.
Sie scrollte durch ihre Kontakte und blieb bei dem Namen Edgar Billinsky hängen. Allein die Tatsache, dass er nicht unter einem Begriff wie Papa oder Vater auftauchte, führte ihr wieder einmal vor Augen, wie schwer die Beziehung zwischen ihnen immer gewesen war. Wenn sie ihn anderen gegenüber überhaupt erwähnte, nannte sie ihn in der Regel meinen Erzeuger. Auch das sprach Bände.
Die Unterhaltung mit Klimmt spukte schon wieder durch ihren Kopf. Aus einem Impuls heraus klickte Mara die Handynummer ihres Vaters an. Fast ein Wunder, dass sie die gespeichert hatte, so selten suchten sie den Kontakt zueinander.
Es klingelte eine ganze Weile. Mara konnte sich seinen kritischen Gesichtsausdruck allzu gut vorstellen, als er die Anruferin feststellte. Aber dann ertönte doch noch seine Stimme: »Was für eine Überraschung. Mara Billinsky meldet sich tatsächlich bei ihrem alten Herrn.«
Diese süffisante, wohldosierte Ironie in seinem Ton war ihr immer gegen den Strich gegangen. Und sie hörte heraus, dass er Alkohol getrunken hatte. Kein Wunder bei ihm, erst recht um diese Tageszeit.
»Noch eine größere Überraschung«, gab sie trocken zurück, »dass der alte Herr den Anruf entgegennimmt.«
»Ich bitte dich, Mara, das ist einfach nicht wahr. Wenn du je den Weg zu mir gesucht hättest, dann …«
»Lassen wir das«, fiel sie ihm hart ins Wort und nahm die Beine vom Tisch. »Sprechen wir lieber von deinem alten Freund und Gönner Gernot Grigoleit.«
»Oh Gott, Mara«, stieß er hervor, diesmal ohne jegliche Ironie. »Stell dir vor, dein penetrantes Stochern in der Vergangenheit hat sich bis zu mir herumgesprochen.«
»In dieser Stadt spricht sich doch alles sofort herum.«
»Du solltest Grigoleit in Frieden lassen und aufhören damit.«
»Damit«, äffte sie ihn nach. »Wie das bei dir klingt. Als ginge es um eine nervige Nebensache. Verfluchte Scheiße, ich will doch nur einmal kurz mit Grigoleit reden.«
»Aber er ist nun mal der Ansicht, dass es nichts mehr zu reden gibt. Dass alles in den Akten steht. Dass da nichts ist außer einer dunklen Sackgasse.«
»Ich hatte noch nie Angst vor dunklen Gassen.«
»Da muss ich leider zustimmen. Die haben dich sogar immer regelrecht angezogen.« Milder fügte er hinzu: »Mara, auch wenn es für dich eine Tragödie ist, aber der Mord an deiner Mutter wird niemals aufgeklärt werden.«
»Für mich ist es das tatsächlich«, erwiderte sie rasch. »Eine verfluchte Scheiß-Tragödie.«
»Für mich auch«, beeilte er sich anzumerken. »Doch im Leben muss man lernen, sich mit Tatsachen abzufinden. Übrigens, das ist nur eines der Dinge, die du nie gelernt hast.«
»Mir kommt gleich das Kotzen.«
»Mara, ich appelliere an dich«, wechselte Edgar Billinsky wieder zu seinem ruhigeren Tonfall. »Lass die Vergangenheit ruhen.«
»Das hat mir heute schon mal jemand geraten.«
»Dann mach es nicht wie sonst immer, sondern nimm einen guten Ratschlag einfach mal an.«
»Klar, damit Leute wie du ihre Ruhe haben«, sagte sie abfällig.
»Nicht meinetwegen, sondern um deiner selbst willen. Hör auf, ein Störenfried zu sein, schau nach vorn. Du hast doch jetzt in deiner Abteilung einige Erfolge vorzuweisen. Mach einfach weiter.«
»Keine Sorge, ich mache weiter.«
Jan Rosen hatte das ansonsten leere Großraumbüro betreten und hängte seine Jacke über die Lehne des Schreibtischstuhls, den Blick forschend auf Mara gerichtet.
»Ich weiß genau, wie du das meinst, Mara«, brachte Edgar Billinsky gereizt hervor. »Und ich sage dir, wenn du nicht die Richtung wechselst, rennst du gegen eine Wand.«
»Du bist eine Wand für mich«, antwortete Mara. Sie klickte die Verbindung weg.
Für einen langen Moment herrschte Grabesstille.
Rosen nahm Platz und klappte seinen Laptop auf. Er schielte darüber hinweg zu Mara und räusperte sich, entschied sich dann aber dafür, den Mund zu halten.
»Ich habe es geschafft«, kam es stattdessen von Mara, »seit einer halben Ewigkeit keine Zigarette mehr zu rauchen. Aber immer, wenn ich mit ihm rede, würde ich am liebsten eine ganze Schachtel vernichten. Und dazu mindestens eine Flasche Roten trinken.«
»Dachte ich’s mir doch, dass das dein Vater war.«
Mara winkte ab. »Reine Zeitverschwendung, mit ihm zu sprechen. Und auch über ihn.« Sie setzte sich bequemer hin und legte wieder die Beine auf die Schreibtischplatte.
»Hast du was Neues?«
Rosen schob den Laptop ein Stück zur Seite und blätterte durch einige handschriftliche Notizen. »Ich habe inzwischen einiges über Denise Dorlac herausgefunden.« Auf seine pedantische Art ordnete er die Zettel noch einmal neu. »Was durch die Ergebnisse der Untersuchungen ihres Mobiltelefons gar nicht so schwer war.« Er sah kurz auf. »Übrigens, falls du dich gefragt hast, wo ich war …«
»Das habe ich.«
»In ihrer Wohnung. Ein recht luxuriöses Fünfzimmerrefugium in Sachsenhausen. Wirklich, wenn ich da meine bescheidenen vier Wände zum Vergleich …«
»Nun mach schon, Rosen«, versuchte Mara ihn anzutreiben, ungeduldig wie immer.
»Äh, ja. Klar.« Verdattert raschelte er mit seinen Blättern. »Also. Wie vermutet, war sie eine Prostituierte der absolut edlen Sorte. Der Preis für eine Stunde fing bei siebenhundertfünfzig Euro an. Sie machte wohl kaum Haus- und Hotelbesuche, sondern empfing ihre Kunden fast ausschließlich in dem Apartment in Citynähe. Alter: zweiunddreißig. Ihr richtiger Name: Sabine Pfeiffer.«
»Klingt natürlich nicht ganz so prickelnd wie Denise Dorlac.«
»Sie stammte aus Hanau, in recht bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. Realschulabschluss. Eine abgebrochene Lehre als Industriekauffrau. Wohl schon kurz darauf hat sie begonnen, als Prostituierte zu arbeiten. Zuerst auf dem Straßenstrich. Dann hat sie sich hochgearbeitet, um es mal so auszudrücken.« Rosen legte ein paar Blätter weg, hielt nur noch eines in der Hand. »Unsere Techie-Kollegen von der digitalen Abteilung haben dank des Handys Einblick in ihre Konten erhalten. Keine Frage, sie war überaus gutgestellt.«
»Familie?«
»Ihr Vater ist vor einigen Jahren gestorben, ihre Mutter lebt noch in Hanau. Wir werden zu ihr fahren müssen, um sie persönlich zu benachrichtigen, gleich morgen als Erstes.«
»Mir graut es jetzt schon davor«, sagte sie leise.
»Geschwister hatte sie keine«, schloss Rosen mit seiner spröden Stimme die Aufzählung.
Mara nickte nachdenklich. »Wir müssen herauskriegen, mit wem sie privat Kontakt hatte und wer ihre Freier waren.«
»Es gibt tatsächlich eine ordentlich geführte Kundenliste. Aber die Namen darauf sind zweifelsfrei Deck- oder Codenamen.« Rosen hob die Achseln. »Gut möglich, dass Denise Dorlac selbst nicht immer über die wahre Identität der Männer im Bilde war.«
»Oder sie verstand sich darauf, Geheimnisse zu bewahren«, warf Mara ein.
»Jedenfalls werten die Kollegen immer noch aus. Handy, Computer. Auch den Papierkram, auf den wir in der Wohnung gestoßen sind.« Rosen musterte sie. »Und bei dir? Was war das für eine Hölle auf der A 661? Wir konnten gar nicht richtig darüber quatschen.«
»Auch da werden noch alle Spuren zusammengetragen. Der Autobahnabschnitt ist nach wie vor gesperrt. Das einzige Sichere ist: Es war eine Autobombe.« Maras Miene drückte blanke Ratlosigkeit aus. »Aber sonst? Alles nur ein blutiges Fragezeichen. Stell dir vor, es ist noch nicht einmal sicher, wie viele Menschen sterben mussten. Geschweige denn, warum. Und durch wessen Hand.« Sie pustete Luft durch die fast geschlossenen Lippen. »Puuh, einen trocknen tiefroten Italiener, den könnte ich jetzt echt brauchen.«
»Damit kann ich leider nicht dienen.« Rosen fuhr sich durch sein akkurat kurz geschnittenes, bereits schütteres Haar. »Ich glaube, ich breche auf. Bin todmüde. Ist ja auch schon wieder nach zehn.« Er schüttelte den Kopf, den Blick ins Nichts gerichtet. »Was für ein Tag.«
Gleich darauf war Mara allein in dem großen quadratischen Raum mit den sechs paarweise angeordneten Schreibtischen. Sie fühlte eine tiefe Leere in sich. Mit mechanischen Bewegungen machte sie sich bereit für den Aufbruch. Worte, die bei der Auseinandersetzung mit ihrem Vater gefallen waren, schwirrten in ihrem Kopf umher wie kleine Insekten, die sich nicht vertreiben ließen.
Als sie im Auto saß und sich auf dem Weg Richtung Bornheim befand, hatte die Aussicht, ihre dunkle Wohnung zu betreten, etwas Erdrückendes. Unweigerlich wurde ihr vor Augen geführt, wie einsam ihr Leben war, wie wenige Menschen es gab, bei denen sie den Drang verspürte, sich auf sie einzulassen. Der Letzte von ihnen war Carlos Borke gewesen. Ein Einzelgänger wie sie, der als Polizeispitzel unterwegs war und zugleich Geschäfte mit Gangstern machte. Er war ermordet worden. Ja, Borke. Sie vermisste ihn. Und sie hasste es, wenn sie in einer solch gedrückten Stimmung an ihn denken musste.
Aus einem spontanen Entschluss heraus wechselte Mara die Spur und bog dann in eine andere Richtung ab. Sie nahm eine Landstraße, die nördlich aus Frankfurt hinausführte. Nur Minuten später erreichte sie ein kleines trostloses Industriegebiet mit Firmen, Hallen und Großgaragen.
Am Straßenrand parkte sie, dann rief sie Meichel an, um ihm zu sagen, dass sie in der Nähe war.
»Was wollen Sie denn hier, Billinsky?«, fragte er verwirrt.
»Nicht mehr lange bis Mitternacht. Ich dachte, ich sehe mal nach, ob mein Tipp etwas wert ist.«
»Sind Sie verrückt? Sie haben wohl keine Hobbys.«
»Ich bin gleich bei euch.«
Wiederum nur Minuten später stand sie neben ihm und seinen Männern. Alle betrachteten aus sicherer Entfernung, getarnt durch ein unauffälliges Zelt, wie es Bauarbeiter benutzten, ein mit Maschendraht umzäuntes Areal: die Spedition Stoberg, wie ein von Rost zerfressenes Schild anzeigte. Oder das, was von ihr übrig war. Ein leeres schäbiges Verwaltungsgebäude, von dem der Putz blätterte, ebenso leere Lkw-Parkplätze und eine verschlossene Garagenhalle für die Lastwagen.
Meichel hatte die Stirn skeptisch in Falten gelegt. Er war fast so alt wie Klimmt, doch sonst verband die beiden nichts. Klimmts schroffe, ruppige Art, sein brütender Zynismus, das war Meichel fremd. Er war ein drahtiger, sportlicher Mann mit stahlgrauem Haar, der den Eindruck erweckte, sich noch einen Rest Idealismus bewahrt zu haben, und daran glaubte, in seinem Job etwas Gutes bewirken zu können.
»Es sieht nicht so aus, als würde uns hier noch etwas Spannendes geboten werden«, sagte er leise.
Kaum hatte Meichel die Worte ausgesprochen, da erklang das Dröhnen eines Motors. Scheinwerfer durchstachen die Dunkelheit.
Rumpelnd näherte sich ein Lkw der Spedition und stoppte. Die Beifahrertür öffnete sich, ein Mann sprang heraus. Er schob das offenbar nicht abgeschlossene Tor auf, und das Fahrzeug legte die letzten Meter bis zu der großen Parkplatzfläche vor dem Gebäude zurück.
»Münchner Kennzeichen«, sagte Mara.
Fast im selben Moment tauchten zwei Autos auf, eine Limousine und ein SUV. Sie passierten das offene Tor und hielten ebenfalls an. Die Motoren verstummten.
»Vielleicht habe ich mich getäuscht«, murmelte Meichel. »Es könnte doch noch spannend werden.«
Sechs Gestalten standen um den Lkw. Sie unterhielten sich, warfen hin und wieder prüfende Blicke in die Umgebung. Von den Straßenlaternen drangen nur schwache Fetzen aus milchigem Licht bis zu dem Speditionsparkplatz.
Mara musterte Meichel. »Na, was denken Sie?«
»Meine alte Bullennase sagt mir, dass da etwas läuft, was absolut nicht koscher ist.« Er nahm Blickkontakt mit seinen Männern auf. »Auch wenn es ein Schuss auf gut Glück ist: Wir sollten uns die Herren dort drüben mal aus der Nähe anschauen.« Dann wandte er sich an Mara. »Sie, Billinsky, halten sich im Hintergrund. Das ist unser Spielfeld.«
»Ganz wie Sie meinen.«
Meichel wollte sich mit seinem Team gerade in Bewegung setzen, als plötzlich aus der Gegenrichtung in schneller Fahrt weitere Autos auftauchten.
Der Hauptkommissar hob die Hand. »Warten wir noch einen Moment.«
Es waren zwei weitere SUVs, beides Porsche. Auch diese Wagen stoppten auf dem Parkplatz der Spedition Stoberg. Männer stiegen aus, zurückhaltende Begrüßungen, kein Händeschütteln. Einer von ihnen öffnete die Ladefläche, metallische Laute in der ansonsten stillen Nacht. Das Industriegebiet war abgelegen, der Verkehrslärm der Autobahn und der Frankfurter Zufahrtsstraßen drang nur gedämpft bis hierher.
Die Männer verschwanden nacheinander im Inneren des Lkws, bis auf zwei, die wohl als Wachposten abkommandiert waren.
Etwas Wildes mischte sich in Meichels Blick. »Fast wären wir zu früh gewesen.«
»Vor allem sind wir zu wenige«, bemerkte einer seiner Männer und warf einen Blick in die Runde, die mit Mara auf sechs Personen angewachsen war.
»Kommt darauf an, für was«, antwortete Meichel. Dann wiederholte er in Maras Richtung: »Trotzdem, Billinsky, Sie halten sich zurück.«
Ein schmales Lächeln umspielte ihre Mundwinkel. »Wird gemacht.«
Angeführt von Meichel verließen die Beamten das Zelt, durch dessen Sehschlitze sie bislang alles beobachtet hatten.
Mara trat ebenfalls vor das Zelt, blieb dann allerdings stehen.
Angespannt verfolgte sie, wie die Polizisten sich mit raschen Schritten dem Speditionsgelände näherten, durchs Tor huschten und dann direkt auf die Fahrzeuge zuhielten.
Ein Wachposten rief etwas, die übrigen Männer sprangen sofort von der Ladefläche herunter. Und jetzt ging alles rasend schnell.
Ein Durcheinander aus Schreien und Schüssen.
Drei der Fremden versuchten sich in ihre Autos zu retten, andere rannten einfach in Panik davon, einer wurde von einer Kugel getroffen und landete röchelnd auf dem Asphalt.
Fast unbewusst hatte Mara ihre Dienstwaffe gezogen. Sie spürte den Stahl in der Hand, vertraut und doch wie so oft mit dieser verwirrenden, jähen Plötzlichkeit. Sie ging auf das Tor zu.
Einer der Fremden rannte hindurch, genau in Maras Richtung, ein Schemen in der Nacht.
Als er sie entdeckte, hielt er abrupt inne.
Auch Mara stoppte ruckartig.
Vom Parkplatz drangen noch immer Schüsse zu ihr.
»Polizei!«, rief Mara. »Keine Bewegung!«
Er stand da, ein junger Mann in elegantem Kurzmantel, mit schwarzem Haar und nervös flackernden Augen.
Seine Hand zuckte zur Manteltasche.
»Nicht!«, schrie sie.
Die Hand verschwand in der Tasche.
Ein Moment, so unheimlich, so intensiv, so übermächtig.
Das Adrenalin peitschte durch Maras Körper. Ihr Mund war schlagartig seltsam trocken, doch zugleich vermochte sie nahezu mechanisch das anzuwenden, was sie für derartige Situationen immer und immer wieder eingeübt hatte. Druckpunkt, nicht atmen, bei entspanntem Hahn ganz gleichmäßig den Abzugswiderstand überwinden, nicht reißen.