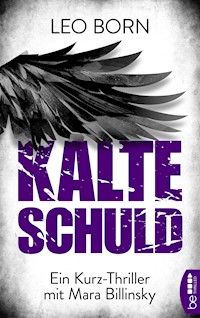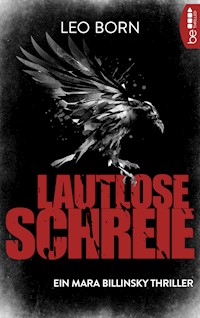9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Mara Billinsky
- Sprache: Deutsch
Düster, detailreich und extrem spannend: Der sechste Fall für Deutschlands härteste Ermittlerin und ihr Team!
Frankfurt wird von einer brutalen Mordserie erschüttert, deren blutige Spuren Kommissarin Mara "Die Krähe" Billinsky bis nach Sizilien führen - mitten in ein grausames Netz aus Zwangsprostitution, Drogenhandel und düsterem Aberglauben. Maras einzige Chance, um an die Hintermänner dieser finsteren Organisation zu gelangen, ist die Prostituierte Joy. Doch Joy flieht vor ihren Peinigern - und wird zur lebenden Zielscheibe einer gnadenlosen Jagd durch die Mainmetropole .
"Autor Leo Born hat eine faszinierende Hauptfigur geschaffen. Wer es in Krimis gerne ein bisschen düster mag, ist hier genau richtig. Das können nicht nur die Skandinavier... (WDR2-Krimitipp zu "Blinde Rache")
"Thrillerunterhaltung de luxe! Absolute Leseempfehlung!." (Gina 1627)
"Leo Born zeichnet mit seinem packenden Schreibstil und seinen bildhaften Beschreibungen, die das Kopfkino beim Lesen auf Hochtouren laufen lassen, auch hier wieder ein düsteres und ungeschminktes Bild der Mainmetropole, bei dem er seine überzeugend gezeichneten und vielschichtig angelegten Protagonisten tief in die düsteren Ecken Frankfurts eintauchen lässt." (Ech68, Lesejury)
"Ein Thriller voller überraschender Wendungen und tiefen Emotionen." (Vivi_2084, Lesejury)
Bisher sind in der Reihe erschienen:
Blinde Rache
Lautlose Schreie
Brennende Narben
Blutige Gnade
Vergessene Gräber
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 527
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber den AutorTitelTeil 1: Schwarze GlühwürmchenMädchen, die auf Reisen gehen1234567Mädchen, die auf Reisen gehen891011121314Teil 2: Glitzernde NatternMädchen, die auf Reisen gehen1516171819202122Mädchen, die auf Reisen gehen23242526Mädchen, die auf Reisen gehen2728Mädchen, die auf Reisen gehen293031323334Teil 3: Stumme Schwalben353637383940414243444546474849505152535455565758Teil 4: Weiße Würmer596061626364656667686970717273747576777879808182Mädchen, die auf Reisen warenÜber den AutorImpressumÜber dieses Buch
Band 6 der Reihe »Ein Fall für Mara Billinsky«
Düster, detailreich und extrem spannend: Der sechste Fall für Deutschlands härteste Ermittlerin und ihr Team!
Frankfurt wird von einer brutalen Mordserie erschüttert, deren blutige Spuren Kommissarin Mara »Die Krähe« Billinsky bis nach Sizilien führen – mitten in ein grausames Netz aus Zwangsprostitution, Drogenhandel und düsterem Aberglauben. Maras einzige Chance, um an die Hintermänner dieser finsteren Organisation zu gelangen, ist die Prostituierte Joy. Doch Joy flieht vor ihren Peinigern – und wird zur lebenden Zielscheibe einer gnadenlosen Jagd durch die Mainmetropole.
„Autor Leo Born hat eine faszinierende Hauptfigur geschaffen. Wer es in Krimis gerne ein bisschen düster mag, ist hier genau richtig. Das können nicht nur die Skandinavier … (WDR2-Krimitipp zu »Blinde Rache«)
»Thrillerunterhaltung de luxe! Absolute Leseempfehlung!.« (Gina 1627)
»Leo Born zeichnet mit seinem packenden Schreibstil und seinen bildhaften Beschreibungen, die das Kopfkino beim Lesen auf Hochtouren laufen lassen, auch hier wieder ein düsteres und ungeschminktes Bild der Mainmetropole, bei dem er seine überzeugend gezeichneten und vielschichtig angelegten Protagonisten tief in die düsteren Ecken Frankfurts eintauchen lässt.« (Ech68, Lesejury)
»Ein Thriller voller überraschender Wendungen und tiefen Emotionen.« (Vivi_2084, Lesejury)
Bisher sind in der Reihe erschienen:
Blinde Rache
Lautlose Schreie
Brennende Narben
Blutige Gnade
Vergessene Gräber
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Teil 1
Schwarze Glühwürmchen
Mädchen, die auf Reisen gehen
Sie war nackt.
Vollkommen nackt.
Man konnte alles sehen, ihren gesamten Körper, ihre Haut, jeden Kratzer, jede Pore.
Nie in ihrem Leben hatte Azuka sich so wehrlos, so verletzlich gefühlt. Ihr Herz trommelte. Tiefe Furcht breitete sich in ihr aus.
Der Mann, der sie hergebracht hatte, ging wortlos nach draußen. Damit befand sich außer ihr nur noch der Priester in dem Wellblechverschlag. Er trug eine hölzerne, rot und weiß bemalte Maske, die sein Gesicht verbarg, und war in seine Galabia gehüllt, den langen Baumwollkaftan. Seine nackten Arme waren von Narben übersät.
Von dem dickflüssigen Getränk, das er Azuka Minuten zuvor in einer Tonschale gereicht hatte, musste sie immer noch würgen. Gift? Drogen? Sie blinzelte. Vor ihren Augen begann sich plötzlich alles zu drehen, ihre Lider flatterten.
Der Priester winkte sie näher zu sich heran.
Zögernd machte sie zwei Schritte auf ihn zu. Sand und winzige Steinchen stachen in ihre bloßen Sohlen, doch sie war viel zu verstört, um darauf zu achten. Ihr Gesicht war schweißbedeckt. Weiterhin sah sie alles nur verschwommen. Sie zitterte, ihre Beine fühlten sich sonderbar weich an, als besäße sie keine Knochen mehr.
Der Priester streckte ihr seine riesige Pranke hin, Handfläche nach oben, und Azuka übergab ihm den kleinen, durchsichtigen Zellophanbeutel, dessen Inhalt er vor einer der vielen brennenden Kerzen begutachtete. Es handelte sich dabei um Azukas Menstruationsblut, das sie mit einigen ihrer abgeschnittenen Zehennägel und Schamhaare vermischt hatte, wie es ihr aufgetragen worden war.
Er ließ den Beutel unter seinem Gewand verschwinden und bedachte Azuka mit einem eindringlichen Blick, den sie durch die Augenöffnungen der Maske wie eine Berührung auf ihrer Haut zu spüren meinte. Er begann düstere Beschwörungsformeln zu murmeln, recht leise, doch das war unheilvoller und beängstigender, als wenn er gebrüllt hätte. Seine Hand lag auf ihrer Schulter. Er drückte Azuka nach unten, bis sie auf dem Boden kniete.
Ihr Herzschlag ging noch schneller, ihre Nerven spielten völlig verrückt. Einen Moment lang dachte sie verwirrt, die Hütte wäre auf einmal voller Menschen, voller Stimmen. Aber natürlich war sie nach wie vor allein mit dem Priester, der sich nach einem verschließbaren Korb bückte, aus dem ein Rascheln erklang. Er öffnete den Deckel. Jäh zog er ein Huhn hervor, das in seiner großen Hand wild flatterte.
Azuka kam sich vor wie dieses hilflose Huhn.
In seiner anderen Hand hatte der Priester plötzlich ein Messer. Das Huhn gackerte immer lauter und aufgeregter, der Ton war unerträglich.
Er hielt das Tier genau über Azukas Kopf. Wieder glaubte sie Stimmen wahrzunehmen, die durcheinanderredeten, doch auch das unentwegte Murmeln des Mannes war deutlich zu hören.
Abrupt verstummte das Huhn. Fast gleichzeitig spürte Azuka eine Flüssigkeit, die auf sie herabregnete. Warm und klebrig floss sie ihren Hinterkopf herab und an ihrer Wirbelsäule entlang. Obwohl sie schwitzte wie nie zuvor in ihrem Leben, war mit einem Mal alles eiskalt in ihr.
Das leblose Tier wurde ihr direkt vors Gesicht gehalten. Mit dem Messer schnitt der Priester in dem kleinen, dürren Körper herum. Dann warf er ihn achtlos weg und legte etwas, das er in der Hand verbarg, in eine weitere kleine Tonschale.
Erneut stieß er seine Beschwörungsformeln aus, in Azukas Kopf drehte sich alles noch schneller. Im nächsten Moment spürte sie den Schmerz, als die Klinge ihre Haut ritzte. Einmal, zweimal, dreimal und noch öfter. Auf den Schulterblättern, weiter unten auf dem Rücken, hinter beiden Ohren. Das Blut des Tiers vermischte sich mit ihrem eigenen, die Stimme des Mannes toste in ihrem Kopf.
Mit der freien Hand hob er Erde auf und rieb sie in Azukas Wunden. Es brannte. Er raunte etwas von geheiligtem Heimatboden, den sie von nun an unter der Haut tragen würde, wo immer sie sich befinden mochte, bis zu ihrem letzten Tag.
Diese Worte machten ihr bewusst, dass sie bald aufbrechen musste. Dann würde sie zu ihnen gehören. Zu den Mädchen, die auf Reisen gehen. So nannte man sie, obwohl man meistens eher darauf achtete, kein Wort über sie zu verlieren.
Die letzten Zauberformeln des Priesters erklangen, gefolgt von einer Stille, die Azuka noch mehr erschreckte als zuvor die vielen Stimmen in ihrem Kopf.
Die kleine Schale wurde vor sie hingestellt, ganz dicht vor ihre Knie. Darin lag das Herz des Huhns. Das Organ sah widerlich aus und schien noch leicht zu zucken.
Azuka wusste, was von ihr erwartet wurde.
Sie holte Luft und griff verzweifelt nach dem Herzen. Warm lag es in ihrer zitternden Hand. Sie schob es sich in den Mund, biss zu, kaute. Der Priester sagte ihr Worte vor. Sie sprach sie mühsam nach, musste dabei immer wieder heftig würgen.
Erneut wurde die Hütte von Stille erfüllt.
Azuka verspürte eine jähe Erschöpfung. Ihre Lider sanken herab, alles wurde schwarz. Trotzdem sah sie etwas, erst nur vage, dann deutlich: ihre Seele. Tatsächlich. Schutzlos schwebte ihre Seele durch die Luft, klein und zart, geformt wie eine Blume, die ihre Blütenblätter schloss für die Nacht. Azuka hielt den Atem an, und tief in ihr erwuchs die Erkenntnis, dass sie ausgeliefert war. Dass es kein Zurück gab.
1
Am Ende dieses Abends würde er tot sein. Er hatte nicht den leisesten Zweifel. Schon seit Stunden stieg Angst in ihm auf, er schmeckte sie auf der Zunge, bitter wie Gift.
Alles fühlte sich fremd an, als hätte er es nie zuvor getan, selbst das Autofahren kam ihm ungewohnt vor. Er vergaß, den Blinker zu setzen, und bog ruckartig ab. Mit zusammengepressten Lippen folgte er der schmalen, von Schlaglöchern übersäten Straße, bis er die seit Langem stillgelegte Gießerei entdeckte. Er brachte den Wagen zum Stehen. Als er den Motor ausschaltete, machte ihm die einsetzende Stille seine verzweifelte Lage nur noch bewusster.
Sie hatten ihn völlig in der Hand. Und jetzt? Welche Wahl hatte er? Nachgeben und bezahlen – oder sich wehren. Dazwischen gab es nichts.
Schweiß stand ihm auf der Stirn. Wieder überfiel ihn die Gewissheit, dass er diesen Tag, ja vielleicht die nächsten Minuten nicht überleben würde.
Ein Blick zur Uhr, ein tiefes Seufzen, dann stieg er aus. Von der Rückbank holte er den Aktenkoffer. Mit steifen Schritten näherte er sich der Fabrik, zu der er am Vormittag beordert worden war. Der Koffer fühlte sich schwerer an, als sein Inhalt war.
Er überquerte das Parkplatzareal. Zwei Autowracks rosteten auf platten Reifen vor sich hin. Nicht mehr lange, und die Dunkelheit würde sich über das von Unkraut überwucherte Fabrikgelände senken, das am äußersten Rand eines Industriegebiets lag. Er betrat die Gießerei durch den Vordereingang. Die Flügel der Doppeltür standen offen, ihre Scheiben waren zersplittert. Er folgte einem langen Korridor im Erdgeschoss, vorbei an Büros, in denen alte Akten und noch gefüllte Schnellhefter wild verstreut herumlagen, als wäre das Unternehmen damals von einem Tag auf den anderen dichtgemacht worden.
Eine Ratte huschte vor seinen Füßen vorbei und verschwand.
Am Ende des Korridors hing eine Tür schief in den Angeln.
Er hielt inne. Atmete tief durch und schwitzte noch stärker. Die Angst schien ihn zu lähmen.
Waren sie bereits da? Erwarteten sie ihn?
Sie konnten mit ihm spielen wie eine Katze mit einer Maus. Die Situation überforderte ihn. Als es angefangen hatte, war er sicher gewesen, jederzeit alles im Griff zu haben. Nie hätte er für möglich gehalten, dass es jemals so weit kommen würde. Und jetzt … Immer noch rührte er sich nicht von der Stelle.
Würde er wagen, was er sich vorgenommen hatte? Nun ja, erst einmal würde er abwarten, was sie sagten, und womöglich … Nein, es gab keinen anderen Ausweg, das war ihm klar, es war dumm, sich etwas vormachen zu wollen. Sein Herz hämmerte in der Brust. Er musste sich zwingen, seinen Weg fortzusetzen und die Halle zu betreten. Hohe Decke, nackte Wände, massige Stützpfeiler. Über die in gut zwei Metern Höhe eingesetzten, größtenteils kaputten Fenster drang das schwächer werdende Tageslicht als milchiger Schleier ins Innere. Sanft legte es sich über die Männer, die am anderen Ende der Halle standen und ihm entgegensahen.
Langsam bewegte er sich auf sie zu, noch steifer als zuvor, und er fragte sich, ob sie das bemerkten.
Sie waren zu zweit. Für ihn benötigte man nicht mehr, sollte das wohl heißen. Kapuzen, Hoodies, funkelnde Goldketten, Sneaker. Sie wirkten auf ihn wie Gestalten aus einem Videoclip auf MTV, es fehlten nur noch die stampfenden Beats eines Rap-Songs.
Die Stimme ließ die Stille ringsum zersplittern: »Hast du das Geld?«
Er stoppte, als wäre er gegen eine unsichtbare Wand gelaufen.
»Natürlich«, hörte er sich mit dünner Stimme antworten.
Beide Männer deuteten ein Grinsen an, überheblich und ganz die Ruhe selbst. Die lässige Art, mit der sie sich präsentierten, hatte für ihn etwas Demütigendes, und das machte alles noch schlimmer. Sie standen relativ nahe beieinander, auch das ein Zeichen, dass sie keinen Respekt vor ihm hatten. Denn je größer der Abstand zwischen Personen war, desto schwerer war es bei einer Auseinandersetzung, sie auszuschalten. Ja, sie waren vollkommen entspannt.
»Dann mal her mit der Kohle, Josch.«
Er fuhr sich mit der Zungenspitze über die trockenen Lippen. Josch. Diesen Namen hatte er ihnen genannt, als sie sich kennengelernt hatten. Inzwischen wussten sie, wie er in Wirklichkeit hieß.
Er kniete sich hin, legte den Aktenkoffer auf dem Boden ab und klappte ihn so auf, dass die Männer keinen Blick auf den Inhalt werfen konnten. Er badete geradezu im Schweiß.
Nachher wirst du tot sein.
Kein anderer Ausweg, sagte er sich erneut. Er würde durchführen, was er sich vorgenommen hatte. Nie zuvor hatte er so etwas gemacht. Gewiss, er hatte mit Gewalt zu tun gehabt, aber das war nicht vergleichbar.
»Na los, Josch«, ertönte die nächste Aufforderung.
Aus dem Augenwinkel streifte er sie mit einem unauffälligen Blick. Wo trugen sie ihre Waffen? Hinten im Hosenbund? Er musste schnell sein. Musste sie vollkommen überrumpeln. Das würde sein Vorteil sein – sein einziger.
Jetzt! Er riss die schon vor Fahrtantritt entsicherte Pistole aus dem Seitenfach des Koffers und begann im Knien zu schießen, ohne zu zielen, er drückte einfach den Abzug durch, immer wieder. Die Männer zogen ihre Waffen. Das gewaltige Dröhnen der vielen Schüsse ließ ihn erzittern, er fühlte sich wie im Zentrum eines tobenden Orkans. Durch den Pulverdampf tränten seine Augen. Erneut drückte er ab und noch einmal und noch einmal, bis das Magazin fast leer war.
Als eine dumpfe Stille eintrat, wusste er nicht, wo ihm der Kopf stand. Hatte er überhaupt irgendwen getroffen? Hatte er etwa selbst etwas abbekommen? Er keuchte und ließ seine Pistole fallen, die mit einem metallischen Klacken auf dem Boden landete. Schweiß lief noch immer an ihm herunter. Oder war es Blut? Er schloss die Augen.
2
Irgendetwas lag in der Luft. Es erfüllte die Gänge, die Büros, die Kantine. Jeder hatte etwas gehört, aber keiner etwas Verlässliches. Seit gut vier Wochen fehlte Hauptkommissar Rainer Klimmt nun schon. Krankheitsbedingt, wie es hieß. Welches Leiden den Leiter der Mordkommission zu der Pause zwang, wusste allerdings niemand, obwohl sich doch so etwas schon längst herumgesprochen haben müsste. Und jetzt hatte Staatsanwalt Christian von Lingert auch noch kurzfristig eine Besprechung für das gesamte Team einberufen.
Ja, irgendetwas lag in der Luft, diesen Eindruck hatte auch Kommissar Jan Rosen, der hastig von seinem Schreibtisch aufstand. Ein dienstliches Telefonat hatte ihn Zeit gekostet, und nun musste er sich beeilen. Er mochte es nicht, zu spät zu kommen. Nicht nur Pünktlichkeit war ihm wichtig, auch gute Manieren, Ordnung und das Einhalten des polizeilichen Regelwerks. Eigentlich ein Wunder, dachte er in einem Anflug eher seltener Ironie, dass er schon seit einer ganzen Weile eng mit einer Kollegin zusammenarbeitete, die bisweilen auf all das pfiff.
Wo trieb sie sich eigentlich wieder herum? Wo war Mara Billinsky?
Sie hatte etwas Unberechenbares, steckte voller Energie und war eigentlich ebenfalls eine Einzelgängerin – ein Grund mehr, um sich darüber zu wundern, dass ihre Zusammenarbeit meistens ganz gut klappte.
Auf dem Weg zum Konferenzraum eilte Rosen hinter zwei Kollegen her, die ihrerseits unterwegs zur Besprechung waren. Ihren Bemerkungen entnahm er, dass Hauptkommissar Klimmt wohl noch länger ausfallen würde. Die beiden stellten Mutmaßungen an, wer ihn – zumindest fürs Erste – vertreten solle. Schleyer und Patzke waren die Namen, die fielen. Offenbar wurde diese Frage schon länger unter allen Kollegen erörtert, ohne dass Rosen, der immer ein Außenseiter gewesen war, es so richtig mitbekommen hatte.
Er betrat als Letzter den modern ausgestalteten Raum mit den Möbeln aus hellem Birkenholz, den in Grün gehaltenen Tapeten und dem Whiteboard, vor dem der Staatsanwalt bereits Aufstellung genommen hatte.
Als Rosen die Tür schloss, begann Christian von Lingert unverzüglich mit der Ansprache, beäugt von der gesamten Abteilung.
»Ich danke Ihnen allen, dass Sie einen zeitlichen Slot gefunden haben, um hier zu sein. Die meisten von Ihnen werden sich denken können, warum ich Sie hergebeten habe – es geht um Hauptkommissar Klimmt.«
Von Lingerts ausgeprägte Geheimratsecken, das streng nach hinten gekämmte, über den Ohren graue Haar und die Brille ließen ihn älter wirken als seine vierzig Jahre. Das kantige, schmale Gesicht mit den tief liegenden kleinen Augen zeugte von Entschlossenheit. Er war wahrlich kein Typ, der herzlich wirkte oder gar vor Humor sprühte. Über ihn kursierten keine Gerüchte, das Privatleben hielt er gekonnt unter Verschluss. Er war ledig, anscheinend nicht einmal liiert, und sein kleiner, aber feiner Freundeskreis bestand aus renommierten Juristen. Ansonsten wusste man nichts über ihn.
»Nach meinem jetzigen Kenntnisstand«, fuhr er fort, »wird der Chef Ihrer Abteilung wohl noch eine ganze Weile fehlen. Sie verstehen sicher, dass ich hier nicht ins Detail gehen kann.«
Rosen fiel auf, dass von Lingert angespannt wirkte, auch wenn der Staatsanwalt das wie üblich durch seine fast schon übertrieben sachliche Art zu überdecken versuchte.
»Es geht nun darum«, sprach von Lingert weiter, »Herrn Klimmts Position interimsweise zu besetzen.«
Ein Moment tiefer Stille entstand. Unauffällige Blicke wurden gewechselt.
»Derjenige, der diese Rolle übernimmt, dient als direkter Ansprechpartner für mich und hat darüber hinaus …« Er musste sich räuspern, richtete den Krawattenknoten. »… bei allen Entscheidungen, die Ihre Abteilung betreffen, das letzte Wort.«
Für jemanden wie von Lingert eine recht unpräzise Ausdrucksweise, befand Rosen und sah verstohlen in die Runde. Wieder fragte er sich beiläufig, wo Mara Billinsky stecken mochte.
Der Staatsanwalt schien die nächsten Worte genau abzuwägen, wie seine starre Miene verriet. »Es war letzten Endes die Entscheidung des Hauptkommissars, schließlich geht es um seine Abteilung.«
Rosen stutzte. Offenbar war der Staatsanwalt nicht unbedingt begeistert über das, was er mitzuteilen hatte.
»Wie dem auch sei«, sagte von Lingert. »Ich gebe Ihnen nun bekannt, wer den Hauptkommissar bis zu seiner Rückkehr vertreten wird.«
Viele Blicke streiften Schleyer und Patzke, die aussichtsreichsten – und wohl einzigen – Kandidaten.
Dann nannte von Lingert den Namen.
Rosen merkte, wie ihm der Kiefer nach unten klappte. Er konnte nicht glauben, was er hörte. Verdutzt musterte er die Kollegen. Jedem stand die Verblüffung ins Gesicht geschrieben, manchem sogar kaum verhohlene Wut.
Nach einem Raunen breitete sich wiederum Stille aus. Man konnte sie förmlich mit den Händen greifen.
3
Durch ein zerklüftetes Meer aus Wolkenfetzen stachen hier und da blasse Sonnenstrahlen. Die Luft war an diesem späten Nachmittag von einer Kälte erfüllt, die dem Frühling keine Chance gab. Doch Mara Billinsky spürte kaum, dass sie fröstelte, so angespannt war sie.
Sie hätte Verstärkung anfordern müssen, ihre Alleingänge waren längst berüchtigt und bei den Kollegen nicht unbedingt beliebt. Allerdings war mal wieder alles sehr schnell gegangen, und ein Impuls hatte ihr gesagt, sie müsse dranbleiben und sich auf den Mann konzentrieren, den sie in der Nähe des Hauptbahnhofs aufgespürt hatte.
Als er die Rolltreppe nach unten genommen hatte, um eine U-Bahn zu erwischen, war sie ihm unauffällig in den Waggon gefolgt. Am Ostbahnhof war er ausgestiegen. Sie blieb ihm auf den Fersen, doch etwas hatte ihn misstrauisch gemacht. Ganz kurz nur hatten sich ihre Blicke gekreuzt – das allerdings hatte genügt, sie spürte es.
Er bewegte sich anders, schien nun aufmerksamer zu sein. Er nahm die Rolltreppe, ging dann Richtung Danziger Platz.
Mara musste vorsichtig sein. Sie durfte ihm nicht zu nahe kommen, ihn aber auch nicht aus den Augen lassen. Jede Menge Leute befanden sich zwischen ihnen, wahrscheinlich Angestellte, die jetzt um die Feierabendzeit mit der S-Bahn aus Frankfurt hinaus nach Hause wollten.
Auf dem Danziger Platz herrschte ein ziemliches Durcheinander an Passanten. Hinzu kamen eine Menge Obdachlose, die überall verstreut auf Pappen und Schlafsäcken hockten, halb volle Wodkaflaschen vor sich.
Plötzlich rannte der Mann von einem Augenblick auf den anderen los.
Mara hatte sich also nicht getäuscht. Er hatte sie bemerkt. Ohne zu zögern, nahm sie die Verfolgung auf. Sie hetzte zwischen Fußgängern und Radfahrern hindurch, stolperte fast über einen auf Decken sitzenden Bettler und rannte weiter.
Der Flüchtende beschrieb einen Bogen und rannte den Weg zurück, auf dem sie gekommen waren, die Unterführung hindurch auf die andere Seite, weiter bis zur Hanauer Landstraße. Nur einmal sah er zurück, um sich zu vergewissern, dass sie hinter ihm her war. Er beschleunigte, überquerte die stark befahrene Straße, und auch da ließ Mara sich nicht abschütteln, wobei sie die quietschenden Reifen der jäh bremsenden Autos ignorierte.
Er bog in die nächste Seitenstraße ab. Maras Blick lag auf seinem leuchtend roten Sportsweater und den ebenso knallig bunten Sneakern. Sie keuchte, sie schwitzte. Obwohl sie in letzter Zeit viel gelaufen war und ihre Kondition verbessert hatte, musste sie anerkennen, dass dieser Kerl einer anderen Liga angehörte. Geschmeidig rannte er mit ausladenden Schritten dahin, ohne an Geschwindigkeit einzubüßen.
Wieder bog er ab, wieder folgte Mara – und auf einmal war er nicht mehr zu entdecken. Auch sonst niemand. Eine abgelegene Ecke jenseits der belebten Hanauer Landstraße. Vom nahen Osthafen wehte der Geruch von brackigem Wasser zu ihr herüber. Wo steckte der Kerl?
Vorsichtiger als zuvor folgte sie nun dem Schienenstrang der Hafenbahnstrecke. Links von ihr reihten sich kastenförmige Industrie- und Bürobauten aneinander. Sie erreichte ausrangierte Güterwaggons, deren Bretterwände von Moos überwuchert und von Graffiti verschmiert waren.
Hatte er sich in Luft aufgelöst? Wie ein Gespenst? Zwischen zwei Waggons schlich sie weiter, plötzlich erfüllt von einem tiefen Unbehagen. Automatisch legte sich ihre Hand auf die Waffe im Hüftholster. Am Ende der Waggons stoppte sie erneut.
Ihr unvermindert lautes Keuchen war das einzige Geräusch weit und breit. Plötzlich ein Schatten über ihr, der Luftzug beim Sprung, die große, sportliche Gestalt, die federnd auf der Erde landete – und dann der Faustschlag, der sie links im Gesicht traf.
Mara wurde zurückgeschleudert, prallte hart gegen den Waggon und landete auf der Erde. Ihr wurde schwarz vor Augen, vielleicht für zwei Sekunden, die ihr aber viel länger vorkamen. Während sie sich panisch aufrappelte, zog sie die Waffe. Von ihrem linken Wangenknochen gingen Schmerzwellen aus. Kurz hörte sie noch die flinken Schritte des Mannes, dann war wieder alles ruhig.
Sie setzte sich recht wacklig in Bewegung und spähte um die Ecke des Waggons. Nichts mehr zu sehen von ihm. Noch einmal verschwamm alles vor ihr, erst dann hatte sie sich endgültig gefangen. Doch zu spät. Sie hätte nicht einmal sagen können, in welche Richtung er davongestürmt war.
»Shit«, murmelte sie leise.
Eigentlich der richtige Zeitpunkt, um ins Präsidium zurückzukehren und durchzuatmen, aber Mara ging es gegen den Strich, aufgeben zu müssen. Eine neue Bedrohung breitete sich offenbar gerade in Frankfurt aus, ein neuer Gegner, den es so früh wie möglich ins Visier zu nehmen galt. Zuerst waren es nur vage Gerüchte gewesen, nun aber gab es erste konkretere Hinweise darauf, dass eine bislang unbekannte Verbrechergruppierung auf dem Vormarsch war.
So war es auch der Tipp eines ihrer Informanten gewesen, der Mara auf die Spur des gerade geflüchteten Mannes gebracht hatte. Also nicht wieder ins Büro, sondern erneut ins Bahnhofsviertel. Dort wollte sie ihren Alfa holen, um anschließend einen Abstecher zu einem weiteren Frankfurter Brennpunkt zu unternehmen. Denn ihr Informant, ein Kleinkrimineller namens Ramon, hatte ihr noch einen zweiten Tipp gegeben.
Kurze Zeit später, als sie im Wagen quer durch die Stadt fuhr und sich über den wie immer dichten Verkehr ärgerte, antwortete sie ihrem Kollegen Rosen auf dessen WhatsApp-Nachricht. Er hatte sich erkundigt, wo sie stecke, und mitgeteilt, dass es wichtige News gebe. Bin bald wieder zurück und berichte dann, tippte sie auf ihre gewohnt knappe Art ein und schickte den Text ab.
Sie befand sich mittlerweile in der Theodor-Heuss-Allee, nahe der Zufahrt zur A 648. Es gelang ihr, in Sichtweite des Frankfurter Straßenstrichs an einer unauffälligen Stelle einen Parkplatz zu finden. Sie ließ das Fenster herunter und damit die kalte Luft hinein. Windböen pfiffen zwischen den hohen, abweisend wirkenden Gebäuden. Ihre linke Gesichtshälfte schmerzte von dem Schlag. Sie betrachtete die in gewissen Abständen stehenden Frauen, die in ihrer knappen Kleidung froren, und die Autos, die langsam die Reihe abfuhren. Manchmal wurde angehalten, es entwickelte sich eine Preisverhandlung, und je nach deren Verlauf stieg die Prostituierte ein oder eben nicht.
Die Minuten verstrichen. Mara trommelte auf dem Lenkrad mit ihren Fingern im Takt des Metallica-Songs Turn the Page und musste an den dazugehörigen Videoclip denken, der die traurige Geschichte einer Hure zeigte. Im Laufe ihrer Dienstjahre hatte es vieles gegeben, was Mara zugesetzt hatte, aber kaum etwas ging ihr derart an die Nieren wie die Schicksale von Frauen, die zumeist mit brutaler Gewalt dazu gezwungen wurden, ihren Körper zu verkaufen. Je mehr man ihnen helfen wollte, desto mehr verstrickte man sich in einem Gewirr aus komplizierten Gesetzesparagrafen und den Unvorhersehbarkeiten der menschlichen Natur.
Was war der Tipp überhaupt wert, der sie hierhergeführt hatte? Vielleicht gar nichts. Mara liebte ihren Job, so hart er auch sein mochte, aber sie hasste es, wie viel Zeit während langer Schichten mit nutzlosem Warten verstrich.
Sie wollte gerade den Alfa starten, als ein alter gelber Ford Mondeo mit zwei angedellten Kotflügeln ihre Aufmerksamkeit weckte. Dieses ramponierte Gefährt hatte ihr Informant erwähnt. Der Ford stoppte, eine junge Frau mit schwarzer Hautfarbe stieg aus, und der Wagen fuhr wieder los.
Unverzüglich nahm Mara die Verfolgung auf. Es ging praktisch genau auf dem Weg zurück, auf dem sie hergefahren war, quer durch die Stadt, bis sie von Neuem mitten im Bahnhofsviertel landete. Der Mondeo wurde in einer der wenigen freien Lücken abgestellt, und Mara blieb nichts anderes übrig, als ihren Alfa rasch in das Parkverbot vor einer Ausfahrt zu bugsieren.
Aus dem Ford schob sich ein Mann, der losging, ohne sich umzusehen. Mara folgte ihm. Er war kaum größer als sie, ein dürrer Endzwanziger, der trotz der kühlen Witterung nur eine dünne Collegejacke mit weißen Ärmeln trug. Maras Informationen zufolge handelte es sich um einen kleinen Fisch im Milieu, der bei allen möglichen krummen Geschäften mitmischte. Er wurde Wiesel genannt, seinen richtigen Namen kannte sie nicht. Was sie allerdings über ihn wusste, war seine Vorliebe für schwarze Prostituierte. Vor allem wusste sie, dass er ihr nicht entwischen würde.
Mara rückte noch dichter auf, lief urplötzlich neben ihm her und drängte ihn in den Schatten einer Durchfahrt, die den Blick auf einen schäbigen Hinterhof frei machte. Sie stellte sich ganz nah vor ihn, sodass sein Rücken die Wand der Durchfahrt berührte und sich ihm kein Fluchtweg bot. Sie hielt ihm ihren Dienstausweis unter die Nase. Während er noch völlig verdutzt darauf starrte, tastete sie ihn rasch nach Waffen ab, ohne auf eine zu stoßen.
Kalt betrachtete sie sein kleines, spitzes Gesicht mit den vorstehenden Schneidezähnen. Der Name Wiesel passte bestens zu ihm, fand sie.
»Sind Sie verrückt geworden?«, stieß er überrumpelt von Maras jähem Erscheinen hervor.
»Los, dort rüber!« Lediglich mit dem Blick ihrer schwarzen Augen drängte sie ihn weiter in den Hof hinein, wo sie vor neugierigen Passanten abgeschirmt waren.
»Was wollen Sie eigentlich?«
»Ganz einfach, ich will Antworten.« Ohne ihm auch nur eine Sekunde Zeit zum Überlegen zu lassen, begann sie: »Wer sind die Neuen im Viertel?«
»Hä? Wer?«
»Diejenigen, über die geredet wird.« Ihr war klar, dass ihr bohrender Blick durchaus seine Wirkung hatte, aber der Widerling hatte sich gefangen und schaffte es, sie frech anzugrinsen.
»Du weißt genau, von wem ich spreche«, zischte sie.
»Nicht die leiseste Ahnung«, kam es nach einer Weile von ihm.
»Ich kann dich auch aufs Präsidium schleifen. Und dann reden wir sehr lange miteinander. Mal sehen, was da noch alles über dich ans Tageslicht kommt. Was ich bisher gehört habe, reicht mir schon ziemlich. Wäre dir das lieber?« Leiser fügte sie an: »Oder wir lassen das mit dem Präsidium. Du beantwortest ein paar Fragen und hast für immer Ruhe vor mir.«
Er zuckte mit den Achseln, betont gleichgültig.
»Also. Wer sind die Neuen?«
»Äh, Sie meinen vielleicht die Blackies? Über die weiß ich nichts. Gar nichts.«
Sie bedachte ihn mit einem abfälligen Blick. »Ich spreche tatsächlich von Männern mit dunkler Hautfarbe. Woher kommen sie?«
»Aus Afrika, schätze ich mal.« Er kicherte.
»Aus welchem Land, du Scherzkeks?«
»Keine Ahnung.« Er zwinkerte frech mit einem seiner Wieselaugen. »Keinen Schimmer, warum Sie ausgerechnet mir auf den Sack gehen.«
Von den Straßen des Viertels drang dumpf das Motorenbrummen in ihre versteckte Ecke.
Sie musterte ihn. »Ich habe keine Lust mehr, mich von Vögeln wie dir anlügen zu lassen. Keine Lust mehr, immer Regeln befolgen zu müssen, während andere auf jede Regel scheißen.«
Er demonstrierte ein ausgiebiges Gähnen. »Das ist jetzt echt nicht mein Problem und …«
»Doch«, unterbrach sie ihn. Ganz dicht stellte sie sich vor ihn und bohrte ihm den Zeigefinger auf die Brust. »Ab dieser Sekunde ist das dein Problem. Du hast vorhin nämlich nicht zugehört. Ich nehme dich mit, und ich schwöre dir, ich finde etwas, das uns dazu bringt, dich sehr, sehr lange bei uns zu behalten. Glaub mir, ich kann auch auf Regeln scheißen, wenn es sein muss.«
Halt dich zurück, sagte Mara eine innere Stimme, die Rosens Stelle einnehmen musste. Er hätte längst schon beruhigend auf sie eingeredet. Aber Typen wie dieser Kerl hier waren schwer zu ertragen.
»Dann noch mal von vorn, Arschloch«, meinte sie schneidend. »Ich will Antworten. Ich weiß einiges über dich, was mir nicht gefällt. Zum Beispiel, wie du die Frauen behandelst, die du in deine Klapperkiste einsteigen lässt. Dass du sie beim Preis reinzulegen versuchst. Dass du sie aufs Übelste erniedrigst. Dass du deine Kippen gern auf ihrer Haut ausdrückst.«
Er war still geworden. Maras Blick fiel auf ein rostendes Eisenrohr, einen knappen halben Meter lang, das nicht weit von ihr auf dem Boden lag. Am liebsten hätte sie es gepackt, um ihm damit eins zu verpassen. Typen wie er widerten sie wirklich an.
Der Druck ihres Fingers wurde stärker, ihr Blick noch bohrender.
»Sie dürfen mich nicht anfassen«, japste er, längst nicht mehr grinsend.
»Zurück zu meiner Frage«, erwiderte Mara ungerührt. »Woher kommen die Männer?«
»Nigeria«, erwiderte er leise.
»Was ist ihr Business?«
»Scheiße, ich weiß auch nicht alles und …«
»Hey!«, unterbrach sie ihn. »Lass das Geschwafel. Antworten!«
»Okay, schon gut«, murmelte er. »Also, die Typen haben ein paar Mädels laufen.«
»Und außer Prostitution?«
»Drogen, glaub ich.«
»Welche Drogen? Irgendwas Spezielles?«
»Nee, die verkaufen den üblichen Dreck. Heißt es jedenfalls.«
»Wer hat das Sagen bei ihnen?«
»Ach, es wird so viel gequatscht …« Etwas ganz Zögerliches mischte sich sofort in seine Stimme. Wenn es um Namen ging, war das immer so bei Kerlen wie ihm.
»Dann quatsch auch du. Wer hat das Sagen?«, wiederholte sie.
»Der Typ mit der Machete.«
»Machete?«
»Ja, man hört, damit kitzelt er die Leute ganz gern.«
»Ist er auffallend groß, schlank, sehr sportlich?« Mara dachte an den Mann, der ihr zuvor entwischt war.
»Hm, eher klein, glaube ich. Also, etwas größer als ich. Aber breiter gebaut.«
»Ich will seinen Namen.«
Der Kerl schnaufte, dann sagte er leise: »Augustus Yekini.«
»Yekini? Mit Ypsilon?«
»Keine Ahnung, wie man den schreibt. Bin froh, wenn ich so wenig wie möglich über ihn weiß.«
»Wen gibt es noch?«
»Ich hab aufgeschnappt, dass Yekini einen Bruder hat.«
»Vorname?«
»Solomon.«
»Auch ein Boss?«
»Solomon ist, glaub ich, gar nicht in Deutschland. Aber Augustus will ihn wohl hierherholen.«
Mara löcherte ihn weiter mit Fragen, als jedoch nicht mehr viel kam, sagte sie: »Wenn ich mitbekomme, dass du für deine Kippen weiterhin keine Aschenbecher nimmst, werde ich dir richtig auf die Pelle rücken. Dann wird’s schlimm für dich.«
Es gab viele ekelhafte Mistkerle wie ihn. Wut loderte nach wie vor in Mara, und es wurde Zeit, dass sie Abstand zu ihm bekam, sonst würde sie sich wirklich nicht mehr beherrschen können. Sie sah ihm die Erleichterung an, als sie ihn ohne eine weitere Bemerkung einfach stehen ließ.
Erst auf der anschließenden Fahrt zum Präsidium gelang es ihr, ihn aus ihren Gedanken zu verscheuchen. Wenigstens hatte er ihr eine Information geliefert, die unter Umständen viel wert war. Endlich hatte sie einen Namen, und falls der sich als wahr herausstellte, war das ein kleiner Sieg, zumal Maras Alltag oft genug von Spuren geprägt war, die im Nichts endeten.
Als sie kurz darauf den riesenhaften sechsgeschossigen Gebäudekomplex betrat, war es endgültig dunkel geworden. Sie folgte den von Neonröhren beleuchteten Gängen und stellte fest, dass Kollegen, denen sie begegnete, ihr merkwürdige Blicke zuwarfen, die sie nicht deuten konnte. Aber keiner äußerte etwas.
Dabei war die Zeit, in der man sie schief angeschaut hatte, doch eigentlich vorbei. Sie hatte sich durchgesetzt. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten und der heftigen Abneigung, die ihr entgegengeschlagen war. Das hatte nicht nur an ihrer mitunter scharfen Zunge und kompromisslosen Art gelegen, sondern auch an ihrem Äußeren. Zu viel Schwarz für den Geschmack der Kollegen: die Doc-Martens-Schnürstiefel, die etwas zu große Motorradlederjacke, die langen gefärbten Haare und die von Kajal noch betonten, unangenehm direkt blickenden Augen. Hämisch hatte man ihr anfangs den Spitznamen Krähe verpasst – inzwischen war er jedoch zu so etwas wie einem Markenzeichen von Mara geworden.
Schleyer kam ihr entgegen, ein erfahrener Bulle, einer der Platzhirsche. Er schien geradewegs durch sie hindurchzustarren. Nicht, dass er sonst die Höflichkeit in Person gewesen wäre, aber das wunderte sie trotzdem.
Sie erreichte das mit Trennwänden in drei Zweierzonen aufgeteilte Großraumbüro, in dem sich ihr Arbeitsplatz befand. An dem Schreibtisch, der ihrem gegenüber platziert war, saß Jan Rosen, ihr Teampartner. »Hallo, Boss«, sagte er zu ihr.
Sie ließ sich auf ihren Stuhl fallen. »Die Gebrüder Yekini«, erwiderte sie direkt, wie es ihre Art war. »Kennst du den Namen?«
»Sollte ich?«
»Ich habe das Gefühl, dass wir von denen noch mehr hören werden, als uns lieb sein kann.«
»Aber du hast wohl nicht gehört, was ich eben zu dir gesagt habe.«
Mara stutzte. »Was meinst du?«
Rosen schmunzelte. »Ich sagte Hallo, Boss.«
Sie hob eine Augenbraue und erwiderte nichts.
»Tja, Billinsky. Du bist es, die Klimmt vertreten wird. Du wirst die Abteilung leiten.«
»Ich?« Ihr war, als hätte man ihr gerade den Boden unter den Füßen weggezogen. »Was?! Spinnst du? Das kann nicht dein Ernst sein.«
Wieder schmunzelte er. »Guten Flug, Krähe!«
Mara starrte ihn immer noch mit großen Augen an. Ein einziges Wort kam über ihre Lippen: »Fuck!«
4
Falko Steffen hätte viel dafür gegeben, durchatmen zu können und von diesem Druck in der Brust befreit zu werden. Er hatte all die Jahre gar nicht zu schätzen gewusst, was für ein angenehmes, sicheres Leben er geführt hatte. Es war ihm nicht im Geringsten bewusst geworden, was er alles aufs Spiel setzte. Einzig und allein für das, was man wohl einen Kick nannte.
Warum hatte er nicht widerstehen können, warum hatte er sich immer tiefer hineinziehen lassen?
Inzwischen bereute er es – mehr als jemals zuvor etwas. Und er hatte keine Ahnung, wie er aus der Geschichte herauskommen sollte. Die Mistkerle hatten ihn bereits ziemlich ausgepresst. Und sie machten natürlich dennoch weiter. Mit den Nerven war er längst am Ende, bald auch mit den Ersparnissen. Er musste sie stoppen. Selbst auf die Gefahr hin, dass sein Leben in sich zusammenfiel wie ein Kartenhaus.
Ständig warf er nervöse Blicke über die Schulter. Er konnte sich überhaupt nicht mehr konzentrieren, auch in diesem Moment nicht, als er im Kinderzimmer am Fenster stand und so tat, als hörte er Milena zu, seiner vierjährigen Tochter, die von der Geburtstagsfeier einer Freundin plapperte, zu der sie eingeladen war.
Es war fast schon Abend. Nachher stand noch ein Treffen mit Anwaltskollegen an. Ziemlich regelmäßig sah man sich in wechselnder Zusammensetzung. Früher hatten sie Sport getrieben, Fußball und Basketball, mittlerweile handelte es sich nur noch um Trinkgelage. Eigentlich hatte Falko Steffen absagen wollen, doch andererseits wollte er sich durch den Druck nicht alles in seinem Alltag kaputtmachen lassen.
Also brach er eine gute halbe Stunde später auf. Milena lag schon im Bett, seine Frau Yvonne machte es sich gerade auf dem Sofa für eine neue Netflix-Serie bequem. Wenn sie wüsste, in welchen Schlamassel er sich hineinmanövriert hatte! Sie wäre am Boden zerstört. Sie würde sich scheiden lassen und Milena zu sich nehmen.
Er durfte sich das gar nicht in allen Details ausmalen, er wurde auch so schon wahnsinnig vor Angst. Und dennoch – er musste es stoppen. So konnte er nicht weiterleben.
Angesichts der unvermeidlich vielen Gin Tonics, die auf ihn warteten, nahm Steffen ein Taxi. Als er wieder ausstieg, achtete er kaum auf die große Menge an Trinkgeld, die er dem Fahrer in die Hand drückte, dabei wollte er doch ab jetzt sparsamer sein. Er befand sich am Rande des Westends. Wohnstraßen, deren Bürgersteige leer waren, alte Villen, moderne Bürogebäude. Direkt um die Ecke, in einer engen, etwas umständlich zu befahrenden Einbahnstraße, hatte einer der Kollegen eine neue Cocktail-Bar aufgetan, die sie alle unbedingt austesten wollten.
Die Straßenlaternen standen zu weit auseinander, um genügend Licht zu spenden. Schon nach ein paar Schritten sah Steffen den Eingang der Bar, die Calypso. Doch gleichzeitig entdeckte er auch etwas anderes: eine Gestalt.
Ja, jemand hielt sich im Schutz eines ausladenden winterfesten Strauchs auf, der zu einem winzigen Friseursalon gehörte.
Angst durchzuckte Falko Steffen wie ein jäher Stromstoß. Dabei war er nie ein Feigling gewesen, ganz und gar nicht, er war jemand, der Probleme anpackte und sich Herausforderungen stellte. Diesmal war alles anders.
Die Gestalt löste sich aus dem Schatten des Strauchs und kam auf ihn zu.
Steffen wischte sich mit einer fahrigen Bewegung kalten Schweiß von der Stirn. Erst jetzt erkannte er, wer sich ihm da näherte.
»Du?«, entfuhr es ihm überrascht. »Woher weißt du, dass ich hier …« Er verstummte. Er selbst hatte die Verabredung und den Treffpunkt erwähnt, jetzt erinnerte er sich daran.
Der Mann hatte etwas in der Hand, das er zuvor nicht bemerkt hatte, weil der es dicht an den Körper drückte. Der Gegenstand war mit einer Supermarkt-Plastiktüte umwickelt. Irgendetwas kam ihm eigenartig daran vor.
»Deine Andeutungen haben mich nervös gemacht«, ertönte die vertraute Stimme.
»Andeutungen?«
»Du willst wirklich alles auffliegen lassen? Das kannst du nicht tun. Da hängst nicht nur du drin.«
»Aber einfach weitermachen kann ich auch nicht. Mir steht das Wasser bis zum Hals.« Die Worte kamen Steffen abgehackt über die Lippen.
»Du meinst es ernst, was?«
»Mir bleibt nichts anderes übrig«, sagte er dumpf.
»Das dachte ich mir.«
Es ging unglaublich schnell. Steffen verstand gar nicht, was geschah. Es war ein Stoß mit diesem Gegenstand in der Tüte. Er wurde im Bauch erwischt. Erst als die Klinge in einem Strahl spritzenden Blutes herausgezogen wurde, begriff er. Doch da steckte die Waffe schon wieder in seinem Körper. Er fühlte keinen Schmerz, nur den sich eisig ausbreitenden Schock. Wie gelähmt stand er da, seine Arme hingen schlaff herab.
Ein dritter Stich, seiner Kehle entwich ein Röcheln. Fremd klang der Laut, als käme er nicht von ihm. Er sackte zusammen, lag halb auf der Seite und fühlte die Kälte des Asphalts unter sich. Über ihm war die Klinge, von der ihm sein eigenes Blut ins Gesicht tropfte.
Noch ein Stich.
Nun tat es doch weh, aber der Schmerz war gar nicht einmal so schlimm, sondern irgendwie entfernt, als hätte er zuvor eine Betäubungsspritze bekommen. Seine Lider senkten sich herab, ganz schwer waren sie auf einmal. Er spürte, wie er an den Schultern gepackt und ein Stück weit über den Untergrund geschleift wurde. Eine Hand, geschützt von Leder, berührte seine eigene Hand. Was geschah? Sekundenlang fühlte er kalten Stahl an seinen Fingerspitzen. Was sollte das?
Etwas kratzte seine Wange. Man drückte ihn offenbar mit Gewalt unter eine Hecke oder ein Gebüsch. Er atmete mühsam und war vollkommen verwundert darüber, dass das der Tag war, an dem er sterben sollte.
5
Es gab wohl auf der ganzen Welt keinen Ort, an dem sie sich hätte fremder fühlen können als hier. Ungewohnt vorsichtig, als könnte sie beim Hinsetzen vom Blitz erschlagen werden, nahm Mara Billinsky auf dem lederbeschichteten Drehstuhl Platz.
Sie sah sich in dem schmucklosen Büro um. Kein einziges Bild an den Wänden, keinerlei persönliche Gegenstände wie Familienfotos, Glücksbringer, halb leere Bonbonpackungen oder Urlaubssouvenirs. So sah es sonst nur bei ihr selbst aus. Eine von sehr wenigen Gemeinsamkeiten, die sie und ihr Chef aufwiesen.
Ja, Hauptkommissar Rainer Klimmts Reich. Sogar der Geruch seiner verbotenerweise gerauchten Zigaretten hing noch in der Luft.
Es war der folgende Morgen, und nach wie vor kam Mara nicht mit dem Gedanken klar, dass ausgerechnet sie ihn vertreten sollte. Den Mann, mit dem sie sich so manches dienstliche Scharmützel geleistet und der anfangs keinen Hehl daraus gemacht hatte, dass er sie am liebsten wieder aus seinem Team subtrahiert hätte.
Doch nach dem anfänglichen Kleinkrieg war eine gewisse Verbundenheit zwischen ihnen entstanden, die alle verblüfft hatte. Erst recht Mara und Klimmt selbst. Und nun saß sie auf seinem Stuhl, wenn auch nur vorübergehend. Ausgerechnet sie. Mit ihren Piercings und ihrer Lederjacke. Die Billinsky. Die Krähe. Verrückt, welchen Lauf das alles genommen hatte.
Die restlichen Stunden des gestrigen Arbeitstages waren für bürokratischen und technischen Kram draufgegangen. Die IT-Kollegen hatten eine ganze Weile gebraucht, um ihren Arbeitsplatz hierher zu verlegen, es gab Onlineprobleme, und plötzlich war es weit nach neun Uhr gewesen. Deshalb hatte Mara an diesem Morgen Wert darauf gelegt, besonders pünktlich zum Dienst zu erscheinen. Sie hatte eine Dienstbesprechung anberaumt, die in recht frostiger Atmosphäre abgelaufen war, und Aufgaben zugeteilt. Nun vergrub sie sich tief in den Datenbanken. Sie hatte den mittlerweile dritten Becher Automatenkaffee neben dem Laptop stehen, als es klopfte.
Ihr Kopf ruckte hoch. »Was gibt’s?« Es war wirklich ungewohnt, ein Einzelbüro zu haben.
Jan Rosen betrat den Raum, einen DIN-A5-Schreibblock in der Hand. »Guten Morgen.« Er nahm auf einem der beiden Besucherstühle Platz. »Ich habe gerade erst deine Nachricht gesehen. Du willst mich sprechen?«
Sie tauschten ein schiefes Grinsen. Ja, auch diese Situation war ungewohnt – seit über zweieinhalb Jahren hatten sie sich die enge Zweierzone im Büro geteilt.
»Eigentlich gestern Abend schon«, bestätigte Mara. »Aber ich wurde ständig aufgehalten. Nach unserem Teammeeting hatte sich von Lingert angekündigt, dann aber doch wieder abgesagt. Das Gespräch, die Unterredung, wie immer man es nennen mag, ist verschoben.«
Sie musterte ihn. Rosen hatte eine harte Zeit hinter sich. Er hatte sich in eine Zwangsprostituierte namens Anyana verliebt, viel auf sich genommen, um sie aus ihrem höchst gefährlichen Umfeld zu retten, und dann miterleben müssen, dass alles umsonst gewesen war. Anyana war ermordet worden. Seither hatte sich Rosen, immer schon zurückhaltend, fast gehemmt, noch mehr abgeschottet. Wie es oft bei solchen Menschen der Fall war, gelang es auch ihm mit seiner unscheinbaren Art, vor der Umwelt zu verbergen, wie sehr er litt. Mara wusste es dennoch nur zu gut. Aber sie hatte keinen Weg gefunden, wirklich zu ihm vorzudringen und ihm die Freundin zu sein, die er jetzt brauchte.
Rosen erwiderte ihren Blick. »Na, Billinsky? Hast du dich schon ein bisschen an dein neues Zuhause gewöhnt?« Ein vorsichtiges Lächeln umspielte seine Lippen.
Sie deutete knapp auf die geschlossene Tür. »Wie geht’s denn da draußen? Die Geier kreisen, schätze ich mal.«
»Kreisen um die Krähe, meinst du? Schon möglich. Du denkst wahrscheinlich an Schleyer.«
»Unter anderem.«
»Schleyer war reichlich überrascht, dass nicht er jetzt auf diesem Stuhl sitzt.« Beiläufig zeigte Rosen in Maras Richtung. »Um es dezent auszudrücken.«
»Und Patzke?«
»Ebenfalls.«
»Stanko?«
Er winkte leicht ab. »Dem ist es wohl ziemlich egal. Schließlich hat er noch nie besondere Ambitionen gezeigt.«
»Stimmt schon. Aber es geht ja nicht nur um eigene Ambitionen. Was alle auf die Palme bringt, ist die Tatsache, dass ausgerechnet ich es bin, die man ihnen vor die dicken Nasen setzt.« Mara grinste. »Ist ja auch ein starkes Stück.«
»Und das hast du wohl Klimmt zu verdanken. Zumindest nicht von Lingert, wenn ich seine finstere Miene richtig gedeutet habe.« Rosen stutzte. »Was ist das eigentlich für eine Schwellung in deinem Gesicht?«
Sie lehnte sich zurück und schilderte ihm alles, was sich am Vortag zugetragen hatte.
»Gut, dass es nur bei einem Faustschlag geblieben ist und du nicht mehr abbekommen hast.«
»Wir müssen alles daransetzen, dass bald die andere Seite etwas abbekommt.«
»Dank deiner Aktion mit diesem Typ namens Wiesel scheint es zumindest konkreter zu werden.« Er zog einen Kugelschreiber aus der Brusttasche seines dunklen Jeanshemds und notierte sich etwas auf dem Block, was von Mara mit zurückhaltendem Schmunzeln beobachtet wurde. Inzwischen mochte sie dieses Beflissene, Sorgfältige an ihm, erst recht, weil sie ganz anders war.
»Nigeria also«, murmelte er. »Mit Verbrechern aus Afrika kenne ich mich nicht besonders gut aus. Aber ich versuche, das nachzuholen.«
»Da bin auch gerade dabei. Als es mehr Anzeichen für Gangster afrikanischer Herkunft gab, hab ich ein bisschen im Dreck gewühlt. Übrigens, ich bin dabei auf einen Kollegen in Italien gestoßen, mit dem ich nun häufiger telefoniert habe.«
»Ach? Davon wusste ich ja gar nichts.«
»Ich wollte weiter mit ihm im Austausch bleiben und erst dann berichten. Es lässt sich nämlich gut an.« Mara stand auf und lehnte sich an die Fensterbank. »Wo wir auf jeden Fall ansetzen müssen, ist der Name Yekini. Einer der beiden Brüder, nämlich Augustus, ist kein unbeschriebenes Blatt. Unsere Abteilung hatte mit ihm noch nicht das Vergnügen, aber Kollegen anderer Ressorts. Es ging um Gewaltdelikte, Drogenhandel, Zuhälterei beziehungsweise Menschenhandel. Ich habe heute schon ziemlich früh herumtelefoniert und auch die Datenbanken durchforstet. Viele Verdachtsmomente gegen unseren Augustus, aber keine Beweise, also auch keine Anklage oder gar Verurteilung.«
»Der Kerl mit dem kräftigen Schlag: War das womöglich Augustus?«
»Auf jeden Fall war er ein echtes Lauftalent. Aber Augustus ist wohl von eher kleiner Statur. Der Typ von gestern wirkte jünger, und er war auffallend groß.«
Rosen notierte eifrig. »Und du bist durch einen Tipp von Ramon auf ihn gekommen, richtig?«
»Auf ihn und auch auf Wiesel, diesen Widerling.« Sie hob kurz die Augenbraue. »Wir bräuchten mehr solcher Infos, aber der Bande aus Nigeria ist es bisher gut gelungen, im Verborgenen zu agieren.«
»Falls es sich wirklich um eine Bande handelt«, warf Rosen abwägend ein. »Also mit einer klaren Struktur, einer Anzahl an konstanten Mitgliedern und so weiter. Wie gesagt, wir wissen einfach zu wenig.«
Mara nahm wieder Platz. »Aber etwas habe ich doch noch anzubieten. Unser Augustus kam über Italien nach Deutschland. Über Sizilien, um genau zu sein.« Sie überlegte kurz und fuhr fort: »Über seinen Bruder Solomon habe ich noch gar nichts gefunden, nicht mal eine namentliche Erwähnung.«
Er sah auf. »Woher kommen die Sizilien-Infos zu Augustus? Etwa von dem italienischen Kollegen?«
Mara nickte. »Ich habe vorhin wieder mit ihm telefoniert. Sein Name ist Domenico Manzoni. Er sprang sofort an, als ich Yekini erwähnte. Offenbar ist der Commissario schon länger hinter den Brüdern her. Ohne Erfolg. Er hat mir auch gesagt, dass Yekini eine Tätowierung auf dem Unterarm hat, die Buchstaben A und Y in geschwungenen Lettern. Übrigens, Manzoni spricht sehr gut Deutsch. Wirklich, der Austausch mit ihm verläuft vielversprechend, das scheint ein cleveres Kerlchen zu sein. Er und ich haben darüber diskutiert, dass ich mal zu einem kurzen Besuch nach Italien fliege. Falls afrikanische Gangster tatsächlich dabei sind, über den Zwischenstopp Sizilien bei uns Fuß zu fassen, scheint das nicht die schlechteste Idee zu sein.«
Erstaunt betrachtete Rosen sie. »Ich hatte tatsächlich keine Ahnung, dass du so viel Energie und Zeit in die Sache steckst. Also, dass das so etwas Großes wird.«
»Du weißt ja, wenn die Alarmlämpchen in meinem Kopf erst mal leuchten …«
»Kannst du etwa Italienisch, Billinsky?«
»Ich kann ganz gut italienischen Rotwein trinken.« Sie zwinkerte ihm zu. »Aber Manzoni spricht hervorragend Deutsch. Er hat erzählt, dass er kein Sizilianer ist, sondern aus Mailand stammt. Dort hat er eine Schweizer Schule besucht, mit Deutsch als Pflichtfach. Außerdem hat er wohl Freunde in Deutschland.«
»Die Krähe im Anflug auf Sizilien …« Er schmunzelte.
»Warum nicht? Ich hatte vor Kurzem sogar Klimmt deswegen angerufen. Und er hat sein Einverständnis gegeben.«
»Ob das jetzt noch gilt …«, zweifelte Rosen.
»Für mich schon.« Sie legte Entschlossenheit in ihren Ton. »Alles deutet darauf hin, dass sich hier in Frankfurt ein Feuer ausbreitet. Und ich will es im Keim ersticken, bevor es zum Flächenbrand wird.«
In diesem Moment klopfte es, die Tür wurde einen Spaltbreit geöffnet, und Stankos Kopf kam zum Vorschein.
»Was ist los?«, fragte Mara.
»Doppelmord«, antwortete er schlicht. »In einer ehemaligen Gießerei.«
Mara federte vom Stuhl hoch. »Okay, ich komme.«
»Eigentlich wollte ich nur wissen, wer das übernehmen soll.«
Sie stutzte. »Rosen und ich fahren hin.«
»Ich kann das auch machen«, bot Stanko an. »Solltest du dich nicht jetzt eher um die Koordination …«
Sie unterbrach ihn ruhig, aber bestimmt: »Koordination bedeutet nicht, dass ich nicht mehr aus diesen vier Wänden rauskomme, oder?«
»Wie du meinst.«
»Übrigens, haben dich Schleyer und Patzke vorgeschickt?«
Er grinste fast ein wenig verlegen, als wäre ihm die ganze Situation unangenehm. »Schon möglich«, meinte er.
Sie griff nach ihrer Lederjacke, die über der Stuhllehne hing. »Es bleibt dabei, Rosen und ich übernehmen das.«
6
Die Kollegen der Spurensicherung huschten in ihren Schutzanzügen und Plastiküberschuhen in emsiger Stille durch die Halle der früheren Gießerei. Verhüllte Gestalten, die immer als Erste den Tatort begutachteten, damit Kriminalbeamte nicht durch eine flüchtige Unachtsamkeit Spuren wie Fußabdrücke im Staub unbrauchbar machten.
Billinsky und Rosen standen am Halleneingang, zu dem ein langer Gang führte, und betrachteten alles wortlos. Mara erinnerte die Fabrik an ihre turbulente Jugendzeit, als sie mit einer Gruppe abgerissener Gestalten solche langsam verfallenden Schauplätze bewusst aufgesucht hatte. Lange vor dem Bau der neuen Europäischen Zentralbank war gerade das Frankfurter Ostend voller Lost Places gewesen, wie sie sie nannte. Dort hatte sie etliche Stunden nutzlos verstreichen lassen. Wohl ein Grund dafür, dass Mara heute am liebsten keine Zeit mehr verlor und immer vorauspreschte.
Als sie endlich das Zeichen erhielten, sich nähern zu dürfen, setzte sie sich in Bewegung, um sich ein genaueres Bild vom Tatort zu verschaffen, gefolgt vom wie immer eher zurückhaltenden Rosen.
Die beiden männlichen dunkelhäutigen Leichen lagen auf dem Rücken, die Oberkörper zerfetzt von mehreren Schusswunden. Das ausgetretene Blut war auf dem Hallenboden eingetrocknet und bildete bizarre rostrote Muster. Neben ihnen befanden sich ihre Pistolen. Rosen deutete darauf. »Zwei Beretta U22.«
Mara nickte. »Wie ich so mitbekommen habe, sind die Dinger zurzeit beliebt bei den bösen Jungs.«
»Stimmt. Das liegt wohl vor allem an dem Design. Mit einer solchen Knarre gilt man als cool, nehme ich mal an.«
»Tja, auch beim Töten darf man keinen Trend versäumen«, meinte Mara sarkastisch.
»Falls die beiden einen afrikanischen Hintergrund haben, könnte das der Flächenbrand sein, von dem du gesprochen hast.« Rosen fuhr sich durch sein schütteres blondes Haar. In den langen Wochen seiner Trauer um Anyana hatte er an Gewicht eingebüßt, die Wangen waren schmaler geworden. Er wirkte älter als seine Anfang dreißig.
»Ja, der Flächenbrand«, murmelte sie. »Oder zumindest sein Anfang.«
»Der Mann, der links liegt, ist klein und untersetzt«, sagte Rosen.
»Ist mir auch aufgefallen.« Mara winkte einen Kollegen der Spurensicherung heran und bat ihn, bei dem Toten die Ärmel der Sportjacke und des Sweatshirts hochzuziehen.
Auf einem Unterarm wurde eine Tätowierung sichtbar: ein A und ein Y.
»Nett, dich kennenzulernen, Augustus«, sagte Mara.
»Können Sie einschätzen, wie lange die beiden tot sind?«, fragte Rosen den Mann in der Schutzkleidung.
»Auf jeden Fall länger als vierundzwanzig Stunden, vielleicht sogar achtundvierzig.«
»Dafür sehen sie noch recht gut aus, um es mal so zu sagen«, meinte Rosen abwägend.
»Trotzdem möglich. Recht kalte, trockene Luft. Männer im besten Alter. Na ja, wirklich festlegen können wir uns erst nach der Obduktion.«
»Irgendwelche Papiere gefunden?«, wollte Mara wissen.
»Nein. Auch sonst bis jetzt nichts Bemerkenswertes außer den Waffen, den Smartphones und dem Autoschlüssel.« Er wandte sich wieder seinen Aufgaben zu.
»Jede Menge Patronenhülsen«, sagte Mara zu Rosen. »Recht viele Treffer, wie die Wunden zeigen, und noch mehr Schüsse, die das Ziel verfehlt haben. Aber kaum Hülsen, die zu den Pistolen der beiden Toten passen.«
»Offenbar sind sie ziemlich überrascht worden«, erwiderte Rosen. »Sie konnten ihre Waffen ziehen, aber kaum noch Gegenwehr leisten.«
»Sieh dir nur die Wand hinter ihnen an. Großflächig von Kugeln perforiert und angekratzt. Da hat jemand die Herren mit wahren Salven eingedeckt.«
»Und somit muss ohrenbetäubender Lärm geherrscht haben.«
»Stimmt.« Mara nickte. »Gab es keine Meldungen? Weißt du irgendwas?«
»Nein, habe nichts gehört.« Rosen winkte ab. »Ziemlich abgelegen hier.«
»Also hat’s niemand mitbekommen.« Sie strich sich eine vorwitzige Strähne aus der Stirn. »Den vielen herumliegenden Hülsen zufolge haben der oder die Killer etwa dort gestanden. Und da findet sich kein einziger Tropfen Blut.« Ihr Finger zeigte auf die Stelle, die sie meinte.
»Stimmt«, sagte Rosen. »Der Sieger dieser Auseinandersetzung ist unverletzt davongekommen. Oder die Sieger.«
»Mal sehen, was die Auswertung der Ballistiker noch bringt. Übrigens, wer hat die Toten gefunden?«
»Drei Jugendliche«, erwiderte Rosen, der das gleich bei ihrem Eintreffen in Erfahrung gebracht hatte. »Sie kommen wohl öfter hierher, um abzuhängen.«
»Und ein paar Joints kreisen zu lassen.«
»Du denkst wohl an deine eigene Teenagerzeit, was?«
»Heute bin ich keine Vorzeigepolizistin, und damals war ich keine Musterschülerin, das kann ich nicht leugnen.« Sie lächelte kurz, wurde aber sofort wieder ernst.
»Ich habe die Namen und Adressen der Jugendlichen notiert«, meinte Rosen. »Wir werden sie eingehender befragen müssen, obwohl ich mir nicht viel davon verspreche.«
»Ich mir auch nicht.« Mara zuckte gleichmütig mit den Achseln. »Wir können froh sein, dass sie die Leichen gefunden haben. Wer weiß, wie lange sie sonst unentdeckt geblieben wären.«
Während Rosen dem Beamten von der Spurensicherung weitere Fragen stellte, trat Mara beiseite und zog das Handy aus der Innentasche ihrer Jacke. Sie wählte einen Kontakt mit einer italienischen Nummer aus.
Domenico Manzoni nahm den Anruf so schnell entgegen, als hätte er darauf gewartet. »Meine Kollegin aus Deutschland – wie schön! Buongiorno. Wie geht es Ihnen?«
»Jedenfalls besser als dem guten Augustus Yekini.«
»Wieso?«, fragte Manzoni.
»Er ist erschossen worden.« Sie beschrieb das Tattoo auf dem Arm des Toten. »Ich kenne ihn ja nicht, aber es wäre schon ein Zufall, würde es sich nicht um Yekini handeln.«
»Ich hätte mit vielem gerechnet, damit allerdings nicht«, murmelte er mit seinem hörbaren, aber nicht ausgeprägten Akzent. »Trotzdem werde ich wohl auf Trauerkleidung verzichten.«
»Es reicht, wenn Sie einen Rosenkranz beten. Sie als Italiener …«
Er lachte. »Sagen Sie’s nicht weiter, aber ich gehe nie in die Kirche. Fußball mag ich auch nicht – aber ich bin trotzdem ein waschechter Italiano.« Während sie ihm zuhörte, gestand sie sich ein, dass sie neugierig auf ihn war – bei ihr eher eine Seltenheit. »Manzoni, einer von Yekinis Mitstreitern ist Seite an Seite mit ihm gestorben.«
»Es könnte sein, dass die Jungs aus Nigeria dabei sind, bei euch einen kleinen Revierkrieg anzuzetteln. Das kennt man ja in Frankfurt, habe ich recht?«
»Und ob«, meinte Mara dumpf. »Können Sie mir noch mehr über Yekini sagen? Das würde womöglich helfen, seinem Mörder auf die Spur zu kommen.«
»Die wenigen Fakten, die ich weiß, habe ich Ihnen mitgeteilt. Jetzt, da Augustus tot ist, wird Solomon umso wichtiger. Mit ihm würde ich mich zu gern unterhalten. Vielleicht könnte er uns sagen, wer seinen Bruder auf dem Gewissen hat.«
»Er befindet sich also noch in Sizilien?«
»Ich habe keine gegenteiligen Informationen. Wir werden hier alles daransetzen, Solomon zu kriegen.«
»Falls Sie Unterstützung brauchen, rufen Sie an.«
Sie hatte es mit Ironie ausgesprochen, aber er erwiderte betont ernsthaft: »Guter Punkt. Ich sagte Ihnen ja schon einmal, Signorina Billinsky: Wenn Sie mehr über Verbrecher mit nigerianischem Hintergrund erfahren wollen, müssen Sie nach Sizilien kommen. Hier liegt die Wurzel des Bösen.«
»Oder ich müsste gleich nach Nigeria.«
»Nein, denn erst hier werden diese Gelegenheitsgangster zu Berufskriminellen. Die Hintergründe des ganzen Wahnsinns kann ich Ihnen nicht in einem Bericht näherbringen, dazu muss man hierherkommen. Glauben Sie’s mir, Signorina Billinsky.«
»Das Signorina können Sie sich sparen. Wenn wir uns treffen, wissen Sie, warum.«
»Signo–« Er stoppte mitten im Wort und musste lachen. »Wirklich, ich freue mich auf Sie, Billinsky.«
Als sie das Gespräch beendete, spürte sie, dass sie endgültig entschlossen war, den Besuch in Sizilien anzutreten. Auch gegen eventuelle Widerstände.
Nach der Rückkehr ins Präsidium dauerte es nicht lange, bis Staatsanwalt Christian von Lingert in Maras Büro auftauchte, um den abgesagten Termin nachzuholen. Sie nahmen Platz, zwischen ihnen Klimmts Schreibtisch, auf dem sich bereits Maras übliches Papierkramchaos ausbreitete, und maßen sich gegenseitig mit langen Blicken.
Man konnte sich kaum zwei gegensätzlichere Menschen vorstellen. Hinzu kam die Tatsache, dass ihre beiden Familien durch eine blutige Vergangenheit miteinander verbunden waren. Doch trotz allem hatte es einen Moment gegeben, an dem sich die Gegensätze auf irritierende Weise angezogen hatten. Zwischen Mara und von Lingert war es zu einem One-Night-Stand gekommen. Es war spontan gewesen, aus einer Laune heraus, fast surreal, wie ein plötzlicher Schneefall im Hochsommer. Und es war ein Ereignis, das es ihnen im Nachhinein noch schwerer machte, auf neutrale Weise miteinander umzugehen. Zumindest war es ihnen gelungen, dass diese eine gemeinsame Nacht ein Geheimnis geblieben war und sich auf den Fluren des Präsidiums nicht herumgesprochen hatte.
Auch jetzt kam die Unterhaltung nur schleppend in Gang.
»Ich wollte dir die Ernennung als Vertreterin persönlich mitteilen«, begann von Lingert betont professionell. »Aber du warst ja mal wieder unterwegs, und keiner der Kollegen wusste, wo …«
»Waren wir zwischenzeitlich nicht wieder beim Sie?«, unterbrach sie ihn mit einem provozierenden Schmunzeln, wohl wissend, dass sie damit Menschen wie ihn zum Kochen bringen konnte.
»Ich weiß nicht, bei was wir waren«, gab er brüsk zurück.
»Na ja, mir soll’s wurscht sein.« Sie wusste, dass auch diese flapsige Art ihm nicht passte. Und setzte gleich noch einen drauf: »Ich kann dir ansehen, wie sehr du mir das gönnst.«
Inzwischen lag etwas Lauerndes in seinem Blick. Als wären sie zwei Kontrahenten vor Gericht.
»Es geht nicht ums Gönnen.« Er richtete seinen perfekt gebundenen Krawattenknoten, wie er es oft tat. »Sondern darum, ob jemand für eine Position geeignet ist.«
Mara lehnte sich bequem zurück und zeigte ihm wieder ihr Schmunzeln. »Ich war nicht geeignet, Polizistin zu sein. Schon gar nicht Kriminalbeamtin bei der Mordkommission. Jetzt bin ich natürlich auch nicht geeignet, Klimmt zu ersetzen. Shit, wir reden doch nicht über die Position des Polizeipräsidenten, sondern nur über ein paar Wochen Vertretung.«
Sein Kopf ruckte hoch, was ihm etwas von einem Raubvogel gab. »Aber auch diese Position – und sei es nur für eine vergleichsweise kurze Zeit – hat jemanden verdient, der etwas repräsentabler ist.«
Mara schmunzelte ihn immer noch an. »Nur darum geht es?«
»Nein, sicher nicht. Und Klimmt war nun auch nicht gerade sonderlich repräsentabel mit seiner brummigen …« Er verstummte, als er merkte, dass er sich fast hätte gehen lassen.
»Hast du war gesagt? Etwas voreilig, findest du nicht?«
Er nahm die Brille ab, säuberte die Gläser mit einem Tuch, was er ebenfalls oft tat, und verzichtete auf eine Antwort.
»Aber keine Sorge«, fuhr Mara fort, »eine Weile braucht sich hier keiner an meiner unrepräsentablen Visage zu stören.«
Irritiert fixierte er sie. »Wieso?«
»Ich werde für einige Tage nach Sizilien verschwinden.« In ein paar hingeworfenen Sätzen umriss sie ihre Absichten und die Gründe dafür.
Er schüttelte wild mit dem Kopf. »Ganz sicher nicht. Gerade jetzt, wo du hier die Abteilung leiten sollst, verdrückst du dich.«
»Ich verdrücke mich nie. Ich ermittle.«
»Das geht nicht.«
»Und ob das geht.«
Ruckartig stand er auf. »So war das nicht geplant.«
»Doch. Ich habe es so geplant. Klimmt war eingeweiht.«
»Davon hat er mir nichts verraten«, schnarrte von Lingert.
»Commissario Manzoni und ich hatten das seit Längerem in Erwägung gezogen. Es macht allen Sinn der Welt, um mehr darüber zu erfahren, mit welcher Art von Gegner wir es neuerdings zu tun haben. Außerdem befindet sich Solomon Yekini, der Bruder des erschossenen Augustus Yekini, noch in Sizilien. Es wird nach ihm gefahndet – und da will ich dabei sein.«
»Du bist Klimmts Stellvertreterin. Brauchen wir dann einen Stellvertreter für die Stellvertreterin, oder wie hast du dir das gedacht?«
Mara hob eine Augenbraue. »Einerseits bin ich nicht geeignet, andererseits sollte ich nicht für ein paar Tage wegkönnen?« Sie winkte ab. »Entspann dich lieber.«
»Entspannen?«, zischte er und beugte sich nach vorn, um die Hände auf der Schreibtischoberfläche abzustützen und Mara noch aggressiver ins Visier zu nehmen. »Ich versichere dir: Falls du keine klaren, verwertbaren Ergebnisse, die zu Festnahmen und Anklagen führen, mitbringen solltest, hat das Konsequenzen für dich.«
»Was du nicht sagst«, gab Mara aufreizend gelassen zurück, obwohl sein besonders heftiger Ton sie nun doch überraschte.
»Ich rede von fundamentalen Konsequenzen für deine Laufbahn als Polizistin.«
»Das war kaum falsch zu verstehen.«
Von Lingert richtete sich auf und starrte immer noch verärgert auf sie herab. »Das will ich auch hoffen. Für Sie, Frau Kommissarin.«
»Wir zwei Hübschen sind also wieder beim Sie?«
»Dabei hätten wir immer bleiben sollen.«
Sie grinste ihn spöttisch an. »Endlich sind wir mal einer Meinung.«
7
Es war erst zwei Tage her, dass er an einem blutigen Tatort gestanden hatte. Solche Situationen waren ihm zuwider. Innerlich wünschte er sich dann immer ganz weit weg. Und womöglich war das ja der springende Punkt: Vielleicht hatte Jan Rosen schon immer ein anderer sein wollen, betraut mit anderen Aufgaben, verwurzelt in einem anderen Alltag.
Ja, erst achtundvierzig Stunden war es her, dass er auf die Leichen von zwei ermordeten Menschen hatte starren müssen – und hier lag bereits die nächste.