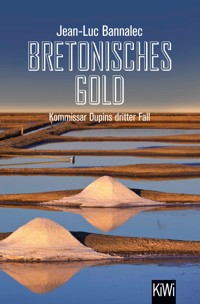10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Dupin ermittelt
- Sprache: Deutsch
Ein raffinierter Krimi voller verblüffender Wendungen, feinsinnigem Humor und der atemberaubenden Schönheit der Glénan-Inseln - Kommissar Dupins zweiter Fall führt ihn in ein gefährliches Labyrinth von Verstrickungen. Zehn Seemeilen vor Concarneau an der bretonischen Küste: Die sagenumwobenen Glénan-Inseln wirken mit ihrem weißen Sand und kristallklaren Wasser wie ein karibisches Paradies – bis eines schönen Maitages drei Leichen angespült werden... Das hatte Kommissar Dupin gerade noch gefehlt: eine wackelige Bootsfahrt am Morgen, ein nervtötender Präfekt, zu wenig Kaffee und keinerlei Anhaltspunkte. Wer sind die drei Toten am bretonischen Strand? Wurden sie Opfer des heftigen nächtlichen Unwetters? Als sich herausstellt, dass einer der Toten ein windiger Unternehmer mit politischem Einfluss, der andere ein selbstherrlicher Segler mit jeder Menge Feinden war, ahnt Kommissar Dupin nichts Gutes. War der vermeintliche Unfall auf offener See in Wahrheit ein kaltblütiger Mord? Während bereits der nächste Sturm aufzieht, führen ihn die Ermittlungen tief in ein gefährliches Labyrinth von Verstrickungen, die Ereignisse spitzen sich zu – und am Ende ist die Wahrheit, wie so oft im Leben, kompliziert. Die Bretagne hat einen Platz auf der Krimilandkarte erobert Jean-Luc Bannalec begeistert mit seinen unterhaltsamen Krimis rund um Kommissar Dupin aus der Bretagne: Mit subtiler Komik und einem Auge für die lokale Farbgebung versetzt Bannalec seine Leser in die unvergleichliche Bretagne, in der man die salzige Luft des Atlantiks nahezu schmecken kann. Die Krimi-Bestseller aus der Bretagne sind in folgender Reihenfolge erschienen: - Bretonische Verhältnisse - Bretonische Brandung - Bretonisches Gold - Bretonischer Stolz - Bretonische Flut - Bretonisches Leuchten - Bretonische Geheimnisse - Bretonisches Vermächtnis - Bretonische Spezialitäten - Bretonische Idylle - Bretonische Nächte - Bretonischer Ruhm - Bretonische Sehnsucht - Bretonische Versuchungen Die Bücher erzählen eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Jean-Luc Bannalec
Bretonische Brandung
Kommissar Dupins zweiter Fall
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Jean-Luc Bannalec
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Jean-Luc Bannalec
Jean-Luc Bannalec ist der Künstlername von Jörg Bong. Er ist in Bonn und im südlichen Finistère zu Hause. Die Krimireihe mit Kommissar Dupin wurde für das Fernsehen verfilmt und in zahlreiche Sprachen übersetzt. 2016 wurde der Autor von der Region Bretagne mit dem Titel »Mécène de Bretagne« ausgezeichnet. Seit 2018 ist er Ehrenmitglied der Académie littéraire de Bretagne. Zuletzt erhielt er den Preis der Buchmesse HomBuch für die deutsch-französischen Beziehungen und die Ehrenbürgerschaft der Stadt Concarneau.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
»Der Krimi des Sommers.« Grazia
»Mit viel Gespür gelingt es Bannalec, den ganz besonderen Zauber und die Kraft des Atlantiks zu schildern. Wirklich gute Strandkorblektüre.« Kieler Nachrichten
»Ein Muss für Bretagne-Urlauber.« WDR 5
»Bannalec versteht es meisterlich, die Atmosphäre der einzigartigen Insellandschaft zu vermitteln und ganz ohne billige Effekte oder Action Spannung zu erzeugen.« hr
»Jean-Luc Bannalec ist auch im zweiten Band gute Unterhaltung gelungen und ein etwas anderer Krimi. Auch weil der Schluss ziemlich ungewöhnlich ist.« rbb Inforadio
»Eine fernwehfördernde Mischung aus Landschaftsreportage, raffiniertem Speisekartenspiel, Geschichtskurs und keltischer Schrulligkeit.« Westdeutsche Allgemeine Zeitung
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2013, 2022, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung Rudolf Linn, Köln
Covermotiv © Rudolf Linn, Köln; © Birgit Pittelkow
Kartografie Birgit Schroeter
ISBN978-3-462-30693-4
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses Zusatzmaterial ist auch auf unserer Homepage zu finden:
https://www.kiwi-verlag.de/magazin/extras/die-karte-zu-bretonische-brandung
Inhaltsverzeichnis
Motto
Widmung
Der erste Tag
Wie auf Zauberweise schwebten ...
Im Quatre Vents saßen ...
Der zweite Tag
Der dritte Tag
Leseprobe »Bretonische Versuchungen«
»An douar so kozh, med n’eo ket sod.«
»Die Erde ist alt, aber nicht verrückt.«
Bretonisches Sprichwort
à L.
Der erste Tag
Wie auf Zauberweise schwebten die flachen, lang gezogenen Inseln über dem tiefopalen Meer, ein wenig verwischt, flimmernd. Wie eine Fata Morgana lag der berühmte Archipel vor ihnen.
Die Konturen der größeren Inseln waren bereits mit bloßem Auge auszumachen, nicht viel hob sich von ihnen ab: die geheimnisumwobene Festung auf Cigogne, der altgediente sturmgepeitschte Leuchtturm von Penfret, die verlassene Farm auf Drénec, die vereinzelten verwitterten Häuser auf Saint-Nicolas, der Hauptinsel des fast kreisrunden Archipels. Die Îles de Glénan. Ein Mythos.
Zehn Seemeilen waren vom Festland aus zurückzulegen, von Concarneau, der prächtigen blauen Stadt der Cornouaille, deren Einwohner die Inseln seit Menschengedenken ihre »Beschützer« nannten. Tag für Tag waren sie ihr unverrückbarer Horizont. Daran, wie sie zu sehen waren, klar, scharf, verschwommen, milchig, ob sie schwirrten oder fest im Wasser lagen, las man das Wetter von morgen ab, und, an bestimmten Tagen, das des gesamten weiteren Jahres. Seit Hunderten von Jahren wurde bretonisch beharrlich diskutiert, wie viele Inseln es waren. Sieben, neun, zwölf oder zwanzig waren die geläufigsten Zählungen. Sieben »große«, nur das war unstrittig. Und groß meinte: ein paar Hundert Meter in der Länge – höchstens. Einst, vor sehr langer Zeit, war alles eine Insel gewesen, nach und nach dann hatten sie das tosende Meer und die ewige Brandung auseinandergerissen. Vor einigen Jahren hatte eine Kommission des Départements nach den amtlichen Kriterien der Bestimmung einer Insel – Land im Meer, das beständig über Wasser ist und eine ebenso ständige Vegetation aufweist – höchstoffiziell »zweiundzwanzig Inseln und Inselchen« festgestellt. Darüber hinaus gab es eine schier unendlich scheinende Zahl an schroff aufragenden Felsen und Felsengruppen. Diese Zahl variierte zudem erstaunlich, je nach dem Stand von Ebbe und Flut, die wiederum je nach den Positionen von Sonne, Mond und Erde selbst erheblich unterschiedlich ausfielen. An manchen Tagen war eine Flut drei, vier Meter höher als an anderen, bei richtig tiefer Ebbe eine Insel um ein Mehrfaches größer und vielleicht über Wasser mit einer Sandbank verbunden, die ansonsten unter der Wasseroberfläche verborgen lag. Einen »normalen« Stand gab es nie. So kam es, dass die Landschaften des Archipels unablässig im Wandel waren und niemand jemals sagen konnte: Das sind sie, die Glénan, so sehen sie aus. Die Glénan waren nicht eindeutig Land, sie waren unklarer Zwischenraum, halb Land, halb See. Bei wütenden Winterstürmen rollten mitunter riesenhafte Wellen über die Inseln hinweg, die gewaltige Gischt machte dann aus allem Meer. »Fast verloren schon im Nichts, in der großen Weite«, so lautete die poetische und dennoch präzise Beschreibung der Menschen hier.
Es war ein außergewöhnlicher früher Maitag, der sich von einem veritablen Sommertag in nichts unterschied, nicht in den geradezu unglaublichen Temperaturen, nicht in dem kräftigen Licht, nicht in den prächtigen Farben. Auch die Luft war schon sommerlich, leichter, sie trug ein bisschen weniger Salz, weniger Jod, Tang und Algen, dafür diese bestimmte, schwer zu beschreibende atlantische Frische. Bereits jetzt, um zehn Uhr morgens, schuf die Sonne einen gleißenden, unruhig aufblitzenden Horizont und darunter einen silbernen Trichter, der sich, Richtung Betrachter, immer weiter verschlankte.
Kommissar Georges Dupin vom Commissariat de Police Concarneau nahm von alldem nicht viel wahr. Er war ausgesprochen übellaunig am heutigen Montagmorgen. Eben noch hatte er im Amiral gesessen, gerade seinen dritten café bestellt, seine Zeitungen vor sich liegen gehabt – Le Monde,Ouest France,Télégramme –, da hatte ihn sein Handy mit einem schrillen Klingeln aufgeschreckt. Auf den Glénan waren drei Leichen gefunden worden. Man wusste bisher noch gar nichts – nur genau das. Drei Leichen.
Er war sofort aufgebrochen. Sein Stammcafé, in dem er jeden seiner Tage begann, lag direkt am Hafen, und nur wenige Minuten später hatte er sich bereits an Bord eines Polizeischnellbootes befunden. Kommissar Dupin war erst ein Mal auf den Glénan gewesen, letztes Jahr, auf Penfret, der Insel ganz am östlichen Rand des Archipels.
Sie waren jetzt seit zwanzig Minuten unterwegs. Die Hälfte hatten sie hinter sich. Kommissar Dupin wäre froh gewesen, wenn es mehr als die Hälfte gewesen wäre. Das Bootfahren auf offenem Meer war nicht seine Sache, sosehr er das Meer auch liebte – wie ein genuiner Pariser des sechsten Arrondissements, denn das war er bis zu seiner »Versetzung« vor jetzt fast vier Jahren gewesen, das Meer eben liebte: den Strand, das Schauen, bestenfalls das Baden, das Gefühl, den Geruch, das Schwärmen. Noch weniger als das Bootfahren an sich mochte er das Bootfahren auf einem der beiden neuen Schnellboote, die die Wasserschutzpolizei vor zwei Jahren nach langen verbissenen Kämpfen mit der Bürokratie erhalten hatte und deren ganzer Stolz sie waren. Die neueste Generation, imposante Hightechwunder, Sonden und Sensoren für alles. Sie schossen förmlich über das Wasser. Ein Boot war auf den Namen Bir getauft – »Pfeil« auf Bretonisch –, das zweite auf Luc’hed, »Blitz«. Boote hatten Dupins Empfinden nach anders zu heißen, aber es hatte nur die Bedeutung gezählt.
Kommissar Dupin fehlte zudem Koffein, das ließ ihn grundsätzlich mürrisch werden. Zwei cafés waren nicht annähernd genug. Er war eher massiger Statur, nicht dick, sicher aber auch nicht dünn, und litt seit seiner Jugend an erstaunlich niedrigem Blutdruck.
Widerwillig war er an Bord gegangen. Eigentlich nur, weil er sich keine Blöße hatte geben wollen und weil Inspektor Riwal, einer seiner beiden jungen Inspektoren, der zu ihm aufsah – was Dupin generell sehr unlieb war –, mit an Bord gegangen war.
Dupin wäre sofort bereit gewesen, die halbe Stunde zum kleinen Flughafen nach Quimper zu fahren, um mit dem kümmerlichen, wackligen Zweimann-Polizeihubschrauber der Zentrale auf die Glénan zu fliegen, selbst wenn es insgesamt deutlich länger gedauert hätte und auch das Fliegen keineswegs ein Vergnügen für ihn war. Aber sein Vorgesetzter, der Präfekt, war mit dem Hubschrauber unterwegs, ein »freundschaftliches Treffen« mit der Präfektur der britischen Kanalinseln Guernsey, Jersey und Alderney, in Bordeaux, einem dösigen Kaff auf Guernsey. Die polizeiliche Zusammenarbeit sollte, das war der entschiedene englische wie französische Wille, intensiviert werden: »Das Verbrechen darf keine Chance haben, egal welche Nationalität es hat«. Kommissar Dupin konnte den Präfekten Lug Locmariaquer nicht ausstehen, und noch jetzt, nach annähernd vier Jahren, konnte er den Namen nicht aussprechen (Georges Dupin hatte generell ein zumeist schwieriges Verhältnis zu Autoritäten, vollkommen zu Recht, wie er fand). Über Wochen hatte er zunächst nervende, dann quälende Anrufe vom Präfekten bekommen, der »Ideen sammelte«, worüber zu sprechen wäre bei einem solch illustren Treffen. Nolwenn, Dupins unendlich patente Assistentin, hatte auf Locmariaquers Anweisung hin »ungeklärte Fälle« der letzten Jahrzehnte recherchieren müssen, die »vielleicht, eventuell und irgendwie« eine Spur zu den Kanalinseln aufwiesen, Fälle, die »vielleicht, eventuell und irgendwie« aufgeklärt »hätten werden können«, wenn es bereits eine engere Zusammenarbeit gegeben hätte. Es war völlig lächerlich. Nolwenn hatte sich gesträubt. Ihr fehlte jedes Verständnis dafür, warum man sich hier »im Süden« mit dem Kanal im hohen Norden zu befassen hatte, wo die Eisberge durchs Meer trieben und es das ganze Jahr über regnete. Meterweise Akten waren gewälzt worden, sie hatten nicht einen signifikanten Fall gefunden – worüber der Präfekt partout nicht glücklich gewesen war.
Was Dupins Laune auf dem Boot nicht verbessert hatte, war der kleine »Unfall« gewesen, zu dem es bereits kurz nach dem Ablegen gekommen war. Er hatte getan, was nur schlimmste Landratten tun: bei dieser Geschwindigkeit, steifem Wind von Backbord und doch etwas agitierter See ebendort, nämlich auf der Backbordseite, einen Blick auf die Inseln zu werfen, während Inspektor Riwal wie die zwei Mannschaftsmitglieder der Bir penibel eng an der Steuerbordseite gestanden hatten. Es hatte nicht lange gedauert, bis ihn eine kapitale Welle erwischte. Kommissar Dupin war klatschnass geworden. Seine stets offen getragene Jacke, das Polohemd und die Jeans – seine Dienstkleidung von März bis Oktober – klebten am Körper, lediglich die Socken in den Schuhen waren trocken geblieben.
Was den Kommissar jedoch besonders missmutig machte, war die Tatsache, keine weiteren Informationen zu besitzen als nur das eine Faktum: dass eben drei Leichen gefunden worden waren. Dupin war kein Mann der Geduld. Ganz und gar nicht. Kadeg, sein zweiter Inspektor, mit dem er in der Regel auf Kriegsfuß stand, hatte ihm per Telefon lediglich mitteilen können, was er wiederum von dem aufgeregten Anruf »eines Mannes mit starkem englischen Akzent« wusste, der kurz zuvor beim Kommissariat eingegangen war. Die Leichen lagen am nordöstlichen Strand von Le Loc’h, der größten Insel des Archipels – und mit »der größten Insel« war eine Länge von vierhundert Metern gemeint. Le Loc’h war unbewohnt, besaß eine Klosterruine, einen alten Friedhof, eine verfallene Sodafabrik und, als größte Attraktion der Insel, einen lagunenähnlichen See. Kadeg hatte ein Dutzend Mal wiederholen müssen, dass er nichts weiter als ebendiese paar Informationen hatte. Dupin hatte Kadeg mit allen möglichen Fragen gelöchert, seine geradezu fanatische Neigung zu scheinbar unbedeutenden Einzelheiten und Umständen war notorisch.
Drei Tote, ohne dass irgendjemand irgendetwas wusste – in der Präfektur hatte verständlicherweise erhebliche Aufregung geherrscht: Das war eine ziemlich große Sache hier im Finistère, am malerischen Ende der Welt, wie die Römer es genannt hatten. Für die Gallier, die Kelten – und als solche verstanden sich die Menschen hier bis heute –, war es natürlich das genaue Gegenteil: nicht das Ende, sondern wortwörtlich der »Anfang«, das »Haupt der Welt«. »Penn ar Bed«, nicht »finis terrae«.
Das Boot hatte mittlerweile abgebremst. Sie fuhren nur noch mit mäßiger Geschwindigkeit. Es folgte eine schwierige Navigation. War das Meer hier ohnehin seicht und durchsetzt von steil aufragenden Felsen – über und unter der Wasseroberfläche – und Bootfahren in diesen Gewässern grundsätzlich nur etwas für äußerst geübte Kapitäne, so war es wie jetzt bei Ebbe noch heikler. Die »Einfahrt« zwischen Bananec und der großen Sandbank vor Penfret war noch der ungefährlichste Zugang zum Archipel, über sie gelangte man in die »Kammer«, wie der durch die umliegenden Inseln vor Stürmen und schweren Seegängen geschützte Meeresraum in der Mitte des Archipels genannt wurde: »la chambre«. Souverän nahm die Bir ihren Weg, manövrierte in harmonischen Bewegungen zwischen den Felsen hindurch und nahm Kurs auf Le Loc’h.
»Wir werden nicht näher rankommen.«
Der Kapitän des Polizeibootes, ein junger, hoch aufgeschossener Kerl in einer Hightech-Stoffuniform, die heftig an ihm herumschlackerte, hatte von seinem erhöhten Kapitänsstand heruntergerufen, ohne dabei jemanden anzuschauen. Er war vollkommen auf das Navigieren konzentriert.
Dupin wurde mulmig zumute. Es waren sicherlich noch hundert Meter bis zur Insel.
»Springflut. Koeffizient 107.«
Auch das hatte der hagere Kapitän einfach ins Unbestimmte gerufen. Fragend blickte Kommissar Dupin seinen Inspektor an, nach dem Vorfall mit der großen Welle hatte er sich in die unmittelbare Nähe der anderen begeben und sich nicht mehr vom Fleck gerührt. Riwal beugte sich sehr nah zu Dupin hin, die Motoren waren, obwohl das Boot fast nicht mehr fuhr, immer noch ohrenbetäubend laut.
»Wir haben zurzeit einen extremen Tidenhub, Monsieur le Commissaire. In den Tagen einer Springflut ist der Wasserstand noch einmal deutlich niedriger als bei einer gewöhnlichen Ebbe. Ich weiß nicht, ob Sie… «
»Ich weiß, was eine Springflut ist.«
Dupin hatte hinzufügen wollen »denn ich lebe seit fast vier Jahren in der Bretagne und habe bereits etliche Springfluten und Nippebben erlebt«, aber er wusste, dass es sinnlos war. Zudem musste er zugeben, dass er das mit den Flutkoeffizienten zwar schon sehr, sehr oft erklärt bekommen hatte, es sich aber bis heute nicht richtig hatte merken können. Für Riwal würde er, wie für alle Bretonen, noch nach Jahrzehnten ein »Fremder« sein (was jedoch in keiner Weise böse gemeint war). Noch dazu ein Fremder der für Bretonen schlimmsten Sorte: ein Pariser (was wiederum durchaus böse gemeint sein konnte). Jedes Mal aufs Neue bekam er es vorgebetet: Wenn Mond, Sonne und Erde auf einer Linie liegen und sich dadurch die Schwerkrafteinflüsse addieren…
Der Motor erstarb jäh, die beiden Kollegen der Wasserschutzpolizei, die, was Dupin erst jetzt auffiel, dem Kapitän auf komische Weise ähnlich sahen, die gleiche drahtige Statur, das gleiche schmale Gesicht, die gleiche Uniform, machten sich umgehend vorn am Bug zu schaffen.
»Wir kommen nicht näher an die Insel ran. Das Wasser ist zu flach.«
»Und was heißt das?«
»Wir müssen hier aussteigen.«
»Es dauerte ein paar Sekunden, ehe Dupin reagierte.
»Wir müssen hier aussteigen?«
Sie waren für Dupins Empfinden noch sehr deutlich auf dem Meer.
»Das Wasser ist nicht mehr tief, vielleicht einen halben Meter.«
Inspektor Riwal hatte sich hingekniet und begonnen, seine Schuhe auszuziehen.
»Aber wir haben doch ein Beiboot.«
Dupin hatte es ehrlich gesagt gerade erst bemerkt. Mit Erleichterung.
»Das lohnt sich nicht, Monsieur le Commissaire. Viel näher kämen wir damit auch nicht an den Strand heran.«
Mit hochgezogenen Augenbrauen blickte Dupin über die Reling. Es schien ihm erheblich mehr als ein halber Meter bis zum Grund zu sein. Das Wasser war unfassbar klar. Jede Muschel, jedes Steinchen war zu sehen. Ein Schwarm winziger hellgrüner Fische huschte vorbei. Sie lagen vor der Nordseite von Le Loc’h. Nichts als blendend weißer Sand, türkisfarbenes flaches Wasser, das Meer lag vollkommen still in der Kammer. Dazu noch ein paar Kokospalmen – wohl die einzige Palmenart, so kam es Dupin vor, die in der Bretagne nicht wuchs –, und durch nichts wäre dieses Bild von der Karibik zu unterscheiden gewesen. Niemand wäre je auf die Idee gekommen, diese Landschaft mit der Bretagne in Verbindung zu bringen. Auf Hunderten von Postkarten war der Anblick zu bestaunen, sie übertrieben tatsächlich kein bisschen.
Riwal hatte inzwischen auch seine Socken ausgezogen. Die Besatzungsmitglieder des Bootes hatten den Anker gesetzt, waren ohne das geringste Zögern geschickt ins Meer gesprungen und nun dabei, das Boot zu drehen, sodass das Heck mit der sich nur knapp über dem Wasser befindlichen Holzstufe Richtung Strand ausgerichtet war. Riwal, in einer hellen Stoffhose, sprang ins Wasser, als gäbe es nichts Selbstverständlicheres auf der Welt. Direkt nach ihm der schlaksige Kapitän.
Dupin zögerte. Es war eine absurde Szene, fand er. Die jungen Polizisten, Riwal und der Kapitän waren stehen geblieben und warteten. Es sah aus, als würden sie Spalier stehen. Alle Augen waren auf ihn gerichtet.
Dupin sprang. Er hatte die Schuhe nicht ausgezogen. Augenblicklich stand er bis knapp über den Knien im Atlantik, der jetzt, Anfang Mai, höchstens vierzehn Grad hatte. Mit Argusaugen fixierte er den Meeresboden. Der Schwarm der winzigen hellgrünen Fische, der nun viel größer war als zuvor, kam neugierig heran und schwamm furchtlos um seine Beine herum. Dupin vollführte eine halbe Drehung, um den Fischen mit dem Blick zu folgen – da sah er ihn: einen stattlichen Krebs, zwanzig, dreißig Zentimeter, in Angriffshaltung, der ihn direkt anstarrte, einen echten »Tourteau«, wie man ihn gern aß hier an der Küste – wie auch Dupin ihn gern aß. Er unterdrückte beides: einen kleinen Ausruf des Schreckens sowie der kulinarischen Begeisterung. Er sah hoch und realisierte, dass alle immer noch bewegungslos standen und ihm zuschauten. Dupin richtete den Oberkörper entschieden auf und begann Richtung Strand zu waten, sorgfältig darauf bedacht, weder Riwals noch die Blicke der drei Polizisten zu streifen. Die Kollegen überholten ihn im Wasser rasch rechts und links.
Dupin erreichte den Strand als Letzter.
Der leblose Körper lag auf dem Bauch, ein wenig seitlich, die Schulter in unnatürlicher Weise unter dem Körper abgeklemmt, es sah aus, als hätte er seinen rechten Arm verloren. Der linke Arm, der gebrochen sein musste, war stark angewinkelt. Der Kopf lag fast genau auf der Stirn, als hätte ihn jemand absichtlich so hingelegt. Das Gesicht war nicht zu sehen. Die blaue Jacke und der Pullover waren weitgehend zerfetzt, man sah die fürchterlichen großflächigen und tiefen Wunden am Rücken und am Hals, am Hinterkopf und am linken Arm. Der Unterkörper schien dagegen fast unversehrt. An einigen Stellen war er von Algen bedeckt. Die festen Segelschuhe, beide noch an den Füßen, wirkten neu. Das Alter des Mannes war in dieser Lage schwer zu schätzen, vielleicht etwas älter als er selbst, vermutete Dupin. Ende vierzig, Anfang fünfzig. Der Tote war nicht sehr groß. Dupin hatte sich neben ihn gekniet, um ihn genauer zu betrachten. Das Meer hatte ihn weit oben an den Strand getragen, ein paar Meter vor die Linie, wo der langsam ansteigende weiße Sand endete und die grellgrüne Vegetation begann.
»Dahinten liegen die beiden anderen, ziemlich nah beieinander. Sie sind in einem ähnlichen Zustand.«
Riwal deutete den Strand entlang. Dupin sah die jungen Kollegen der Wasserschutzpolizei neben etwas Massigem stehen, sicher hundert Meter entfernt. Dupin hatte gar nicht wahrgenommen, dass er nicht allein gewesen war. Riwals Stimme war ein wenig dünn.
»Die Leichen sehen fürchterlich aus.«
Riwal hatte recht.
»Welcher Gerichtsmediziner kommt?«
»Docteur Savoir müsste jeden Augenblick hier sein. Er ist auf dem anderen Schnellboot. Mit Inspektor Kadeg.«
»Natürlich. Das passt ja gut.«
Es war allgemein bekannt, dass der Kommissar und Docteur Savoir wenig Sympathie füreinander hegten.
»Docteur Lafond hat heute Morgen eine Verpflichtung in Rennes.«
In der Regel arrangierte Nolwenn es im Hintergrund immer so, dass der alte – brummige, aber großartige – Docteur Lafond gerufen wurde, wenn Dupin ermittelte.
Der Kapitän der Bir kam entschlossenen Schrittes auf sie zu.
»Es sind drei Männer, alle vermutlich Anfang fünfzig«, der junge Mann sprach ernst und ruhig. »Identität bisher unbekannt. Sehr wahrscheinlich sind die Leichen mit der letzten Flut angeschwemmt worden. Sie liegen ziemlich weit oben am Strand. Wir verzeichnen auf den Glénan mächtige Strömungen, und in den Tagen der Springflut sind sie noch stärker als sonst. Wir fotografieren und dokumentieren alles.«
»Ist das jetzt der niedrigste Stand der Ebbe?«
»Fast.«
Der Polizist schaute kurz auf die Uhr.
»Das Tideniedrigwasser war vor eineinhalb Stunden. Seitdem läuft das Wasser schon wieder auf.«
Dupin rechnete.
»Es ist jetzt 10 Uhr 45 – die letzte Ebbe war also um… «
»Der letzte Niedrigwasserstand war heute Morgen um 9 Uhr 15, der vorletzte gestern Abend um 20 Uhr 50. 12 Stunden und 25 Minuten früher. Der Höhepunkt der Flut wurde in der Nacht um 3 Uhr 03 erreicht.«
Es hatte keine drei Sekunden gedauert, der Polizist schaute Dupin ohne das geringste Zeichen von Triumph an.
»Haben wir Vermisstenmeldungen? Bei uns, bei der Seerettung?«
»Nein, Monsieur le Commissaire, es liegen, soweit wir wissen, bisher keine vor. Die können aber noch kommen.«
»Le Loc’h ist unbewohnt, oder?«
»Ja. Saint-Nicolas ist die letzte bewohnte Insel des Archipels. Aber auch dort wohnen nicht viele Menschen. Allenfalls zehn, im Sommer fünfzehn.«
»Das heißt, über Nacht ist hier auf der Insel niemand?«
»Es ist streng verboten, auf dem Archipel zu campen. In manchen Sommernächten tun es ein paar Abenteurer dennoch. Wir werden uns die ganze Insel ansehen. Und vielleicht haben vergangene Nacht einige Boote in der Kammer vor Le Loc’h gelegen. Das ist ein beliebter Ankerplatz. Das werden wir herausfinden.«
»Wie heißen Sie?«
Dupin mochte den unaufgeregten, sorgfältigen, jungen Polizisten.
»Mein Name ist Kireg Goulch, Monsieur le Commissaire.«
»Kireg Goulch?«
Dupin war die Nachfrage einfach rausgerutscht.
»Genau.«
»Das… das ist ein sehr… ein… ich meine, ein bretonischer Name.«
Auch dieser Kommentar schien den jungen Mann in keiner Weise zu irritieren. Dupin räusperte sich kurz und gab sich Mühe, wieder konzentriert bei der Sache zu sein.
»Inspektor Riwal sagte, der Engländer, der die Leichen entdeckt hat, war mit einem Kanu unterwegs.«
»Hier machen viele Besucher Touren mit Meerkajaks, das ist höchst populär. Auch wenn sie um diese Jahreszeit noch nicht so zahlreich sind, einige sind schon da.«
»Schon morgens? Sie machen ihre Touren bereits um diese Uhrzeit?«
»Am allerliebsten. Über Mittag brennt die Sonne auf dem Meer bereits gewaltig.«
»Der Mann hat aber nicht angelegt und ist ausgestiegen?«
»Soweit wir wissen, nein. Hier am Strand sind auch keine Fußspuren zu sehen.«
Dupin hatte gar nicht daran gedacht. Der nach jeder Flut wieder jungfräuliche Sand zeichnete aufs Vollkommenste jede Spur auf, sogar jeden Versuch einer Verwischung.
»Wo ist der Mann?«
»Auf Saint-Nicolas. Er wartet dort am Quai. Unser zweites Boot bringt einen Kollegen auf die Insel. Er wird mit dem Mann sprechen. Inspektor Kadeg hat das angewiesen.«
»Inspektor Kadeg hat das angewiesen?«
»Ja, er… «
»Ist schon gut.«
Es war nicht der Zeitpunkt für einen Affekt. Dupin nestelte mit einigem Aufwand aus seiner immer noch nassen Jacke eines seiner roten Clairefontaine-Hefte heraus, die er traditionell für Notizen verwendete. Weitgehend geschützt war es bei dem kleinen Meerunfall halbwegs trocken geblieben. Mit derselben eigenwilligen Umständlichkeit kramte er einen seiner billigen Bic-Kulis heraus, die er immer in großen Vorräten kaufte, weil sie ihm stets unbegreiflich schnell abhandenkamen.
»Hat es denn irgendwo einen Schiffbruch gegeben?«
Er wusste noch im selben Moment, dass es eine überflüssige Frage war. Sie hätten davon natürlich längst gehört. Der junge Polizist nahm die Frage mit freundlichem Langmut.
»Auch davon wissen wir bisher nichts, Monsieur le Commissaire. Aber wenn es gestern Abend oder gestern Nacht zum Kentern eines Bootes gekommen wäre, könnte es unter Umständen dauern, bis sein Ausbleiben bemerkt würde. Je nachdem, wie groß das Boot ist, über welche technische Ausrüstung es verfügt, wo es passiert ist, wohin es fuhr, wer es erwartete… «
Dupin machte sich ein paar lustlose Notizen.
»War denn gestern Nacht schlechtes Wetter? Gab es hier draußen einen Sturm?«
»Sie dürfen sich von dem Wetter heute nicht täuschen lassen. Gestern Abend ist ein Unwetter vor der Küste entlanggezogen, die Zentrale wird uns genau sagen können, wie stark es war und wo und wie es sich bewegt hat. In Concarneau war es nur wenig zu spüren, aber das heißt nichts. Wir verfügen über alle Aufzeichnungen. Die See ist ja noch heute einigermaßen unruhig, auch wenn es hier in der Kammer still ist. Sie haben es eben auf dem Boot selbst deutlich gemerkt.«
Das war eine neutrale Feststellung, ohne Unterton. Goulch wurde ihm immer sympathischer.
»Es war kein Jahrhundertunwetter, aber offenbar heftig«, schloss der Kapitän.
Kommissar Dupin kannte das zur Genüge, er war längst selbst zu sehr Bretone geworden, um sich von dem blauen, wolkenlosen Himmel und der perfekten Schönwetterstimmung noch narren zu lassen. Die bretonische Halbinsel, ihr äußerster, zerklüfteter Vorsprung – das Finistère –, erklärte ihm Nolwenn immer, lag weit vorgelagert mitten im Nordatlantik. »Wie ein urzeitliches Ungetüm streckt Armorika sein gezacktes Haupt aus. Gleich einem züngelnden Drachen.« Er mochte das Bild – und auf der Landkarte konnte man den Drachen tatsächlich erkennen. Die Bretagne war somit nicht nur der Urgewalt des bekanntermaßen wildesten aller Weltmeere ausgesetzt, sondern auch den chaotischen, sich unentwegt verändernden Wetterfronten, die sich zwischen der Ostküste der USA, Kanada, Grönland, der Arktis und den westatlantischen Küsten Irlands, Englands, Norwegens und Frankreichs entwickelten. Das Wetter konnte innerhalb kürzester Zeit von einem ins andere Extrem umschlagen. »Vier Jahreszeiten an einem Tag« war die Formel dafür, die die Bretonen gern mit Stolz zitierten.
»Vielleicht war es ja gar kein Schiffbruch.«
Riwals Stimme hatte wieder etwas an Festigkeit gewonnen.
»Sie könnten von der Flut überrascht worden sein. Dem Unwetter. Beim Angeln oder Muschelnfischen. Vor allem, wenn es Touristen waren. Bei besonders niedrigen Ebben kommen viele Muschelfischer.«
Das stimmte. Dupin nahm den Punkt in sein Notizheft auf.
»Warum haben sie keine Schwimmwesten an? Spricht das nicht für eine solche Annahme? Dass sie gar nicht auf einem Boot waren?«
»Nicht unbedingt«, erwiderte Goulch bestimmt. »Viele der Einheimischen fahren ohne Schwimmwesten. Und wenn noch Alkohol dazukommt… Ich würde dem keine Bedeutung beimessen.«
Dupin machte eine resignierte Handbewegung. So war es. Sie wussten nichts – schon gar nicht hier draußen.
»Alkohol spielt allgemein eine große Rolle auf dem Meer. Besonders hier auf den Inseln«, fügte Goulch noch hinzu.
»Die Menschen behaupten, dass die Flaschen auf den Glénan kleiner sind als auf dem Festland – deswegen sind sie hier so schnell leer.«
Dupin brauchte einen Moment, bis er den Witz verstanden hatte – er nahm an, dass es einer war –, Riwal hatte ihn als sachliche Ergänzung vorgetragen.
Goulch fuhr unbeeindruckt fort:
»Die Körper sind sicherlich eine Zeit lang in der Brandung getrieben, vermutlich ist es so zu den schweren Verletzungen gekommen. Wenn es ein Bootsunfall war, haben sie sich die Verletzungen vielleicht teils schon während des Unfalles zugezogen.«
»Könnten sie weit entfernt von hier ihr Leben verloren haben? Ich meine, wie weit könnte die Strömung sie getragen haben?«
»Das hängt ganz davon ab, wie lange sie im Meer getrieben sind. Vielleicht haben sie zunächst noch gelebt und versucht, sich zu retten. Und sind dann erst ertrunken. Es macht nicht den Eindruck, als hätten sie Tage im Meer getrieben. Solche Leichen sehen anders aus. Dennoch, die Strömungen sind unterschiedlich schnell. Manche acht Stundenkilometer, so hätten die toten Körper selbst in einer Nacht schon eine beträchtliche Entfernung zurücklegen können. Aber je nachdem, wo sie ins Wasser gekommen sind, sind sie womöglich im Kreis getrieben. Die Richtungen der Strömungen wechseln, je nach Tidenstand, Wetter, Jahreszeit.«
»Ich verstehe: Es lassen sich noch keinerlei Aussagen treffen.«
»Es ist eine Eigenart des Archipels, dass bei bestimmten Konstellationen von Sonne, Mond und Erde viele Strömungen zu Le Loc’h führen. Zu allen Zeiten wurden hier Schiffbrüchige angeschwemmt. Bei Unfällen großer Schiffe waren es manchmal Dutzende Leichen, die am Strand gefunden wurden. Deswegen hat man auf der Insel im 19. Jahrhundert einen Friedhof gebaut, direkt neben der Kapelle. So musste man die Toten nicht extra nach Saint-Nicolas bringen, wo zuvor der einzige Friedhof des Archipels gewesen war. Hier wurden sie alle begraben. – Man hat auf der Insel sogar schon Grabstätten aus der frühen keltischen Zeit gefunden.«
»Sie wurden immer hier angeschwemmt?«
Dupin sah sich unwillkürlich mit einem seltsamen Gefühl um.
»Man hielt die Insel über Jahrhunderte für das sagenumwobene Versteck von Groac’h, der Hexe der Schiffsuntergänge. Sie war unermesslich reich, reicher als alle Könige zusammen, heißt es. Und ihre Schatztruhe war der See, der eine unterirdische Verbindung mit dem Meer hat. Eine magische Strömung brachte so die Schätze aller versunkenen Schiffe zu ihr. Auf dem Grund stand auch ihr Palast.«
Riwal lächelte, als Goulch geendet hatte, aber er sah deutlich angestrengt aus.
»Sie frisst gern junge Männer«, ergänzte Goulch, »sie verführt sie, verwandelt sie in Fische, frittiert sie und frisst sie. Viele haben sich auf die Suche nach dem sagenhaften Schatz gemacht. Nie ist einer zurückgekommen. Es gibt unzählige Geschichten.«
So war es in der Bretagne. Unter der Oberfläche des Gewöhnlichen und Natürlichen wirkten obskure Kräfte. Und jeder Ort hatte seine eigenen übernatürlichen Geschichten. Auch wenn sich die Bretonen selbst darüber lustig machten – und Dupin kannte keinen Menschenschlag, der sich allgemein so souverän und grandios über sich selbst lustig machen konnte –, bei diesen Geschichten erstarb das Lachen von einem Augenblick auf den nächsten, und alles war ganz real. Es steckte zu tief, über Tausende Jahre war das Übernatürliche die natürlichste Wahrnehmung der Welt gewesen – und nur, weil man sich jetzt im 21. Jahrhundert befand, sollte es plötzlich anders sein?
»Ich will die anderen beiden Toten sehen.«
Dupin ging den Strand entlang, Goulch und Riwal folgten ihm. Die erste, die entscheidende Frage war im Moment: Waren die Männer Opfer eines Unfalls geworden? Ertrunken? Gab es irgendwelche Hinweise, dass es etwas anderes als ein Unfall gewesen sein könnte?
Die leblosen Körper lagen einander zugewandt auf der Seite, die Arme dem anderen entgegengestreckt. Es sah ein wenig makaber aus, als hätten sie noch gelebt und in ihrer Agonie mit letzter Kraft zueinanderkriechen wollen. Der unheimliche Eindruck der Szene wurde von einer Reihe großer Perlmuttmuscheln verstärkt, die wie arrangiert um die Toten herumlagen und in allen Regenbogenfarben schimmerten. Goulchs Kollegen knieten zwischen den Leichen, der eine machte Fotos mit einer Digitalkamera. Wortlos stellte sich die kleine Gruppe neben sie und betrachtete die beiden Körper.
Dupin löste sich nach einigen Momenten, ging langsam mehrere Male um die Leichen herum und bückte sich dabei immer wieder. Die gleichen schweren Fleischwunden, bei dem einen fast ausschließlich am Unterkörper, beim anderen am ganzen Körper verteilt, stark zerfetzte Kleidung (Baumwollhosen, Polohemden, Fleecejacken, feste Schuhe), ein paar Algen und Seetang, auf und in den Wunden.
Der Polizist mit der Kamera richtete sich langsam auf:
»Wie der Tote dort drüben weisen sie auf den ersten Blick keine anderen Verletzungen auf als solche, die spitze Felsen ihnen beim Treiben in der Brandung zugefügt haben könnten.«
»Auf dem Meer muss man niemanden verletzen, um ihn zu töten. Es reicht ein kleiner Stoß, ein Sturz ins Wasser. Bei Unwettern und hohem Seegang hat selbst ein geübter Schwimmer nicht den Hauch einer Chance. – Weisen Sie einen kleinen Schubser einmal nach.«
Goulch hatte mit jedem Satz recht. Man musste hier draußen anders denken.
»Das zweite Boot kommt.«
Dupin fuhr zusammen. Goulch deutete aufs Meer. Die Luc’hed näherte sich mit hohem Tempo der Bir, erst kurz bevor sie diese erreichte, verlangsamte sie ihre Fahrt. Sie stoppte direkt neben der Bir und legte sich parallel zu ihr.
Dupin beobachtete die Prozedur, die er von eben kannte. Er konnte Kadeg und Docteur Savoir ausmachen, den Kapitän, zudem einen weiteren Polizisten, der bereits im Meer stand und das Boot ausrichtete. Ohne Umstände verließen alle das Boot und wateten auf den Strand zu, Kadeg ein Stück voraus. Natürlich.
»Wir haben einen Polizisten zur Befragung des Engländers, der die Leichen entdeckt hat, auf Saint-Nicolas abgesetzt. Wir werden bald einen Bericht erhalten. Drei Leichen, das ist ein gewichtiger Fall.«
Noch ehe er aus dem Wasser war, hatte Kadeg schon losgelegt, in dem emsigen Ton, den er gern anschlug und den Dupin auf den Tod nicht ausstehen konnte.
»Wir wissen noch gar nicht, ob das hier überhaupt ein Fall ist, Inspektor.«
»Was wollen Sie damit sagen, Monsieur le Commissaire?«
»Alles sieht erst einmal nach einem Unfall aus.«
»Und das heißt, dass wir nicht alles erfassen sollen, was zu erfassen ist, um zu erfahren, was hier geschehen ist?«
Ein beeindruckend idiotischer Satz, fand Dupin. Er merkte, wie gereizt er war. Was an dem ganzen verunglückten Morgen lag – und am Eintreffen des zweiten Bootes. Kadeg, dann dieser linkische Gerichtsmediziner Savoir, der hier gleich eine Show wie in einer CSI-Folge abziehen würde, dabei auf unglaubliche Weise umständlich war und nie zum Punkt kam. Jetzt erst sah Dupin, dass der Polizist des zweiten Bootes einen riesigen und offensichtlich schweren Koffer trug, in dem sich mit Sicherheit Savoirs Hightechausrüstung befand.
Dupin wusste, dass er sich nur auf die Situation konzentrieren sollte. Vielleicht wäre das hier in ein paar Stunden vorbei und nicht mehr seine Sache.
»Oh! Monsieur le Commissaire.«
In Savoirs Stimme lag ein absurder Hauch von Stolz, als hätte er allein durch das Erkennen Dupins eine anspruchsvolle Aufgabe gemeistert.
»Gibt es erste Erkenntnisse? Was gibt es bisher an Fakten?«
Er war während dieser betont markig gesprochenen Fragen an Dupin vorbeigelaufen, ohne seine Schritte auch nur ein wenig zu verlangsamen.
»Ich werde mir alles ansehen, dann wissen wir sicher schon mehr. Obgleich ich selbstverständlich nur vorläufige Aussagen treffen kann, zu allem Weiteren benötige ich mein Labor. Die Ausrüstung bitte hierhin, zwischen die beiden Leichen.«
Savoir warf einen kurzen, aber theatralisch professionellen Blick auf die Körper und klappte den Koffer auf.
»Ist alles bereits dokumentiert worden? Fotografiert?«
»Ja, diese Arbeiten sind abgeschlossen. Bei allen drei Toten«, schaltete sich Goulch ein.
»Lässt sich schon vor einer Autopsie sagen, ob die Männer ertrunken sind?«
Savoir starrte Goulch indigniert an.
»Ausgeschlossen. Ich werde mich auch in diesem Fall selbstverständlich keinen Spekulationen hingeben. Das wird alles seine Zeit brauchen.«
Dupin schmunzelte. Wunderbar! Er wurde hier nicht gebraucht. Er trat zu Riwal und Goulch.
»Ich werde mir die Insel ansehen.«
Er hatte selbst keine Ahnung, was er genau tun wollte.
»Sollen wir uns dennoch später noch einmal systematisch umschauen, Monsieur le Commissaire? Ob wir etwas Auffälliges finden?«
»Ja, ja. Unbedingt, Goulch. Ich laufe einfach etwas herum. Und finden Sie heraus, ob jemand von einem Boot aus etwas Ungewöhnliches wahrgenommen hat hier auf Le Loc’h. Überhaupt. Auch anderswo.«
»Wollen Sie auf etwas Bestimmtes hinaus?«
Kadeg hatte sich unangenehm nahe vor ihn gestellt, er tat das sehr gern und wusste, dass Dupin es nicht leiden konnte.
»Routine, Kadeg. Ausschließlich Routine. Von eingehenden Nachrichten über Schiffbrüche oder Vermisste erfahren wir ja automatisch, denke ich?«
Kommissar Dupin war selbst nicht klar, was er mit »automatisch« meinte. Er hatte sich bei dieser Frage deutlich Goulch zugewandt.
»Natürlich, Monsieur le Commissaire. Alle Polizeistationen der Küste sind informiert, auch die der umliegenden Distrikte. Wir haben die beiden Hubschrauber aus Brest angefordert, von der Seerettungszentrale. Sie sind seit einer Stunde im Einsatz und fliegen die Umgebung ab.«
»Sehr gut, Goulch, sehr gut. – Riwal, Sie bleiben in der Nähe von Monsieur Goulch. Ich will über alles fortlaufend unterrichtet werden. Kadeg, sobald Savoir grünes Licht gibt, suchen Sie bei den Leichen nach Dokumenten, nach allem, was uns hilft, sie zu identifizieren.«
»Ich – ich.«
Kadeg verstummte. Einer musste das machen. Und der Kommissar konnte bestimmen, wer. Es war, als würde sich dieser simple Gedankengang mit Pein auf Kadegs Gesicht zeigen, seine Züge verzerrten sich.
»Seien Sie gründlich, Kadeg. – Funktionieren die Mobiltelefone eigentlich auf den Inseln, Riwal?«
»Letztes Jahr wurde ein neuer Mast auf Penfret errichtet. Wenn auch kein richtig großer. Die Verbindung ist seitdem meistens stabil.«
Riwal blickte über Le Loc’h hinweg und schien den Mast auf Penfret zu suchen.
»Was heißt das?«
»Das hängt von verschiedenen Faktoren ab.«
»Und was bedeutet das?«
Dupin fand das nicht unwichtig.
»Vor allem vom Wetter. Bei schlechtem Wetter haben Sie zumeist gar keinen Empfang, bei gutem Wetter eigentlich schon. Zuweilen aus irgendwelchen Gründen aber selbst dann nicht. Es hängt sehr davon ab, ob Sie auf dem Wasser sind oder nicht – und vor allem natürlich davon, auf welcher Insel Sie sind. Auf Bananec haben Sie eigentlich nie Empfang, obwohl es ja gar nicht weit von Saint-Nicolas entfernt ist.«
Dupin fragte sich, wie das sein konnte, rein technisch gesehen. Und warum Riwal das so genau wusste. Er ließ beide nachfragen.
»Und hier auf Le Loc’h?«
»Heute vermutlich stabil.«
»Ich bin also – vermutlich erreichbar.«
»Und wundern Sie sich nicht, Monsieur le Commissaire, auf dem Archipel sieht man manchmal Dinge, die dann im nächsten Moment verschwunden sind. Oder hört sonderbare Geräusche und Laute. Das war schon immer so, das ist ganz normal.«
Dupin hatte keinen Schimmer, was um alles in der Welt er dazu sagen sollte. Er drehte sich um, fuhr sich durch die Haare und lief in westlicher Richtung den Strand entlang, auf die dickbäuchige Südspitze der Insel zu.
Es war wirklich atemberaubend. Wohin man auch schaute. Feinster weißer Zuckersand, sachte ins Meer abfallende Strände, bei denen man gar nicht sah, wo die Wasserlinie begann, so durchscheinend war das Ozeanwasser. Ein helles, zugleich leuchtendes Türkis, das sich in unendlichen Übergängen in Opal, dann in ein Hellblau verwandelte. Dunkler wurde es erst weit draußen. Nicht, dass man in Concarneau nicht auch in berückender Weise das Meer spürte – genau das machte die Stadt ja aus –, aber das hier, die Glénan, steigerte alles um ein Vielfaches. Man war nicht am Meer, man war im Meer, so das Gefühl, mitten im Meer. Es waren nicht nur der Geschmack und Geruch, es war ein tiefer, durchdringender Eindruck.
Das Betörendste aber war das Licht, ein mächtiges, gewaltiges Licht, dabei sanft, nicht aggressiv. Es war ein Licht von überall her. Es schien keine bestimmte Quelle zu haben, zumindest nicht nur eine, nicht nur die Sonne. Es kam vom ganzen Himmel – aus all seinen Weiten, Höhen, Schichten, Sphären und Dimensionen. Und vor allem – es kam vom Meer. Das Licht schien endlos multipliziert zu werden, sich in den verschiedenen Atmosphären und dem Wasser zu spiegeln und sich dabei immer mehr zu verdichten. Die kleinen Fetzen Land waren viel zu unerheblich, um etwas davon zu schlucken. Dupin hatte noch nie so viel Licht gesehen wie in der Bretagne – auch noch keinen Himmel, der so hoch hing, so frei war –, aber hier auf den Glénan wurde das alles übertroffen. Es macht einen trunken, erzählten sich die Menschen an der Küste, es verdreht einem den Kopf. Dupin verstand, was sie meinten.
Er kramte sein Mobiltelefon aus der linken hinteren Hosentasche hervor. Es schien bisher alles überstanden zu haben. Und es hatte tatsächlich Empfang.
»Nolwenn?«
»Monsieur le Commissaire?«
Dupin hatte völlig vergessen, dass seine Sekretärin heute Morgen einen Arzttermin gehabt hatte und gar nicht im Büro gewesen war, beim alten, knorrigen Docteur Garreg, der auch sein Hausarzt war. Jetzt erst fiel es ihm wieder ein.
»Ach ja, Sie wissen wahrscheinlich noch gar nicht, was passiert ist?«
»Nein. Ich wollte gerade bei Inspektor Kadeg anrufen. Ich habe gesehen, dass er es drei Mal bei mir versucht hat.«
»Drei Leichen. Auf den Glénan. Auf Le Loc’h. Angeschwemmt. Noch nicht identifiziert. Es sieht im Augenblick nach einem tragischen Unfall aus.«
»Ja, sie liegen immer auf Le Loc’h. Die Glénan bedeuteten zu allen Zeiten Schiffbrüche.«
Nolwenn blieb wie immer vollkommen gefasst.
»Wenn du beten lernen willst, so fahr aufs Meer! sagen wir hier.«
Nolwenn mochte alte Sprichwörter, und diese zu vermitteln gehörte zu ihren »bretonischen Lektionen«, die sie dem Kommissar seit seiner Ankunft im Interesse seiner »Bretonisierung« gab (so nannte sie ihr Projekt tatsächlich). Dupin war nicht sicher, was er antworten sollte.
»Ja. So oder so, das wird gehörige Wellen schlagen. Savoir ist eben angekommen. Ich gehe jetzt die Insel ab.«
»Sie sind schon dort?«
»Ja.«
»Mit dem Boot?«
»Ja.«
Das zweite Ja hatte viel resignierter geklungen, als Dupin es beabsichtigt hatte.
»Kann ich im Moment etwas tun?«
»Nein. Erst einmal müssen wir die Identität der Toten ermitteln.«
Dupin hatte tatsächlich kein konkretes Anliegen gehabt. Er hatte bloß gewollt, dass Nolwenn im Bilde war. Nolwenn war sein Anker, seit dem ersten Tag in seiner neuen »Heimat«. Sie war universell patent und pragmatisch, nichts in der Welt – und auch darüber hinaus, stellte Dupin sich vor – schien sie aus der Fassung bringen zu können. Sie würde in drei Wochen das erste Mal seit zwei Jahren Urlaub machen, weit weg, am mediterranen Rand der Pyrenäen, in Portbou. Seit er davon erfahren hatte, machte es Dupin erheblich nervös, sie plante volle vierzehn Tage am Stück.
»Der Präfekt wird Sie heute noch einmal persönlich sprechen wollen. Nach den ersten Erörterungen bei seinem Treffen auf Guernsey. Wir hatten einen Telefontermin für den Nachmittag vereinbart. Ich befürchte, das wird jetzt ganz und gar unmöglich sein. Ich werde ihm über sein Büro eine Nachricht zukommen lassen.«
»Ich – das ist – wunderbar! Ja. Die Verbindung hier draußen ist sehr schlecht. Er wird sich das denken können – ich befinde mich gewissermaßen mitten im Meer.«
»Der Präfekt wird von dem neuen Mast auf Penfret wissen. Die Einweihung war ein Ereignis. Auch wenn er wirklich leistungsstärker sein könnte. Aber – ich nehme doch an, dass Sie sich in Ihrer Ermittlung befinden werden. Drei Leichen, ich meine, für bretonische Verhältnisse… Egal wie sie zu Tode gekommen sind. Eine rasche Aufklärung wird auch im Interesse des Präfekten sein.«
Dupins Stimmung hob sich, das erste Mal an diesem Tag.
»Sehr gut, ja. So ist es.«
Erst jetzt dachte er doch einen Augenblick darüber nach, warum das mit dem Mast so ein »Ereignis« gewesen war, dass alle davon wussten.
»Ich werde also mitteilen, dass erst einmal nicht mit Ihrem Anruf zu rechnen ist.«
»Ausgezeichnet.«
Dupin zögerte.
»War – wie war es beim Arzt? Ich meine… «
»Alles in Ordnung.«
»Da bin ich froh.«
Er kam sich ein wenig albern vor.
»Danke. Woran Sie unbedingt noch denken sollten, ist, Ihre Mutter anzurufen. Sie hat heute bereits drei Mal auf den Anrufbeantworter gesprochen.«
Das fehlte ihm noch. Er vergaß es die ganze Zeit. Seine Mutter. Zum allerersten Mal seit seiner »Verbannung in die Provinz« – so nannte sie es bis heute konsequent – hatte sie sich vorgenommen, ihn zu besuchen. An diesem Donnerstag. Und seit Wochen rief sie an, mittlerweile täglich, um noch eine »wichtige Frage« zu klären, bei der es sich immer nur um eine einzige Angst drehte: ob es derart weit entfernt von der Metropole noch ein hinreichendes Maß an zivilisatorischen Standards gab. Dupin hatte sie – Anna Dupin, die traditionell elitäre Pariserin aus großbürgerlichem Haus, tyrannisch wenn es sein musste, ansonsten bezaubernd, und die Paris nur verließ, wenn es unumgänglich war – natürlich im besten Hotel Concarneaus untergebracht. Und er hatte selbstverständlich das teuerste Zimmer gebucht, die »Suite Navy«, aber sie schien es dennoch nicht für ausgemacht zu halten, dass es über fließendes Wasser verfügte.
»Mach ich.«
»Gut.«
»Danke, Nolwenn.«
Dupin legte auf. Er musste sich wirklich noch um einiges für diesen Besuch kümmern, hauptsächlich um seine Wohnung. Auch wenn sie gar nicht besonders unordentlich war, aber er hatte keine Lust, sich die geringste Blöße zu geben. Am besten, sie würden gar nicht erst in seine Wohnung gehen. Er würde den gesamten Besuch an anderen Orten stattfinden lassen.
Dupin war um einen kleinen Vorsprung herumgelaufen, hier endete jäh der weiße Sandstrand. Struppiges, buschiges, fettes Grün – Halme, Gräser, Farne – wuchs bis zur felsigen Meereslinie hinunter. Das Gestein der Insel zog sich an dieser Stelle dreißig, vierzig Meter ins Wasser, erst dort war wieder Sand. Dupin betrat den schmalen, steinigen Trampelpfad, der einmal um die Insel führte, ein alter Schmuggler- und Piratenweg, wie sie hier an den Küsten allerorts zu finden waren. Über Hunderte Jahre waren die Glénan das Reich ruhmvoller Piraten gewesen, »böser« englischer zum Beispiel und »guter« bretonischer, die bis heute jenseits moralischer Fragen sehr verehrt wurden, denn einzig entscheidend war: Sie kamen aus der Bretagne und waren weltberühmt. Nolwenns Heldin, nach der sie ihre erste Tochter genannt hatte, war die »Tigresse de Bretagne«, Jeanne de Belleville, die »bretonische Tigerin«: die verbürgt erste Piratin der Weltgeschichte. Eine atemberaubend schöne Frau aus dem Adel der damals noch eigenständigen (!) Bretagne, die im 13. Jahrhundert mit einer »Flotte« von nur drei Booten in tollkühner Weise unzählige hochgerüstete Schiffe zerstört hatte – Schiffe eines Todfeindes: des französischen Königs.
Am westlichen Ende der Insel waren die Ruinen der Soda-Fabrik auszumachen, in der aus Algen industrielles Soda für die Herstellung von Glas, Wasch- oder Farbmitteln gewonnen worden war, Anfang des 20. Jahrhunderts ein kostbarer Stoff, was sich heute niemand mehr vorstellen konnte. Jetzt sah man plötzlich auch den erstaunlichen See. Ein wenig unwirklich, wie eine glatte Fläche lag er da, man sah die unglaubliche Farbe, für die er berühmt war: ein leuchtendes, fast phosphoreszierendes Grüngraublau. Dabei war das Besondere die eigentümliche tiefe Intensität des Tons. Dupin musste, ob er wollte oder nicht – und er versuchte angestrengt, nicht zu wollen –, unwillkürlich an Goulchs Geschichten über den See denken. Die Hexe. Groac’h. Er verstand sofort, dass dieser See der Fantasie weite unheimliche Flügel verlieh. Einen Augenblick fröstelte er. Bilder tiefschwarzer Unterwasserhöhlen-Labyrinthe tauchten unwillkürlich vor seinem inneren Auge auf.
Dupin hatte gedacht, es wäre eine gute Idee, etwas herumzulaufen. Sich umzusehen. Aber eigentlich gab es gar keinen Grund. Wonach sollte er Ausschau halten? Was immer geschehen war, es war bestimmt nicht auf Le Loc’h geschehen, es würde hier also auch nichts geben, was von Relevanz wäre. Er hatte im Grunde nicht die geringste Ahnung, was er überhaupt noch auf der Insel sollte. Sie mussten die Identität der Toten ermitteln und herausfinden, was den drei Männern zugestoßen war. Dazu würde er vor Ort keinen Beitrag leisten können.
Es war bisher überhaupt nicht Dupins Tag gewesen, dieser Montag. Der Kommissar hatte nicht viel und nicht gut geschlafen, dabei funktionierte das mit dem Schlafen seit einiger Zeit eigentlich passabel, zumindest für seine Verhältnisse. Er war die ganze Nacht unruhig gewesen, ohne zu wissen, warum. Sicher war, er brauchte einen café. Unbedingt. Und sofort.
Dupin holte das Handy aus seiner Tasche.
»Riwal?«
»Monsieur le Commissaire?«
»Könnten Sie Goulch bitten, dass mich die Bir nach Saint-Nicolas fährt?«
»Nach Saint-Nicolas? Jetzt?«
»Genau.«
Es entstand eine längere Pause, und in der Stille war Riwals Frage, was der Kommissar jetzt auf Saint-Nicolas vorhabe, quasi zu hören. Riwal fragte nicht, nach Jahren der Zusammenarbeit mit dem eigenwilligen, bisweilen dickschädeligen Kommissar wusste er, was sinnvoll war und was nicht.
»Ich nehme an, Saint-Nicolas wird der Umschlagplatz für alle Neuigkeiten hier auf dem Archipel sein, oder? Bei der Gelegenheit kann Goulch seinen Kollegen abholen und ich vielleicht noch einmal ein paar Worte mit dem Engländer wechseln.«
»Ich spreche mit Goulch. Sie müssten nur wieder zum Strand kommen, man wird Sie an anderen Stellen der Insel nicht abholen können.«
»Kein Problem. Ich bin gleich da.«
»Gut.«
»Riwal – die Bar dort wird doch schon aufhaben, oder?«
»Die Bar?«
»Das Café.«
»Ich habe keine Ahnung, Chef.«
»Mal sehen.«
Die hölzernen Hummerkäfige mit den geflochtenen, vom Meer ausgewaschenen hellblauen Tauen standen zu Dutzenden wild herum, hier und da zu kunstvollen Türmen gestapelt, rechts vom Hauptquai zu regelrechten Gebirgen. Dupin saß auf einem der wackligen, abgeblätterten Holzstühle, die zusammen mit den Tischen weit verteilt draußen vor der Bar standen, und bestaunte die Käfige.
Das Les Quatre Vents war augenfällig nicht als Restaurant, Café oder Bar gebaut worden. Es war das Bootshaus der ersten Seerettungsgesellschaft der Küste gewesen, die in Concarneau ihren Hauptsitz hatte, aber hier draußen ihre, aufgrund der dauernden Einsätze, wichtigste Dépendance. Über hundert Jahre war es alt, und man hatte es außen gar nicht und innen nur wenig und ohne großen Aufwand umgebaut. Links ein kleiner, windschiefer, provisorisch aussehender Anbau aus Holz, weiß gestrichen wie das steinerne Haupthaus, der über einen Durchbruch mit dem Hauptraum verbunden war, große Fenster hatte und noch einmal Platz für einige zusätzliche Tische bot.
Es gab nicht viel im Quatre Vents, eine kleine Auswahl an Getränken, hauptsächlich Bier, Wein und Hochprozentiges, ein wechselndes Plat du jour – den Fisch des Tages oder ein Entrecôte –, Sandwiches mit verschiedenen Fischrillettes, Fischsuppe, die Meeresfrüchte, die hier aus dem Atlantik zu holen waren: Krebse, Seespinnen, verschiedenste Muschel- und Schneckenarten: Bulots, Bigourneaux, Palourdes, Praires, Ormeaux. Aber vor allem, natürlich, die Hummer der Glénan. Über dem Haupteingang stand auf einem Stück Holz in weißen handgeschriebenen Buchstaben »Bar«, darunter »Les Quatre Vents«, rechts und links der Schrift flogen stilisierte Möwen. Vor dem alten Bootshaus lagen noch die Schienen, die bis tief ins Meer führten und auf denen das stolze Boot der Seerettungsgesellschaft so weit ins Wasser gebracht worden war, bis es selbst manövrieren konnte.
Dupins Laune hatte sich schlagartig gebessert, seit er im Quatre Vents saß. Es war großartig hier. Ihm war sofort klar gewesen, dass er diesen Ort liebte; augenblicklich hatte er einen Platz auf Dupins Liste der »besonderen Orte« erobert, die er führte, solange er sich zurückerinnern konnte. Orte, die ihn froh machten. Im Quatre Vents war alles echt, nichts arrangiert, dekoriert, um idyllisch zu sein. Und in der Tat, es war kein bisschen idyllisch, es war – umwerfend schön. Und, genauso wichtig: der café war perfekt. Dupins zweiter jetzt. Es gab keine Bedienung, man musste sich alles auf Holztabletts an dem langen Tresen in der Bar holen und konnte sich damit hinsetzen, wo man wollte. Dupin hatte sich mit dem Rücken zur Wand des Anbaus gesetzt, so konnte er die ganze Szenerie überblicken.
Links, vielleicht dreißig Meter entfernt, lag das größte Haus der Insel, das lang gestreckte ehemalige Farmhaus, das der legendären Segelschule als Zentrale diente: Les Glénans (mit »s«, die Inseln dagegen wider alle Grammatik ohne »s«). Sie war Ende des Zweiten Weltkrieges von ein paar idealistischen jungen Leuten aus der Résistance gegründet worden und hatte sich in den folgenden Jahrzehnten zur weltweit anerkanntesten Segelschule entwickelt, die sich schon bald auf fünf der Inseln verteilt hatte und mittlerweile Dépendancen in zwölf Ländern unterhielt. Das Gebäude glänzte leuchtend weiß, es musste erst vor Kurzem neu gestrichen worden sein, innerhalb von Monaten verloren selbst die resistentesten Spezialfarben am Meer ihren Glanz, so scharf setzten ihnen Sonne, Salz, Feuchtigkeit und Wind zu. Gegenüber der Segelschule, vor der sich ein kleiner länglicher Platz erstreckte, lagen zwei Austernbecken, deren solide Außenwände Richtung Meer zugleich eine Art Hafenmauer bildeten. Die Becken waren zur Hälfte mit einem Schuppen überbaut, der im Sommer als Austernbar diente, nicht schick – nichts war schick hier –, kein Gehabe und Getue, bloß köstlich.
Die vordere Wand des Schuppens brachte etwas Skurriles in die ansonsten vollkommen stimmige Szene: ein riesengroßes Gemälde, forciert naiv gemalt, auf dem typische Landschaften der Glénan, die bekanntesten Wahrzeichen der einzelnen Inseln und auch mythische Stoffe zu einem surrealen Panoramabild vermischt worden waren. Rechts sah man den Thron der Groac’h und sie selbst als hübsche junge Königin mit einem Fischschwanz. Genau in der Mitte des Bildes, auf einem Strand, stand ein großer Pinguin und schaute keck in die Gegend. Pinguine waren zwar Dupins Lieblingstiere, aber er grübelte doch darüber nach, was dieser dort zu suchen hatte, ein Brillenpinguin, wenn er sich nicht täuschte.
An der Seite des größeren Austernbeckens entlang führte der aus schwerem Beton gegossene, massive Quai, der sich bestimmt fünfzig Meter ins Meer zog. Hier legten in den Sommermonaten die vielen Boote an, die zwischen den Inseln und verschiedenen Orten an der Küste hin- und herpendelten. Dort hatte vor einer halben Stunde auch die Bir festgemacht. Der junge Polizist hatte die – vollkommen ergebnislose – Befragung des Engländers längst abgeschlossen und bereits am Quai gewartet.
Nicht weit von den Austernbecken begann einer der typischen karibisch anmutenden Strände der Glénan. Das Bemerkenswerte dieses Strandes war, dass er sich bei Ebbe, also jetzt, zu einer schier unendlich langen Sandbank ausdehnte, die aus Bananec, eigentlich die kleinere Nachbarinsel von Saint-Nicolas, einen Annex der Hauptinsel werden ließ. Zwischen beiden lag nun der außergewöhnlichste Strand des Archipels, alle zwölf Stunden – und fünfundzwanzig Minuten! – neu und rein dem Meer entwachsen.
Nur an zwei anderen Tischen saßen Gäste. Eine Gruppe Engländer, der Kleidung nach zu urteilen Segler, und eine Gruppe Franzosen, dem Anschein nach Pariser, Dupin hatte einen sicheren Blick für so etwas. Beiden Gruppen war eine gewisse Aufgeregtheit anzumerken, was nicht verwunderlich war. Dupin nahm an, dass sie über die angeschwemmten Leichen sprachen. Natürlich.
Sie hatten bei der Untersuchung der Leichen keinerlei Hinweise auf die Identität der Toten gefunden, keine Papiere, keine Handys, nichts, in den Hosentaschen von zweien war etwas Kleingeld gewesen, bei einem ein Zettel, der vom Salzwasser schon schwer angegriffen und bisher nicht zu entziffern war. Kadeg hatte angerufen und einen schneidig formulierten Bericht vorgetragen, kurz nachdem Dupin auf Saint-Nicolas angekommen war.
Dupin hatte Hunger. Mehr als das obligatorische Croissant zum ersten café hatte er noch nicht gegessen. Warum sollte er nicht etwas bestellen? Ein bisschen komisch kam er sich vor, eine Insel weiter lagen drei unbekannte Tote am Strand, die Ermittlungen liefen, alle waren beschäftigt, nur er saß hier und – machte Ferien, so fühlte es sich an. Gerade hatte er sich – gegen seine Skrupel – entschieden, etwas zu essen, da wurden seine Gedanken jäh von einem ohrenbetäubenden Lärm unterbrochen. Ein Hubschrauber überflog in einer langen Kurve Saint-Nicolas Richtung Osten, er war wie aus dem Nichts gekommen, Dupin erkannte den Seerettungsdienst. Es musste einer der Hubschrauber sein, von denen Goulch gesprochen hatte. Als er sich entfernte und Dupin gerade im Begriff war aufzustehen, klingelte sein Handy.
»Ja?«
Er hatte nicht auf die Nummer geachtet. Er hasste es, wenn er das vergaß.
»Ich bin es.«
Erleichtert atmete er auf. Nolwenn.
»Gut, ich wollte… «
»Locmariaquer. Er hat von Guernsey aus angerufen. Ein Freund von ihm wird vermisst. Yannig Konan. Ein Unternehmer und Investor, wie man so sagt. Er ist zunächst mit Matratzen reich geworden, dann hat er sein Geld in die verschiedensten Geschäfte gesteckt. Er hat seine Finger in allem Möglichen. Richtig reich«, Nolwenn betonte das »richtig«, mit gerümpfter Nase, das konnte Dupin förmlich hören, »und ein erfahrener Segler. Konan war auf einer Bootstour mit einem Bekannten.«
»Ein Freund von… ein Freund des Präfekten?«
»Ja. Denken Sie, dass er… «
»Zu zweit? Sie waren zu zweit unterwegs?«
»Ja. Zu zweit. – Ein Krimineller, dieser Konan, wenn Sie mich fragen.«
»Ein Krimineller? Was meinen Sie mit… Ach… Er wird schon wieder auftauchen, dieser Matratzenunternehmer. Wir haben hier drei Leichen.«
Eine schwebende Pause entstand.
»Seit wann wird er vermisst?«
Dupin ärgerte sich über seine Nachfrage, er hatte eigentlich keine Lust, sich damit zu beschäftigen.
»Er wollte sich gestern Abend bei seiner Frau melden. Und heute Morgen wollte er zurück sein im Hafen von Sainte-Marine. Da liegt sein Boot, da hat er auch eines seiner Häuser. Konan hat heute eine Reihe wichtiger Termine. Er ist bislang nicht aufgetaucht und hat niemanden benachrichtigt, deswegen hat sich sein Büro in Quimper bei seiner Frau gemeldet, die… «
»Und der Bekannte?«
»Auch er geht nicht ans Handy, sagt Konans Frau.«
»Wo waren sie mit dem Boot unterwegs?«
»Das wusste seine Frau nicht genau. Sie verbringen bei gutem Wetter wohl häufig das Wochenende auf dem Boot. Oft auf den Glénan. Angeln und tauchen. Die Weite suchen, wie wir sagen.«
Jeder zweite Bretone, schätzte Dupin, hatte ein Boot. Und wenn man selbst keines hatte, so kannte man jemanden, der eines hatte. Das galt selbstverständlich nur für die Küstenbretonen. Kein Inlandsbretone käme je auf die Idee, auch nur ans Meer zu fahren.
»Sie werden schlicht keinen Empfang haben, da, wo sie sind. Auf dem Meer scheint das so eine Sache zu sein mit dem Empfang.«
»Konans Boot verfügt über ein Satellitentelefon. Aber darüber sind sie ebenso wenig zu erreichen.«
»Sie werden… «
Der Hubschrauber war zurückgekommen. Wie eben war er merkwürdigerweise erst zu hören, als er schon fast genau über Dupin stand. Der Lärm war brutal.
»Was ist bei Ihnen los?«
Nur mit Mühe verstand Dupin Nolwenns Frage.
»Ein Hubschrauber!«, brüllte er.
»Ein Hubschrauber?«
Dupin wollte gerade das Telefon vom Ohr nehmen, um es direkt vor den Mund zu halten und die Erklärung hineinzuschreien, als ihm Nolwenn zuvorkam.
»Natürlich. Die Küstenwache.«
Der Hubschrauber machte keine Anstalten weiterzufliegen. Im Gegenteil, jetzt war deutlich zu erkennen, dass er sank. Zuerst langsam, dann immer rascher. Er würde landen. Der Lärm war noch dröhnender geworden, es war vollkommen unmöglich, sich zu verständigen.
»Ich lege jetzt auf.«
Dupin hatte keine Ahnung, ob Nolwenn ihn verstanden hatte.
Der Hubschrauber konnte höchstens noch ein paar Meter über dem Boden sein, er war aus Dupins Sichtfeld verschwunden. Dupin überlegte, was er tun sollte. Ob er nachsehen musste? Er blieb sitzen. Es dauerte weitere ein, zwei Minuten, dann stoppte der Pilot den Motor, und sofort war die große, tiefe Stille zurück, die auf dem Archipel herrschte. Noch bevor Dupin erleichtert seufzen konnte, schrillte sein Telefon erneut. Diesmal war es nicht Nolwenn, sondern Riwal.
»Was gibt es?«
»Der eine Hubschrauber der Küstenwache müsste gerade bei Ihnen gelandet sein.«
Dupin sah sich außerstande, darauf etwas zu antworten.
»Wir haben Sie nicht erreichen können, bei Ihnen war dauernd besetzt. Im Meer wurden Gegenstände gesichtet. Vielleicht von einem Boot. Bei einer kleinen Felsengruppe, Les Méaban – drei Seemeilen östlich des Archipels. Sie gehört aber noch zu den Glénan, irgendwie. Der andere Hubschrauber ist noch dort und sucht weiter.«
Zu dem jahrhundertealten Streit, aus wie vielen Inseln, Inselchen und Felsengruppen bei welchen Gezeiten der Archipel nun tatsächlich bestand, hatte sich immer auch ein anderer gesellt: Welche Insel, Inselchen und Felsengruppen, die erkennbar nicht unmittelbar zum Archipel gehörten, zählte man dennoch hinzu? Wenn es sein musste, auch nur geologisch, erdgeschichtlich. Gern wurde landläufig alles den Glénan zugeordnet, was irgendwie vor der Küste zwischen Trévignon, Concarneau und Guilvinec lag, so wurden sie immer größer.
»Könnten die Toten von dort bis hierher getrieben worden sein? Was meint Goulch?«, fragte Dupin.
»Durchaus, meint er. Aber er sagt auch, dass das im Augenblick reine Spekulation sei.«
»Was will der Hubschrauber hier auf Saint-Nicolas?«
»Wir haben – Sie nicht erreicht.«
»Er ist meinetwegen hier?«
»Der – der Präfekt hat – angeordnet, dass er Sie zur Felsengruppe fliegt, um das persönlich in Augenschein zu nehmen.«
Offensichtlich war es Riwal sehr schwergefallen, das wiederzugeben. Am ersten Teil des Satzes hatte er eine gefühlte Minute herumgedruckst, durch den zweiten war er im Bruchteil einer Sekunde gerast.
»Hinfliegen? Angeordnet?«
Dupin spürte, wie er in Rage geriet, ganz gegen seinen Willen, denn es war sein fester Vorsatz, in allem, was den Präfekten betraf, ruhig zu bleiben und sich nicht provozieren zu lassen – und das, obgleich er sich nur an wenige Dinge, Sätze und Vorgänge im Zusammenhang mit dem Präfekten erinnerte, die nicht irgendeine Art von Provokation gewesen wären.
»Und warum sollte ich da hinfliegen?«
»Ich sollte Ihnen nur ausrichten, was er gesagt hat. Und er sprach wiederholt von ›Anordnung‹.«
Riwal war anzuhören, dass er sich am liebsten in Luft aufgelöst hätte.
»Hat er Sie direkt angerufen?«
»Ja, zwei Mal bereits in den letzten zehn Minuten, er hatte es bei Ihnen versucht, aber, wie gesagt, da war besetzt. Er hat auch gesagt«, Riwal klang nun restlos verzweifelt, »ich solle Sie unbedingt daran erinnern, die Anklopffunktion Ihres Telefons zu aktivieren, er habe Ihnen auch das bereits einige Male gesagt, er könne Sie nie erreichen, wenn es darauf ankomme. Er lande immer nur bei Nolwenn.«
»Anklopffunktion?«
Das war ein abstruses Gespräch.
»Das bedeutet, dass… «
»Ich werde nirgendwohin fliegen. Was sollte ich aus der Luft erkennen? – – – So ein Blödsinn. Die Kollegen werden das gewissenhaft inspizieren. Wichtiger ist, dass wir eines der Boote dorthin schicken.«
»Die Bir ist bereits unterwegs. Sie haben Tauchausrüstungen an Bord. Sollen wir Sie mit dem zweiten Boot abholen?«
»Ich bleibe hier.«
»Und der Präf…«