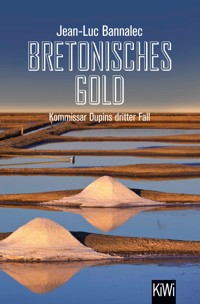10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Dupin ermittelt
- Sprache: Deutsch
Ein neuer rätselhafter Fall führt Kommissar Dupin auf die raue Île de Sein – mitten im Atlantik, wo mehr Kaninchen als Menschen leben und einst mächtige Hexen und der Teufel selbst hausten. Nie wieder wollte Kommissar Dupin auf dem Meer ermitteln. Doch in seinem fünften Fall verschlägt es ihn vor die äußerste Westküste der Bretagne. Auf der einzigartigen Île de Sein, nur zwei Tage vor dem 75. Geburtstag seiner Mutter, steht Dupin bis zu den Knöcheln in Fischabfällen. In der Auktionshalle von Douarnenez liegt die Leiche einer jungen Fischerin mit durchtrennter Kehle. Schnell stellt sich heraus: Die Tote stammte von der Île de Sein, kämpfte gegen die Zerstörung der Meere und mächtige Hochseepiraten. Noch am selben Morgen erreicht Dupin ein Hilferuf von der Insel: Eine zweite Leiche wurde entdeckt. Der Kommissar und sein Team ermitteln unter Hochdruck in der eingeschworenen Gemeinschaft der stolzen Menschen des Meeres. Haben die Spuren mit den alten Schmugglerrouten des Archipels zu tun? Gab es Beweise für illegale Aktivitäten im Parc Iroise, dem maritimen Naturschutzgebiet der Delphine und Wale? Und was steckt hinter dem Mythos der versunkenen Stadt, von dem die Insulaner erzählen? Vor beeindruckender Kulisse – zwischen den Inseln Molène, Ouessant und Sein – ermittelt Dupin in einem Fall, der ihm alles abverlangt und ihn an seine Grenzen bringt. Ein atmosphärischer Bretagne-Krimi voller Geheimnisse und überraschender Wendungen, der die raue Schönheit der bretonischen Küste und Inselwelt einfängt. Jean-Luc Bannalec verzaubert mit seinen Kriminalromanen um Kommissar Dupin aus der Bretagne: Mit pointiertem Humor und einem Talent für die regionale Atmosphäre entführt er Leser in die malerische Bretagne, in der man die salzige Brise des Atlantiks spüren kann. Die Krimi-Bestseller aus der Bretagne sind in folgender Reihenfolge erschienen: - Bretonische Verhältnisse - Bretonische Brandung - Bretonisches Gold - Bretonischer Stolz - Bretonische Flut - Bretonisches Leuchten - Bretonische Geheimnisse - Bretonisches Vermächtnis - Bretonische Spezialitäten - Bretonische Idylle - Bretonische Nächte - Bretonischer Ruhm - Bretonische Sehnsucht - Bretonische Versuchungen Die Bücher erzählen eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 586
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Jean-Luc Bannalec
Bretonische Flut
Kommissar Dupins fünfter Fall
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Jean-Luc Bannalec
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Jean-Luc Bannalec
Jean-Luc Bannalec ist der Künstlername von Jörg Bong. Er ist in Bonn und im südlichen Finistère zu Hause. Die Krimireihe mit Kommissar Dupin wurde für das Fernsehen verfilmt und in zahlreiche Sprachen übersetzt. 2016 wurde der Autor von der Region Bretagne mit dem Titel »Mécène de Bretagne« ausgezeichnet. Seit 2018 ist er Ehrenmitglied der Académie littéraire de Bretagne. Zuletzt erhielt er den Preis der Buchmesse HomBuch für die deutsch-französischen Beziehungen und die Ehrenbürgerschaft der Stadt Concarneau.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
»Etwas Entspannung gefällig?« FAZ
»Vor allem eines zählt in den Kommissar-Dupin-Romanen: die mythendurchwirkte, dramatisch akzentuierte Landschaft der Bretagne, die Bannalec fürwahr in glühenden Farben zu schildern weiß.« Hamburger Abendblatt
»ein Kurz-Urlaub im Kopf« Freie Presse
»eine Liebeserklärung an Land, Leute und Küche der Bretagne« Mannheimer Morgen
»Der Autor schildert das sturmgepeitschte Meer, den durchdringenden feinen Regen und die seltenen Sonnenstunden so anschaulich, dass man beim Umblättern der Seiten meint, ein wenig Salz in der Luft zu riechen.« Nordsee-Zeitung
»Ein Muss für alle Fans des sympathischen Kommissars und der wildromantischen Bretagne!« Neue Woche
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2016, 2018, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln
Covermotiv: © Getty Images/STICHELBAUT Benoit/hemis.fr
Kartografie: Birgit Schroeter, Köln
ISBN978-3-462-31596-7
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses Zusatzmaterial ist auch auf unserer Homepage zu finden:
https://www.kiwi-verlag.de/magazin/extras/die-karten-zu-bretonische-flut
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
Der erste Tag
Der zweite Tag
Epilog
Leseprobe »Bretonische Versuchungen«
à L.
à Zoé
Diaoul – pe vurzud?
Der Teufel – oder ein Wunder?
Bretonisches Sprichwort
Der erste Tag
»So ein Scheiß«, presste Commissaire Georges Dupin vom Commissariat de Police Concarneau halblaut hervor.
Der Gestank war bestialisch. Ihm war speiübel. Eine Benommenheit, eine Art Schwindel, hatte ihn überkommen. Er hatte sich mit dem Rücken an die Wand lehnen müssen, lange würde er es hier nicht aushalten. Er spürte, wie kalter Schweiß auf seine Stirn trat. Es war 5 Uhr 32, noch nicht Tag, aber auch nicht mehr Nacht, und empfindlich frisch. Am Himmel dämmerte es zaghaft. Dupin war um 4 Uhr 49 aus dem Bett geklingelt worden – da war es noch tiefe Nacht gewesen –, um kurz nach zwei erst hatten Claire und er das Amiral verlassen, wo ausgelassen gefeiert worden war: der Anbruch des längsten Tages, der 21. Juni, die Sommersonnenwende. Alban Hevin hieß das Fest bei den Kelten. Wurde die Bretagne ohnehin mit betörendem Licht bedacht, so steigerte es sich, auch wenn das kaum möglich schien, in diesen Tagen noch einmal auf magische Weise. Um halb elf erst ging die Sonne unter, und auch danach blieb für eine ganze Weile strahlendes Licht in der Atmosphäre, war der Horizont über dem Atlantik noch deutlich zu sehen, zugleich bereits die helleren Sterne. Beinahe bis Mitternacht hielt sich das »astronomische Dämmerlicht«, wie es genannt wurde, dann vereinten sich Meer und Himmel in völligem Dunkel. So viel Licht – es machte einen ganz trunken. Tage, die Dupin liebte. Eigentlich.
Der bis an die Decke gelblich gekachelte Raum war beengt, grelle Neonlampen leuchteten ihn kalt aus, die beiden winzigen Fenster, eher breitere Schlitze, waren gekippt, ließen aber nicht annähernd genügend frische Luft hinein. Sechs mannshohe dunkelgraue Container auf Rollen standen in zwei Dreierreihen.
Die junge Frau – Mitte dreißig, vermutete Dupin – hatte in dem Container vorne links gelegen; eine Reinigungskraft hatte sie entdeckt. Zwei Polizisten waren umgehend hergekommen, in die Fischauktionshalle am Hafen von Douarnenez. Zusammen mit der Spurensicherung aus Quimper, die früher als Dupin da gewesen war, hatten sie die Leiche aus dem Container geholt und auf den gekachelten Boden gelegt.
Es war selbst für Hartgesottene ein entsetzlicher Anblick. So etwas hatte Dupin während seiner gesamten Laufbahn noch nicht gesehen. Die Leiche war mit Fischabfällen übersät, Innereien, Mägen, Gedärmen, einem Gemisch aus allem halbwegs Flüssigen, das sich in der Tonne gesammelt hatte. Sogar ganze Fischstücke, Teile von Gräten und Fischschwänze klebten an der Frau. Am Kopf, an den Händen, dem – nur an ein paar Stellen noch in seiner Farbe zu erkennenden – hellblauen Pullover, der knallgelben Öllatzhose mit den schwarzen Hosenträgern, an den schwarzen Gummistiefeln. In ihren kurzen dunkelbraunen Haaren hatten sich ein paar kleine Fischköpfe verfangen, Sardinen. Auch das Gesicht war verklebt. Schimmernde Schuppen blitzten im Licht, eine große Schuppe lag, die Wirkung war besonders makaber, auf dem linken Auge, das rechte stand weit offen. Am Oberkörper hatte sich die schleimige Masse mit dem Blut der Frau vermischt. Mit sehr viel Blut. Am unteren Hals war eine vier bis fünf Zentimeter lange Wunde zu sehen.
»Mausetot«, der drahtige Gerichtsmediziner mit hellrosa Wangen, der eigentlich gar nicht nach einem Komiker ausgesehen hatte und dem der Gestank nicht im Geringsten etwas anzuhaben schien, zuckte mit den Schultern. »Was soll ich sagen? Die Todesursache ist allem Augenschein nach ebenso wenig ein Rätsel wie der Vitalzustand der Frau. Jemand hat ihr die Kehle durchgeschnitten, wahrscheinlich gestern zwischen zwanzig und vierundzwanzig Uhr, Details dieser Hypothese erspare ich Ihnen«, er blickte zu Dupin und dann zu den beiden Mitarbeitern der Spurensicherung. »Wenn Sie keine Einwände haben, bringen wir die junge Dame dann mal ins Labor. Und die Tonne gleich mit. Vielleicht finden wir ja noch etwas Interessantes.« Ein fröhlicher Tonfall. Eine neue Welle der Übelkeit erfasste Dupin.
»Von uns aus kein Problem. Wir sind fertig, die Arbeit der Spurensicherung ist vorläufig abgeschlossen.«
Der eigentlich zuständige Forensiker aus Quimper befand sich, zur Freude Dupins, im Urlaub, an seiner Stelle waren zwei seiner Gehilfen gekommen, beide mit dem gleichen grenzenlosen Selbstbewusstsein ausgestattet wie ihr Herr und Meister. Der Kleinere der beiden hatte das Reden übernommen: »Am Deckel der Tonne, da, wo man sie öffnet, haben wir eine ganze Reihe von Fingerabdrücken nehmen können, etwa zwanzig verschiedene, schätze ich, die meisten unvollständig und überlagert. – Mehr ist im Moment nicht zu sagen. Auch wir werden uns die Tonne«, ein kurzes Zögern, »noch einmal genauer von innen ansehen.«
Kadeg, einer der beiden Inspektoren Dupins, der restlos wach und aufgeräumt schien und übertrieben nahe an der Leiche stand, räusperte sich: »Ein paar mehr Informationen wären dennoch schön. Zum Beispiel zur Klinge«, er hatte sich an den Gerichtsmediziner gewandt und mimte den Experten. »Ich vermute, sie war relativ fein, der Schnitt mutet beinahe chirurgisch an.«
Der Gerichtsmediziner ließ sich nicht beeindrucken. »Wir werden uns die Wunde in aller Ruhe ansehen. Die Charakteristik des Schnittes hängt nicht nur von der Klinge ab, sondern maßgeblich von der Geschicklichkeit des Täters sowie von der Geschwindigkeit, mit der er den Schnitt gesetzt hat. Jemand, der sein Messer beherrscht, kann Ihnen mit fast jedem Messer fast jeden Schnitt setzen, auch in einer Kampfsituation. – Gut, eine Machete würde ich tendenziell ausschließen«, unzweifelhaft fand er sich wirklich lustig, »aber jede der, ich vermute, insgesamt hundert, zweihundert Klingen, welche die Fischer hier in der Halle zusammengenommen gerade mit sich tragen, käme infrage. Wobei unbedingt noch an die Dutzenden professionellen Messer zu denken wäre, die beim Ausnehmen und Präparieren der Fische zum Einsatz kommen.«
»Über die Frage, wer mit einem Messer umgehen kann«, fuhr der kleine Forensiker unverhohlen spöttisch fort, »werden Sie hier nicht weiterkommen. Alle, die am Meer leben, angeln, Muscheln suchen, ein Boot besitzen, einer Arbeit nachgehen – also fast jeder hier –, besitzt mindestens ein gutes Messer und kann damit umgehen.«
Kadeg schien eine weitere Entgegnung zu erwägen, ließ es dann aber und wechselte schnell das Thema: »Wie oft und wann werden die Tonnen geleert? Haben Sie das schon in Erfahrung bringen können? Es gibt doch sicher einen festen Rhythmus.«
Mit der Frage wandte er sich an den blutjungen Polizisten aus Douarnenez, der mit seinem Kollegen als Erstes eingetroffen war und der ganz bodenständig wirkte.
»Zweimal am Tag, das wissen wir bereits. Die Arbeiten der Fisch-Ausnehmer dauern manchmal bis in die Nacht, deswegen werden die Tonnen ganz früh am nächsten Morgen geleert, bevor die ersten Boote reinkommen, so um halb fünf. Und dann ein zweites Mal gegen fünfzehn Uhr. Die Reinigungskraft, die die Tonne leeren wollte, hat vollkommen aufgelöst einen Mitarbeiter der Halle herbeigerufen. Und der hat sich bei uns auf der Wache gemeldet. Anschließend hat er den Raum hier abgesperrt.«
»Ohne selbst einmal einen Blick in die Tonne zu werfen und zu schauen, ob er die Person kannte?«
»Man sah wohl bloß ein Bein.«
»Und ein Telefon?« Kadeg bohrte weiter. »Haben Sie ein Handy bei der Toten gefunden?«
»Nein.«
»Also«, der Gerichtsmediziner hatte es eilig, »dann packen wir die Leiche jetzt mal ein und… «
»Chef!« Riwal, der andere Inspektor Dupins, war im Türrahmen des – längst überfüllten – kleinen Raumes erschienen. Er hatte eine Frau im Schlepptau, die der toten Frau seltsam ähnlich sah, nur war sie wahrscheinlich um die fünfzig.
»Gaétane Gochat, die Chefin des Hafens und der Auktionshalle hier, sie ist gerade eingetroffen und… «
»Céline Kerkrom. Das ist Céline Kerkrom«, die Hafenchefin war abrupt stehen geblieben und starrte auf die Leiche. Es dauerte einen Moment, bis sie weitersprach.
»Eine unserer Küstenfischerinnen. Sie lebt auf der Île de Sein und kommt mit ihrem Fang meistens zu uns, um ihn hier zu verkaufen.«
Gaétane Gochat klang ganz und gar unaufgeregt, von Entsetzen, Schock oder Mitleid keine Spur, was hingegen, hatte Dupin gelernt, gar nichts besagte. Die Reaktion auf plötzliche brutale wie tragische Ereignisse fiel von Mensch zu Mensch äußerst unterschiedlich aus.
Bei seinem letzten großen Fall am Belon hatten sie Himmel und Hölle in Bewegung setzen müssen, um überhaupt zu wissen, wer da ermordet worden war – hier nahm es sich mit der Identifikation der Toten immerhin geradezu komfortabel aus.
»Ich brauche einen café«, brummte Dupin – sein zweiter Satz überhaupt, seitdem er eingetroffen war. »Wir haben einiges zu besprechen, Madame Gochat, kommen Sie mit. Sie auch, Riwal!« Er war nicht in der Verfassung, sich um den griesgrämigen Ton in seiner Stimme zu scheren.
Unvermittelt hatte er sich von der Wand gelöst, war an allen vorbeigelaufen und, ohne eine Reaktion abzuwarten oder die ratlosen, verblüfften Gesichter überhaupt wahrzunehmen, im nächsten Moment aus der Tür. Er brauchte Kaffee, und zwar auf der Stelle. Er musste die Benommenheit loswerden, die Übelkeit, den infernalischen Gestank und auch die Müdigkeit, die ihn alles wie durch einen diffusen Schleier sehen ließ, kurz: Er musste zu sich kommen, überhaupt erst in der Realität ankommen, und das schnell. Mit einem wachen, klaren, scharfen Verstand.
Zielstrebig manövrierte der Kommissar durch die große Halle, beim Hereinkommen hatte er dort einen Stand mit einem kleinen Tresen und großer Kaffeemaschine gesehen, ein paar verschrammte Stehtische davor. Riwal und Gaétane Gochat hatten Mühe, Schritt zu halten.
In der gekachelten schmucklosen Fischhalle nahm das alltägliche professionelle Leben ungeachtet der dramatischen Nachricht, die ohne Zweifel bereits die Runde gemacht hatte, seinen Lauf; es herrschte reges Treiben. Fischer und Fischhändler, Restaurantbesitzer und andere Käufer gingen ihren Geschäften nach. Hunderte flache Kunststoffboxen standen in der ganzen Halle verteilt auf dem nassen Betonboden. Grelle Farben: knallrot, neongrün, signalblau, leuchtend orange, nur wenige in Weiß oder Schwarz. Dupin kannte die Boxen aus Concarneau, sie waren ein fester Bestandteil aller Häfen und ein Hauptutensil des Auktionsgeschehens. In ihnen lag grob gestoßenes Eis und darauf alles, was den Fischern ins Netz gegangen war: Unmengen an Fischen und Meerestieren, in allen Größen, Farben, Formen und Unformen, alles, was sich eine reiche Fantasie an exotischen Meereskreaturen auszudenken vermochte. Riesige, archaisch anmutende Seeteufel mit weit aufgerissenen Mäulern, schillernde Makrelen, angriffslustige blaue Hummer, eng aneinandergeschmiegte grauschwarze Tintenfische, Massen an Langustinen, unterschiedliche Seezungenarten, Prachtexemplare mächtiger Wolfsbarsche (die Dupin liebte, vor allem als Carpaccio oder Tatar), überaus köstliche Rotbarben, gigantische Seespinnen, finster dreinschauende Riesenkrebse. Auch Fische und Krustentiere, deren Namen Dupin nicht kannte, und solche, die er noch nie gesehen hatte, zumindest nicht bewusst, nicht so, vielleicht zubereitet auf seinem Teller. Sein kulinarisches Interesse, musste er zugeben, überwog als guter Franzose bei Weitem das zoologische. In einer Box entdeckte er einen traurig verirrt aussehenden, gekrümmten Hai, in einer anderen daneben einen metergroßen, fast vollkommen runden, dabei ziemlich platten Fisch mit einer unproportional großen Rückenflosse, die der seines Nachbarn zum Verwechseln ähnlich sah. Ein Mondfisch, wenn Dupin sich richtig erinnerte, Riwal hatte ihm vor Kurzem erst einen in den Hallen von Concarneau gezeigt. Die Bretagne war ein Paradies, in vielerlei Hinsicht, natürlich insbesondere für Liebhaber von Fischen und Meeresfrüchten; nirgends waren sie besser, nirgends frischer. Das war der Grund, warum hinter beinahe jedem Fischgericht beinahe jedes französischen Sterne-Restaurants der Zusatz »breton« stand, »Sôle bretonne«, »Langoustines bretonnes«, »Saint-Pierre breton«, eine höhere Auszeichnung gab es nicht.
Im hinteren Teil der Halle fanden die Auktionen statt, dort war am meisten Betrieb. An den Seiten die halb offenen Räume, in denen ein Teil der Fische bereits präpariert wurde. Männer in weißen Hygieneanzügen mit Kapuzen, weißen Gummistiefeln und blauen Handschuhen hantierten an Arbeitsflächen aus Edelstahl mit großen, langen Messern.
»Zwei petits cafés«, Dupin hatte, obwohl er zwischen den Boxen hatte zickzack laufen müssen, den Stand zügig erreicht, die ältere Dame hinter dem Tresen warf ihm einen misstrauischen Blick zu, machte sich dann aber doch mit zwei Pappbechern an der Maschine zu schaffen.
Dupin wandte sich an die Hafenchefin, die neben Riwal stand.
»Sind Sie mit der Toten verwandt, Madame?«, es war Dupin durch den Kopf gegangen, weil sie sich so ähnlich sahen.
»In keiner Weise«, winkte Gaétane Gochat ab, sie schien die Frage des Öfteren zu hören.
»Haben Sie eine Ahnung, was hier passiert ist?«
»Nicht die geringste. Ist sie hier in der Auktionshalle umgebracht worden? Und wann? Wann ist der Mord geschehen?«
»Wahrscheinlich zwischen acht und Mitternacht gestern Abend. Ob sie hier umgebracht wurde, wissen wir noch nicht sicher. Bis wann waren Sie gestern Abend hier?«
»Ich?«
»Genau, Madame, Sie.«
»Ich denke, bis ungefähr 21 Uhr 30. Ich war in meinem Büro.«
»Wo liegt Ihr Büro, wenn ich fragen darf?«
Sie antwortete mit unbeweglicher Miene.
»Direkt neben der Auktionshalle. Da ist der Verwaltungskomplex des Hafens.«
Madame Gochat war eher der prosaische Typ, auf die zu regelnden Dinge konzentriert, schnell, rational. Eine Person mit großer Präsenz, etwas stämmig, kurze, braune Haare, braune Augen, kein verbissenes Gesicht, aber sachlich, kleine, ernste Fältchen um die Augen und den Mund. Sie würde, Dupin war sich sicher, resolut sein können, wenn es darauf ankäme. Sie trug Jeans, eine verfluste graue Fleecejacke, die obligatorischen Gummistiefel.
»Welche Fischer kommen hierher? Auch die großen Boote?«
»Morgens um fünf kommen die Hochseetrawler rein, die zwei Wochen auf See waren, nachmittags um vier die lokalen Boote, die zwei Tage auf See waren, und um siebzehn Uhr die Küstenfischer, die morgens um vier, fünf aufbrechen, die Sardinenfischer schon am Abend vorher. Sobald die Boote eingelaufen sind, gehen die Auktionen los. Gestern war viel Betrieb, die Feriensaison hat begonnen, ein paar der Küstenfischer waren noch hier, als ich gegangen bin.«
»Haben Sie Madame Kerkrom da gesehen?«
»Céline? Nein.«
Die ältere Dame hinter dem Tresen hatte die beiden cafés vor Dupin abgestellt. Die Miene, die sie dabei machte, war schwer zu deuten.
»Zu einem früheren Zeitpunkt?«
»Gegen neunzehn Uhr, denke ich, da habe ich sie einmal kurz gesehen. Sie kam gerade mit einer Box in die Halle.«
»Haben Sie mit ihr gesprochen?«
»Nein.«
»Und was haben Sie selbst zu dem Zeitpunkt in der Halle gemacht?«
In Madame Gochats Blick lag eine leichte Gereiztheit.
»Ich schaue gerne ab und an nach dem Rechten.«
Dupin trank den ersten café in einem einzigen großen Schluck. Ein echter café de bonne sœur, Nonnencafé, wie Bretonen schwächere Kaffees nannten. Torré, Stier, hießen die starken. Für die richtig schlechten, die ungenießbaren und ekligen, gab es eine Vielzahl von Ausdrücken, bretonisch drastischen Ausdrücken, pisse de bardot, was so viel hieß wie Pisse vom Maulesel, oder kafe sac’h, Wasser, durch eine alte Hose gepresst.
»Sie sagten eben, Céline Kerkrom kam mit ihrem Fang meistens hierher, was heißt das? Wie regelmäßig war das?«
»Fast jeden Tag, immer zu Beginn der Auktion. Sie hat sich auf Lieu jaune – Pollack –, Barsche und Doraden spezialisiert. Sie fischte meistens mit Leinen. Nur selten noch mit Stellnetzen, soweit ich weiß.«
»Gestern hat sie ihren Fang also hierhergebracht?«
»Ja.«
»Aber nicht jeden Tag?«
»Vielleicht an fünf, sechs Tagen im Monat nicht. Ab und an verkaufte sie direkt an ein paar Restaurants.« Dem Tonfall nach zu urteilen, war es Madame Gochat gar nicht recht.
»Der Täter konnte sich also einigermaßen darauf verlassen, dass sie hier war?«
Madame Gochat blickte einen kurzen Moment irritiert, fing sich aber umgehend wieder.
»Durchaus.«
»Hatte sie eine Mannschaft? Mitarbeiter?«
»Nein. Sie war alleine auf ihrem Boot. Viele Küstenfischer sind Ein-Mann- oder Ein-Frau-Betriebe. Ein hartes Brot.«
»Wir müssen wissen, wann sie gestern gekommen ist, wer sie als Letztes wann und wo gesehen hat. Mit wem sie gesprochen hat. Alles.«
»Klar«, meldete sich Riwal zu Wort.
»Wenn ich es richtig verstehe«, Dupin hatte sich wieder zur Hafenchefin gewandt, nestelte sein rotes Clairefontaine-Notizbuch aus der Hosentasche, seinen Bic aus der Jacke, »sind unter den Fischern, die sich heute Morgen hier aufhalten, wahrscheinlich keine, die gestern Abend da waren?«
»Ganz sicher nicht.«
»Wer genau hält sich außer den Fischern während der Auktionen hier auf?«
»Mindestens einer meiner Mitarbeiter, die Käufer – Fischhändler, Restaurantbesitzer –, die Arbeiter, die bereits einen Teil der Fische präparieren. Und zwei Leute vom Eis.«
Madame Gochat bemerkte Dupins fragenden Blick.
»Alle brauchen erhebliche Mengen Eis. Direkt neben der Halle befindet sich ein großes Eissilo. Das ist ein Service von uns, vom Hafen.«
»Wir brauchen so schnell wie möglich eine vollständige Liste aller Personen, die sich gestern Abend zwischen sechs und Mitternacht in der Halle und am Quai davor aufgehalten haben.«
»Meine Mitarbeiter werden sich darum kümmern.« Gochat schien daran gewöhnt, Anweisungen zu geben. »Die Leute, die in der Halle waren, kriegen wir irgendwie zusammen, aber herauszufinden, wer auf dem Quai war, wird schwierig. Dieser Teil des Hafens ist frei zugänglich. Der Quai ist sehr beliebt bei den Anglern, abends stehen dort immer größere Gruppen. Und auch Touristen schauen gern einmal vorbei, es gibt immer etwas zu sehen. Außerdem liegen da seit gestern Mittag drei spanische Hochseetrawler, jedes Boot mit mindestens acht Besatzungsmitgliedern.«
»Ich nehme an, dass die großen Schiebetüren zur Halle während der gesamten Betriebszeiten offen stehen?«
»Selbstverständlich.«
Das war ein sehr freier Eingang, sicherlich zehn Meter breit. Und einmal in der Halle, war es nicht weit bis zu dem kleinen Nebenraum, wo die Tote gefunden worden war.
»Ich will«, Dupin wiederholte den Auftrag mit deutlichem Nachdruck, »von jeder Person wissen, die sich hier aufgehalten hat. Von wann bis wann wer hier was gemacht hat. Und dann knöpfen wir uns jeden Einzelnen vor!«
»Wird gemacht, Chef«, erwiderte Riwal. »Die Kollegen aus Douarnenez haben übrigens bereits mit dem Mitarbeiter von Madame Gochat gesprochen, der gestern Abend hier war und die Halle abgeschlossen hat. Jean Serres. Um 23 Uhr 20. Die letzten Fischer sind kurz vorher gegangen. Er hat Céline Kerkrom einige Male im Laufe des Abends gesehen.«
Wie Kadeg machte auch Riwal einen wachen und zudem fast unpassend entspannten Eindruck, aber das war nach der Geburt seines Sohnes Maclou-Brioc vor vier Wochen durchgehend der Fall – trotz des Schlafmangels –, der väterliche Stolz ließ ihn unangreifbar wirken. »Er hat nichts Ungewöhnliches oder gar Verdächtiges bemerkt. Bisher hat sich auch niemand gemeldet, dem etwas aufgefallen ist.«
Es wäre auch zu schön gewesen.
»Um welche Uhrzeit hat dieser Jean Serres die Fischerin das letzte Mal gesehen?«
»Dazu haben die Kollegen nichts gesagt.«
Dupin trank den zweiten café. Wieder in einem Zug. Er schmeckte kein bisschen besser als der erste. Es war egal.
»Noch einen, bitte.« Im Augenblick ging es nicht um Geschmack, nur um die Wirkung. Die Dame vom Stand quittierte die Bestellung mit einem flüchtigen Blick.
»Madame Gochat«, Dupin wandte sich an die Hafenchefin, »ich möchte, dass Sie Ihren Mitarbeiter anrufen und fragen, wann er Céline Kerkrom gestern Abend das letzte Mal gesehen hat.«
»Sie meinen, ich soll ihn jetzt anrufen?«
»Jetzt.«
»Wie Sie wollen.«
Madame Gochat holte ihr Handy aus der Hosentasche und trat einen Schritt zur Seite.
»Jean Serres«, fuhr Riwal fort, »schätzt, dass es um einundzwanzig Uhr noch zehn bis fünfzehn Fischer waren, die sich in der Halle aufgehalten haben. Zudem fünf Leute zum Präparieren, vielleicht fünf Händler und zwei Männer vom Eis. Ab ungefähr einundzwanzig Uhr haben die ersten Sardinenküstenfischer abgelegt, vom Hafenbecken nebenan. Am Quai war wohl einiges los. Der Regen vom Nachmittag hatte gegen halb sechs schlagartig aufgehört und die Sonne war durchgebrochen. Das hat die Angler und Flaneure angelockt.«
In Concarneau gehörte Dupin selbst zu den Flaneuren, die immer wieder zur Auktionshalle schlenderten. Er mochte das muntere, bunte Treiben an den Hafenanlagen, das sich in seinen perfekt choreografierten Bahnen abspielte und sich jeden Tag verlässlich wiederholte. Es war immer etwas los.
Die ältere Dame vom Stand hatte den dritten Pappbecher vor Dupin auf den Tresen gestellt und sich anschließend um vier ältere Fischer in gelber Ölmontur gekümmert, die gerade eingetroffen waren.
»Ich möchte, dass Sie sämtliche Mitarbeiter der Halle besonders genau unter die Lupe nehmen, Riwal«, sagte Dupin laut.
»Mach ich, Chef.«
Dupin kippte auch den dritten petit café in einem Schluck herunter.
Die Hafenchefin trat wieder zu ihnen, das Telefon noch in der Hand: »Serres sagt, er habe Céline Kerkrom so gegen halb zehn abends das letzte Mal gesehen. In der Halle. Er glaubt, dass sie gegen sechs eingelaufen ist.«
»Ist ihm etwas Besonderes an ihr aufgefallen?«
»Nein. Sie sei ganz normal gewesen. Aber er hatte natürlich auch keinen Grund, genauer auf sie zu achten. Sie haben nicht miteinander gesprochen.«
»Ich will gleich selbst mit dem Mann sprechen. – Riwal, sagen Sie ihm, er soll sich sofort aufmachen.«
»Wird erledigt.«
Riwal verließ den Tresen und steuerte auf den Ausgang der Halle zu, wo eine kleine Gruppe von Polizisten stand.
»Wie lange gehen die Auktionen der Küstenfischer für gewöhnlich, Madame Gochat?«
»Das ist extrem unterschiedlich, es hängt von der Saison und dem Wetter ab. Im Dezember, wenn es auf die Feiertage zugeht, ist am meisten los, noch mehr als im Juni, Juli und August. Dann arbeiten wir hier bis nach Mitternacht, im Moment so bis elf, halb zwölf.«
»Und nach dem Ende der Auktionen? Was machen die Fischer da noch?«
Madame Gochat zuckte mit den Schultern. »Sie kehren zu den Booten zurück, bringen sie zu ihren Liegeplätzen. Manchmal hantieren sie auch noch herum, werkeln an ihren Booten, unterhalten sich am Quai oder trinken noch einen.«
»Hier?«
»Am Vieux Quai. Port de Rosmeur. Direkt nebenan.«
Zum ersten Mal an diesem Morgen hellten sich Dupins Züge auf. Er hätte fast lächeln müssen. Der Quai und das Viertel dahinter waren fabelhaft, er konnte Stunden auf der alten Mole mit ihren in Blau-, Rosa- und Gelbtönen gestrichenen Fischerhäusern verbringen, in einem der Cafés oder Bistros sitzen und einfach dem Leben zuschauen. Dem wirklichen Leben, wie man so sagte. Am liebsten im Café de la Rade, strahlend weiß und atlantisch blau gestrichen, einst eine Fischkonservenfabrik. Alles dort war unverstellt, nichts inszeniert. Man blickte auf den Hafen, auf die Bucht von Douarnenez, es war atemberaubend schön. Dupin mochte Douarnenez, besonders die wunderbaren alten Markthallen – man bekam dort unglaublichen Kaffee – und Port de Rosmeur, das mit Charme gealterte Hafenviertel aus dem 19. Jahrhundert, dem goldenen Zeitalter der Sardine. Wenn sie in Douarnenez eine Einsatzzentrale brauchen würden, wäre das Café de la Rade ohne Zweifel der richtige Ort. Der Kommissar, der dazu neigte, alles sofort zu ritualisieren, erkor in jedem seiner Fälle Bars, Cafés, Bistros, manchmal auch Plätze in der freien Natur zur »Einsatzzentrale«. Für Besprechungen, und, wenn es sein musste, auch für offizielle Verhöre. Dupins Abneigung gegen Diensträume jeder Art, vor allem seine eigenen, war berüchtigt. Er entfloh ihnen so oft wie irgend möglich. Er löste seine Fälle am Ort des Geschehens, nicht vom Schreibtisch aus, auch wenn es ihm der Präfekt immer wieder nahelegte. Dupin musste draußen sein, an der frischen Luft, unter Menschen. Die Dinge selbst sehen. Die Menschen selbst sprechen, sie in ihrer Welt erleben.
»Kannten Sie die Tote näher, Madame Gochat?«
»Nein. Wie gesagt, eine Küstenfischerin von der Île de Sein. Sie war mal verheiratet, ihr Exmann war, soviel ich weiß, einer der Techniker vom Leuchtturm der Insel.« Der Hafenchefin war auch jetzt, während sie über die Tote sprach, keine Gefühlsregung anzumerken.
»Wann war die Scheidung?«
»Ach, das ist schon viele Jahre her, bestimmt zehn. Auf den Inseln heiratet man jung. Und wenn es schiefgeht, ist man auch jung wieder alleine.«
»Was noch? Was können Sie noch über sie sagen?«
»Tja, sie war sechsunddreißig, eine der wenigen Frauen in diesem Geschäft. Sie war sehr geradeheraus und hat sich ab und an heftig mit einigen Leuten angelegt.«
»Sie war eine Kämpferin! Eine Rebellin!«, die ältere Dame vom Kaffeestand schoss hinter einem kleinen Waschbecken hervor, wo sie mit ein paar Gläsern beschäftigt gewesen war, sie schien in Rage.
Heftiges Missfallen stand Madame Gochat ins Gesicht geschrieben. Dupin beeilte sich nachzuhaken, er war neugierig geworden.
»Was meinen Sie, Madame… ?«
»Ich bin Yvette Batout, Monsieur le Commissaire«, jetzt hatte sie sich genau vor Dupin auf die andere Seite des Tresens gestellt. »Céline war die Einzige, die dem selbst ernannten Fischerkönig der Gegend die Stirn geboten hat. Charles Morin. Ein Krimineller mit einer großen Flotte, einem halben Dutzend Hochseetrawlern und noch mehr Küstenbooten. Bolincheurs vor allem und ein paar Chalutiers. Er hat eine Menge Dreck am Stecken, nicht nur in der Fischerei.«
»Es reicht, Yvette«, der Ton der Hafenchefin war schneidend.
»Lassen Sie Madame Batout doch ausreden.«
Madame Batout blinzelte Dupin kurz an. »Morin ist skrupellos, auch wenn er den Grandseigneur gibt. Er fischt mit gewaltigen Schlepp- und Treibnetzen, auch am Boden, verursacht Unmengen von Beifang, missachtet die Fangquoten – Céline hat ihn sogar ein paarmal innerhalb des Parc Iroise erwischt, mitten im Naturschutzgebiet. Auch wenn er alles abstreitet und seine Kritiker bedroht. Céline hat ihn mehrmals angezeigt, bei den Behörden, auch beim Parc. Sie hatte die nötige Courage. Erst letzte Woche wurden sechs tote Delfine an einem Strand von Ouessant gefunden, die in einem Treibnetz erdrückt worden waren.«
»Er hat Céline Kerkrom direkt gedroht?«
Dupin machte sich ausführliche Notizen. Ein rasantes Gekritzel, das an eine Geheimschrift erinnerte.
»Dass sie sich vorsehen solle, sie würde schon sehen, hat er gesagt, hier in der Halle, vor Zeugen, im Februar.«
»Er meinte ein juristisches Vorgehen wegen Verleumdung, doch keinen Mord, das ist ein Unterschied, Yvette.« Gaétane Gochats Entgegnung wirkte seltsam mechanisch, es war in keiner Weise zu erkennen, was sie dachte.
»Was genau ist hier im Februar geschehen?«
»Die beiden«, die Hafenchefin kam einer Antwort Madame Batouts zuvor, »sind sich hier zufällig begegnet, und es gab einen Streit. Mehr nicht. So was kommt vor.«
»Es war mehr als ein Streit, Gaétane, und das weißt du!« Madame Batouts Augen blitzten böse.
»Wie alt ist Monsieur Morin?«
»Ende fünfzig.«
»Was meinen Sie mit Dreck am Stecken, und das nicht nur in der Fischerei, Madame Batout?«
»Er hat bei einer ganzen Reihe krimineller Machenschaften seine Finger im Spiel. Auch beim Zigarettenschmuggel über den Kanal. Aber aus irgendeinem Grund kriegt man ihn nie zu fassen. Vor drei Jahren war ihm einmal ein Zollboot dicht auf den Fersen, sie hatten ihn fast erwischt, da hat er das Boot versenken lassen! Das einzige Beweisstück! Und man konnte ihm wieder nichts anhaben.«
»Du solltest aufpassen, was du sagst, Yvette.«
»Ist denn gegen Charles Morin schon einmal polizeilich ermittelt worden?«
»Noch nie«, antwortete die Hafenchefin entschieden, »es waren, ich sage es einmal so, immer äußerst vage Anschuldigungen. Gerüchte. Ich denke, bei so vielen illegalen Aktionen, die er begangen haben soll, wäre ihm die Polizei doch irgendwann einmal auf die Schliche gekommen.«
Dupin kannte leider nicht wenige Fälle, in denen es sich anders verhielt.
»Großartig«, murmelte er.
Das erste Gespräch, und sie hatten nicht nur ein heißes Thema, sondern gleich zwei. Illegale Fischerei und Zigarettenschmuggel.
Die Fischerei war ein gigantisches bretonisches Thema. Wer regelmäßig Ouest-France und Le Télégramme las – und das tat Dupin mit besonders strenger Regelmäßigkeit –, erfuhr jeden Tag Neuigkeiten von der Fischerei. Fast gleichauf mit der Landwirtschaft und noch vor dem Tourismus stellte sie den wichtigsten Wirtschaftszweig dar, ein stolzes bretonisches Symbol, beinahe die Hälfte des gesamten französischen Fischfangs kam aus der Bretagne. Ein altehrwürdiger Wirtschaftszweig, der sich in einer tiefen Krise befand. Gleich mehrere Faktoren machten der bretonischen Flotte zu schaffen: Überfischung, die Zerstörung der Meere durch die industrielle Großfischerei, die Erwärmung und Verschmutzung der Ozeane – ebenso mit erheblichen Auswirkungen auf die Fischbestände –, die Klimaveränderungen mit ihren Wetterkapriolen, die zu einer Zunahme der Fangausfälle führten, die brutale, nahezu gesetzlose internationale Konkurrenz, eine seit Langem dramatisch verfehlte Fischereipolitik, regional, national, international. Ein Gegenstand heftigster Auseinandersetzungen, erbitterter Querelen und Konflikte.
Und mit dem Tabakschmuggel lag ihm der Präfekt – sehr zum Leidwesen des Kommissars – bereits seit Jahren in den Ohren. Aber: Der Tabakschmuggel stellte tatsächlich ein ernstes Problem dar, so abenteuerlich es in hochmodernen Zeiten in Mitteleuropa auch klingen mochte. Ein Viertel aller in Frankreich gerauchten Zigaretten kam auf illegalen Wegen ins Land, der öffentliche Schaden belief sich mittlerweile jährlich auf eine Milliardensumme. Und seit der Verkauf über das Internet verboten worden war, hatte sich die Lage noch weiter verschärft.
»Vielen Dank, Madame Batout, das war äußerst hilfreich. Ich denke, wir werden uns eingehend mit diesem Monsieur Morin beschäftigen. – Wo wohnt er?«
»Bei Morgat, auf der Presqu’île de Crozon. Da besitzt er eine prächtige Villa. Er hat aber auch noch andere Häuser, eines hier in Douarnenez, in Tréboul. Immer an den schönsten Orten«, Madame Batout schaute weiterhin grimmig.
»Und war er gestern Abend auch hier?«
»Ich habe ihn nicht gesehen«, gab Madame Batout enttäuscht Auskunft.
»Er kommt sehr selten«, mischte sich die Hafenchefin ein, »aber es waren sicherlich einige seiner Fischer da. Er… «
»Madame Gochat!«, ein schmaler junger Mann in dickem blauem Filzpullover hatte sich genähert und ihren Blick gesucht. Sie hatte minimal genickt.
»Wir bräuchten Sie oben, Madame.«
»Etwas, das mit der toten Fischerin zu tun hat?« Dupin war schneller gewesen als Madame Gochat. Der Kaffee tat langsam seine Wirkung.
Der junge Mann blickte verunsichert.
»Antworten Sie dem Commissaire, wir haben nichts zu verbergen«, ermutigte ihn Madame Gochat.
Es war ein interessantes Schauspiel. Der junge Mann hatte sichtlich Angst vor ihr.
»Der Bürgermeister, am Telefon, es ist dringend, sagt er.«
»Er wird sich noch einen Augenblick gedulden müssen«, instruierte Dupin.
Gaétane Gochat schien zunächst etwas entgegnen zu wollen, ließ es dann aber.
»Noch einmal zu der Toten, Madame Gochat. Was können Sie mir noch erzählen? Ist sie mit noch jemandem aneinandergeraten?«
Die Hafenchefin gab dem jungen Mann ein Zeichen, er machte sich umgehend wieder davon.
»Sie«, Gochat zögerte kurz und schien die Worte abzuwägen, »sie hat sich für einen nachhaltigen, ökologisch verträglichen Fischfang eingesetzt. Sie war ab und zu an Projekten und Initiativen im Parc Iroise beteiligt.«
»Der Parc Iroise«, Madame Batout mischte sich wieder ein, sie hatte zwischendurch mit beeindruckender Geschwindigkeit ein paar andere Bestellungen erledigt, »ist ein einzigartiger maritimer Naturpark, wie es ihn kein zweites Mal gibt! Hier, vor der äußersten Westküste der Bretagne, zwischen der Île de Sein, Ouessant und dem Kanal. Unser Parc weist die größte maritime Biodiversität Europas auf«, aus der beharrlichen Dame sprach ungezügelter Stolz, Dupin glaubte beinahe, Riwal zu hören. »Mehr als hundertzwanzig Fischarten sind hier zu Hause! Zudem beherbergt er mehrere Robben- und Delfinkolonien. Und das größte Algenfeld Europas! Mit über achthundert verzeichneten Arten, das siebtgrößte der ganzen Welt. Und erst… «
»Bei dem Parc handelt es sich«, die Hafenchefin fiel Madame Batout ins Wort, »um ein großes Pilotprojekt. Neben der wissenschaftlichen Forschung geht es vor allem um das Modell eines funktionierenden Gleichgewichts zwischen der Nutzung des Meeres durch den Menschen – Fischerei, Algenproduktion, Freizeit, Tourismus – und einer intakten Ökologie, dem Schutz des Meeres.«
Nolwenn und Riwal hatten schon viele Male von dem – zweifelsohne außerordentlichen – Vorhaben erzählt, aber ehrlich gesagt wusste Dupin nur sehr wenig darüber. Und im Augenblick ging es um anderes.
»Ich meine: Hatte Céline Kerkrom in letzter Zeit irgendwelche weiteren Auseinandersetzungen?«
»O ja. Nicht nur mit Morin.«
Gochat warf Madame Batout einen warnenden Blick zu und übernahm: »Auf der Insel hat Céline Kerkrom eine Initiative für alternative Energiegewinnung ins Leben gerufen, gegen das Öl, das dort zur Produktion von Strom und zur Aufbereitung des Salzwassers eingesetzt wird. Sie hat die ganze Insel agitiert. Sie wollte mehrere kleinere Gezeiten-Kraftwerke bauen lassen, irgend so ein Röhrensystem.«
»Und das erbost Sie?«
Gochat hatte bei ihren letzten Sätzen gar nicht mehr neutral geklungen.
»Ich meine nur, dass sie sich ganz sicher Feinde gemacht hat.«
»Wen speziell?«
»Thomas Roiyou zum Beispiel. Ihm gehört das Ölboot, mit dem die Insel versorgt wird.«
Dupin schrieb alles mit.
»Und sie sind direkt aneinandergeraten?«
»Ja. Céline Kerkrom hat im März ein ›Manifest‹ ihrer Inselbewegung formuliert und überall verteilt, Ouest-France und Le Télégramme haben darüber berichtet. Roiyou hat sich dann öffentlich in einem Interview dazu geäußert.«
»Céline hatte doch vollkommen recht!«, Madame Batout konnte nicht an sich halten.
Der Unmut in Gochats Gesicht steigerte sich immer weiter.
»Habe ich notiert. Wir werden sicherlich auch mit diesem Monsieur ein Gespräch führen. Wissen Sie«, Dupin richtete sich demonstrativ an beide Damen, »ob Céline Kerkrom Familie hatte? Oder ob sie Freunde unter den Fischern hatte?«
»Das kann ich Ihnen nicht sagen«, Gochat wirkte tatsächlich ratlos. »Sie schien mir eine Einzelgängerin, aber ich kann mich täuschen. Da müssen Sie mit jemandem sprechen, der sie besser kannte. Fragen Sie die Menschen auf der Insel. Da kennt jeder jeden.«
»Haben Sie«, Dupin wandte sich Madame Batout zu, »eine konkrete Idee, was hier vorgefallen sein könnte?«
»Nein.«
Eine überraschend kurze Antwort, dafür, dass sie vorher so engagiert war.
Es entstand eine kleine Pause.
»Aber Sie müssen den Täter zur Strecke bringen!«
Dupin lächelte.
»Das werden wir, Madame Batout. Das werden wir. Haben Sie keine Sorge.«
»Also dann. – Ich muss Milch holen. Hinten im Lager«, Madame Batout, die sehr zufrieden mit sich wirkte, entfernte sich mit diesen Worten.
»Werden Sie«, Gochat war anzumerken, dass sie etwas beschäftigte, »werden Sie die Halle jetzt schließen müssen?«
Das Ja lag Dupin schon auf der Zunge – er war berüchtigt dafür, jeden Tatort großräumig und lange absperren zu lassen.
»Nein. Erst einmal nur den kleinen Raum mit den Abfalltonnen.«
Es wäre in diesem Fall klug, das Leben und den Betrieb hier seinen gewohnten Gang gehen zu lassen.
»Eine letzte Frage, Madame Gochat. Wie geht es dem Hafen wirtschaftlich? Sie werden es sicherlich schwer haben. Wie alle anderen Häfen.«
»Wir haben zu kämpfen, ja. Und das tun wir: Wir kämpfen. Wir liegen bei der Fangmenge seit ein paar Jahren auf Platz sechzehn aller französischen Häfen. Mit viertausendfünfhundert Tonnen Fisch jährlich. Die Sardinen machen dabei immer noch den Großteil aus, sie sind unsere traditionelle Stärke.«
Das Thema schien sie keinesfalls zu verunsichern.
»Die Anzahl der registrierten Boote geht aber sicher auch hier zurück?«
Zumindest war das in Concarneau ein stetiges Thema. So wie in der ganzen Bretagne.
»Seit einigen Jahren haben wir eine einigermaßen konstante Situation. Bei uns sind zweiundzwanzig Boote registriert, davon achtzehn Küstenfischer.«
»Und der Anteil des Fanges, der bei Ihnen auktioniert wird, bleibt der auch konstant?«
Dupin hatte ein leichtes Flackern in Gochats Augen bemerkt. Riwal wäre stolz gewesen auf seine Sachkundigkeit. Auch dieses Thema wurde im Kommissariat leidenschaftlich diskutiert: Internationale Unternehmen, spanische zum Beispiel, nutzten zwar die bretonischen Häfen, aber nur noch zum Ausladen, der Fang wurde direkt am Quai in riesengroße Gefrierfahrzeuge verfrachtet.
Es dauerte einen Moment, ehe sie antwortete:
»Nein, aber dafür steigen die Gebühren für die Benutzung des Hafens«, zum ersten Mal war ein leicht bissiger Unterton zu hören. »Unser Hafen liegt sehr privilegiert. Er bietet selbst bei schwerer See ruhiges Wasser, in jeder Hinsicht perfekte Bedingungen. – Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen der ökonomischen Situation des Hafens und dem Mord?«
Sie blickte herausfordernd. Trotzig.
Dupin überging die Frage.
»Das war’s fürs Erste, Madame Gochat. Wir werden uns sicher häufiger sprechen.« Dupin hatte nichts dagegen, dass sein Satz den Beiklang einer Drohung besaß.
Die Hafenchefin hatte sich wieder ganz im Griff:
»Ich bin den ganzen Tag über hier. – Auf Wiedersehen, Monsieur le Commissaire.«
Sie hatte sich schon abgewandt, als Dupin – der am Tresen stehen geblieben war – ihr hinterherrief:
»Nachdem Sie um 21 Uhr 30 Ihr Büro verlassen haben, wo sind Sie da hin?«
Er verzichtete darauf, eine Floskel wie »Reine Routine« oder »Diese Frage stellen wir jedem« hinzuzufügen.
Sie kam ein paar Schritte zurück. »Direkt nach Hause, unter die Dusche und dann ins Bett.«
Auch das erneute Nachhaken hatte sie nicht aus dem Konzept gebracht.
»Wie weit ist es von hier bis zu Ihnen nach Hause?«
»Eine Viertelstunde mit dem Wagen.«
»Dann waren Sie noch vor 22 Uhr 30 im Bett?«
»Ja.«
»Und dafür gibt es Zeugen?«
»Mein Mann ist auf einer Dienstreise, er kommt heute Abend wieder.«
»Haben Sie noch vom Festnetz telefoniert?«
»Nein.«
»Das war – höchst aufschlussreich, noch einmal vielen Dank.« Dupin hatte sich mit diesen Worten entschlossen in Bewegung gesetzt.
Richtung Ausgang, es waren nur ein paar Schritte.
Er würde sich draußen ein wenig umschauen. Bis der Mitarbeiter von Madame Gochat einträfe, den er sprechen wollte.
Das »Sichumschauen«, eine spezielle Art des ziellosen Umherlaufens, gehörte zu Dupins Lieblingsdisziplinen. Nicht selten entdeckte er auf diese Weise Details, die zunächst ohne Bedeutung schienen und dann plötzlich doch von großer Wichtigkeit waren. Nicht wenige Fälle hatte er nur aufgrund einer dieser unscheinbaren Kleinigkeiten, auf die er beim Herumstöbern zufällig gestoßen war, gelöst.
Dupin stand auf dem Quai. Mittlerweile war es hell.
Er hatte sich eine ganze Weile umgesehen, war besonders ziellos umhergelaufen, hatte sich dies und jenes besonders genau angeschaut – ohne dass irgendetwas von Bedeutung gewesen wäre.
Er betrachtete die Auktionshalle. Ein weiß gestrichener Bau, lang und flach, schlicht, wie alle anderen Gebäude hier am Hafen. Nahe am Eingang zwei Gabelstapler, quer auf dem Quai, so als hätten die Fahrer sie aus irgendeinem Grund übereilt aufgegeben.
Überall herrschte routinierte Geschäftigkeit, die Menschen gingen ihren gewohnten Tätigkeiten nach. Es war, wie die Hafenleiterin gesagt hatte: Die Auktionshalle lag mittendrin, jeder konnte, ohne aufzufallen, hier umherlaufen. Hinter und zwischen den verschiedenen Gebäuden verliefen auf grasig-erdigem Boden schmale Trampelpfade. Dupin sah sogar zwei kantige Campingwagen mit Klappstühlen davor.
Die immer noch merklich frische Luft tat gut, schärfte die Sinne und den Verstand, hinzu kam das Koffein der drei cafés.
Dupin war, wie er es immer tat – ein Tick –, bis zum äußersten Rand der Mole getreten, die Schuhspitzen standen fast über, eine unvorsichtige Bewegung, und er würde fallen, was schon jetzt, bei ablaufendem Wasser, einen Sturz von drei, vier Metern bedeutete.
Vor ihm lag die weite Bucht von Douarnenez, die sich von den langen normannisch anmutenden Stränden am Ende der Bucht bis zum Cap Sizun im Südwesten und der Halbinsel von Crozon im Norden erstreckte, weit Richtung offener Atlantik. Eine riesengroße natürliche Bucht.
Das Panorama war berückend. Dupin verstand, warum alle Welt sagte, es sei die schönste Bucht Frankreichs. Eine der schönsten Europas.
Das tiefblaue glatte Wasser, die helle Betonmole, die den Hafen umschloss, und dahinter wieder das Meer, das dort noch blauer aussah. Postkartenblau. Heiter. Auf ihm schon jetzt leichthändig dahingleitende Segelboote, im Laufe des Vormittages würden es mehr und mehr werden. Ferienstimmung. Oberhalb des breiten Meeresstreifens zarte grüne Landschaften mit flachen, sanft geschwungenen Hügeln. Die Presqu’île de Crozon. Darüber zuletzt das endlose klare Hellblau des Himmels, verziert von einzelnen makellos weißen Wattewolken. Es war Sommer, mit jeder Stunde würden die Temperaturen nun klettern. Ein traumhafter Tag stand ihnen bevor. Der sich nicht kümmerte um die Tragödie, die sich hier gerade abspielte.
Rechts lag der Vieux Port, auch er von einer langen Mole geschützt. Links von der Halle knickte der Quai nach zwei-, dreihundert Metern in einem rechten Winkel ab und lief auf die vorgelagerte Hafenmole zu. Dicke Autoreifen hingen als Poller für die Boote an Seilen herab. Einige Angler versuchten in diesen frühen Stunden bereits ihr Glück. Drei hübsche Fischerboote, mehrfach vertäut, sie trugen die Namen Vag-A-Lamm, Ar Raok und Barr Au. So hatten die Fischerboote in Filmen ausgesehen, die Dupin als Kind gesehen hatte, so hatten sie die Maler in Pont-Aven gemalt. Aus Holz, das eine in hellem Türkis, kräftigem Gelb und unten ein Paprikarot, das andere die obere Hälfte knallrot und die untere atlantikblau, das dritte in verschiedenen Grüntönen, vom Dunklen ins Helle, und an der Wasserlinie grellweiß. Nichts war beliebig bei der Farbwahl. Jeder Fischer, jedes Unternehmen wählte die Farben und Kombinationen selbst, wusste Dupin, eine richtiggehende Signatur, möglichst auffällig, markant, so waren sie auf See schon von Weitem zu identifizieren.
Dupin betrachtete die technischen Anlagen für die Hochseetrawler dahinter: Boote ganz anderer Dimension, vierzig, fünfzig Meter lang, hoch gebaut. Dieser Teil des Hafens, die Anlagen, die Hallen, besaßen nichts vom Charme und Flair des Vieux Port. Alles war funktionell, technisch, aus Beton, Stahl, Aluminium, ewig kämpfend gegen den allgegenwärtigen Rost, das Meer, die Zeit. Es ging, man sah es überall, um harte Arbeit. In dieser Welt zählte nur äußerste Professionalität, jeder Fehler konnte tödlich sein. Können, Wissen, Erfahrung, das war die Währung, wenn man mit dem Meer rang. Standhaftigkeit. Tollkühnheit. Dupin bewunderte das. Schon als kleiner Junge hatte er Häfen geliebt, überhaupt die See und ihre Geschichten. Er war wie besessen gewesen, er hatte alle Meeresgeschichten gelesen, die er in die Finger bekommen konnte. Vor allem war das Meer Gegenstand eines unendlichen eigenen Fabulierens geworden, trotz seiner schon damals bestehenden heftigen Abneigung gegen Bootsfahrten jeder Art. Wahrscheinlich verhielt es sich sogar so, dass seine Fantasie die Abneigung erst hervorgebracht hatte. Die Unzahl an Unwesen, scheußlichen Monsterkreaturen, die er sich ausgemalt hatte und die, wie bei Jules Verne, im Dunkel der Tiefe lauerten. Riesenkraken, Seeschlangen, unförmige, schlingende Scheusale. Die Welt ganz unten war so lichtlos schwarz wie die Welt ganz oben, das All. Das fürchterlich Unbekannte. Das fürchterlich Wunderbare.
Dupin ging in Richtung der Angler. Eine einzige Straße führte in die Hafenzone hinein, Dupin hatte seinen Wagen weiter oben stehen lassen, unweit von Chancerelle/Connétable, der ersten Fischkonservenfabrik der Welt. 1853, Riwal betete es gern herunter, war sie in Betrieb gegangen. Napoleon selbst war es gewesen, der die französische Industrie angewiesen hatte, eine Methode zur Haltbarmachung von frischen Lebensmitteln für seine Feldzüge zu entwickeln. So war die Konservendose erfunden worden und hatte Douarnenez und andere bretonische Gegenden sehr reich gemacht. Um genau zu sein, war es die Sardine gewesen, die alle reich gemacht hatte. Dupin war verrückt nach den roten Dosen mit Sardinen, Makrelen und anderen Fischen, vor allem nach den unfasslich zarten Thunfischfilets. Über tausend Fischerboote mit ihren berühmten dunklen Segeln hatten zu Hochzeiten der Sardine, Ende des 19. Jahrhunderts, in und um den Port de Rosmeur gelegen, ganze fünfzig »Fritures«, Konservenfabriken, hatte es damals gegeben. Dupin hatte von Nolwenn einen Band mit frühen Fotografien aus der Bretagne geschenkt bekommen. Da war es zu sehen: ein quirliges Treiben, ein buntes Gewimmel – und nur zu erahnen: der penetrante Geruch frittierten Fisches, der überall in der Luft gelegen haben musste. Penn Sardin, Sardinenköpfe, hatten sich die Bewohner der Stadt stolz genannt.
»Chef! Chef!« Riwal kam dem Kommissar entgegengelaufen. »Ich habe Sie gesucht. Ich… «, er blieb vor Dupin stehen, »Jean Serres, der Mitarbeiter der Hafenchefin, müsste in ein paar Minuten da sein, es hat länger gedauert, er musste das Fahrrad nehmen, weil sein Wagen nicht ansprang, und er wohnt ein gutes Stück außerhalb«, er holte mit dem Arm weit aus, aber es blieb unklar, welche Richtung er meinte. »Die Kollegen haben auch schon mit drei Fischern gesprochen, die gestern Abend da waren. Einer erinnert sich, Céline Kerkrom noch um kurz vor zehn gesehen zu haben. Da war sie alleine und stand in der Nähe des Eingangs, sagt er. Die drei haben uns bereits sämtliche andere Fischer nennen können, die gestern Abend da gewesen sind. Und ein paar der Käufer. – Ich denke, wir werden unsere Liste ohne Probleme bekommen. Bisher hat niemand etwas Besonderes zu berichten gehabt.«
»Bringen Sie so viel wie möglich zu diesem«, Dupin holte sein Notizheft heraus und warf einen Blick auf die erste Seite, »Fischerkönig Charles Morin in Erfahrung. Ich will vor allem wissen, was die Polizei von ihm denkt. Ob sie ihn für einen Kriminellen hält. Den sie bisher nur noch nicht drangekriegt haben.«
»Wird erledigt, Chef. – Übrigens sind die Presseleute eben erschienen, die beiden von Ouest-France und Le Télégramme, sie stehen bei Madame Batout am Kaffeestand.«
»Sagen Sie, dass wir noch völlig im Dunkeln tappen. Die Wahrheit also.«
»Mache ich.«
Dupin hatte sich wieder ganz nah an die Kante der Mole gestellt, sein Blick glitt über die weite Bucht.
Riwal tat es ihm gleich. Passanten würden sie für zwei entspannte Ausflügler halten.
»Sie wissen ja«, eine rhetorische Formel seines Inspektors, wenn er mit dem Erzählen begann, »hier auf dem Grund der Bucht von Douarnenez soll Ys liegen. Das mythische Ys, die prächtige, unermesslich reiche Stadt mit ihren roten Mauern, in der sogar die Dächer aus purem Gold waren. Die eines Tages im Meer versunken ist. Wo der berühmte König Gradlon herrschte, dem seine Frau eine wunderhübsche Tochter gebar, Dahut. Es gibt zahlreiche Berichte und Erzählungen. Diese urbretonische«, selbstverständlich lag Riwals Betonung darauf, »Geschichte ist ohne Zweifel die bekannteste aller französischen Sagen vom Meer.«
Natürlich. Dupin kannte die Geschichte nur zu gut. Tatsächlich kannte sie jedes Kind in ganz Frankreich.
»Im nächsten Jahr wird eine lang geplante, aufwendige wissenschaftliche Expedition den Grund der Bucht untersuchen. Man hat festgestellt, dass er mehrere Meter mit Sand und Schlamm bedeckt ist, sie werden von den großen Sturmfluten in die Bucht befördert. 1923, bei einer der Jahrhundertebben nach einer vollkommenen Sonnenfinsternis, haben mehrere Fischer von Ruinen berichtet, die sie mitten in der Bucht gesehen haben.«
Es waren auch schon zahlreiche Atlantis-Expeditionen unternommen worden, lag Dupin auf der Zunge.
»Und da vorne«, Riwal machte eine vage Bewegung mit dem Kopf, »direkt vor dem westlichen Rand von Douarnenez, liegt die Île Tristan mit ihrer überreichen Fauna und ihren mysteriösen Ruinen. Sie soll, so eine Fassung der Sage, der letzte existierende Teil von Ys sein. Und nicht nur das«, er sprach nun geradezu ehrfürchtig, »sie ist selbst ein Ort vieler sagenhafter, wilder, schauriger, blutiger, aber auch wundervoller Geschichten und Legenden. Sogar der größten und tragischsten Liebesgeschichte, die die Menschheit kennt: der von Tristan und Isolde. Die beide sterben mussten. Eine bretonische Geschichte«, auch hier zelebrierte Riwal die Betonung, »eine Geschichte der Cornouaille, des berühmten mittelalterlichen Königreiches, das von der Pointe du Raz bis nach Brest und Quimperlé reichte und«, der Ton wurde immer feierlicher, »die zu einem der bedeutendsten Stoffe der abendländischen Literatur zählt. Bis heute wird die Geschichte erzählt. Immer neu. Bereits 1170 wurde sie das erste Mal festgehalten. Und schon dort steht, dass Tristan aus der Gegend von Douarnenez stammt, der Hauptstadt der Cornouaille. Quimper«, ein abschätziger Blick, »wurde es erst viel später. Davor«, ein Aufleuchten der Augen, »war es Ys. – Auch Isolde ist Bretonin. In einer der unzähligen Versionen der Geschichte will sich Tristan aus Verzweiflung über den Tod seiner Geliebten von hohen Klippen ins Meer stürzen. Dabei wird er von einer Böe erfasst und sanft auf der kleinen Insel abgesetzt. Aber auch dort starb er dann schnell an seinem unendlichen Kummer. Wie auch immer, dort befindet sich ihr Grab. Dort liegen sie, die beiden Liebenden, für alle Zeiten unter zwei Bäumen, deren Äste einander umschlingen«, Riwal seufzte ergriffen, »irgendwo im Nordwesten der Insel, niemand weiß, wo, nur der König, der sie dort begraben ließ. Die Überreste seiner Burg finden Sie bei Plomarc’h an der Plage du Ris… «
»Riwal«, Dupin wurde ungeduldig, sosehr er die Meereslegenden auch liebte, »wir müssen wissen, mit wem Céline Kerkrom den engsten persönlichen Kontakt hatte. Ihr Haus durchsuchen. Gespräche mit Freunden und Nachbarn auf der Île de Sein führen. Überhaupt mit den Inselbewohnern. – Sie fahren, so rasch es geht, auf die Insel.«
»Kein Problem, Chef.« Riwal liebte Boote.
»Finden Sie heraus, wer am meisten über sie weiß. Und dann bringen Sie die Personen mit aufs Festland.«
Dupin wollte, wenn es irgend ging, vermeiden, selbst auf die Insel fahren zu müssen.
»Wird gemacht«, Riwal schien es nicht erwarten zu können.
»Ich habe übrigens einen Cousin hier in Douarnenez.«
Dupin unterdrückte die Nachfrage. Was nichts änderte.
»Er ist der Präsident der Association du véritable Kouign Amann, der Vereinigung des wahren Kouign Amann.«
Der bretonische Butterkuchen – Dupin lief unfreiwillig das Wasser im Mund zusammen. Bretonische Butter, ein Elixier, sehr viel davon, ein bisschen Mehl, noch weniger Wasser, dafür umso mehr Zucker, das waren die simplen Bestandteile, die hohe Kunst aber bestand darin, sie durch Karamellisieren in eine ambrosiaartige Köstlichkeit zu verwandeln.
»Mitte des 14. Jahrhunderts«, Riwal sprach mit einem kurzen Seitenblick zu Dupin, so schnell er konnte, »musste ein Bäcker hier in Douarnenez Kuchen für ein großes Fest backen, in der Nacht aber waren ihm die meisten seiner Zutaten gestohlen worden, nur Butter, Mehl und Zucker waren ihm geblieben – da erfand er den Kouign Amann. Mein Cousin hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Originalrezept zu verteidigen. Man kann es nicht verbessern!«
»Ich muss dringend telefonieren, Riwal. Und Sie sollten sich aufmachen, Kadeg wird alles hier übernehmen.«
Übergangslos war der Inspektor wieder ganz bei der Sache: »Ich werde mir ein Boot kommen lassen. Apropos Boot: Kadeg inspiziert gerade mit Kollegen das Boot der Fischerin.«
Das war wichtig.
»Und?«
»Wir geben sofort Bescheid, wenn sie fertig sind, Chef. Dann bis gleich.«
Riwal lief zur Halle zurück.
Dupin blieb an der Mole stehen.
Er zog sein Handy aus der Jackentasche hervor. Ein wichtiges Ritual stand aus: das erste Telefonat in einem neuen Fall mit Nolwenn, seiner unersetzlichen Assistentin. Und auch Claire würde er anrufen müssen, er war vorhin einfach verschwunden, hatte nur eine kurze Nachricht auf dem Tisch hinterlassen. Eigentlich hatten sie vorgehabt, auszuschlafen, im Amiral gemütlich zu frühstücken und auch noch gemeinsam zu Mittag zu essen. Dupin hatte erst am Nachmittag im Kommissariat auftauchen wollen. In den letzten Monaten hatten sie nicht allzu viel Zeit miteinander verbracht, Claire und er. Ganz anders, als er es sich gedacht – und gewünscht – hatte, nachdem Claire im letzten Jahr in die Bretagne gezogen war und in Quimper den Posten als Chefin der kardiologischen Abteilung angenommen hatte. Das Traurige war: Heute hatte Claire bis zum Nachmittag frei – äußerst kostbare Stunden also, die sie miteinander hätten verbringen können –, dann musste sie nach Rennes, zu einem Ärztetreffen, und würde auch über Nacht bleiben. Damals in Paris, während ihrer »ersten Beziehung«, hatte es fast ausnahmslos an Dupin gelegen, dass sie sich selten sahen, jetzt war es andersherum. Häufig fuhr Dupin noch spätnachts nach Quimper, um sie von der Klinik abzuholen. Dann saßen sie auf Claires kleinem Balkon, tranken Rotwein und aßen Käse, den Dupin in den Hallen von Concarneau besorgt hatte. Claire war meistens so müde, dass sie einfach schweigend beieinandersaßen und auf die schwach beleuchteten alten Gässchen blickten. Ausflüge, wie früher, als Claire an ihren freien Tagen aus Paris in die Bretagne gekommen war, unternahmen sie nur noch selten; Dupin vermisste es.
Er hatte es eben im Auto schon bei Nolwenn versucht, da war besetzt gewesen. Wie immer würde sie bereits im Bilde sein, bestens informiert; Dupin hatte das Rekonstruieren, wie sie über wen wann welche Information erhielt, schon vor langer Zeit aufgegeben und längst telepathische Techniken in Erwägung gezogen. Gewöhnliche druidische Fähigkeiten also.
»Diese Frau ist eine Rebellin, Monsieur le Commissaire, ich kenne sie über eine Tante meines Mannes, deren Freundin. Kerkrom ist ihre Nichte«, Dupin hätte es sich denken können – auch wenn sich ihm diese verwandtschaftliche Verbindung nicht vollends erschloss. Nolwenn stellte sich – eine urbretonische Leidenschaft und ein genetisch verankerter, wunderbar anarchistischer Reflex – prinzipiell auf die Seite des Widerstands. Sie kannte alle, die sich gegen Ungerechtigkeiten, Willkür und schlechte Herrschaft auflehnten.
»Sie kannten sie persönlich?«
»So gut wie. Ich werde versuchen, etwas in Erfahrung zu bringen.«
»Unbedingt.«
Besser konnte es nicht sein. Nolwenn nahm sich der Sache an.
»Es geht hier um viel mehr als nur das traurige Ende dieser fabelhaften Frau«, Nolwenn war außer sich. »Es soll Sie nicht weiter unter Druck setzen, aber das muss Ihnen sehr bewusst sein. – Und wissen Sie, welch immensen Mut es braucht, sich bei tosender See, meterhohen Wellen, peitschendem Sturm und in völliger Dunkelheit alleine dem Meer zu überlassen? Das tägliche Brot einer Fischerin. Eines Fischers.«
Für Dupin sowieso ein Albtraum.
»Es sind Helden! Es ist ein großer Beruf! Ein Mythos, ganz zu Recht.«
Dupin hatte nicht vor, zu widersprechen.
»Jean-Pierre Abraham«, Nolwenns Lieblingsschriftsteller, der viele Jahre Leuchtturmwärter gewesen war und später auf den Glénan-Inseln gelebt hatte, Dupin verehrte ihn nicht minder, »hat einmal geschrieben: ›Auf das Meer zu fahren heißt jedes Mal aufs Neue, die Welt der Lebenden zu verlassen. Ohne Gewähr, in sie zurückzukehren.‹ Dagegen ist die Arbeit eines Kommissars der reine Müßiggang!«
Dupin nahm es nicht persönlich.
Nolwenn ließ eine kurze Pause entstehen.
»Sie müssen diesem mafiösen Morin auf den Zahn fühlen, ihm ist alles zuzutrauen!«
»Das werden wir, Nolwenn, das werden wir.«
»Céline wird sich ohne Zweifel eine Reihe von Feinden gemacht haben.«
»Riwal wird auf die Insel fahren.«
»Sehr gut. Er weiß, wie man mit den Menschen dort redet. – Aber eigentlich sollten Sie mitfahren.« Ein strenger Rat. »Und übrigens, nur damit Sie sich nicht wundern, ich arbeite heute von Lannion aus. Bin aber jederzeit erreichbar.«
Dupin hatte keinen blassen Schimmer, was das heißen sollte.
»Und… «
»Chef! Chef!«, wieder Riwal, dieses Mal stürzte er regelrecht auf ihn zu. In seinem Gesicht lag Entsetzen.
»Ich rufe zurück, Nolwenn.«
»Wir haben… «, außer Atem kam er vor Dupin zum Stehen. »Wir haben noch eine Tote, Chef!«
»Was?«
»Kein Witz, Chef. – Noch eine Tote. Eine neue.«
»Noch eine Tote? Wer?«
»Wieder eine Frau. – Und raten Sie, wie sie umgebracht wurde?«
»Eine durchgeschnittene Kehle.«
Riwal starrte ihn verwirrt an.
»Woher wissen Sie das?«
Dupin fuhr sich durch die Haare: »Das kann nicht wahr sein.«
»Eine Delfinforscherin vom Parc Iroise. Eine durchgeschnittene Kehle. Und raten Sie auch noch, wo!«
Bevor Dupin etwas sagen konnte, antwortete Riwal schnell selbst: »Auf der Île de Sein!«
Damit nahm die Insel jetzt unabweisbar eine bedeutende Stellung im Geschehen ein.
»Ein kleiner Junge hat sie gefunden.«
»Delfinforscherin?«
»Ja.«
»Die Dame vom Kaffeestand hat doch eben etwas von getöteten Delfinen erzählt.«
»Im Parc Iroise gibt es zwei Populationen von Großen Tümmlern. Um die Île d’Ouessant sind es circa fünfzig, um die Île de Sein zwanzig. Insgesamt haben sie es im Parc Iroise sogar mit mehreren verschiedenen Delfinarten zu tun, dem Kleinen Tümmler, dem Blauen Delfin und«, natürlich, Riwal kannte sie alle, »im Sommer auch mit dem Rundkopfdelfin. Die Delfine stellen einen Schwerpunkt für die Wissenschaftler im Parc dar, wir wissen noch sehr wenig über ihr hoch entwickeltes soziales Verhalten. Ihre ungeheure Intelligenz. Der Zustand der Delfine zeigt zudem den ökologischen Zustand des Parcs an, die Wasserqualität… «
»Kannten sich die beiden Frauen?«
»Das kann ich Ihnen nicht sagen.«
»Wann wurde die Delfinforscherin umgebracht?«
»Auch das wissen wir noch nicht.«
»Das ist doch vollkommen verrückt.«
Dupin hatte gerade erst begonnen, sich mit dieser einen Toten auseinanderzusetzen. »Das heißt, wir müssen auf die Insel. Ich auch.«
»Ich fürchte ja, Chef.«
Dupin würde nicht umhinkommen.
»Das Meer wird noch ziemlich aufgewühlt sein«, Dupin war sich vollkommen darüber im Klaren, dass es zurzeit ungleich wichtigere Themen gab. Dennoch. Die letzten Tage, bis gestern Nachmittag noch, hatte ein Sturm getobt, heute war Sommer, Hochsommer, und das Meer hier in der Bucht herrlich glatt – aber, er war kein Debütant mehr in »Armorica«, dem »Land am Meer«, draußen würde es noch kräftig nachschwappen.
»Der Helikopter steht uns leider nicht zur Verfügung. Der Präfekt ist damit unterwegs, die viertägige nationale Simulationsübung zur… «
»Lassen Sie gut sein, Riwal.«
Dupin würde sich bloß aufregen. Es war immer das Gleiche. Wenn sie den Hubschrauber wirklich brauchten, hatte ihn der Präfekt. Dieses Mal, der Präfekt hatte seit Wochen von dem »überaus bedeutenden Ereignis« berichtet, ging es um eine praktische Simulation der über Jahre neu konzipierten Pläne zur Durchführung verdeckter frankreichweiter Geschwindigkeitsüberwachungen mit »sensationellen neuen Technologien und Strategien«; für Dupin persönlich ein überaus heikles Thema.
»Wir könnten mit einem Polizeiboot von hier aus los, oder –«, Riwal schaute auf die Uhr, »oder wir nehmen die reguläre Fähre von Audierne, das könnten wir schaffen, wir sind in zwanzig Minuten am Ableger.«
Dupin warf ihm einen fragenden Blick zu.
»Auf der Fähre ist es deutlich ruhiger, sie liegt tiefer und stabiler im Wasser. Aber«, Riwal schaute noch einmal auf die Uhr, »wir müssten auf der Stelle los.«
Dupin gefiel das Wort »regulär«, wenn er schon aufs Wasser musste.
»Ist bereits irgendein Kollege da? Gibt es eine Gendarmerie auf der Insel?«
»Nein. Aber der stellvertretende Bürgermeister kümmert sich um alles. Er ist zugleich der Inselarzt und Präsident der Nationalen Seenotrettung SNSM.«
Das klang vielversprechend.
»Ein Polizeiboot ist bereits unterwegs. Von Audierne aus.«
»Von Audierne ist die Strecke kürzer als von Douarnenez?«
»Ja.«
»Wir nehmen die Fähre. Regulär. – Wir machen uns umgehend auf den Weg. Mit Ihrem Wagen! Geben Sie der Fährgesellschaft Bescheid, dass sie auf uns warten. Kadeg soll hier übernehmen. Geben Sie ihm die Prioritäten durch. Und er soll sich Verstärkung holen.«
Mit den letzten Worten war Dupin losgelaufen, Riwal folgte.
Es war absurd alles. Zwei durchgeschnittene Kehlen innerhalb weniger Stunden – das war kein Zufall. Beide Opfer, beide Frauen, kamen von der Île de Sein, hatten mit dem Meer zu tun, dem Parc Iroise. Natürlich war es ein und derselbe Fall. Dupin hatte keinen Zweifel.
Beim Ablegen waren die Wellen drei Meter hoch, ein wenig weiter draußen waren es schon fünf Meter gewesen – lange, kräftig wogende Wellen mit erstaunlichen Tälern –, seit dem letzten Landzipfel, der Pointe du Raz, erreichten die Wellen locker sieben oder acht Meter. Nun hatten sie neun Kilometer offenen Meeres bis zur Insel vor sich.
Die klassisch blau-weiße Enez Sun III – der Name der Insel auf Bretonisch – war nicht so lang, nicht so groß, nicht so solide, wie Dupin es sich nach Riwals Ausführungen vorgestellt hatte. Von »deutlich ruhiger« und »stabiler im Wasser« war nichts zu spüren. Die reguläre Fähre schoss in abenteuerlichen Neigungen und Winkeln in den Himmel, um im nächsten Moment tief ins Wellental zu fallen.
Es war ein vollkommenes Chaos. Ein Auf und Ab wie auf einer waghalsigen Achterbahn, aber es war nicht bloß diese eine Bewegung von hoch und runter, es waren mehrere Bewegungen, völlig unterschiedliche Bewegungen, und, das war das Schlimmste, alle simultan: ein Hin- und Herwiegen, ein Wanken, ein plötzliches Kippen, ein Schwanken und Schlingern. Die Sinne, der Körper, der Geist – nichts vermochte sich auf einen Rhythmus einzustellen. Zu diesen schrecklichen Empfindungen kam das unerträgliche Vibrieren des gesamten Körpers hinzu – ausgelöst durch das unerträgliche Vibrieren des gesamten Bootes, das der Motor direkt unter dem Kommissar produzierte. Und der ohrenbetäubende Lärm.
Dupin versuchte, den Horizont zu fixieren, das half, sagten alle, unglücklich war nur, dass Riwal und er keinen Sitzplatz auf dem oberen Deck bekommen hatten – das Schiff hatte zwölf Minuten auf sie gewartet –, sondern zwei Meter über der theoretischen Wasserhöhe im offenen Heck stehen mussten und es hier gar keinen Horizont zu sehen gab, weil er beständig von wogenden Wasserbergen verdeckt war. Das Schiff war bis auf den letzten Platz ausgebucht, Tagesausflügler und Inselbewohner, die über Nacht auf dem Festland gewesen waren.
Das Wasser hatte eben, am Festland, ein tiefes dunkles Blau gehabt, nun aber war es einfach schwarz. Und vor allem: Es war überall. Überall um Dupin herum, in keiner ästhetischen Distanz mehr, er war mittendrin, ausgeliefert auf Gedeih und Verderb. Es war auch in der Luft, in Form dichter Gischtwolken, die beim Brechen jeder einzelnen Welle entstanden, und schon die Gischt der kolossalen Heckwelle im steifen Rückwind reichte aus, um alle Passagiere komplett zu durchnässen. Alles schmeckte und roch nach Meer, Dupin hatte es im Mund, in der Nase, im Haar.
Sie würden die ganze Fahrt über stehen und leider nicht einmal in der Mitte des Hecks, wo es zumindest ein klein wenig besser gewesen wäre, da man die seitlichen Kipp- und Gleitbewegungen nicht so heftig mitmachte. Dort jedoch hatte es sich ein dickes Paar mit einem winzigen Hund und unzähligen Gepäckstücken gemütlich gemacht.
Dupin fragte sich, ob das Polizei-Schnellboot nicht doch das geringere Übel gewesen wäre. Jetzt war es zu spät.