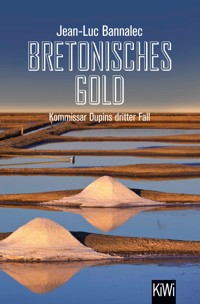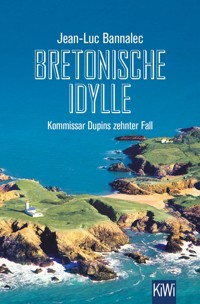
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Dupin ermittelt
- Sprache: Deutsch
Mord unter der Sonne der Bretagne - Kommissar Dupin ermittelt auf der malerischen Belle-Île Die Hitzewelle hat in diesem August sogar die Bretagne fest im Griff. Keine Aussicht auf Abkühlung für Kommissar Dupin. Und zu allem Überfluss planen die Kollegen auch noch die große Feier seines zehnjährigen Dienstjubiläums. Doch dann wird eines Morgens an der Küste bei Concarneau ein Toter aus dem Meer gefischt, ein Schafzüchter von der legendären Belle-Île. Und ehe Dupin sich's versieht, befindet er sich an Bord eines Schnellbootes auf dem Weg zur »schönsten Insel der Welt«, wo er schon bald auf tiefste menschliche Abgründe stößt … In seinem zehnten Fall taucht Kommissar Dupin ein in die faszinierende Welt der Belle-Île mit ihrer einzigartigen Landschaft, der traditionellen Schafzucht und der Whisky-Produktion. Doch hinter der idyllischen Fassade lauern Geheimnisse, Erpressung und Mord. »[Eine] unterhaltsame Lektüre – auch für Daheimgebliebene, die sich die Meeresbrise und den würzigen Thymian- und Kiefernduft der Insel auf den heimischen Balkon holen wollen.« Kulturtipp Schweiz »Bretonische Idylle« von Jean-Luc Bannalec ist ein atmosphärischer Kriminalroman für Frankreich-Fans und alle, die sich nach einer Auszeit an der bretonischen Küste sehnen. Jean-Luc Bannalec präsentiert mit seinen Krimiabenteuern um Kommissar Dupin aus der Bretagne die ideale Urlaubslektüre: Mit gewitztem Humor und einem Gespür für regionale Nuancen entführt er die Leser in die unverwechselbare Bretagne, wo die salzige Atlantikluft fast greifbar wird. Die Krimi-Bestseller aus der Bretagne sind in folgender Reihenfolge erschienen: - Bretonische Verhältnisse - Bretonische Brandung - Bretonisches Gold - Bretonischer Stolz - Bretonische Flut - Bretonisches Leuchten - Bretonische Geheimnisse - Bretonisches Vermächtnis - Bretonische Spezialitäten - Bretonische Idylle - Bretonische Nächte - Bretonischer Ruhm - Bretonische Sehnsucht - Bretonische Versuchungen Die Bücher erzählen eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Jean-Luc Bannalec
Bretonische Idylle
Kommissar Dupins zehnter Fall
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Jean-Luc Bannalec
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Jean-Luc Bannalec
Jean-Luc Bannalec ist der Künstlername von Jörg Bong. Er ist in Frankfurt am Main und im südlichen Finistère zu Hause. Die Krimireihe mit Kommissar Dupin wurde für das Fernsehen verfilmt und in zahlreiche Sprachen übersetzt. Im Jahr 2016 wurde der Autor von der Region Bretagne mit dem Titel »Mécène de Bretagne« ausgezeichnet. Seit 2018 ist er Ehrenmitglied der Académie littéraire de Bretagne. Zuletzt erhielt er den »Preis der Buchmesse HomBuch für die deutsch-französischen Beziehungen« Jahr 2016 wurde der Autor von der Region Bretagne mit dem Titel »Mécène de Bretagne« ausgezeichnet. Seit 2018 ist er Ehrenmitglied der Académie littéraire de Bretagne. Zuletzt erhielt er den »Preis der Buchmesse HomBuch für die deutsch-französischen Beziehungen«.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
»Um die Sommerlektüre muss man sich keine Sorgen machen.« Kölnische Rundschau
»Die Figuren sind von Leben erfüllt. Jeder für sich ist ein echter Charakter – und bekannte Figuren werden stringent weiterentwickelt.« Mein Frankreich
»[Zum Schluss] kommt es zu einer spannenden Auflösung, bei der sich Dupin und der Autor selbst übertreffen.« Sächsische Zeitung
»Ein ebenso unterhaltsamer wie auch spannender Krimi mit viel Bretagne-Flair und echten Typen. Geschrieben mit einem Augenzwinkern.« Ruhr Nachrichten
»Der Autor entführt die Leser und Leserinnen erneut in eine wunderbare Landschaft am ›Ende der Welt‹ und weiß mit seinen Schilderungen geschickt, unmittelbar Fernweh zu erzeugen.« Schweriner Volkszeitung
»Unterhaltsame Lektüre – auch für Daheimgebliebene, die sich die Meeresbrise und den würzigen Thymian- und Kiefernduft der Insel auf den heimischen Balkon holen wollen.« Kulturtipp
»Bannalecs ausführliche, fast schon poetische Landschaftsbeschreibungen lassen beim Lesen den Wunsch aufkommen, die Koffer zu packen und dieses wundersame Fleckchen Erde mit eigenen Augen zu sehen.« Franken aktuell
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2021, 2023, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln
Covermotiv: © akg-images / Bruno Barbier
Kartografie: Birgit Schroeter
ISBN978-3-462-32083-1
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses Zusatzmaterial ist auch auf unserer Homepage zu finden:
https://www.kiwi-verlag.de/magazin/extras/karte-zu-bretonische-idylle
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
Der erste Tag
Kommissar Georges Dupin hatte ...
Das Haus von Byn ...
Der zweite Tag
Der dritte Tag
Leseprobe »Bretonische Versuchungen«
À L.
und in Andenken an meinen Freund Uwe Rosenfeld, Bretone im Herzen
Neb a fell dezhañ ober fall,
A gav un digarez pe un all.
Wer Böses tun will,
findet immer eine Ausrede.
Bretonisches Sprichwort
Der erste Tag
Kommissar Georges Dupin hatte einen neuen Freund.
Dupin war, wie heute, weit hinausgeschwommen, als sie sich das erste Mal begegnet waren. Der Kommissar mochte es, so ganz allein draußen im Meer zu sein. Es herrschte eine ganz besondere Stimmung, eine wundersam gedämpfte Ruhe. Vor allem mochte er die verrückte Perspektive: die Augen nur knapp über dem Wasser, schienen Himmel und Ozean unendlich. Unendlich weit. Und unendlich blau, nur in den Tönen unterschieden sich das obere und das untere Blau. Heute war der Himmelsstreifen eine Spur lichter. Manchmal war es auch umgekehrt. Unentwegt spielten Himmel und Meer in der Bretagne dieses Spiel: sich untereinander die Blautöne abspenstig zu machen, als lieferten sie sich einen Wettstreit. Und es gab Tage, an denen beide exakt den gleichen Ton annahmen, womit sie den Horizont zum Verschwinden brachten, Tage, an denen sie sich harmonisch ineinander auflösten und die Menschen in einen Taumel versetzten. Dann blieb nichts mehr zu sehen als ein einziges Himmelsmeer, ein einziger Meereshimmel. Und es war unmöglich zu sagen, wo das eine aufhörte und das andere begann.
Vor zwei Wochen also war beim Schwimmen plötzlich etwas Graues vor ihm aufgetaucht. Eine Schnauze zunächst, eine beträchtliche Schnauze, eindeutig mit Fell, einzelne lange weiße Schnurrhaare zu beiden Seiten. Nur allmählich hatte sie sich geneigt, bis ein paar glänzende dunkle Augen und ein spitz zulaufender Kopf zum Vorschein gekommen waren.
Eine Robbe.
Eine Kegelrobbe, genauer gesagt, un phoque gris, wie ihn Riwal und Nolwenn – sein erster Inspektor und seine »Assistentin«, die ungleich mehr war als eine Assistentin – später aufgeklärt hatten. Zu behaupten, Dupin hätte bei dieser ersten Begegnung Angst gehabt, wäre zu viel gesagt. Respekt hingegen sehr wohl. Selbstverständlich war ihm im ersten Augenblick etwas mulmig zumute gewesen. Schließlich waren es imposante Tiere, massig und dennoch enorm schnell, Akrobaten des Meeres, hübsch anzusehen, ja, putzig als Babys, aber im Wesentlichen Raubtiere. Was ebenfalls zu bedenken war: Womöglich existierte auch im Meer eine Art Tollwut, jedenfalls zeigte dieses Exemplar kaum Scheu, was, wie man gemeinhin wusste, bei Wildtieren als suspekt galt.
Eine Weile war Dupin so regungslos wie möglich verharrt, hatte sich, die Robbe im Blick, lediglich mit sachten Bewegungen über Wasser gehalten. Glücklicherweise hatte das Meer glatt dagelegen, wie ein gespanntes Laken, ohne auch nur die Andeutung einer Welle. So war es die gesamte letzte Zeit gewesen, seit die große Hitze, la canicule, ganz Westeuropa und ausnahmsweise auch die Bretagne fest im Griff hatte, eine Region, die von Hitzewellen für gewöhnlich verschont blieb. Ce n’est pas normal, die allgemeine Empörung war nicht zu überhören, im Supermarkt, beim Friseur, beim Bäcker, im Weinladen, im Café, bei zufälligen Begegnungen auf der Straße. In Rennes war dieser Tage der beängstigende Hitzerekord von 40,1 Grad gemessen worden, in Concarneau immerhin noch 34,7 Grad. So etwas hatte es, da war man sich einig, seit Menschengedenken nicht gegeben.
Die Robbe war aufrecht geschwommen, in gewisser Weise hatten sie sich in dem glasklaren Wasser gegenübergestanden. Sie hatte einen neugierigen Eindruck gemacht, verwundert vielleicht, als fragte sie sich, wer da in ihrem Element herumschwamm. Eine Weile hatten sie einander gemustert. Dann hatte Dupin es für das Beste befunden, ruhig und ohne hektische Bewegungen zurück zum Ufer zu schwimmen. In Begleitung der Robbe, wie er feststellte. Einen höflichen Abstand einhaltend, war sie ihm bis zum Strand gefolgt. Dupin war auf eine intensive Weise berührt gewesen. Noch eine ganze Zeit hatte er an der Wasserlinie gestanden.
Das war vorletzten Donnerstag gewesen. Seitdem hatte ihn die Robbe jeden Morgen erwartet, wenn er vor der Arbeit, um acht, ein strenges sommerliches Ritual, zum Schwimmen an seinen Hausstrand kam. Um ihn raus aufs Meer zu begleiten. Ausgelassen schwamm sie auf dem Bauch, auf dem Rücken, tauchte unter ihm hindurch und um ihn herum, schoss kreuz und quer durchs Wasser, ohne sich je weit von ihm zu entfernen. Verließ er das Meer und den Strand, blickte sie ihm eine Zeit lang nach, um dann entschieden abzutauchen und bis zum nächsten Tag anderweitigen Beschäftigungen nachzugehen. Ab und an gab sie beim gemeinsamen Schwimmen einen durchdringenden Klicklaut von sich, beim täglichen Abschied auch eine Art singendes Pfeifen, das, er hatte die Bedeutung noch nicht erfasst, in ein tiefes Dröhnen übergehen konnte.
Auch heute, es war der 7. August, ein Mittwoch, hatte die Robbe auf Dupin gewartet. Geduldig schwamm sie neben ihm her. Dupin bewunderte ihre Langmut, nach ihrem Empfinden musste er sich im Tempo einer Meeresschnecke bewegen. Aus irgendeinem Grund, vielleicht eine veränderte Strömung, hatte sich der Atlantik über Nacht abgekühlt. Das geschah manchmal, selbst bei großer Hitze, und gerade jetzt war die Abkühlung höchst willkommen. Mit dreiundzwanzig Grad war der Atlantik in der Baie de Concarneau längst ungewöhnlich warm geworden. Dupin befand sich auf dem Rückweg seiner Schwimmstrecke, als er am Strand eine wild gestikulierende Person bemerkte. Es dauerte ein wenig, bis er die Gestalt erkannte. Es war Riwal.
»Chef! Chef!«
Dupin blickte auf die Uhr. Es war zwanzig nach acht. Wo lag das Problem? Sie hatten Viertel vor neun gesagt. Und es war nicht weit zum Kommissariat. Eigentlich hätte er sogar noch rasch einen petit café im Amiral trinken können. Nolwenn und Riwal wollten »dringlich und abschließend« über »die große Feier« sprechen: Dupins zehnjähriges Dienstjubiläum. In zwei Tagen war es so weit, Freitagabend. Ausnahmsweise würde die Festivität nicht im Amiral stattfinden, die Wahl war nach wochenlangen Abwägungen auf das Ty Mad in Douarnenez gefallen.
Hatte Nolwenn den Inspektor geschickt, um sicherzustellen, dass er auch wirklich kommen würde? »Viel Zeit haben wir leider nicht«, hatte sie bereits gestern gemahnt, denn schon um 11 Uhr 30 hatte Dupin einen Termin mit dem Chef der Feuerwehr. Dupin war der ganze Wirbel ohnehin nicht recht, die Diskussionen hatten sich über Wochen hingezogen, irgendwann hatte er der Feier resigniert zugestimmt. Er hatte keinen blassen Schimmer, was sie heute noch so lange besprechen sollten. Nolwenn übertrieb. Und zwar maßlos.
Am Ufer winkte Riwal jetzt immer verzweifelter. Auch die Robbe hatte den Inspektor wahrgenommen. Sie hatte innegehalten und blickte, so schien es, mit ausgesprochen skeptischer Miene Richtung Strand.
»Chef! Chef, ein Toter!«
Dupin war sich einen Moment unsicher, ob er richtig gehört hatte.
»Was?«
»Ein Toter! Chef, wir haben einen Toten!«
Die Worte hallten durch die gesamte Bucht. Es bestand kein Zweifel.
Ein Toter!
Glücklicherweise war um diese Uhrzeit noch nichts los. Nur Dupins Nachbarin, die alte Madame Claudel, war, ein Baguette unterm Arm, auf der Uferpromenade unterwegs. Natürlich, wie sollte es anders sein, war sie neugierig stehen geblieben und beobachtete die Szene.
»Ich komme, Riwal.«
Dupin begann zu kraulen, so schnell er konnte. Die Robbe schien bemerkt zu haben, dass hier etwas Irreguläres vor sich ging, sie blickte sich alarmiert um und eskortierte Dupin dann fürsorglich bis zum Strand.
»Wo? Wer ist es?«
Dupin rannte noch im Wasser los. Er stürmte auf den Inspektor zu.
»Eine Männerleiche, im Meer. Im Hafen von Doëlan. Wir wissen noch nicht, wer der Tote ist. Ein Fischer hat ihn gefunden.«
»Und er kennt ihn nicht?«
»Nein.«
Dupin war, ohne langsamer zu werden, an Riwal vorbeigelaufen, zu seiner Kleidung, die weiter oben am Strand lag. Riwal folgte ihm.
»Hinweise auf ein Verbrechen?«
»Noch nicht.«
»Wenn der Fischer ihn nicht kennt, ist er nicht von dort.«
Doëlan war ein winziger Ort, der zur kleinen Gemeinde Clohars-Carnoët gehörte.
Der Kommissar war bei seinen Sachen – Handtuch, Jeans, Polo, Schuhe – angekommen.
»Wahrscheinlich nicht, nein.«
»Wird irgendwo jemand vermisst?«
»Nein. Zwei Gendarmen aus Quimperlé sind auf dem Weg, sie müssten bald in Doëlan eintreffen. Der Gerichtsmediziner ist auch schon unterwegs.«
»Gut.«
Es blieb keine Zeit, sich abzutrocknen. Oder die Badehose loszuwerden. Er musste die Jeans einfach drüberziehen.
»Wir nehmen meinen Wagen!«
Dupin spurtete los.
»Meernebel, Chef, Brume de mer.«
Nach zehn Jahren Bretagne kannte Dupin das Phänomen, aber es war jedes Mal aufs Neue spektakulär anzusehen. Der Nebel war aus dem Nichts aufgetaucht. Die gesamte Fahrt über hatte der bretonische Himmel sein makelloses atlantisches Blau zur Schau gestellt. Erst als sie zum Hafen hinuntergefahren waren, hatte sich der Nebel gezeigt: ein eigenartiger hellweißer Dunstschleier, der unmittelbar über dem Meer schwebte. Dupin schätzte die Sicht auf vielleicht zehn Meter, darüber hinaus vermochte man bloß noch Silhouetten und Konturen zu erahnen, Boote, Kähne, Felsen, Bojen. Dann verlor sich alles im wabernden Nichts. Die Grenze war scharf gezogen: Wo das Meer endete, endete auch der Nebel. Wie an einer unsichtbaren Wand. Er lag nur über dem Meer. Es war geradezu gespenstisch.
Kadeg, Dupins zweiter Inspektor, war mit Le Menn und Nevou – den beiden Polizistinnen, die Nolwenn vorletztes Jahr zur längst überfälligen Verstärkung des Teams erkämpft hatte – ein paar Minuten vorher eingetroffen. Mit einem Kahn waren sie zur Leiche gefahren, die noch im Wasser lag. Mitten in den Meeresnebel hinein. Von ihnen war nichts zu sehen.
»Maritimer Stratus, Chef.« Auch Riwal und Dupin hatten sich inzwischen einen Kahn genommen, einen abenteuerlich winzigen, fand Dupin, weiß-blau gestrichen und mit zwei einfachen Holzrudern ausgestattet.
»Streng genommen ist das gar kein Nebel, das sind echte Wolken. Die sich über dem Meer bilden, wenn die erhitzten Luftmassen aus dem Inland die Küste erreichen und jäh abkühlen.«
Es war ein ganz und gar unpassender Zeitpunkt für die Erörterung meteorologischer Mysterien. Außerdem war Dupin egal, was genau es war, das ihnen die Sicht nahm.
Doch im nächsten Moment war Riwal wieder ganz bei der Sache: »Einer der Gendarmen schaut sich die Autos am Hafen an und prüft, ob welche von auswärts kommen. Und der Hafenmeister kontrolliert die Boote.«
»Irgendwoher muss er ja kommen«, brummte Dupin mürrisch.
»Wir müssen höllisch aufpassen, Chef, die Ebbe hat fast ihren tiefsten Punkt erreicht. Wir haben es gerade mit einem beachtlichen Koeffizienten zu tun, da fehlt erheblich mehr Wasser als sonst. Rechts und links der Fahrrinne lauern spitze Felsen.«
Das kümmerliche Boot wankte und schwankte bedenklich, auch wenn es weit und breit keine Wellen gab.
»Und die letzten aus der Ria ablaufenden Wassermassen verursachen extrem starke Strömungen«, ergänzte Riwal. »Die machen das Manövrieren nicht einfacher.«
Sosehr Dupin das Schwimmen liebte, so sehr hasste er Bootsfahrten. Ganz gleich auf welchen Booten. Riwal ruderte auf Steuerbord-, Dupin auf Backbordseite. Der Inspektor stellte sich alle paar Augenblicke aufrecht hin, um Ausschau nach den anderen zu halten, was die wackelige Angelegenheit nur noch wackeliger werden ließ.
»Hier drüben! Hier!«
Kadegs militärisch-zackige Art. Eine seiner unangenehmen Eigenschaften, von denen es einige gab und die einem dummerweise sofort auffielen. Im Gegensatz dazu dauerte es, bis man seine sympathischen Seiten entdeckte, Dupin hatte Jahre gebraucht.
Kadeg hatte, das musste am Meernebel liegen, zugleich ganz nah und ganz weit entfernt geklungen. Dupin hätte beim besten Willen nicht sagen können, wo sich sein Inspektor befand.
»Okay«, bestätigte Riwal.
Sie waren, wie sie feststellten, etwas zu weit gerudert, Dupin tat ein paar kräftige Schläge allein, das Boot drehte sich. Die Silhouette der sich vom Ufer weit ins Meer ziehenden Kaimauer trat massig und gespenstisch aus dem Dunst hervor.
»Noch ein bisschen weiter, hierher!«
Nevous kräftige, tiefe Stimme leitete sie. Mit einem Mal sahen sie das Boot der Kollegen. Neben Kadeg und Nevou konnte Dupin die hochgewachsene Le Menn mit ihrem Zopf und einen der Gendarmen aus Quimperlé erkennen. Kadeg und Le Menn knieten im Bug, weit über die schmale Reling des Bootes gebeugt, Nevou und der Gendarm hielten sie an den Beinen fest, es war ein skurriler Anblick.
»Bonjour, Monsieur le Commissaire.« Die schüchterne Stimme gehörte dem Gendarmen.
»Sie haben vermutlich auch keine Ahnung, wer der Tote sein könnte?« Dupin klang unwirsch, obwohl er das gar nicht wollte.
»Ich habe ihn in der Gegend noch nie gesehen«, der Gendarm wirkte nun erst recht eingeschüchtert, »es kann auch ein Fremder sein, jetzt in der Saison wimmelt es hier von Touristen.«
So war es Anfang August. Die meisten Franzosen verreisten in den vier Wochen nach dem Nationalfeiertag am 14. Juli. Dazu kamen die Touristen aus anderen Ländern.
Riwal und Dupin waren noch zwei, drei Meter vom Boot der Kollegen entfernt, allmählich war die Szene zu erkennen. Zwischen zwei großen weißen Bojen war eine Leine gespannt, an der weitere Leinen zum Vertäuen von Booten befestigt waren. Die Leiche hatte sich in ihnen verfangen und wurde von der Strömung gegen eine der Bojen gepresst. Kadeg und Le Menn versuchten, den Körper zu befreien.
»Wir haben es gleich«, schnaufte Le Menn, ihr langer Zopf baumelte im Wasser, »noch einen Moment.«
Dupins Blick haftete auf dem Toten.
Riwal hatte ihr Boot mit ein paar kräftigen, geschickten Schlägen auf die andere Seite der Boje gebracht, jetzt lag es direkt an der Leiche. Der Kommissar hatte sich in den Bug gekniet, ohne das heftige Schaukeln, das er damit ausgelöst hatte, zu bemerken.
Der Tote war hager. Nicht besonders groß, nicht besonders klein. Er trieb auf dem Rücken. Die Strömung drückte den Kopf regelmäßig unter Wasser, dann tauchte er plötzlich wieder auf, es war ein überaus makabres Schauspiel. Der gesamte Körper befand sich unentwegt in Bewegung. Am unheimlichsten aber wirkten die Augen: schmale, starre Schlitze, durch die einen nasse, glasige Pupillen anzustarren schienen. Die Lider waren angeschwollen. Der Mann mochte um die sechzig sein, kurze Haare, ein derbes Gesicht, ein unnatürlich rosiger Ton.
»Er liegt noch nicht lange im Wasser«, konstatierte Le Menn ruhig, die nach wie vor an den Leinen herumhantierte, »eindeutig.«
»Ein paar Stunden maximal«, präzisierte Kadeg mit gewichtigem Ton.
Der Mann trug eine schwarze Stoffhose und ein grünes kurzärmliges Hemd, die Strömung hatte den halben Bauch freigelegt.
»Wo bleibt Docteur Lafond?« Dupin war im Begriff, sich wieder zu setzen, als er plötzlich innehielt.
»Er hat sich eben gemeldet«, teilte Le Menn mit, »er kommt gleich zum Hafen. Er hat …«
»Riwal«, unterbrach Dupin sie, der sich abermals hinkniete, »können Sie uns etwas näher ranbringen?«
Der Kommissar lehnte sich weit über den Rand, das Boot neigte sich.
»Was ist, Chef? Was haben Sie gesehen?«
»Noch näher, Riwal!«
Der Inspektor tat sein Bestes, es war eindrucksvoll, wie er, jetzt stehend, den Kahn mit nur einem Ruder im Griff hatte. Dupin konnte den Körper des Toten beinahe berühren, dann drehte das Boot abrupt ab.
»So ein Scheiß«, entfuhr es Dupin.
»Die Strömung, Chef. Keine Chance.«
Es schien aussichtslos, das Manöver noch einmal zu wiederholen.
»Monsieur le Commissaire, wenn Sie uns sagen würden, was Sie vorhaben?«, ließ Kadeg pikiert vernehmen. Er hielt jetzt das rechte Bein des Toten fest.
»Ich …«
Dupin brach ab. Kurzerhand kletterte er an Riwal vorbei zum Heck, legte seine Waffe ab – noch wichtiger: sein heiliges Notizheft –, warnte den Inspektor mit einem knappen »Achtung!« und sprang über Bord. Er tauchte kurz unter, um dann mit ein paar kräftigen Zügen zur Boje zu schwimmen.
»Alles okay, Chef?« Riwal wusste, dass weiteres Nachfragen sinnlos war, wenn Dupin sich etwas in den Kopf gesetzt hatte.
»Alles okay.«
Dupin hatte etwas am Hals des Toten gesehen. Zumindest glaubte er, es gesehen zu haben. Der Kommissar hielt sich an der Leine zwischen den großen Bojen fest, er war jetzt direkt beim Toten, griff nach dem Hemdkragen und zog ihn zur Seite. Es war eindeutig. Dupin hatte sich nicht vertan. Am Hals waren deutliche Verletzungen zu erkennen. Und zwar sehr spezifische. Zeichen einer Strangulation. Der Mann an der Boje war ermordet worden.
Sie hatten die Leiche vor das Hafenbüro gebracht. Jetzt lag sie auf dem Asphalt mitten auf dem Parkplatz, der weiträumig abgesperrt worden war. Der Nebel über dem Meer schien sich weiter zu verdichten, hielt sich aber noch immer strikt an die rätselhafte Grenze: Zum Landesinneren hin war der Himmel frei und blau, auch hier über dem Parkplatz.
Der Tote lag in der prallen Sonne, die sich, obgleich es erst kurz nach neun war, gar nicht wie Morgensonne anfühlte, so stark brannte sie bereits. Der Gerichtsmediziner, Doktor Lafond, war mit zwei Mitarbeitern eingetroffen und hatte den Toten ein erstes Mal in Augenschein genommen. Auch die Kollegen der Spurensicherung waren mittlerweile vor Ort und sahen sich aufmerksam am Hafen um.
Trotz seiner notorischen Abneigung gegenüber vorschnellen Aussagen hatte sich Lafond zu einem »Offenbar erdrosselt, mit einem Seil oder einem Tuch, wahrscheinlich erst vor ein bis drei Stunden« hinreißen lassen. »Eher drei Stunden. Das wäre sechs Uhr heute Morgen. Länger ist es nicht her.« Tonlos hatte Lafond noch hinzugefügt: »Ein brutaler Tod.« Davon zeugten die Wunden, Quetschungen, Striemen und vor allem die Hämatome am Hals auf schaurige Weise, die nun, ohne die Kühlung durch den Atlantik, immer grässlicher hervortraten. Der Mann war, auch das stand für Lafond außer Frage, bereits tot gewesen, als er ins Meer gefallen oder geworfen worden war. Womit Grundlegendes feststand. Damit konnte man arbeiten.
Dupin, Le Menn und Riwal hatten kurz mit dem Fischer gesprochen, der die Leiche bei seiner Einfahrt in den Hafen entdeckt hatte. Er war um kurz vor Mitternacht rausgefahren, genau wie zwei andere Küstenfischer, die sich noch auf dem Meer aufhielten. Sie hatten dem Fischer die Leiche noch einmal gezeigt, aber auch jetzt, bei näherer Betrachtung, kam ihm der Mann nicht bekannt vor.
»Der Mörder hat ganz schön Pech gehabt«, murmelte Le Menn plötzlich.
Riwal und Dupin sahen sie fragend an. »Wenn sich die Leiche nicht in den Leinen an der Boje verfangen hätte, wäre sie nie gefunden worden. Sie wäre einfach immer weiter rausgetrieben. Und der Tote für alle Zeiten verschwunden gewesen.«
So war es.
»Man hätte einen Unfall vermutet. Der Fall wäre zu den Hunderten Akten der Vermissten gekommen.«
Es geschah immer wieder. Menschen gingen im Meer verloren. Aus für immer unbekannten Gründen und unter für immer ungeklärten Umständen. Sie verschwanden einfach. Das Meer nahm sie. So hieß es hier. Das war Teil des bretonischen Lebens.
»Le Menn hat völlig recht«, bestätigte Riwal. »Das war der reine Zufall. Es war extrem unwahrscheinlich, dass der Tote je entdeckt wird.«
»Irgendjemand muss ihn doch kennen.«
Kadeg, Nevou und die beiden Gendarmen waren bereits mit einem Foto des Mannes im kleinen Dorf von Haus zu Haus unterwegs.
»Ich würde ihn jetzt mit nach Quimper nehmen.« Doktor Lafond stand neben der Leiche und wischte sich den Schweiß von der Stirn.
»Keine Einwände.« Dupin zuckte mit den Achseln. Er war immer noch triefnass.
Ein Mann kam lässigen Schrittes auf sie zu, beide Hände in den Hosentaschen, ein ausgewaschenes graues T-Shirt, übersät mit dunklen Flecken, Arbeitskleidung. Große, abstehende Segelohren, Mitte vierzig vielleicht.
»Können wir Ihnen helfen, Monsieur?«, wollte Dupin wissen.
»Ich bin der Hafenmeister«, teilte der Mann grußlos mit, lief an Dupin vorbei, nur für einen Moment blieb sein Blick an dem klitschnassen Kommissar hängen, und hielt auf die Leiche zu.
»Ein Inspektor hat gesagt, ich soll ihn mir ansehen.«
Erst kurz vor der Leiche blieb er stehen.
»Ah. Wie ich es mir dachte. Provost. Patric Provost. Ein Bellilois.«
Eine nüchterne Feststellung, keinerlei Emotion. Die Hände immer noch in den Hosentaschen.
»Sie kennen den Mann?« Im Nu stand Dupin neben ihm.
»Er kommt einmal im Jahr. Vom 6. auf den 7. August. Nur dann. Da hat der alte Provost Geburtstag. Sein Onkel. Jean Provost. Die ganze Familie stammt von der Belle-Île.«
»Sind Sie sicher, dass er es ist, Monsieur?«
Ein angedeutetes Nicken.
»Und er kommt von der Belle-Île?«
Abermals nur ein Nicken.
Dupins Blick ging zu Riwal: »Sagt Ihnen der Name Provost etwas?«
Auch Riwal war quasi ein Bellilois. Seine Schwester, die mit ihrem Mann, einem gebürtigen Bellilois, vor ein paar Jahren an die amerikanische Ostküste gezogen war, besaß ein Domizil auf der Insel, das seitdem Riwals Wochenend- und Ferienhaus geworden war. »Das absolute Paradies«, pflegte er zu sagen. Bis zur Fähre in Quiberon waren es von Concarneau aus anderthalb Stunden, dann eine Dreiviertelstunde Überfahrt. Riwal war verliebt in die Belle-Île, die berühmteste und größte der bretonischen Inseln. Ein Mythos.
»Nicht viel. Eine der alteingesessenen Familien, glaube ich.« Der Inspektor schüttelte den Kopf.
Dupin wartete. Aber mehr kam nicht. Riwal wirkte selbst enttäuscht. Er rieb sich die Schläfe und schien angestrengt nachzudenken.
Dupin wandte sich wieder an den Hafenmeister. »Hat er weitere Angehörige? Verheiratet?«
»Keine Ahnung. Der alte Provost hat auf jeden Fall keine Frau. Er lebt allein.«
»Wie ist Patric Provost nach Doëlan gekommen, Monsieur?«, übernahm Le Menn.
»Wie immer, mit seinem Boot. Es liegt da vorne, am Anfang der Ria.« Er deutete Richtung Inland.
Die Ria zog sich hier bei Doëlan bestimmt einen Kilometer ins Inland. Eine urbretonische Landschaftsform: ein durch den Anstieg des Meeresspiegels vor Jahrtausenden überflutetes Tal, ein versunkenes Flussbett, das zu einem mäandernden schmalen Meeresarm geworden war, wie ein Fjord. Im Norden der Bretagne hießen sie Abers. Rechts und links des Ufers erstreckten sich flache Hügel mit hübschen alten Fischerhäusern, ein Teil des Dorfes zog sich unten an der Ria entlang, ein anderer Teil lag auf dem Gefälle dazwischen. Zu sehen war der Meeresarm im Moment nicht: Der dichte Nebel verdeckte auch ihn.
»Provost ist gestern Abend angekommen, so um sechs«, fuhr der Hafenmeister fort. »Und wollte heute Morgen wieder zurück. Ihm gehört eine große Schafzucht. Ein verstockter Geizkragen, er hasst Menschen.«
Eine skurrile Kombination von Informationen.
»Ach ja, Schafe!«, rief Riwal plötzlich aus. »Natürlich! Daher kenne ich den Namen Provost.«
Dupin hatte begonnen, sich Notizen zu machen.
»Es gibt auf der Insel eine berühmte, ganz besondere Schafrasse, Chef«, jetzt sprang die enzyklopädische Maschine an, »sie heißt auch so. Wie die Insel, meine ich. Belle-Île-Schafe. Verrückte Geschichte, Chef. Man hielt sie für ausgestorben, ein Tierarzt, der auf der Insel Ferien machte, hat dann zufällig entdeckt, dass auf der Insel noch ein Dutzend davon lebte, und …«
»Wo in Doëlan wohnt Provosts Onkel?«, unterbrach ihn Le Menn, sie war Dupin zuvorgekommen.
»Impasse des Pêcheurs. Nicht weit.«
In Doëlan war nichts weit.
»Haben Sie mit Patric Provost gesprochen, als er ankam?«
»Gesprochen ist zu viel gesagt. Ein mundfauler Typ. Unsympathisch.«
Mitgefühl oder Pietät waren nicht die Sache des Hafenmeisters. Dabei meinte er es nicht böse, Dupin kannte solche Leute.
»Ist Ihnen gestern Abend etwas Ungewöhnliches an ihm aufgefallen?«
Le Menn war berüchtigt für ihr Fragetempo.
»Nein. Er war wie immer.«
»Wie lange haben Sie gestern Abend hier im Hafen gearbeitet, Monsieur?«
»Lange. Bis halb elf. Ich hatte viel zu tun.«
»Haben Sie etwas Ungewöhnliches bemerkt?«
»Nein.«
»Wie viele fremde Boote waren über Nacht hier?«
Im Sommer waren die Häfen entlang der Küste so etwas wie die Campingplätze der Bootsurlauber.
»Zwölf, als ich ging. Aber vielleicht ist ja noch jemand hinzugekommen.«
»Sie verfügen über eine Liste, nehme ich an.«
»Alle registriert.«
»Als Erstes«, Dupin verspürte Ungeduld, »reden wir mit dem Onkel.«
Er wandte sich ab in Richtung der Straße, die zum kleinen Hauptplatz des Ortes führte, den Dupin gut kannte.
»Le Menn, Sie kommen mit mir. Riwal, rufen Sie Kadeg und Nevou an, Sie inspizieren schon einmal Provosts Boot. Le Menn und ich stoßen dann zu Ihnen.«
Dupin zog sein Handy hervor. Das wichtigste Telefonat stand aus. Nolwenn und er hatten bisher noch nicht gesprochen. Riwal hatte sie nach der Bergung der Leiche à jour gebracht. Mehr wusste sie noch nicht. Er drückte die Nummer.
»Ah, Monsieur le Commissaire. Neuigkeiten?«
»Wir wissen, wer der Tote ist. Und dass er von der Belle-Île kam. Und – dass es Mord war.«
Dupin fasste mit knappen Worten zusammen, was sie gerade erfahren hatten.
»Von der Belle-Île? Hm. Riwals Reich.«
»Über Patric Provost weiß er leider nichts. Sagt Ihnen der Name etwas?«
»Auch nicht, nein. Aber das wird sich gleich ändern.«
Dupin hörte sie bereits tippen.
»Und da haben wir ihn schon. Patric Provost. Moutons bretons heißt sein Unternehmen, ein bisschen einfallslos, aber gut. Einen Moment …«
Le Menn hatte Dupin überholt und eilte die Straße zum Platz hinauf. Auch sie hatte das Telefon am Ohr.
»Jetzt bin ich auf seiner Website …« Eine Pause. »Eine äußerst bescheidene Seite … Die berühmten Belle-Île-Schafe. Eine sehr ansehnliche Zucht … Er ist Vizepräsident von Denved ar Vro, sehe ich.«
Nolwenn betonte es so, als müsste Dupin Bescheid wissen.
»Eine Vereinigung, die sich speziell um den Bestand und die Vermarktung dieser besonderen Rasse kümmert. Das Lammfleisch gilt als das beste überhaupt. Es ist extrem begehrt. Agneau de pré salé. Wie vom Mont-Saint-Michel. Nur heißt das Label auf der Belle-Île anders: Agneau du large.«
»Verstehe.«
Es gab tatsächlich nichts Besseres, eine grandiose Köstlichkeit. Die Schafe grasten auf salzig-jodigen Wiesen voller wilder Kräuter direkt am Meer. »Sie würzen sich beim Fressen gewissermaßen selbst«, hatte ihm einmal ein Bretone gesagt. In Dupins kulinarischem Ranking landete dieses Lammfleisch direkt hinter dem Entrecôte. Und das hieß etwas.
»Schauen Sie, was Sie sonst noch über den Mann finden, Nolwenn. Wir sprechen erst mal mit dem Onkel.«
»Damit eines klar ist, Monsieur le Commissaire«, Nolwenns Tonfall hatte mit einem Mal ein bedrohlich ernstes, nahezu dramatisches Timbre angenommen, »Freitagnachmittag müssen Sie den Fall gelöst haben. Die Feier steht! Und wenn die Welt untergeht! Und nächsten Montag ist Ihr Test. Auch den werden Sie unter keinen Umständen verpassen! Ich gehe davon aus, dass Sie Ihr Büchlein immer dabeihaben. Also los! Ken emberr.«
Bevor Dupin auch nur ein Wort entgegnen konnte, hatte sie aufgelegt.
»Bretonisch für Anfänger«, der Kurs mit abschließendem Test und Diplom war das »Geschenk« der Kolleginnen und Kollegen im Kommissariat zum Jubiläum. Auf wen die Idee zurückging, war klar. Über die gesamten zehn Jahre hatten Riwal und Nolwenn dem Kommissar das Erlernen des Bretonischen dringend nahegelegt, auch unter professionellen Gesichtspunkten: Ohne Kenntnisse der uralten keltischen Sprache sei auch in der bretonischen Gegenwart kein Kriminalfall zu lösen. Rund 250000 Menschen seien ihrer noch mächtig, und dies nur in der Bretagne bretonnante, der westlichen Bretagne. Geschlagene fünfzehn Montagabende hatte er in dem stickigen Seminarraum des Espace culturel über den alten Markthallen Concarneaus zugebracht. Immerhin: Die sieben Mitschülerinnen und Mitschüler waren allesamt äußerst sympathisch gewesen. Dupin hatte sich sogar ein wenig mit einem pensionierten Feuerwehrmann angefreundet, der kurz davor war, noch einmal zu heiraten, eine Bretonin »pur beurre«, die auf einer bretonischen Vermählungs-Zeremonie bestand. Zu dem Kurs hatte ein kompaktes Miniatur-Büchlein gehört, Le Breton en 5 minutes par jour, so der programmatische Titel. Es war nach Themen respektive Situationen geordnet, die das glückliche bretonische Dasein beschrieben: »Mit den Freunden feiern«, »Essen« (ein umfassendes Kapitel), »Trinken« (ein noch umfassenderes Kapitel), »Seinen Senf zu etwas geben«, »Das Wetter diskutieren«, »Zustimmen und widersprechen« (die urbretonische Tugend: das Revoltieren). Seitdem streuten Nolwenn und Riwal noch häufiger als ohnehin schon bretonische Wendungen ein. Ken emberr – »bis gleich«.
»Ist doch eine schöne Idee«, hatte Claire angemerkt, und eigentlich hatte sie recht. Eigentlich. Dupin hatte sich erst einmal um überlebenswichtige Sätze gekümmert: Kafé am bo, mar plij, »Einen café bitte«, und Gwelloc’h eo ganin ur banne gwin, »Ich nehme ein Glas Wein«. Zwei Sätze, mit denen man eine Sprache bereits elementar beherrschte.
Mittlerweile hatten sie den Dorfplatz erreicht.
»Hier entlang«, wies ihn Le Menn an, die anscheinend genau wusste, wohin sie mussten. »Hausnummer fünf. Da vorne links.«
Dupins Telefon klingelte.
Claire.
»Ja?«
»Ist alles okay bei dir, Georges?«
Eine tiefe Beunruhigung lag in ihrer Frage.
»Ja. Warum?«
»Madame Claudel hat mich eben angerufen. Sie hat etwas von einem Toten in Concarneau erzählt. An unserem Strand. Du hättest ihn aus dem Meer gezogen. Sie war völlig aufgelöst. Sie vermutet einen Mord. Jetzt hat sie sich in ihrem Haus eingeschlossen, weil der Täter bestimmt noch frei herumlaufe.«
Dupin seufzte. Die Nachbarin hatte anscheinend etwas gründlich missverstanden. Er berichtete, was wirklich geschehen war. Auch dass sie es tatsächlich mit einem Mord zu tun hatten. Aber nicht bei ihnen am Strand in Concarneau.
»Gut, Georges. Ich habe jetzt eine dringende Intervention.«
Schon hatte sie aufgelegt.
Dupin schüttelte kurz den Kopf.
Zwei Minuten später klingelten Le Menn und er an der Tür eines alten reetgedeckten Steinhauses, das von üppigen Hortensien umgeben war, lila, pink, blau, rot. Kurz ging Dupin durch den Kopf, dass er, nass, wie er immer noch war, ein seltsames Bild abgeben würde. Aber es war egal. Eigentlich sah er nie aus wie ein »echter« Kommissar.
Es dauerte eine Weile, bis sich im Haus etwas regte. Merkwürdige Geräusche drangen nach draußen.
Die Tür öffnete sich sehr langsam. Vor ihnen stand ein kleiner, gebeugter Mann, Dupin schätzte ihn auf Mitte, Ende achtzig, der sich zitternd auf eine Gehhilfe stützte.
»Ja?«
Eine klare, feste Stimme, der nichts von der offensichtlichen Gebrechlichkeit anhaftete. Nur freundlich hatte sie nicht geklungen.
»Monsieur Provost? Jean Provost?«
Dupin wollte sichergehen.
»Wen erwarten Sie sonst hier, Monsieur?« Die linke Hand rutschte vom Griff der Gehhilfe, Dupin fürchtete kurz, Provost könne stürzen, aber der Mann fing sich wieder. »Was wollen Sie?«
Als möglicher Täter, das stand schon jetzt fest, schied Jean Provost aus.
»Commissariat de Police Concarneau, dürfen wir reinkommen, Monsieur?«
Es war keine Mitteilung, die man zwischen Tür und Angel machte.
»Warum?«
»Eine ernste Angelegenheit, Monsieur.« Dupins Betonung unterstrich seine Worte. Und zeigte anscheinend Wirkung.
»Na gut.«
Provost drehte sich und die Gehhilfe mühsam um und bewegte sich schweigend und langsam durch den kargen Flur in ein schummriges Zimmer, das das Wohnzimmer zu sein schien. Ramponierte Holzdielen. Es roch nach Schmierseife, zitronig, Dupin kannte den Geruch. Jemand war vor nicht allzu langer Zeit zum Putzen da gewesen. Der alte Mann steuerte auf ein schmales Sofa zu, neben dem ein einziger, mit dem gleichen abgewetzten dunkelgrünen Stoff bezogener Sessel stand. Kurz davor blieb Provost abrupt stehen und wandte sich ihnen zu. Er machte weder Anstalten, sich zu setzen, noch, ihnen einen Platz anzubieten.
»Also?«
Es klang immer noch nicht freundlicher.
»Vielleicht setzen Sie sich besser?«, fragte Le Menn mit besorgter Miene.
»Wir haben eine sehr traurige Nachricht, Monsieur.« Dupin kamen die Sätze und ihr grausamer Inhalt mit einem Mal ganz irreal vor. »Ihr Neffe, Patric Provost, ist tot. Er ist heute Morgen vermutlich hier im Hafen Opfer eines Gewaltverbrechens geworden.« Er setzte kurz ab. »Wir möchten Ihnen unser tiefstes Beileid aussprechen, Monsieur.«
Der Kommissar hatte den Blick fest auf das Gesicht des alten Mannes gerichtet.
Zunächst wirkte es so, als hätte Jean Provost die Sätze gar nicht gehört. Oder nicht verstanden. Seinen Zügen war keine Reaktion anzumerken. Regungslos starrte er den Kommissar an.
»Monsieur Provost, geht es Ihnen gut?« Le Menn war es nicht geheuer.
Immer noch keine Reaktion.
Dupin hatte in seiner Laufbahn schon viele Gespräche dieser Art führen müssen, und doch war es jedes Mal aufs Neue schrecklich. Er hatte in solchen Momenten die unterschiedlichsten Reaktionen erlebt.
»Monsieur Provost, wir werden alles tun, um dieses Verbrechen schnellstmöglich aufzuklären und den Täter zu fassen. Eventuell können Sie uns dabei helfen.«
Jean Provosts Augen hatten sich geweitet.
»Wie ist er gestorben?« Seine Stimme war unverändert. Fest und klar.
»Er wurde erdrosselt und anschließend ins Meer geworfen. Seine Leiche hat sich in den Leinen einer Boje im Hafen verfangen. Nicht weit von der Kaimauer. Ein Fischer hat sie da entdeckt.«
Es war grausam. Aber die Wahrheit. Und die Hinterbliebenen mussten die Wahrheit kennen, immer. Noch schlimmer als die Realität waren die Fantasien, die sich sonst einstellten.
Wieder blieb der alte Mann stumm. Dupins Augen hatten sich mittlerweile an das Zwielicht gewöhnt.
»Ihr Neffe war gestern Abend bei Ihnen, haben wir gehört. Zu Ihrem Geburtstag.«
Dupin sprach mit sanfter Stimme.
Jean Provost schob die Gehhilfe zur Seite, dann machte er ein paar kleine vorsichtige Schritte zum Sofa und setzte sich. »Ja.« Sein Blick ging Richtung Fenster, aber eigentlich ins Leere.
»Haben Sie beide den Abend hier verbracht, Monsieur?«, wollte Le Menn wissen.
»Wir gehen immer ins Restaurant. Er hat mich hier abgeholt. Es ist nicht weit.«
»Welches Restaurant?«, setzte Le Menn nach. »Les Trois Mâts?«
Sie waren gerade daran vorbeigekommen, es lag an dem kleinen Platz. Dupin kannte es. Eine Institution. Der alte Mann bewegte zustimmend den Kopf. Es war schwer, sich vorzustellen, wie er es bis dahin geschafft hatte. Und zurück.
»Wie lange waren Sie im Restaurant?«
»Bis halb zehn. Dann hat Patric mich nach Hause gebracht und ist gegangen. Er übernachtet immer auf seinem Boot.«
»Kannte Patric Provost hier in Doëlan oder der Gegend außer Ihnen noch andere Leute?«
»Nein. Nicht dass ich wüsste. Er lebt auf seiner Insel, verlässt sie selten.«
Seine Stimme hatte mittlerweile an Kraft verloren.
»Sie wissen von niemandem, mit dem er hier eine Verabredung hätte haben können?«
Le Menn ließ nicht locker.
»Nein.«
»Hat er Ihnen etwas erzählt, das in einem Zusammenhang mit der Tat stehen könnte?«
»Was meinen Sie?«
»Von einem Streit, einem Konflikt, irgendwelchen Querelen?«
»Er hat von seinen Schafen erzählt. Seiner Zucht. Ein bisschen über Bonaparte. Wir reden nie viel.«
»Bonaparte?«
»Er«, ein Stocken, »er verehrt Napoleon. Und weiß viel über ihn. Ein Tick.«
»Er hat Ihnen also von keiner Auseinandersetzung erzählt?«
Ein entschiedenes Kopfschütteln.
»Worüber haben Sie noch gesprochen?«
»Die Hitze. Dass sie schlimm für die Schafe ist.«
»Noch etwas?«
Jean Provost sah die junge Polizistin ratlos an.
»Wirkte er in irgendeiner Weise ungewöhnlich auf Sie? Nervös, ängstlich, sorgenvoll, abgelenkt?«
Die Ratlosigkeit in seinem Blick nahm zu.
»Gar nicht.«
»Hat er Ihnen gesagt, wann er heute früh zurückfahren wollte?«
»Nein. Aber er fährt immer ganz früh.«
»Hat er Familie auf der Belle-Île? Gibt es Angehörige?«
Dupin würde sie so schnell wie möglich verständigen müssen, was hieß: persönlich aufsuchen. Bevor die Nachricht sie auf anderem Wege erreichte.
»Er ist allein.«
»Verstehe. Geschwister? Leben die Eltern noch?«
»Nein.«
»Das heißt, es gibt niemanden. An Familie, meine ich. Niemanden außer Ihnen.«
Es waren traurige Sätze.
»Nur mich.«
Jean Provosts Blick war leer.
»Und Freunde? Wissen Sie von Freunden?«, komplettierte Le Menn die Fragen.
Kopfschütteln.
»Andere soziale Kontakte?«
»Nein.«
»Und Sie?«
Dupins Nachfrage war zu unbestimmt.
»Ich meine – leben Sie allein?«
Eigentlich war es offensichtlich.
Jean Provost nickte schwach.
»Können wir etwas für Sie tun, Monsieur?«
Der alte Mann schaute den Kommissar unsicher an.
»Die Nachricht muss ein schwerer Schock für Sie sein. Haben Sie einen Hausarzt, den wir rufen sollen?«, kam Le Menn Dupin zu Hilfe.
»Ich brauche nichts.«
»Wer versorgt Sie?«
»Elise. Meine Hilfe. Sie kommt um elf.«
Das war nicht allzu lange hin.
»Was wissen Sie vom Leben Ihres Neffen auf der Belle-Île, Monsieur?« Dupin kam zu den Sachfragen zurück.
»Nicht viel. Sein Leben ist die Schafzucht. Außerdem gehört ihm viel Land. Und Häuser.«
»Wie kommt das?«
»Wir sind Acadiens. Die ganze Familie. Patrics Vater war der Älteste. Er hat alles geerbt. Nach seinem Tod dann Patric.«
»Acadiens?«
Dupin hatte noch nie davon gehört.
»Die alteingesessenen Familien der Insel.«
»Aber Ihr Teil der Familie hat die Insel verlassen?«
»Meine Eltern. Vor meiner Geburt. Mein Bruder, Patrics Vater, ist dann zurück auf die Insel.«
»Was wissen Sie über Patrics Unternehmen?«
»Ich glaube, es läuft gut.«
»Handelt er mit Immobilien?«
»Sicher nicht.«
»Wo wohnt er auf der Insel?«, übernahm Le Menn wieder.
»In einem abgelegenen Weiler.«
»Hat er ein Haus dort?«
»Ja.«
Dupin wurde unruhig. Von Jean Provost würden sie für den Moment nicht mehr erfahren. Außerdem mussten sie weiter, Riwal und die anderen warteten auf dem Boot auf sie.
»Nur noch eine allerletzte Frage, Monsieur. Wissen Sie, was mit dem Erbe Ihres Neffen passiert? Der Schafzucht, dem Land, den Immobilien?«
»Keine Ahnung.«
»Hat er Ihnen gegenüber nie von einem Testament gesprochen? Oder darüber, dass Sie bedacht würden im Falle seines Todes?«
»Das hätte er nie getan. Über sein Testament zu sprechen.«
»Gut.«
Dupin würde einen der Gendarmen aus Quimperlé bitten, später noch einmal bei Provost vorbeizugehen.
»Dann danken wir Ihnen für Ihre Hilfe, Monsieur. Wenn Ihnen noch etwas einfallen sollte, das für uns von Interesse sein könnte, melden Sie sich jederzeit. Ich lasse Ihnen eine Karte da.«
Le Menn legte sie auf den kleinen Beistelltisch neben dem Sofa.
»Au revoir, Monsieur«, verabschiedete sich Dupin, es war ein warmherziges »Au revoir«.
Der merkwürdig gleichförmige, in der Sonne grell aufscheinende Nebel lag wie eine dämonische weiße Schlange im schmalen Tal der Ria. Er nahm sich hier noch mysteriöser aus als über dem offenen Meer. Zwar waren seine Grenzen nicht ganz so scharf gezogen wie an der Küste, dennoch hielt er sich auch hier im Wesentlichen an den Lauf des Wassers. Und verschluckte, was sich auf ihm befand: die zahlreichen, im Sommer wie dekoriert über die gesamte Meeresbucht verteilten Motorboote, Segelboote, Zodiacs und die kleinen bunten Plastikbeiboote an den verwaisten Bojen.
Le Menn war zum Hafenbüro zurückgegangen, um dort die Stellung zu halten. Einer der Gendarmen aus Quimperlé hatte Dupin zu Kadeg begleitet, der sie gegenüber dem Quai de Kernabat mit einem absurd kleinen neongrünen Beiboot erwartet hatte. Es war, wie kurz die Strecken auch sein mochten, bereits der zweite Bootsausflug in diesem Fall. Kein gutes Zeichen. Vom Ufer aus hatten sie Patric Provosts Boot nicht ausmachen können, nicht mal Konturen, der Nebel schien hier noch undurchlässiger. Es waren auch keine Stimmen zu vernehmen, weder die von Riwal noch die von Nevou.
Dupin hatte sich auf dem Weg zu Kadeg ein zweites Mal mit Nolwenn ausgetauscht. Sie hatte Provosts genauen Wohnort ausfindig gemacht, Islonk, ein winziger Weiler, bestehend aus sieben Häusern, im Südwesten der Insel, und sogar bereits die Nachbarn identifiziert. Sie würde Dupin eine Liste schicken. Ansonsten war über Patric Provost nicht viel herauszufinden. Keine Einträge im Polizeiregister und nur ein paar kleinere Zeitungsmeldungen, in denen es um seine Schafzucht ging. Offenbar war sie die größte der Insel, mit einer Dependance auf dem Festland, bei Carnac, und einer weiteren auf Hoëdic – einem der beiden Inselchen östlich der Belle-Île. Über Provost persönlich war in den Artikeln allerdings nichts zu erfahren. Selbstdarstellung schien nicht seine Sache gewesen zu sein. Nolwenn hatte zudem bereits einmal kurz mit der Gendarmerie in Le Palais, der kleinen Inselhauptstadt, gesprochen, der Brigade territoriale autonome de Palais. Und zwar mit dem Kommandanten höchstpersönlich. Er musste informiert sein – und noch wichtiger: Mit seiner Hilfe würden sie an weitere Informationen über Provost kommen.
Die Presse – in Person des alten Donal und der spindeldürren Drollec, den beiden Star-Redakteuren von Télégramme und Ouest-France, mit denen Dupin, im Prinzip, auf gutem Fuß stand – hatte von dem Fund der Leiche bereits Wind bekommen. Anscheinend waren sie schon am Hafen. Noch wussten sie nicht, dass es sich um einen Mord handelte. Doch das war nur eine Frage der Zeit. Lange würde sich die Nachricht nicht unter Verschluss halten lassen. Natürlich würden die beiden mit dem Hafenmeister sprechen, oder er mit ihnen, und dann um eine polizeiliche Bestätigung bitten. Der ja auch gar nichts im Wege stand. Sie hatten es schließlich mit einem Mord zu tun, so war es nun mal. So wenig das ins idyllische Doëlan und den prächtigen Sommer passte, geschweige denn in die touristische Hochsaison.
»Salut, Chef.«
Riwals Stimme kam aus dem Nichts.
Dupin drehte sich jäh zur Seite. Er musste sich orientieren, sie waren erst ein paar Meter in die dichten Schwaden vorgedrungen. Kadeg tat ein paar kräftige Schläge. Dann, mit einem Mal, sah Dupin ein Boot, so nah, dass die Kollision kaum mehr zu verhindern war. Intuitiv hob er sein Ruder wie zum Kampf und stieß sie ein Stück ab. Ein Motorboot. Dupin schätzte es auf neun oder zehn Meter, groß genug für eine behagliche Schlafkabine.
»Hier ist nichts Besonderes zu entdecken, Chef.« Riwal stand direkt über ihnen an der Reling. »Nichts Verdächtiges. Nichts, was auf eine Gewalttat hindeutet. Keine Spuren eines Kampfes. Alles unauffällig.« Er klang enttäuscht.
Kadeg und Dupin erreichten das Heck, wo sich neben dem Motor eine Stufe und eine Tür in der Reling befanden.
»Wir haben auch kein Seil, keine Leine, kein Tuch gefunden, nichts, womit der Mord geschehen sein könnte. Womit auch immer die Tat begangen wurde, der Täter hat es mitgenommen oder verschwinden lassen.«
Dupin erhob sich vorsichtig, wobei das Boot schaukelte, als wäre er aufgesprungen, griff nach der Reling und tat einen beherzten Schritt auf die mit Holz verkleidete Stufe im Heck.
»Sie werden nichts Interessantes finden«, empfing ihn Nevou. »Weder hier oben noch unten in der Kabine. Das ist ein Job für die Spurensicherung. Im Zweifelsfall kontaminieren wir den Tatort nur. Wenn es überhaupt auf dem Boot passiert ist.«
Dupin nickte abwesend.
Sie befanden sich auf dem Hinterdeck des Bootes, direkt am Steuerhaus. Vor der Reling stand eine weiße Plastikbank, auf der ein abgetragener Sonnenhut und eine Flasche Wasser lagen. Dupin öffnete die Plexiglas-Schiebetür des Steuerhauses und trat ein. Wie immer bei Schiffen dieser Bauart diente es auch als Küche, Mini-Esszimmer und Salon. Zu seiner Linken sah er eine gepolsterte, in maritimem Blau gehaltene Sitzbank, einen Tisch aus hellem Holz, rechts eine funktionale Küchenzeile und vorne, erhöht, den Steuersitz und das Steuer selbst. Alles wirkte erstaunlich großzügig, was auch an den Panoramafenstern lag. Ganz anders als bei seinem Freund Henri und allen anderen Bootsbesitzern, die Dupin kannte, fehlten hingegen die meist wild über die Kabine verteilten Gegenstände, Bücher, Lesebrillen, Zeitungen, Sonnencremetuben, Pullover. Hier war alles ordentlich aufgeräumt, es wirkte unpersönlich. Zwei penibel gefaltete Karten. Eine sorgfältig über den Steuersitz gehängte Jacke. Ein einzelnes leeres Glas in der kleinen Spüle.
Die beiden Inspektoren und Nevou waren draußen geblieben. Sie wussten, dass es das Beste war, Dupin machen zu lassen, nach seiner Fasson.
Dupin öffnete vorsichtig den Kühlschrank: eine kleine Bierflasche, 1664, eine halb leere Flasche Rosé. Mehr gab er nicht her. Für Exzesse reichte das nicht, Provost schien ein moderates Leben geführt zu haben. Dupin verließ das Steuerhaus und begab sich in die untere Kabine des Bootes. Auch diese wirkte geradezu großzügig. Ein Bett in der Mitte, sicher einen Meter vierzig breit. Das Kopfkissen lag am linken Rand der Matratze, die Decke war zurückgeschlagen. Es sah aus, als wäre Provost eben erst aufgestanden. Und als hätte er keine Zeit gehabt, nach dem Aufstehen das Bett zu machen, was er, wenn man sich das Boot so ansah, sonst sicher getan hätte. Am Kopfende lag eine akkurat gefaltete Tagesdecke auf einer Ablage. In den Schränken befanden sich eine Hose, ein paar T-Shirts und Unterwäsche. Eine Schiebetür führte in ein praktisches Miniatur-Bad. Zahnbürste, Zahnpasta, Duschgel, Handtuch. Vielleicht war der Täter am frühen Morgen an Bord gekommen und hatte Provost direkt überwältigt. Ein plausibles Szenario, wenn auch im Moment vollkommen spekulativ.
Eine Minute später war Dupin zurück auf dem Deck, er blieb in der Schiebetür stehen.
»Wir haben gerade vom meteorologischen Dienst gehört«, rapportierte Kadeg, »dass sich der Nebel so gegen vier, fünf Uhr morgens gebildet hat. Schlagartig. Wie schon die letzten Tage. Wenn es auf dem Boot passiert ist, hat der Täter im Schutz des Nebels operieren können.«
Dupin hatte sich schon bei der Ankunft umgeschaut. Mögliche Nachbarboote waren bei dem Nebel nicht zu sehen. Und auch die Leiche hätte von hier aus, zumal um diese frühe Uhrzeit, unbemerkt Richtung Meer treiben können. Die auslaufenden Strömungen der Ria kamen auf acht bis zehn Stundenkilometer.
»Auf den meisten Booten im Umkreis hat niemand übernachtet«, komplettierte Kadeg seinen Bericht, »es sind eher kleinere Boote, von Leuten aus dem Ort. Das nächste, auf dem jemand geschlafen hat, liegt rund fünfzig Meter entfernt. Eine Familie mit zwei kleinen Kindern. Und dort hat niemand irgendetwas Verdächtiges bemerkt.«
»Ihren höchsten Punkt hat die Flut um 3 Uhr 05 erreicht«, erklärte Riwal, »seitdem läuft das Wasser ab. Vor fünf Minuten hat die Ebbe ihren Tiefststand erreicht, langsam kehrt der Atlantik zurück.«
Alles passte zusammen.
»Wann knöpft sich die Spurensicherung das Boot vor?«
»Jetzt gleich, Chef.«
»Fahren wir zurück aufs Festland.« Dupin bewegte sich auf die Tür im Heck zu. Er hatte es plötzlich eilig. Kadeg folgte ihm. Er würde sie mit dem neongrünen Beiboot nur nacheinander übersetzen können.
Kadeg und Dupin saßen gerade, einer Havarie abermals nur knapp entgangen, als Dupins Handy klingelte.
Nolwenn.
»Ja?«
Kadeg begann zu rudern.
»Ich habe gerade länger mit zwei der Gendarmen der Inselbrigade gesprochen. Und noch mal mit dem Kommandanten Kir Cosqueric, dem Provost natürlich ein Begriff ist. Ein Gendarm wohnt zwei Weiler weiter. Wie es aussieht, war unser Opfer äußerst unbeliebt. Und das nicht bloß bei einem oder zwei seiner Zeitgenossen, sondern offenbar bei allen, die ihn kannten. Provost war wohl das, was man ein, ich zitiere, ›Ekel‹ nennt.«
»Ein Ekel?«
»Ein echtes Scheusal, ja. Provost hat offenbar alle Welt gegen sich aufgebracht. Der Gendarm sagte, auf der Insel könnte eigentlich so gut wie jeder der Mörder sein. Einige würden ihn richtiggehend hassen.«
Das war immerhin mal etwas Neues.
»Wenn der Täter überhaupt von der Insel kommt.«
»Hat Cosqueric einen speziellen Verdacht?«
Auch Kadeg verstand sich aufs Manövrieren, sie waren bereits am Ufer angekommen.
»Nein, das nicht. Aber er weiß von allerhand Konflikten Provosts mit allen möglichen Leuten. Wenn auch von keiner konkreten Eskalation in letzter Zeit.«
»Wissen Sie etwas über die Erbverhältnisse?«
»Nein. Aber ich weiß bereits, wer sein Notar ist. Er sitzt in Vannes. Ich kümmere mich drum.«
»Sehr gut.«
»Ein Mord ist es trotzdem«, stellte Nolwenn trocken fest, »auch wenn er ein Ekel war.«
»Allerdings«, sagte Dupin geistesabwesend. Er versuchte, so aus dem Boot zu steigen, dass es nicht noch im letzten Moment kenterte.
»Soll ich Goulch schicken? Soll er Sie fahren?«
»Fahren?«
Dupin hatte es bisher erfolgreich verdrängt: Wenn sie auf die Belle-Île wollten, würden sie ein Boot benötigen. Was auch immer er sich einfallen lassen würde, es würde keinen glaubhaften »dringlichen polizeilichen Grund« für einen Hubschraubereinsatz darstellen, und den brauchte es, um den Aufwand und die Kosten für einen solchen Flug zu rechtfertigen. Goulch war ein erfahrener Kapitän der Wasserschutzpolizei Concarneaus. Auf seinem Boot, der stolzen Bir, bretonisch für Pfeil, war der Kommissar schon das ein oder andere Mal unterwegs gewesen. Nicht dass er sich mit Goulch auf dem Meer plötzlich wohlgefühlt hätte, im Gegenteil, er hatte es auch auf der Bir gehasst, dennoch: wenn, dann nur mit Goulch.
»Ich denke darüber nach, Nolwenn. Bis später. Ich melde mich.«
Nur keine übereilten Aktionen jetzt. Er musste in Ruhe einen Plan machen.
»Eine Sache noch, Monsieur le Commissaire. Bei Ihnen im Viertel an der Corniche herrscht ziemliche Unruhe, es wird erzählt, es hätte einen Mord gegeben. Jemand sei ertränkt worden. Und der Mörder sei auf der Flucht.«
Dupin klärte die Sache mit Madame Claudel auf.
»Bis später, Nolwenn.«
»Ken emberr.«
Dupin legte auf.
»Kadeg, sagen Sie allen Bescheid. In fünf Minuten im Les Trois Mâts. Ich will mit jemandem sprechen, der gestern Abend im Restaurant gearbeitet hat.«
»Geht klar.«
Die Terrasse des Les Trois Mâts