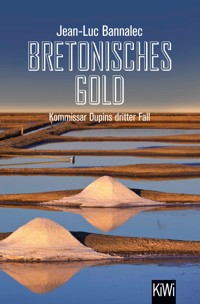10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Dupin ermittelt
- Sprache: Deutsch
Ein tödliches Familiengeheimnis, rätselhafte Vorfälle und ein schwerverletzter Inspektor Kadeg – ein Fall, der Dupin und sein Team bis ins Mark erschüttert. Während auch noch im Oktober die Sonne vom Himmel strahlt und die Nächte lau sind, ereilt Inspektor Kadeg ein schwerer Schicksalsschlag. Seine Lieblingstante stirbt. Doch damit nicht genug. Der Inspektor wird auf ihrem Anwesen angegriffen und lebensgefährlich verletzt. Dupin und sein Team sind zutiefst bestürzt und suchen fieberhaft nach möglichen Gründen für die Tat. Schon bald häufen sich die Merkwürdigkeiten. Was hat es mit den sensationellen Vogelsichtungen an der Côte des Légendes auf sich, die Kadegs Tante kurz vor ihrem Tod notierte? Und welche Geheimnisse verbergen die anderen Familienmitglieder? Im wilden bretonischen Norden, zwischen rauem Atlantik und betörenden Apfelwiesen, entwickelt sich ein vertrackter und höchst persönlicher Fall für Commissaire Dupin. Der 11. Band der erfolgreichen Bretagne-Krimi-Reihe entführt die Leser in eine Welt voller Rätsel, regionaler Eigenheiten und kulinarischer Köstlichkeiten. »Trotz des raschen Tempos der Ermittlungen bleibt […] genug Raum für die Schilderungen der Bretagne und ihrer eigenwilligen Einwohner – Bannalec liebt beide offenbar sehr. Und er beschreibt so schön, dass sich der Leser wünscht, selber Bretone zu sein.« Westdeutsche Zeitung In den fesselnden Geschichten von Jean-Luc Bannalec um Kommissar Dupin in der Bretagne findet man die perfekte Urlaubslektüre: Durch humorvolle Erzählkunst und ein Auge für das lokale Umfeld lässt Bannalec seine Leser die frische Atlantikbrise der Bretagne förmlich riechen. Die Krimi-Bestseller aus der Bretagne sind in folgender Reihenfolge erschienen: - Bretonische Verhältnisse - Bretonische Brandung - Bretonisches Gold - Bretonischer Stolz - Bretonische Flut - Bretonisches Leuchten - Bretonische Geheimnisse - Bretonisches Vermächtnis - Bretonische Spezialitäten - Bretonische Idylle - Bretonische Nächte - Bretonischer Ruhm - Bretonische Sehnsucht - Bretonische Versuchungen Die Bücher erzählen eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 364
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Jean-Luc Bannalec
Bretonische Nächte
Kommissar Dupins elfter Fall
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Jean-Luc Bannalec
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Jean-Luc Bannalec
Jean-Luc Bannalec ist der Künstlername von Jörg Bong. Er ist in Frankfurt am Main und im südlichen Finistère zu Hause. Die Krimireihe mit Kommissar Dupin wurde für das Fernsehen verfilmt und in zahlreiche Sprachen übersetzt. 2016 wurde der Autor von der Region Bretagne mit dem Titel »Mécène de Bretagne« ausgezeichnet. Seit 2018 ist er Ehrenmitglied der Académie littéraire de Bretagne. Zuletzt erhielt er den Preis der Buchmesse HomBuch für die deutsch-französischen Beziehungen.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Kommissar Dupins elfter Fall: geheime Gärten, seltene Vogelarten, viel Cidre und grandiose Landschaften.
Während der bretonische Sommer auch im Oktober frohgemut weitermacht, die Sonne vom Himmel strahlt und die Nächte lau sind, ereilt Kadegs Familie ein schwerer Schicksalsschlag. Seine 89-jährige Tante verstirbt, nachdem sie von einer Reihe »Vorzeichen des Todes« heimgesucht wurde. Doch damit nicht genug, Kadeg wird auf ihrem Anwesen lebensgefährlich angegriffen.
Kommissar Dupin und sein Team sind bis ins Mark erschüttert und suchen auf dem Gelände der geschichtsträchtigen ehemaligen Abtei, die Kadegs Tante bewohnte, nach möglichen Gründen für die Tat. Bald mehren sich die Merkwürdigkeiten. Was hat es mit den sensationellen Vogelsichtungen an der Côte des Légendes auf sich, die Kadegs Tante kurz vor ihrem Tod notiert hat? Und welche Geheimnisse verbergen die anderen Familienmitglieder?
In einer der rausten und atemberaubendsten Gegenden der Bretagne, im hohen Norden, zwischen großen Meeresarmen, wildem Atlantik und betörenden Apfelwiesen entwickelt sich ein vertrackter und höchst persönlicher Fall.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2022, 2024 Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln
Covermotiv: © shutterstock-andre quinou
ISBN978-3-462-32084-8
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses Zusatzmaterial ist auch auf unserer Homepage zu finden:
www.kiwi-verlag.de/magazin/extras/die-karten-zu-bretonische-naechte
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
Der erste Tag
Der zweite Tag
Dupin liebte die Corniche. ...
»Sie müssen über die ...
Der dritte Tag
Der vierte Tag
Dank
À L.
Gant amzer en em gav taouledet
Avaloù ha pennoù kalet.
Mit der Zeit werden Äpfel und harte Köpfe weich.
Bretonisches Sprichwort
Der erste Tag
»Vorzeichen des Todes, eindeutig. Intersignes de la mort.«
Kadeg, Inspektor des Commissariat de Police de Concarneau, setzte eine dramatische Miene auf. Seine Stirn war sorgenzerfurcht.
»Die Elster fliegt schon eine ganze Zeit lang ums Haus. Ab und zu setzt sie sich aufs Dach.« Der dramatischen Miene folgte eine dramatische Pause. »Vor ein paar Wochen fing ein Hahn an, vor Mitternacht zu krähen. Schließlich hat meine Tante ein Wiesel im Garten gesehen. – Und letzte Woche ist die Elster dann auch noch gegen die Scheibe des Schlafzimmerfensters geflogen.«
Ein Vibrieren lag in Kadegs ungewöhnlich matter Stimme.
»Eindeutig«, wiederholte er, »Vorzeichen des Todes.«
»Reichen Sie mir doch mal das Baguette, Riwal«, wandte sich Kommissar Georges Dupin an seinen ersten Inspektor.
Der Kommissar hatte eine assiette de la mer bestellt, ein herrliches Essen an heißen Tagen; ein Dutzend Austern, dazu ein riesiger Krebs, langoustines, eine ansehnliche Portion kleiner und großer Meeresschnecken, bigorneaux und bulots. Und das Wichtigste: frische hausgemachte Mayonnaise. Paul, der Besitzer des Amiral, Dupins zweites Zuhause in der »Blauen Stadt« am Meer, hatte ihm sicher ein halbes Pfund davon auf den Tisch gestellt. Nussessig, behauptete Paul, sei das Geheimnis ihres sensationellen Geschmacks. Wie auch immer, Dupin war verrückt nach dieser Mayonnaise. Nach Meeresfrüchten ohnehin. Andere Völker, Barbaren allesamt, verunglimpften Mayonnaise als fettigen Bestandteil des fast food, in Frankreich hingegen verstand man sie als das, was sie war: Kunst. Schon Paul Bocuse hatte sie gefeiert, wie alle göttlichen Köche. Eine Spezialität mit Geschichte, industriell verhunzt wie wenige andere. Kreiert wurde sie 1756, im Siebenjährigen Krieg. Maréchal Richelieu höchstpersönlich nahm mit seinen Truppen Menorca ein. Als Dank erhielt er weder Medaille noch Landgüter, sondern man widmete ihm eine neu erfundene Soße, eine exquisite Köstlichkeit, die nach der letzten eingenommenen Stadt benannt wurde: Maó, spanisch Mahón, die sauce mahon-naise. Die Bretonen waren sich sicher: Der Koch war einer von ihnen gewesen, es konnte gar nicht anders sein. – Das Beste war, den Teller am Ende mit einem Stück Baguette auszuwischen, auf dem sich die Reste der Mayonnaise mit den Aromen der Meeresfrüchte vermischten. Ein marines Elixier.
»Sie sollten diese Vorzeichen unbedingt ernst nehmen, Chef.« Riwal machte keine Anstalten, Dupin den Brotkorb herüberzureichen.
Die vier Kollegen hatten es sich auf der Terrasse des Amiral gemütlich gemacht. Riwal und Kadeg an einem Tisch, Dupin und Nevou, eine der beiden Polizistinnen des Kommissariats, am Tisch daneben.
»Die Elster gilt als Todesvogel.« Riwal war spürbar unbehaglich zumute. »Es sind tatsächlich alles klassische Vorzeichen. Man kennt sie seit Tausenden Jahren. Uraltes keltisches Wissen.«
»Bekomme ich trotzdem etwas Baguette?«, versuchte Dupin erneut sein Glück.
»Commissaire, das ist kein Witz.« Nevou strafte Dupin mit einem grimmigen Blick.
Dupin seufzte laut. Er hatte sich den ganzen Morgen auf diese Dreiviertelstunde Mittagspause gefreut. Auf die Meeresfrüchte, die Mayonnaise, das Baguette, ja, auf die Zeit für sich. Ganz allein. Ohne andere Menschen. Dafür mit den obligatorischen Zeitungen, Ouest-France, Le Télégramme und Le Monde.
Entgegen allen meteorologischen Prophezeiungen war das Wetter erneut sagenhaft schön geworden, sodass sich die Kollegen Dupin spontan angeschlossen hatten, als er das Kommissariat verließ. Er hätte den Hinterausgang nehmen sollen, so wie er es nicht selten tat.
Es war der erste Oktober, doch der Sommer schien beschlossen zu haben, frohgemut weiterzumachen, so als wäre nichts. Als hätte es keinen Herbstanfang gegeben. Bereits die letzten Jahre waren September und Oktober lupenreine Sommermonate gewesen, bis Anfang November gar, dann erst war das Wetter umgeschlagen. Niemand beschwerte sich.
Der Kommissar setzte sich so aufrecht, wie es ging. Als Zeichen seiner Ernsthaftigkeit und Konzentration.
»Gut. – Und was soll das alles heißen?«
»Meine Tante ist sich sicher, dass sie bald sterben wird.«
Dupin erkannte Kadeg nicht wieder. Eigentlich war der Inspektor die Verkörperung unerträglicher Pedanterie, militärischer Zackigkeit, vor allem aber pragmatischer Nüchternheit, was ihn gleichwohl, bedauerlicherweise, nicht davon abhielt, sich gelegentlich in die eine oder andere fixe Idee zu verrennen. Normalerweise gehörten Phänomene wie »Vorzeichen des Todes« zu Riwals Interessen. Und Kadegs Rolle bestand darin, sich darüber lustig zu machen.
Seltsame Vorkommnisse, Erscheinungen des vielgestaltigen Übernatürlichen, die anderswo als außergewöhnlich angesehen werden mochten, waren in bretonischen Sphären ganz gewöhnlich. Auch für Nolwenn – offiziell Dupins Assistentin, inoffiziell »die Chefin«, wie es sich im Kommissariat irgendwann durchgesetzt hatte – war Übernatürliches eine ganz selbstverständliche Sache.
»Ich will ja nicht sagen, so ist es«, Riwal blickte Kadeg voller Mitgefühl an, »aber so ist es.«
Kadeg war kein Mann, der seine Gefühle zeigte, aber nun saß er vor ihnen wie ein Häuflein Elend.
»Wie alt ist Ihre Tante?«, wollte Nevou wissen.
»Neunundachtzig. Dabei noch ganz rüstig. Und völlig gesund. – Ihre Mutter ist achtundneunzig geworden.«
Riwal nickte: »Gesundheit spielt für den Tod keine Rolle.«
Dupin lag ein scharfer Protest auf der Zunge. Wenn sie »völlig gesund« war – warum sollte die alte Dame jetzt plötzlich sterben? In der Bretagne gab es nicht wenige Hundertjährige. Und die Gene hatte sie offenbar.
Dupin verkniff sich den Protest. Es wäre müßig. Er kannte die Geschichten von den »Vorzeichen des Todes«, sie waren zahllos. Und mitunter ganz alltäglich, was ihnen, so empfand es Dupin, etwas Komisches verlieh. Fast alles konnte den Tod ankündigen, den allmächtigen Ankou. Zum Beispiel, wenn nachts die Hunde heulten oder wenn in Kirchen Kerzen erloschen, wenn man von Pferden träumte – es sei denn von weißen –, man plötzlich Tränen in den Augen hatte oder von einem jähen Schauder ergriffen wurde. Besonders bedenklich: wenn Geschirr hinfiel und dabei zerbrach. Anscheinend galten die Zeichen nur in bestimmten Konstellationen – ansonsten würde jeder Bretone täglich Ankündigungen seines nahen Todes sehen und die Bretagne wäre eine menschenleere Gegend. Dupin selbst wäre ein hundertfach toter Mann. Außerordentlich hinterhältig war auch jenes Vorzeichen: wenn im Haus drei Lichter zugleich an waren. Dann nämlich, hieß es, stehe ein besonders schmerzhafter Tod unmittelbar bevor. Nur wenige der Vorzeichen, fand Dupin, hatten einen überzeugend mysteriösen Charakter. Etwa wenn man morgens mit wachsgelben Flecken auf den Händen aufwachte. Oder, vielleicht noch unwahrscheinlicher: wenn man im Traum jemanden mit einem großen Bündel schmutziger Wäsche herumlaufen sah.
»Vielleicht gehen Sie mal mit Ihrer Tante zum Arzt, Kadeg. Nur vorsichtshalber.« Dupin sprach mit sanfter Stimme, erkennbar um Empathie bemüht.
Nevou, Riwal und Kadeg starrten Dupin fassungslos an.
»Wenn es ihr Tod sein soll, dann ist es ihr Tod. Daran können Sie überhaupt nichts ändern«, klärte Nevou ihn auf. »Niemand kann das. Auch kein Arzt.«
Es klang wie »vor allem kein Arzt«. Riwal nickte bedächtig.
»Haben Sie Ihre Tante in letzter Zeit besucht?«, fragte Dupin.
»Am Sonntag – gestern.« Kadeg stockte. »Sie nimmt nach und nach Abschied.«
Was seine Zeit dauern würde. Dupin wusste nicht viel über Kadegs Tante, wohl aber, dass sie Oberhaupt des beachtlichen Familienclans der Kadegs war. Der Inspektor hatte seine Eltern früh verloren, ein Autounfall, er war gerade achtzehn gewesen. Er hatte mit einem Mal allein klarkommen müssen. Seine Tante, die Schwester seiner Mutter, hatte sich um ihn gekümmert. Überhaupt schien sie die Familie zusammenzuhalten. Wenn Dupin die zahlreichen Geschichten in den letzten zehn Jahren richtig gedeutet hatte, hing Kadeg sehr an ihr. Sie lebte im hohen bretonischen Norden, bei Aber Wrac’h, an einem der drei großen legendären Abers, wie sie an der Nordwestküste des Finistère hießen – Flüsse, die sich zu Meeresarmen weiteten. Der Tante gehörte eine ehemalige mittelalterliche Abtei samt einem Park, dem ehemaligen Abteigarten.
»Ich verstehe.« Es kam Dupin ein wenig makaber vor. »Ich meine, es tut mir sehr leid«, fügte er rasch hinzu. »Das mit Ihrer Tante.«
Nevou, Riwal und Kadeg bedachten den Kommissar abermals mit einem missbilligenden Blick. Dupins Satz hatte ein bisschen wie »Herzliches Beileid« geklungen.
»Noch ist sie nicht tot«, protestierte Kadeg. »Sie …«
»Möchte jemand einen café?«, rettete Paul den Kommissar. »Ach, und die neuen Äpfel sind da. – Ich habe eine ofenwarme Tarte mit köstlichen Reinettes d’Armorique.«
Eine der Dutzenden bretonischen Apfelsorten.
»Unbedingt«, schoss es aus Dupin hervor. »Und einen café.«
»In Ordnung.« Paul nickte.
»Für mich auch, bitte.« Riwals Augen leuchteten. Die Ankunft der neuen Äpfel gehörte zu den 365 kulinarischen Feiertagen des bretonischen Jahres. Und Riwal kannte sämtliche bretonischen Apfelsorten, die alten, die neuen, die zum Backen, die für Kompott … Auch Dupin mochte Äpfel – auf der Tarte goldbraun karamellisiert –, aber noch mehr den ultradünnen Teig unter ihnen.
»Für mich ebenfalls«, sagten Kadeg und Nevou gleichzeitig.
»Kadeg, wie steht es eigentlich um die Lieferung der Cinémomètres jumelles laser?« Dupin musste die Chance ergreifen und sicherstellen, dass sie nicht mehr auf Kadegs Tante zurückkamen. »Und die neuen Éthylotests waren doch auch für den Oktober angekündigt, oder?« Er mimte einen engagierten Tonfall.
Neue Hightechgeräte zur Geschwindigkeitskontrolle und für Alkoholtests. Beides waren Themen, denen sich Kadeg geradezu leidenschaftlich widmete.
»Ich erwarte sie spätestens Ende des Monats.« Augenblicklich war Kadeg bei der Sache. Und wieder fast der Alte. »Sie katapultieren uns direkt in die Zukunft, Commissaire. Die Präzision der neuen Lasertechnologien erreicht unvorstellbare …«
»Was ist mit unseren Passagenschwimmern, Nevou?«
Weitere Lobpreisungen der technischen Innovationen waren nicht nötig, es war Dupin nur um die Ablenkung gegangen.
Seit ein paar Tagen machte sich eine Gruppe Jugendlicher den Spaß, nachts in der Passage zu schwimmen, den hundert Metern Meer zwischen den beiden Stadthälften Concarneaus, der Ville Close und dem östlichen Teil der Stadt. Zweimal am Tag strömten die gigantischen Wassermassen des Atlantiks durch die Passage in den großen Hafen der Stadt hinein und wieder heraus. Concarneau besaß einige Kilometer Küste und nicht wenige traumhafte Strände, jeder durfte schwimmen, wo er wollte, nur hier, wo die Boote ein- und ausfuhren, war Schwimmen strengstens verboten. Es kamen viele Boote, Tag und Nacht. Der besondere Kick beim Schwimmen durch die Passage bestand darin, gegen die mächtige Strömung anzukämpfen. – Nevou hatte sich der Sache angenommen, mit ein paar Anwohnern gesprochen, um die Gruppe zu identifizieren. Eigentlich war es eine Petitesse. Aber eben eine gefährliche.
»Hab ich geklärt.«
»Was heißt das?«
»Ich weiß, wer da mitmacht, und habe mit zwei der Jugendlichen gesprochen.« Sie rieb sich übers Kinn und fügte hinzu: »Ich denke, sie haben verstanden.«
Dupin hatte keinen Zweifel.
»Und Riwal? – Was liegt für Sie heute noch an?«
»Das wissen Sie doch, Chef. – Die Fortsetzung des Gesprächs mit Madame Docteur.«
Dupin wusste es, natürlich. Er hatte es bloß vergessen. Verdrängt. Weil es zu absurd war. Vorgestern früh hatten sie einen Anruf vom Hauptpostamt erhalten. Ein Päckchen, das zur Auslieferung angekommen war, hatte über Nacht in der Post gelegen und am Morgen penetrant seltsam gerochen. Mehr noch: Die ganze Post hatte danach gestunken. Ein Postbeamter hatte eine gute Nase bewiesen – verdächtig gut – und war sich sofort sicher gewesen: Cannabis. Und er hatte recht gehabt. Dreißig Gramm schlecht verpacktes Cannabis. Anschließend hatte nicht die Post, sondern die Polizei, genauer gesagt: Le Menn und Riwal, das Paket ausgeliefert. Ein wenig außerhalb, Richtung Fouesnant. Die Empfängerin des Päckchens war die pensionierte Stadtarchivarin, eine »Madame Docteur«, Historikerin. Le Menn und Riwal hatten bei ihrem Besuch höflich auszudrücken versucht, dass die Sache illegal sei und man Anzeige erstatten müsse. Die ausgesprochen fröhliche Siebzigjährige hatte nicht im Ansatz verstanden, warum. Sie bestelle die »Medizin« seit zehn Jahren und immer beim selben bretonischen Hersteller, fait en Bretagne. Noch nie habe jemand etwas einzuwenden gehabt. Sie hatte dann dringend zu einem Friseurtermin gemusst, und man hatte sich auf eine Fortsetzung des Gesprächs am heutigen Nachmittag geeinigt. Fluchtgefahr bestand keine.
Dupin selbst hatte um fünfzehn Uhr einen Termin, der nicht weniger absurd war.
Ein Professor des weltberühmten Instituts für Meeresbiologie in Concarneau hatte das Gefühl, verfolgt zu werden. Seit drei Wochen. Letzten Mittwoch hatte der Wissenschaftler, ein Pariser um die vierzig, unangekündigt im Kommissariat gestanden. Und von einem Mann in einem blauen Seemannspullover berichtet, der ihm nachstelle. Ein Pullover, wie ihn Zehntausende Bretonen besaßen, auch Dupin. Und unzählige Touristen. »Ungefähr so groß wie Sie«, hatte die weitere Aussage des Professors gelautet. Und: »Überhaupt ähnelt er Ihnen, muss ich sagen. Bloß mit weißen Turnschuhen.« Dabei hatte der Professor den besagten Mann immer bloß aus der Ferne gesehen. Beim Verlassen des Instituts war der Mann ihm angeblich bis nach Hause gefolgt, rund zehn Minuten zu Fuß. Gestern dann – der Professor hatte Dupin heute früh angerufen – wollte er ihn beim Verlassen seines Hauses gesehen haben. Er arbeite durchaus an etwas Geheimem, hatte der Professor zu Protokoll gegeben, aber jede weitere Auskunft verweigert. Dupin wusste, dass das Institut, das erste meeresbiologische Institut der Welt, den Geheimnissen des Atlantiks, seiner Tiere und Pflanzen, auf der Spur war. Und dass diese in der Tat ungeheure Möglichkeiten boten. Auch Claire wies ab und zu mit einer bedeutungsschweren Geste aufs Meer: »Da liegen die Lösungen für all unsere Probleme. Nicht bloß dass wir dort herkommen, so wie alles Leben auf der Erde – das Meer kann uns auch retten.« Wobei sie grimmig hinzufügte: »Verdient haben wir die Rettung eigentlich nicht, so wie wir uns benehmen.«
»Nach dem Gespräch mit Madame Docteur übernehme ich eine Schicht«, komplettierte Riwal, seine Züge hellten sich auf.
»Sehr gut.« Dupin nickte. Bei der »Schicht« ging es um die Überwachung einer Bootsbaustelle. Um die Abwehr von Industriespionage. Seit vier Jahren baute der Segler François Gabart – weltweit einer der Großen des Segelsports und stolzer Concarnois – sein neues Superboot: einen Trimaran der »Classe Ultime«. Zweiunddreißig Meter lang. Ein aerodynamisches Wunder. Die ganze Stadt fieberte beim Bau mit. Jetzt war es fast fertig, im nächsten Jahr würde Gabart damit die Transatlantikregatta bestreiten. Die Farbe des Bootes war ein patriotisches Bekenntnis: ein blaues Boot für die blaue Stadt. Zwei Polizisten waren abgestellt, um auf der Baustelle nach dem Rechten zu sehen, eigentlich reichte das – aber Riwal liebte den Job. So wie er Boote liebte. Und François Gabart.
»Et voilà.« Paul war zurück. Mit den cafés – und der Tarte. Stille trat ein, jeder genoss das Dessert für sich.
Im Hafenbecken der Ville Close – der auf einer Insel gelegenen Altstadt Concarneaus – veranstaltete die Sonne ein unruhig funkelndes, grelles Spektakel, das die gesamte Welt überbelichtete und in einen diffusen Lichtschleier packte. Von der typisch frühherbstlichen Milde des Lichts war nichts zu merken.
»Ja?«
Bärbeißiger hatte ein Ja wahrscheinlich noch nie geklungen.
Es war halb eins. Nachts.
Dupin lag im Bett. Claire lag neben ihm. Sie schlief längst. Seit zehn schon, sie war spät und todmüde aus der Klinik gekommen, hatte das Omelette heruntergeschlungen, das Dupin zubereitet hatte, rasch geduscht, war – ein abendliches Ritual – ans Fenster getreten, um aufs Meer zu schauen, und dann ins Bett gefallen.
Schon bald hatte Dupin sich neben sie gelegt und gelesen. Eine verrückte Geschichte, Freya von den sieben Inseln, Claire hatte ihm das Buch geschenkt. Aber in Wahrheit hatte er Claire beim Schlafen zugesehen. Er mochte das. – Eigentlich hatte er mit ihr letztes Wochenende wegfahren wollen. Eine Überraschung. Er hatte ein Zimmer gebucht, im Hotel Ty Mad in Tréboul, ein Juwel am Ende vom Ende der Welt, es gehörte seiner Freundin Armelle. Alles hatte gepasst. Mit Armelles Hilfe hatte er ein prächtiges Picknick organisiert, in einer versteckten Bucht. Im warmen Sand zwischen mächtigen, vom Meer gerundeten hellen Steinen. Das war jedenfalls Dupins Plan gewesen. Dann war Claires Kollege krank geworden. Und sie hatte das Wochenende durcharbeiten müssen. Als Ausgleich würde sie nun morgen und übermorgen freihaben – wovon sie gemeinsam nichts haben würden, gar nichts.
Dupin hatte Claire an dem Wochenende fragen wollen. Endlich. Es wäre perfekt gewesen.
»Er – er steht draußen vor der Tür. Er hat versucht, einzudringen. Glaube ich.« Dupin hatte die Stimme des Meeresbiologen erkannt. Der Professor klang panisch.
»Was heißt das, Monsieur?« Dupin war hellwach.
»Ich habe gesehen, wie sich die Türklinke bewegt hat. – Er will ins Haus.«
»Sind Sie sich sicher? Ich meine, dass sich die Türklinke bewegt hat?« Dupin flüsterte. Er wollte Claire nicht wecken.
»Fast sicher. – Es war dunkel. Und selbstverständlich habe ich das Licht nicht angemacht.«
Dupin hatte sich im Bett aufgesetzt.
»Da war jemand vorm Haus. Ich versichere es Ihnen. Er ist auf und ab gegangen.«
»Und es war der Mann, von dem Sie denken, dass er Sie in letzter Zeit verfolgt hat?«
Ein kurzes Zögern, dann: »Mit abschließender Gewissheit kann ich das nicht sagen.«
Großartig. Schon bedauerte Dupin, dem Professor seine Handynummer gegeben zu haben. Es war als Beruhigung gedacht gewesen.
»Sind Sie allein zu Hause, Monsieur?«
»Meine Frau ist auch da. Sie schläft.«
»Können Sie die Person vom Fenster aus erkennen?«
Es war eine sternenklare Nacht, zudem beinahe Vollmond. Die Welt war in solchen Nächten alles andere als dunkel.
»Wenn ich ans Fenster trete, sieht er mich doch.«
»Vermutlich weiß die Person, dass Sie sich im Haus befinden.«
Wenn da überhaupt eine Person war.
»Ich will nur …«
Ein Knacken.
»Hallo? – Professor?«
Das Gespräch war abgebrochen.
»Hallo? Hallo?« Dupin flüsterte nun ganz und gar nicht mehr.
»Georges? Was ist los?«
Jetzt hatte er Claire doch geweckt.
Schläfrig drehte sie sich zu ihm.
Dupin stand auf.
»Alles in Ordnung, Claire, schlaf weiter. Ich muss kurz einer Sache nachgehen. – Bin gleich wieder bei dir.«
»Okay.«
Sie drehte sich um.
Dupin war erleichtert, sie schien sofort wieder einzuschlafen.
Er ging ins Badezimmer und schloss vorsichtig die Tür hinter sich, dann machte er das Licht an und wählte die Nummer des Professors.
Nichts.
»So ein Scheiß.«
Missmutig verließ Dupin das Bad, holte leise ein paar Sachen aus dem Kleiderschrank und lief zur Treppe. Unten machte er das Licht an und versuchte es noch einmal bei dem Professor.
Auch dieses Mal ohne Erfolg.
»Na gut«, seufzte er.
Er streifte sich seine Sachen über, Jeans, Polohemd. Wählte dabei Riwals Nummer.
Der Inspektor nahm augenblicklich ab.
»Was ist passiert, Chef?«
»Höchstwahrscheinlich gar nichts. – Dieser Professor vom Institut. Er glaubt, dass sich der Mann, der ihn verfolgt, vor seinem Haus rumtreibt. Er hat mich gerade angerufen. – Die Verbindung ist plötzlich abgebrochen.«
»Und Sie erreichen ihn nicht mehr?«
»Nein. – Ich fahre kurz vorbei, Riwal.«
»Völlig richtig, Chef. Sie wissen, dass das Institut ein paar spektakulären Dingen auf der Spur ist …«
»Ist gut, Riwal.«
»Ich komme mit, Chef. Der Professor wohnt in meiner Nähe.«
»Gut.« Dupin hatte den Autoschlüssel schon in der Hand. »Dann treffen wir uns dort.«
»Übrigens, haben Sie es schon gehört, Chef?«, setzte Riwal nach.
Dupin öffnete die Haustür.
»Was denn?«
Dupin lief durch den Garten und die laue Nacht.
»Sehr traurig, Chef.«
Es waren sicher immer noch siebzehn Grad.
»Kadegs Tante. – Sie ist gestorben. So schnell ist es gegangen.«
»Was?«, rief Dupin, viel zu laut.
»Ihre Nichte hat sie heute Abend um halb acht gefunden. Auf der Terrasse, im Liegestuhl. – Wohl ihr Lieblingsplatz. Dort ist sie friedlich entschlafen. Kadeg hat eben angerufen.«
»Heute Abend?«
»Heute Abend, ja. Der Dorfarzt hat den Tod festgestellt. Plötzlicher Herztod. ›Altersherz‹. Ein Bestatter aus Brest hat sie bereits abgeholt. Kadeg ist unterwegs dorthin.«
Dupin erreichte seinen Wagen, stieg ein und startete den Motor.
»Das tut mir sehr leid zu hören. Ich rufe Kadeg morgen an.«
»Sie hat es ja gewusst. Die Zeichen waren eindeutig. – Und so ist es nun gekommen.«
»Ich denke nicht, dass …«
Dupin brach ab. Zugegebenermaßen schien es ein eigentümlicher Zufall. Dass sie gerade erst heute Mittag über Kadegs Tante und die Vorzeichen des Todes gesprochen hatten – und sie nun, keine zwölf Stunden später, tatsächlich tot war. Aber selbstverständlich gab es das: Menschen, die spürten, dass ihr Tod nahte. Mit Übernatürlichem hatte das nichts zu tun.
»Bis gleich, Riwal.«
Dupins Citroën machte einen energischen Satz nach vorn.
Um 3 Uhr 15 legte sich Dupin ein zweites Mal in dieser Nacht ins Bett.
Er war hellwach.
Es war ein rundum grotesker Einsatz gewesen, er hätte es wissen müssen.
Weit und breit war niemand zu sehen gewesen. Kein Verdächtiger, kein Unverdächtiger. Keine Spur eines Verfolgers.
Und der jähe Abbruch der Verbindung und dass der Professor danach nicht mehr zu erreichen gewesen war, hatte die banalste aller Erklärungen gehabt: ein leerer Akku.
Riwal war damit beschäftigt gewesen, mit einer seiner gigantischen Taschenlampen den Garten des Professors abzusuchen, als Dupin eingetroffen war. Ohne irgendetwas Auffälliges zu finden. Anschließend hatten Dupin und Riwal dann zusammen die Straße vor dem Haus und die nähere Umgebung in Augenschein genommen. Zuletzt hatten sie noch einmal ausführlich mit dem Professor gesprochen, der unverändert darauf beharrte, jemanden vor dem Haus gesehen zu haben. Er hatte verlangt, dass sie Fingerabdrücke von der Haustürklinke nahmen, und war erst zu beruhigen gewesen, als sie ihm zugesichert hatten, am nächsten Morgen jemanden vorbeizuschicken.
Claire hatte gar nicht gemerkt, dass Dupin zurück ins Bett gekrochen war. Schlief sie einmal, dann schlief sie tief und fest. Dupin beneidete sie darum.
Er griff nach seinem Buch und folgte Freya abermals auf die sieben Inseln.
Der zweite Tag
Dupin liebte die Corniche.»Seine« Corniche. Wo Claire und er seit ein paar Jahren wohnten. Das westliche Stück der Küste Concarneaus, in der Nähe des großen Strands Sables Blancs. Mit den kleinen Sandbuchten inmitten heller Granitwelten, feinem, blendend weißem Sand, der einen irren Kontrast zu den zahllosen Türkis- und Blautönen des Meeres und dem morgenfrischen Himmelblau bildete. Die großzügige, von mächtigen Palmen gesäumte Promenade, den weit ins Meer reichenden Quai Nul.
Wie jeden Morgen im Sommer war er nach dem Aufstehen und einem sofortigen café schwimmen gewesen. Nach dem Duschen und einem zweiten café stand er nun neben seinem Wagen. Wie immer würde er auf dem Weg ins Kommissariat einen kurzen Zwischenstopp im Amiral einlegen. Für ein croissant oder pain au chocolat, je nachdem, das entschied die Laune, und für einen dritten café, dieses Mal mit einer ernst zu nehmenden Maschine gebrüht.
Gleich war es acht.
Auch heute, am zweiten Oktobertag, trumpfte der Sommer unverhohlen weiter auf, dabei war es wunderbar frisch, jetzt am Morgen. Eine noch ganz unverbrauchte Welt.
Die nächtliche Szene mit dem Professor kam Dupin mittlerweile so vor, als hätte er sie geträumt.
Er hatte sich auf dem Fahrersitz seines Citroëns niedergelassen, als der penetrante Ton seines Handys anhob.
Es war Nolwenn.
»Ja?«
»Wo sind Sie, Monsieur le Commissaire?«
»Was ist passiert?«
Etwas stimmte nicht, Dupin hörte es sofort.
»Kadeg – er wurde niedergeschlagen«, Nolwenn sprach tonlos, »im Garten seiner Tante, gestern Nacht. Er …«
»Was?«
Dupin erstarrte.
»Jemand hat ihn …«
»Wie geht es ihm?«
»Nicht gut. – Aber es ist nicht lebensgefährlich. Er wurde seitlich am Kopf getroffen. Rechts. Das Ohr sieht wohl übel aus. Er …«
»Wo ist er?«
»In Brest, Klinik Pasteur-Lanroze.«
»Ich fahre hin.«
Dupin hatte den Motor gestartet. Er gab Gas.
»Wir kommen auch. Riwal ist bereits unterwegs. Ich rufe Kadegs Frau an, sie weiß es schon. Die Arme.«
»Wie ist es dazu gekommen?«
»Wir wissen noch gar nichts, Monsieur le Commissaire, der Anruf kam gerade erst. Der Gärtner von Kadegs Tante hat ihn im Park ihres Anwesens gefunden. Stark lädiert, Kadeg war nur halb bei Bewusstsein.«
»Was hat Kadeg denn überhaupt da gemacht?«
»Das wissen wir nicht, er war zuvor beim Bestattungsinstitut. Wir gehen davon aus, dass er so gegen 23 Uhr 20 in Aber Wrac’h angekommen ist, er hat den Bestatter um 22 Uhr 50 verlassen. Es sind rund dreißig Minuten Fahrt. – Der Arzt sagt, Sie können später mit Kadeg sprechen. Er wird noch untersucht. Sie machen ein CT vom Kopf.«
»Wer ist vor Ort? In Aber Wrac’h, im Haus der Tante?«
»Vier Gendarmen aus Lannilis.«
»Ich möchte, dass alles großflächig abgesperrt wird. Das Haus, der Garten. Alles. – Und ich will den Gärtner sprechen.«
»Natürlich.«
»Und«, Dupin dachte nach, »und diese Nichte, die die Tante gestern gefunden hat. – Kadegs Cousine, nehme ich an.«
»Klar.«
»Gut. – Wir sehen uns in Brest, Nolwenn.«
»Bis gleich.«
Dupin hatte den Kreisverkehr am Ende der Corniche erreicht, jetzt ging es den Hügel hinauf, Richtung Route Nationale, er trat das Gaspedal bis zum Anschlag durch.
»So ein Scheiß«, entfuhr es ihm.
Kadeg sah elend aus.
Der Kopf war verbunden, um das rechte Ohr ein dicker Verbandsknubbel. Im linken Arm steckte eine Infusionsnadel, daran ein Schlauch. Riwal stand am Kopfende des Bettes, er war selbst ganz bleich.
Der verantwortliche Arzt hatte neben der erheblichen Wunde am oberen Ohr und an der Kopfhaut eine »schwere Kommotio« diagnostiziert. Gehirnerschütterung. Eine vorläufige Diagnose. Insgesamt, hatte der Arzt ein paarmal mit ernster Miene wiederholt, habe Kadeg großes Glück gehabt. »Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Als schweres Schädel-Hirn-Trauma.« Zudem hatte er von einem Schock gesprochen. Und tatsächlich wirkte Kadeg im Innersten erschüttert.
»Er … er muss schon da gewesen sein.« Kadeg sprach langsam, leise, die Stimme brüchig. »Irgendwo da bei den Bäumen, im Gebüsch. – Es war dunkel. Ich meine, bei ganzem Vollmond hätte ich ihn vielleicht gesehen. Aber …« Er brach ab.
Kadeg hatte die Sätze bereits ein halbes Dutzend Mal in unterschiedlichen Formulierungen wiederholt. Als könnte er den Angreifer vielleicht doch noch entdecken, wenn er es bloß ein weiteres Mal erzählte. So verhielt es sich mit Traumata: Das Gehirn spielte die traumatische Situation unendlich durch, in der unsinnigen Hoffnung, sie doch noch abwenden zu können.
»Er hat einfach zugeschlagen. Auf einmal, aus dem Nichts. Ich meine, ich weiß es nicht, ich kann mich nicht erinnern. Ein Ast, ein Brett vielleicht. Es ist wie ausgelöscht. Ich glaube, ich war manchmal ein bisschen wach, aber ich weiß es nicht mehr. – Es hat sich alles gedreht.«
»Der Arzt sagt, er sei wahrscheinlich zunächst länger bewusstlos gewesen und dann in eine Art Dämmerschlaf gefallen«, ergänzte Riwal.
Kadeg lag in einem der üblichen Krankenhausbetten. Wobei man sich hier, in der renommierten Klinik Pasteur-Lanroze im Norden Brests, Mühe gab, selbst den Betten ein lebendiges, nicht ganz so steriles Design zu geben. Das Kopfende des Bettes war in einem Algengrün verkleidet, das sich als Farbe auch im Nachttischschränkchen wiederfand. Der Wand hinter dem Bett hatte man ein beruhigendes Bordeauxrot verliehen. Nolwenn hatte ein »Chambre grand confort« für Kadeg ergattert – so hieß es tatsächlich –, was bedeutete: Es gab eine Sitzecke mit einem Sessel, einen imposanten Fernseher und – so stand es in der Beschreibung – »Gourmetverpflegung«.
»Sie haben wirklich überhaupt gar nichts von dem Angreifer sehen können?« Auch Dupin konnte nicht anders, als die Frage in unzähligen Varianten zu wiederholen.
»Nein.«
»Warum sind Sie gestern Nacht noch nach Aber Wrac’h gefahren, Kadeg?«
Dupin hatte begonnen, auf dem hellgrünen Linoleumboden des Zimmers hin und her zu laufen.
»Ich …« Kadeg stockte. »Nachdem ich meine Tante beim Bestatter so habe liegen sehen … Ich meine … Ich hatte es gar nicht geplant. – Es war ein Bedürfnis. Ich …«
Er hielt inne.
Dupin verstand das Bedürfnis gut. Das Zuhause der Menschen, Wohnungen, Häuser, in denen sie lange gelebt hatten, war weit mehr als Wände und ein Dach. Nach einer Zeit nahm es etwas von den Menschen selbst an. Als hätten sich ihr Geist und ihre Seele dort ausgebreitet, nirgendwo sonst blieben Verstorbene so präsent.
»Wie gesagt. Ich habe etwas gehört. Glaube ich. Geräusche. Ich meine, als ich auf der Terrasse war.« Auch diesen Teil der Geschichte hatte Kadeg schon mehrmals erzählt. »Bei den Apfelbäumen am Wald. Da kamen die Geräusche her, glaube ich. Ich habe laut gerufen, dass ich von der Polizei bin.«
Das war eine wichtige Information, die den Vorfall noch gravierender machte: Der Täter hatte gewusst, dass Kadeg Polizist war. Der Täter war bereit gewesen, einen Polizisten schwer zu verletzen, vielleicht sogar zu töten. Kopfverletzungen konnten immer den Tod bedeuten.
»Ich bin dann …«
»So, jetzt genügt es wirklich.«
Der hochgewachsene junge Arzt, der eben bereits auf ein baldiges Ende des Gesprächs gedrängt hatte, war auf leisen Turnschuhsohlen aufgetaucht und unterbrach Kadeg.
»Der Patient braucht jetzt dringend Ruhe.« Er trat an die Infusionsvorrichtung. »Wir werden die Kortisontherapie nun ein wenig reduzieren, sie putscht sehr auf. Dann wird er ohnehin keine Lust mehr auf Konversation verspüren. – Das Liebste wäre mir, er schliefe jetzt.«
Der Arzt hatte recht. Und mehr würden sie im Moment von Kadeg ohnehin nicht erfahren.
»Es sind übrigens drei Kolleginnen von Ihnen eingetroffen«, sagte er zu Dupin. »Sie warten vor dem Haupteingang, soll ich Ihnen ausrichten.«
Nolwenn, Nevou und Le Menn.
»Danke, Docteur.«
Dupin trat an Kadegs Bett. »Schonen Sie sich, Kadeg. – Wir kümmern uns um diese Sache, das verspreche ich Ihnen.«
Es hatte mehr Pathos in dem Satz gelegen, als Dupin beabsichtigt hatte.
»Und mein aufrichtiges Beileid zum Tod Ihrer Tante.«
Kadeg brachte bloß noch ein schwaches »Danke« hervor.
»Wir kriegen ihn, Thierry.« Riwal war die ganze Zeit nicht von Kadegs Seite gewichen.
Dupin nickte Kadeg zu, dann dem Arzt und verließ das Zimmer.
»Bis ganz bald«, versicherte Riwal seinem Kollegen und folgte Dupin.
Drei Minuten später standen sie mit Nolwenn, Nevou und Le Menn vor der Klinik. Nolwenn verlangte einen detaillierten Bericht.
Riwal gab alles genauestens wieder.
»Mehr hat man beim CT nicht festgestellt?«
»Nein«, sagte Riwal. »Es scheint nur die Gehirnerschütterung zu sein. Er muss eine Woche strikte Bettruhe einhalten. Das Ohr musste genäht werden.«
Dupin hatte begonnen, vor dem Eingang der Klinik auf und ab zu laufen, er spürte, wie die Rage in ihm zunahm und zu gleißender Wut wurde.
Niemand griff seine Leute an.
»Warum attackiert jemand einfach so einen Polizisten?«, empörte sich nun auch Le Menn. »Was könnte die Person um diese Uhrzeit im Park des Anwesens gewollt haben?«
Nolwenn blickte grimmig. »Was immer es ist – da hat jemand etwas wirklich Schlimmes im Schilde geführt.« Ihre Stimme zitterte vor Empörung. »Der Täter war bereit, einen Mord in Kauf zu nehmen. An Kadeg. – An einem Polizisten.«
Nolwenn hatte recht. Mit allem. Bei einem Angriff auf einen Polizisten musste der Täter mit einer noch massiveren Reaktion der Polizei rechnen – der Täter hatte es offenbar in Kauf genommen.
»Vielleicht«, murmelte Nevou, »wollte der Täter ins Haus der Tante eindringen, ist aber durch Kadegs Ankunft davon abgehalten worden. – Wir sollten hinfahren.«
So war es.
»Fahren wir«, gab Dupin den Befehl.
»Ich bleibe hier bei Kadeg. Seine Frau wird gleich eintreffen, sie musste die Zwillinge noch zur Großmutter bringen«, erklärte Nolwenn. »Le Menn, Sie fahren am besten nach Concarneau zurück und halten dort die Stellung.«
Dupin nickte.
»Ich habe Ihnen die Adresse von Kadegs Tante Joëlle Contel geschickt, Monsieur le Commissaire. – Aber das Wichtigste: Bei den Ermittlungen zur Aufklärung der Attacke auf Inspektor Kadeg handelt es sich seit wenigen Minuten offiziell um eine solidarische Kooperation zwischen den Kommissariaten Brest und Concarneau. Es war nicht einfach, ich musste – sagen wir – vehement werden. Aber am Ende war Locmariaquer verständig.«
Der Präfekt. Mit dem Dupin unentwegt auf Kriegsfuß stand. Eine Geißel, vom ersten bretonischen Tag an.
Dupin hatte zwar zwischendurch kurz daran gedacht, dass der Fall eigentlich geografisch nicht in ihrer Zuständigkeit lag, es aber sofort wieder verdrängt. Denn natürlich ging es gar nicht anders, als dass sie ermittelten. Schließlich war Kadeg angegriffen worden.
»Sie sind im Rahmen dieser Untersuchung berechtigt, die Gendarmerie von Lannilis zu befehligen, Commandante Carman und ihre Truppe.«
»Ausgezeichnet.«
Es war wie immer: Nolwenn vollbrachte Wunder. Und das wie nebenbei.
»Das wäre ja noch schöner gewesen. Unser Mann wird überfallen und jemand Fremdes ermittelt …« Nolwenn schüttelte den Kopf.
Dupin eilte zu seinem Wagen, er hatte direkt vor dem Haupteingang geparkt.
»Wir sehen uns dort.«
Es war ein Paradies, wenn auch ein windiges: Aber Wrac’h.
Das Örtchen mit dem kleinen Hafen lag unmittelbar am Meer. Unmittelbar an der Mündung des Abers. Zu beiden Seiten lang gestreckte, zerklüftete Halbinseln, die sich weit ins Meer zogen. Dazwischen, in der breiten Bucht, Dutzende Inselchen und wüste Felsen.
Auch die Abbaye des Anges, die einstige Abtei der Engel, das Zuhause von Kadegs Tante, war ein Paradies. Ein Paradies hinter hohen, uralten Steinmauern aus hellem Granit, ein paar Hundert Meter vom Örtchen entfernt, ebenfalls direkt am Meer gelegen und an einem hübschen langen Sandstrand.
Hinter der ehemaligen Abtei erhob sich ein dicht bewaldeter Hügel. Sanft und harmonisch stieg er an und schirmte die Abtei wie ein gigantischer Wall vom Inland ab. Die gesamte Anlage, das von den Mauern umgebene Reich, sah aus wie hingezaubert. Wie immer hatten die Mönche genau gewusst, wo sie sich niederließen. Wo es am schönsten war. Am sichersten.
Es war eine friedliche Welt, eine himmlische Welt. Eine Idylle. Zumindest bei diesem sagenhaften Sonnenschein, der zusammen mit einem beeindruckend steifen Wind heute auch den Norden der Bretagne regierte. Ein Wind aus Nordwesten, schwer bepackt mit Salz und Jod vom offenen Atlantik. Der Ort hatte eine besonders starke Aura. Dupin lag nichts ferner als Mystizismus, aber so etwas gab es: Orte, an denen man etwas Derartiges spürte. In diesem Fall eine helle, kristalline Aura, eindeutig keine finstere. Aber: Sie war gestört worden. Und zwar ganz empfindlich.
Dupin hatte direkt vor der Mauer geparkt, wo bereits zwei Polizeiwagen standen, zwei Renaults, vermutlich von der örtlichen Gendarmerie.
Dupin war noch nie hier gewesen, überhaupt nur einmal an diesem Stück Küste. In Tréompan.
Der Kommissar bewegte sich auf den Eingang zu, ein Torbogen in der mächtigen vorderen Mauer. Hinter ihr ragte die schlichte, dabei umso imposantere Kirche der Abtei auf. Dupin schätzte die Höhe auf über zwanzig Meter, sie war aus dem gleichen hellen Granit erbaut wie die Mauern. »Bretonische Gotik« – eine eigensinnige Mischung aus Romanik und Gotik. Ein bretonisch spitzes Dach mit in der Sonne glitzernden Schieferplättchen. Ein sehr hohes, schmales Kirchenfenster in einem geheimnisvoll schimmernden Blau.
An die Kirche war ein lang gezogenes Gebäude mit ebenso spitzem Dach angebaut worden. An dieses noch eines, ein Stück flacher – und an jenes noch ein letztes. Man hatte es mit einer Häuserfront von sicher hundertfünfzig Metern zu tun. Das letzte Haus bot gerade so genügend Platz für eine gedrängte erste Etage.
Dupin trat durch den Torbogen in einen Innenhof. Und blieb unwillkürlich stehen.
Es war bloß ein Schritt gewesen, aber es fühlte sich an wie ein Sprung in eine andere Welt, in eine andere Zeit. Als würde die gesamte Anlage unter einer himmelhohen unsichtbaren Kuppel liegen, sich in einer eigenen Sphäre befinden. Im Schutz der gewaltigen Mauern war kein Windhauch zu spüren. Üppige Lavendelbüsche. In einer Ecke stand ein extravaganter Oleander in Orange.
Dupin hatte sehr wenig geschlafen, keine drei Stunden, da konnte einem die Welt schon mal sonderbar vorkommen.
»Hallo?«
Er tat ein paar Schritte in den Hof. Alles befand sich in einem sagenhaften Zustand. Das Haus neben der Kirche hatte eine elegante Eingangstür unter einem reich verzierten Steinbogen. Die Tür aus Holz wies filigrane Verstrebungen auf, in die Glas eingelassen war. Wie die Fensterrahmen war sie in einem matten Minzgrün gestrichen. Rechts und links des Eingangs befanden sich Mauervorsprünge, darauf geschwungene Terrakottatöpfe mit akkurat geschnittenen Buchsbäumchen. Eine mit weißen Flechten bewachsene Steinmauer trennte den Hof vom Park, riesige Hortensienbüsche in Weiß und Altrosa wuchsen an der Mauer. Einzelne hochgewachsene Bäume ragten dahinter in den Himmel. Eine mächtige Pinie wollte noch höher hinaus als alle anderen.
»Hallo?«, rief Dupin erneut. »Ist hier jemand?«
Die Gendarmen mussten ja irgendwo sein. Außerdem sollten der Gärtner und die Nichte mittlerweile eingetroffen sein. Allerdings hatte Dupin bis auf die Polizeiautos keinen anderen Wagen gesehen.
Er schritt auf die elegante Haustür zu. Rechts hing eine Glocke an einer filigranen Messingkonstruktion. Ein kurzes Schiffstau zum Läuten.
Dupin drückte die Türklinke. Abgeschlossen.
Dann läutete er.
»Hallo? – Hier Commissaire Dupin.«
»Hier hört Sie niemand, Chef.«
Riwal war hinter Dupin im Hof erschienen.
»Die Kollegen sind auf der anderen Seite der Abtei, da liegen das Wohnhaus und die Terrasse.« Der Inspektor lief energischen Schrittes voraus. »Ich war schon einmal hier. Mit einer Führung. Es ist zwar tatsächlich alles Privatbesitz, aber Madame Contel war es immer wichtig, diesen außergewöhnlichen Ort allen zugänglich zu machen. Die alte Abtei ist schließlich ein bedeutendes Monument.«
Schweigend passierte Riwal die gesamte Häuserfront und bog hinter dem letzten Gebäude um die Ecke. Normalerweise hätte der Inspektor einen außergewöhnlichen Ort wie diesen mit ellenlangen sachkundigen Einlassungen bedacht. Bestimmt gab es viel zu erzählen. Aber nicht heute.
Sie passierten ein Beet lila blühender Artischocken mit ihrem silbrigen, tief geschlitzten Blattwerk. Dupin war verrückt nach Artischocken, er aß sie am liebsten mit einer selbst gemachten Vinaigrette, Geheimzutat Kerbel, eins der wenigen Rezepte, die er beherrschte.
An der dem Meer abgewandten Seite gelangte man direkt in den Park. Jetzt erst sah man, wie groß diese Anlage hier wirklich war. Der gepflegte Rasen stieg in Richtung Wald an.
»Ich frage mich, ob wir nicht eine Autopsie an Joëlle Contel vornehmen lassen sollten«, brach Riwal sein Schweigen, ohne jedoch sein beachtliches Schritttempo zu vermindern.
»Sie denken, dass es unter Umständen gar kein natürlicher Tod war?«
»Wir sollten nichts ausschließen.«
»Sehen Sie irgendeinen konkreten Grund, Riwal?«
»Nur vorsichtshalber.«
Sie liefen an einem Gebäude vorbei, das aussah wie eine alte Stallung. Eine hohe Mauer mit drei großen Torbogen schloss sich an. Riwal lief unbeirrt geradeaus. Die Bogen gestatteten einen Blick in den großen Innenhof, der von den umliegenden Gebäuden geschützt wurde. Hier schien alle Zeit stehen geblieben, himmlische Ewigkeit regierte. Hohe, elegante Zypressen, wilder Wein, der die Fassade mit knallroten Blättern überwucherte. Man hatte beinahe das Gefühl, in der Toskana oder in der Provence zu sein. Unvorstellbar, dass man sich am Atlantik befand, der hier im bretonischen Norden noch ungleich rauer war als in der Südbretagne. Fuchsien, verschiedene Irisarten, gelb, lila, ein dunkles Rot. Hellblaue Agapanthi. Rosenbüsche. Holunder, verblühter Baldrian. Großzügig bemessene Kräuterbeete, ohne Zweifel mit geheimnisvollsten Gewächsen. Dezent angelegte Wege führten durch das selige Innenreich an einem mit großen Granitblöcken eingefassten Brunnen vorbei. Es gab sogar einen Säulengang.
Sie bogen um die nächste Ecke – und da war sie, die Terrasse. Der Lieblingsplatz von Joëlle Contel, Kadegs Tante. Die Terrasse, auf der sie gestorben und in deren Nähe Kadeg angegriffen worden war. Eine große verwitterte Holzterrasse, direkt vor einem weiteren steinernen Haus.
Hier wartete eine kleine Versammlung. Zwei Gendarminnen, zwei Gendarmen, eine Frau um die fünfzig, schätzte Dupin – die Nichte vermutlich –, ein junges Mädchen und ein weiterer Mann. Wahrscheinlich der Gärtner. Sie standen an einem langen Holztisch.
Eine der Gendarminnen kam mit dynamischem Elan auf Dupin und Riwal zu.
»Commandante Anne Carman. Chefin der zuständigen Gendarmerie aus Lannilis. Ich bin mit den Untersuchungen des Vorfalls von letzter Nacht befasst.«
Erst nach einer kurzen Pause bedachte sie Riwal und Dupin mit einem knappen »Bonjour«.
»Bonjour, Commandante Carman.« Dupin nickte ihr zu.
Riwal brummte nur etwas. Für gewöhnlich war der Inspektor ein ausgesprochen höflicher Mensch.
Die Kommandantin hatte lockiges dunkles Haar, das sie halblang trug, feine, ebenmäßige Gesichtszüge, eine zierliche Figur, die ein wenig verloren wirkte in dem hellblauen Hemd mit den obligatorischen Abzeichen auf den Schultern und der dunkelblauen Hose.
»Was hatte Ihr Inspektor hier mitten in der Nacht verloren?«, wandte sie sich an Dupin. Die Zierlichkeit machte sie mit dem Nachdruck in ihrer Stimme und einer herausfordernden Körperhaltung wett.
»Ein rein privater Besuch. Nichts Dienstliches«, schoss es barsch aus Riwal hervor, der die Frage offenbar als Angriff verstanden hatte. »Unser Kollege ist ein Neffe der verstorbenen Madame Contel.«
»Das ist mir bekannt.«
Dupin versuchte zu vermitteln: »Inspektor Kadeg ist gestern Nacht nach Brest gefahren, zum Bestatter, nachdem seine Tante dorthin gebracht worden war. Gewissermaßen, um sich zu verabschieden. Danach hatte er das Bedürfnis, hierherzukommen. – Er hatte sie am Sonntagabend noch besucht. Hier, in der Abtei. Seine Tante hat ihm viel bedeutet.«
Die Frau, die bei den Gendarmen gestanden hatte, trat auf sie zu.
»Bonjour. Ich bin Sophie Gautier, die Nichte von Joëlle Contel.« Hinter ihr das Mädchen – Dupin schätzte es auf vielleicht sechzehn. »Und das ist meine Tochter Marie.«
»Bonjour, Messieurs«, grüßte das Mädchen höflich.
»Haben Sie Neuigkeiten von Thierry?« Sophie Gautier wirkte tief besorgt. »Er ist mein Cousin«, fügte sie wie zur Erklärung hinzu. »Ich habe nur kurz mit seiner Frau telefoniert. Sie sagt mir Bescheid, wenn Thierry Besuch empfangen kann.«
Es war seltsam. Dupin würde sich daran gewöhnen müssen, dass alle Kadeg beim Vornamen nannten. Er hatte es hier mit Kadegs Familie zu tun.
»Ihr Cousin hat Glück gehabt, Madame.«
»Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Er hat eine schwere Gehirnerschütterung sowie eine erhebliche Verletzung am Ohr erlitten.« Riwal schien mit Dupins knapper Antwort nicht einverstanden zu sein. »Das Ohr wird teilweise chirurgisch rekonstruiert werden müssen.«
»Unser aufrichtiges Beileid zum Verlust Ihrer Tante, Madame Gautier«, kondolierte Dupin. Er hätte es beinahe vergessen.
»Sie waren es, die Joëlle Contel gestern Abend hier gefunden hat?«, kam Riwal übergangslos zur Sache. Eine rhetorische Frage.
»So ist es.« Sophie Gautier drehte sich um und deutete auf einen altmodischen Liegestuhl aus massivem Teakholz, eine dicke dunkelgrüne Auflage. Sie war eine aparte Frau, sonnengebräunt, leuchtend grüne Augen, ein starker Kontrast zum Kastanienbraun der langen Haare. Sie trug eine dunkelblaue Cargohose, ein langärmeliges Shirt, sie wirkte robust und weiblich zugleich. Sie ging zum Liegestuhl und strich mit der Hand liebevoll über die Lehne. »Hier saß sie, wann immer das Wetter es zugelassen hat«, sagte sie traurig.
»Kam Ihnen irgendwas komisch vor, als Sie Ihre Tante gefunden haben, Madame Gautier?«, fragte Riwal.
»Was meinen Sie, Inspektor?« Sophie Gautier wirkte verunsichert.
»Genau das«, antwortete Riwal unbeirrt. »Ob Ihnen irgendetwas auffällig vorkam, als Sie Ihre Tante hier gestern Abend tot aufgefunden haben – das meine ich.«
»Ich …« Sie blickte Riwal an. »Nein, gar nichts. Es war ein Schock. Ich wollte nur noch einmal kurz bei ihr vorbeischauen. Ich … ich kümmere mich um Tante Joëlle. Ich meine«, sie setzte kurz ab, »ich habe mich um Tante Joëlle gekümmert. Ich wohne gleich nebenan, keine dreihundert Meter entfernt.«
»Wir haben uns hier eben alles genau angesehen. Die Terrasse, den Garten, das Wohnhaus«, die Kommandantin machte eine schwungvolle Handbewegung, »es gab überhaupt nichts Auffälliges, Inspektor, nicht das Geringste. – Außerdem, was soll das heißen?«
Sie und Riwal würden keine Freunde werden, das war jetzt schon klar.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: