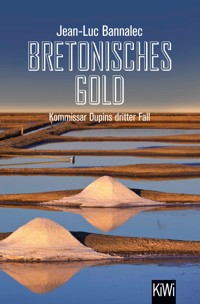10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Dupin ermittelt
- Sprache: Deutsch
Mord à la carte: Kommissar Dupin ermittelt in der Gastronomie-Szene der bretonischen Smaragdküste! Die ersten Sommertage in Saint-Malo, kulinarisches Paradies und einstige Korsarenstadt – was für ein vielversprechender Ausflug für Kommissar Dupin. Doch statt die bretonischen Spezialitäten zu genießen, muss er an einem leidigen Polizeiseminar teilnehmen. Während einer Pause in den Markthallen der Altstadt wird Dupin Zeuge eines schockierenden Verbrechens: Direkt vor seinen Augen ereignet sich ein Mord. Die Täterin, Schwester des Opfers, flieht vom Tatort. Beide Frauen sind berühmte Küchenchefinnen an der malerischen Smaragdküste. Eine heimtückische Mordserie erschüttert die Region und führt Dupin von der Austernstadt Cancale über das mondäne Seebad Dinard bis in die einzigartige Restaurantszene von Saint-Malo. Bei seinen Ermittlungen stößt er auf düstere Familiengeheimnisse, tragische Schicksale und unglaubliche Geschichten. In »Bretonische Spezialitäten«, dem neunten Fall für den eigenwilligen Kommissar, entführt uns Bestseller-Autor Jean-Luc Bannalec einmal mehr in die zauberhafte Bretagne – einem Krimi-Schauplatz voller Geheimnisse, Genüsse und Gefahr. Mit seinen charmanten Kriminalgeschichten rund um Kommissar Dupin aus der Bretagne liefert Jean-Luc Bannalec die perfekte Urlaubslektüre: Mit sanftem Humor und einem Gefühl für die lokale Stimmung versetzt er seine Leserschaft in die sehenswerte Bretagne, wo die Atlantikluft spürbar ist. Die Krimi-Bestseller aus der Bretagne sind in folgender Reihenfolge erschienen: - Bretonische Verhältnisse - Bretonische Brandung - Bretonisches Gold - Bretonischer Stolz - Bretonische Flut - Bretonisches Leuchten - Bretonische Geheimnisse - Bretonisches Vermächtnis - Bretonische Spezialitäten - Bretonische Idylle - Bretonische Nächte - Bretonischer Ruhm - Bretonische Sehnsucht - Bretonische Versuchungen Die Bücher erzählen eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Jean-Luc Bannalec
Bretonische Spezialitäten
Kommissar Dupins neunter Fall
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Jean-Luc Bannalec
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Jean-Luc Bannalec
Jean-Luc Bannalec ist der Künstlername von Jörg Bong. Er ist in Frankfurt am Main und im südlichen Finistère zu Hause. Die ersten neun Bände der Krimireihe mit Kommissar Dupin wurden für das Fernsehen verfilmt und in zahlreiche Sprachen übersetzt. 2016 wurde der Autor von der Region Bretagne mit dem Titel »Mécène de Bretagne« ausgezeichnet. Seit 2018 ist er Ehrenmitglied der Académie littéraire de Bretagne.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
»Der Kriminalfall um die beiden schwesterlich verfeindeten Restaurant-Chefinnen ist stimmig und mit überraschenden Wendungen konstruiert.« Westfälische Nachrichten
»Es gibt Bücher, bei denen man bedauert, wenn man sie zu Ende gelesen hat. Zu diesen gehört der jüngste Band der Krimireihe von Jean-Luc Bannalec.« Fuldaer Zeitung
»Ein hochinteressanter und kniffliger Fall. Spannend, verlockend und überraschend bis zum Schluss.« SR 3
»Jean-Luc Bannalec nimmt seine Leser mit auf eine furiose Verbrecherjagd – und auf eine besondere kulinarische Reise.« Magdeburger Volksstimme
»Auch die neunten Bretagne-Ferien in Krimiform von Bannalec bieten fast so viel Unterhaltung wie ein echter Urlaub an diesem von der Schöpfung bevorzugten Flecken Erde.« Schweizer Familie
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2020, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln
Covermotiv: © Rudolf Linn, Köln, © Arch White/Alamy Stock Foto
ISBN978-3-462-32082-4
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses Zusatzmaterial ist auch auf unserer Homepage zu finden:
www.kiwi-verlag.de/magazin/extras/die-karten-zu-bretonische-spezialitaeten
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
Der erste Tag
Der zweite Tag
Der dritte Tag
Der vierte Tag
Der fünfte Tag
Dank
À L.
À Stefan
Keuz a-raok ne vez ket,
Keuz war-lerc’h ne dalv ket.
Davor bedauern tut man nicht,
Danach bedauern hilft nicht.
BRETONISCHES SPRICHWORT
Der erste Tag
»Ein Stück von dem Brillat-Savarin, bitte.«
Den Bruchteil einer Sekunde hatte er gezögert. Aber Kommissar Georges Dupin vom Commissariat de Police Concarneaukonnte nicht anders. Ihm lief das Wasser im Mund zusammen. Es war einer seiner Lieblingskäse. Ein rarer, himmlischer Weichkäse. Triple crème. Am besten schmeckte er auf einem frischen, knusprigen Baguette, noch ein wenig ofenwarm.
Käse gehörte zu Dupins Grundnahrungsmitteln – er konnte auf vieles verzichten, wenn es sein musste, aber nicht auf Käse. Er kam wahrscheinlich direkt nach Kaffee. Es folgten weitere unverzichtbare Dinge wie Baguette und Wein. Gute Charcuterie. Und selbstverständlich Entrecôte. Und Langustinen. Bei genauerer Überlegung kam ehrlicherweise so einiges zusammen, was den Begriff des Unverzichtbaren streng genommen absurd werden ließ.
Dupin wanderte vor dem Käsestand in den fabelhaften Markthallen von Saint-Servan – einem westlichen Stadtteil von Saint-Malo – auf und ab. »Und ein Stück Langres, bitte.«
In den Hallen herrschte ein reges Treiben, fern aller Hektik. Man spürte die ganz besondere Wochenanfangsstimmung, noch besaßen die Menschen Schwung, das Kommende schien bewältigbar. Der Langres gehörte ebenfalls zu Dupins liebsten Käsesorten, ein orangeroter Weichkäse aus Rohmilch von Kühen der Champagne-Ardenne. Er wurde über Wochen mit Calvados affiniert und hatte einen intensiven, pikant-würzigen Geschmack.
»Und dann noch«, ein gespieltes Zögern, »ein Stück von dem Rouelle du Tarn, bitte«, ein Ziegenkäse aus dem Süden, ausgewogen aromatisch, mit leichten Haselnussnoten.
Dutzende Käsesorten waren in der Auslage zu sehen, neben- und übereinander gestapelt. Käse aus Ziegen-, Schafs- und Kuhmilch, verschiedenste Größen, Formen, Oberflächen, Farben. Das reine Glück.
Auf dem Schild über dem Stand war »Les Fromages de Sophie« zu lesen. Die unterschiedlichen Käse-Aromen lagen in der Luft und vermengten sich mit den vielversprechenden Düften der umliegenden Stände: von frischen Kräutern, bekannten und exotischen Gewürzen, Hartwürsten und Patés, dickbäuchigen Cœur-de-bœuf-Tomaten, Erdbeeren und Himbeeren, getrockneten und kandierten Früchten, unwiderstehlichen Backwaren. Ein Aromen-Orchester aus Herzhaftem und Süßem. Man bekam Appetit, und zwar auf alles.
»Probieren Sie mal von dem hier, Monsieur: von der Ferme de la Moltais, ein bretonischer Tomme. Aus der Gegend von Rennes, auch ein Kuhmilchkäse, mit erstaunlich fruchtigen Nuancen, etwas härter, eine traumhafte Textur. Sie werden sehen.«
Die freundliche junge Frau mit kurzen dunklen Haaren, Brille und einem himmelblauen Tuch um den Hals hielt ihm kurzerhand ein Stück hin. Dupin war schon ohne die Ausführungen der Käseverkäuferin begeistert gewesen – der Anblick alleine hatte gereicht –, aber die Beschreibung machte es noch köstlicher.
»Nehmen Sie schon«, wies ihn eine alte, beeindruckend weißhaarige Dame, die hinter ihm in der Schlange stand, in strengem Tonfall und mit hochgezogenen Augenbrauen an.
»Sie stehen vor einem der besten Käsestände der Stadt, junger Mann! Und wir haben viele davon! – Anscheinend sind Sie nicht von hier.« Es klang wie ein Vorwurf.
Die Dame hatte Dupin treffsicher als »Fremden« ausgemacht, auch wenn der Kommissar keinen blassen Schimmer hatte, warum. Zwar befand er sich hier »hoch im Norden«, am östlichen Rand der Kanalbretagne, nicht weit entfernt von der normannischen Grenze; dennoch gehörte Saint-Malo doch eigentlich vollumfänglich zur Bretagne. Jedoch hatte er bereits an Nolwenns und Riwals erster Reaktion auf seine Mitteilung, dass er für einige Tage zu einem Polizeiseminar nach Saint-Malo gehen würde, bemerkt, dass sich die Sache anscheinend komplizierter ausnahm. Die Stadt musste einen ausgeprägten Sonderstatus besitzen, beide – seine wunderbare Assistentin sowie sein erster Inspektor – waren lediglich ein einziges Mal dort gewesen, an jedem anderen Ort der Bretagne hingegen, so Dupins Eindruck, zahlreiche Male. Zudem, auch dies war ziemlich verdächtig, hatten die umfassenden Ausführungen gefehlt, die Dupin für gewöhnlich zu jedem Fleck der Bretagne vorgetragen bekam, sobald er Concarneau verlassen musste. Dafür waren Nolwenn und Riwal augenblicklich auf das Credo Saint-Malos zu sprechen gekommen, das die selbstbewusste Stadt seit Jahrhunderten prägte: Ni Français, ni Breton: Malouin suis! – Weder Franzose noch Bretone: Einwohner von Saint-Malo bin ich! Malouiner. Zunächst der Textilhandel und dann vor allem die von den französischen Königen legalisierte Piraterie, das Korsarentum, hatten die Stadt zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert märchenhaft reich werden lassen, hatte Riwal knapp erläutert. Reich, mächtig, unabhängig. Aus einer kleinen Stadt war eine verwegene Seemacht geworden, die mit den anderen Seemächten der Zeit auf Augenhöhe agiert hatte. So hatte sich der malouinischeCharakter geformt: siegesgewiss, souverän, stolz. In den Ohren manch anderer – wie Nolwenn und Riwal – klang es wie: hochmütig, überlegen, eingebildet. Außerdem provozierte die eigenwillige, ja unerhörte Behauptung, kein Bretone zu sein, zutiefst. Der andere Teil hingegen, nicht zu den Franzosen zu gehören, weckte wärmste bretonische Sympathien. Die Rebellion gegen alle »Fremdherrschaft«, die unbedingte Liebe zur Freiheit und der trotzige Wille, sie noch um den Preis des Todes zu erkämpfen und zu bewahren, all das war natürlich zutiefst bretonisch, sodass Riwal am Ende seiner ungewöhnlich kurzen Einlassungen zu einem kühnen Paradox gelangt war: dass Saint-Malo eben gerade deswegen, weil es nicht bretonisch sein wolle, eine »ganz besonders bretonische, geradezu urbretonische Stadt« sei. Darüber hinaus hatte er ein denkbar großes Lob ausgesprochen: Die Region stelle – »man muss es fairerweise anerkennen« – das kulinarische Herz der Bretagne dar. »Ein einziges lukullisches Fest! Die gesamte Region wohlgemerkt, Dinard und Cancale eingeschlossen, nicht bloß Saint-Malo.«
»Dieser Tomme wird über zehn Wochen mit geheimen Zutaten veredelt!«, unterbrach die Käseverkäuferin Dupins Gedanken. »Bretonischer Käse ist seit ein paar Jahren gewaltig im Kommen, Monsieur. – Vor allem jüngere Affineure beeindrucken mit fantastischen Kreationen.«
Dupin zelebrierte das Probieren an Marktständen. Es gehörte unbedingt zu einem Marktbesuch dazu. Wenn er samstagvormittags aus den Hallen von Concarneau kam, war er satt. Dupin liebte überhaupt Märkte – kulinarische Paradiese, die ob der Vielzahl der Angebote, der Fülle und Überfülle, einen süßen Taumel auszulösen vermochten. Zum festen Bestandteil der reichen Marktkultur gehörten auch Stände mit Küchenutensilien, vor allem Töpfe und Messer; Dupin hatte ein Faible für gute Messer.
Der Marché de Saint-Servan in Saint-Malo war ein besonders bemerkenswerter Markt. Schon wegen seiner Lage mitten im Zentrum des stimmungsvollen Stadtteils, dazu das ausnehmend schöne Gebäude. Aus den Zwanzigern, vermutete Dupin. Der Boden war mit großen beigen Kacheln ausgelegt, entlang der Gänge Säulen aus rostfarbenem Klinkerstein. Das Eindrucksvollste: Glas, wo es nur ging, von überall flutete Licht herein. Die Fenster- und Türrahmen waren in einem maritimen Türkisgrün gehalten, in den Gängen und auch über Sophies Käsestand dekorative Metallbögen.
»Ich nehme gerne ein größeres Stück«, Dupin war hingerissen.
»Darf es noch etwas sein, Monsieur?« Die Verkäuferin lächelte erwartungsfroh. »Ich hätte da noch einen …«
Jetzt war es Zeit für die Stimme der Vernunft.
»Nein, danke. Das war’s für heute.«
Sie wog die Stücke in eindrucksvoller Geschwindigkeit ab und packte sie, nicht weniger fix, in eine hellblaue Papiertüte mit der Aufschrift »Les Fromages de Sophie«, die Dupin vergnügt entgegennahm.
Ihm war durchaus bewusst, dass es keine gute Idee gewesen war, so viel Käse zu kaufen, eigentlich überhaupt Käse zu kaufen. Sie würden in den nächsten Tagen ohne Frage genügend zu essen bekommen. Im übervollen Zeitplan des Seminars – vier Seiten im Querformat – war für jeden Abend ein Restaurantbesuch vorgesehen.
Dupins Laune hatte sich während des Marktbesuches erheblich aufgehellt; er hatte ihn mit zwei petits cafés im Café du Théâtre begonnen, direkt an der Ecke des mit Bäumen gesäumten Platzes vor den Markthallen. Bei seiner Ankunft heute Morgen um 7 Uhr 58 auf dem Campus der Polizeischule hatte sich seine Laune sehr tief im Keller befunden, um während des Vormittags noch weiter zu sinken, durchgehend, bis zur Mittagspause. Immerhin: Es war ein strahlender Sommertag. Alle in Concarneau hatten den Kommissar, auch jetzt noch, Anfang Juni, vor der Kälte und dem Regen »im hohen Norden« gewarnt; doch gerade waren es 28 Grad, die Sonne stach und der Himmel war ein einziges kräftig leuchtendes Blau.
Das aktuelle Stimmungshoch würde leider nur von kurzer Dauer sein. In zwanzig Minuten ging es weiter in der Polizeischule. Waren Veranstaltungen dieser Art für Dupin grundsätzlich ein Albtraum, würde sich diese ganz bestimmt noch schlimmer gestalten als alle anderen zuvor. Vor einem Monat war der Präfekt unangekündigt in Concarneau aufgetaucht, freudestrahlend hatte er vor Dupin gestanden: »Ich habe Neuigkeiten, eine große Ehre für Sie, mon Commissaire.« Dupin hatte sich nicht vorstellen können – nicht vorstellen wollen –, was der Präfekt meinen könnte, aber Schlimmstes befürchtet. Und natürlich war es eingetreten. In der ersten Juniwoche würde an der École de Police de Saint-Malo, einer der renommiertesten Polizeischulen des gesamten Landes, ein »einzigartiges Seminar« stattfinden. Jede Präfektin, jeder Präfekt der vier bretonischen Départements – drei Frauen und ein Mann – hatte eine Kommissarin oder einen Kommissar bestimmen können, mit dem sie oder er gemeinsam teilnehmen würde. Schlimmer konnte es wirklich nicht kommen, ein nicht auszuhaltender Gedanke: Locmariaquer und er, zusammen, vier ganze Tage, Montagfrüh bis Donnerstagabend, viele, viele Stunden. So lange wie noch nie. Für gewöhnlich schaffte es Dupin, die Begegnungen mit dem Präfekten drastisch kurz zu halten. Den behaglichen Sonderstatus, den Dupin längere Zeit wegen eines attraktiven Jobangebots aus Paris innegehabt hatte, hatte er mit dessen endgültiger Absage im letzten Spätherbst eingebüßt – und der Präfekt seine Beißhemmung. Der aufreibende Kleinkrieg hatte längst wieder eingesetzt. Locmariaquers abschließender Satz hatte allem noch die Krone aufgesetzt: »Sie sollten wissen, dass diese außerordentliche Veranstaltung auch eine Anerkennung des unermüdlichen Engagements von Ihnen allen darstellt. – Die Kollegen in Saint-Malo haben sich deswegen ein äußerst attraktives Begleitprogramm ausgedacht, Sie werden sehen.«
Zur »intensiven Teambildung« war die gemeinsame Unterbringung in der Polizeischule vorgesehen gewesen. Schlagartig war eine Schreckensvorstellung durch Dupins Kopf gegeistert: Präfekte und Kommissare in Doppel- oder Mehrbettzimmern, gewiss mit gemeinschaftlicher Nutzung der Sanitärbereiche. Nachdem Dupin zunächst erwogen hatte, im kommenden Monat einem schweren grippalen Infekt anheimzufallen – was allerdings einem Hausarrest gleichgekommen wäre –, war er umgehend tätig geworden und hatte im Internet nach einem netten, kleinen Hotel Ausschau gehalten. Rasch hatte er eines gefunden, die Villa Saint Raphaël, ein hübsches Maison d’hôtes mitten in Saint-Servan. Freilich war Locmariaquer alles andere als glücklich gewesen, als er davon Wind bekam, doch Dupin nahm es gerne in Kauf.
Er war nach einer beschaulichen Fahrt durch das einsame bretonische Inland gestern Abend in Saint-Malo eingetroffen und hatte festgestellt, dass er es mit seiner Unterkunft besser nicht hätte treffen können; sein Zimmer – direkt unterm Dach – war wunderbar, genau wie die gesamte Villa Saint Raphaël und ihr großer Garten. Worum es in diesem »einzigartigen Seminar« genau gehen würde, war Dupin noch immer nicht klar. Weder die vorab zugesandten Unterlagen noch die aufrichtig leidenschaftlichen einführenden Worte der gastgebenden Präfektin des Départements Ille-et-Vilaine am heutigen Morgen hatten es aufzuklären vermocht. Die Präfektin hatte etwas von der »Verbesserung der operativen, praktischen Arbeitsbeziehungen« zwischen den vier Départements erzählt, um lächelnd hinzuzufügen, dass »das Wichtigste jedoch sei, sich in der entspannten Atmosphäre Saint-Malos besser kennenzulernen« und »ein paar vergnügliche und konstruktive Tage miteinander zu verbringen«. Sie hatte es ernst gemeint. Und es passte zu dem tatsächlich imponierenden Begleitprogramm, von dem Nolwenn und Riwal geargwöhnt hatten, dass es den stolzen Malouinern dabei nicht zuletzt um Selbstdarstellung ging. »Die machen noch aus einem Polizeiseminar eine PR-Show …« Eine böswillige Interpretation, fand Dupin. Wäre Concarneau der Austragungsort, würden sie gleichfalls alles aufbieten, was die Region hergab. Der ewige Wettkampf der bretonischen Stämme: Wer war der beste, wer der bretonischste von allen? Eine uralte Tradition.
Wie auch immer, es war eine kuriose Vorstellung: all die Präfekten und Kommissare auf einem Haufen, an einem Ort. Dupin hatte unwillkürlich an das Druidentreffen bei Asterix und Obelix denken müssen.
Mit einem tiefen Seufzer steuerte Dupin auf den Hallenausgang zu. »Punkt vierzehn Uhr geht es weiter!«, hatte ihn Locmariaquer beim Verlassen des Seminarraums ermahnt. Immerhin war es nicht weit zur Polizeischule, deren Terrain weitläufig war wie ein kleines Dorf. Vier Hektar, hatte die Präfektin erklärt, in allerbester Lage, nicht weit von der weltberühmten Altstadt Saint-Malos – intra muros – und dem ebenso berühmten Stadtstrand entfernt.
Dupins Blick blieb an einem Stand mit köstlich aussehenden Wurstwaren hängen. Bretonische Würste, ganze Schinken, roh, gekocht, geräuchert.
»Was kann ich für Sie tun?«, fragte ein hochgewachsener Verkäufer.
»Ich … «
Hohe, schrille Schreie unterbrachen Dupin.
Sie kamen ganz aus der Nähe, es konnten bloß ein paar Meter sein.
Grässliche Schreie. Schmerzensschreie. Jäh wandte sich Dupin zur Seite. Rechts befand sich ein imposanter Gewürzstand.
Am hinteren Ende des Standes, neben einer der Säulen, ging etwas vor sich.
Die Schmerzensschreie verstummten schlagartig, dafür waren jetzt andere, panische Schreie zu hören. Und aufgeregte Stimmen.
Eilig bewegte sich Dupin auf die Szene zu. Bereit einzugreifen, die Muskeln aufs Äußerste gespannt.
Die panischen Schreie kamen von zwei Frauen, denen tiefes Entsetzen ins Gesicht geschrieben stand. Andere Marktbesucher wichen erschrocken zurück oder begannen zu laufen. Chaos brach aus.
Mit einem Mal verstummten die Schreie.
Auf den glänzenden Kacheln – Dupin sah sie erst jetzt – lag eine Frau, gekrümmt, bewegungslos, auf der rechten Körperseite. Ihr weißes Leinenhemd hatte sich auf Brusthöhe dramatisch rot verfärbt. Mehrere Einstiche waren im Stoff zu sehen. Und das Makaberste: Auf Herzhöhe steckte ein Messer.
Im Handumdrehen war Dupin bei ihr, ging in die Hocke, legte sein Ohr an ihren Mund, suchte ihren Puls am Handgelenk, dann am Hals.
Er holte sein Handy aus der Jeanstasche.
»Commissaire Dupin, ich benötige umgehend einen Krankenwagen, Marché de Saint-Servan, bei dem großen Gewürzstand, nicht weit vom Ausgang, eine Frau wurde niedergestochen, nicht ansprechbar«, ein professionelles Stakkato, »Stichwunden in der Herzgegend«, er blickte sich rasch um und bemerkte den Stand mit den Messern, an dem er eben schon vorbeigekommen war, direkt neben dem Gewürzstand, »ein Küchenmesser, es steckt noch im Körper. – Und«, er zögerte kurz, »schicken Sie die Polizei.«
Dupin hatte größte Mühe, einen Puls zu spüren – er war unendlich schwach.
»Ein Arzt? Ist hier ein Arzt?«, rief Dupin – immer noch in der Hocke – so laut er konnte. »Ich bin Polizist. Die Frau ist schwer verletzt.«
Ein paar der Marktbesucher hatten sich neugierig um ihn versammelt, aber niemand machte Anstalten, ihm zu helfen.
Dupin hatte kein gutes Gefühl. Es war äußerst kritisch um die Frau bestellt. Sie gab keinen Laut von sich.
»Da ist sie rausgelaufen. Die Frau, die das getan hat.« Ein Mädchen, vielleicht zwölf oder dreizehn Jahre, war an Dupin herangetreten und zeigte mit der Hand Richtung Ausgang. »Sie ist da raus, gerade erst. Dann ist sie nach links.«
Dupin erhob sich rasch.
»Das stimmt«, neben dem Mädchen tauchte eine kurzhaarige Frau um die vierzig auf, vermutlich die Mutter, »zwei Frauen haben sich angeschrien. Dann hat die eine plötzlich auf die andere eingestochen. Es ging alles wahnsinnig schnell. Sie hat bei dem Stand nebenan einfach ein Messer gegriffen. – Sie standen hier an der Säule, ich habe es aus dem Augenwinkel gesehen. – Na los, verfolgen Sie sie!«
Dupin zögerte, er konnte die Schwerverletzte nicht so liegen lassen.
»Ich kümmere mich um sie. Ich bin Lehrerin und Ersthelferin an unserer Schule.«
Schon beugte sie sich über die Frau.
Dupin stürzte los. Die Polizei und die Sanitäter würden sicher jeden Moment eintreffen.
Er war ohne Waffe. Ein Fehler.
Er lief dennoch weiter.
Schon hatte er den Ausgang erreicht. Er hielt sich links auf der Rue Georges Clemenceau.
Und tatsächlich – er entdeckte eine hektisch davonrennende Frau.
Dupin beschleunigte.
Am Ende der Straße hatte er bereits ein paar Meter aufgeholt.
Abermals bog die Frau links ab. Rue de Siam.
Dummerweise besaß Dupin bisher nur eine sehr grobe Orientierung in der Stadt, aber sein Gefühl sagte ihm, dass sie sich nicht weit vom Meer befanden, der Port de plaisance musste in der Nähe sein, gestern Abend war Dupin an ihm vorbeigefahren.
Die Flüchtige wechselte die Straßenseite. Sie hatte ihren Verfolger bemerkt, ab und an warf sie einen Blick über die Schulter, ohne ihr Tempo zu verlangsamen.
Jetzt bog sie auf eine lange gerade Straße ein.
Der Abstand verringerte sich weiter. Dupin besaß eine reelle Chance. Er mobilisierte all seine Kräfte. Plötzlich gaben die Häuserzeilen einen weiten Blick auf das Meer und den Freizeithafen frei.
Jetzt erkannte Dupin, was ihr Ziel war. Ein Parkplatz. Die Fahrbahn gabelte sich und schuf einen lang gezogenen Streifen, groß genug für zwei Wagenreihen.
Die Frau rannte noch ein paar Meter, zwängte sich dann in eine Lücke zwischen zwei Autos. Die Rücklichter des einen Wagens leuchteten zweimal kurz auf.
Noch zwanzig Meter. Dupin musste sich beeilen.
Sie saß bereits in ihrem Auto, der Motor heulte auf.
Zehn Meter noch.
Abrupt setzte der Wagen zurück. Die Frau schlug scharf nach rechts ein. Bremste brutal. Im nächsten Moment würde sie den Vorwärtsgang einlegen.
Dupin hatte den Wagen erreicht, ein Land Rover, irgendein kleineres Modell, dunkelblau. Er wusste, er hatte lediglich noch den Bruchteil einer Sekunde. Entschlossen fasste Dupin nach dem Griff der linken hinteren Tür.
In diesem Moment machte der Wagen einen Satz nach vorn. Dupin verlor das Gleichgewicht und musste den Griff loslassen, die Wucht der Beschleunigung riss ihn zu Boden. Während er zur linken Seite abrollte, preschte der Wagen an der Reihe der parkenden Fahrzeuge entlang.
Sofort war Dupin wieder auf den Beinen und spurtete hinterher.
Am Ende des Parkplatzes würde sich die Flüchtige links in den Verkehr einordnen – und vielleicht verlangsamen müssen, hoffte er.
Vergeblich. Der blaue Land Rover gab Gas und fuhr blindlings auf die Straße. Jetzt versperrten die parkenden Autos Dupins Blick. Er hörte bloß noch den hochdrehenden Motor und, einen winzigen Augenblick später, ein heftiges Hupen sowie einen ohrenbetäubenden metallischen Krach, dem auf der Stelle ein weiterer folgte.
Dupin hatte das Ende des Parkplatzes erreicht und lief auf die Straße.
Von dem Land Rover waren bloß noch die Rücklichter zu sehen, am Ende der Straße bog er scharf links ab.
Dupin blickte sich rasch um: Es war zu einem ernsten Zusammenstoß gekommen. Ein Wagen hatte anscheinend versucht, dem Land Rover auszuweichen, und war seitlich in die parkenden Autos gefahren, ein anderer war, diese Kollision sah halb so wild aus, hinten aufgefahren.
Dupin lief auf den ersten Wagen zu. Der Fahrer, ein Mann Mitte dreißig, öffnete die Tür.
»Sind Sie verletzt?«
»Ich – ja – ich meine, nein. Nicht verletzt.«
Dem Mann schien nichts zu fehlen.
Ein Fußgänger, der das Ganze anscheinend beobachtet hatte, kam herbeigeeilt und zog sein Handy hervor.
»Ich rufe einen Krankenwagen.«
Auch in der Gegenrichtung hatten Autos angehalten, einige der Fahrer stiegen hilfsbereit aus.
Dupin bewegte sich zielsicher auf einen kleinen Peugeot zu, mit vielversprechenden Rallyestreifen an der Seite. Ein junger Mann mit kurz rasierten Haaren, der im Wagen sitzen geblieben war und das Fenster heruntergelassen hatte, blickte ihm entgegen.
»Commissaire Georges Dupin«, informierte ihn Dupin ohne weitere Erklärungen. »Ich muss mir kurz Ihren Wagen ausleihen.«
Der Fahrer brauchte einen Moment, ehe er begriff, was Dupin meinte. Körperhaltung, Blick und Tonfall des Kommissars betonten überdeutlich, dass es sich nicht um einen Scherz handelte.
»Ich …«
»Steigen Sie aus.« Ein Befehl, keine Bitte.
Der junge Mann blickte unschlüssig, tat dann aber wie geheißen. Dupin drängte sich an ihm vorbei in den Wagen.
»Und wie kriege ich mein Auto wieder?«
Dupin saß schon am Steuer.
»Holen Sie es später bei der Polizeischule ab.«
Dupin zog die Tür zu, ließ den Motor an und trat das Gaspedal umgehend bis zum Anschlag durch. Ein ohrenbetäubendes Quietschen traktierte die Trommelfelle. Nicht umsonst hießen diese Wagen im Polizeijargon »Krawallwagen«.
Dupin schoss los und bog am Ende der Straße links ab. Ein Gewirr von Straßen und Gässchen tat sich auf, der Land Rover war nicht zu sehen. Dupin ging davon aus, dass die Flüchtige eher die Hauptstraßen bevorzugen würde. Er folgte der breitesten Straße. Nach etwa hundert Metern ging es halb links, dann geradeaus. Jetzt befanden sich zwei andere Wagen vor ihm, entschlossen schoss er in einem Satz an ihnen vorbei, der leichte, kleine Peugeot war unfassbar wendig. Bald stieß Dupin auf einen der größeren Boulevards und entschied sich spontan für die Richtung stadtauswärts.
Mit großer Wahrscheinlichkeit war es sinnlos, was Dupin hier tat, aber jetzt abzubrechen, wäre ihm wie kampfloses Aufgeben vorgekommen.
Er steuerte auf einen großen Kreisverkehr zu, hohe Bäume in der Mitte. Weitere abenteuerliche Überholmanöver wurden fällig, eines gelang nur äußerst knapp.
Hinter dem Kreisverkehr wurde die Straße noch breiter. Dupin musste heftig bremsen – ein Stau.
»Na großartig!«, entfuhr es ihm. Noch immer war von einem dunkelblauen Land Rover nichts zu sehen – was allerdings auch an dem großen Schulbus ein paar Wagen vor Dupin liegen konnte. Es ging nur langsam voran, dann folgte ein weiterer Kreisverkehr. Schließlich verwies ein großes Schild auf die N176, die »Vierspurige« – die bretonische Autobahn.
Ohne ersichtlichen Grund löste sich der Stau plötzlich auf. Im Nu zeigte der Tacho des Peugeots 120 Stundenkilometer an. Dupin würde sich in wenigen Augenblicken entscheiden müssen: Fuhr er Richtung Mont Saint-Michel und in die Normandie, nach Osten also, oder Richtung Saint-Brieuc, nach Westen?
»Verdammt.«
Er hatte den Fluch gerade ausgestoßen, als er einen höher gebauten dunklen Wagen auszumachen meinte, der weit vor ihm Richtung Saint-Brieuc auf die N176 auffuhr. Dupin hielt sich ebenfalls rechts. Plötzlich klingelte sein Telefon. Kein guter Zeitpunkt.
Dupin gab Vollgas, der Motor unterstrich es mit markanten Geräuschen.
Die Straße verlief in einer leichten Kurve, jetzt konnte Dupin den Wagen genauer sehen.
Er war es. Eindeutig. Ein Land Rover. Dieses Mal würde er sie nicht wieder verlieren.
Oder doch? So fest er das Gaspedal auch durchtrat, über 170 Stundenkilometer kam er nicht hinaus. Stück für Stück vergrößerte sich der Abstand, ohne dass Dupin auch nur das Geringste daran ändern konnte.
Ihm blieb nichts anderes übrig, als zuzuschauen, wie die Frau in ihrem Land Rover davonzog.
»Das kann nicht wahr sein.« Dupin schlug fest auf das Lenkrad.
Das Spiel war verloren. Sie war ihm erneut entwischt.
»So ein Scheiß.«
Der penetrante Ton seines Handys hob abermals an. Mit der rechten Hand kramte er es hervor. Noch fuhr er mit Höchstgeschwindigkeit auf der Überholspur, wie um die Niederlage nicht besiegeln zu müssen.
»Ja?«, rief er wütend ins Telefon.
»Locmariaquer am Apparat«, ein deutlich ungehaltener Ton, »wir warten hier seit achtzehn Minuten auf Sie. Für den Nachmittag ist Arbeit in Zweiergruppen angesagt. – Wann können wir mit Ihrer illustren Anwesenheit rechnen?«
»Ich bin …« Dupin erwog, einfach aufzulegen. Aber es wäre keine gute Idee. Er kam um dieses Gespräch nicht herum, er würde berichten müssen, was vorgefallen war.
»Dupin – Ihr Verhalten ist infam, Sie …«
»Es gab eine schwere Messerattacke. Auf dem Marché de Saint-Servan. Eben gerade. Ich war«, Dupin musste unbedingt klarmachen, dass er nicht anders gekonnt hatte, als sich unmittelbar einzubringen, »quasi Zeuge der Attacke«, es durfte andererseits natürlich auch nicht den leisesten Anschein erwecken, als wäre er irgendwie verwickelt gewesen, »aber natürlich vollkommen zufällig vor Ort. – Eine Frau hat eine andere niedergestochen. Sie ist geflohen, ich war genötigt, die Verfolgung aufzunehmen, in Ausübung …«
»Aha!«, unterbrach der Präfekt ihn, jetzt bereits in einem veränderten Tonfall, »das muss die Angelegenheit sein, wegen der unsere Gastgeberin und ihre Kommissarin eben so schnell aufgebrochen sind. Was genau ist passiert, Dupin?«
»Mehr weiß ich nicht, Monsieur le Préfet«, war Dupins ehrliche Antwort. Es half immer ein wenig, den Titel ins Spiel zu bringen; den Namen des Präfekten konnte Dupin auch nach neun Jahren immer noch nicht richtig aussprechen.
»Wo sind Sie jetzt?«
»Ich befinde mich gerade auf der N176 Richtung Saint-Brieuc, Monsieur le Préfet, ich hatte die Verfolgung aufgenommen, habe den Wagen aber«, er konnte es nicht verschweigen, »leider verloren.«
»Sie haben ihn verloren? Wie kann das sein?«
Dupin war auf die rechte Spur gewechselt und hielt nach der nächsten Abfahrt Ausschau. So schwer es ihm fiel, er würde nur noch eines tun können: zurückfahren.
»Ich sitze in einem sehr kleinen Wagen. Bei 170 gibt er auf.«
»Was soll das heißen? Warum fahren Sie einen sehr klei…«
»Ich berichte später, Monsieur le Préfet. Ich habe hier keine Freisprecheinrichtung, ich muss mich auf die Straße konzentrieren.«
»Na gut. Ich sehe Sie dann gleich hier. Ich …«
Dupin legte auf.
Gerade hatte er das Telefon frustriert auf den Beifahrersitz gelegt, als es erneut klingelte.
Eine unbekannte Nummer.
»Ja?«
»Hier Commissaire Louane Huppert«, ein durch und durch sachlicher Tonfall, »Ihre Kollegin aus dem Seminar.«
Die Kommissarin aus Saint-Malo.
»Ich höre.«
»Ich befinde mich am Tatort, Commissaire. Wo es eben zu dem Mord gekommen ist, den Sie …«
»Sie ist tot?«
»Allerdings. Blanche Trouin ist leider noch vor Ort verstorben. Eine Lehrerin behauptet, ein Kommissar aus Concarneau habe ihr die Schwerverletzte überlassen und …«
»War sie schon tot, als die Sanitäter eintrafen?«
Die Kommissarin ging nicht darauf ein.
»… und habe die Verfolgung der Mörderin aufgenommen. Bei der es in der Folge zu einem Unfall zweier Fahrzeuge kam, die Zeugen vor Ort haben meinem Kollegen von filmreifen Szenen berichtet. Das gesamte Stadtviertel befindet sich in Aufruhr. Es …«
»Sie wissen also bereits, wer die Tote ist?«
»Das wissen wir, ja. Und nicht nur das. – Wir wissen auch, wer die Mörderin ist.«
Dupin konnte es nicht fassen. »Sie wissen, wen ich gerade in dem dunkelblauen Land Rover auf der N176 verfolgt habe?«
»Sie haben was?«
»Wer ist es?«
»Dann stimmt auch die Geschichte mit dem ›geliehenen‹ Wagen? Ein Peugeot 208?«
»Es bestand eine reelle Chance, die Frau zu stellen …« Dupin musste den Grund, aus dem er sich den Wagen geliehen hatte, selbstverständlich möglichst zwingend darstellen. Das Dumme war nur: Wenn er die Chance, sie zu erwischen, als zu realistisch beschrieb, wurde es für ihn in der Folge umso prekärer. »Aber dann ist sie doch entwischt. – Wer ist es?«
»Sie haben sie entkommen lassen?«
»Die Höchstgeschwindigkeit des Wagens, in dem ich sitze, beträgt 170. – Sie kennen sowohl das Opfer als auch die Mörderin?«
»Richtung Saint-Brieuc oder Normandie?«
»Saint-Brieuc.«
»Wo haben Sie sie verloren – ungefähr?«
»Bei der Ausfahrt Richtung Quévert.«
»Gut. – Das Opfer, Blanche Trouin«, kam die Kommissarin nun endlich auf Dupins Fragen zurück, »ist eine bekannte Küchenchefin, sie besitzt ein Restaurant in Dinard. Le Désir. – Ein Michelin-Stern. – Vierundvierzig Jahre alt.«
»Und die Täterin?«
»Lucille Trouin.«
Dupin musste sich verhört haben.
»Was?«
»Ihre Schwester. – Zwei Jahre jünger, ebenfalls Küchenchefin, ebenso erfolgreich. Ihr Restaurant befindet sich in Saint-Malo. Noch kein Stern, aber kurz davor, einen zu bekommen.«
Dupin ließ eine Pause entstehen. Die Geschichte klang zu kurios. Mittlerweile war er von der Vierspurigen abgefahren.
»Sie wissen, dass Sie keinerlei Befugnisse hatten für das, was Sie getan haben.«
Es war nicht einmal eine rhetorische Frage, sondern eine einfache Feststellung.
»Das ist mir durchaus bewusst«, es wäre nicht verkehrt, sich in dieser Situation besonders freundlich zu verhalten, »aber ich wollte helfen. Ich war zufällig vor Ort. Und«, das Argument fiel ihm gerade ein, »geht es in unserem Seminar nicht um die Intensivierung der Zusammenarbeit? Ich habe mein Handeln in diesem Geiste verstanden.«
Jetzt hatte er übertrieben.
»Wissen Sie denn schon«, wechselte er schnell das Thema, »was da auf dem Markt geschehen ist? Gibt es bereits Hinweise, warum die Schwester das getan hat?«
»Dupin«, kein Commissaire, kein Monsieur, nichts, »ich möchte Sie bitten, umgehend in die Markthallen zurückzukommen. Zu Blanche Trouins Gewürzstand. – Ich sehe Sie in ein paar Minuten dort.«
»Der Stand, vor dem es passiert ist, gehörte dem Opfer?«
Die Kommissarin hatte bereits aufgelegt.
Immerhin: In Hinblick auf sein »unbefugtes Handeln« war die Unterhaltung einigermaßen harmlos verlaufen.
Er erreichte einen großen Kreisverkehr – es schien hier Hunderte davon zu geben – und orientierte sich. Er musste auf dem schnellsten Wege zurück nach Saint-Servan.
Am besten parkte er dort, wo die Flüchtige geparkt hatte. Lucille Trouin. Die ihre ältere Schwester mitten im Trubel der Markthallen erstochen hatte.
Was war das bloß für eine Geschichte? Morde in familiären Zusammenhängen waren zwar rein statistisch die häufigsten. Aber was war zwischen den beiden Schwestern vorgefallen? Welche grausame Tragödie steckte dahinter?
Knapp zehn Minuten später stellte Dupin den Wagen auf dem Parkplatz beim Port de plaisance ab. Ganz in der Nähe hatte der dunkelblaue Land Rover gestanden. Dupin hatte fünf Polizeiwagen mit Blaulicht gezählt, die ihm auf der Einfallstraße mit rasantem Tempo entgegengekommen waren, um der jüngeren Schwester nachzusetzen, auch wenn der Vorsprung uneinholbar schien.
Schon kamen die Markthallen in den Blick.
Dupin erreichte den Gewürzstand. Es roch intensiv nach Koriander, Ingwer, Kardamom, Kümmel, wie ein besonders wild gemischtes Curry. Alles war weiträumig abgesperrt worden, die Händler hatten ihre Stände verlassen müssen.
Die Gruppe, die sich am Tatort versammelt hatte, war beeindruckend groß. Sicher ein Dutzend Polizisten, Leute von der Spurensicherung, Sanitäter mit gleich zwei Krankenwagen, die direkt vor dem Eingang gehalten hatten, der Gerichtsmediziner, der ein wenig verloren neben der Toten zu warten schien. Ganz am Rand sah Dupin die Ersthelferin mit ihrer Tochter, eine Polizistin kümmerte sich um sie.
Kommissarin Huppert stand etwas abseits, im Gespräch mit einem Sanitäter. Sie war sehr groß, beinahe so groß wie Dupin, schlank, dunkelblonde Haare zu einem Zopf gebunden, höchst aufmerksame, wache grüne Augen.
»Gut, ja. Bringen Sie die Leiche ins forensische Labor.«
Der Sanitäter ging auf den Gerichtsmediziner zu, und Huppert wandte sich an Dupin: »Für die Forensik gibt es eigentlich nichts zu tun. Es ist ja alles bekannt. Das Opfer. Die Todesursache, der Todeszeitpunkt. Sogar die Mörderin. – Es fehlen nur«, sie formulierte es in aller Ruhe, völlig prosaisch, »das Motiv und die flüchtige Täterin. Jeder wusste, dass sich die Schwestern nicht ausstehen können. Aber …« Sie brach ab und blickte Dupin mit ernster Miene an.
»Also Dupin, was haben Sie gesehen? Gehört? – Was haben Sie von dem Vorfall mitbekommen?«
»Ich habe nur Schreie gehört, den Streit und die Tat selbst habe ich nicht gesehen.«
Dupin rekapitulierte das Geschehen mit knappen Worten, von den ersten Schmerzensschreien bis zur Verfolgung zu Fuß und dann mit dem Wagen. Kommissarin Huppert hörte aufmerksam zu.
»Hier vor Ort hat die Ersthelferin übernommen.« Dupin deutete mit dem Kopf in ihre Richtung.
»Ich weiß. Sie hatte keine Chance zu helfen. Als die Sanitäter eintrafen, war Blanche Trouin bereits verstorben.«
Mit der letzten Silbe klingelte Dupins Telefon. Rasch holte er es aus der Hosentasche.
Es war ein unpassender Moment – aber es war Nolwenn.
»Einen Augenblick. Ich bin sofort wieder da.«
Bevor Kommissarin Huppert etwas sagen konnte, trat er ein paar Schritte zur Seite. Er sprach mit gesenkter Stimme:
»Es ist gerade äußerst ungün…«
»Waren Sie das?«
»Was?«
»Diese Verfolgungsjagd auf der N176?«
»Ich habe nur …«
Sie hatte es vermutlich über die internen polizeilichen Kanäle gehört – der Land Rover war zur Fahndung ausgeschrieben, die gesamte bretonische Polizei würde mittlerweile davon Kenntnis haben.
»Sie haben sie entwischen lassen?«
Nolwenn äußerte sich nicht selten kritisch über Dupins Handeln – aber diese Frage hatte ungewöhnlich scharf geklungen.
»Ich kann Ihnen nur eines sagen«, fuhr sie energisch fort, »halten Sie sich da raus, Monsieur le Commissaire! Dafür ist Saint-Malo zuständig. Die wissen ohnehin alles besser. Außerdem ticken die Uhren da vollkommen anders.«
Seine fabelhafte Assistentin hatte noch nie verlangt, dass er sich aus einer Untersuchung raushielt, ihre zwiegespaltenen Gefühle gegenüber Saint-Malo schienen eigentümliche Züge anzunehmen.
»Ich befinde mich gerade im Gespräch mit der Kommissarin, Nolwenn. Am Tatort.«
»Lassen Sie die Finger von den Ermittlungen, Monsieur le Commissaire. Sie riskieren riesigen Ärger. Konzentrieren Sie sich auf das Seminar, und kommen Sie dann einfach nach Hause.« Etwas versöhnlicher fügte sie hinzu: »Oder konzentrieren Sie sich aufs Kulinarische. Das Begleitprogramm sieht ein paar herausragende Abendessen vor.«
»Ich muss hier weitermachen, Nolwenn.«
Er wartete kurz, bevor er auflegte, er wollte nicht harsch wirken.
»Bis dann, Monsieur le Commissaire.«
Dupin steckte das Handy zurück in die Hosentasche.
Natürlich hatte Nolwenn recht. Der Ärger, den er sich durch seine Einmischung einhandeln könnte, wäre beträchtlich. Während des Telefonates hatte er sich unauffällig umgeschaut, ob er vielleicht die hellblaue Papiertüte mit dem Käse irgendwo sah, die er eben einfach liegen gelassen hatte. Aber sie war nirgends zu sehen.
Er kehrte zu Huppert zurück, die ihn die ganze Zeit im Blick gehabt hatte.
»Meine Mitarbeiterin aus Concarneau …«
»Nolwenn.«
Auf Dupins Miene war ein Anflug von Stolz zu erkennen – Nolwenn hatte anscheinend bretagneweit echte Berühmtheit erlangt.
»Was meinten Sie gerade? Jeder wusste, dass sich die Schwestern nicht ausstehen konnten?«, fragte Dupin.
»Sagen wir mal so, sie standen in starker Konkurrenz zueinander. Auch in der Öffentlichkeit. Es war eine unverhohlene Rivalität.«
»Die Sache muss doch weit über eine gewöhnliche Rivalität hinausgegangen sein. Fast alle Geschwister konkurrieren miteinander. Für eine derart dramatische Zuspitzung muss es einen massiven Auslöser gegeben haben.«
»Unbedingt«, stellte die Kommissarin trocken fest. Sie schien sagen zu wollen: eine banale Erkenntnis.
»Haben die beiden Familie? Beziehungen, Kinder?«
»Beide kinderlos. Die Eltern leben nicht mehr. – Die Ältere war verheiratet, zu ihrem Ehemann fahre ich gleich. Die Jüngere lebt in einer festen Beziehung. Ihren Lebensgefährten besuche ich danach ebenfalls. – Und jetzt bringen Sie den Wagen, den Sie sich ausgeliehen haben«, die Kommissarin schien nun allein weitermachen zu wollen, »zur Polizeischule, ganz, wie Sie es dem Besitzer versprochen haben. Und dann geht es weiter im Klassenzimmer.«
Sie schien es nicht provozierend zu meinen, zumindest fehlte ein ironischer Unterton.
»An dem Seminar werde ich ja nun bedauerlicherweise nicht mehr teilnehmen können«, fuhr sie fort und wandte sich von Dupin ab. »Sehr bedauerlich.«
Schon bei der Aufforderung, ins »Klassenzimmer« zurückzukehren, hatte Dupin heftiger Protest auf der Zunge gelegen. Aber, so schwer es auch auszuhalten war: Die Ermittlung war die Angelegenheit der Kommissarin aus Saint-Malo – sie war raus aus dem Seminar, und er hatte es weiterhin am Hals.
Um 15 Uhr 15 hatte Dupin widerwillig und resigniert den Seminarraum B12 im Hauptgebäude der Polizeischule betreten.
Ohne Kommissarin Huppert und die gastgebende Präfektin aus Rennes waren sie bloß noch zu fünft; die Kommissarin aus dem Morbihan hatte in letzter Minute wegen eines Bootsunfalls die Teilnahme absagen müssen, dabei war sie es gewesen, auf die Dupin am neugierigsten gewesen war. Sie war die Nachfolgerin von Commissaire Sylvaine Rose, die voriges Jahr zur Präfektin des Départements Loire-Atlantique befördert worden war, das zwar zur historischen Bretagne zählte, ihr aber durch eine Verwaltungsreform in den Achtzigern entrissen worden war.
Keiner hatte ein Wort zu dem ganzen Geschehen gesagt, als Dupin dazugestoßen war, augenblicklich war die Gruppenarbeit fortgesetzt worden. Dupin war dem nicht unsympathisch wirkenden Kommissar aus den Côtes-d’Armor zugeteilt worden, auf bunten Kärtchen hatten sie die verbesserungswürdigen Punkte in der Zusammenarbeit zwischen den Départements notieren sollen. Zudem die »Optimierungspotenziale« in der Zusammenarbeit zwischen den Kommissaren und Präfekten. Dupin war hin- und hergerissen gewesen, keines oder aber Dutzende der Kärtchen zu beschreiben. Er war in seinen Gedanken ohnehin fortlaufend abgeschweift, zu dem fürchterlichen Mordfall. Zu den beiden Schwestern.
Er hatte unter dem Tisch auf seinem Handy im Internet zu den Trouin-Schwestern und ihren Restaurants recherchiert. Alles wirkte enorm beeindruckend; vor allem die ältere Schwester Blanche, das Opfer, schien ein echter Star gewesen zu sein. Sie war, auch durch den ihr vor zwei Jahren verliehenen Michelin-Stern, auf dem Weg gewesen, zu den wirklichen Grands Chefs zu gehören, die in Frankreich so angesehen und populär waren wie große Künstler oder Rockstars – und unter denen es noch immer nicht allzu viele Frauen gab. Die Anzahl an Berichten und Interviews war erstaunlich, in renommierten nationalen wie auch internationalen Zeitungen und Zeitschriften. Auch die Artikel über die jüngere Schwester waren zahlreich, Lucille Trouin schien der älteren nur um wenig nachzustehen. Beide Schwestern waren offenbar von ihrem Vater inspiriert worden, der ebenfalls Küchenchef gewesen war, allerdings in einem einfachen, aber höchst beliebten Bistro. Es wurden Äußerungen der beiden zitiert und kommentiert – überwiegend von Lucille Trouin –, in denen die schwesterliche Konkurrenz offen zur Sprache kam. Sie schienen tatsächlich keinen Hehl daraus gemacht zu haben. Die jüngere Schwester hatte nach der Verleihung des Michelin-Sterns an die ältere vollmundig angekündigt, auch bald einen zu erhalten. In einem Interview sprach Lucille Trouin von dem »ungerechten Vorteil« ihrer älteren Schwester, auf eine Rezeptsammlung des Vaters zurückgreifen zu können, die dieser Blanche vermacht hatte. Anscheinend hatte Blanche schon als Jugendliche ihre Kochleidenschaft entdeckt, Lucille hingegen erst mit Mitte zwanzig. Über den Vater selbst hatte Dupin nicht viel gefunden. Abgesehen von der offensichtlichen Konkurrenz der Schwestern hatte Dupin nichts entdeckt, das mit einer derartig brutalen Eskalation in Verbindung gebracht werden konnte. Selbstredend hatte er ebenso geschaut, ob es Neues zur Verfolgung von Lucille Trouin gab, über die allenthalben berichtet wurde. Noch schien die Suche ohne Erfolg.
Mit »positiv-motivierenden« Worten des Coaches war der erste Seminar-Tag um 17 Uhr 15 zu Ende gegangen.
»Kommen Sie, Dupin, jetzt erzählen Sie mal ausführlich, was da los war«, hatte ihn sein Seminar-Partner, Kommissar Gaston Nedellec, aufgefordert, nachdem der Coach den Raum verlassen hatte – alle waren neugierig sitzen geblieben. Bereitwillig hatte Dupin seine Geschichte ein weiteres Mal erzählt. Anschließend waren sie auseinandergegangen.
Um 18 Uhr 30, vor wenigen Minuten, hatte sich das Team – alle sprachen die ganze Zeit nur vom »Team« – an der Porte Saint-Louis in der Altstadt einfinden sollen. Den Auftakt des Begleitprogramms bildete eine Stadtführung. Natürlich hatte Dupin erwogen zu schwänzen, es dann aber für unklug befunden, gleich am ersten Abend zu fehlen.
Er war ein paar Minuten zu spät. Schnellen Schrittes lief er auf das Südtor zu, eines von acht mächtigen Toren, durch die man die enormen, haushohen Wehranlagen passierte und in die Altstadt gelangte.
Vom offenen Meer waren starke Böen aufgekommen, voller Salz und Jod, man konnte förmlich sehen, wie sie den Atlantik aufpeitschten, die großen Wellen vor sich her trieben. Der Himmel gab sich weiterhin makellos blau. Linker Hand lag eine massive Mole, die von der Ecke der Stadtmauer in einem eleganten Schwung weit in die breite Rance-Mündung hineinreichte, Richtung Dinard.
Noch hatte die Hochsaison nicht begonnen, aber schon jetzt kamen Besucher von überallher, Saint-Malo war das ganze Jahr über ein beliebtes Ziel, vor allem für kürzere Reisen. An den Molen erkannte man es: wer Bretone war und wer bloß Besucher. Überall in der Bretagne war das gleiche Spiel zu beobachten. Die Unkundigen wagten sich bis zur Spitze der Mole hinaus, um spektakuläre Blicke aufs tosende Meer zu erhaschen. Dann geschah es: Getrieben von der Flut und den peitschenden Böen barsten einzelnen Brecher derart heftig gegen die Mauern, dass sie sich in wilden Fontänen und mit gewaltigen Gischtwolken über die Mole ergossen. Ein Naturschauspiel, das für die Molengänger einem Bad im Meer gleichkam. Wie auch immer man gekleidet sein mochte, man war umgehend pitschnass, durch und durch, bis auf die Unterwäsche und die Strümpfe. Dupin beobachtete ein Paar, das laut aufschrie und panisch davonrannte.
Er erreichte das Stadttor. Das Team hatte sich in dem einigermaßen windgeschützten Durchgang versammelt. Locmariaquer, der in seiner reich dekorierten Uniform übermäßig aufgeplustert aussah, konnte sich die Rüge nicht verkneifen:
»Und wieder warten wir nur auf Sie, Commissaire! – Dieser nette Monsieur hier«, er zeigte auf einen untersetzten Mann mit schmalen Schultern, wenigen verbliebenen Haaren und runder Brille, der ein altes Tweedjackett trug, »wird mit uns nun einen Rundgang über die Stadtmauern machen. Die berühmte Tour des remparts. Und dabei wird er uns etwas über Saint-Malo erzählen. Denn …«
Eine drahtige Frau, die nicht zum Team gehörte und die Dupin bisher nicht bemerkt hatte, räusperte sich vernehmlich: »Das ist Étienne Monnier, der landesweit renommierte Stadthistoriker von Saint-Malo«, der Mann nickte bestätigend, »uns wird das Privileg zuteil, von ihm höchstpersönlich durch die Etappen unserer glorreichen Stadtgeschichte geführt zu werden.«
»Sie ist eine Assistentin von Commissaire Huppert«, flüsterte Kommissar Nedellec Dupin zu. »Sie vertritt unsere Gastgeberinnen. Übrigens gibt es nichts Neues zur Verfolgung von Lucille Trouin, ich habe eben nachgefragt. Diese Dame würde es wissen, denke ich.«
Dupin nickte freundlich.
»Wenn wir denn nun vollständig sind«, setzte die Assistentin fort, »kommen wir zum Programm für den heutigen Abend. Auf die Stadtführung folgt ein Besuch im Maison du Beurre von Yves Bordier, dem weltweit bekannten und vielfach geehrten Butterhersteller. Dort werden wir uns die Ausstellung zur Kulturgeschichte der Butter anschauen, um dann in seinem Bistro Autour du Beurre zu speisen.«
Dupin verspürte gewaltigen Hunger, der herrliche selbst gemachte Frühstückskuchen in der Villa Saint Raphaël war das Einzige, das er heute gegessen hatte. Natürlich kannte er die Butter von Bordier. Die Manufaktur war legendär. Und Butter stellte für die Bretagne – weit über ihren Status als eines der wichtigsten Lebensmittel hinaus – so etwas wie ein Wahrzeichen dar.
»Ich will Ihnen versichern«, sie machte eine selbstbewusste dramaturgische Pause, »dass uns ein sehr angemessenes Rahmenprogramm gelungen ist. Vor allem, das will ich nicht verschweigen, dank unserer Präfektin. Ein Programm, das Ihnen einige unserer außerordentlichen Attraktionen und Errungenschaften näherbringen wird, insbesondere die kulinarischen. Ich spreche von den Kochkünsten einiger der bedeutendsten Chefs der Region – bedeutend nicht bloß für die Region, sondern für die gesamte Bretagne, ja für unsere ganze Nation. Sie alle werden uns ihre gastronomischen Pforten öffnen.« Die Assistentin brach verlegen ab: »Nicht alle mehr, natürlich. Blanche Trouins gastronomische Pforte wird uns nun unglücklicherweise für immer verschlossen bleiben. Und von dem Besuch im La Noblesse, Lucille Trouins Restaurant, haben wir kurzentschlossen Abstand genommen.« Ihr war sichtbar unbehaglich zumute. »Wie auch immer, über die Restaurantbesuche hinaus werden Sie einige weitere Spezialitäten Saint-Malos kennenlernen. Viele davon befinden sich in der Rue de l’Orme, wo wir gleich hingehen. So auch das japanisch-bretonische Restaurant von Bertrand Larcher, in dem wir morgen essen werden. – Das Sträßchen stellt so etwas wie das kulinarische Zentrum der Stadt dar.«
Was auch immer man über die Sinnhaftigkeit des Seminars sagen mochte, das Begleitprogramm war eindrucksvoll, musste Dupin anerkennend feststellen – zumindest der gastronomische Teil.
»Die Devise unserer international brillierenden Küche lautet: Voyages et Aventures. Reisen und Abenteuer. So formuliert es der Chef des Saint Placide, wo wir am letzten Abend essen werden. Auch in der Geschichte der Stadt ging es immer wieder ums Reisen, um verwegene Abenteuer. Um Wagnisse und ihr erfolgreiches Bestehen.«
Dupin mochte das Motto, trotz des übertriebenen Pathos. Es passte auf das ganze Leben: Reisen und Abenteuer, das war es.
Die Dame vom Kommissariat setzte sich in Bewegung.
»Los geht’s. – Hier entlang. Wir begeben uns auf die Wehrmauern. Jetzt heißt es klettern!«
Steile Stufen, viele davon. Dupin ging sie als Letzter an.
»Ja, also«, der Historiker, der die Gruppe zusammen mit Kommissarin Hupperts Assistentin anführte, übernahm mit sonorer Stimme und ehrwürdigem wissenschaftlichem Duktus, »eine Sache zu dem Mordfall, der uns alle gerade beschäftigt: Ich denke, Sie sind sich alle der Tatsache gewahr, dass es in der Menschheitsgeschichte nur so von Geschwister-Dramen wimmelt, bereits seit der Antike.«
Er war für die pointenlose Mitteilung kurz stehen geblieben.
»So, nun aber zum eigentlichen Sujet«, er setzte sich wieder in Bewegung. »Anders als die Innenstadt blieben die Wehranlagen von den fürchterlichen Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg weitgehend verschont, die Mauern gehen teilweise bis auf das 12. Jahrhundert zurück. Die klassizistischen Reederhäuser aus dem 18. Jahrhundert, die das charakteristische Stadtbild ausmachen«, routiniert deutete er mit der rechten Hand auf die Innenstadt Richtung Kirche, »wurden nach dem Krieg allesamt wieder originalgetreu aufgebaut. – Nie, nicht ein einziges Mal, hat ein Feind unsere Mauern im Kampf bezwingen können! Saint-Malo hat immer widerstanden.«
Kommissar Nedellec hatte sich auf Dupins Höhe zurückfallen lassen, die zwei Präfektinnen und Locmariaquer hatten weiter zum ersten Grüppchen aufgeschlossen.
»Chateaubriand, einer der vielen illustren Söhne der Stadt und einer der bewundernswertesten Autoren der französischen Sprache überhaupt, schrieb, dass die Ville Close von Saint-Malo, von der Fläche her nicht größer als der Tuileriengarten in Paris, der Welt mehr berühmte Persönlichkeiten geschenkt habe als viele andere, viel größere Städte.«
Es war bemerkenswert, zu welchem Nachdruck die Stimme des Historikers trotz der vielen Stufen in der Lage war.
»Neben den Korsaren, die beinahe über drei Jahrhunderte die Weltmeere beherrschten, erblickten hier weltbekannte Entdecker, Physiker, Ärzte und Schriftsteller das Licht der Welt. Etwa Jacques Cartier, der Kanada entdeckt hat, ein Land, zu dem wir bis heute engste Verbindungen pflegen. Pierre Louis Moreau de Maupertuis erforschte die Arktis, René Duguay-Trouin eroberte Rio de Janeiro. – In Saint-Malo hat man es mit der ganzen Welt zu tun!«
»Trouin. – Wie die beiden Schwestern«, murmelte Kommissar Nedellec.
Sie waren oben auf der erstaunlich breiten Mauer angekommen. Auf beiden Seiten ging es steil hinunter, eine steinerne Brüstung schützte vor dem Abgrund. Der Wind pfiff doppelt so stark wie unten. Ein klarer, belebender Wind.
»Aber«, der Historiker folgte der Mauer Richtung Norden, »fangen wir doch vorne an. – Begonnen hat alles mit einer Siedlung in Saint-Servan, genauer: auf der kleinen Halbinsel Alet, dort drüben«, er deutete in die entsprechende Richtung. »Dort legten die Kelten im ersten Jahrhundert vor Christus einen großen Versammlungsplatz an, der von den Römern nach der Eroberung Galliens zu einer kleinen Stadt ausgebaut wurde.«
Er meinte es wirklich ernst mit dem »Vorne Anfangen«.
Dupin war unauffällig ein paar Schritte zur Seite getreten; es reichte, um im Wind fast nichts mehr zu hören und sich dafür einen Moment von der Aussicht überwältigen zu lassen. Vom berückenden Licht, von den Farben. Natürlich war er davon ausgegangen, dass es einen guten Grund für den poetischen Namen des Küstenstreifens zwischen dem Cap Fréhel und Cancale gab – »Smaragdküste« –, aber eine derart dramatische Entsprechung hatte er sich nicht vorstellen können. Das Meer leuchtete tatsächlich smaragdfarben, geheimnisvoll und intensiv. Heller in seinen Tönen Richtung Ufer, mit rätselhaften dunklen Flecken am Horizont. Es war aufgewühlt, übersät mit hellweißen Gischtkronen – moutons