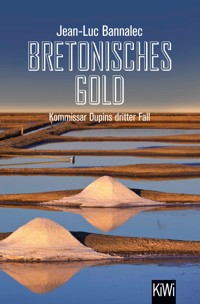10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Dupin ermittelt
- Sprache: Deutsch
Ein spannender Fall für Kommissar Dupin – mitten in den malerischen Weinbergen der Loire und am mysteriösen Lac de Grand-Lieu in der Bretagne. Kommissar Dupin und Claire verbringen ihre Flitterwochen an der Loire, im traumhaften Pays de Retz. Von Weingut zu Weingut, von einem kulinarischen Hochgenuss zum nächsten soll die Reise gehen. So zumindest der Plan. Doch dann wird ein bekannter Winzer ermordet, der Ex-Mann einer Freundin von Claire. Sie zählt auf Dupins Unterstützung, denn er ist bekannt für seine erfolgreiche Aufklärung kniffliger Fälle. Oder ist sie am Ende selbst in die Sache verwickelt? Dupin muss all sein Gespür und seine Erfahrung einsetzen, um den Mörder in der Welt der Winzer und vorzüglichen Weine zu finden. Seine Ermittlungen führen ihn auch an den größten See der Bretagne, den geheimnisvollen Lac de Grand-Lieu, an dem schon die berühmte Kosmetikdynastie Guerlain residierte. »Bretonischer Ruhm« ist der zwölfte Fall für den eigenwilligen Kommissar, der mit unkonventionellen Methoden und seinem untrüglichen Instinkt das Verbrechen aufzuklären versucht. Jean-Luc Bannalec bietet mit seinen aufregenden Krimis über Kommissar Dupin aus der Bretagne die optimale Lektüre für die Ferien: Mit scharfem Witz und einem Sinn für das regionale Kolorit lädt er ein in die atemberaubende Bretagne, wo der Atem des Atlantiks spürbar wird. Die Krimi-Bestseller aus der Bretagne sind in folgender Reihenfolge erschienen: - Bretonische Verhältnisse - Bretonische Brandung - Bretonisches Gold - Bretonischer Stolz - Bretonische Flut - Bretonisches Leuchten - Bretonische Geheimnisse - Bretonisches Vermächtnis - Bretonische Spezialitäten - Bretonische Idylle - Bretonische Nächte - Bretonischer Ruhm - Bretonische Sehnsucht - Bretonische Versuchungen Die Bücher erzählen eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Jean-Luc Bannalec
Bretonischer Ruhm
Kommissar Dupins zwölfter Fall
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Jean-Luc Bannalec
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Jean-Luc Bannalec
Jean-Luc Bannalec ist der Künstlername von Jörg Bong. Er ist in Bonn und im südlichen Finistère zu Hause. Die Krimireihe mit Kommissar Dupin wurde für das Fernsehen verfilmt und in zahlreiche Sprachen übersetzt. 2016 wurde der Autor von der Region Bretagne mit dem Titel »Mécène de Bretagne« ausgezeichnet. Seit 2018 ist er Ehrenmitglied der Académie littéraire de Bretagne. Zuletzt erhielt er den Preis der Buchmesse HomBuch für die deutsch-französischen Beziehungen und die Ehrenbürgerschaft der Stadt Concarneau.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
»Die optimale Urlaubslektüre mit viel Atmosphäre und sympathischen Figuren.« Frankfurter Rundschau
»Die Lösung des Falls ist so logisch wie überraschend, richtig gut ausgedacht. […] Schön zu lesen und spannend.« Ruhr Nachrichten
»Die gut dosierten Landschaftsbilder, schöne Farbspiele, ein nimmermüder Kommissar und seine quirlige Frau lassen einen Sommer mit Temperaturschwankungen gut temperiert über die Bühne gehen.« Vorarlberger Nachrichten
»Bannalec integriert Humor in seine Geschichten, etwas, das in Krimis allzu oft fehlt. Sein weiteres Markenzeichen ist die Art und Weise, wie er seine Liebe und sein Wissen zur Bretagne zum Ausdruck bringt, insbesondere in den Beschreibungen des völlig unvorhersehbaren Wetters und der erhabenen Schönheit der Region.« Washington Post über »Bretonische Geheimnisse«
»Ungewöhnlich spannend, voller Atmosphäre, mit einem grundsympathischen Ermittler, dessen Ecken und Kanten den Leser sofort für ihn einnehmen.« FAZ über »Bretonische Verhältnisse«
»Wie immer ein Sommerbuch.« Bücher Magazin
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2023, 2025 Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln
Covermotiv: © Hassan Bensliman / Adobe Stock
ISBN978-3-462-32085-5
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses Zusatzmaterial ist auch auf unserer Homepage zu finden:
www.kiwi-verlag.de/die-karten-zu-bretonischer-ruhm
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
Der erste Tag
Der zweite Tag
Der dritte Tag
Der vierte Tag
Der fünfte Tag
Der sechste Tag
À L.
C’hwezhet an avel e-lec’h ma karo
Pa ra glav e c’hleb atav.
Der Wind bläst, wohin er will,
bei Regen wird alles nass.
Bretonisches Sprichwort
Der erste Tag
»Zunächst müssen wir mit einem kriminellen Vorurteil aufräumen.«
Dupin hörte gespannt zu.
Die junge Frau reckte das Kinn kämpferisch nach vorn.
»Dem Vorurteil, dass es keine bretonischen Weine gibt!«
Dupin hätte es sich denken können.
»Selbstverständlich gibt es bretonische Weine!« Die Winzerin, schulterlange flachsblonde Haare, blickte streng. »Und sie gehören zu den besten, berühmtesten und beliebtesten der Welt.«
Was für alles Bretonische galt – dennoch war es im Hinblick auf den Wein eine kühne These: Dupin kannte einen Weinhügel südlich von Saint-Malo und ein paar Reben am Golfe du Morbihan, beides sehr hübsch, aber weltberühmt?
»Natürlich spreche ich von den Loire-Weinen.«
Natürlich.
Genau dort befanden sie sich gerade. An der Loire, unweit ihrer Mündung westlich von Nantes. Im Augenblick allerdings in einem hohen Gewölbe unter der Erde, stimmungsvoll beleuchtet, ja, mit einem riesigen, alten Kerzenleuchter – aber eben unter der Erde. Nicht Dupins Sache, er mochte weder Höhlen noch Tunnel, nicht einmal gewöhnliche Keller. Es war bei Weitem nicht so schlimm wie seine ausgeprägte Angst, auf dem Meer zu sein, aber dennoch …
»Die meisten Menschen machen sich gar nicht bewusst«, tadelte die engagierte Winzerin, »dass die Loire, der längste Fluss Frankreichs, eigentlich ein urbretonischer Fluss ist. Sie mündet nicht bloß nach tausendundzwölf Kilometern in der Bretagne, ihre ganzen letzten hundert Kilometer fließt sie durch bretonische Lande.«
Und was war mit den anderen neunhundertundzwölf Kilometern? Waren es nicht deutlich mehr Kilometer, die die Loire nicht durch die Bretagne floss?
Dupin musste allerdings zugeben, dass er sich das mit den letzten hundert bretonischen Kilometern tatsächlich nie klargemacht hatte. Und so würde es wahrscheinlich den meisten Menschen gehen, auch Bretonen. Wobei man freilich erwähnen musste, dass das Département Loire-Atlantique im administrativen Sinne gar nicht mehr zur Bretagne gehörte, seit es ihr im Zuge einer Verwaltungsreform Mitte des 20. Jahrhunderts entrissen worden war. Und das, obwohl die Region doch seit Tausenden Jahren ein wesentlicher Teil der Bretagne gewesen war. Woran sich, so das Empfinden der meisten Einwohner, auch nach dem kaltherzigen Verwaltungsakt nichts geändert hatte. Selbstredend gehörten Nantes – einst stolze bretonische Hauptstadt – und seine Umgebung samt der Guérande und ihrer legendären Salzgärten unverändert zur Bretagne. In der Wahrnehmung der übrigen Welt sowieso.
»Schon der Name Loire«, fuhr die Winzerin mit Begeisterung fort, »geht aufs Bretonische zurück: Liger, das bedeutet so viel wie ›königlicher Fluss‹. Heute ist die Loire einer der letzten großen naturbelassenen Flüsse Europas. Und an vierhundert der tausend Flusskilometer wird Wein angebaut. Auf über siebzigtausend Hektar, und zwar seit rund zweitausend Jahren, seit den Römern.«
Sie musste kurz Luft holen.
»Die ungemeine Vielfalt der Landschaften der Loire spiegelt sich in der Vielfalt der Weinsorten wider, denen allen etwas gemein ist: eine einzigartige Frische, Frucht und Eleganz. – Denken Sie an die Sancerre- oder Pouilly-Fumé-Weine vom Oberlauf des Flusses, die uns mit klassischen Sauvignon Blancs verwöhnen.«
Dupin dachte gerne an klassische Sauvignon Blancs.
»Oder an die Touraine-, Saumur- und Anjou-Weine der mittleren Loire. Hier brillieren die autochthonen Sorten Chenin Blanc und der rote Cabernet Franc – nicht bloß die romantischen Schlösser.«
Auch an die Chenin Blancs und den roten Cabernet Franc dachte Dupin ausgesprochen gerne.
Die Winzerin musterte die neun Teilnehmer der Weinverkostung in der Fontaine aux Bretons am südlichen Rand von Pornic, einschließlich Claire und Dupin.
Seit drei Tagen waren Claire und der Kommissar verheiratet. Letzten Donnerstag war es geschehen, im Standesamt von Concarneau, wo sonst. Nach einem ausgelassenen Fest am Samstagabend im Amiral – wo sonst – waren sie gestern Nachmittag zu ihrer Hochzeitsreise aufgebrochen. Und, das war der Plan gewesen, genau rechtzeitig zum Abendessen angekommen. Sie hatten draußen auf der Terrasse gesessen, genauer: inmitten eines wilden, üppig sprießenden Kräutergartens, inmitten einer betörenden Mischung ätherischer Düfte von Salbei, Thymian, Rosmarin, Estragon, Minze und Majoran. Und überaus köstlich gespeist. Kreationen, in denen sich viele der Düfte wiederfanden.
Gegen neun war die Sonne als spektakulär blutrotes Drama untergegangen, der Himmel hatte lange nachgeleuchtet. Ein perfekter Sommerabend hier an der Côte de Jade, der Jadeküste, im äußersten bretonischen Süden, ein laues Lüftchen wehte, noch über zwanzig Grad in der Nacht.
Heute Morgen beim Aufwachen – vor nicht einmal einer Stunde, kurz nach elf – hatte es dagegen in Strömen geregnet, ein Wolkenbruch, der bis zu ihrem Abstieg in das Gewölbe immer stärker geworden war.
Die Winzerin kam zur letzten Loire-Etappe: »In der Region um Nantes bis zur Mündung schließlich regiert die Rebsorte Melon de Bourgogne, die man auch unter dem Namen Muscadet kennt. Gut gekühlt ist der Wein ein herrlicher Begleiter zu Austern, überhaupt zu allen Meeresfrüchten. Selbst die berühmtesten Gourmets bestätigen das!«
Dupin war überzeugt: Niemand käme auf die Idee zu widersprechen. Claire und er hatten die Traube erst gestern Abend eingehend genossen. Zuerst mit, dann ohne Meeresfrüchte.
»Hier im Pays de Retz, der Region südlich der Loire-Mündung, gibt es jedoch noch viel mehr Weinschätze zu entdecken als den Muscadet – bei uns in der Fontaine zum Beispiel den Grolleau Gris. Eine sehr alte, extrem seltene Rebsorte. Und auch die Rebstöcke sind alt, seit dreißig Jahren stehen sie auf unserem Weinberg unmittelbar am Meer. Le Clos du Rocher. Ein Kalk- und Tonboden. Wer den Weinberg noch nicht kennt: Schauen Sie ihn sich im Anschluss an die Verkostung an. Graue Beeren, eine Variante der weißen Grolleau-Traube, sie wurden früher meist bloß zum Verschnitt eingesetzt. Ein trauriges Schicksal, das nicht wenige großartige Rebsorten erlitten.«
Aus ihrem Blick sprach lebhafter Missmut.
»Wir dagegen lassen die Traube ihre Qualitäten ganz von selbst entwickeln. Wir machen einen reinen Grolleau Gris, zu hundert Prozent. Ich sage immer: der perfekte Sommerwein, und zwar für jeden Tag!«
Dupin war bereit, es auszuprobieren, unbedingt. Die Winzerin vermochte eindrucksvoll zu überzeugen. Es gelang ihr sogar, ihn von dem engen Gewölbe abzulenken. Ein nicht zu verachtender Nebeneffekt.
»Auch der Grolleau passt fantastisch zu Austern und anderen Meeresfrüchten, freilich auch zu Fisch und weißem Fleisch. Wichtig ist nur: Er muss zwischen acht und zehn Grad kalt sein – nie wärmer!« Ihr Blick hatte etwas Verzücktes angenommen. »In der Nase der Duft von Honig und reifen Früchten, wobei die Passionsfrucht dominiert – wenn auch mit geziemender Dezenz, um der Aprikose und Birne noch hinreichend Raum zu lassen. Und natürlich den Zitrusfrüchten, der klassischen Grolleau-Note. Aber jetzt verrate ich schon zu viel.«
Vor allem hatte sie Dupin den Mund wässrig gemacht.
»Darüber hinaus kreieren wir hier einen fabelhaften Chenin Blanc wie auch zwei rote Weine. All unsere Weine spielen mit den Elementen der besonderen Lage hier, wo sich Land und Meer so unmittelbar begegnen. Einer der roten ist ein Cabernet Franc. Auch eine ganz alte Traube, aus der die Merlot-Rebe hervorgegangen ist. Äußerst geringe Adstringenz, Sie können ihn bereits ganz jung trinken. Und ebenfalls richtig herunterkühlen.«
Dupin mochte das im Sommer sehr: junge, gekühlte Rotweine. Er hatte es immer schon gemocht, seit einigen Jahren war es geradezu eine Mode geworden.
»Die andere rote Traube ist die autochthone Abouriou. Himmlisch fruchtig – etwas Johannisbeere, aber mehr noch Erdbeere und Himbeere. Ein tiefdunkler Wein. Was daran liegt, dass die Trauben fast schwarz sind. Zudem rund wie Murmeln, prall von Saft.«
Es wurde immer schlimmer, Dupins Mund immer wässriger. Jeder Kelch ging an ihm vorüber, sinnierte er in einem kleinen Anfall von Melancholie.
»Phänomenal wenig Säure. – Überhaupt phänomenal«, die Wangen der Winzerin färbten sich selbst weinrot. »Ach!«
Sie machte eine wirkungsvolle dramaturgische Pause.
»Es gibt so viel zu erzählen, so viel zu wissen. Ein großer Weinliebhaber hat einmal gesagt: ›Wer ihn wirklich zu genießen vermag, trinkt keinen Wein mehr, sondern kostet Geheimnisse.‹ Genauso ist es: Einen Wein zu genießen, ist eine Kunst. Und wie bei jeder Kunst gehören Wissen und Können dazu. – Dabei ist es keine komplizierte Detektivarbeit, sondern im Prinzip ganz einfach. Wie der Wein selbst: Traubensaft, dessen Zucker zu Alkohol wird. Und doch ist seine Vielfalt schier grenzenlos.«
Sie seufzte.
»Weltweit gibt es über zehntausend Rebsorten! – Zum Weinbau offiziell zugelassen sind davon zweitausendfünfhundert, bei uns in Frankreich, dem Zentrum der Weinkultur, rund zweihundert. Wobei sich der Hauptanteil der Produktion, rund zwei Drittel, auf gerade mal zehn Sorten beschränkt. Schon deswegen engagieren wir uns für alte, seltene Arten, in denen ungeheure geschmackliche Möglichkeiten liegen. Ich kann Ihnen nur raten: Lassen Sie sich ein auf die Erkundung der immensen Vielfalt! Jede Rebsorte ist anders, besonders, einzigartig. – Welch Reichtum!«
Jetzt wurde die Winzerin vollends pathetisch.
»Aber: Die Rebsorten sind nur ein Faktor von vielen, die über einen Wein, sein Wesen und seinen Geschmack entscheiden. Es beginnt mit dem Charakter des Bodens und Ortes. Gleiche Rebsorten in verschiedenen Lagen können völlig unterschiedlich schmecken. Anders, als man denkt, entstehen die besten Weine nicht auf den besonders fruchtbaren Böden, das produziert bloß gepflegte Banalität, sondern ganz im Gegenteil: in Lagen, auf denen sich die Reben quälen. Wo ihnen das Äußerste abverlangt wird. Das allein schafft Charakter! Grenzsituationen, wie hier bei uns am offenen Atlantik. Das alles Entscheidende aber ist der Winzer! Sein Savoir-faire, seine Ideen, seine Visionen – und die Fähigkeit, sie umzusetzen.«
Sie strahlte.
»Natürlich hängt das Weinerlebnis auch von den ganz konkreten Bedingungen des Genusses ab. Denken Sie bloß an die falsche Temperatur: Schon ein paar Grad zu viel töten die edelste Rebsorte. – Und natürlich ist Weingeschmack etwas Individuelles, lassen Sie sich von keinem Experten einschüchtern! Der eine mag frische, säurebetonte Weißweine, der andere eher milde. Wobei Säure nichts Negatives ist, an ihr hängen köstliche Aromen wie Zitrone, Ananas, Aprikose, Pfirsich, Stachelbeere, Kiwi oder auch Apfel. Wieder ein anderer bevorzugt kräftige Rotweine.«
Dupin gab den samtigen Rotweinen den Vorzug, solchen, die stark und alkoholreich waren.
»Die Wahrheit ist: Jeder muss den Wein finden, der zu seinem Körper, seinem Wesen, seinem Geist passt.«
Noch ein Seufzen der Winzerin, es kam tief aus dem Herzen.
»Aber jetzt zu uns. Wir wollen heute Ihren Geschmack schulen. Ihre Sinne für Aromen schärfen. Und Ihnen ein paar Grundlagen der Ansprache vermitteln – das ist der Fachbegriff für eine Weinbeschreibung.«
Eine Übung, die Dupin nie plausibel gewesen war.
»Wir werden jetzt nacheinander die vier Weine unserer Fontaine verkosten.«
Endlich kamen sie zum praktischen Teil.
»Zudem einen Muscadet der Domaine du Lac, die einem befreundeten Winzer gehört. Ein Muscadet, der erst kürzlich eine prestigeträchtige Goldmedaille errungen hat, direkt von den Ufern des Lac de Grand-Lieu, keine halbe Stunde von hier.«
Jetzt war es Dupin, der strahlte. Übermorgen würden Claire und er diesen Muscadet genau dort, in der Domaine du Lac selbst, trinken. Die zweite Station ihrer Reise.
Die Winzerin blickte in die Runde, die Teilnehmer wiederum blickten auf die mit zahlreichen Flaschen befüllten Weinkühler, die auf dem Tisch standen.
»Sie wissen, dass wir eine Éco-Domaine sind. Auf unseren zwei Hektar wird streng ohne Herbizide und Pestizide gearbeitet. Übrigens auch ohne Maschinen. Alles geschieht von Hand.«
Claire hatte Dupin das alles bereits ausführlich erörtert. Die Eigentümerin der Auberge La Fontaine aux Bretons, Cécile Cast, war eine Freundin von Claire. Claire hatte Cécile über Anne kennengelernt, die Ärztin in Nantes war, Kardiologin wie Claire. Cécile hatte Claire und ihn schon letztes Jahr eingeladen, sie auf ihrem Weingut zu besuchen. Weingut, Hotel und Restaurant in einem. Claire und Dupin hatten kommen wollen, es aber nicht geschafft. Jetzt hatte sich alles perfekt gefügt. Eine Hochzeitsreise an die Loire, in die Weinberge: Schöner ging es nicht.
»Und jetzt schlagen wir unsere Weintagebücher auf – die roten Hefte, die vor Ihnen liegen.«
Die Stimme der Winzerin hatte sich verändert, fand Dupin. Wo war der Enthusiasmus geblieben? Er hatte als Auftakt der Verkostung und nach der langen Vorrede eher an einen ersten großen Schluck gedacht als an ein Weintagebuch.
Vor jedem Platz an dem schmalen, dafür beeindruckend langen Holztisch lag ein kleines Ensemble: ein Taschenbuch über Loire-Weine, eine Broschüre über die Fontaine aux Bretons, eine kreisrunde Schablone und ebenjenes Weintagebuch. Bordeauxrot mit einem Motiv: ein stilisierter schwarzer Korkenzieher. Darüber stand Weintagebuch in dicken schwarzen Lettern, es hatte ganze hundertvierundvierzig Seiten.
Nur widerwillig schlug Dupin es auf.
»Jede Seite ist für einen Wein bestimmt. Es beginnt mit grundlegenden Informationen: Name, Datum und Ort der Verkostung, Alkoholgehalt, Rebsorte. Dann sehen Sie fünfstufige Skalen für die Bestimmung von Körper, Tanninen, Geschmacksintensität, Säure und Süße.«
Die Sache wurde immer ernster.
»Die Verkostung selbst vollzieht sich, wie Sie wissen, in vier Etappen. Erstens: optischer Eindruck – das Auge trinkt mit! Zweitens: Bouquet – die Nase noch viel mehr. Drittens: Geschmack. Viertens: Abgang. – Alle vier gilt es zu bestimmen. Unten finden Sie zudem Raum für umfangreiche Notizen.«
Als Claire ihm von der Idee mit den Weinproben erzählt hatte, war er begeistert gewesen. Er liebte Weine, besonders die der Loire. Und er war tatsächlich noch nie an der Loire gewesen, ein unverzeihliches Versäumnis. Auf jeder der Stationen ihrer neuntägigen Reise hatten sie mindestens eine Verkostung eingeplant. Dupin hatte sich das Ganze ausgesprochen fröhlich ausgemalt – an umfangreiche Notizen, Bestimmungen in vier Etappen, fünfstufige Skalen und technische Angaben hatte er jedenfalls nicht gedacht. Wobei ihn vor zwei Wochen schon ein erstes Mal eine leichte Skepsis heimgesucht hatte. Claire hatte ihn mit einem Geschenk zur Vorbereitung der Reise überrascht. Le nez du vin, Die Nase des Weins, hieß das überformatige, kiloschwere Buch. Es ging um ein umfassendes Wahrnehmungs- und Bestimmungstraining. Eine intensive Verkostungsübung. Claire konnte gar nicht mehr aufhören, davon zu schwärmen. Der Clou des Buchs bestand in vierundfünfzig winzigen Fläschchen mit typischen »Grundaromen« des Weins, die dem Buch beilagen. Eigentlich gab es weit über tausend Aromen, hatte Claire ausgeführt. Sie hatte für das Getue mancher Wein-Connaisseure so wenig übrig wie Dupin, aber liebte den wissenschaftlichen Ansatz. Dupins Leidenschaft war dagegen ausschließlich praktischer Natur.
»Ans Werk!« Der Ton der Winzerin glich plötzlich dem einer Lehrerin. »Zuerst die grundlegenden Informationen. – Wir beginnen mit dem Grolleau Gris.«
Vielleicht war es ja tatsächlich besser, nicht direkt einen kräftigen Schluck zu nehmen. Sie waren spät aufgestanden, zum Frühstück hatte es vor der Degustation nicht mehr gereicht. Sie hatten bislang nur Kaffee im Magen. Mehrere der perfekt gekühlten Grolleau-Gris-Flaschen machten die Runde. Alle begannen eifrig mit den Notizen, auch Claire.
»Falls Sie sich fragen, was das für schwarze Eimerchen sind, die an jedem Platz stehen – das sind professionelle Degustations-Spucknäpfe.«
Ein paar Teilnehmer nickten wissend, die anderen schauten fragend.
»Damit es keine Missverständnisse gibt«, instruierte die Winzerin, die eben noch so sympathisch gewirkt hatte, »bei einer Weinprobe wird nicht getrunken! Sie verkosten, dann spucken Sie den Wein in die Näpfe.«
Nicht dass Dupin vorgehabt hätte, sich heute Mittag in einer Gruppe von Unbekannten zu betrinken – aber so hatte er es sich auch nicht vorgestellt.
Ein junger Mann kam die steile Wendeltreppe herunter. Die Wände des Gewölbes bestanden aus kahler Erde, hier und dort nackter Stein. Einzelne Stahlpfeiler zum Stützen. Ganz ähnlich musste es bereits Anfang des 19. Jahrhunderts ausgesehen haben, als der Keller gebaut worden war. Natürlich wirkte das alles sehr pittoresk – solide Architektur aber, fand Dupin, war etwas anderes.
»Hallo? Ich suche einen Monsieur Dupin.«
»Hier!«
Alle sahen ihn an.
»Ein Telefonat für Sie. Eine Dame. Sie sagte, es sei dringend.«
Dupin sprang auf – nicht ohne Claires missbilligenden Blick zu bemerken. Aber was sollte er tun? Er holte sein Handy hervor. Kein Empfang, nicht ein einziger Balken.
»Hat die Dame ihren Namen genannt?«
»Nein. Das wollte sie nicht.«
Das war gar nicht Nolwenns Art. Sonderbar.
Der Mann machte kehrt und stieg die Treppen wieder hoch.
Dupin steuerte auf die Wendeltreppe zu. Kurz darauf stand er an der Rezeption.
Der Mann reichte ihm ein schnurloses Telefon.
»Ja?«
»Monsieur le Commissaire?«
»Am Apparat.«
Er kannte die Stimme, aber es war nicht Nolwenn, seine fabelhafte Assistentin.
»Hier Madame Claudel.«
Ihre Nachbarin in Concarneau, Anfang neunzig mittlerweile.
»Das war es mit Ihrem Haus, Monsieur.«
»Wie bitte?«
»Na, Ihr Haus. Es wird zerstört.«
»Zerstört?«
»Oben. Die Holzkonstruktion.«
Sie hatten, nachdem sie das Haus gekauft hatten, das Dach ausbauen lassen. Und ein schönes Fenster als großzügigen Erker in die Schräge eingefügt. Ein Ausbau aus naturbelassenem Holz.
»Was meinen Sie, Madame?«
»Ein pic vert, ein Grünspecht. Sie wissen, die durchlöchern alles. Gnadenlos«, schob Madame Claudel hinterher. Es klang nach einem Monster in einem Horrorfilm.
»Was?«
»Die Jahre zuvor war er bei Corinne und François zugange. Letzten Herbst haben sie ihre gesamte hübsche Holzfassade durch Plastik ersetzen lassen. Sehr hässlich – aber effektiv.«
»Ich … Was meinen Sie mit: Die durchlöchern alles?«
»Na, dass Ihr Specht kreisrunde Löcher in das Holz und in die Isolation dahinter pickt. Vier Stück sind es bereits.«
»Vier Löcher?« Es schien eine ernste Angelegenheit zu sein.
»Genau das habe ich doch gerade ges…«
»Warum? – Sucht er Insekten?«
»Ach wo! – Da ist doch nichts. Das weiß er.«
Eine Pause.
»Er will ein Nest bauen.«
»In unserem Haus?«
»So ist es.«
Madame Claudels Tonfall besagte: Endlich ist der Groschen gefallen.
»Warum vier? – Vier Nester? Eins für jede Jahreszeit?«
»So ein Quatsch! Er will die Weibchen beeindrucken. Je mehr Nester, desto besser. – Und wenn er merkt, dass das Isolationsmaterial nicht für ein Nest geeignet ist, versucht er es an einer anderen Stelle von Neuem. Nur um festzustellen, dass sich dort das gleiche Material …«
»Dann wird er sicher bald aufhören.«
Am anderen Ende der Leitung war ein beinahe hysterisches Lachen zu hören.
»Aufhören? Von wegen! – Sie haben ja keine Ahnung! – Corinne und François waren nur ein langes Wochenende verreist, Sonntagabend waren es dann neun Löcher! Kurz darauf schon achtzehn! Wissen Sie, wie teuer das ist? Ich meine, was sie am Ende bezahlt haben? Zweiundfünfzigtausend Euro.«
»Zweiundfünfzigtausend Euro?«
»Das zahlt keine Versicherung. Und es sieht auch noch abscheulich aus. Sei’s drum. – Auf jeden Fall müssen Sie auf der Stelle etwas unternehmen, Monsieur le Commissaire. Wenn der Specht merkt, dass ihn niemand aufhält, führt er sein Werk ungestört fort. Dann ist nach der Honigreise Schluss mit der Heiterkeit.«
»Hochzeitsreise, Madame Claudel.«
Schon vor ihrer Abreise hatte Madame Claudel konsequent von der Honigreise gesprochen.
»Tja dann. – Ich wollte ja nur Bescheid geben.«
Sie wirkte eingeschnappt.
»Ich kümmere mich um die Sache, Madame Claudel. – Ich danke Ihnen sehr.«
»Ich wünsche Ihnen viel Glück!« Madame Claudel legte auf.
Einen Moment stand Dupin ratlos da.
Mit einem Mal hellte sich sein Gesicht auf. Das war die Lösung, natürlich.
Rasch wählte er die Nummer.
»Ah! – Der Kommissar im Glück! Na, wie ist es, Chef?«
Der Tonfall seines ersten Inspektors war kokett.
»Riwal, ich brauche Sie.«
Wenn jemand wusste, wie dieses Problem zu lösen war, dann Riwal. Er war Dupin schon bei mehreren Auseinandersetzungen mit bretonischen Wildtieren zu Hilfe gekommen. Durchweg auf naturfreundliche Art. Und so sollten sie es auch im Falle des neuen Angreifers halten.
»Ein Grünspecht attackiert unser Dach, Riwal. Den Ausbau oben. Er hat schon vier Löcher gemacht.«
Stille.
»Riwal? – Hallo?«
War die Verbindung unterbrochen worden?
»Ich bin noch da, Chef.« Ein resignierter Tonfall. »Das ist nicht gut, Chef.«
Dupin hatte eine andere Reaktion erhofft.
»So ein Specht muss doch zu stoppen sein, Riwal.«
»Ganz ehrlich, Chef?«
»Natürlich ganz ehrlich, Riwal.«
»Ist er nicht.«
»Was meinen Sie damit?«
»Am Ende bleibt Ihnen nur eines: das Holz durch ein synthetisches Material zu ersetzen. WPC oder so. Was leider nicht allzu schön aussieht.«
Niemals würde Claire das zulassen.
»Es muss doch Wege geben, einen Specht zu vertreiben, Riwal.«
»Werfen Sie mal einen Blick ins Internet und die sozialen Netzwerke, Chef. Da finden sich Tausende Tipps. – Der eine empfiehlt eine lautstarke Beschallung mit Heavy Metal, der andere bunte Netze, in die man das Haus einwickeln soll. Wieder andere lebensgroße realistische Uhu-Imitationen alle zwei Meter auf verschiedenen Höhen – ein natürlicher Feind des Spechts. Wobei die Methode umstritten ist. Es gibt Gerüchte, dass sich die Spechte daran gewöhnen.«
All das würde nicht infrage kommen.
»Nichts davon hilft wirklich, Chef. Höchstens kurzfristig. Der Specht ist ein kluges Tier. – Sie wissen ja, wie intelligent die meisten Vogelarten sind.«
In ihrem letzten gemeinsamen Fall war es um Vögel gegangen. Unter anderem.
»Aber lassen Sie sich Ihre Hochzeitsreise nicht verderben.«
Das war leichter gesagt als getan.
»Ich fahre gleich mal mit Kadeg zu Ihrem Haus. Das können wir ja in den nächsten Tagen ab und zu machen.«
Das war zwar von einer echten Lösung weit entfernt, aber besser als gar nichts.
»Herzlichen Dank, Riwal. Das ist sehr nett von Ihnen.«
Das war es wirklich.
»Ist doch selbstverständlich, Chef. – Genießen Sie die Zeit!«
Dupin legte auf.
Nachdenklich begab er sich auf den Weg zurück in die Unterwelt.
Schon auf der obersten Stufe schallte ihm der Satz entgegen:
»Und nun alle ran ans Aromenrad!«
Die Winzerin sprach offenbar von der Scheibe aus Pappe, die jeder an seinem Platz liegen hatte.
Claire schien bester Dinge.
Die Gläser hatten sich nun auch mit realem Wein gefüllt, nicht nur mit theoretischem. Ein Fortschritt in Dupins Sinne.
»Es gibt keine falschen Geschmacksassoziationen!«, instruierte die Winzerin generös.
»Sinneseindrücke sind subjektiv. – Nur keine Hemmungen!«
Hemmungen hatte Dupin keine – bloß das dringende Bedürfnis nach einem guten Schluck Wein.
»Tasten Sie sich von den vordergründigen Aromen zu den subtileren, hintergründigen. Achten Sie bei einem Weißwein zuerst auf Frucht oder Blumen und Blüten. Dann auf die grünen oder vegetalen Aromen, zum Beispiel schwarzer Tee, grüne Paprika, Minze oder andere Kräuter. – Also, was sind die ersten Schritte?«, wandte sich die Winzerin an die aufgeregt wirkende Dame direkt neben sich.
Die Antwort kam prompt: »Schwenken und schauen, dann schwenken und riechen!«
Die Winzerin nickte zufrieden.
Artig hatte Dupin seinen Platz eingenommen. Auch sein Glas war gefüllt. Und eine der Flaschen war bei ihm stehen geblieben.
»Kein anderer Sinn ist bei uns Menschen so ausgeprägt wie der Geruchssinn.« Die Winzerin wurde philosophisch. »Zugleich entzieht sich keiner so weitgehend der Sprache. Deswegen unsere Übungen! Über achtzig Prozent dessen, was wir Geschmack nennen, kommt bei uns Menschen über die Nase zustande, also eigentlich durch den Geruch – nur zwanzig Prozent über den Mund und das Schmecken im eigentlichen Sinne. Die Zunge schafft gerade mal sechs Bestimmungen: süß, salzig, sauer, bitter, herzhaft, fettig. Die Nase entscheidet die Dinge! Auch die zwischenmenschlichen Beziehungen: Wen mögen wir, wen nicht? In wen verlieben wir uns, in wen nicht? Wen können wir überhaupt nicht riechen?«
Claire hatte ihm das bereits anhand des großen Aromenbuches erklärt: Der Geruchssinn war mit dem limbischen System verknüpft, das im Hintergrund mehr regelte, als einem bewusst und lieb war.
»Und wenn Sie dann den ersten – wohlgemerkt – kleinen Schluck nehmen: den Mund dabei stets ein bisschen offen halten!« Die Winzerin kam zum Konkreten zurück. »Wein braucht Sauerstoff, ganz wie wir Menschen. Kein Gurgeln, aber ein Hin-und-her-Wenden.«
Es folgte ein strenger Blick in die Runde.
»Riechen und schmecken Sie genau! Dann spucken Sie aus. Und riechen und schmecken abermals. Jetzt sind Sie ganz Nase und Mund! – Zum Auge kommen wir später. Und sprechen Sie Ihre Geschmackseindrücke laut aus! Ungefiltert, spontan – später diskutieren wir sie dann systematisch. Also los!«
Den Teilnehmern war der Respekt anzumerken, während sie das Glas zum Mund führten.
Ehrfurchtsvoll nahm jeder einen Schluck und versuchte, so geräuschlos und vornehm wie möglich in den Napf zu spucken. Dann trat Stille ein. Aber nur kurz.
»Heu!«
»Mandel!«
»Zitrusfrüchte – Pampelmuse.«
Jeder schien es versuchen zu wollen. Es ging wild durcheinander.
»Pfirsich.«
»Hefe! Hefe!«
»Quitte!«
»Sehr gut!«, applaudierte die Winzerin. »Weiter so! Wein ist Poesie in Flaschen, hat Robert Louis Stevenson gesagt, und der wusste, wovon er sprach. Die Schiffsmannschaft auf dem Weg zur Schatzinsel suchte seinerzeit selbst Inspiration im Wein.«
In Spirituosen jeglicher Art, dachte Dupin.
Er hatte sein Glas mit einem einzigen großen Schluck geleert. Unbemerkt. Und er hatte beobachtet, dass auch Claire nichts ausgespuckt hatte. Dupin nahm es als Ermutigung, sich ein zweites Glas einzuschenken, während weiter frei assoziiert wurde:
»Unbedingt Apfel. Richtung Granny Smith.«
»Eher Birne, finde ich.«
»Litschi!«
»Anis und Artischocke.«
Es erschien dem Kommissar ein wenig willkürlich. Was dem Wein selbst natürlich keinen Abbruch tat. Der Grolleau Gris war wunderbar. Und tatsächlich: Dupin schmeckte Birne. Vor allem beim zweiten Glas, das er ebenfalls in einem Zug trank. Der Blick der Winzerin streifte ihn dabei kurz – Dupin meinte ein leichtes Schmunzeln auf ihren Zügen wahrzunehmen.
Der zweite Tag
Der fabelhafte Grolleau Gris war zum bestimmenden Thema des gestrigen Tages geworden. Eines rundherum glückseligen Tages, mit sehr frühem Aperitif und einem Abendessen, das bis tief in die Nacht ging. Zwischen der Degustation am Vormittag und dem Aperitif hatte es ein ausgedehntes Mittagessen auf der Terrasse gegeben, abermals begleitet von dem famosen Wein, er war äußerst verträglich. Nach dem Mittagessen hatten sie im verwunschenen Garten in der Sonne gelegen, die den Regen mit aller Kraft vertrieben hatte. Für gewöhnlich scheute Dupin Müßiggang, er war physisch und psychisch gar nicht dazu in der Lage.
»Das ist also der Trick«, hatte Claire angemerkt, »darauf hätte ich schon bei unseren Ferien an der Rosa Granitküste kommen sollen: eine konstante leichte Alkoholisierung bei sommerlichen Temperaturen …«
Eigentlich hatten sie nach dem ausgedehnten Mittagessen vorgehabt, ein Stück an der Küste entlangzuspazieren. Wozu es dann natürlich nicht gekommen war. Immerhin war es ihnen vor dem Aperitif gelungen, eine Runde um das weitflächige Anwesen zu drehen. Eine durch und durch friedliche, in sich geschlossene Welt: sanfte Senken, dunkelgrüne Teiche, ein Bach, kleine Wälder, wilde Wiesen. Zudem gab es Gemüse- und Kräutergärten und natürlich den Weinberg. Und viele Tiere. Pferde, Schafe, Hasen, Meerschweinchen, Schweine, Truthähne, Hühner, Frösche, Gänse, Enten. Dupins Lieblinge aber waren ganz ohne Zweifel die beiden Esel, Tristan und Isolde. Von dem Grünspecht hatte er Claire vorsichtshalber noch nichts erzählt, er würde sich heute erneut bei Riwal melden. Vielleicht wäre das Problem dann schon erledigt. Riwal war durchaus in der Lage, Wunder zu vollbringen.
Heute, es war elf Uhr, saßen Claire und Dupin im romantisch-verwilderten Garten vor dem hübschen alten Haupthaus der Fontaine, in dessen Parterre das Restaurant und eine kleine Hofboutique lagen. Das Hotel, das erst vorletztes Jahr gebaut worden war, befand sich hinter dem Haupthaus. Zuvor hatte es nur ein paar wenige Gästezimmer gegeben.
Von überall blickte man aufs Meer, bis hin zur Île de Noirmoutier, die ungefähr zwanzig Kilometer entfernt lag. Sie war lang und flach und streckte sich weit in den Atlantik. Die Küste zwischen ihr und Pornic bildete eine gewaltige Bucht. Die Baie de Bourgneuf.
Claire und Dupin hatten einen Tisch inmitten der wilden Kräuterwelt als ihren Frühstücksplatz auserkoren, ein halbes Dutzend gab es davon. Dupin hatte noch nie so verrückt wuchernde Kräuterbüsche gesehen, durchsetzt von Blumen in allen Farben. Die dunkelgrünen Stühle waren überaus bequem, sicher auch, weil die Sitzflächen aus luftigem Geflecht bestanden. Verwitterte hohe Steinmauern schützten den weitläufigen Garten, durch ein offen stehendes schmiedeeisernes Tor fiel der Blick direkt auf den Weinberg, er lud zum Flanieren ein, so konnte man unmittelbar bestaunen, was man später trinken würde.
»Was meinst du – vielleicht machen wir heute den roten Abouriou zum Thema des Tages?«
Claire lächelte Dupin an.
»Unbedingt.«
Es stand zwar keine Verkostung auf dem Programm, aber das hinderte sie ja nicht daran, genau das zu tun. Probiert hatten sie den Wein gestern schon – und sie waren absolut begeistert gewesen. Die nachdrückliche Aufforderung der Winzerin, die enorme Vielfalt an Rebsorten zu erkunden und nicht zur gefährlichen Reduktion der Biodiversität auf Erden beizutragen, war unbedingt ernst zu nehmen, da waren Claire und Dupin sich einig.
»Ich finde, wir widmen jeden Tag unserer Reise einer bestimmten Traube.«
»Hervorragend.«
Dupin schenkte Claire und sich aus der großen Kaffeekanne nach. Ein Schluck heiße Milch dazu – perfekt. Ideal auch, um ein pain au chocolat hineinzutunken. Zwei Hummeln umkreisten die Kaffeetassen, sie schienen den Duft ebenso zu lieben wie Dupin. Irgendwo mussten sich Scharen von Vögeln befinden, ein heiteres Tirilieren war zu hören – nur war kein einziger Vogel zu entdecken. Seltsam. Das war Dupin schon gestern aufgefallen.
Dupin trug eine Kappe, das Thermometer war schon jetzt auf stolze 29 Grad geklettert – obgleich es einer dieser Tage war, an denen sich das Wetter urbretonisch präsentierte: ultimativ wechselhaft. Man würde jeden Schwur leisten, dass der gesamte restliche Tag so sonnig bliebe wie jetzt. Und zehn Minuten später würde es in Strömen regnen. Dann, wenn man es sich auf dem Sofa gemütlich gemacht hätte, würde einen die Sonne zehn Minuten später abermals ins Freie locken … Aber ein echter Bretone ließ sich von so etwas nicht zum Narren halten.
Dupin war in die Zeitung vertieft.
»Wusstest du, dass das Restaurant einen eigenen Fischer hat? Der sich exklusiv um den Tagesfang kümmert?«
Dupins Handy klingelte. Er ignorierte es.
Claire und er hatten sich strenge Regeln überlegt, wie sie es auf ihrer Hochzeitsreise mit der Arbeit halten würden. Beide hatten ihren Kollegen mitgeteilt, dass sie nur in absoluten Notfällen erreichbar wären. Dupin hatte zudem versprechen müssen, sich bei kriminellen oder auch nur verdächtigen Vorkommnissen während der Reise vollständig rauszuhalten. Auf keinen Fall sollte es enden wie vor sechs Jahren, als sie versucht hatten, gemeinsam Ferien zu machen. Und – überaus erstaunlich, aber wahr – Dupin verspürte tatsächlich keinen Drang, zu wissen, was sich im Kommissariat in Concarneau abspielte …
»Wenn es etwas Ernstes wäre, würde ich es schon erfahren.« Dupin ließ das Telefon klingeln, bis es verstummte.
»Also los. Gehen wir spazieren.« Claire erhob sich. »Und schwimmen!«
Sie liebte das Schwimmen. Genau wie Dupin.
»Unbedingt.«
Schon stand er neben ihr, ein blau-weißes Badetuch unter dem Arm, in das die Badehose gewickelt war. Claire trug ihren Bikini bereits unter ihrem Kleid.
»Cécile sagt, wir sollen nach Süden laufen. Da bekämen wir einen perfekten Eindruck von der ganzen Landschaft. – Und morgen dann Richtung Pornic.«
Sie hatten die Tage so geplant, dass sie es gemütlich angehen konnten. Erst Ende der Woche ging es – nach der Station am See – weiter nach Saumur.
»Heute Abend essen wir in dem Restaurant, von dem Cécile so schwärmt, nicht weit von hier, direkt am Küstenweg.«
Dupin hatte keine Einwände. Beim Frühstück über das Abendessen zu reden gehörte zu ihren festen Ritualen. Was alles andere als originell war – alle Bretonen taten das. Die kleinen Krisen des Alltags ließen sich mit kulinarischen Perspektiven stets besser meistern.
Sie spazierten los, durch das große schmiedeeiserne Tor, mitten durch den Weinberg, schnurstracks Richtung Meer.
Bei der Ankunft vorgestern waren sie durch Pornic gefahren und hatten es für sehr hübsch befunden. Ein Städtchen mit viel Flair und Patina. Pittoresk, ja, aber nicht zu pittoresk. Dupin hatte direkt zwei, drei Cafés ausgemacht, die etwas für sie wären.
Es war erstaunlich: Wenn man sich vom Süden der Loire-Mündung näherte, war die Welt ganz flach. Erst kurz vor Pornic fand man sich in gewohnt bretonisch hügeliger Landschaft wieder. Flach war die Bretagne nirgends, mit ihrer maximalen Erhebung von dreihundertfünfundachtzig Metern war sie nicht gebirgig, aber überall irgendwie hügelig, es ging ständig rauf und runter, besonders an der Küste. »Genau dort, in Pornic, beginnt die Bretagne«, hatte Nolwenn in der letzten Woche noch feierlich gesagt. Man könne es sehen, spüren, erleben.
Der atemberaubende Weg folgte zuverlässig den zahllosen Windungen der zerklüfteten Küste. Gelassen und majestätisch thronende Meereskiefern, Zedern und Zypressen, verwachsene uralte Eichen, baumgroße Oleander, Magnolien, Agaven, Farne und Gräser.
Rechts ging es steil hinunter bis zum Wasser, wo sich jetzt, bei tiefer Ebbe, dunkelgraue Granitplatten und Sand abwechselten. Überall gab es versteckte kleine Sandbuchten. Der Preis, um zu den Traumstränden zu gelangen, war ein abenteuerlicher Abstieg über unbefestigte Pfade. Hier konnte jeder eine Bucht für sich allein haben, märchenhaft von zerfurchten Felsen eingerahmt. Durch den feinen, hellen Tonschlamm zwischen Festland und der Île de Noirmoutier sah das Wasser leicht milchig aus. Der Schlamm verlieh den bläulichen, grünlichen, selbst den türkisen Farbtönen des Wassers etwas Mysteriöses. Farbtöne, die Dupin bisher aus der Bretagne nicht kannte. Für gewöhnlich ließ die kristalline Klarheit des bretonischen Atlantiks die Farben rein, stark und frisch erstrahlen. Hier waren es gebrochene, zartere Töne. Und obwohl die Sonne gerade hinter ein paar dramatisch dunklen Wolken verborgen war, sah man die Farbe, die der Küste ihren Namen gab: das berühmte Jadegrün.
Der Atlantik, in der großen Bucht von drei Seiten eingeschlossen, plätscherte heiter vor sich hin, von Wellen keine Spur, er wirkte fast wie ein Binnenmeer. Was das Küstenbild hier mehr prägte als alles andere, waren die pêcheries. Dupin kannte sie bisher nur von Postkarten und aus Bildbänden. Fischerhütten aus Holz, grazile Konstruktionen auf sehr hohen Stelzen, verwegen in die Landschaft gebaut, manchmal nur über lange, schmale Stege erreichbar. Alle mit Balkon und hölzernem Kranarm versehen, an dem ein einzelnes versteiftes Netz angebracht war. Die Konstruktion der pêcheries hing mit der besonderen Fischerei-Methode der Region zusammen.
Alle dreißig bis fünfzig Meter standen sie im Meer, ihre Silhouetten wirkten wie rätselhafte Skulpturen oder gigantische Insekten. Jetzt, bei Ebbe, befanden sich die meisten von ihnen auf dem Trockenen.
»Großartig. Das wäre doch etwas, Georges: ein Tiny House auf Stelzen im Meer. Auf der Terrasse ein Tisch, zwei Stühle. Da säßen wir dann jeden Abend bei Sonnenuntergang mit Wein, Baguette und Käse.«
Claire und Dupin waren gebannt von dem Panorama.
Dupin verstand mittlerweile auch, was Nolwenn gemeint hatte: dass genau hier die Bretagne begann. Mit einem Mal war das Wilde da, dieses ganz eigentümliche bretonische Element. Schwer zu fassen, aber deutlich zu spüren: etwas Raues, Schroffes, Freies. Eine Urkraft. In der Natur, den Landschaften, im Meer, im Himmel. Richtung Süden, Bordeaux, fehlte es. Ab Pornic aber war es da. Selbst wenn manche bretonische Landschaft ans Mittelmeer oder die Karibik erinnerte, diese wilde Authentizität wollte die Natur nicht abschütteln.
»Pêche au carrelet heißt diese Technik übrigens«, wusste Claire. »Eine ganz alte Form der Netzfischerei. 2021 wurde sie offiziell in die Liste von Frankreichs immateriellem Kulturerbe aufgenommen. Bei Flut werden die Netze heruntergelassen, die Fischer warten ein paar Minuten, dann werden die Netze abrupt hochgezogen.«
Dupin hatte in den letzten Wochen gleich mehrere Bücher über Pornic und die Gegend auf Claires Nachttisch liegen sehen. »Man sieht nur, was man weiß«, lautete ihre Maxime.
»Gefangen wird alles, was hier an der Küste herumschwimmt: Anchovis, Meeraale, Wolfsbarsche, Krabben, Seehechte, Sardinen und Seezungen.«
Was wollte man mehr? Die Auswahl reichte für zahllose köstliche Abendessen.
»Da!« Claire war stehen geblieben. »Das ist sie! Unsere Bucht!«
Das dichte Grün ließ nur erahnen, was Claire meinte. Ein besonders heller, sichelförmiger Sandstreifen zwischen zwei flachen hellgrauen Felsformationen, auf denen links und rechts je eine der pêcheries thronte. Es sah besonders verlockend aus.
»Und hier geht es runter.«
Sie wies auf einen steinigen Pfad, der vom Weg abzweigte.
Drei Minuten später hatten sie den Strand erreicht. Ein kleines Paradies – nur für sie beide.
Sie schwammen übermütig weit hinaus, bis zu einer rosa Boje. Das Wasser war weich, samtig und ein Stück wärmer als bei ihnen im Finistère, sicher dreiundzwanzig Grad – trotzdem war es unverkennbar atlantisch: salzig, jodig, frisch.
Erst als sie zurückschwammen, wurde die kontemplative Ruhe unterbrochen.
»Dein Handy, Georges, es klingelt schon wieder.«
»Egal.«
Dupin meinte es wirklich ernst.
Schon bald verstummte es.
Sie waren gerade erst aus dem Wasser, als es erneut klingelte.
»Sieh doch mal nach, wer es ist«, forderte Claire ihn auf.
»Keine Lust.«
»Vielleicht ist es wichtig.«
Widerwillig zog Dupin das Handy aus seinem linken Schuh, wo er es abgelegt hatte.
»Nolwenn.«
»Solltest du nicht doch rangehen?«
»Warum?«
»Damit du beruhigt bist.«
»Ich bin ruhig.«
Im nächsten Moment nahm Dupin an.
»Was gibt es, Nolwenn?«
»Ah – Monsieur le Commissaire, bonjour. Ich nehme an, es geht Ihnen blendend!«
Er war erleichtert. Etwas Schlimmes konnte nicht passiert sein …
»Ich lasse Sie auch sofort wieder in Ruhe.«
»Was ist los?«
»Nichts, gar nichts! Alles friedlich. Nicht der kleinste Vorfall. Mir scheint bloß, Sie nehmen das mit dem Grünspecht nicht ernst.«
Was? Deswegen rief sie an?
»Ein fataler Fehler, Monsieur le Commissaire, Sie …«
»Kann ich später zurückrufen, Nolwenn?«
Dupin hatte Claire immer noch nicht von dem Specht erzählt. Und sie stand direkt neben ihm.
»Die Sache drängt, Monsieur le Commissaire.«
»Ich …«
Der schrille Klingelton von Claires Telefon unterbrach Dupin.
Claire holte es aus ihrer Handtasche und trat ein paar Schritte zur Seite.
»Ich melde mich am Nachmittag, Nolwenn. Versprochen.«
»Er zerstört das ganze Haus, Monsieur le Commissaire.«
Das hielt er jetzt wirklich für etwas übertrieben.
»Ein Grünspecht im Furor. – Ich könnte Ihnen da Geschichten erzählen …«
Dupin würde nicht nachfragen.
»Aber mein Mann hat eine Idee – und die wollte ich Ihnen erklären. Nicht ganz legal, aber er hat die Methode schon ein paarmal angewandt. Sehr effektiv, sage ich nur.«
»Ich bin gespannt.«
Das war er tatsächlich.
»Aber später.«
»Na gut, dann entlasse ich Sie mal wieder in die Flitterwochen, Monsieur le Commissaire. – Neun Tage gehen schnell vorbei.«
»Danke, Nolwenn.«
Dupin war nicht sicher, ob Nolwenn seine Worte noch gehört hatte, so schnell hatte sie aufgelegt.
»Georges!«
»Ja?«
Dupin wandte sich zu Claire um.
»Cécile … Das war Cécile.«
Claires Gesicht hatte alle Farbe verloren.
Etwas stimmte ganz und gar nicht.
»Brian, ich meine, Céciles Ex-Mann«, Claire sprach langsam, mechanisch, »der Winzer, du weißt – von dem Muscadet, den wir gestern probiert haben. Wo wir morgen hinwollten – Cécile war gestern Abend noch bei ihm. Er hatte Geburtstag. Sie haben immer noch ein sehr enges Verhältnis.«
Sie stockte.
»Und?«
»Cécile hat gerade einen Anruf bekommen. Sie haben ihn vor einer Viertelstunde gefunden. Am See, nicht weit von seinen Reben. – Tot. Erschossen. Offenbar mit einem Schrotgewehr. Er war joggen.«
»Was?«
Claire hatte eilig begonnen, sich anzuziehen.
»Ein Mord, Georges. – Ein brutaler Mord.«
Was Claire da sagte, wirkte völlig irreal.
»Cécile ist am Ende. Ich muss zu ihr, Georges. – Beeil dich!«
»Unglücklicher Zufall? Ein Wilderer-Unfall? Das ist doch ganz und gar absurd.«
Cécile Cast stand der Schmerz ins Gesicht geschrieben, trotzdem war sie außer sich. Und versuchte nicht, es zu verbergen.
Der Kommissar aus Nantes, Gaspard Lelouche, ein hochgewachsener, schlanker Mann, aristokratische Züge, dezent gewellte, kurze Haare, vielleicht Mitte dreißig, in einem lässigen beigen Sommeranzug, hatte einen schweren Stand. Und Dupin beinahe so etwas wie Mitleid.
Lelouche war erst seit Kurzem Kommissar, hatte er von Nolwenn gehört, als sie während der Fahrt erneut telefoniert hatten. Lelouche kam aus Angers, ein Stück die Loire hoch, dort hatte er offenbar äußerst erfolgreiche polizeiliche Arbeit geleistet. Erst letztes Jahr war er zum Kommissar in Nantes befördert worden, der Hauptstadt des Départements. Dupin kannte ihn nicht – und er Dupin nicht, wie es den Anschein hatte.
»Ein Wilderer-Unfall! Das kann nicht Ihr Ernst sein!« Cécile Cast, nachlässig hochgesteckte rote Haare, ein fliederfarbenes Kleid, wandte sich vom Kommissar ab und dem Toten zu.
Brian Katell, zweiundvierzig, so alt wie seine Ex-Frau, lag in der Nähe einer hölzernen Barke. Der Lac de Grand-Lieu war keine dreißig Minuten von Pornic entfernt. Am nördlichen Ufer des Sees, dort, wo sie sich gerade befanden, reichten die Reben von Brian Katells Domaine du Lac bis an den See heran.
Mittlerweile hatte sich eine große Gruppe versammelt: Kommissar Lelouche, Cécile Cast, Claire, Dupin, der angestellte Verwalter von Brian Katells Weingut, der Capitaine der Gendarmerie aus Bouaye, eine junge Polizistin, ein Gerichtsmediziner, die Chefin der Spurensicherung sowie zwei ihrer Mitarbeiter.
Die Leiche bot einen schauerlichen Anblick. Der Gerichtsmediziner kniete neben dem Körper im nassen Gras. Die Chefin der Spurensicherung und ein Mitarbeiter nahmen die Barke in Augenschein, der zweite Kollege untersuchte die Stelle, an der sie verwischte Spuren von Schuhabdrücken gefunden hatten, zirka zehn Meter entfernt, auf dichtem Gras unter einer Eiche.
»In der Tat hat man es hier am See ab und zu mit Wilderern zu tun«, antwortete Kommissar Lelouche auf Céciles Einwand. »Der Kollege von der Gendarmerie hat es mir berichtet. Nicht häufig, aber ab und zu kommt es vor. – Monsieur Katell könnte beim Laufen einen Wilderer überrascht und der ihn daraufhin erschossen haben. Tragisch.«
»Meinen Sie wirklich, dass jemand kaltblütig mordet«, Cécile Cast sah dem Kommissar in die Augen, »nur um einer Anzeige wegen Wilderei zu entgehen?«
Die Wut brachte die Farbe zurück in ihr Gesicht. Als Claire und Dupin eingetroffen waren, hatte sie sich noch in einem regelrechten Schockzustand befunden. Blass, verstört, zitternd.
»Vielleicht hat Monsieur Katell dem Wilderer gedroht und wollte die Polizei rufen.« Kommissar Lelouche sprach beinahe aufreizend ruhig.
Katells Handy war direkt neben der Leiche im Gras gefunden worden, allerdings kannte niemand den Code.
»Madame Cast, in den Landes hat letztes Jahr ein Wilderer bei einer Polizeikontrolle zwei Polizisten erschossen«, belehrte der Kommissar Claires Freundin. »Und das ist kein Einzelfall.«
Dupin versagte sich jeden Kommentar. Seit sie am See angekommen waren, hatte er konsequent geschwiegen – und er hatte nicht vor, von dieser Linie abzuweichen.
»B & P. – Baschieri & Pellagri. 3,5 Millimeter Jagdschrot.«
Die zierliche schwarzhaarige Leiterin der Spurensicherung war zu ihnen getreten und hielt eine Plastiktüte mit einem kleinen, dunklen Metallteilchen in der einen Hand, in der anderen ein Tablet.
»Dreiunddreißig Gramm pro Patrone. Weicheisen, härter als Blei, aber bleifrei und erheblich leichter. Völlig umweltfreundlich. Wird für gewöhnlich bei der Wasserjagd eingesetzt. Kaliber 12/76, ziemlich gleichmäßige Deckung bei allen Witterungsverhältnissen. – Perfekte Munition für Entenjagd. 3,5 Millimeter sind da das Optimum. Für eine ausreichende Tötungswirkung muss der Schrotkorndurchmesser größer sein als bei Bleischroten, mindestens 3,25 Millimeter – aber besser noch die 3,5 Millimeter.«
Feierlich übergab sie dem Kommissar die Tüte mit dem Schrotteilchen.