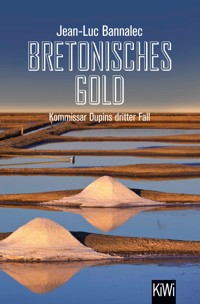10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Dupin ermittelt
- Sprache: Deutsch
Ein rätselhafter Mordfall erschüttert die malerische Altstadt von Concarneau – Kommissar Dupin ermittelt in seinem atmosphärischsten Fall Concarneau, die »blaue Stadt« am Meer, kurz vor den Pfingsttagen. In der berühmten Altstadt Ville Close feiern die Bretonen mit Musik und Tanz den Auftakt des Sommers, und alles könnte so wunderbar heiter sein. Gäbe es nicht plötzlich einen Toten – genau vor Kommissar Dupins Lieblingsrestaurant, dem Amiral. Doch damit nicht genug: Ausgerechnet in diesen Tagen sind Dupins Inspektoren beurlaubt und Nolwenn unerreichbar. Gemeinsam mit zwei neuen Kolleginnen widmet sich der Kommissar der alles entscheidenden Frage: Wer hatte es auf Docteur Chaboseau abgesehen? Der angesehene Arzt stammte aus einer der einflussreichsten Familien der Gegend. Weder dessen Frau noch seine engsten Freunde, ein stadtbekannter Apotheker und ein Weinhändler, können sich einen Reim auf die Tat machen. Könnte es etwas mit den vielseitigen Interessen des Arztes zu tun haben, der nicht nur Kunstsammler war, sondern auch in bretonische Brauereien und traditionelle Fischkonservenfabriken investierte? Während Dupin noch fieberhaft nach Anhaltspunkten sucht, kommt es zu einem Anschlag, der ganz Concarneau in Aufruhr versetzt. In seinem stimmungsvollsten Fall macht Jean-Luc Bannalec das wunderschöne Städtchen zum Protagonisten: Seine Häfen und Strände, Galerien und Restaurants, seine Traditionen und ganz besondere Geschichte. Ein spannender Bretagne-Krimi mit unverwechselbarem Flair! Die Krimis von Jean-Luc Bannalec über Kommissar Dupin in der Bretagne sind die optimale Urlaubslektüre: Durch seinen feinsinnigen Humor und das Gespür für das regionaltypische Kolorit werden die Leser in die bezaubernde Bretagne versetzt, in der man das Meer förmlich riecht. Die Krimi-Bestseller aus der Bretagne sind in folgender Reihenfolge erschienen: - Bretonische Verhältnisse - Bretonische Brandung - Bretonisches Gold - Bretonischer Stolz - Bretonische Flut - Bretonisches Leuchten - Bretonische Geheimnisse - Bretonisches Vermächtnis - Bretonische Spezialitäten - Bretonische Idylle - Bretonische Nächte - Bretonischer Ruhm - Bretonische Sehnsucht - Bretonische Versuchungen Die Bücher erzählen eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Jean-Luc Bannalec
Bretonisches Vermächtnis
Kommissar Dupins achter Fall
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Jean-Luc Bannalec
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Jean-Luc Bannalec
Jean-Luc Bannalec ist der Künstlername von Jörg Bong; er ist in Frankfurt am Main und im südlichen Finistère zu Hause. Die ersten acht Bände der Krimireihe mit Kommissar Dupin, »Bretonische Verhältnisse«, »Bretonische Brandung«, »Bretonisches Gold«, »Bretonischer Stolz«, »Bretonische Flut«, »Bretonisches Leuchten«, »Bretonische Geheimnisse« und »Bretonisches Vermächtnis«, wurden für das Fernsehen verfilmt und in zahlreiche Sprachen übersetzt. 2016 wurde der Autor von der Region Bretagne mit dem Titel »Mécène de Bretagne« ausgezeichnet. Seit 2018 ist er Ehrenmitglied der Académie littéraire de Bretagne.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Concarneau, die »Blaue Stadt« am Meer, kurz vor den Pfingsttagen. In der berühmten Altstadt Ville Close feiern die Bretonen mit Musik und Tanz den Auftakt des Sommers, und alles könnte so wunderbar heiter sein. Gäbe es nicht plötzlich einen Toten – genau vor Kommissar Dupins Lieblingsrestaurant, dem Amiral. Doch damit nicht genug: Ausgerechnet in diesen Tagen sind Dupins Inspektoren und seine Assistentin Nolwenn im Urlaub. Gemeinsam mit zwei neuen Kolleginnen widmet sich der Kommissar der alles entscheidenden Frage: Wer hatte es auf Docteur Chaboseau abgesehen? Einen Arzt, der großes Ansehen genoss und aus einer der einflussreichsten Familien der Gegend stammte. Weder dessen Frau noch seine engsten Freunde, ein stadtbekannter Apotheker und ein Weinhändler, können sich einen Reim darauf machen. Könnte es etwas mit den Vorlieben des Arztes zu tun haben, der nicht nur Kunstsammler war, sondern auch in bretonische Brauereien und traditionelle Fischkonservenfabriken investierte? Während Dupin noch fieberhaft nach Anhaltspunkten sucht, kommt es zu einem Anschlag, der die gesamte Stadt in Aufruhr versetzt.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2019, 2021, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Rudolf Linn, Köln
Covermotiv: © L'Oeil de Paco
ISBN978-3-462-31931-6
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses Zusatzmaterial ist auch auf unserer Homepage zu finden:
https://www.kiwi-verlag.de/magazin/extras/die-karten-zu-bretonisches-vermaechtnis
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
Der erste Tag
Der zweite Tag
Es war 6 Uhr ...
»Also, Chef«, unterbrach Riwal ...
Der dritte Tag
Dank
Quellennachweis
Leseprobe »Bretonische Versuchungen«
À L.
À Sandra, wie eigentlich jedes Buch
Ret eo terriñ ar graoñenn
Evit kaout ar vouedenn.
Es gibt nur einen Weg: Man muss die Nuss knacken, um ihren Kern zu erhalten.
Bretonisches Sprichwort
Der erste Tag
Es gab Tage, da war die Welt vor allem eines: Himmel.
Dieser 24. Mai war so ein Tag. Lichtdurchflutet, strahlend, klar, hell, wie frisch gewaschen.
Das Himmelsgewölbe wirkte noch weiter, noch höher als gewöhnlich. Es machte den Eindruck, als dehnte sich der Raum, als drängte die Atmosphäre der Erde tiefer ins All vor. Ein leuchtend sphärisches Blau, das erst am Horizont allmählich blasser wurde. Ein eigentümliches, seltsam vibrierendes Blau, dem man zutraute, selbst eine Art Energie oder Materie zu sein. Die Erde schien sich unter der Weite dieses Blaus zusammenzuziehen, flacher und kleiner zu werden.
Kommissar Georges Dupin aus Concarneau lag auf dem Rücken im Gras. Er hatte sich der Länge nach ausgestreckt. Auf einem Plateau weit oberhalb des Meeres. Einer grünen Kuppe, die hinter schroffen Klippen anhob, stolze zweiundsiebzig Meter über dem Meeresspiegel, so stand es auf einer Tafel am Parkplatz. Die Kuppe war bedeckt mit Heidekraut, knallgelbem Ginster, buschigen Gräsern und Moos in den unterschiedlichsten Farben: Grün, Rostrot, Gelb.
Pointe du Raz hieß die letzte Landspitze im äußersten Westen des Finistère, deren hoch aufragende Felsen sich in Form eines grob gezackten Keils weit in den Atlantik hinauswagten. Gewaltige, unruhige Strömungen umtosten die legendäre Pointe, das nördliche Ende der Bucht von Biskaya, die an der westlichen Küste Spaniens ihren anderen Endpunkt besaß. Es war – gespickt von Untiefen – eines der gefährlichsten Gebiete des gesamten Atlantiks, die Wassermassen drängten um die Bretagne herum in den Ärmelkanal, wo sie zur Nordsee wurden.
Das Panorama von hier oben war berückend: der majestätische Atlantik, die bizarren Klippen – sie sahen aus wie der Schwanz eines Drachens –, mitten im Meer zwei tollkühne Leuchttürme auf unwirtlichen Felsen und in der Ferne die phantastische Île de Sein. Wenn man es tatsächlich erleben wollte, das Ende der Welt, gab es vielleicht keinen eindrucksvolleren Ort als die Pointe du Raz. Man sah es, man spürte es: Finis terrae. Die letzte Bastion, die dem ungestümen, schier endlosen Meer trotzte. Plötzlich fühlte sich das »feste Land« schwindelerregend fragil an.
Auch ein anderes Geheimnis der Bretagne nahm man an diesem Ort besonders wahr: das einzigartige Zusammenspiel aus Licht und Farben. In der Bretagne gab es – so kam es Dupin vor – mehr Licht als anderswo. Seine außerordentliche Leuchtkraft ließ auch die Farben außerordentlich werden, die nichts anderes waren als Brechungen dieses Lichts. Es kam einem vor, als wäre das für das menschliche Auge sichtbare Farbspektrum – das Spektrum zwischen Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo und Violett – hier ungleich breiter gefächert. Als würde das Licht in den endlosen Brechungen auf den Wasserflächen rund um die bretonische Halbinsel feiner zerlegt. Diese Intensität an Licht und Farben hatte schon ihre größten Liebhaber trunken werden lassen: Monet, Gauguin, Picasso und viele andere Maler waren der Bretagne erlegen.
Seit Dupins erstem Besuch hier stand die Pointe du Raz – außerhalb der haute saison! – auf der Liste seiner Lieblingsorte. Für den heutigen Ausflug gab es gleich zwei Gründe: Le Fumoir de la Pointe du Raz, eine neue Fischräucherei in der Nähe, von der Inspektor Riwal in den höchsten Tönen geschwärmt hatte. Dort wurden die feinsten Fische der gefürchteten Meerespassage geräuchert, vor allem die herrlichen Lieus jaunes, eine besondere Dorschart. Vornehmlich mit den »unvergleichlichen Aromen des Rauches bretonischer Eichen« und unter Zugabe einer geheimen Mischung verschiedener Pfeffersorten und Gewürze. Die Räucherei gehörte dem Cousin eines Cousins von Riwal, Dupin hatte an der Stelle nicht richtig zugehört, die weitläufigen Verwandtschaftsverhältnisse Riwals – zu denen ebenso Wahlverwandtschaften gehörten – verwirrten den Kommissar stets aufs Neue. Wie auch immer, Riwals Schwärmen hatte Dupin zu einem Besuch in der Fischräucherei verleitet. Außerdem hatten Claire und er ihren ersten freien gemeinsamen Abend seit Wochen, da Claire in der Klinik mehr oder weniger durchgearbeitet hatte. Lieu jaune war ihr Lieblingsfisch, und Geräuchertes mochte sie prinzipiell. Dupin hatte sie überraschen wollen.
Der zweite Grund für den Ausflug war die Renovierung des Kommissariats. Vier Wochen dauerte sie nun schon an. Es war ein einziger Albtraum. Einen »gänzlich unbeeinträchtigten Betrieb des Kommissariats« hatte die beauftragte Firma versprochen, das war schon in der Theorie Unsinn gewesen. Und natürlich war es auch in der Praxis anders gekommen. Bereits am ersten Tag war das schiere Chaos ausgebrochen. Alles beeinträchtigte den Betrieb, ganz zu schweigen vom Lärm, Staub und Dreck. Und selbstverständlich – »völlig geruchsfrei die ganze Sache«, hatte der Malermeister versichert – hatte es umgehend unerträglich nach Farbe gestunken, selbst das Aufreißen sämtlicher Fenster und Türen hatte daran nichts geändert. Das einzig Gute war, dass der Gestank der Farben und Lösungsmittel den scheußlichen Grundgeruch des Gebäudes, der Dupin seit seinem ersten Arbeitstag in den Wahnsinn trieb – auch wenn er ihn als Einziger wahrnahm –, überdeckte. Unter Umständen, so hoffte Dupin, würde der Geruch am Ende der Renovierung sogar ganz verschwunden sein.
Sämtliche Mitarbeiter des Kommissariats hatten in den letzten Wochen das Weite gesucht, lediglich eine regelmäßig wechselnde Notbesetzung hielt vor Ort die Stellung. Alle hatten stets neue und immer fantasievollere Anlässe gefunden, das Büro zu meiden. Ungeheuerliche Vorkommnisse wie ein geplündertes Karottenbeet oder unerlaubtes Muschelsammeln am Strand mussten plötzlich vor Ort überprüft werden, manchmal waren sie zu dritt oder viert unterwegs. Sie hatten uralte »offene Fälle« wiederaufgenommen: den Diebstahl dreier Surfbretter im letzten Oktober und das Verschwinden eines rosafarbenen Beibootes im Hafen. Alle waren sie froh gewesen, als es tatsächlich zu einem Vorfall gekommen war: Beim Abriss eines alten Hauses in Pont-Aven waren sechshundert belgische Goldstücke aus dem Jahre 1870 gefunden worden. Ein echter Schatz, dessen Wert auf ein paar Hunderttausend Euro taxiert wurde – und dessen Fund Anlass zu wilden Spekulationen bot.
Anfang dieser Woche war dann aber selbst Dupins Assistentin Nolwenn der Geduldsfaden gerissen. Direkt vor ihrer Tür war ein Eimer dickflüssiger Farbe ausgelaufen, und sie war schwungvoll hineingetreten. In den Wochen zuvor hatte sie noch tapfer versucht, die Fassung zu wahren, doch nach diesem Zwischenfall hatte sie umgehend ein paar Tage freigenommen. Was schlagartig zu heftiger Nervosität bei Dupin geführt hatte, umso mehr, da sie keinerlei Angaben über den Zeitpunkt ihrer geplanten Rückkehr ins Büro gemacht hatte. Über die Jahre – durch Unmengen an Überstunden – musste Nolwenn mehrere Monate Urlaub angespart haben. Dupin hatte sich nicht getraut, nachzuschauen. Eine längere Abwesenheit Nolwenns – zudem als Protestaktion – würde, so viel stand fest, früher oder später im Desaster enden. Sie war mit ihrem Mann kurzerhand zu einer Radtour aufgebrochen, die eigentlich für den September vorgesehen gewesen war. Eine sehr spezielle Radtour, inspiriert von dem bretonischen Bestseller Bistrot Breizh. Le tour de Bretagne des vieux cafés à vélo, der zu den ältesten, urtümlichsten Kneipen führte, die die Bretagne zu bieten hatte. Handverlesen und mit großer Kennerschaft ausgewählt. Eine Tour buchstäblich von Dorf zu Dorf. Vom Profil her eher gemütlich als sportlich, durch wunderbare einsame Landschaften, Nolwenn hatte sich für den Weg durchs Inland entschieden. Sie hatte auch Riwal und Dupin nahegelegt, sich freizunehmen, woraufhin Riwal mit seiner Frau und den beiden Kindern prompt für ein paar Tage auf die Belle-Île exiliert war. Eine seiner Schwestern besaß dort ein Haus, das leer stand, seitdem sie in die Heimat ihres Mannes, nach Cape Cod an der amerikanischen Ostküste, ausgewandert war. Der Kommissar hatte keinerlei Interesse daran gehabt, sich freizunehmen. Zum einen konnte sich Claire zurzeit unter keinen Umständen aus der Klinik loseisen, zum anderen waren Ferien nicht Dupins Sache. Kadeg, Dupins anderer Inspektor, war fein raus. Seit zweieinhalb Monaten befand er sich in Elternzeit und würde erst im Juli wiederkommen. Seine Frau und er hatten im März Zwillinge bekommen. Anne und Conan. Der Inspektor hatte sich einen dieser Doppelkinderwagen – ein monströses Gefährt – zugelegt, mit dem er ab und an im Kommissariat auftauchte. Er war nicht selten über Tage alleine mit den Kindern, seine Frau – Kampfsportlehrerin in Lorient für Kyokushin-Karate, die »härteste Kontaktkampfsportart der Welt«, worauf Kadeg jedes Mal aufs Neue stolz hinwies – reiste regelmäßig zu Lehrgängen und Turnieren.
Dupin war am Mittag losgefahren, hatte den Fisch für das Abendessen gekauft und dabei länger mit dem sympathischen Besitzer der Fumerie geplaudert. Vom Parkplatz war er bis zum Ende der Pointe gelaufen. Später, nach der kleinen Pause, würde er hinter dem beeindruckenden Strand der Baie des Trépassés auf der wunderbaren Terrasse des Relais de la Pointe in der Sonne noch ein kühles Bier trinken. Auch das eines seiner Rituale, er liebte es, dort zu sitzen. Er würde ein paar Galettes apéritives au jambon essen, kleine Vierecke aus knusprig-buttrigem Crêpes-Teig mit saftigem Schinken. Gegen sieben, halb acht wäre er wieder zu Hause. Claire hatte versprochen, es bis halb neun zu schaffen, so hätte er genügend Zeit, alles vorzubereiten.
Er hatte Glück mit dem Wetter. Es fühlte sich an, als würde der Frühling am heutigen Tag dem Sommer weichen. Dem langen bretonischen Sommer, der sich bis Anfang Oktober ziehen würde. Vielleicht sogar noch etwas länger, im Jahr zuvor hatten Claire und Dupin am 31. Oktober ein letztes Mal gebadet. Es waren heute über zwanzig Grad, die sanfte Brise brachte eine leichte salzig-jodige Note. Einen Geschmack des Sommermeeres. Die Sonne ließ die Haut warm werden, ohne zu brennen. »Beau et chaud« hatte Le Télégramme für die nächsten Tage vorhergesagt. Gab es ein schöneres Versprechen?
Statt der geplanten Viertelstunde lag Dupin nun schon eine Dreiviertelstunde im weichen Gras. Es fiel ihm schwer, sich zu lösen. Was nicht bloß an der Behaglichkeit der Liegestätte und dem Bann des weiten Himmels lag, sondern vor allem am meditativen Rauschen der Wellen, die sich gleichförmig und ohne Hast an den Klippen unterhalb des Plateaus brachen. Der sonst so unruhige Kommissar war in ein wohliges Dösen verfallen.
Plötzlich vernahm er den penetranten Ton seines Mobiltelefons.
Dupin richtete sich auf und suchte nach seinem Handy. Es verstummte. Als er das Telefon endlich aus der Hosentasche gezogen hatte, klingelte es erneut.
»Ja?«, knurrte der Kommissar.
»Ich bin’s, Chef.«
Inspektor Riwal.
»Was gibt es?«
»Nichts, Chef. – Ich wollte mich nur mal melden.«
Riwal hatte sich schon gestern und vorgestern gemeldet. Und schon da hatte Dupin gemeint, so etwas wie ein schlechtes Gewissen in seiner Stimme zu hören. Darüber, dass der Inspektor das sinkende Schiff so Hals über Kopf verlassen hatte.
»Hier ist alles in Ordnung, Riwal. – Wie ist es auf der Insel?«
»Schön. Aber ich komme sofort, wenn etwas ist, Sie müssen nur …«
»Genießen Sie es!«
»Gut, Chef. – Nur damit Sie Bescheid wissen: Meistens haben wir keinen Empfang im Haus, das Festnetz hat meine Schwester abgemeldet. Gerade bin ich in einer Kneipe, aber …«
»Alles okay, Riwal. Schalten Sie mal ab. – Hatten Sie es gerade schon mal bei mir versucht?«
»Nein, warum?«
»Nicht wichtig. – Schöne Pfingsttage.«
Dupin legte auf. Sein Blick wanderte über das Meer. Ein unendliches Funkeln und Schimmern.
Im letzten Sommer hatte er seinen Freund Henri – den Inhaber des Café du Port in Sainte-Marine – nach Le Conquet begleitet. Henri hatte dort die berühmte herzhafte Wurst, eine Spezialität der nahen Île Molène, sowie Pétoncles besorgt, die kleinen, nussig schmeckenden Jakobsmuscheln – für ein herrliches Ragout aus beidem. An der nahe gelegenen Pointe de Corsen hatten sie das Auto stehen lassen und waren ein Stück spazieren gegangen. Sie hatten das Panorama genossen: das tiefblaue Meer, in der Ferne das sagenumwobene Insellabyrinth um die Île Molène. Dupin hatte gesagt: »Fehlen nur noch ein paar Delfine.« »Da sind sie doch«, hatte Henri mit der gelassensten Selbstverständlichkeit geantwortet, die man sich vorstellen konnte, und auf das Wasser gezeigt. Zehn, fünfzehn Delfine waren es gewesen. Über Minuten hatten sie tollkühne Sprünge und rasante Schwimmmanöver vollführt. Eine echte Show. Dann waren sie mit einem Mal verschwunden gewesen. Dupin wusste, dass es lächerlich war, aber seit diesem Tag schaute er immer besonders aufmerksam hinaus aufs Meer.
Das Telefon klingelte erneut.
Im nächsten Augenblick hatte der Kommissar sich seufzend erhoben.
»Ja?«
»Georges! Wie gut, dass wir dich erreichen.«
Eine ernste Frauenstimme.
»Wir fahren doch direkt durch, haben wir gerade beschlossen, wir sind schon bei Laval. Wir erreichen Claire aber nicht.«
Jetzt hatte Dupin die Stimme erkannt. Es war Claires Mutter.
»Wir sind so gegen neun da.« Etwas raschelte. »Oder, Gustave?«
Prompt war aus dem Hintergrund ein lautes »Unbedingt! Spätestens. Wenn nicht früher« zu hören. Dupin vernahm jetzt auch Motorgeräusche.
»Das ist doch wunderbar, oder?«, sagte Claires Mutter begeistert. »So haben wir noch den ganzen Abend zusammen! Wir freuen uns, Georges. – Sagst du Claire Bescheid?«
»Ich … bin mir sicher, sie wird außer sich sein. – Vor Freude.«
»Das denke ich auch! Bis nachher also, Georges!«
Vorbei war das Gespräch.
Dupin brauchte eine Weile, um sich zu sammeln.
Das war es dann wohl mit dem ruhigen Abend zu zweit. Es würde also schon heute beginnen. Nicht, wie ursprünglich geplant, erst am morgigen Samstag. Dupin hatte es konsequent verdrängt. Claires Eltern kamen zu Besuch, seine Schwiegereltern gewissermaßen. Das gesamte lange Pfingstwochenende. Gustave und Hélène Lannoy. Aus der Nähe von Fécamp in der Normandie. Dupin hatte sie, seit Claire und er wieder zusammengekommen waren, erst wenige Male wiedergesehen. Die beiden würden bei ihnen wohnen. Drei Tage lang. Dupin war glücklich über das Haus, in das Claire und er letztes Jahr gezogen waren, aber ein geräumiges Haus brachte, wie sich jetzt zeigte, nicht nur Vorteile mit sich. Claires Eltern waren so unterschiedlich, wie man es nur sein konnte. Hélène war Yogalehrerin und Claires Vater führte eine erfolgreiche Anwaltskanzlei, die er offiziell eigentlich bereits einem Seniorpartner überlassen hatte. Allerdings war es ihm unmöglich loszulassen. Zu den wenigen Dingen, die sie teilten, gehörte neben der Vorliebe für gutes Essen und Trinken sowie der tiefen Liebe zu Claire die Lust am Diskutieren, mit einem Redeverhältnis von neun zu eins für Claires Mutter. Stoff gab es aufgrund ihrer unterschiedlichen Ansichten stets genug, es reichte für mehrere gemeinsame Leben. Eine interessante Anlage für eine Beziehung, fand Dupin – nichtsdestotrotz würde jeder der beiden ihre Ehe, ohne zu zögern, als »überglücklich« bezeichnen. »So sind sie halt«, hatte Claire ihn ermahnt, »es wird bestimmt schön!«
»Verflucht!«, entfuhr es ihm. Er hatte sich wirklich auf heute Abend gefreut. Auf die Zeit zu zweit. »Das kann …«
Das Telefon. Ein viertes Mal.
Abermals nahm er unwirsch an.
»Ja?«
»Spreche ich mit Commissaire Georges Dupin?«
Es war die Stimme einer älteren Frau. Dupin riss sich zusammen. Die Anruferin traf keinerlei Schuld an der unglücklichen Wendung seines Abends.
»Am Apparat. Mit wem spreche ich?«
»Ich bin Madame Chaboseau. Die Gattin von Docteur Pierre Chaboseau.«
Docteur Chaboseau, der Arzt mit der modernsten Praxis Concarneaus, sie befand sich in einer Villa am Boulevard Katerine Wylie, direkt am Meer. Nicht weit von Claires und Dupins Haus entfernt. Chaboseau war als Kardiologe und Hausarzt tätig und legte größten Wert auf Status, genau wie seine Frau. Sie zählten zu den Notables der Stadt, den alteingesessenen, wohlhabenden Familien, die über Generationen die Geschicke Concarneaus geprägt hatten und über einflussreiche Beziehungen verfügten. Sie lebten, auch deshalb kannte Dupin sie, nicht in der Villa, in der sich die Praxis befand, sondern in dem Haus, in dem auch Dupins Stammrestaurant war, das Amiral. Ebenfalls eine prächtige Immobilie in bevorzugter Lage, den Chaboseaus gehörte der zweite und dritte Stock des Gebäudes sowie das aufwendig ausgebaute Dachgeschoss.
»Worum geht es, Madame?«
»Er ist tot.«
»Wie bitte?«
Hatte er sich verhört?
»Mein Mann«, ein deutlicher Vorwurf war zu vernehmen, »er ist tot. Ich habe ihn vor ein paar Minuten gefunden, unten im Hof. Er ist aus seinem Arbeitszimmer im obersten Stock gestürzt.«
Sie sprach beinahe mechanisch, bemüht, korrekte Angaben zu machen.
Dupin stand wie angewurzelt.
»Ihr Mann ist tot?«
»Ja.«
»Aus einem Fenster gestürzt?«
»Er liegt zerschmettert am Boden.«
Eine Pause.
»Ich …«, Dupin brach ab. Und setzte noch einmal an: »Haben Sie die Polizei verständigt?«
Eine seltsame Frage, musste er zugeben.
»Ich habe mir im Kommissariat Ihre Nummer geben lassen. Ich habe gesagt, es sei dringend.«
»Und Sie haben den Vorfall dort nicht gemeldet?«
»Ich denke, es handelt sich um eine Angelegenheit, mit der sich der leitende Kommissar persönlich befassen sollte.«
Dupin hatte sich bereits in Bewegung gesetzt. Er erreichte einen kleinen Pfad.
»Sind Sie sicher, dass Ihr Mann tot ist?«
»Es ist eine große Blutlache zu sehen. Er liegt sehr«, sie suchte nach Worten, »sehr merkwürdig da.«
»Verständigen Sie auf der Stelle einen Krankenwagen, Madame. Ich mache mich unverzüglich auf den Weg, aber es wird eine Dreiviertelstunde dauern, bis ich bei Ihnen bin.« Eigentlich sogar mindestens eine. Wenn er beherzt fuhr.
»Ich werde den Kollegen Bescheid geben, sodass sofort jemand zu Ihnen fährt.«
Er beschleunigte seine Schritte.
»Denken Sie denn, es war Mord?«
Madame Chaboseau zögerte.
»Madame? Sind Sie noch am Apparat?«
»Sie sollten sich so schnell wie möglich herbemühen, Commissaire.«
Es war ein grauenvoller Anblick gewesen. Ein absonderlicher noch dazu. Die beachtlich große Blutlache hatte sich um den gesamten Oberkörper herum ausgebreitet. Beinahe kreisförmig und tiefrot. Glassplitter blitzten im Sonnenlicht auf, als wären sie Dekoration. Sie waren über den kleinen Innenhof verteilt: die Überreste der großen Panoramascheibe, durch die Docteur Chaboseau gestürzt war. Er war auf der rechten vorderen Körperseite aufgeschlagen. Die Schulter stand auf unnatürliche Weise vom Körper ab. Auch die Hüfte bildete einen merkwürdigen Winkel zu den schlaffen Beinen. Dupin schätzte die Höhe, aus der der Arzt gestürzt war, auf rund fünfzehn Meter. Der Tote trug eine dunkle Cordhose, ein beigefarbenes Hemd und eine gleichfarbige Weste sowie edel aussehende schwarze Hauslederslipper, die absurderweise an den Füßen geblieben waren. Das rötliche Haar sah aus, als wäre es gerade eben erst gekämmt worden. Nur die linke Gesichtshälfte war zu sehen. Das linke Auge stand einen Spalt weit offen.
Nachdem Dupin den Toten eine Weile betrachtet hatte, hatte er sich direkt in die Wohnung der Chaboseaus begeben, mit einem dieser nachträglich eingebauten Fahrstühle, wie sie viele alte Gebäude besaßen. Der Aufzug glich einer Sardinenbüchse, die an einem Drahtseil hing.
Der Gerichtsmediziner – der alte Docteur Lafond, noch der erträglichste von allen Vertretern seiner Zunft – wie auch die Spurensicherung waren selbstverständlich längst vor Ort. Dupin war mit Abstand der Letzte am Tatort gewesen, Docteur Lafond hatte nur auf ihn gewartet, bevor er die Leiche ins Labor nach Quimper bringen ließ.
Während der rasanten Fahrt von der Pointe du Raz zurück nach Concarneau hatte Dupin mehrfach versucht, Nolwenn und Riwal zu erreichen. Vergebens. Bei jedem zweiten Anruf hatte er eine Nachricht aufs Band gesprochen. Es half nichts, er würde erst einmal ohne sie auskommen müssen. Von den vier Kollegen, die sich überhaupt im Kommissariat aufgehalten hatten, waren zwei rasch vor Ort gewesen. Rosa Le Menn und Iris Nevou. Dem Kommissariat waren Anfang des Jahres zwei neue Stellen zuerkannt worden – was sie vor allem Nolwenns energischer Beharrlichkeit zu verdanken hatten, seit geraumer Zeit schon waren sie notorisch unterbesetzt gewesen. Zwei Kolleginnen verstärkten nun das Team, Nolwenn hatte auch diese Veränderung als »bitter nötig« erachtet. Le Menn kam direkt von der Polizeischule, war Anfang zwanzig, groß, mit breiten Schultern wie eine Schwimmerin, und trug ihre dunkelblonden Haare in einem geflochtenen Zopf. Sie war selbstbewusst, voller Energie. Iris Nevou war zierlicher – in der Uniform sah sie immer etwas verloren aus –, sehr helle Haut, dunkler Pagenkopf, und mit einer bemerkenswert tiefen, durchdringenden Stimme ausgestattet. Zwei Mal war sie als beste Polizeischützin der Bretagne ausgezeichnet worden, obwohl sie nicht einmal besonders viel trainierte. Sie hatte fünfzehn Jahre in der Gendarmerie von Le Conquet gearbeitet. Ende letzten Jahres hatte sie ihren Mann und ihr bisheriges Leben verlassen und war vom äußersten Nordwesten der Bretagne in den »Süden« gezogen.
Le Menn und Nevou hatten die Leiche ein erstes Mal in Augenschein genommen. Und jetzt, da auch Dupin den Toten gesehen hatte, erschien ihm Madame Chaboseaus Annahme, dass ihr Gatte schon zum Zeitpunkt ihres Anrufes tot gewesen war, äußerst plausibel. Dennoch hätte sie natürlich einen Krankenwagen rufen müssen, was sie allerdings selbst nach Dupins nachdrücklicher Aufforderung nicht getan hatte.
Sie befanden sich mittlerweile im Dachgeschoss, Dupin hatte in die Wohnräume der zweiten und dritten Etage nur einen kurzen Blick geworfen. Das ausgebaute Dachgeschoss war »Monsieurs Reich«, wie Madame Chaboseau sich ausgedrückt hatte. Sie befanden sich im großräumigen privaten Arbeitszimmer, Dupin schätzte es auf mindestens fünfzig Quadratmeter. Richtung Hafen drei kleinere Fenster, auf der gegenüberliegenden Seite zwei großzügige Panoramafenster. Sie boten einen großartigen Blick auf die Stadt, über die Dächer der umstehenden Häuser hinweg. Das rechte Fenster war kaputt, über drei Meter breit, beinahe bis zum Holzfußboden reichend – hier war es geschehen.
Die Art und Weise, wie das Dachgeschoss ausgebaut worden war, ließ einen Umbau in den Siebzigern vermuten. Die Einrichtung bestand ausschließlich aus Antiquitäten: alte Stehlampen, zwei schmale elegante Sekretäre, auf denen Kunstbildbände lagen, Perserteppiche auf gepflegtem dunklem Parkett, in einer Ecke eine mit rotem Samt bezogene Chaiselongue, in einer anderen ein schwarzer Ledersessel mit einem gepolsterten Fußhocker davor. An den Wänden hingen Gemälde in alten goldenen Holzrahmen, es waren sicher zwei Dutzend. Ein mächtiger Schreibtisch, ein ungemütlich aussehender Stuhl mit hoher Lehne dahinter. Alles in penibel gepflegtem Zustand, nahezu obsessiv ordentlich. Dupin erinnerte es an die Wohnung seiner Pariser Kindheit. Das Credo seiner Mutter lautete: Lässt man auch nur eine einzige Staubflocke zu, folgt zwangsläufig der allgemeine Niedergang.
»Und nur, falls Ihnen der Gedanke kommt, Monsieur le Commissaire«, sagte Madame Chaboseau in diesem Moment geradezu empört, »mein Mann war keinesfalls wackelig auf den Beinen! Auch wenn er dieses Jahr vierundsiebzig geworden ist. Seine Hüfte machte ihm ein wenig zu schaffen, aber er war weit davon entfernt, deswegen das Gleichgewicht zu verlieren und durch eine Fensterscheibe zu stürzen!«
Sie reckte das spitze Kinn in die Höhe.
»Und noch weniger – es verbietet sich eigentlich, darüber auch bloß einen Moment nachzudenken –«, sie stieß zischend die Luft aus, »noch weniger war es Selbstmord! Bereits die bloße Erwägung ist infam.«
Le Menn, Nevou und die Spurensicherung hatten bereits nach einem Brief oder Zettel gesucht, einer Nachricht von Monsieur Chaboseau, und nichts gefunden. Auch in den unteren Stockwerken nicht. Was jedoch noch nicht viel hieß, die meisten Selbstmörder hinterließen keinen Abschiedsbrief. Im Moment gab es allerdings in der Tat keinerlei Hinweise auf einen Selbstmord.
Dupin schätzte Madame Chaboseau auf Anfang siebzig. Kastanienbraun gefärbtes, kinnlanges Haar, eine voluminöse, elegante Frisur, die – so Dupins Vermutung – tägliche Friseurbesuche erforderte, zurückhaltend geschminkt, eine teuer aussehende Brille in Bordeauxrot. Sie trug eine dunkelgrüne Bluse und eine weite schwarze Stoffhose. Auch jetzt, vielleicht zwei Stunden, nachdem sie ihren Mann tot aufgefunden hatte, waren ihr keine übermäßigen Emotionen anzumerken. Dupin wusste, dass sich ein Schockzustand bei jedem Menschen unterschiedlich äußerte. Er hütete sich, von ihrem Auftreten auf ihr Inneres zu schließen. Wie er allgemein ein entschiedener Gegner voreiliger Schlussfolgerungen und Vermutungen war.
»Docteur Lafond wird die Leiche in der Gerichtsmedizin zuallererst auf Blutergüsse, Kratzer und Quetschungen untersuchen«, erklärte Rosa Le Menn klar und ruhig, aber ohne falsche Zurückhaltung, »um herauszufinden, ob Spuren eines Kampfes, einer körperlichen Auseinandersetzung zu finden sind.«
Im gesamten Arbeitszimmer gab es keinerlei Indizien, die auf einen Kampf hinwiesen. Dennoch: Mehr als einen einzigen kräftigen, geschickten Stoß hätte es nicht gebraucht, um den Arzt durch das Fenster stürzen zu lassen.
Dupin hatte in der Zwischenzeit das zweite, das intakte Panoramafenster inspiziert, das baugleich mit dem zerbrochenen war. Es gab weder Doppelverglasung noch Sicherheitsglas. Solche baulichen Vorschriften, die das, was passiert war, vermutlich verhindert hätten, hatte es zu der Zeit, als der Dachausbau erfolgt sein musste, noch nicht gegeben. Wenn ein erwachsener Mann frontal auf eine solch große, einfach verglaste Scheibe fiel, eventuell noch durch einen Stoß verstärkt oder indem er sich mutwillig in sie hineinwarf, gab sie augenblicklich nach.
»Sie werden ihn ebenfalls auf einen Herzinfarkt oder Schlaganfall untersuchen«, ergänzte Le Menn in diesem Augenblick an Madame Chaboseau gewandt. »Auch das hätte unter Umständen einen Sturz in die Scheibe auslösen können.«
Sicher, es gab solche unglücklichen Zufälle. Aber Dupin hielt es für äußerst unwahrscheinlich.
»So ist das Vorgehen, Madame Chaboseau. Wir werden schon bald mehr wissen«, schloss Le Menn. Dupin hatte es schon in den letzten Wochen beobachtet: Sie referierte penibel die schulpolizeilichen Regeln, die Art und Weise, wie sie es tat, ihre Mimik, ihre Stimme, ihre Haltung, sprachen aber bereits eine andere Sprache. Sie verrieten, dass Le Menn dem »offiziellen Vorgehen« mitunter skeptisch gegenüberstand, was sie Dupin von Beginn an sympathisch gemacht hatte.
Der Kommissar lief in dem großen Raum umher, ab und zu blieb er stehen, murmelte etwas vor sich hin.
Madame Chaboseau stand neben dem massiven Schreibtisch ihres Mannes, dunkles poliertes Holz, eine große Filzauflage, ein Computerbildschirm darauf. Dupin widmete sich den Bildern an den Wänden, die eng nebeneinanderhingen. Genau wie in den beiden anderen Stockwerken, die sie zuvor kurz in Augenschein genommen hatten. Hier oben hingen vor allem Arbeiten auf Papier. Pastell, Wasserfarben, Bleistift. Dupin entzifferte Signaturen von Gauguin, Berthe Morisot, Signac und Monet. Zwei Monet’sche Aquarelle von der Belle-Île hingen direkt über dem Schreibtisch. Fast allesamt Bretagnebilder. Dupin war kein Experte, aber er kannte sich gut genug aus, um zu wissen: Hier hing sehr viel Geld an den Wänden. In den unteren Stockwerken vermutlich noch mehr, dort waren es vor allem Ölgemälde. Der Kommissar hatte zudem die hochmoderne Klimaanlage bemerkt, die gut gesicherte Tür, die Alarmanlage. Madame Chaboseau hatte allerdings bereits bei seinem Eintreffen, noch bevor Dupin eine Frage zu den Bildern hatte stellen können, mitgeteilt, dass keine Kunstwerke fehlten, auch keine anderen Wertsachen. Um einen Diebstahl war es offenkundig nicht gegangen.
Dupin wandte sich an Madame Chaboseau: »Und Sie haben keine Idee, wer Ihren Mann – aufgesucht haben könnte? Denken Sie noch einmal nach.«
»Das habe ich eingehend getan«, Madame Chaboseau gab sich keine Mühe, den Verdruss in ihrer Stimme zu mäßigen. »In seinem Kalender ist nichts vermerkt. Für den gesamten heutigen Tag nicht. – Und es ist bereits das dritte Mal, dass Sie fragen.«
Der tadellose Zustand von Tür und Schloss zeigte, dass sich niemand mit roher Gewalt Zutritt verschafft hatte. Wenn es weder ein Unfall noch ein Selbstmord gewesen war, sprach im Moment einiges dafür, dass Chaboseau die Person, die ihm das angetan hatte, selbst hereingelassen hatte. Was hieße: Wahrscheinlich hatte er die Person gekannt, zumindest erwartet, vielleicht war er mit ihr verabredet gewesen. Aber es gab auch zahlreiche andere mögliche Szenarien: etwa, dass er das Haus verlassen hatte, ihm auf dem Rückweg jemand unbemerkt gefolgt war und sich erst in dem Moment gezeigt hatte, als der Arzt die Wohnung aufschloss. Oder jemand hatte sich überzeugend als jemand anderes ausgegeben. Wobei Docteur Chaboseau, wie Dupin ihn einschätzte, sicherlich nicht so einfach zu täuschen gewesen wäre.
Iris Nevou war bereits unterwegs, um herauszufinden, welche der Bewohner am Nachmittag zu Hause gewesen waren und ob sie etwas Auffälliges bemerkt hatten. Die Wohnräume der Chaboseaus in den oberen Stockwerken nahmen zwei Drittel des lang gezogenen alten Gebäudes ein, in dem sich auch das Amiral befand; im anderen Drittel, auf der vom Place Jean Jaurès abgewandten Seite, wohnten drei Parteien. Im ersten Stock befanden sich ein zusätzlicher Raum des Amiral – für gewöhnlich größeren Gesellschaften vorbehalten – sowie eine weitere Wohnung, die eine Familie mit zwei Kindern bewohnte.
Dupin ging erneut zu dem kaputten Fenster. Er blieb erst kurz vor dem Abgrund stehen und sah in die Tiefe. Unwillkürlich lief ihm ein Schauer über den Rücken.
»Und Sie selbst, Madame Chaboseau, Sie waren zwischen vierzehn und sechzehn Uhr in der Stadt unterwegs, sagten Sie vorhin?«
Ihr Anruf hatte Dupin um 16 Uhr 07 an der Pointe du Raz erreicht.
»Ich hatte einen Friseurtermin, um vierzehn Uhr. Bis ungefähr Viertel nach drei. Danach hatte ich noch ein paar Dinge zu erledigen.«
»Wenn Sie uns davon etwas detaillierter erzählen könnten?«
Dupin war bei den letzten Sätzen erneut durch den Raum gelaufen und blieb ein weiteres Mal vor dem kaputten Fenster stehen. Er schaute nach unten und erinnerte sich plötzlich an den Zehn-Meter-Sprungturm in einem Pariser Schwimmbad, auf den ihn als Zwölfjährigen eine Wette mit seinen Freunden getrieben hatte. Er trat einen energischen Schritt zurück und wandte sich wieder Madame Chaboseau zu.
»Ich war in der Galerie Gloux. Wegen eines Bildes. Dann bin ich zu Maurite.«
Ein marokkanischer Traiteur in der fabelhaften Markthalle. Dupin liebte den Stand, Maurite war großartig und bot die köstlichsten Dinge an. Und auch die Galerie Gloux kannte der Kommissar natürlich, über die Jahre waren Françoise und Jean-Michel Gloux Freunde geworden.
»Das Dienstmädchen hat heute frei. Ich habe ein feines poulet noir gekauft.«
Die Sätze hatten geklungen wie vor fünfzig Jahren. Vor hundert Jahren.
»Das war es? Nichts weiter?«
»Ich war noch kurz bei Hops, wegen der Black-Angus-Würste.«
Ein Laden, in dem auch Claire und Dupin gerne einkauften. Die Besitzerin, Katell Cadic, verkaufte vorzügliche Hartwürste und fantastischen Käse.
»Wir werden das überprüfen«, sagte Dupin und spürte, wie der Gedanke an die Würste ihn ablenkte. Er riss sich zusammen. »Ist in der letzten Zeit irgendetwas im Leben Ihres Mannes vorgefallen, das Sie mit einem Mord in Verbindung bringen würden?«
»Natürlich nicht!«, empörte sich Madame Chaboseau. »Es gab für niemanden einen Grund, meinem Mann nach dem Leben zu trachten. – Eine groteske Vorstellung.«
»Ein Vorfall in der Praxis?«, hakte Dupin unbeeindruckt nach. »Eine Fehldiagnose vielleicht? So etwas kommt vor.« Der Arzt hatte, soweit Dupin informiert war, zwar einen tadellosen Ruf besessen – dennoch: Rein statistisch gesehen musste auch ihm Derartiges schon unterlaufen sein in seiner langjährigen Berufspraxis, es war gar nicht anders vorzustellen.
Madame Chaboseau schwieg und fixierte Dupin mit strengem Blick.
»Oder ein anderer Konflikt? Ein Streit, der eskaliert ist? Überlegen Sie bitte, Madame. Es ist wichtig.«
Sie schüttelte entschieden den Kopf.
»Rivalitäten? – Er wird sicherlich nicht nur Freunde gehabt haben.«
Macht und Status, wie sie Familien wie die Chaboseaus besaßen, erwarb und erhielt man mitunter auf Kosten anderer. Was sie dann »Kollateralschäden« nannten. Meistens nahmen sie es noch nicht einmal wahr, weil sie mit »Wichtigerem« beschäftigt waren.
»Mein Mann ist hochgeschätzt«, sie hatte ihre Stimme zwar gesenkt, aber sprach mit unterschwelliger Aggressivität. »Er genießt einen tadellosen Ruf. In seinem Beruf als Arzt, aber auch als sozialer Wohltäter und Mäzen. Er ist in einer Vielzahl von Projekten engagiert.«
»Sie haben also überhaupt keine Idee, wer auf Ihren Mann schlecht zu sprechen gewesen sein könnte? Und warum?«, auch Dupin sprach nun leise und scharf. »Wenn Sie uns Informationen vorenthalten, behindern Sie die Aufklärung dieses Falls.«
»Lächerlich.«
Dupin wandte sich ab und begann abermals umherzulaufen. Er war in einen gewissen Affekt geraten. Es hatte nur teilweise mit Madame Chaboseau und ihrer hochmütigen, aufreizend unterkühlten Art zu tun. Dupin befand sich in einer merkwürdigen Stimmung. Es war eine Mischung aus Entsetzen über den möglichen, seine Intuition sagte ihm: wahrscheinlichen Mord – und tiefster Empörung. Auch wenn es noch nicht feststand: Es wäre dreist, direkt vor ihrer Nase, vor der Tür des Kommissariats, ein solches Verbrechen zu begehen.
»Wie kam es«, schaltete sich Le Menn ein und bemühte sich dabei um einen sachlichen, verbindlichen Ton, »dass ausgerechnet Sie Ihren Mann gefunden haben? Oder anders: Warum haben Sie den Eingang im Hof genommen?«
Wie häufig gehörten zu den vornehmeren Stadtwohnungen kleine Hinterhöfe, die zumeist als Parkplätze genutzt wurden. Der Hinterhof der Chaboseaus besaß sogar einen eigenen Hauseingang, der – wie der Haupteingang – zum Fahrstuhl und Treppenhaus führte.
»Ich nehme häufig den hinteren Eingang. Vor allem, wenn man einkaufen war, ist er äußerst praktisch.«
»Wozu nutzen Sie den Hof?«, setzte Le Menn nach.
Der Hof war vielleicht vier mal drei Meter groß. Rechts und links eine hohe Mauer, zur Straße hin ein elektrisches Tor, brusthoch.
»Früher hatte ich dort meinen Wagen stehen.«
»Und Ihr Mann?«
Madame Chaboseau zog die Augenbrauen hoch: »Er parkt seinen Wagen seit eh und je gegenüber, in dem größeren Hof. Er hat dort einen Stellplatz gemietet.«
Es sollte – so klang es zumindest für Dupins Ohren – so viel heißen wie: Das ist der angemessenere Platz für die Limousine meines Mannes. Beide Höfe lagen in der Rue du Guesclin, einer schmalen, wenig befahrenen Einbahnstraße hinter dem Amiral. An der Straßenecke befand sich Dupins Lieblings-Presseladen, geführt von Alain und Amélia. Dort kaufte er all seine Zeitungen und vieles mehr: Bücher, die Wissenschafts- und Kochmagazine für Claire und seine roten Notizhefte von Clairefontaine, auch die Dutzenden Kugelschreiber, die er ständig wieder verlor.
»Und wozu nutzen Sie Ihren Hof mittlerweile?« Le Menn ließ nicht locker.
Dupin holte sein Clairefontaine heraus und machte sich ein paar Notizen.
»Nur noch als privaten Zugang zum Haus.«
»Zu dem nur Sie beide den Schlüssel besitzen?«
»Und der Hausmeister sowie das Dienstmädchen. Sonst niemand.«
»Sie haben den Leichnam Ihres Mannes erst in dem Moment gesehen, als das Tor aufging?«
Bisher hatte sich niemand gemeldet, der Zeuge des Sturzes gewesen wäre – oder den Leichnam schon früher als Madame Chaboseau bemerkt hätte. Was nicht verwunderte, die Straße war nicht sehr belebt. Und das Einfahrtstor sicher ein Meter vierzig hoch.
Madame Chaboseau nickte.
»Worüber haben Sie beim Mittagessen gesprochen? Hatten Sie ein besonderes Thema?«, Dupin bemühte sich um einen freundlichen Ton. Madame Chaboseau hatte vorhin erwähnt, dass sie und ihr Mann zusammen gegessen hatten, zwischen zwölf und halb zwei, unten im Amiral, in der Brasserie, wie jeden Freitagmittag. Ihrer Aussage zufolge war sie anschließend in den zweiten Stock gegangen, ihr Mann in sein Büro im vierten Stock. Freitagnachmittags praktizierte er offenbar schon seit einigen Jahren nicht mehr.
»Wir haben Zeitung gelesen. – Und über dieses und jenes gesprochen.«
»Zum Beispiel?«
»Über den Hafen.«
»Den Hafen?«
»Den Hafenausbau.«
»Verstehe. Und was genau?«
Diese Woche waren mehrere Artikel über die neue Werft erschienen, die kürzlich eröffnet worden war. Die Stadt hatte außerdem Terrain für den weiteren Ausbau des Hafens freigegeben.
»Wie sehr wir all diese Aktivitäten begrüßen.«
Der Hafenausbau war schon lange eines der vorherrschenden Themen in Concarneau. Denn die Ville Bleue, die schöne »Blaue Stadt«, war im Wesentlichen eines: eine Stadt am Meer. Und der Hafen ihr Zentrum; genau genommen waren es sogar drei Häfen. Der Freizeit- und Sporthafen für Amateursegler und Profis. Der legendäre Fischereihafen – nichts hatte die Geschichte Concarneaus so geprägt wie die Fischerei –, dessen Aufkommen zwar geringer geworden war in den letzten Jahrzehnten, der aber immer noch zu den bedeutendsten Fischereihäfen ganz Frankreichs gehörte. Und nicht zuletzt der Industriehafen mit seinen Werften, dem Schiffbau und den Schiffsreparaturen, der am stärksten wuchs. Wenn man über die beeindruckend hohe Brücke über dem Moros fuhr und mit einem Mal einen atemberaubenden Blick auf Concarneau hatte, befand sich der Hafen direkt unter einem. Man sah riesige Schiffe im Wasser oder in imposanten Trockendocks. Der Hafen in der Stadt, die Stadt im Hafen lautete das Motto des Ausbaus. Ein Satz, der auch auf die glückliche geografische Lage der Stadt hinwies, die durch Landzungen und große natürliche Becken des Flusses Moros geschützt war vor dem brutalen Tosen des Atlantiks und vor feindlichen Angriffen, von denen es in der Geschichte der Stadt einige gegeben hatte.
»Es wird bei Ihrem Gespräch über den Hafen doch sicher um etwas Spezielleres gegangen sein?«
»Nein. – Und inwiefern sollte dies überhaupt von Belang sein?«
Es war müßig.
»Worüber haben Sie noch gesprochen?«
»Das Wetter.«
Die Antwort hatte nicht einmal harsch geklungen. Und vermutlich entsprach sie der Wahrheit. Das Wetter war in der Bretagne ein äußerst beliebtes Thema, auch wenn es – anders als in anderen Teilen der Welt – das Leben der Menschen eigentlich wenig beeinflusste, kein Bretone ließ sich wegen des Wetters von irgendetwas Wichtigem abhalten.
Es klopfte, Iris Nevou trat in den Raum. Unmittelbar begann sie zu berichten: »Keiner der Nachbarn hat zwischen vierzehn und sechzehn Uhr eine fremde Person im Haus gesehen. Ich habe mit allen selbst gesprochen«, sie holte ihr Smartphone aus der Tasche und tippte darauf herum, »soll ich Ihnen die Liste schicken?« Sie blickte zu Dupin, ihre tiefe Stimme faszinierte ihn jedes Mal aufs Neue, sie stand in einem bemerkenswerten Kontrast zu ihrer fragilen Erscheinung.
»Tun Sie das. Und niemand hat irgendetwas gesehen – oder zumindest gehört? Die berstende Fensterscheibe? Einen Schrei?«
»Niemand, nichts. Auch Paul Girard nicht«, der Besitzer des Amiral, ein Freund Dupins von der ersten bretonischen Stunde an. »Und auch keiner der Mitarbeiter. Ich habe mit Ingrid gesprochen.« Die wundervolle, patente Chefin der Brasserie. »Paul Girard ist übrigens gerade bei seiner Austernzüchterin, um neue Ware zu holen.«
»Was ist mit den Mitarbeitern aus der Küche?«
Die Küche lag nach hinten raus, allerdings sicher zehn, fünfzehn Meter entfernt vom kleinen Hof.
»Auch sie haben nichts gehört.«
Was plausibel war. In Küchen ging es laut zu, hinzu kamen die leistungsstarke Klimaanlage und der Lärm vom Markt, der freitags auf dem Platz vor dem Amiral stattfand.
»Sehr gut.«
Nevou hatte alles bedacht, Dupin war zufrieden.
Sein nachdrückliches »sehr gut« hatte auf den Gesichtern der Anwesenden einen ratlosen Ausdruck erscheinen lassen, Nevou eingeschlossen.
Der Kommissar wandte sich abrupt zum Gehen.
Kurz vor der Tür blieb er stehen und drehte sich um: »Ich danke Ihnen sehr, Madame Chaboseau. Bitte melden Sie sich, wenn Sie etwas brauchen!«
Madame Chaboseau stand tiefe Verblüffung ins Gesicht geschrieben.
»Wenn Ihnen etwas einfällt, rufen Sie mich an. Meine Nummer haben Sie ja. Und: Le Menn, Sie warten hier – die Spurensicherung kommt gleich noch einmal hoch.«
Sie würden dann auch den Computer mitnehmen. Madame Chaboseau hatte angegeben, das Passwort nicht zu kennen, was hieß: Es würde wie immer kompliziert. Das galt ebenso für den Code von Monsieur Chaboseaus Handy, das sie auf einem der Sekretäre sichergestellt hatten. Das Festnetz hatte er schon seit Jahren kaum noch benutzt, nur sie selbst, so Madame Chaboseau, habe noch damit telefoniert; dafür besitze sie kein Handy.
Die Kollegen der Spurensicherung hatten im Hof begonnen, waren danach bereits im Dachgeschoss gewesen, um sich dann – damit sie das Gespräch mit Madame Chaboseau in Ruhe führen konnten – in den zweiten und dritten Stock zu begeben. Dupin hatte sie angewiesen, Fotos von allem zu machen, was Madame Chaboseau nur unter Protest zugelassen hatte.
»Und Sie, Nevou, Sie kommen mit mir«, sagte der Kommissar und winkte sie zu sich.
Er hatte einige Aufträge für sie.
»Und bevor ich es vergesse, Madame: Der Raum hier gilt bis auf Weiteres als Tatort. Der Hof ebenso. Niemand außer der Polizei hat Zutritt.«
Er öffnete die Tür und lief auf die Treppen zu, den Aufzug würde er kein zweites Mal betreten.
Nicht, dass er nicht noch eine ganze Reihe von Fragen an Madame Chaboseau gehabt hätte, aber er musste sich erst einmal ordnen. Und es so schnell wie möglich erneut bei Riwal und Nolwenn versuchen. Vor allem würde es keinen Augenblick länger ohne einen café gehen. Den hatte er eigentlich schon am Nachmittag an der Baie des Trépassés trinken wollen. Nach dem kühlen Bier. Das er ebenso wenig bekommen hatte wie die Schinken-Crêpes. Der entspannte Ausflug schien bereits Tage her.
Dupin saß auf der Terrasse des Amiral. In seiner gewohnten Ecke, die weiß getünchte Steinmauer im Rücken. Es war Viertel nach sieben, nur ein weiterer Tisch, ganz am anderen Ende, war noch besetzt. Ingrid hatte ihm gerade den café gebracht, den er beim Durchqueren des Lokals bei ihr bestellt hatte. Er seufzte erleichtert.
Als Dupin das Amiral von der Avenue Pierre Guéguin her betreten hatte, Nevou war davor stehen geblieben, um zu telefonieren, waren die beiden Redakteure von Ouest-France und Le Télégramme auf ihn zugestürmt. Donal und Drollec. Die Bürogebäude der beiden Zeitungen lagen keine zweihundert Meter entfernt von hier, am Place Jean Jaurès, dem weiträumigen Platz vor der Südseite des Amiral.
Natürlich würde sich die Nachricht vom Tod Chaboseaus wie ein Lauffeuer in der gesamten Stadt verbreitet haben. Trotz aller Sympathie für die Journalisten: Dupin war nicht in der Stimmung gewesen, Erklärungen abzugeben. Daher hatte er so unwirsch wie wahrheitsgemäß erklärt, dass er noch überhaupt »nichts, aber auch gar nichts« zu sagen hätte.
Dupin lehnte sich zurück, trank einen Schluck Kaffee und ließ seinen Blick über den Platz schweifen, der bereits von den Spuren des Marktes gesäubert worden war.
Linker Hand erhob sich die mächtige Ville Close, daneben erstreckten sich die ellenlangen, sich verzweigenden Holzstege des Freizeithafens. Dutzende sanft schaukelnde Boote, Segelboote zumeist. Die bunten Segel hingen träge herab, effektvoll beschienen von der immer noch hoch stehenden Sonne. Die langen Tage hatten begonnen.
Mit einem Mal musste Dupin lächeln. Es gab gleich mehrere Gründe für seine – unpassende – Gefühlsregung. Wenn das hier mehr als ein tragischer Unfall oder Selbstmord war, wenn hier ein Verbrechen stattgefunden hatte – und sein Gefühl sagte ihm, dass dies der Fall war –, dann würde er jetzt öfter hier sitzen, und zwar »dienstlich«. Das Amiral würde sein Büro. Zudem würde er heute auf keinen Fall bei dem Abendessen mit Claires Eltern dabei sein können. Und überhaupt aller Voraussicht nach große Teile der familiären Pfingstaktivitäten verpassen.
»Ach, hier sind Sie, Commissaire!« Iris Nevou stand plötzlich vor seinem Tisch, er hatte sie nicht kommen sehen. Sie wirkte verstimmt.
»Auch einen?« Dupin hob die leere Tasse hoch.
»Ich trinke keinen Kaffee.«
Nevou setzte sich neben ihn.
»Unterhalten Sie sich bitte einmal mit den Praxismitarbeitern von Docteur Chaboseau über eventuelle Feinde ihres Chefs. Oder Konflikte.«
»Einverstanden.« Nevou zog ein zerfleddertes braunes Notizheft hervor. »Einverstanden« war eines ihrer Lieblingswörter, das sie anders, als es die meisten Menschen taten, nicht wie beiläufig verwendete, sondern jedes Mal mit großem Nachdruck betonte.
»Dann«, Dupins Clairefontaine lag bereits aufgeschlagen vor ihm, er überflog, was er sich notiert hatte, »dann diese Projekte – welche sind das, in denen sich Docteur Chaboseau«, er zitierte Madame Chaboseaus Worte, »als sozialer Wohltäter und Mäzen auf solch vorbildhafte Weise engagiert hat? Le Menn soll Ihnen bei der Recherche helfen.«
Vor allem am Anfang ging es meist darum, es auf gut Glück zu versuchen. Zu recherchieren, hier und dort. Man musste möglichst viele Netze an möglichst vielen Stellen auswerfen. Und sehen, was hängen blieb.
»Sollten wir nicht warten, bis wir wirklich wissen, womit wir es hier zu tun haben? Wenn es nun gar kein Mord war? Ich weiß ja nicht.«
Noch eine Wendung, die Nevou gern benutzte. Und die mehr zum Ausdruck brachte als einen konkreten Zweifel an der jeweiligen Sache. Bei ihrem »Ich weiß ja nicht« ging es vielmehr um eine Haltung, die grundsätzlich alles infrage stellte. Und keinem Augenschein traute. Eine gute Haltung, fand Dupin. Eigentlich.
»Ich …« Was sollte er sagen. Streng genommen hatte sie recht. »Wenn es aber doch Mord war, was im Augenblick die mit Abstand plausibelste Annahme ist, verlören wir wertvolle Zeit.«
Sie zuckte mit den Schultern. »Na gut. Dann würde ich mich an Ihrer Stelle für Chaboseaus geschäftliche Unternehmungen interessieren.«
»Was genau meinen Sie?«
»Seine Frau und er betätigen sich bekanntlich als Unternehmer und Investoren.«
Das war neu. Für Dupin zumindest.
Ein Hund hatte sich neben ihrem Tisch niedergelassen. Ein großer Hund, langes, dreckiges Fell, schwer zu sagen, welche Farbe, gelblich irgendwie. Er lag mit der Schnauze auf den Pfoten, ab und zu hob er den Kopf und blickte den Kommissar an. Dupin sah sich nach dem Besitzer um, konnte aber niemanden entdecken.
»Was sind das für Investitionen?«
»Sie sind an mehreren Firmen und Projekten beteiligt. Immobilien, eine Bierbrauerei, auch am Freizeithafen hier in Concarneau. Ich weiß von diesen dreien. Aber vielleicht sind es mehr.«
Die Bretagne hatte viele erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer hervorgebracht. Geschäftsleute, die sich zugleich in der Verantwortung sahen, gesellschaftlich zu wirken, auch das eine stolze bretonische Tradition. Es gab unzählige Beispiele, so auch Yves Rocher, der auf dem Dachboden seines Elternhauses seine erste Creme auf der Basis von Feigwurz hergestellt hatte. Oder François Pinault, der milliardenschwere Kunstmäzen, der eines der größten Modeimperien der Welt gegründet hatte. Gucci, Yves Saint Laurent, Puma, mittlerweile alles in bretonischer Hand.
»Weiß man, in welcher finanziellen Höhe die Chaboseaus sich an den Projekten beteiligen?« Dupin war neugierig geworden.
Nevou zuckte mit den Schultern. »Ich werde es recherchieren.« Sie wirkte immer noch ein wenig mürrisch. Dupin hätte ihr zu gern einen Kaffee bestellt. Er war davon überzeugt, dass Koffein die Laune verbesserte.
»Hatte er Geschäftspartner? Feste Geschäftspartner?«
»Ich werde es recherchieren.«
»Sprechen Sie darüber auch mit Madame Chaboseau in allen Einzelheiten.«
»Einverstanden.«
Schweigend notierte Dupin sich ein paar Stichpunkte und gab Ingrid, die den Tisch am anderen Ende der Terrasse abkassierte, ein Zeichen für einen weiteren Kaffee.
Nevou runzelte die Stirn. »In der Wohnung hängen sicher einige Millionen an den Wänden. Das ist mehr als ein gewöhnliches Hobby, denke ich. Auch ein interessanter Punkt.«
Dupin hatte schon einmal in einem Fall mit einem wertvollen Gemälde zu tun gehabt, einem Gauguin. Zwar war bei den Chaboseaus offenbar kein Bild gestohlen worden, aber eine kriminelle Geschichte konnte in der Kunstwelt auch ganz anders aussehen. Vielleicht, und das war nur eine von zahlreichen Möglichkeiten, war Chaboseau einem raffinierten Fälscher aufgesessen, woraus sich eine dramatische Geschichte entsponnen hatte.
»Madame Chaboseau hat angegeben, heute Mittag wegen eines Bildes in der Galerie Gloux gewesen zu sein.«
Dupin war nicht ganz klar, was genau Nevou damit sagen wollte. Er würde dennoch in der Galerie vorbeischauen. Das war ohnehin eine gute Idee. Françoise und Jean-Michel kannten die Stadt, die Menschen, die concarnesischen Verhältnisse.
»Wir …«
»Commissaire!«
Im Handumdrehen stand Rosa Le Menn vor ihnen.
»Der Gerichtsmediziner hat angerufen. Er wollte Sie persön…«
»Und?«
»Ein ausgeprägtes prämortales Hämatom an der rechten Schulter. Und eines am Oberarm. Frisch, sie sind kurz vor dem Tod verursacht worden. Ich zitiere«, ihre Augen weiteten sich, »morphologisch deutet alles auf einen heftigen Stoß hin. Docteur Lafond würde sich, so soll ich es Ihnen sagen, schon nach der ersten Inaugenscheinnahme weitgehend darauf festlegen.«
Sie setzte ab, musterte Dupin, als würde sie ihm Zeit lassen wollen, die Nachricht zu verarbeiten.
»Das hieße«, konstatierte Nevou, »er ist tatsächlich umgebracht worden.« Sie ließ trotzdem ein »Ich weiß ja nicht« folgen.