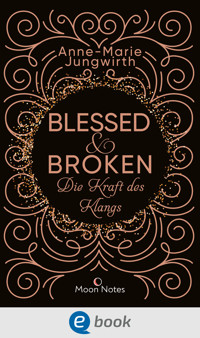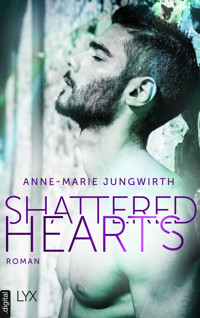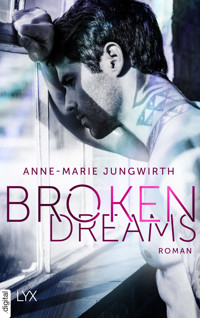
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Only by Chance
- Sprache: Deutsch
Straße trifft auf High Society
Fünf Jahre saß Tyriq im Gefängnis. Nach seiner Entlassung hat er keinen Cent in der Tasche, doch er ist fest entschlossen, ein neues Leben zu beginnen und seiner alten Gang den Rücken zu kehren. Beides ist schwerer als gedacht. Als er den Geldbeutel der gut situierten Innenarchitektin Avery findet, prallen Welten aufeinander - aber zwischen den beiden knistert es sofort. Mit Avery an seiner Seite fasst Tyriq neuen Mut und will seine längst zerbrochenen Träume verwirklichen. Doch seine Vergangenheit lässt sich nicht so leicht abschütteln und stellt ihre Liebe auf eine harte Probe ...
Auftakt der "Only-by-Chance"-Serie von Anne-Marie Jungwirth
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 512
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Epilog
Leseprobe
Die Autorin
Die Romane von Anne-Marie Jungwirth bei LYX
Impressum
Anne-Marie Jungwirth
Broken Dreams
Roman
Zu diesem Buch
Fünf Jahre saß Tyriq im Gefängnis. Nach seiner Entlassung hat er keinen Cent in der Tasche, doch er ist fest entschlossen, ein neues Leben zu beginnen und seiner alten Gang den Rücken zu kehren. Beides ist schwerer als gedacht. Als er den Geldbeutel der Innenarchitektin Avery findet, prallen Welten aufeinander – aber zwischen den beiden knistert es sofort. Mit Avery an seiner Seite fasst Tyriq neuen Mut und will seine längst zerbrochenen Träume verwirklichen. Doch seine Vergangenheit lässt sich nicht so leicht abschütteln und stellt ihre Liebe auf eine harte Probe …
1
Tyriq
Der Soundtrack, der den Beginn meines zweiten Lebens begleitete, klang in etwa so: knarr, raschel, knarr. Meine zweite Chance. Das Intro bildete das metallene Knarren der Zellentür. Dieses Geräusch hatte in den letzten fünf Jahren meinen Rhythmus bestimmt, Tag und Nacht für mich geteilt. Ich wollte es nie wieder hören. Ebenso wenig wie das Rascheln der Plastikbeutel, in denen mir meine Habseligkeiten übergeben wurden. Sie rochen wie damals, wie mein altes Leben. So vertraut. Ich wusste nicht, ob ich das gut finden sollte. Schließlich war mein bisheriges Leben alles andere als eine Erfolgsgeschichte gewesen. Wenn es überhaupt eine Geschichte war, dann eine abschreckende. Ich könnte damit von Schule zu Schule ziehen und Kinder davor warnen, den falschen Weg einzuschlagen. Das wäre eine gute Sache, und vielleicht sollte ich wirklich darüber nachdenken. Das Problem war nur, ich hatte keine Perspektive für das Publikum anzubieten. Alles, was ich hatte, war ein Haufen Scheiße. Ich war am Ende des Tunnels, stand aber immer noch in der Dunkelheit. Vorübergehend. Ich wollte das Licht. Ich wollte es wirklich. Mehr als alles andere … Und ich war bereit, hart dafür zu arbeiten. Nicht für die Kinder in den Schulen, die ich nie besuchen würde. Vermutlich nicht einmal für mich selbst. Aber für Mama.
Papa tot, Madox tot …
Sie hatte nur noch mich und mein Versprechen. Ich würde es nicht brechen.
Nicht noch einmal.
Und schließlich stand ich hier und lauschte den Schlussakkorden dieses bedeutenden Moments, dem finalen Knarren des großen Ausgangstores. Das Tor zur Freiheit und der Weg zu unbegrenzten Möglichkeiten. Wobei … wenn man genau hinhörte, war es eher ein Ächzen als ein Knarren. Das spiegelte mein Innerstes perfekt wider. Ich sollte mich erlöst fühlen, rennen, singen oder tanzen, keine Ahnung – irgendwas. Jeden einzelnen Tag in den letzten Jahren hatte ich auf diesen Moment hingefiebert, und jetzt, wo er da war, wurden ihm meine Gefühle nicht gerecht.
Ein paar Schritte von mir entfernt erkannte ich Pepe, meinen besten Freund seit Kindertagen. Er stand auf dem staubigen Parkplatz, mit dem Rücken gegen einen auf Hochglanz polierten BMW gelehnt. Ich musterte ihn von der Ferne und hatte plötzlich das Gefühl, die eine Uniform gegen die andere getauscht zu haben. Während ich drinnen die weiten blauen Hosen mit dem gelben CDCR-Aufdruck des Gefängnisses und ein weißes Shirt unter einem hellblauen Hemd getragen hatte, waren es nun eine weite blaue Hose und ein weißes Unterhemd. Beides unterschied sich nur um Nuancen von Pepes Outfit. Ich musste innerlich lachen. Irgendwie hatte ich gedacht, alles hätte sich geändert in den letzten fünf Jahren. Die Mode in unserem Barrio offenbar nicht.
»Hey«, rief ich Pepe zu. »Ich wusste nicht, dass du kommst.«
»Estúpido, glaubst du etwa, ich verpasse, wenn mein bester Freund herauskommt?« Er breitete seine Arme aus und kam auf mich zu.
Das mochte eine rhetorische Frage sein, aber nachdem wir in den letzten zwei Jahren kein Wort miteinander gewechselt hatten, hätte ich sie vor fünf Minuten noch mit Ja beantwortet. Ich versuchte, den Gedanken an Pepes letzten Besuch abzuschütteln. Es war kurz nach Madox’ Tod gewesen, und wir hatten beide Dinge gesagt, die wir nicht hätten sagen sollen, waren in unserer Rage zu weit gegangen. Ich hegte deswegen keinen Groll mehr auf Pepe. Heute wusste ich, dass es Wut auf mich selbst war, die ich auf ihn projiziert hatte.
Erleichtert, dieses Kapitel nun hinter mir lassen zu können, nahm ich Pepe in den Arm und klopfte ihm auf die Schulter. Ich hatte kein Recht, sauer auf ihn zu sein. Oder auf irgendwen, außer mich selbst.
»Ich bin froh, dass du hier bist, Homie.«
»Und ich erst.« Pepe strahlte, und auch ich konnte nicht anders.
Das merkwürdige Gefühl, das mich vor wenigen Minuten noch beschlichen hatte, war wie weggeweht. »Und nun?«
»Eigentlich wollte ich dich nach Hause fahren. Deine Mutter macht ihr berühmtes Chili.« Pepe fuhr sich übers Kinn und lachte spitzbübisch. »Aber wenn du möchtest, können wir vorher einen Abstecher zu einem Frisör machen und dir einen anständigen Haarschnitt verpassen.«
»Whoa.« Ich boxte Pepe gegen den Oberarm. »Erstens ist das Chili meiner Mama ganz weit oben in den Top Ten der Dinge, die ich im Knast vermisst habe. Und du weißt ja, wie es ist, wenn man auf etwas so sehr hinfiebert. Wenn es dann zum Greifen nah ist, ist der Drang nicht auszuhalten. Also, ein Abstecher – no way! Und zweitens: Ich mag meine neue Frisur.«
»Diese Matte? Du siehst aus wie … wie … keine Ahnung. Ich kenne Menschen mit solchen Frisuren nicht persönlich.«
»Ich hoffe, ich darf mit diesen Haaren trotzdem in deinen schicken Schlitten einsteigen.«
»Schweren Herzens.« Pepe öffnete die Fahrertür und zwinkerte mir zu.
Ich drehte mich noch einmal um, sah hoch zu den Wachtürmen und ließ meinen Blick über die kargen und vertrockneten Außenanlagen schweifen. Ich reckte dem California State Prison mein Kinn entgegen.
Merk dir dieses Gesicht. Denn du wirst es nie wiedersehen.
Vielleicht erscheint das kindisch, für mich war es aber alles andere als das. Noch nie war mir etwas so ernst gewesen. Ich ging ums Auto herum und stieg ein.
Die Ledersitze waren hell, ich hatte fast Angst, sie mit meinen alten Sachen schmutzig zu machen. Pepes letztes Auto war, soweit ich mich erinnern konnte, eine Aufbewahrungsstation für Pizzakartons, Burgertüten und Bierdosen gewesen. Wobei die darin beförderten Wertstoffe vermutlich teurer waren als der alte verrostete Buick selbst. Aber das war lange her.
»Dir scheint es ja richtig gut zu gehen. Du kannst dir einen BMW leisten?«
Pepe musterte mich skeptisch. Sofort fühlte ich mich schuldig, so etwas gesagt zu haben. Schließlich hatte er die letzten Jahre, während ich hinter Gittern saß, vermutlich hart dafür gearbeitet. Ich gönnte es meinem Freund.
»Tut mir leid. Das war nicht so gemeint, wie es vermutlich geklungen hat.«
»Nein, schon okay. Du hast recht. Die letzten Jahre waren gut für mich. Ich wollte dir das nur nicht unter die Nase reiben.«
Natürlich wollte er das nicht. Im Gegensatz zu mir war er immer ein guter Freund gewesen. »Das freut mich für dich. Ehrlich. Und ich hoffe, dass du mir beim Chili alles darüber erzählst.«
»Tyriq, ich glaube, deine Mutter wird froh sein, dass du endlich wieder zu Hause bist. Wenn heute jemand im Mittelpunkt steht, dann du. Die Geschichten über mein langweiliges Leben kann ich dir später erzählen.«
»Aber du bleibst doch, oder?«
Pepe schüttelte den Kopf. »Heute ist Familientag. Lass uns das morgen nachholen.«
»Klingt nach einem guten Plan.«
»Klar, kommt ja auch von mir.«
»Ich hatte ganz vergessen, was für ein selbstherrliches Arschloch du sein kannst.«
»Tja.« Pepe startete den Motor, drückte das Gaspedal durch und ließ den Motor aufheulen. »Dann gewöhn dich besser mal wieder dran.«
Ich hakte mit dem Zeigefinger in der Luft eine imaginäre Check-Box ab. »Schon erledigt.«
»Und ich hatte fast vergessen, wie schnell du lernst.«
Und wie wenig ich trotzdem daraus mache … »Jetzt quatsch nicht, sondern bring mich heim.«
Mit quietschenden Reifen fuhr er los. Ein Lebensabschnitt blieb hinter mir zurück und wurde vom aufgewirbelten Staub verschluckt. Abgesehen von einem Topf Chili hatte ich keine Ahnung, was vor mir lag. Vermutlich hauptsächlich Ablehnung und Vorurteile. Aber denen würde ich mich nicht heute widmen.
Ich stand ratlos vor der unbekannten Haustür. Pepe war schon weitergefahren, und ich wagte nicht, an dieser Tür zu klingeln, hinter der meine Mutter nun wohnen sollte. Wann war sie denn umgezogen?Sie hatte es mir nicht erzählt, keine Andeutung gemacht. Dabei war Mama die Einzige, die mich jede Woche besucht hat. Außer wenn sie so krank war, dass sie das Bett nicht verlassen konnte, aber das kam so gut wie nie vor. Sie war robust, die stärkste Frau, die ich kannte. So leicht konnte sie nichts umhauen. Vielleicht war sie nicht immer so gewesen, sondern musste es nur sein, weil das Leben ihr keine besonders guten Karten ausgeteilt hatte. Keinen besonders guten Mann. Und keine besonders guten Söhne.
Ich fuhr zusammen, als sich die Haustür öffnete und meine Mutter im Türrahmen stand. »Tyriq«, rief sie und zog mich in eine feste Umarmung. »Mein Junge!«
»Mama«, brachte ich erstickt hervor.
Sie hielt mich so fest, dass ich kaum mehr Luft bekam, und ich bin wirklich nicht von zarter Statur. Der Tag im Gefängnis ist lang und die Freizeit so öde, dass Krafttraining eine der wenigen verlockenden Beschäftigungen ist. Ich keuchte kurz.
Sie löste sich von mir und musterte mich skeptisch. »Cielo,warum stehst du denn hier vor der Tür und klingelst nicht?«
»Ich wollte gerade«, log ich. »Aber du bist mir zuvorgekommen.«
Sie lächelte und streifte sich die Hände an ihrer Kochschürze ab.
»Und du solltest wirklich langsam aufhören, mich Cielozu nennen.« Ich war kein Himmel, nicht mal ihrer.
Mama verdrehte die Augen. »Tyriq, du kannst tun und lassen, was du willst. Du bist und bleibst mein Cielo.«
Jetzt war es an mir, skeptisch die Augen zusammenzukneifen. »Woher hast du eigentlich gewusst, dass ich hier unten stehe?« Wann bist du umgezogen und warum hast du es mir nicht erzählt?
»Ich könnte ja behaupten, dass das mein unschlagbarer mütterlicher Instinkt ist, aber ich habe Pepes Auto aus dem Küchenfenster gesehen.« Sie zeigte schräg nach oben zu einem Fenster mit einer weißen Gardine und jeder Menge Kräuter auf der Fensterbank. »Hast du Hunger?«
»Pepe hat gesagt, du machst dein berühmtes Chili für mich.«
»Dieser Junge kann aber auch kein Geheimnis für sich bewahren.« Sie schüttelte den Kopf und nickte Richtung Hausflur. »Sollen wir?«
»Bitte!« Ich presste meine Hände vor der Brust zusammen. »Ich sterbe vor Hunger.«
Wir gingen die Treppe hoch in den ersten Stock. Meine Mutter ging voran und öffnete die Wohnungstür. »Komm rein, Cielo, und fühl dich wie zu Hause.«
Als ich eintrat, umfing mich der Duft von zu Hause, oder besser gesagt von Mamas Küche: gebratene Zwiebeln, Knoblauch, Paprika und ein Hauch Koriander. Die Einrichtung des Wohnzimmers, in dem ich mich befand, bestand aus Einbauschränken und einer geblümten Zweisitzercouch.
»Komm«, sagte sie, während sie den Raum mit ein paar Schritten durchquerte und mir mit einem Winken signalisierte, ihr zu folgen. Durch einen gemauerten Rundbogen gelangten wir in die Küche. Verglichen mit unserer alten kam sie mir winzig vor. Doch sie hatte alles, was man brauchte, und wirkte durch die geöffnete Durchreiche zum Wohnzimmer nicht beengt.
Meine Mutter nahm den Deckel von einem großen Topf und rührte mit einem Holzlöffel im Chili. »Koste«, sagte sie und hielt mir den gefüllten Löffel entgegen.
Schon der Geruch ließ mir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Gehorsam öffnete ich den Mund und probierte. Der Geschmack explodierte in meinem Mund. Es schmeckte nach Freiheit, nach Kindheit, nach Glück … nach meiner Mama. »Es ist perfekt.«
»Dann lass uns essen«, sagte sie strahlend. Schnell füllte sie zwei tiefe Teller und stellte sie mit Löffeln und etwas Brot auf den kleinen runden Tisch vor der Durchreiche. Eiswasser für uns beide stand bereits dort.
»Guten Appetit.«
Meine Mutter bekreuzigte sich. »Lass es dir schmecken, mein Junge.«
In seliger Ruhe genoss ich mein Essen. Manchmal vergisst man, die kleinen Dinge im Leben zu schätzen. Zum Beispiel wie es ist, nicht mit hundert anderen Menschen in einem Raum zu essen oder ohne die musikalische Begleitung scheppernder Tabletts und Prügeleien. Ich aß alles bis auf den letzten Bissen und wischte mit einem Stück Brot den Rest vom Teller. Als kleiner Junge wollte ich meine Mutter heiraten. Und auch wenn mir dieser Gedanke in den letzten zwanzig Jahren – aus gutem Grund – nicht mehr gekommen war, konnte ich die Beweggründe des kleinen Tyriq gerade wieder gut nachvollziehen.
»Es war köstlich, Mama«, sagte ich und stopfte mir das Brot in den Mund. »Ich hatte fast vergessen, wie gut es ist.«
»Und du hast auch vergessen, dass man nicht mit vollem Mund redet, Tyriq.« Sie lächelte mich liebevoll an. »Dabei warst du doch immer der mit den guten Manieren bei uns im Haus.«
»War«, erwiderte ich schulterzuckend und nickte. »Und apropos Haus …«, ich räusperte mich, »du hast mir gar nicht erzählt, dass du umgezogen bist. Wann? Und …«
Meine Mutter legte ihre Hand auf meine und bedeutete mir zu schweigen. »Etwa ein halbes Jahr, nachdem Madox gestorben ist. Ich konnte mir das Haus allein einfach nicht mehr leisten. Und ich …« Sie schluckte. »Ich wollte dich nicht damit belasten.«
»Mich damit belasten? Mama, du weißt doch, dass du nie eine Belastung für mich warst oder sein wirst.«
Sie drückte meine Hand und sah mich aufmunternd an. »Ich weiß, mein Schatz. Aber ich wollte nicht, dass du dir unnötig Sorgen machst. Ich meine, was hättest du denn schon an meiner Situation ändern können?«
»Nichts«, sagte ich und wich ihrem Blick aus.
»Siehst du. Und trotzdem hätte es dir keine Ruhe gelassen. Wie ich dich kenne, hättest du dich vermutlich auch noch dafür schuldig gefühlt.«
»Zu Recht.« Ich schlug auf den Tisch. Nicht vor Zorn, sondern aus Verzweiflung. »Ich war nicht da für dich. Ich habe dich allein gelassen. Und Madox auch.«
»Tyriq Javier Flores García«, sagte sie in ihrem Ich-dulde-keine-Widerrede-Tonfall und stand dabei auf. »Ich will diesen Blödsinn nicht mehr aus deinem Mund hören. Was Madox passiert ist, war nicht deine Schuld. Im Gegenteil.« Sie bekreuzigte sich. »Man soll nicht schlecht über die Toten reden, aber was dir passiert ist, geht auf sein Konto und nicht umgekehrt. Also hör endlich auf, Schuld auf dich zu laden, die zu tragen nicht deine Aufgabe ist.«
Das konnte sie drehen und wenden, wie sie wollte. Ich war nicht da gewesen, als mein Bruder erschossen wurde. Ich war nicht da gewesen, um ihn zu retten. Ich war nicht da gewesen, um seinen Leichtsinn auszugleichen und seine Waghalsigkeit in die Schranken zu weisen.
Ich. War. Nicht. Da.
»Ich meine es ernst, Tyriq«, drängte sie. »Versprich mir, dass du aufhörst, dich damit zu quälen.«
»Wenn das so einfach wäre.«
Mama presste ihre Lippen zu einer feinen Linie zusammen, so wie sie es immer tat, wenn sie nach den richtigen Worten suchte. »Glaubst du, Madox hätte gewollt, dass du dich quälst?«
Vermutlich nicht. Mein kleiner Bruder hatte immer viel zu sehr in den Tag hinein gelebt, um nachtragend zu sein. Aber Papa hätte es gewollt. Ich hatte ihm versprochen, auf Madox aufzupassen. An seinem Sterbebett hatte ich es ihm geschworen. Und dann hatte ich sie im Stich gelassen. Beide.
2
Avery
Seit zehn Minuten saß Tamy jetzt schon vor meinem Schreibtisch und trommelte nervös auf der Materialmustermappe für unseren Termin herum. Sie war eine gute Praktikantin: strebsam, verlässlich, mitdenkend. Damit war mir Tamy verdammt ähnlich. Doch manchmal ging es mir ganz schön auf den Keks, immer in diesen Spiegel blicken zu müssen. So wie jetzt. Am liebsten hätte ich ihr die Mappe entrissen und damit auf die Finger gehauen.
»Tamy, bitte«, sagte ich stattdessen und sah tadelnd auf ihre Hände. Genau wie ich trug sie natürliche Fingernägel, was in L. A. fast so etwas wie ein rebellischer Akt ist. Allerdings zierte ein dezenter roséfarbener Lack ihre Finger – klassisch, elegant und meiner Meinung nach total langweilig.
»Es tut mir so leid. Ich wollte dich nicht stören. Es ist nur … Sollten wir nicht langsam fahren?«
»Ja, sollten wir.« Wenn wir in einer perfekten Welt leben würden. »Aber dieser Auftrag ist eine C-Klientin, und ich habe hier gerade eine wichtige Anfrage von einem A-Klienten, die ich vorher noch dringend bearbeiten muss.« Mr Warren war nicht nur ein A-Klient, sondern ein sehr ungeduldiger und cholerischer Mensch. Über beides sah ich angesichts seines großzügigen Einrichtungsbudgets gern hinweg.
Tamy nickte mir schmallippig zu, wirkte aber keineswegs glücklich mit meiner Antwort. Wäre ich in ihrem Alter vermutlich auch nicht gewesen. Schließlich meint man nach dem College, man wüsste alles. In Wahrheit weiß man gar nichts und ist – bestenfalls – von unerreichbaren Idealen verblendet. Als ich MacGowan Interior Design gegründet habe, wollte ich nur Herzensprojekte annehmen und mir für jeden Klienten ausreichend Zeit nehmen. Ich wollte in sie hineinspüren und für sie Orte schaffen, die ihr Wesen spiegelten und ihre Bedürfnisse befriedigten, wie sie es nie für möglich gehalten hätten. Mein Anspruch war es, jeden Raum individuell, geschmackvoll und trotzdem funktionell zu gestalten. Jedes Zimmer sollte perfekt sein. Und zwar nur für diesen einen Klienten.
Die Realität hatte mich leider schneller eingeholt, als mir lieb war. In dieser gab es nun einmal Wettbewerb und Kostendruck, Mieten und Gehälter, die zu zahlen waren. Würde ich meine Aufträge so bearbeiten, wie ich mir das zu Beginn vorgestellt hatte, wäre ich nach einem halben Jahr pleite. Das wusste ich deshalb so genau, weil ich es nach meinem ersten halben Jahr tatsächlich war. Mit Daddys Geld, das ich nicht gern annahm, und seinen Ratschlägen, die ich noch viel weniger gern annahm, hatte ich mein Unternehmen anschließend wieder auf die Beine gebracht und mich von unrealistischen Träumereien verabschiedet und durch vernünftige Konzepte ersetzt. Raumdesign war eben nur die halbe Miete, wenn man tatsächlich erfolgreich sein wollte. Da Tamy ein Praktikum machte, um etwas zu lernen, würde ich ihr keine Scheinwelt vorspielen, sondern ihr die nackte, kalte Realität zeigen. Auftrüge und Kunden zu priorisieren, gehörte dazu. Deshalb drückte ich auf die Schnellwahltaste auf dem Telefon. »Melissa, kommst du bitte kurz?«
»Ja, sofort.« Einen Augenblick später stand meine Assistentin vor meinem Schreibtisch, ihre langen blonden Haare mit einem Kugelschreiber zu einem Knoten zusammengesteckt. »Was gibt es?«
»Kannst du bitte Mr Warren anrufen und einen Begehungstermin für sein neues Projekt vereinbaren? Wenn möglich noch heute oder morgen.«
Sie machte sich eine Notiz und sah zu mir auf. »Wird gemacht. Sonst noch etwas?«
»Ja. Weißt du noch, was ich ihm das letzte Mal mitgebracht habe?«
»Einen Bilderrahmen aus der Kleinvelt-Kollektion«, antwortete sie ohne zu zögern. »Wir haben noch einige der Studio-Z-Kerzenleuchter. Die hatte er noch nicht.«
»Sehr gut. Leg mir bitte einen beiseite und dazu noch eine gute Flasche Rotwein.«
»Wird gemacht. Sonst noch etwas?«
Ich blickte über die Unterlagen, die in kleinen Stapeln auf der weißen Arbeitsfläche verstreut lagen. »Nein, erst mal nicht. Wir fahren dann los zu unserem Termin bei Mrs Clarins.«
»Gut.« Melissa hatte sich gerade zum Gehen abgewandt, als sie sich noch einmal umdrehte und mich zögernd ansah.
»Was ist?«, fragte ich.
»Es ist nur … die neue Stofflieferung von Prada ist heute bei fabricA angekommen. Ich wollte sie eigentlich später holen. Aber … der Shop liegt auf eurem Weg …«
Ich hob die Hand, um sie zu unterbrechen. »Kein Problem. Wir können kurz dort haltmachen und sie mitnehmen.«
Wenn ich es richtig im Kopf hatte, war es ihre Woche mit ihrer Tochter. Seit Melissa sich getrennt hatte, lebte Sophia abwechselnd eine Woche bei ihrem Vater und eine bei ihrer Mutter. So unorthodox sich das für mich erst einmal angehört hatte – es funktionierte für alle Beteiligten offensichtlich gut. Während ihrer Woche trat Melissa beruflich etwas kürzer, woraus ich ihr – Stress hin oder her – keinen Strick drehen wollte. Andere Frauen zu fördern, ist einer der Werte meiner Firma, an dem ich niemals rütteln wollte.
»Danke, Avery. Bis später.«
Tamy kritzelte in ihrem Notizbuch herum und sah mich schließlich erwartungsfroh an.
»Jetzt können wir los.«
Sofort sprang sie auf. »Ich bin schon so aufgeregt.«
Wäre mir gar nicht aufgefallen. »Das ist normal. Aber glaub mir, wenn du erst einmal ein paar Termine hinter dir hast, vergeht das«, erklärte ich und griff nach meiner Handtasche. »Hast du alles?«
Tamy deutete auf die Laptop-Tasche und die Mustermappe in ihrer Hand und nickte. »Ja.«
Auf dem Weg zu unserer Klientin hielt ich bei fabricA. Es war noch früh und der Parkplatz des kleinen Einkaufscenters gähnend leer.
»Sind wir nicht schon etwas spät für Besorgungen?«, fragte Tamy.
»Dafür nicht, glaub mir.«
Tamy nickte und ihr verkniffener Gesichtsausdruck zeigte mir, dass sie mir kein Wort glaubte. Was okay war. Ich zeigte auf das Schild über dem Laden. »Das hier ist der beste Stoffladen in ganz L. A.«
Tamy grinste, als ich mich zu ihr umwandte, und mir wurde die Zweideutigkeit meiner Wortwahl bewusst. Zu Collegezeiten hätte ich darunter vermutlich auch etwas anderes verstanden. Obwohl ich mir bei Tamy nur schwer vorstellen konnte, dass sie mal aus der Rolle fiel. Sie war bewundernswert kontrolliert, organisiert und strebsam. Viele junge Leute könnten sich eine dicke Scheibe von ihr abschneiden. Andererseits – man war nicht nur jung, um zu lernen. Man war jung, um Fehler zu machen, um Spaß zu haben, mutig zu sein. Ach du meine Güte! Wann hatte ich mir das selbst zuletzt erlaubt? Ich war zwar nicht mehr so jung wie Tamy, aber mit fünfundzwanzig alles andere als alt. In den letzten Jahren hatte ich definitiv zu viel gearbeitet und zu wenig Spaß gehabt.
»Gehst du bitte schon mal zur Kasse und fragst nach unserer Bestellung?«, instruierte ich Tamy. »Ich muss schnell noch etwas nachsehen.«
»Okay.« Sie setzte sich in Bewegung, wobei ihr akkurat geschnittener Bob bei jedem Schritt mitwippte.
Zielgerichtet steuerte ich auf den Tisch mit den Duchesse-Stoffen zu, und mein Auge fand genau das, wonach ich gesucht hatte. Einladend und glänzend lag er vor mir: ein Traum aus schwerer, kupferfarbener Seide. Mit der flachen Hand fuhr ich über den Stoff und knetete ihn anschließend vorsichtig. Er fühlte sich wunderbar an und hatte die perfekte Balance aus Weichheit und Steifigkeit. Dann fiel mein Blick auf das Etikett. Kein Wunder bei dem Preis. Er passte perfekt in das grobe Konzept, das ich Mrs Clarins gleich vorstellen wollte. Ich schnappte mir den Ballen, klemmte ihn mir unter die Arme und marschierte auf die Kasse zu.
Tamy war bereits dabei, die Bestellung mit Shirin, der Inhaberin des Ladens, durchzugehen und zu verpacken.
»Avery, Liebes, wie geht es dir?«, begrüßte sie mich überschwänglich.
»Hi Shirin. Danke, alles bestens. Das hier kommt noch dazu«, sagte ich und legte den Stoffballen auf die Ladentheke.
»Ist der nicht herrlich?«
»Hab mich sofort in ihn verliebt. Wenn man Stoffe heiraten dürfte, hätte ich ihm schon einen Antrag gemacht.«
»Wenn ich dir da mal nicht zuvorgekommen wäre«, konterte Shirin und tippte auf ihrer Kasse, während mich Tamy fragend ansah.
»Ist für das Schlafzimmer von Mrs Clarins. Ich denke, dafür wird sie mir unser Zuspätkommen verzeihen.« Das ist zumindest der Plan.
Tamy betrachtete den Stoff so verliebt, als würde sie ihn gleich um ein Date bitten wollen. »Wofür genau ist der?«
»Für die Vorhänge. Der Stoff aus der Mustermappe ist zwar auch gut, aber der hier … Er ist perfekt.«
»Das wird toll aussehen.«
»Ich weiß.« Das klang arrogant, aber was soll ich sagen? Wenn ich etwas wirklich gut verstand, dann das Kombinieren von Farben, Formen und Materialien. »Bringst du das schon mal zum Wagen? Ich kümmere mich um die Rechnung.«
»Natürlich.« Tamy nickte, schnappte sich den ersten großen Karton und ging zur Tür.
Shirin blickte von ihrer Computerkasse auf. »Zahlst du gleich oder sollen wir das auf Lieferschein setzen?«
»Lieber gleich.« Ich zückte meinen Geldbeutel und legte meine Firmenkreditkarte auf den Tisch.
Sie steckte die Amex ins Lesegerät, und ich bestätigte die Zahlung. Tamy flitzte währenddessen zweimal zwischen Tresen und Kofferraum hin und her.
»Alles klar.« Shirin drückte mir die Rechnung in die Hand. »Nächste Woche bekommen wir eine tolle Lieferung bedruckter ägyptischer Baumwolle. Wenn du möchtest, kannst du sie vor allen anderen sehen und auswählen.«
Letztes Jahr hatte sie bei einem Lieferanten versehentlich die zehnfache Menge Damast bestellt. Ich hatte ihr dabei geholfen, die Ware zu Markt- und nicht zu Schleuderpreisen wieder loszuwerden. Seitdem war ich die Vorzugskundin in ihrem Laden. »Danke, du bist ein Schatz.«
Ich klemmte mir zwei Ballen, die noch auf dem Tresen lagen, unter meinen rechten Arm und hielt meinen Geldbeutel mit der Hand umklammert.
»Bis dann.«
Mit der freien Hand winkte ich zum Abschied und ging mit Tamy, die die restlichen Ballen trug, zum Auto.
Fünfzehn Minuten später erreichten wir das Haus von Mrs Clarins. Andere würden es vermutlich als Villa bezeichnen, aber diese Dimension hatte es für mich nicht. Der Auftrag war verdammt klein, ich verfluchte mich dafür, dass ich ihn angenommen hatte. Es ging lediglich um ein Schlafzimmer. Der Rest des Hauses war erst vor Kurzem, nach dem Tod ihres Mannes, komplett von Benjamin Mason eingerichtet worden. Eigentlich nahm ich solche Aufträge nicht an, aber als mir Mrs Clarins am Telefon erklärt hat, dass sie in diesem ungemütlichen Raum kein Auge zumachen könnte, hat es mich irgendwie gepackt. Ob das nun Stolz oder Schadenfreude war, konnte ich nicht sagen. Denn Benjamin Mason war nicht nur ein Kollege. Er war mein Rivale. Erzrivale, um genau zu sein.
Ich nickte Tamy aufmunternd zu und klingelte mit dem kupferfarbenen Duchesse-Stoff im Arm an der Tür.
Mrs Clarins öffnete. »Ich dachte schon, Sie kommen nicht mehr«, sagte die Witwe anstelle einer Begrüßung.
»Hallo, Mrs Clarins. Es tut mir fürchterlich leid, aber dafür habe ich den perfekten Stoff für Ihr Schlafzimmer gefunden.« Zur Entschuldigung zeigte ich auf den Ballen, den ich bei mir trug. »Natürlich haben Sie die Entwürfe noch nicht gesehen und können es sich deshalb vermutlich noch nicht vorstellen. Aber …«, ich streichelte den Stoff und blickte ihn fast sehnsüchtig an, »… ich denke, Sie werden sie genauso lieben wie ich.«
»Das hoffe ich sehr«, sagte sie knapp, während dem Satz in ihrem Kopf mit Sicherheit noch etwas folgte wie bei der Verspätung oder bei Ihren Preisen.
Mit einem zuversichtlichen Nicken deutete ich auf Tamy. »Das ist übrigens Tamara Brown, meine neue Mitarbeiterin.«
»Guten Tag, Mrs Clarins«, flötete Tamy, streckte ihr die Hand entgegen und setzte ein breites Lächeln auf.
»Kommen Sie rein.« Unsere Klientin ging voraus, durchquerte den Eingangsbereich und hielt auf einen großen Tisch im offenen Wohn-Ess-Bereich zu.
Alles hier trug die Handschrift meines Rivalen, und das war keine schlechte, wie ich neidlos anerkennen musste. Trotzdem würde ich nie einen Raum so einrichten. Diese Vorliebe für große auffällige – und meiner Meinung nach völlig funktionslose – Stücke würde mir immer fremd bleiben. So wie der riesige, blau lackierte Baumstamm in der linken Raumhälfte.
»Bitte«, sagte die Klientin und nahm an dem bunt furnierten Kirschbaumtisch Platz.
Ich setzte mich ebenfalls und gab Tamy das Zeichen, ihren Laptop zu starten. Dann klickte sie für mich durch die Präsentation, und ich erklärte anhand der Bilder und der Mustermappe mein Konzept aus harten Linien und weichen Farben und Stoffen. Normalerweise hatte ich ein gutes Gespür dafür, wie Dinge ankamen. Mrs Clarins war jedoch ein echtes Pokerface. Bis auf ein knappes Nicken hier und ein kleines Aha da hielt sie sich bedeckt.
»Aufgelockert wird das Ganze durch verschiedene Schattierungen von Edelmetallen, wie die goldene Deckenleuchte, die rosé-goldenen Nachttischlampen und diese Kerzenleuchter und Bilderrahmen.« Tamy untermalte meine Worte mit den entsprechenden Bildern in der Präsentation. Schließlich griff ich nach dem Stoff, den ich eben gekauft hatte. »Und natürlich durch diesen wunderbaren Stoff hier für Ihre Vorhänge.«
»Aha«, sagte die Witwe zum gefühlt hundertsten Mal.
Schon klar, es war kein superinnovatives Konzept, aber so, wie ich sie verstanden hatte, war das ja auch nicht das, was sie wollte. Mrs Clarins wollte einen Raum zum Träumen und wohlfühlen. Das war mein Entwurf zweifelsohne.
»Was denken Sie?« Verdammt noch mal – es war ein wunderschöner Raum zum Träumen.
Die Witwe presste ihre Lippen zusammen und sah auf den Bildschirm des Laptops, mied meinen Blick konsequent. Hätte sie mir in die Augen gesehen, hätte ich mich sicherer gefühlt. »Um ehrlich zu sein …«, setzte sie an, »ich hatte es mir irgendwie anders vorgestellt. Es ist sehr harmonisch und bestimmt ein Raum, in dem ich hervorragend schlafen kann. Aber eben auch etwas einfallslos.«
Tamy neben mir wurde kleiner und kleiner.
Leute wie Mrs Clarins waren meine Lieblingskunden. Wenn man sie fragte, hatten sie nie konkrete Vorstellungen. Mit dem Konzept konfrontiert wussten sie aber schließlich ganz genau, dass sie es sich anders vorgestellt hatten.
»Verstehe.« Ich räusperte mich und schaltete dabei in meinen Diplomatie-Modus um. »Daran lässt sich ja arbeiten. Wenn ich Sie bei unserem ersten Gespräch richtig verstanden habe, wollten Sie ein Schlafzimmer, in dem Sie abschalten können. Das scheint der Entwurf schon einmal zu erfüllen. Gehen wir doch einfach mal die einzelnen Bestandteile durch. Was gefällt Ihnen daran gut und was gar nicht?«
Verstohlen blickte sie auf den Stoffballen auf dem Tisch. »Besonders gut gefällt mir der Vorhang. Er ist so …«
»… opulent, aber nicht erdrückend«, beendete ich für sie den Satz.
»Ganz genau.«
Aufmunternd lächelte ich Tamy zu. Der Termin war noch nicht vorbei und ich noch lange nicht fertig. »Sehr gut. Machen wir weiter. Was ist mit dem Rest? Welches Element würden Sie am liebsten aus dem Konzept streichen?«
Mrs Clarins zuckte mit den Schultern. »Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Es gefällt mir alles. Es ist einfach nur noch nicht das.« Sie schnipste mit den Fingern, um ihr das zu unterstreichen.
Wie gern hätte ich meinen Kopf auf die Tischplatte geknallt. »Ihnen fehlt das besondere Etwas. Ein auffälliges Einzelstück, das alle Blicke auf sich zieht. Habe ich recht?«
»Vermutlich.« Zum ersten Mal, seit ich die Präsentation beendet hatte, sah sie mich an.
»Was halten Sie davon? Sie führen mich in Ihrem Haus herum und zeigen mir alles, was Ihnen besonders gut gefällt, damit ich ein Gefühl für Ihr ganz persönliches Extra bekomme?«
»Sehr gern.« Sie stand auf und nickte mir und Tamy zu. »Folgen Sie mir.«
Um diesen verlustbringenden Auftrag endlich abzuschließen, wollte ich alles tun. Wenn es ihr gefiel, würde ich ihr sogar einen pinkfarbenen Baum ins Schlafzimmer stellen. Hauptsache fertig und raus hier.
Memo an mich selbst: Nie wieder Ein-Zimmer-Aufträge von komplizierten Personen annehmen.
3
Tyriq
Am Morgen wachte ich mit Rückenschmerzen auf. Die Zweisitzercouch im Wohnzimmer war einfach zu klein für mich. Meine Mutter hatte selbst darauf schlafen wollen und mir ihr Bett angeboten. »Ich bin so klein, mich stört das gar nicht«, hatte sie gesagt. Aber das stand natürlich nicht zur Debatte. Als ich beschlossen hatte, wieder bei ihr einzuziehen, zurück in mein altes Zimmer, hatte ich nicht gewusst, dass sie in eine kleine Wohnung gezogen war. Aber so war es schon mehr als genug, ihr Sofa zu vereinnahmen, wie ein Parasit, und ich würde hoffentlich bald auf eigenen Beinen stehen.
Seit Monaten quälte mich der Gedanke, was ich tun würde, wenn ich endlich draußen war. Es war keine Frage von Träumen, sondern Angst davor, keine Chance mehr zu bekommen. Meine Mutter hatte mir nach dem Essen einen kleinen Lichtblick zum Dessert präsentiert: Ich hatte gleich am nächsten Tag in einem Café, nicht weit von hier, einen Termin zum Probearbeiten. Pepe hatte ihn für mich organisiert. Und mir nicht mal was davon erzählt. Daran erkennt man eben echte Freunde. Sie tun dir was Gutes und erwarten nichts dafür, wollen einfach, dass es dir gut geht. In einem Café zu arbeiten, stand früher zugegebenermaßen nicht auf der Liste meiner Traumberufe, aber ich war nicht wählerisch. Wenn ich an die Zeit vor dem Gefängnis zurückdachte, wurde mir schlecht. Die Drogen, die Gewalt … Wie viele Leben ich wohl zerstört hatte? Ich wollte nie wieder dorthin zurück und würde dankbar jede Chance auf ein anständiges Leben, die sich mir bot, nutzen.
»Tyriq, mein Junge«, sagte Mama, während sie etwas Sahne in ihren Frühstückskaffee rührte, »eine Sache ist da noch.«
»Und was?«
»Deine Kleidung. Du solltest dir für heute wirklich etwas anderes besorgen.«
Ich sah an mir hinab und wusste sofort, was sie meinte. Ein sinnvoller, gut gemeinter Ratschlag. Und trotzdem fühlte sich der knusprige Speck in meinem Mund gerade eher schneidend an. Mit etwas Kaffee spülte ich die Stücke hinunter und räusperte mich.
»Sollte ich den Job bekommen – und glaub mir, ich werde wirklich alles dafür geben –, dann werde ich mir von meinem ersten Lohn etwas kaufen.«
Energisch schüttelte sie den Kopf, verließ die Küche und kam wenig später mit einem Geldbeutel in der Hand wieder, aus dem sie ein paar Scheine zog. Sie legte das Geld auf den Tisch. »Kauf dir was.«
Das hatte ich befürchtet. »Nein, das kann ich nicht annehmen. Du hast doch selbst nicht viel.«
»Cielo«, setzte sie an und seufzte theatralisch, »sieh es als Startinvestition in dein neues Leben. Denn, wenn du so gehst …«, sie zeigte auf das Unterhemd und die weite Hose, die ich trug, »… wird es vermutlich gar keinen Job geben und keinen Lohn, von dem du dir etwas kaufen könntest.«
Sie hatte recht, das war mir klar. Trotzdem sträubte sich alles in mir. Ich nahm die Scheine in die Hand und zählte sie. Es waren fünfzig Dollar. Ich nahm einen Zehner davon und gab ihr den Rest zurück.
»In Ordnung, aber ich zahle dir alles zurück und werde dich unterstützen, sobald ich etwas verdiene.«
Meine Mutter runzelte die Stirn. »Was willst du dir denn davon kaufen?«
»Ich werde in einen Secondhandladen gehen.«
»Wenn du meinst.«
»Ja, tue ich.«
Sie nickte. »Gut. Eines solltest du dir aber dringend aus dem Kopf schlagen.«
»Und das wäre?«
»Dass du mir helfen musst. Ich komme klar. Du musst dir keine Sorgen um mich machen. Wenn du etwas für jemanden tun willst, mein Junge, dann für dich. In Ordnung?«
Ich nickte zögerlich. Wir widmeten uns schweigend dem Frühstück.
Auf meinem alten Computer, der nun in Mamas Schlafzimmer stand, suchte ich nach einem Secondhandladen und wurde schnell fündig. Ginas Thrift Shop. Ich notierte mir die Adresse und hoffte inständig, dass ich mir auch bald ein Smartphone leisten konnte. Meine Mutter borgte mir für heute ihren kleinen Chevrolet, dafür lieferte ich sie in dem Restaurant ab, in dem sie als Küchengehilfin arbeitete. Anschließend fuhr ich weiter zu dem Secondhandladen.
Der Laden war ein ziemlicher Reinfall. Es gab nur Frauenklamotten. Ich fragte mich nach einem weiteren Secondhandshop durch. Das nächste Geschäft, das ich aufsuchte, hatte sich auf exklusive Abendgarderobe spezialisiert. Beim dritten Anlauf hoffte ich, endlich fündig zu werden. Den Wagen stellte ich auf dem Parkplatz der kleinen Einkaufsmeile, in dem das Vintaloo untergebracht war, ab. Ich stieg aus und wandte mich im Gehen noch einmal zum Auto um. Etwas Schwarzes auf dem Boden zog meinen Blick auf sich: ein Damengeldbeutel mit goldenem Designeremblem. Ich bückte mich und hob ihn auf. Unsicher sah ich mich um, als wäre das Aufheben etwas Verbotenes, bei dem ich hoffen müsste, nicht erwischt zu werden. Ich schüttelte den Gedanken ab und bemühte mich um einen klaren Kopf.
Links und rechts von mir parkte niemand. Die Besitzerin der Geldbörse war vermutlich schon nicht mehr hier. Die zwei ineinander verschlungenen Cs sahen aus, als würden sie mich anlachen. Erneut sah ich mich verstohlen um und spürte, wie mein Herz zu rasen begann. Fuck!
Ich öffnete den Geldbeutel. Ein Bündel Scheine sprang mir förmlich entgegen, als wären sie in der Börse eingequetscht gewesen wie einer dieser Clowns in der Box. Schnell nahm ich das Geld heraus und zählte grob. Das waren knapp dreihundert Dollar.
Dreihundert Dollar! Schon die Hälfte davon würde mein Leben gerade sehr viel leichter machen. Was redete ich da? Selbst ein Zwanziger würde mir ein schon fast komfortables Gefühl verschaffen.
Es war verlockend. Das Geld einfach an mich zu nehmen und die Börse wegzuwerfen. Auf das Bare kam es Leuten, die einen Geldbeutel verloren, oft ja ohnehin nicht an. Ich könnte ihn anschließend in einen Briefkasten werfen, der Besitzer wäre vermutlich dankbar. Nachdenklich stand ich da, das Geld in der einen, die Börse in der anderen Hand. Wieso dachte ich überhaupt so lange nach? Das war doch eine Einladung. Vielleicht sogar Schicksal. Möglicherweise war es Gottes Art, sich um mich zu kümmern, bis ich es in einer Woche wieder selbst konnte. Wieso verdammt nur zögerte ich?
Natürlich wusste ich, warum. Ich hatte es mir schließlich geschworen, als ich entlassen wurde: Keine krummen Dinger mehr. Das hieß nicht nur, mich nicht mehr erwischen zu lassen. Ich hatte vor, ein anständiger Mensch zu werden. Und anständige Menschen klauten kein Geld. Sie klauten überhaupt nichts. Sie dachten noch nicht einmal daran.
Ich setzte mich zurück ins Auto und legte den Geldbeutel auf dem Armaturenbrett ab. Verzweifelt fuhr ich mir durch die Haare. Haare – es fühlte sich immer noch seltsam an, plötzlich so viele zu haben. Vielleicht war es genau das, was mich an meinem Zögern so irritierte. Es war wie meine neue Haarpracht, einfach ungewohnt. Aber so, wie es richtig war, mein Äußeres zu ändern und mich anzupassen für den Wunsch nach einem normalen Leben, war es auch richtig, das Geld nicht zu nehmen.
Aber schon zehn Dollar … Nein!
Ich würde in der Geldbörse nach dem Führerschein suchen. Und wenn die Besitzerin nach einem anständigen Menschen aussah, würde ich den Geldbeutel unangetastet abgeben. Wenn nicht, dann würde ich mir zumindest zwanzig Dollar herausnehmen. Deal!
Ich atmete tief ein und nahm die erste Karte aus einem der Schlitze.
¡Por favor!
Ich bekreuzigte mich kurz und blickte auf die Karte in meiner Hand. Eine American Express. Avery MacGowan.
Wieso nur fühlte es sich plötzlich wie das größere Verbrechen an, nur weil ich ihren Namen kannte? Nüchtern betrachtet wäre es vorher genauso falsch gewesen. Wollte ich diese Frau bestehlen?
Es war nicht so, dass mein Verhalten Frauen gegenüber sehr viel besser gewesen war als das gegenüber Männern und ich hatte genug Dinge getan, auf die ich nicht besonders stolz war.
Ich schüttelte mich bei der Erinnerung an diese Person, die ich einmal gewesen war und nie wieder sein wollte, und steckte die Amex zurück. Danach fand ich diverse Kundenkarten, bis ich endlich den Führerschein herauszog.
Avery MacGowan.
Andächtig betrachtete ich das Bild. Wenn man einen Namen liest, hat man eine bestimmte Vorstellung von einer Person, wie alt, wie jung, wie groß, wie klein, wie zart, wie kräftig und wie hübsch oder hässlich dieser Mensch ist.
Ich kannte niemanden mit dem Namen Avery oder MacGowan, insofern war meine Vorstellung nur vage gewesen. Doch in diesem vagen Bild hatte ich eine vornehme und zurückhaltende Frau gesehen. Schön, aber nicht aufreizend. Klug, trotzdem weiblich.
Schon komisch. Avery. Es war nur ein Name. Und doch hatte er solch starke Assoziationen in mir geweckt.
Sanft fuhr ich mit den Fingern über das Bild. Wie es aussah, hatte ich mich nicht getäuscht.
Avery MacGowan sah für mich nach einer absolut anständigen Person aus. Irgendwie war ich beinahe erleichtert, dass ich so nicht in die Versuchung kam, etwas zu tun, was ich sonst bereut hätte.
4
Tyriq
Unschlüssig stand ich in der Umkleide des Secondhandladens und fragte mich, ob das Button-down-Hemd oder der Rollkragenpullover die bessere Wahl für den ersten Arbeitstag eines Exknackis war. Der Rolli würde mehr von den alten Gang-Tattoos verdecken, das Hemd dafür seriöser wirken. Ich zog den Pullover über und mir schauderte augenblicklich. Nicht, weil er so überhaupt nicht mein Style war. Nicht, weil er gebraucht war. Es war die Menge an Stoff auf meiner Haut. Ein eigentümliches Gefühl, sich so einzupacken. Ich hatte mein ganzes Leben im Großraum L. A. verbracht. Eine Hose und ein T-Shirt waren für meine Begriffe schon mehr als genug Kleidung. Ich zog den Rolli aus und schlüpfte in das Hemd. Während ich die letzten Knöpfe schloss, entschied ich, dass es das werden würde. Obwohl ich es bis oben hin zuknöpfte, konnte meine Haut noch atmen.
Mit einer Hand schob ich den beigen Stoffvorhang beiseite und trat auf der Suche nach einem Spiegel hinaus. Mit zusammengekniffenen Augen betrachtete ich mich.
Das war nicht ich.
Aber das war gut, schließlich wollte ich nicht mehr ich sein.
Die Verkäuferin stellte sich neben mich und musterte meinen Anblick im Spiegel. Sie war etwa so alt wie ich und trug kurze gebleichte Haare. »Das Hemd steht dir super. Aber diese Hose …«
Schon klar, ich sollte mir eine andere zulegen. Nur irgendwie hatte ich mir eingeredet, dass sie zusammen mit einem schönen Oberteil ganz okay war. »So schlimm?«
»Ja«, sagte sie knapp, und ihr Gesichtsausdruck sprach Bände.
Ich sah an mir hinab. »Ehrlich gesagt, habe ich seit meiner Kindheit keine Hosen mehr getragen, die anders geschnitten waren. Ich glaube, ich würde mich nicht wohl darin fühlen.«
»Das weiß man erst, wenn man es probiert hat.«
Ich zögerte, was die Verkäuferin offensichtlich als Zustimmung interpretierte.
»Ich suche dir was raus. 32/32 schätze ich.«
Unschlüssig zuckte ich mit den Schultern. Keine Ahnung, schon möglich, dass das meine Jeansgröße war. Immerhin hatte ich noch nie in meiner tatsächlichen Größe eingekauft. »Ich warte in der Umkleide.«
Wenig später kam die Verkäuferin auf meine Kabine zu und schob sanft den Vorhang beiseite. Auf ihren Armen lagen drei Hosen. »Das hier ist eine Skinny.« Sie drückte mir eine schwarze Jeans in die Hand. »Wird dir vermutlich nicht gefallen, ist aber der letzte Schrei und würde dir bestimmt fabelhaft stehen.«
Mit Blick auf die Hosen fragte ich mich kurz, was ich hier eigentlich tat. Es war nicht des Geldes wegen. Das Hemd kostete nur zwei Dollar. Da war eine Hose bestimmt noch drin, und schließlich wollte ich einen guten Eindruck beim Probearbeiten machen. Es war schon schwer genug, überhaupt etwas zu bekommen, wenn man vorbestraft war. Trotzdem fühlte ich mich wie ein verdammter Verräter. Ich sollte nicht so denken, das wusste ich. Es war richtig, mich zu verändern. Dennoch – obwohl ich es nicht wollte – schlug da dieses zweite Herz in meiner Brust.
»Die anderen beiden sind einfach nur straight geschnitten. Probier sie mal an. Und ruf mich, falls du eine andere Größe brauchst.«
»Mach ich.« Ich nickte höflich, zog den Vorhang zu und ließ mich auf den Hocker sinken. War das zu glauben? Ich saß hier mit einer Skinny Jeans in einer Umkleide, während in meinem alten Barrio vermutlich gerade ein paar Dreizehnjährige zum Dealen rekrutiert wurden. Was mich nicht kümmern sollte. Das lag hinter mir. Alles!
Deshalb ließ ich doch meine Hose runter und griff mit zusammengebissenen Zähnen zu der Jeans, die zuoberst auf dem Stapel lag. Mit äußerstem Widerwillen zog ich den Reißverschluss zu und kam mir vor wie eingeschweißt. Diese Hose – ich hasste sie schon jetzt und brauchte nicht einmal in den Spiegel zu sehen, um zu wissen, dass das keine Hose, sondern eigentlich eine Leggins war. Bestimmt machte sich die Frau da draußen nur über mich lustig.
Als ich aus der Kabine trat, konnte ich ihr schallendes Gelächter förmlich in meinem Kopf hören. Nur dass ich es eben nicht hörte. Was mich etwas nervös machte. Unsicher trat ich vor den Spiegel.
»Und?«, fragte die Verkäuferin hinter mir erwartungsvoll und strich sich eine gebleichte Strähne hinters Ohr.
»Ich weiß nicht.« Wusste ich wirklich nicht. »Ich fühle mich irgendwie verkleidet.«
»Schade, du siehst nämlich toll darin aus.« Sie schnalzte mit der Zunge und ließ mich stehen, fast so, als wäre ich ein hoffnungsloser Fall. Vielleicht war ich das in vielerlei Hinsicht. Aber musste das auch bei so einfachen Dingen wie Kleidung sein? Konnte ich mich nicht wenigstens hier zusammenreißen und somit meinem Leben eine Chance auf einen Neuanfang geben?
Ich marschierte zur Kasse, hinter der die Verkäuferin gerade gelangweilt aus dem Fenster sah.
»Tut mir leid, ich bin mir wirklich unsicher damit. Trägt man so was echt? Ich meine, kann ich das auch zur Arbeit tragen?«
»Was arbeitest du denn?« Sie wirkte ehrlich interessiert und bemüht, mir zu helfen.
»Ich fange heute im Senza Chichi an.«
Ratlos zuckte sie mit den Schultern. »Und was ist das für ein Laden?«
»Einer mit tollem italienischen Kaffee, aber ohne Sirup-Schnickschnack.« Das hatte zumindest Mama gesagt. »Es gibt dort Kuchen und ich glaube, auch Sandwiches.«
»Aha.« Sie sah mich an, als hätte ich ihr gerade erzählt, dass letztes Jahr meine Katze überfahren worden ist.
»Und?«, fragte ich und zeigte auf mein Outfit.
»Bedienung oder Selbstbedienung?«
»Bedienung.«
»Dann würde ich auf jeden Fall die nehmen. Die Frauen werden dich lieben und dir ein gutes Trinkgeld geben.«
»Was?«
»Was was? Du hast mich ganz genau verstanden.«
Hatte ich. Doch es widerstrebte mir zutiefst. Es war nicht so, dass ich Geld nicht gut gebrauchen konnte. Mich dafür in eine enge Hose zu zwängen, das erschien mir aber so … Ich hatte schon schlimmere Dinge getan. Sehr viel schlimmere Dinge. Trotzdem, bei all dem hatte ich mich wenigstens gefühlt wie ein Mann.
»Schluck dein Ego runter und nimm sie. Sie steht dir. Punkt.«
Ohne ein Wort zu sagen, ging ich zurück zur Umkleide, um wieder in meine eigene Hose und Shirt zu schlüpfen. Ich starrte auf den Stapel Jeans auf dem Hocker. War das jetzt mein Leben? Sexy Kleidung und Trinkgeld?
Kopfschüttelnd ging ich in Richtung Kasse, den Stapel mit den Hosen auf meinem Arm, das Hemd darübergelegt.
»Und?«, fragte die Verkäuferin, während ich alles ablegte.
»Das Hemd auf jeden Fall.« Ich holte meinen Geldbeutel heraus und blickte hinein. Zehn Dollar hatte ich noch. Zehn! Und die mussten eine Woche reichen, bis ich meinen ersten Lohn bekommen würde. »Was kosten die Hosen?«
»Die zwei unteren jeweils zehn und die Skinny …«, sie blickte mich mit einem bittersüßen Lächeln an, »weil sie dir so gut steht, gebe ich dir Hemd und Hose für fünf Dollar.«
Es war schwer, sich von ihrer Schadenfreude nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Ich atmete tief ein und versuchte, meinen Ärger umzulenken. Genau so, wie es mir Joe im Knast gezeigt hatte. Ich konnte das. Ich konnte das absolut.
Lächelnd sah ich zu ihr auf. »Deal.« Weit würde ich mit nur einem Hemd allerdings nicht kommen. Ich zeigte auf das weiße, das ich ausgesucht hatte. »Hast du noch ein oder zwei ähnliche Hemden für den Preis?«
»Klar, ich such dir welche raus.«
Während sie gezielt auf eine der Kleiderstangen zuging, wartete ich an der Kasse.
»Hellblau lässt sich gut kombinieren«, sagte sie und zeigte auf das erste Hemd, das sie geholt hatte. »Und kariert geht auch immer.«
Ich starrte auf das Muster des zweiten Hemds, das die Farben der einst berühmt-berüchtigten und rivalisierenden Gangs in L. A. trug: Rot und Blau. Aber für mich spielte diese Symbolik keine Rolle mehr. »Was kosten sie?«
»Auch jeweils zwei Dollar.«
Ich nahm die zehn Dollar aus meinem Geldbeutel und reichte sie ihr.
»Du bist nicht nur sexy, sondern auch klug.« Sie gab mir einen Dollarschein zurück und legte mein Geld in die Kasse.
Immer noch leicht verärgert hob ich eine Augenbraue und versuchte, tief zu atmen.
»Bitte.« Grinsend hielt sie mir eine Tüte mit meinen Sachen entgegen.
»Danke.« Ich nahm die Einkäufe und wandte mich um zum Gehen.
»Und viel Erfolg«, rief sie mir hinterher, als ich bereits dabei war, die Tür zu öffnen.
»Danke, kann ich gebrauchen.« Vermutlich mehr, als du dir vorstellen kannst.
An der Tür fiel mir der Geldbeutel wieder ein. Ich machte auf dem Absatz kehrt und ging zurück zur Kasse.
Die Verkäuferin musterte mich verwirrt. »Du hast es dir doch nicht etwa anders überlegt?«
»Nein.« Ich lachte auf. »Das nicht. Es ist nur … Hast du zufällig Internet hier?«
Sie sah mich an, als würde ich eine Zwangsjacke tragen. »Hast du kein Handy? So wie jeder normale Mensch?«
»Schon, aber das hat kein Internet«, log ich.
Sie schüttelte den Kopf und zog einen Schlüssel aus ihrer Tasche hervor. »Wie alt bist du? Fünf? Sogar mein sechsjähriger Neffe hat ein Smartphone.«
Der wurde vermutlich auch nicht gerade aus einer fünfjährigen Haftstrafe entlassen. »Bitte.«
»Na gut«, sagte sie und ging quer durch den Laden zu einer Tür, die sie aufschloss. Dort standen ein Computer und ein paar Aktenschränke. Sie setzte sich ans Gerät und tippte etwas ein. »Du machst hier aber keinen Scheiß, okay?«
»Versprochen.«
Die Verkäuferin stand auf und zeigte auf den Bürostuhl. »Ich habe wirklich keine Ahnung, warum ich das tue. Vermutlich, weil du so süß bist.«
Wenn du wüsstest. »Danke!«
Sie ging davon und ich setzte mich, ohne zu zögern, öffnete den Browser und googelte einen Namen: Avery MacGowan.
Als Erstes sprangen mir diverse Social-Media-Profile entgegen. Die Bildersuche zeigte Fotos einer Frau, die der auf dem Führerschein ähnelten. Ich hatte weder Instagram noch Twitter und schon gar kein LinkedIn. Nur Facebook hatte ich. Den Account hatte ich vor meiner Haft das letzte Mal genutzt und brauchte drei Anläufe, bis ich meinen Usernamen und das Passwort richtig eintippte. Immerhin.
Ich gab ihren Namen in die Suchmaske ein und wählte das Profil, von dem ich glaubte, dass es ihres war. Während sich die Seite aufbaute, holte ich den Geldbeutel aus meiner Tasche, nahm den Führerschein heraus und verglich das Bild. Sie war es eindeutig. Und sie war elegant, schön … und absolut nicht meine Liga. Fairerweise musste man sagen, dass das im Augenblick vermutlich auf alle Frauen zutraf. Gut, nicht alle, aber die guten, anständigen.
Trotzdem blieb ich etwas länger als nötig an einem ihrer Bilder hängen. Sie war nicht wie die Frauen aus meinem Barrio. Ihr bow chicka wow wow hinterherzurufen, würde mir nicht einmal im Traum einfallen. Ich bewunderte ihre blasse, fast elfenbeinfarbene Haut und fragte mich, wie es möglich war, in Südkalifornien zu leben und kein bisschen gebräunt zu sein. Ihre roten, leicht gewellten Haare flossen über ihre Schultern und lenkten meinen Blick zu ihrem tief ausgeschnittenen Dekolleté, das sie ganz ohne hochgepushte Brüste präsentierte. Obwohl man viel Haut sah, war es kein obszöner Anblick, sondern ein sinnlicher, femininer. Alles an ihr wirkte natürlich und ästhetisch. Ich ertappte mich dabei, wie ich weiter und weiter scrollte und mehr von ihr sehen wollte, und schalt mich innerlich dafür und klickte endlich auf Nachricht schreiben.
Was genau sollte ich ihr schreiben?
Wie sollte ich sie begrüßen?
Verdammt, Tyriq, hör auf mit dem Quatsch!
Ich klopfte mir links und rechts auf meine Wangen. Immerhin hatte ich ihren Geldbeutel gefunden, egal, ob ich ihr das jetzt lyrisch mitteilte oder mit einem »Hey yo, what’s up?«, sie würde sich darüber freuen. Über alles andere sollte ich mir ohnehin keine Gedanken machen.
Nach vielen Anläufen brachte ich endlich eine brauchbare Nachricht zusammen.
Hi, ich habe deinen Geldbeutel auf dem Parkplatz vor dem Oak Drive Center gefunden. Ich würde ihn dir gerne wiedergeben. Melde dich doch einfach, damit wir etwas ausmachen können. Gruß, Tyriq
Ich drückte auf Absenden, starrte den Bildschirm an und wartete. Erst da fiel mir mein eigenes Profilbild auf. Und die ganzen anderen Bilder, die ich vermutlich auf meiner Seite hatte … Heilige Mutter! So schnell ich konnte, ging ich in die Einstellungen und setzte alles auf Privat. Sollte ich mein Profilbild löschen oder wäre gar kein Bild noch komischer als mein altes?
Bing!
Zu spät. Sie hatte geantwortet und mein Bild vermutlich schon gesehen.
So viele Gedanken. So viel Nervosität. Es war erstaunlich, was fünf Jahre Enthaltsamkeit aus einem machen konnten.
5
Avery
In jedem Raum in Mrs Clarins’ Haus fand man irgendein absonderliches Designobjekt, das in keiner Weise mit den restlichen Einrichtungsgegenständen harmonierte. Schwer zu sagen, ob ihr das jemand eingeredet hatte, oder ob das wirklich ihr Geschmack war. Ihr Beharren darauf wirkte auf mich dogmatisch. Ich konnte ihren Stolz spüren, als sie mir die Objekte zeigte, aber nicht die Liebe zu ihnen. Es sollte mir gleichgültig sein, aber um ehrlich zu sein, wurmte es mich. Nicht weil das nicht mein Geschmack war, sondern weil ihr Wunsch mich unvorbereitet getroffen hatte. Für gewöhnlich hatte ich ein Händchen dafür, mich in meine Klienten einzufühlen, verstand, wer sie sind und was sie wollen. Ich hasste es, wenn Menschen an dieser Säule meines Selbstverständnisses rüttelten. Der Termin bei Mrs Clarins war nicht optimal gestartet, hatte sich aber zum Besseren hin gewendet. Wir verblieben damit, dass ich einen individuellen Eyecatcher in das Konzept integrieren würde und es ansonsten wie geplant umsetzen konnte.
Die Witwe verabschiedete uns, und wir stiegen ins Auto. Während ich in meiner Handtasche wühlte, nahm Tamy auf dem Beifahrersitz Platz und starrte mich ungläubig an.
»Was ist?«, fragte ich.
»Als wir hierhergekommen sind, hätte ich wirklich nicht gedacht, dass es gut laufen wird.«
»Weil wir so spät waren?«
Sie nickte schüchtern. »Und nach der Präsentation dachte ich: Verdammt, sie entzieht uns bestimmt den Auftrag.«
»Du liegst nicht falsch mit deiner Einschätzung. Zu Beginn meiner Karriere hätte ich mir Unpünktlichkeit nie erlaubt. Und wenn das jetzt doch einmal vorkommt, dann nicht, weil das eine Allüre von mir wäre oder ich meinen Job nicht ernst nehmen würde. Ich habe einfach so viel um die Ohren, dass es oft nicht anders geht. Und was den Verlauf des Gesprächs angeht …« Ich seufzte laut. »Das Ruder herumzureißen ist etwas, das ich erst lernen musste. Zu Beginn hat es mich immer unheimlich getroffen, wenn meine Entwürfe kritisiert wurden, und es war schwer für mich, mit den Kunden darüber zu diskutieren und Lösungen zu finden. Und Gesprächsführungskompetenz hin oder her: Wenn die Leistung nicht stimmt, nützt das alles nichts.«
Ich holte mein Handy aus der Tasche und checkte meine Nachrichten und E-Mails. Meine Freundin Zelda lud mich wieder einmal zum Dinner zu ihr und ihrem Freund ein. Verstand sie denn nicht, dass solche Abende nur was für Pärchen waren?
Zum Schluss widmete ich mich dem nervigsten aller Nachrichtenkanäle – meinem Facebook-Messenger, der mir zwei neue Nachrichten anzeigte. Zuerst war da Big Marcus, der mich fragte, ob ich ihm ein paar Nacktbilder schicken könnte. Ich wollte gar nicht wissen, was seiner Meinung nach big an ihm war und sperrte ihn sofort. Dann war da noch eine Mitteilung von einem Tyriq JFG. Wenn das jetzt noch ein Typ war, der Fotos, getragene Unterwäsche oder Schuhe von mir wollte, würde ich kotzen.
Hi, ich habe deinen Geldbeutel auf dem Parkplatz vor dem Oak Drive Center gefunden. Ich würde ihn dir gerne wiedergeben. Melde dich doch einfach, damit wir etwas ausmachen können. Gruß, Tyriq
War das ein Scherz? Ich griff nach meiner Handtasche und durchwühlte sie hektisch. Kein Geldbeutel. Und wir hatten vorhin bei fabricA im Oak Drive Center eingekauft.
Ich tippte: Vielen Dank! Bist du noch dort?
Ja, kam es sofort zurück. Aber nicht mehr lange.
Ich: Kannst du noch zehn Minuten warten?
Tyriq: Klar.
Ich: Danke! Bis gleich!
Erleichtert atmete ich aus.
»Alles in Ordnung?«, fragte Tamy neben mir.
Ich nickte. »Ich habe meinen Geldbeutel wohl vorhin verloren, als wir die Stoffe eingeladen haben, aber jemand hat ihn gefunden.«
»Gott sei Dank! Manchmal glaubt man ja, es gibt gar keine anständigen Menschen mehr.«
»Ja«, sagte ich abwesend und klickte auf Tyriqs Profilbild. Ich erschrak: Ein Junge – Mann konnte man hier definitiv nicht sagen – mit weiter Hose und freiem Oberkörper. Er trug Tattoos. Nicht nur ein paar. Vom Hosenbund bis zum Hals war seine Haut komplett mit Tinte bedeckt. Und wer in L. A. aufwuchs – auch abseits der üblen Bezirke –, wusste, dass dies nicht bloß Körperschmuck darstellte. Obwohl ich mich für jemanden hielt, der nicht viele Vorurteile hatte, war dieses Bild nicht unbedingt das, was ich mir unter einem anständigen Menschen vorstellte. Wie schön, dass einen das Leben immer wieder überraschte. Ich starrte auf das Foto – sogar der kahl rasierte Kopf war mit Tattoos versehen. Autsch.
Ich konnte nicht anders und zeigte Tamy das Bild. »Das ist der ehrliche Finder.«
Tamy starrte mit weit aufgerissenen Augen vom Foto zu mir. »Sieht irgendwie gangmäßig aus, der ehrliche Finder.«
»Ja«, sagte ich amüsiert und verstaute das Handy wieder in meiner Tasche. »Und gleich sehen wir Bubi-Gangsta in natura.«
»Ich bleibe dann im Wagen sitzen.« Tamy grinste.
Es war nicht so, dass mir die Brutalität der Straßengangs keine Angst machte, ganz im Gegenteil. Es gibt Viertel, durch die man nachts nicht einmal mit dem Auto fahren sollte. Zumindest nicht, wenn man nicht erschossen werden will. Aber dieser Kerl hier … es war nicht sein jugendliches Äußeres, das mich mutig machte, es war die Begebenheit an sich. Welcher kriminelle Brutalo gab schon einen gefundenen Geldbeutel ab? In meinem Kopf passte das nicht zusammen.
Ich startete den Wagen und fuhr los in Richtung Oak Drive Center und Bubi-Gangsta.
6
Tyriq
In der Umkleide des Secondhandladens warf ich mich in meine neue Kleidung. Es war fraglich, ob ich es vor dem Probearbeiten noch nach Hause schaffen würde.
Etwa zehn Minuten wartete ich auf dem Parkplatz und lehnte mich mit dem Rücken gegen das Heck des Wagens. Wir hatten keinen Treffpunkt ausgemacht, aber es war wohl das Logischste, dass ich mich dort platzierte, wo ich den Geldbeutel gefunden hatte. Ein weißer Range Rover raste in meine Parkreihe und fuhr an mir vorbei. Durch die Scheibe konnte ich eine brünette und eine rothaarige Frau erkennen. Ein paar Schritte von mir entfernt stoppte der Wagen abrupt und die Fahrertür öffnete sich. Die Frau mit den roten Haaren stieg aus. Das war mit Sicherheit Avery MacGowan. Trotzdem würde ich nicht wie bescheuert winken.
Sie war komplett in Weiß gekleidet und wirkte in dem Center, in dem die meisten Leute mit bunten Shorts und T-Shirts herumliefen, merkwürdig deplatziert. Davon schien sie selbst gar keine Notiz zu nehmen. Sie blickte sich um und sah mich schließlich. Ich lächelte, doch statt das Lächeln zu erwidern, ließ sie ihren Blick schweifen, als wäre ich gar nicht da. Dann sah sie wieder zu mir, ohne auch nur im Geringsten zu reagieren. Das konnte ja wohl nicht ihr Ernst sein. Ich war schließlich der Einzige, der im Umkreis des Fundorts herumstand. Jetzt würde ich erst recht nicht blöd winken, um sie auf mich aufmerksam zu machen. Ich verschränkte die Arme vor der Brust und musste feststellen, dass sie in meine Richtung sah und mich wieder ignorierte. Vielleicht war das ein guter Zeitpunkt, meine Meinung zu ändern und das Geld ohne schlechtes Gewissen einzustecken. Quasi als Preis für ihre Ignoranz.
Sie schüttelte den Kopf, ging ein paar Schritte nach links und nach rechts und schließlich wieder zurück zu ihrem Auto.
Seufzend stieß ich mich vom Wagen ab und ging auf sie zu. »Avery MacGowan?«
»Ja«, antwortete sie mit weicher Stimme und erstauntem Blick. »Bist du Tyriq? Hast du meinen Geldbeutel gefunden?«
»Überrascht?«
»Ehrlich gesagt – ja. Auf deinem Profilbild siehst du … so komplett anders aus.«
»Ist nicht mehr das aktuellste«, gestand ich und betrachtete sie. Sie war blass. Ich dachte immer, Weiß wäre eine Sommerfarbe und würde nur gebräunte Menschen gut kleiden, aber sie sah unsagbar elegant aus in ihrem hellen Anzug.
Avery lächelte und durchbrach damit die Kühle, die sie sonst ausstrahlte. »Überhaupt nicht mehr aktuell.« Sie biss sich auf die Lippen und wirkte beinahe beschämt, als sie mir schließlich ihre Hand entgegenstreckte. »Ich bin Avery.«
Ich nahm ihre Hand. Sie sah aus wie Porzellan, doch fühlte sie sich weich und warm an. »Tyriq«, erwiderte ich. Meine Finger pochten und strichen leicht über ihren Handrücken. »Hi.«
Schnell löste ich unsere Begrüßung und vergrub beide Hände in den Vordertaschen der neuen Jeans. Es musste unglaublich verkrampft wirken. Diese blöde Hose saß einfach zu eng. Warum hatte ich sie mir nur aufschwatzen lassen? Ich fühlte mich unwohl und wünschte, ich hätte mich noch nicht umgezogen.
»Du hast also meinen Geldbeutel gefunden?«
»Ja, genau.« Natürlich! Nur deshalb war sie ja hier, Estúpido. Ich zog ihn aus der Gesäßtasche und hätte mich ohrfeigen können. »Hier«, sagte ich nur und reichte ihr die Börse.
Sie nahm sie entgegen. »Vielen Dank!«
»Ist doch selbstverständlich«, sagte ich und machte eine wegwischende Handbewegung.
Avery legte den Kopf schief und sah auf die Tattoos, die aus meinem Hemd über meinen Hals krochen. »Das sollte es, ist es aber leider nicht.«
Wem sagst du das?
Ihr Blick ruhte weiter auf meinem Hals, den es mir zusammenschnürte. Ihre Augen wirkten konzentriert, als würde sie die Bedeutung der Zeichen entschlüsseln wollen. Natürlich konnte sie das nicht. Aber zu erkennen, um welche Sprache es sich handelte, war nicht allzu schwer, wenn man in L. A. lebte.