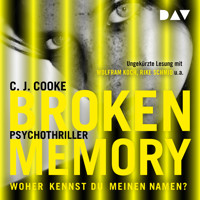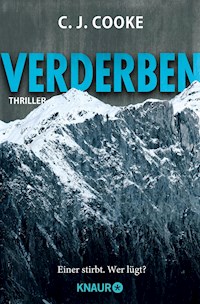6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Du weißt nicht, wer du bist. Du weißt nicht, wer sie sind. Aber sie kennen deinen Namen. Raffiniert, abgründig, manipulativ - Intelligente psychologische Spannung aus der Feder der preisgekrönten irischen Autorin C.J.Cooke, die Sie garantiert bis zur letzten Seite gefangen nehmen wird! Eine Frau erwacht am einsamen Strand einer Insel im Mittelmeer, verletzt und ohne jede Erinnerung. Zum Glück wird sie von vier Freunden, von Beruf Schriftsteller und Autoren, gefunden, die diese Insel als Rückzugsort gewählt haben, um sich in Einsamkeit und karger Abgeschiedenheit ganz dem Bücherschreiben und Schreibprozess widmen zu können. Sie wollen sich um die gestrandete Frau kümmern, bis sie ihr Trauma überwunden hat, ihre Erinnerung zurückgekehrt ist und es ihr gut genug geht, um die Insel zu verlassen. Doch irgendetwas stimmt nicht mit den zwei Männern und zwei Frauen, das kann ihr unfreiwilliger Gast, auch mit Gedächtnisverlust, fühlen: Jeder von ihnen scheint etwas zu verbergen - und: Was wissen sie wirklich über ihren Gast? Zeitgleich sucht man in London verzweifelt nach einer jungen Mutter und Ehefrau, die am helllichten Tag spurlos verschwunden ist. Ohne Geld und Ausweis, ohne Koffer oder Auto, ohne Flugticket und ohne ihre Kinder. Sie ist spurlos verschwunden. Der Ehemann verzweifelt. Stück für Stück lassen die Ermittlungen die perfekte Fassade von Ehe- und Familienglück bröckeln … Auf intelligente und hochspannende Art und Weise spielt die Autorin C.J. Cooke, die sich an der Universität in Glasgow mit der literarischen Gestaltung psychisch labiler Helden beschäftigt, in ihrem Psycho-Thriller "Broken memory" mit Themen wie Erinnerung, Gedächtnisverlust, Identität und Mutterschaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 492
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
C.J. Cooke
Broken Memory
Woher kennst du meinen Namen?
Aus dem Englischen von Susanne Wallbaum
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Du weißt nicht, wer du bist.
Du weißt nicht, wer sie sind.
Aber sie kennen deinen Namen.
Eine Frau erwacht am einsamen Strand einer Insel im Mittelmeer, verletzt und ohne jede Erinnerung. Zum Glück wird sie von vier Freunden, von Beruf Schriftsteller und Autoren, gefunden, die diese Insel als Rückzugsort gewählt haben, um sich in Einsamkeit und karger Abgeschiedenheit ganz dem Bücherschreiben und Schreibprozess widmen zu können. Sie wollen sich um die gestrandete Frau kümmern, bis sie ihr Trauma und den Gedächtnisverlust überwunden hat und es ihr gut genug geht, um die Insel zu verlassen. Doch irgendetwas stimmt nicht mit den zwei Männern und zwei Frauen: Jeder von ihnen scheint etwas zu verbergen – was wissen sie wirklich über ihren Gast?
Zeitgleich sucht man in London verzweifelt nach einer jungen Mutter und Ehefrau, die am helllichten Tag spurlos verschwunden ist. Ohne Geld und Ausweis, ohne Koffer oder Auto, ohne Flugticket und ohne ihre Kinder. Sie ist spurlos verschwunden. Der Ehemann verzweifelt. Stück für Stück lassen die Ermittlungen die perfekte Fassade von Ehe- und Familienglück bröckeln …
Inhaltsübersicht
Widmung
Die Frau am Strand
17. März 2015
17. März 2015
17. März 2015
18. März 2015
18. März 2015
18. März 2015
19. März 2015
18. März 2015
20. März 2015
18. März 2015
11. April 1982
23. März 2015
23. März 2015
24. März 2015
24. März 2015
24. März 2015
25. März 2015
21. Januar 1985
28. März 2015
27. März 2015
29. März 2015
29. März 2015
Rote Wolle
14. November 1988
31. März 2015
31. März 2015
1. April 2015
24. April 1990
2. April 2015
2. April 2015
31. März 2015
2. April 2015
1. April 2015
2. April 2015
1. April 2015
2. April 2015
2. April 2015
2. April 2015
2. April 2015
2. April 2015
2. April 2015
Licht, das hereinströmt und wieder hinaus
3. April 2015
3. Mai 2015
25. Juni 2015
Drei Jahre später, 17. Oktober 2018
Dank
Nachwort
Für Summer, die kleine Pferdenärrin
Die Frau am Strand
17. März 2015
Eloïse: Das Hin und Her von Füßen um meinen Kopf herum lässt mich zu mir kommen. Stimmen, die ängstlich durcheinanderreden.
Ist sie tot? Was machen wir? Joe! Du kannst doch Mund-zu-Mund-Beatmung, oder?
Etwas Schweres presst sich auf meine Lippen. Beißender Nikotingeruch steigt mir in die Nase. Heißer Atem brennt auf meinen Wangen. Ein Stoß gegen meinen Brustkorb. Noch einer. Ich fahre hoch und übergebe mich, spucke – literweise, so kommt es mir vor – widerliches salziges Nass. Jemand streicht mir über den Rücken und sagt: Gut so, Liebes, gut machst du das.
Ich drehe mich auf die Seite und senke unter Husten und Würgen den Kopf, bis meine Stirn den Boden berührt. Meine Haare sind nass, das, was ich am Leib habe, trieft, und ich zittere vor Kälte. Jemand hilft mir auf und legt meinen schlaffen rechten Arm über ein Paar kräftige Schultern. Jetzt, da ich aufrecht bin, sehe ich einen gelben Klecks auf dem Boden: eine Schwimmweste. Meine? Der Mann, der mich stützt, lässt mich behutsam auf einen Stuhl gleiten. Ich höre ihnen zu, während sie mich genauer anschauen und beratschlagen, was zu tun sei.
Ist das Blut da in den Haaren?
Guck mal nach, Joe. Blutet es noch?
Sieht tief aus, aber ich glaube, es hat aufgehört. Oben habe ich ein paar sterile Tupfer.
In meinem Kopf setzt ein Pochen ein, ein dumpfer Schmerz auf der rechten Seite. Auf dem Tisch vor mir materialisiert sich eine Tasse. Kaffeeduft steigt auf und klärt meine Sicht, bis schließlich die Leute im Raum Konturen annehmen. Dicht neben mir ein Mann. Er keucht vor Anstrengung. Noch ein Mann. Mit einem großen schwarzen Brillengestell. Zwei weitere Personen, Frauen. Eine beugt sich über mich und fragt: Geht’s? Ich nicke benommen. Schaue sie genauer an. Freundliche Augen. Okay, Joe, sagt sie, wie es aussieht, hast du ihr das Leben gerettet.
Ich kenne diese Leute nicht. Ich weiß nicht, wo ich bin. Hell getünchte Wände und ein hübscher Steinfußboden. Eine Küche vermutlich. An Haken unter der Decke hängen Kupferkessel und -pfannen, rechts von mir steht ein altmodischer schwarzer Herd. Ich fühle mich ausgelaugt, ohne einen Funken Energie, aber die Frau, die mir den Kaffee hingestellt hat, hält mich davon ab, wegzudämmern. Wir müssen dich untersuchen, Süße. Ihr Ton hat einen leisen, melodischen amerikanischen Einschlag. Das fällt mir erst jetzt auf. Sie sagt: Du warst eine Weile bewusstlos.
Der jüngere Mann, der mit der Brille, erklärt, er werde sich jetzt meinen Kopf ansehen. Er tritt hinter mich, und ohne Vorwarnung spüre ich etwas Kaltes auf der Kopfhaut. Es ist ein stechender Schmerz. Ich keuche auf. Jemand hält meine Hand und sagt, die Wunde werde gereinigt. Dann nimmt der Mann sich eine Stelle oberhalb meiner Braue vor, reinigt sie ebenfalls, obwohl es, wie er sagt, nur ein Kratzer ist.
Der andere, der mich zu dem Stuhl gebracht hat, sitzt mir gegenüber. Kahl, untersetzt. Mitte, Ende vierzig. Verwaschene Aussprache. Er nimmt eine Zigarette aus der Packung und steckt sie sich an.
Kommst du von der Hauptinsel?
Hauptinsel?, wiederhole ich. Es ist eher ein Krächzen.
Von dort bis hierher ganz allein?, sagt der jüngere Mann. Das hätte sie bei diesem Sturm niemals geschafft.
Genau, das meine ich auch, erwidert der Glatzkopf. Sie kann von Glück sagen, dass ihr Boot nicht weiter draußen gekentert ist.
Die Frau, die mir den Kaffee gebracht hat, holt sich einen Stuhl und setzt sich rechts neben mich.
Ich bin Sariah, sagt sie. Schön, dich kennenzulernen. Dann wendet sie sich an die anderen. Nun ist sie ja wach. Wir sollten uns wirklich langsam mal vorstellen.
Der mit der Brille hebt kurz die Hand.
Joe.
George, sagt der Glatzkopf. Ich hab dich gefunden.
Schweigen. Erwartungsvoll schaut Joe zu der Frau, die rechts von ihm sitzt. Sie wirkt nervös. Hazel, sagt sie. Oder besser: haucht sie.
Und du, hast du auch einen Namen?, fragt George.
In meinem Kopf herrscht Leere. Mein Blick gleitet über die Gesichter der anderen, ich verknüpfe Gesichter mit Namen, nur mein eigener fällt mir nicht ein. Körperlich bin ich zerschunden und schwach, aber mein Denken ist vollkommen klar.
Schon gut, Süße, macht nichts, sagt Sariah und tätschelt mir die Schulter. Du hast einiges hinter dir. Lass dir Zeit. Das wird schon.
Machst du Urlaub auf der Hauptinsel?, hakt George nach.
Es ist, als würde mein Kopf mit einem Hammer bearbeitet. Tut mir leid … aber … was für eine Hauptinsel?
Kreta, sagt Sariah. Wo bist du untergebracht?
Bist du mit deiner Familie da? Mit Freundinnen?, fragt der Brillenmann. Sie könnte ja auch von einer anderen Insel gekommen sein. Andikythira?
Das glaube ich nicht, sagt die kleine Frau mit den rötlichen Locken – Hazel – leise. Die Strömungen zwischen Andikythira und hier sind viel stärker als die nach Kreta hinüber. Und Andikythira ist weiter weg.
Entschuldigung, werfe ich ein. Habe ich das richtig verstanden? Ich bin auf Kreta?
Seht ihr?, sagt George.
Nein, nein, will ich einwenden, doch Joe unterbricht mich.
Sie hat gefragt, ob sie auf Kreta ist. Wir sind hier auf Komméno, nicht auf Kreta.
Jedenfalls müssen wir deinen Leuten – dem oder denen, die jetzt auf dich warten – Bescheid sagen, dass du heil hier gelandet bist. Hast du eine Telefonnummer? Wo soll ich anrufen?
Er holt ein kleines schwarzes Telefon aus der Tasche und zieht eine Antenne heraus. Kreta. War ich auf Kreta?
Ich kann mich nicht erinnern, bringe ich schließlich hervor. Tut mir leid, im Moment weiß ich gar nichts.
Die freundliche Frau, Sariah, nimmt meine Hand. Sowie wir mit dem Satellitentelefon Empfang haben, rufen wir bei der Polizei auf Kreta an. Keine Angst.
Der kräftige Mann, George, mustert mich. Er kneift die Augen leicht zusammen. Wo kommst du denn nun her?
Auch wenn mir schwindlig und übel ist, müsste ich das doch wissen! Es ist lächerlich, aber ich kann mich beim besten Willen nicht erinnern. Warum? Ich versuche, mir Gesichter ins Gedächtnis zu rufen, Angehörige, Menschen, die ich liebe – aber in dem Teil meines Hirns, der für dieses Wissen zuständig ist, herrscht vollkommene Leere.
George stützt das Kinn in die Hand, zieht nachdenklich an seiner zweiten Zigarette und sieht mich aufmerksam an. Die anderen trinken Tee. Ich habe nicht mitbekommen, dass jemand Tassen hingestellt oder Wasser aufgesetzt hätte. Mal scheint die Zeit stillzustehen, mal macht sie Sprünge. Ich versuche aufzustehen und kippe dabei fast um. Meine Beine sind wie Pudding. Sariah springt auf, um mich zu stützen.
Langsam.
In dem großen Fenster gegenüber steht ein kreisrunder Mond am violett-roten Himmel, bleich scheint er auf Hügel und Senken herab. Ein greller Schein zuckt über das Wasser, in der Küche ist es für einen Augenblick taghell. Kurz darauf grollt genau über uns Donner, rüttelt an Töpfen und Pfannen. Mir fehlt die Orientierung, ich fühle mich elend, fange wieder an zu zittern. Nicht vor Kälte, sondern unter Schock.
Sariah legt den Arm um mich. Wir bringen dich in eins der Zimmer, ja? Schön gleichmäßig atmen.
Doch bevor wir uns auch nur rühren, höre ich eine tiefe Stimme sagen: Vielleicht ist sie geflüchtet.
George!, faucht Sariah.
Er lacht schallend. Ich zucke zusammen.
War ein Scherz.
In meinem Kopf entsteht Druck, immer mehr Druck, bis ich nach Luft schnappe und meine Hand zur Kehle fährt. Beide Frauen beugen sich zu mir vor und drängen mich zu atmen. Ich versuche es. Ich soll erklären, was los ist, kann aber nicht sprechen.
Jemand sagt: Vielleicht müssen wir sie in ein Krankenhaus bringen.
17. März 2015
Lochlan: Als mein Telefon klingelt, sitze ich mit einem Kunden im Dome beim Tee. Es ist ein wichtiger Termin – Mr Coyle beabsichtigt, einen Venture Capital Fonds zur Investition in neue Technologien aufzulegen –, deshalb drücke ich den Anruf weg.
»Entschuldigung.«
Mr Coyle hebt eine Braue. »Ihre Frau?«
So ist es. Vorm Wegdrücken habe ich im Display kurz ihren Namen gesehen.
»Nein, nein. Also, wo waren wir?«
»Google Glass?«
Ich schenke uns Rotwein nach. »Ah ja. Das Unternehmen bringt etwas auf den Markt, das ähnlich ist, nur besser. Es verbindet sich nahtlos mit neuen Social-Media-Plattformen und hat von mehreren Testpersonen fünf Sterne bekommen. Im September sollen die ersten Geräte für etwa fünfhundert Pfund in den Handel kommen.«
Mein Telefon klingelt schon wieder. Diesmal gibt Mr Coyle einen leisen Unmutslaut von sich. »ELOÏSE« steht da in weißen Buchstaben. Ich will sie erneut wegdrücken, doch Mr Coyle wedelt kurz mit der Hand. »Gehen Sie ran. Sagen Sie, wir haben zu tun.«
Ich stehe auf und gehe zum nächsten Fenster hinüber.
»Was ist los, El? Ich bin in einem Meeting …«
»Lochlan? Sind Sie das, mein Lieber?«
Das ist nicht meine Frau. Sie redet weiter, und ich brauche einen Moment, um die Stimme zuzuordnen.
»Mrs Shahjalal?«
Es ist die Yorkshire-Frau von gegenüber.
»… und da dachte ich, ich schau mal nach. Als ich reinkam, hab ich mich gewundert … sind Sie noch dran?«
Aus dem Augenwinkel sehe ich Mr Coyle eine Kellnerin heranwinken.
»Ist alles in Ordnung, Mrs Shahjalal? Wo ist Eloïse?«
Einen Moment herrscht Schweigen. »Das sagte ich doch gerade: Ich weiß es nicht.«
»Was soll das heißen, Sie wissen es nicht?«
»Wie ich schon sagte: Der UPS-Bote hat bei mir geklingelt und gefragt, ob ich das Päckchen annehme, weil drüben bei Ihnen keiner ist. Und das hat mich gewundert, denn ich war mir sicher, dass ich gerade erst Max am Fenster gesehen hatte. Ich hab also das Päckchen angenommen, und dann, vielleicht eine Stunde später, habe ich wieder Max am Fenster gesehen, und da dachte ich, jetzt geh ich mal rüber und sehe nach dem Rechten. Max ist auf einen Stuhl geklettert, um mir die Tür aufzumachen.«
Ich habe Mühe, diese Informationen zu verarbeiten. Mr Coyle erhebt sich. Zieht sein Jackett über. Ich drehe mich zu ihm um und hebe die Hand zum Zeichen, dass ich gleich da bin, doch er verzieht das Gesicht.
»Gut, also, Max hat Sie reingelassen. Und was war dann?«
»Na ja, Eloïse ist immer noch nicht da. Ich bin jetzt seit fünfzehn Uhr hier, die Kleine muss dringend gefüttert werden. Auf dem Schreibtisch lag das Handy von Eloïse. Ich hab einfach irgendwo draufgedrückt – und zum Glück Sie erwischt.«
Im Hintergrund höre ich es rascheln, dazu leise, maunzende Laute. Mir dämmert, dass Mrs Shahjalal Cressida auf dem Arm hat, meine Tochter. Sie ist zwölf Wochen alt. Eloïse stillt noch.
»Also … Eloïse ist nicht zu Hause. Sie ist nicht da?« So dumm es klingen mag, ich begreife das nicht. Wo soll sie denn sein?
Mr Coyle wirft mir finstere Blicke zu. Er zieht seinen Schlips in Form und wendet sich zum Gehen. Ich lasse das Telefon sinken und rufe ihm nach: »Mr Coyle!«
Er ignoriert mich.
»Ich schicke Ihnen das Datenblatt per Mail!«
Mrs Shahjalal redet in einem fort weiter. »Das ist doch komisch, Lochlan. Der kleine Max ist außer sich. Er scheint wirklich nicht zu wissen, wo sie ist. Was soll ich bloß tun?«
Ich gehe zum Tisch hinüber und greife mir meine Mappe. Die Messinguhr auf dem Kaminsims zeigt Viertel nach vier. Wenn ich gleich ein Taxi kriege, könnte ich den Zug um halb fünf nach London noch erwischen, aber die Bahnfahrt dauert viereinhalb Stunden, und dann muss ich noch mit dem Taxi von King’s Cross nach Twickenham. Es wird mindestens zehn, bis ich zu Hause bin.
»Ich mache mich sofort auf den Weg«, sage ich.
»Sind Sie in der Stadt?«
»Ich bin in Edinburgh.«
»Edinburgh? In Schottland?«
Draußen herrscht dichter Verkehr; es sind jede Menge Leute unterwegs. Während ich noch versuche, einen klaren Gedanken zu fassen, werde ich beinahe von einem Doppeldeckerbus gerammt, der sehr nahe am Kantstein fährt. Ich mache einen Satz rückwärts und schnappe nach Luft. Eine Gruppe Schulkinder windet sich im Gänsemarsch durch das Gewimmel. Es gelingt mir, ein Taxi anzuhalten.
»Waverley, bitte.«
Ich frage Mrs Shahjalal, ob sie bei den Kindern bleiben kann, bis ich da bin, und sie sagt glücklicherweise Ja, wobei ich sie kaum höre, so laut schreit Cressida inzwischen.
»Sie muss gefüttert werden, Mrs Shahjalal.«
»Das ist mir klar, mein Lieber, aber die Zeiten, als ich noch ein Kind hätte stillen können, sind vorbei.«
»Vielleicht ist ganz oben im Kühlschrank noch ein Behälter mit Muttermilch. Das müsste draufstehen. Die Fläschchen bewahrt Eloïse, glaube ich, in dem Schrank neben dem Toaster auf. Geben Sie die Flasche vorher für vier Minuten in den Mikrowellen-Sterilisator. Da muss Wasser unten drin sein.«
»Muttermilch sterilisieren?«
Jetzt höre ich im Hintergrund Max schreien. »Ist das Papa? Papa, bist du das?« Ich bitte Mrs Shahjalal, ihm kurz das Telefon zu überlassen.
»Max! Max, mein Großer!«
»Hallo Papa. Darf ich Schokolade? Bitte!«
»Wenn du mir sagst, wo Mami ist, kauf ich dir Schokolade, soviel du willst.«
»So viel, wie ich essen kann? So viel?«
»Wo ist Mami?«
»Kann ich ein Überraschungsei?«
»Ist Mami heute Vormittag weggegangen? War jemand bei uns im Haus?«
»Ich glaub, sie ist im National History Museum, weil, sie mag die Dinosaurier, und der große, der, der so lang ist, heißt Dippy, der heißt Dippy, weil er ein Diplodocus ist, Papa.«
Das bringt mich nicht weiter. Ich sage ihm, er solle mir Mrs Shahjalal wieder geben, die immer noch nicht versteht, wie sie die Muttermilch sterilisieren soll, und die ganze Zeit bohrt sich Cressidas Geschrei durchs Telefon direkt in meinen Kopf.
Als ich endlich im Zug sitze, poste ich auf Facebook:
So was mache ich normalerweise nicht, aber – weiß jemand, wo Eloïse steckt? Sieht so aus, als wäre sie nicht zu Hause …
Die Nacht senkt sich herab wie ein schwarzes Tuch. Das Taxi rollt durch die Potter’s Lane. Wir wohnen in einer netten edwardianischen Doppelhaushälfte in Twickenham, einem ruhigen Stadtteil mit vielen Parks in der Nähe und Schwänen und Enten auf dem Fluss und Fröschen am Ufer und trotzdem nahe genug am Zentrum, dass man am Samstagnachmittag mal ins National History Museum oder in die Kew Gardens fährt. Hinter ein paar Fenstern brennt noch Licht, aber unsere Nachbarn sind entweder im Ruhestand oder beruflich sehr eingespannt, weshalb hier abends eher wenig los ist.
Ich gebe dem Fahrer sein Geld und steige aus. In der Einfahrt steht vor meinem Mercedes Eloïses Nissan Qashqai. Mein Herz macht einen Satz. Während der Bahnfahrt habe ich immer wieder mit Mrs Shahjalal telefoniert, mich nach den Kindern erkundigt und mit ihr beratschlagt, was zu tun ist. Mrs Shahjalal ist sehr alt und vergesslich. El ist mehr als einmal bei ihr zum Fenster eingestiegen, um die Haustür zu öffnen, weil sie ihren Schlüssel drinnen vergessen hatte. Höchstwahrscheinlich ist das alles nur ein Riesenmissverständnis. Ich habe einen Kunden verloren, weil Eloïse oben war und geduscht hat oder so. Mein Handy-Akku ist schon seit einiger Zeit leer, und die Steckdosen im Zug waren alle kaputt. Mrs Shahjalal konnte mich also nicht erreichen. Aber der Qashqai steht da. Eloïse muss also wiedergekommen sein.
Ich schließe auf und stehe im Dunkeln. Alles ist still.
»El?«
Ich gehe ins Spielzimmer. Mrs Shahjalal sitzt ganz vorn auf der Sofakante und wiegt Cressida in ihrem Körbchen, die Kleine hat die Ärmchen angewinkelt neben dem Kopf.
»Hallo«, flüstere ich. »Wo ist sie?«
Mrs Shahjalal schüttelt den Kopf.
»Aber … sie ist doch da«, sage ich. »Ihr Auto steht draußen. Wo ist sie?«
»Sie ist nicht da.«
»Aber …«
Mrs Shahjalal hebt den Finger an die Lippen und schaut besorgt zu Cressida ins Körbchen. Es muss lange gedauert haben, sie zum Schlafen zu bringen. Jetzt atmet sie mit einem stockenden Seufzer ein, wie so oft, wenn sie lange und heftig geweint hat.
»Max ist oben, im Bett«, sagt Mrs Shahjalal leise.
»Und Els Auto? Das weiße in der Einfahrt?«
»Das steht da schon den ganzen Tag.«
Ich stürme nach oben, sehe in allen Zimmern, in den Bädern und auf dem Dachboden nach, dann laufe ich wieder runter, mache überall Licht und durchforste sämtliche Räume nach meiner Frau. Nachdem ich sie nicht gefunden habe, gehe ich in den Garten und starre in die Finsternis. Plötzlich scheint das Undenkbare möglich. Abgesehen von gelegentlichem Winken von Haustür zu Haustür, kenne ich Mrs Shahjalal überhaupt nicht, und jetzt sitzt sie in meinem Haus, wiegt meine Tochter und erzählt mir, meine Frau hätte sich in Luft aufgelöst.
Ich hole mein Telefon aus der Tasche und beginne zu wählen.
17. März 2015
Eloïse: Irgendwie bin ich in diesen Schaukelstuhl gelangt. In eine dicke orangefarbene Decke gehüllt, sitze ich vor einem knisternden Feuer. Mein rechter Ärmel ist hochgekrempelt; jemand hat mir einen Gürtel um den Oberarm geschlungen. Joe, der große dünne Typ mit Brille, steht neben mir und drückt ein kaltes Instrument innen auf mein Handgelenk. Es riecht seltsam hier drinnen – nach Tang. Vielleicht bin ich es auch, die so riecht.
»Ist gleich so weit.«
»Was machst du?«, frage ich. Allerdings ist es eher ein ersticktes Krächzen. Es fühlt sich an, als wäre mein Mund mit Sandpapier ausgekleidet.
»Deinen Blutdruck messen.«
Zwischen den anderen ist ein hitziger Disput entbrannt. Offenbar geht es um mich. Mir ist immer noch schlecht, ich fühle mich elend.
Jetzt nimmt er mir endlich den Gürtel ab. »Hm. ’n bisschen niedrig für meinen Geschmack. Hast du ein enges Gefühl in der Brust?«
Ich sage, dass ich da nichts spüre, mich insgesamt aber fühle wie ausgespuckt. Er nimmt mein Gesicht in beide Hände, die Daumen auf meinen Wangen, und sieht mir forschend in die Augen.
»Du stehst unter Schock. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass du in einem üblen Sturm allein in der Ägäis herumgeschippert bist. Du musst die Beine hochlegen. Und viel Wasser trinken.«
Die Frau – Sariah – hebt meine Füße an und bettet sie auf einen Kissenstapel.
»Was macht dein Kopf?«, fragt sie.
»Tut weh«, sage ich matt.
»Aber du wirst nicht gleich wieder ohnmächtig, oder?«, fragt Joe, und ich deute ein Kopfschütteln an. Das genügt, um den Schmerz wieder anzuknipsen, so heftig, dass es mir den Atem verschlägt.
»Es ist schon nach Mitternacht, deshalb ist es gar nicht so einfach, dich in ein Krankenhaus zu bringen.« Sariah verschränkt die Arme. Wieder fällt mir ihr Akzent auf, er unterscheidet sich von dem der anderen. Amerikanisch, vielleicht auch kanadisch. »Hier in der Nähe gibt’s sowieso kein Krankenhaus«, fügt sie hinzu. »George hat die Polizei in Heraklion und Chania verständigt.«
»Bin ich als vermisst gemeldet?«
»Ich fürchte, nein.«
Offenbar sieht sie, wie sehr mich das trifft. Sie hockt sich neben mich und streichelt mir die Hand, als sei ich ein kleines Kind. »He, nicht traurig sein«, sagt sie. »Gleich morgen früh rufen wir noch mal an.«
Nichts an diesem Haus kommt mir bekannt vor. Ich habe das sichere Gefühl, zum ersten Mal hier zu sein.
»Wohnt ihr hier? Kenne ich jemanden von euch?«
»Wir haben dich gerettet«, antwortet George sachlich. Ich sehe ihn nicht, spüre ihn aber irgendwo hinter mir.
»Es war stürmisch«, fährt Joe fort. Er klingt irgendwie zögerlich. Unsicher. »Ein großer Sandsturm, bestimmt von Afrika her. George und ich waren unten, um nach dem Boot zu sehen. Dass es sich nicht losmacht, sondern an seinem Platz liegt. Und da haben wir dich entdeckt.«
»Wo war ich denn?«
»Am Knochenstrand«, sagt Joe.
»Knochenstrand?«
»Das ist die kleine hufeisenförmige Bucht mit den weißen Felsen, die aussehen wie Knochen. Unten bei der Scheune.« Er grinst. »Irre, dass du das überstanden hast. Irgendjemand da oben muss es ziemlich gut mit dir meinen.«
»Du bist mit einem Boot gekommen«, erklärt Sariah. »Und du weißt nicht mehr, ob noch jemand bei dir war?«
Ich habe das quälende Gefühl, dass ich das alles wissen müsste, dass ich über das Boot und den Strand und den Ort, von dem ich gekommen bin, Bescheid wissen müsste. Und ich habe keine Ahnung, nicht den blassesten Schimmer, warum ich das alles nicht weiß.
»Warum bist du überhaupt nach Komméno gekommen?«, fragt George und taucht in meinem Blickfeld auf, als er nach der Zigarettenschachtel greift. »Weil – hier ist doch eigentlich nichts.«
»Was ist Komméno?«
»So heißt das hier«, antwortet Sariah mit einem betrübten Unterton, so als habe sie es mit jemandem zu tun, der minderbemittelt ist oder krank. »Das ist die Insel Komméno.«
Ich warte – hoffe, dass mir nun automatisch eine Antwort auf Georges Frage einfällt, eine Erklärung für alles.
Aber mir fällt nichts ein.
18. März 2015
Lochlan: Es ist nach Mitternacht. Meine Frau gilt jetzt offiziell als vermisst. Wirklich begriffen habe ich das noch nicht.
Das sind die Fakten: (1) Gestern Abend kurz nach sieben hatte ich über FaceTime Kontakt mit Eloïse, da war sie in der Küche beim Pfannkuchenmachen, und die Kinder haben friedlich im Wohnzimmer gespielt, und (2) irgendwann heute zwischen zehn und dreizehn Uhr ist sie, während die Kinder oben im Bett lagen und schliefen, aus unserem Haus verschwunden. Es gibt (3) keinerlei Hinweis darauf, dass jemand hier war, Max hat niemanden gesehen, und (4) Eloïses Sachen, Ausweis, Kreditkarten, Autopapiere, Führerschein und Handy sind hier, im Haus. Sie kann sich also nicht melden, kommt nirgendwohin – weder mit der U-Bahn noch mit einem Taxi oder Flieger – und hat keine Möglichkeit, sich etwas zu essen oder zu trinken zu kaufen. Und (5) niemand hat auch nur die Spur einer Ahnung, wo sie stecken könnte.
Die abgepumpte Muttermilch ist aufgebraucht. Ich bin so durch den Wind, dass Cressida eine halbe Ewigkeit schreien musste, bis mir dämmerte, dass sie vielleicht mal wieder gefüttert werden muss. Vor einer Stunde habe ich ein Taxi gerufen, dem Fahrer einen Fünfziger gegeben und ihn beauftragt, mir Babynahrung aus dem Supermarkt zu besorgen. Anfangs war Cressida irritiert: weil sie schon wieder an einem Plastikteil saugen musste und wegen des fremden Geschmacks der Folgemilch, aber am Ende hat sie sich damit abgefunden und das Fläschchen in einem Rutsch geleert.
Mrs Shahjalal ist nach Hause gegangen. Sie lebt allein in Nr. 39, gleich gegenüber. Sie hat angeboten, am Morgen wiederzukommen und zu helfen, so gut sie eben kann. Im Moment bin ich komplett durcheinander, nicht in der Lage, einen klaren Gedanken zu fassen.
Während der Bahnfahrt ab Waverley, Edinburgh, habe ich Eloïses Freundinnen abtelefoniert in der Hoffnung, dass sie sich bei einer von ihnen gemeldet hat. Natürlich hat seit gestern oder vorgestern niemand etwas von ihr gehört. Auf meinen Facebook-Post hin sind jede Menge weinende Emojis und gute Wünsche bei mir eingegangen, mit anderen Worten: nichts Brauchbares. Nach langem Zögern habe ich Gerda, Eloïses Großmutter, eine SMS geschrieben und gefragt, ob El vielleicht in ihrem Haus in Ledbury ist. Angesichts der Tatsache, dass die Kinder noch hier sind, ziemlich unwahrscheinlich, aber ich wusste einfach nicht, wen ich sonst noch fragen sollte.
Vier- oder fünfmal habe ich das ganze Haus abgesucht. In Kleiderschränke, den Badezimmerschrank, die komische Abseite unter der Treppe, sogar unter den Betten und auf dem Dachboden habe ich geschaut, dann bin ich mit einer Taschenlampe durch den Garten hinten gegangen und habe mir die Büsche und den Schuppen vorgenommen. Ich muss wohl gedacht haben, sie könnte irgendwo feststecken. Es war ein Gefühl, als würde ich verrückt. Und bei alldem sprang Max um mich herum und fragte, ob wir jetzt was spielen und ob er sich verstecken soll, und Cressida merkte, dass sie von jemand anderem gehalten wurde als von ihrer Mutter, und meinte, halb London davon in Kenntnis setzen zu müssen.
Gerda rief zurück und sagte, sie habe El seit letzter Woche nicht mehr gesehen, aber am Sonntagabend mit ihr telefoniert. Dann fing sie an, mich auszuquetschen, und ich stammelte so was wie, Eloïse sei nicht da gewesen, als ich am Nachmittag nach Hause gekommen sei. Es entstand eine lange Pause.
»Was soll das heißen, Eloïse ist nicht da? Wo steckst du, Lochlan?«
»Ich bin in London.«
»Und wo sind die Kleinen?«
»Hier.«
»Willst du sagen, Eloïse ist gegangen?«
»Ich will sagen: Sie ist nicht zu Hause. Ihr Auto steht da, ihre Schlüssel sind da und ihr Handy. Alles.«
»Ruf die Polizei.«
»Das hab ich schon.«
Ich sah mir Els Handy an, alle Nachrichten – für den Fall, dass irgendeine Notlage eingetreten war, die sie aus dem Haus gezwungen hatte, aber außer einer Anfrage wegen einer eBay-Anzeige für einen Hochstuhl, Mails von Etsy, Boden, Sainsbury und Laura Ashley sowie Outlook-Memos für den Elternabend von Max’ Spielgruppe am nächsten Freitag und einem Impftermin für Cressida beim Kinderarzt fand ich nichts.
Gegen elf kam, müde um die Augen und in seinen Grüffelo-Bademantel gehüllt, Max nach unten. Das blonde Haar, länger, als ich es in Erinnerung hatte, war statisch aufgeladen und stand pusteblumengleich in alle Richtungen ab.
»Hallo, Papa.« Er gähnte.
»He, Maxiboy. Wie geht’s?«
Er kam herübergetapst und kletterte auf meinen Schoß. In einer Wallung von Zärtlichkeit drückte ich ihm einen Kuss auf den Kopf.
»Ist Mami wieder da?«
Es tat weh, Nein sagen zu müssen.
Er rollte sich ein und kuschelte sich an mich. »Musste sie einkaufen gehen? Hat sie vergessen, dass Cressida und ich noch hier waren?«
»Das glaube ich nicht.«
»Hat sie sich auf dem Heimweg verlaufen?«
Ich schüttelte den Kopf, und er wurde grantig.
»Ich will Mami! Wo ist Mami?«
Als der Kummer darüber, ihn nicht trösten zu können, und die Sorge, er könnte Cressida wecken, übermächtig wurden, fing ich an zu schwindeln.
»Vielleicht wollte sie einen Blumenstrauß für ihre Freundin besorgen.«
»Welche Freundin?«
»Äh … die mit den langen schwarzen Haaren, die von der Spielgruppe.«
Er richtete sich auf. »Sarah?«
»Genau, Sarah.«
»Nein! Das kann gar nicht sein, Sarah hat nämlich jetzt gelbe Haare.«
»Dann eben für Niamh.«
»Warum soll Mami denn Niamh Blumen kaufen? Ist Niamh traurig?«
»Ich glaube.«
»Was für Blumen?«
»Weiß ich nicht, Maxi.«
»Rufst du Niamh mal an und sagst ihr, dass wir Mami hier bei uns brauchen?«
»Mach ich bald, Süßer, bald. Aber jetzt bringen wir dich erst mal ins Bett.«
In einem flüchtigen Augenblick von Klarheit im Kopf dachte ich an die Hightech-Baby-Monitore, die El hatte anbringen lassen, als Max auf die Welt kam – im Ernst, regelrechte Überwachungskameras –, und sah auf Els Handy nach, ob da vor Kurzem Daten gespeichert worden waren. Aber nein, die Kameras waren schon vor Ewigkeiten abgeschaltet worden. Natürlich.
Ich versuchte es mit Bestechung: Wenn er schlafen ging, ohne dass seine Mami ihn gebadet und ihm seine Lieblingsgeschichte vorgelesen hatte, versprach ich ihm, würde ich mit ihm in den Thomas-und-seine-Freunde-Park fahren. Er bestand trotzdem darauf, unten bei mir zu bleiben, und weinte sich in den Schlaf.
Es ist kurz vor zwei Uhr nachts, als draußen ein Polizeiwagen hält und zwei Uniformierte vor der Tür stehen, ein Mann und eine Frau. Ich führe sie ins Wohnzimmer, aber um auch nur hören zu können, was sie sagen, muss ich zunächst Cressida beruhigen. Ihr Gesicht ist purpurrot, Tränen kullern über ihre Wangen, und die kleinen Fäuste boxen wild in die Luft. Max liegt auf dem Sofa und schläft. Er hat sich den Quilt, den Eloïse ihm gemacht hat, bis ans Kinn gezogen und murmelt ab und zu vor sich hin.
»Wann haben Sie das letzte Mal mit Ihrer Frau gesprochen, Mr Shelley?«, fragt der Mann.
Ich wiege Cressida vor und zurück. »Das habe ich doch alles am Telefon schon gesagt«, erwidere ich. Ich will Antworten. Lösungen. Die Polizisten sollen ihren Zauberstab schwingen und meine Frau hier erscheinen lassen.
»Tut mir leid, aber einige Informationen müssen noch einmal bestätigt werden. Bevor wir die Ermittlungen aufnehmen, müssen wir noch ein paar Fragen stellen.«
»Ich war ab Montag in Edinburgh. Am Dienstag habe ich gegen neunzehn Uhr über FaceTime mit ihr gesprochen«, sage ich mit einem Seufzer. »Manchmal rufe ich auch tagsüber an, aber im Büro war so viel zu tun. Ich hatte gar keine Gelegenheit.«
»Wo arbeiten Sie?«
Ich hieve Cressida in eine andere Position, etwas weiter weg von meinem Ohr. Mit ihren drei Monaten ist sie immer noch winzig; noch kann ich sie der Länge nach auf dem Unterarm halten. Als ich sie so herum lege, gibt sie ein gewaltiges Bäuerchen von sich.
»Gut gemacht«, sage ich, doch sie fängt gleich wieder an zu weinen. »Bei Smyth and Wyatt. Vier Tage die Woche bin ich in Edinburgh, die restliche Zeit in der Filiale am Victoria Embankment.«
Der Officer notiert: Smith & White South – Bank.
»Es ist keine Bank, sondern ein Corporate-Finance-Haus.«
Er streicht seine Notiz durch. »Gut. Gab es Meinungsverschiedenheiten zwischen Ihnen und Ihrer Frau? Irgendwas, das sie bewogen haben könnte zu gehen?«
»Hören Sie, das habe ich alles schon gesagt. Meine Frau ist nicht gegangen. Cressida ist gerade mal zwölf Wochen alt. El stillt noch.«
Ich bin sauer. Frustriert. Vor allem aber habe ich Angst. Unweigerlich male ich mir aus, welche Sorgen Eloïse sich macht, egal, wo sie ist, denn nachdem es bei Max schwierig war, hat sie alles darangesetzt, Cressida stillen zu können, und sie sagt immer, sie tue es nach Bedarf. Ist das so schwer zu verstehen? Meine Frau ist nicht gegangen; sie will stillen. Sie fragen, was El beruflich macht, und ich erkläre, dass sie gerade in Elternzeit ist, trotzdem aber gelegentlich im Fernsehen auftritt, um über ihre Arbeit zu sprechen.
»Sie hat vor einigen Jahren eine kleine Hilfsorganisation gegründet, die sich um Flüchtlingskinder kümmert. Sehr erfolgreich«, sage ich. »Sie wird oft für Medienauftritte angefragt. Meine Sorge ist, glaube ich, dass … ich weiß es nicht. Es laufen so viele Verrückte herum.« Ich klammere mich an jeden Strohhalm, schon klar, aber mir schwirrt alles Mögliche durch den Kopf, und mein Körper vibriert vor Adrenalin. Ich höre nicht auf, zur Haustür zu spähen, weil ich denke, sie kommt gleich hereinspaziert.
»Hat sie etwas in der Richtung angedeutet? Drohbriefe, ein Stalker, so was in der Art?«
»Nichts dergleichen.«
Er legt eine Pause ein, falls mir doch noch was einfällt, aber mir fällt nichts ein.
»Können Sie sagen, was sie anhatte, als Sie sie das letzte Mal gesehen haben?«
»Ich glaube, eine graue Yoga-Hose und ein Schlafanzugoberteil. Wie gesagt, es war gegen neunzehn Uhr. Ich hätte sie heute Morgen anrufen sollen, aber ich war eh schon spät dran …«
Er notiert sich das und bittet mich, sie zu beschreiben. Ob sie Tattoos habe oder sichtbare Narben. Nein. Schmuck? Ich sage, dass sie vermutlich ihren Verlobungs- und den Ehering trägt. Die habe ich jedenfalls nirgends gefunden.
»Haben Sie Ihre Nachbarn gefragt, ob die jemanden haben ins Haus gehen sehen?«
Ich nicke. »Mrs Shahjalal von gegenüber war es ja, die gemerkt hat, dass sie nicht da ist.«
Wieder schreibt er mit, langsam, langsam, langsam, so als nehme er eine Essensbestellung auf. »Mrs Shahjalal wird die Nächste sein, mit der wir sprechen. Wie sieht es auf Ihren Konten aus? Gab es irgendwelche Abbuchungen? Wenn wir davon Kenntnis hätten, könnten wir ihre letzten Schritte nachvollziehen.«
Ich habe das schon via Handy gecheckt. Wir haben ein gemeinsames Konto. Heute ist nichts abgegangen – mit Ausnahme der Wassergebühren und der Gemeindesteuer. Natürlich habe ich das auch alles schon gesagt. Das war eins der ersten Dinge, die ich überprüft habe.
»Erzählen Sie mir von Eloïse«, sagt er. »Alter? Größe? Gewicht? Was für ein Mensch ist sie?«
Cressida schreit inzwischen so schrill, dass die Polizistin aufsteht und die Arme nach ihr ausstreckt.
»Darf ich?«
»Bitte.« Ich übergebe sie ihr. Die Polizistin nimmt sie hoch, drückt ihre Wange an Cressies und redet leise auf sie ein. Zehn Sekunden, und mit dem Weinen ist Schluss. Erst da geht mir auf, dass der Lärm vor allem aus meinem Kopf kam.
»Wie alt, sagten Sie, ist sie?«
»Zwölf Wochen. Max ist im Januar vier geworden.«
Die Polizistin lächelt Cressida an, und die starrt zurück. »Ich hab einen Jungen. Zehn Monate alt. Er ist riesig, aber du – du bist ja noch eine richtig kleine Maus.«
»Sie ist etwas zu früh gekommen«, sage ich. Es ist so eine Erleichterung, nicht mehr angeschrien zu werden. Ich lasse mich aufs Sofa fallen, neben Max, und massiere mir die Schläfen. Der Mann sieht mich erwartungsvoll an.
»Eloïse ist siebenunddreißig. Ungefähr eins siebzig groß und schlank. Ich weiß nicht, was sie wiegt, gut sechzig Kilo vielleicht. Sie hat gerade erst ein Kind zur Welt gebracht.«
»Ist das ein neueres Foto?«, fragt er mit Blick auf das Fotografenbild, das, zwischen zwei dicke Glasplatten gepresst, hinter mir an der Wand hängt.
Das Ding hat ein Vermögen gekostet, aber wir sehen darauf so gelöst aus, so zufrieden – im Nachhinein bin ich froh, dass ich nachgegeben und mich damit einverstanden erklärt habe, es machen zu lassen. Eloïse hat Cressida auf dem Arm, den winzigen, drei Wochen alten Spatz, und obwohl ich weiß, dass sie Hemmungen hatte – ich musste mich hinknien, damit mein Kopf ihren ansatzweise noch vorhandenen Babybauch verdeckt –, finde ich, dass sie toll aussieht. Schulterlanges goldblondes Haar, dieses wundervolle Lächeln und die makellose Haut, als hätte sie LEDs in den Adern: schimmernd, das ist das richtige Wort. Ich weiß, meine Frau ist eine Schönheit, drei Klassen zu hoch für mich.
»Ist sie der Typ dafür, einfach auf und davon zu gehen?«, fragt der Officer. »Hat sie das schon mal gemacht?«
»Nein, noch nie. Überhaupt nicht.«
Der Officer starrt mich ausdruckslos an. »Keine Drogenprobleme? Alkohol? In die Richtung?«
Ich schüttele den Kopf. »Nichts. Als sie mit unserem Sohn schwanger wurde, hat sie aufgehört, Alkohol zu trinken. Ab und zu genehmigt sie sich vielleicht ein Glas Wein. Sie … hören Sie, ich wiederhole mich: Eloïse ist die Letzte, von der ich mir vorstellen kann, dass sie einfach so verschwindet. Sie ist ruhig. Zurückhaltend. Häuslich, verstehen Sie?«
»Sie würde also nicht mal kurz rausgehen, um, sagen wir, eine Nachricht abzuhören oder zu telefonieren? Nur für fünf Minuten?«
Mir geht allmählich die Geduld aus; ich bin kurz davor, in Tränen auszubrechen, was mich nur noch mehr aufregt. »Unsere Kinder waren hier. Sie wusste, dass ich frühestens morgen Abend aus Edinburgh zurückkommen würde. Es ist absolut undenkbar, dass sie die Kinder allein gelassen hätte. Sie lässt Cressida ja noch nicht mal unten, wenn sie nach oben geht, um zu duschen. Wir haben im Bad einen Auto-Sitz stehen und in der Küche eine Babywippe.«
Der Polizist nickt. »Gut. Gab es, als Sie heimkamen, irgendwelche Hinweise darauf, dass jemand hier im Haus war? Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen?«
Ich schüttele den Kopf. »Alles war abgeschlossen.«
»Und die Hintertür? War die auch abgeschlossen?«
Ich überlege. War sie?
Dass ich zögere, veranlasst ihn, sich aufmerksam umzusehen. »Welche Zugänge zum Haus gibt es noch? Fenster? Weitere Türen hinten?«
»Jetzt, wo ich darüber nachdenke: Mit der Hintertür war etwas nicht in Ordnung. Das Schloss war eingefroren und funktioniert nicht mehr richtig. Ich wollte das schon lange reparieren lassen, aber …« Ich hatte so viel zu tun. Ich schließe die Augen und stoße einen Seufzer aus. Panik bohrt sich in mein Herz. Warum war ich so achtlos? Wieso habe ich zugelassen, dass die Hintertür nicht anständig verschlossen werden kann?
Er erhebt sich und geht nach hinten, zur Rückseite des Hauses. Ich folge ihm. Aber es ist ja dunkel, der Blick nach draußen bringt nicht viel.
»Was liegt hinter Ihrem Garten?«
»Ein schmaler Weg und dahinter die rückwärtigen Gärten der Parallelstraße. Larkspur Terrace.«
Das schreibt er auf. »Haben Sie Geld im Haus? Irgendwelche Wertsachen, teure Geräte?«
»In der Küche steht eine Schachtel mit ein paar Hundertern. Für dringende Fälle.«
»Ist sie noch da?«
Ich nicke. »Auch Eloïses sämtlicher Schmuck.«
»Sicher?«
Die Türklingel fährt dazwischen. Sofort gehe ich hin, reiße die Tür auf – und stehe Gerda und Magnus gegenüber, traurig und zornig zugleich, alle beide. Ich sage ihnen, dass die Polizei da ist.
»Sie ist noch nicht zurück?«, bellt Magnus. Er ist Eloïses Großvater, ruppig, stets gut gekleidet und unsterblich. Wie Clint Eastwood. Der Mann hat, ich weiß nicht, wie viele Dreifach-Bypass-Operationen und Krebstherapien hinter sich, und trotzdem scheint er mit den Jahren immer zäher zu werden. Nicht ganz so dauerpikiert wie Gerda, eher bodenständig, aber trotzdem nicht der Typ Mann, mit dem ich gern mal einen trinken würde.
»Kommt ihr aus Herefordshire?«, frage ich. Sie haben Wohnsitze an allen möglichen Orten – in der Schweiz, in Griechenland –, und ich habe überlegt, ob Eloïse sich vielleicht in einem dieser Häuser aufhalten könnte, aber sie sind alle viel zu abgelegen und praktisch unerreichbar. Abgesehen davon hätte Eloïse keinen Grund gehabt, an einen dieser Orte zu fahren.
Gerda, die längst ins Wohnzimmer gerauscht ist und den schlafenden Max auf dem Sofa entdeckt hat, geht über meine Frage hinweg. »Die Kinder sind noch nicht im Bett? Ist es dafür nicht ein bisschen spät?«
Die Polizisten stellen sich kurz vor. Gerda setzt sich mit verkniffener Miene neben Max und stopft die Decke um ihn fest. Magnus schreitet den Raum ab, als suche er nach etwas, das nicht an seinem angestammten Platz ist.
»Das sind Gerda und Magnus Bachmann«, sage ich und verkneife mir, was ich sonst immer leise hinzufüge: frisch aus der Gruft. El gibt mir dann jedes Mal einen Klaps, obwohl sie auch lachen muss. »Gerda und Magnus sind die Großeltern von Eloïse. Sie sind natürlich sehr beunruhigt.«
Ich sage nicht, dass sie die übergriffigsten Schwiegereltern der Welt sind. Gerda zückt ein goldenes Klapphandy und tippt mit manikürtem Finger eine Nummer ein. »Eloïse, Liebes, hier ist Mama. Ich rufe jetzt zum zwanzigsten Mal an, und ich sage dir, ich höre erst damit auf, wenn du dich meldest. Rufst du bitte einen von uns an, damit wir wissen, dass es dir gut geht?«
Ihr Englisch klingt perfekt antrainiert mit Schweizer Einsprengseln. Es erinnert mich an Eloïse, bei der auch manchmal Spuren aus ihren Teenager-Jahren in Genf herauszuhören sind. Sie spricht fließend Deutsch und Französisch, außerdem konversationstaugliches Italienisch und hat Max schon einiges beigebracht. Gerade will ich Gerda mitteilen, dass Eloïses Handy auf dem Tisch im Esszimmer liegt, da klingelt es schon. Kurz leuchten ihre Augen auf, weil sie meint, Eloïse gefunden zu haben, dann fällt der Groschen.
Es ist totenstill im Haus, das sich anfühlt wie ausgehöhlt. Benommen schenke ich Magnus einen Whisky ein und mache für Gerda und mich einen Tee. So hocken wir zu fünft im Wohnzimmer, verwirrt und vollkommen ratlos. Trotz der späten Stunde blinkt und piept mein Handy unaufhörlich von eingehenden SMS und Facebook-Nachrichten, und obwohl ich jede einzelne genau studiere, finde ich keinerlei Hinweis darauf, wo meine Frau sein könnte.
»Hast du mit ihren Freundinnen gesprochen?«, fragt Gerda.
»Natürlich hat er das«, schnarrt Magnus.
Mir entfährt ein müder Seufzer. »Ich habe eine Frau aus der Baby-Spielgruppe angerufen, zu der sie manchmal geht. Während der gesamten Bahnfahrt von Edinburgh hierher habe ich herumtelefoniert: mit Bibliotheken, Cafés, der Schwimmhalle, unserem Hausarzt, dem Zahnarzt – bis mein Akku leer war. Mit allen, die mir eingefallen sind.«
Magnus setzt sich und steht wieder auf. »Das ist gut. Irgendjemand wird ja wohl mit ihr Kontakt gehabt haben.«
Ich sage: »Ich habe alle Leute aufgelistet, die sie gestern gesehen haben. Heute hat sie keiner gesehen. Außer den Kindern.«
»Was sagt Max? Er muss doch was mitgekriegt haben«, wiederholt Gerda zum hundertsten Mal.
»Er sagt, sie haben am Vormittag Lebkuchenfiguren gebacken, und dann hat er Mittagsschlaf gemacht. Als er aufgewacht ist, hat er sie überall gesucht, auch im Garten, aber er hat sie nicht gefunden. Und dann ist Mrs Shahjalal rübergekommen.«
Ich stehe auf und sammle Tassen und Gläser ein. »Ich sollte wohl mal die Kinder ins Bett bringen. Ich ruf euch morgen früh an, in Ordnung?«
Gerda setzt eine beleidigte Miene auf.
»Nein! Wir bleiben! Eloïse kommt bestimmt bald wieder, aber bis dahin brauchen die Kinder uns doch.«
18. März 2015
Eloïse: Ich erwache in einem Bett. In einem Raum, der offensichtlich ein Dachboden ist. Staubpartikel schwirren im Sonnenlicht, das durch eine Dachluke hereinfällt. Über mir kreuzen sich alte Balken, in den Ecken sitzen Spinnweben. Mit den Wänden aus rohem Stein und dem schweren Geruch von Staub und Feuchtigkeit hat das Ganze etwas von einer Höhle.
Ich hieve mich hoch und zucke zusammen, denn sofort ist der Kopfschmerz wieder da. Dazu machen sich diverse andere Schmerzen bemerkbar, im rechten Schienbein und Knöchel und oben im Rücken, und die Muskulatur in Oberarmen und Nacken ist total verspannt. Es fühlt sich an, als sei ich einem Elefanten in die Quere gekommen. Vorsichtig betaste ich die Schnittwunde am Kopf. Kein frisches Blut, aber verkrustete Haare.
Die Ereignisse von gestern Abend kullern in meinem Bewusstsein durcheinander wie Steine. Die Leute, denen ich begegnet bin, die mich nach einem Bootsunfall am Strand gefunden und gerettet haben. Schriftsteller, oder? Zu einer Schreibwerkstatt hier? Ich versuche, mir meinen Namen ins Gedächtnis zu rufen. Er erscheint nicht, also sage ich laut: Ich heiße … Mein Mund bleibt offen stehen, als könnte mein Name sich so von selbst formen und erklingen. Ich habe das deutliche Gefühl, dass ich irgendwo etwas zurückgelassen habe, aber sosehr ich auch lauere, es zeigt sich nicht.
Wasser. Ich brauche Wasser. Langsam schiebe ich die Beine über die Bettkante und stelle die Füße auf den Boden. Kalt. Meine Kleidung besteht aus einem T-Shirt mit einer verwaschenen Ananas vorn drauf und einer schlabberigen schwarzen Badehose.
Ich stakse zur Tür wie ein Fohlen, aber der Drücker lässt sich nicht bewegen. Ich rüttele daran, umfasse ihn mit beiden Händen und bearbeite ihn mit aller Kraft. Schließlich dreht und dreht er sich, aber die Tür gibt nicht nach. Für einen Augenblick wird mir schwarz vor Augen. Ich stütze mich mit einer Hand an der Wand ab, lasse mich auf den Boden nieder und lehne die Stirn an die Tür. Atme langsam und stockend ein und aus. Eine große graue Spinne spaziert an meinen nackten Füßen vorbei. Ich zucke zurück, und im nächsten Moment flitzt sie davon, einen der staubigen Risse in der Wand hinauf. Immerhin habe ich noch genug Adrenalin in mir, um ein, zwei, drei Mal mit der Faust gegen die schwere Tür zu hämmern. Irgendwo unten im Haus sind leise Stimmen zu hören.
Nach einer Weile geht die Tür endlich auf und rammt mich. Jemand quetscht sich fluchend durch den Spalt und hilft mir auf.
»Sie war zu«, erkläre ich.
»Abgeschlossen?« Es ist die Stimme von Joe. Er inspiziert die Tür kurz und sagt: »Nicht abgeschlossen. Die klemmt immer. Na los, komm, du musst was essen.«
Er ruft etwas nach unten, und dann legt er mir eine Hand um den Hinterkopf und die andere fest ins Kreuz. Kurz darauf taucht eine der beiden Frauen auf. Ich erkenne sie wieder: die Freundliche, die mich so besorgt angeschaut hat. Sariah. Sie hilft Joe, mich zu stützen, und dann bewegen wir uns vorsichtig eine steinerne Wendeltreppe hinunter, eine Etage und dann noch eine, Joe vorweg und Sariah hinter mir, für den Fall, dass ich strauchele.
Die gesamte Anlage lässt darauf schließen, dass es sich um ein altes Bauernhaus handelt; zur stilgerechten Dekoration sind einige Überbleibsel aus seiner Vergangenheit an den Wänden drapiert – alte Hakenpflüge, mehrere gemein aussehende Mistgabeln, ein altes Rad und ein paar Kuh- oder Ziegenglocken. In einem der Räume unten steht ein Schaukelstuhl – ich erinnere mich, da habe ich gestern Abend gesessen und am ganzen Leib gezittert – vor einem schönen Kamin, der den Geruch von verbranntem Toast verströmt.
Die Küche sieht bei Tageslicht anders aus – lang gestreckt und lichtdurchflutet, ausgestattet mit einem großen Herd samt Backofen, Kühlschrank und weißen Granitarbeitsplatten. In der Mitte des Raums steht ein Holztisch mit vier Stühlen. Alles leicht angegammelt und verstaubt, aber nicht annähernd so gruselig, wie es mir gestern Abend vorkam. Ein erdiger Geruch liegt in der Luft, so als sei das alles hier lange nicht genutzt worden, doch dann, als ich näher komme, duftet es intensiv nach gegrillten Tomaten und Pittabrot.
»Jetzt sollst du erst mal was zu essen haben«, sagt Sariah und macht sich an einer der Pfannen auf dem Herd zu schaffen.
Joe führt mich langsam zu einem Stuhl und geht dann zur Spüle hinüber. Er ist deutlich jünger, als ich gestern auf den ersten Blick dachte. Anfang zwanzig vielleicht, irgendwie noch studentisch. Lang, blass und dünn. Das dunkle Haar steht gegelt kerzengerade hoch, die schwarz gerahmte Brille mit den eckigen Gläsern verdeckt die Augen teilweise.
Er reicht mir ein Glas Wasser, das ich in einem Zug leere. Sariah gibt etwas aus der Pfanne auf einen Teller. Sie trägt einen roten Rock und einen Kimono aus fließendem, mit orangefarbenen Blumen bedrucktem Stoff. Toll sieht sie aus: goldene Ringe an den langen dunklen Fingern, bunte Perlenketten um den Hals, das dunkle Haar in dicken Strängen mit einem orangefarbenen Tuch hochgebunden und zusammengehalten. Sie stellt mir den Teller hin: gebratene Kirschtomaten, Oliven, Pittabrot.
»Danke«, sage ich, und sie lächelt.
»Was dagegen, dass ich mir mal deinen Kopf ansehe?«, fragt Joe.
Ich spüre seine Hände, die behutsam das Haar an meinem Hinterkopf scheiteln und die Wunde untersuchen.
»Wie sieht es aus?«
»Sauber. Ein bisschen aufgeschürft drum herum. Was macht der Nacken?«
Seine Finger streichen an meinem Hals auf und ab, und dann bewegt er vorsichtig meinen ganzen Kopf nach links und nach rechts.
»Steif.«
»Ich sehe zu, dass ich ein Schmerzmittel finde.«
Der Wasserkessel auf dem Herd gibt ein hohes Pfeifen von sich. Sariah geht hin, brüht Kaffee auf und fragt, ob ich Milch dazu möchte. Mir ist das alles fremd, es verwirrt mich. Ich sage Ja, mit Milch, aber selbst das ist komisch, ich höre meine eigene Stimme nur von fern, ich erkenne sie kaum. Entschlossen, in alldem einen Sinn zu entdecken, irgendetwas zu finden, das mir vertraut ist, lasse ich meinen Blick durch den Raum wandern. Es stellt sich keine Vertrautheit ein.
Die andere Frau – Hazel nennt Joe sie – kommt herein, reibt sich die Hände und murmelt etwas von Tee. Sie ist klein und dünn und hat hellrote Locken wie Springfedern. Der viel zu große schwarze Wollpullover hängt weit über den flaschengrünen Rock herunter. Sie trägt etwas unter den Arm geklemmt, ein Notizbuch.
Als sie mich sieht, bleibt sie abrupt stehen – so, als habe sie mit mir hier nicht gerechnet. »Hallo«, sagt sie knapp. Dann setzt sie sich und richtet das Notizbuch auf ihrem Schoß aus. Ihre Aussprache ähnelt der von Joe und George.
»Hallo.«
»Bleibst du hier bei uns?«
Von der Spüle her sagt Sariah: »Wir versuchen immer noch, sie zu einem Arzt zu bekommen.«
Hazels Blick wandert von mir zu Sariah. »Joe ist doch Arzt, oder nicht?«
»Ich mache Erste Hilfe«, sagt Joe, der gerade wieder hereinkommt. »Hier«, fügt er hinzu, »die hab ich gefunden. Paracetamol.«
»Danke.« Ich drücke gleich mehrere Tabletten aus dem Streifen und nehme sie mit einem Schluck Kaffee.
Hazel beobachtet mich, das spüre ich, ihre grauen Augen mustern mich von Kopf bis Fuß.
»Du warst vielleicht in einem Zustand gestern«, sagt sie. »Ganz schön aufreibend. Kannst du dich erinnern?«
In Wahrheit meint sie vermutlich, ob ich mich an das erinnern kann, was geschehen ist, bevor ich in ihrer Küche gelandet bin. Ihr Lächeln ließe sich auch so deuten, dass sie sich über meinen elenden Zustand amüsiert. Ich werde mich vor ihr hüten.
»Und du weißt immer noch nicht, wie du hierhergekommen bist?«
»Ich glaube nicht …«
»Und dein Name?«
Ich mache den Mund auf, denn da müsste er sein, er sollte mir auf der Zunge liegen, aber die Region in meinem Hirn, die für die Selbstvergewisserung zuständig ist, scheint leer gefegt, geschlossen, verödet.
Als Hazel mich zögern sieht, blitzt es in ihren Augen. Sariah bedenkt sie mit einem scharfen Blick, und sofort wendet sie sich beschämt ab.
»Quäl dich nicht«, sagt Sariah. »Du hast einen schlimmen Abend hinter dir, dein Kopf hat was abgekriegt. Lass dir Zeit. In ein paar Stunden kommt das alles wieder.«
Schwere Schritte nähern sich der Hintertür. Es ist George, verschwitzt und völlig erschöpft, sein graues Unterhemd ist klatschnass. Als er näher kommt, wird Hazel unruhig.
»Hast du’s gefunden?«, fragt Sariah.
George schüttelt den Kopf; Sprechen wäre ihm wohl zu anstrengend. Er ist zu dick und im Augenblick so tiefrot im Gesicht, dass ich mich darauf gefasst mache, ihn mit einem Rums umkippen zu sehen. Er zieht ein Handtuch von dem Regal über der Spüle und tupft sich den Schweiß von Brauen und Gesicht.
»Das Boot, oder was?«, ruft Hazel schrill. »Ist das Boot weg?«
Keine Antwort. Beide, Hazel und Sariah, starren George an, während er sich hinsetzt, sich zurücklehnt und erst einmal tief durchatmet. Sie scheinen besorgt. Die Stimmung ist plötzlich im Keller.
»Welches Boot?«, frage ich vorsichtig. Meine Stimme hört sich immer noch fremd an, so, als hätte jemand anders die Frage gestellt.
»Wir haben bei Nikodemos ein Motorboot gemietet, damit wir zum Einkaufen nach Kreta fahren können«, erklärt Sariah leise.
»Wir haben dich nur entdeckt, weil wir nachsehen wollten, ob es für den Sturm hinreichend festgemacht ist.« Keuchend zieht George die nassen Stiefel und Socken aus. Der säuerliche Schweißgeruch trifft mich unvorbereitet. »Dich haben wir gefunden. Aber das Boot ist weg.«
»Hat Joe nicht gesagt, dass es wahrscheinlich an einem anderen Strand wieder angespült wird?«, fragt Hazel.
George neigt den Kopf nach links und nach rechts, dass es in seinem Nacken knackt. »Ich hab überall nachgeschaut, glaub mir. Das Boot ist weg. Gesunken wahrscheinlich.«
»Was Nikodemos wohl dazu sagt, dass sein Boot gesunken ist?«, murmelt Hazel. »Der wird sauer sein. Richtig sauer.«
»Was Nikodemos wohl dafür berechnen wird?«, erwidert George. »Das ist die Frage.«
»Wir sind doch versichert, oder?«, wirft Sariah ein und wendet sich wieder dem Herd zu. Mit heftigen, etwas fahrigen Bewegungen schlägt sie Eier in die Pfanne.
George fährt sich über den Stoppelkranz an seinem Kinn. »Wir müssen uns was anderes überlegen, wie wir zum Einkaufen zur Hauptinsel kommen. Nicht zu reden davon, dass wir unsere Besucherin wieder dahin verfrachten müssen, wo sie hergekommen ist.«
Sofort fühle ich mich schuldig. Ich gehöre hier nicht her. Das Gefühl, fehl am Platz zu sein, macht mich hilflos; ich bin eine Last. George und Hazel bestätigen mich darin, indem sie beide – vorwurfsvoll, wie mir scheint – kurz zu mir herüberschauen. »Tut mir leid, was mit eurem Boot passiert ist«, sage ich.
»Wir finden eine Lösung«, sagt Sariah, ohne sich umzudrehen, und ich frage mich, ob sie gespürt hat, wie ich mich fühle.
Joe kommt von draußen herein; er hält den Saum seines schwarzen T-Shirts hoch, das sich unter einer Ladung Pfirsiche beult. George hebt an, ihm von dem Boot zu erzählen, doch Sariah fällt ihm ins Wort.
»Frühstück, Joe?«
Er lässt die Pfirsiche auf die Arbeitsplatte kullern, reibt sich die Hände und wirft einen Blick auf die Pfanne. »Gern.«
»Willst du auch was, George?«
»Okey-dokey.« Er schaut mich an. »Falls es dir noch nicht aufgefallen ist: Sariah ist in diesem Laden die Köchin.«
»Und was bin ich in diesem Laden?«, meldet sich Hazel zu Wort.
»Die Putzfrau«, antwortet Joe mit vollem Mund und sieht mich an. »Hazel ist ständig am Aufräumen und Putzen. Sie nimmt dir dein Glas schon zum Spülen aus der Hand, bevor du es geleert hast.«
Hazel zuckt genervt die Achseln. »Gegen Reinlichkeit ist doch nichts einzuwenden, oder? Ordnung ist das halbe Leben.«
»Trotzdem. Ich rate dir: Halt deinen Teller fest«, sagt Joe. »Sonst nimmt sie ihn dir weg.«
»Und was ist mit dir?«, frage ich. »Was machst du?«
Er wirft eine Kirschtomate hoch und fängt sie mit dem Mund wieder auf. »Erste Hilfe.«
»Sie meint, was du hier machst, Dummie«, sagt George.
»Ah, ach so. Ich bin eben ein bisschen langsam. Also – ich biete medizinische Versorgung?«
»Erste Hilfe im Haus«, schlägt George vor.
»George ist der Schrauber«, sagt Hazel.
»Und was soll das heißen?«, fragt George.
»Dass du Sachen reparierst«, wirft Joe ein. »Es sei denn, ›Schrauber‹ ist Mongolisch für ›grantiger Mistkerl‹.«
»Ich schraub dich gleich zusammen.«
»Siehst du?« Joe hebt eine buschige schwarze Braue und zwinkert mir zu.
Sariah bringt den letzten Gang zum Tisch, einen großen Teller mit aufgeschnittenen Feigen und Tomaten. Sie nimmt die Schürze ab, hängt sie über einen Haken neben dem Herd und setzt sich neben mich, während George zur Spüle geht und sich kaltes Wasser ins Gesicht und in die Achselhöhlen spritzt. So elend ich mich auch fühle, im Zusammensein mit ihnen bin ich entspannter; inzwischen ist es, als würde ich sie schon ewig kennen. Dadurch wird diese Situation, die eigentlich nicht auszuhalten ist, erträglich.
»Und wie kommt es, dass du dich nicht an deinen Namen erinnerst, aber weißt, wie Sprechen geht?«, fragt Hazel.
»So ist es ja nicht«, erwidert Joe. »Sie hat eine Amnesie. Das heißt nicht, dass sie komplett handlungsunfähig ist.«
Sie zieht eine Schnute. »Also weißt du nicht, ob du irgendwelche abgedrehten Vorlieben hast?«
»Ich glaube nicht«, sage ich.
Das scheint sie zu faszinieren, plötzlich wirkt sie hellwach. »Das möchte ich in meinem neuen Buch verwenden. Macht’s dir was aus, wenn ich dir noch ein paar Fragen stelle?«
Ich will sagen, dass ich nichts dagegen habe, aber Joe fällt mir ins Wort.
»Was bist du nur für eine Wichtigtuerin«, sagt er und lächelt sie spöttisch an. »Ich dachte, in deinem neuen Buch geht’s um einen Banker, der nicht begreift, dass er tot ist …«
Mit einer energischen Handbewegung bringt sie ihn zum Schweigen. Und dann fragt sie mich: »Weißt du, was dir schmeckt?«
»Ich glaube, ich mochte das, was ich gerade gegessen habe.«
Aber das genügt Hazel nicht. Frage um Frage präsentiert sie mir: Wie heißt der derzeitige Präsident der Vereinigten Staaten? Welches Jahr haben wir? Wie hieß meine Grundschule? Was war das Peinlichste, das mir je passiert ist? Und so weiter. Für die meisten dieser Fragen bin ich noch viel zu benebelt, aber immerhin, ich weiß, welches Jahr wir haben, und bin über tagespolitische Ereignisse einigermaßen informiert. Nur wer ich bin, weiß ich nicht.
»Du könntest Gott weiß wer sein«, insistiert Hazel – gereizt und neugierig zugleich. »Wie sollst du auch wissen, wer du bist, wenn du dich an nichts erinnerst?«
»Wer von uns hat schon eine Ahnung davon, wer er ist?«, wirft Joe ein und deutet mit einem Finger ein Fragezeichen an. »Wir sind doch jeder mehrere Persönlichkeiten in einer Haut.«
»Ich nicht«, entgegnet George. »Mann, du tust ja so, als wären wir alle … wie heißen noch mal diese russischen Puppen?«
»Russische Puppen«, sagt Hazel.
»Identität ist das, was wir zeigen«, sagt Joe. »Da kannst du jeden Psychoanalytiker fragen.«
Hazel hebt eine Braue. »Okay. Gleich den nächsten Psychoanalytiker, der mir auf dieser unbewohnten Insel über den Weg läuft, werde ich fragen.«
Das erschreckt mich. »Unbewohnt?«
Joe nickt.
»Die ganze Insel?«
»Ein unbewohntes Paradies«, sagt Sariah träumerisch. »Hier gibt’s nur dieses alte Bauernhaus und ein paar minoische Ruinen. Und uns.«
Ich schaue zum Fenster. Ein Flecken abschüssigen trockenen Bodens und dahinter das Meer, bis zum Horizont nichts als Blau. Hazel fängt an, mir zu erläutern, dass die nächstgelegene Insel Andikythira heißt und acht Seemeilen entfernt liegt, aber daraus entspinnt sich zwischen Joe und ihr ein Streit darüber, ob Kreta näher ist oder nicht. Ich schweife ab. Acht Meilen Ozean bis zur nächsten Stadt. Ich hatte gedacht, dass noch mehr Leute hier auf der Insel sind, Leute, mit denen wir reden, die etwas zur Klärung meiner Situation beitragen oder helfen könnten, das verschwundene Boot wiederzufinden. Dass ich die Möglichkeit hätte, mich an die Behörden zu wenden und herauszufinden, wo ich hergekommen bin.
»Aber … wie kommt ihr an eure Vorräte?«
»Früher gab es im Süden der Insel ein Hotel«, sagt Hazel vertraulich. »Mit Restaurant, ein paar Geschäften, sogar einer Bowlingbahn. Aber sie haben letztes Jahr dichtgemacht. Die Rezession, du weißt schon. Da haben wir früher unsere Sachen herbekommen. Jetzt haben wir eben von Nikodemos – das ist der Mann, dem die Insel gehört – dieses Motorboot geliehen …«
»… das gesunken ist, wie es scheint«, ergänzt George.
»Internet haben wir auch nicht«, wirft Joe ein.
Kein Internet heißt, ich kann weder in den sozialen Netzwerken noch via Google nach Berichten über eine Frau forschen, deren Beschreibung auf mich passt und die auf Kreta als vermisst gilt.
»Nikodemos hat uns auch ein Satellitentelefon mitgegeben«, sagt Sariah, die merkt, wie sehr mich das alles beunruhigt. »Gott sei Dank! Ohne das Boot wären wir sonst ja wirklich wie Schiffbrüchige.«
Daran erinnere ich mich. Dass George gestern Abend das Satellitentelefon aus der Tasche gezogen hat. Sie wollten versuchen, die Polizei auf der Hauptinsel zu erreichen.
»Hattet ihr inzwischen Kontakt zur Polizei?«, frage ich schnell.
»Das war das Erste, was ich heute Morgen gemacht habe«, sagt George, und ich atme auf. Doch dann fährt er fort: »Es ist niemand als vermisst gemeldet. Ich hab sie gebeten, bei den Dienststellen auf den anderen Inseln nachzufragen. Das wollten sie machen.« Er zuckt die Achseln. »Tut mir leid, dass ich nichts Besseres zu berichten habe.«
»Vielleicht könnten wir die britische Botschaft anrufen? Wer mich vermisst, würde sich doch bestimmt auch dorthin wenden.«
»Okey-dokey.«
Er holt das Telefon aus der Hosentasche und zieht die Antenne heraus. Dann springt er auf, wählt eine Nummer und geht zum Fenster hinüber, wohl um besseren Empfang zu haben.
»Ich hätte gern die britische Botschaft«, sagt er.
Mein Herz rast. Ich stehe ebenfalls auf und folge ihm gespannt.
»Athen, sagen Sie?« Er hält das Telefon ein Stück von seinem Mund weg und erklärt mir: »Auf Kreta gibt’s keine britische Botschaft. Am nächsten dran ist die in Athen.«
Die Antwort auf meine Frage, wie weit es nach Athen ist, fällt niederschmetternd aus: sechzehn Stunden mit dem Boot, das wir ja anscheinend noch nicht einmal haben.