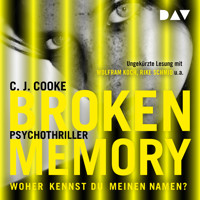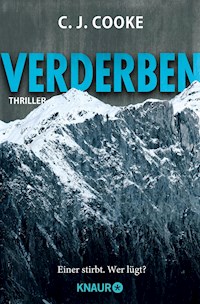
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Vier Freunde. Ein Toter. Wie lebst du mit der Schuld? Raffiniert komponierter psychologischer Spannungsroman um ein Berg-Unglück und die Macht von Schuld und Sühne Vier Freunde – drei Männer und eine Frau – brechen im Juni 1995 zu einer anspruchsvollen Klettertour auf den Mont Blanc auf. Bald kommt es zu Reibereien und Rivalitäten unter den Männern. Am Ende kehren nur drei der Freunde vom Berg zurück. 20 Jahre später ist Helen mit ihrem Mann Michael und den Kindern auf dem Heimweg aus dem Urlaub, als ihr Auto von einem weißen Van gerammt wird. Helen erwacht im Krankenhaus, Michael und die Kinder sind schwer verletzt. Doch das ist nicht der größte Schock für Helen: Die Polizei eröffnet ihr, dass ihr Mann den Fahrer des Vans für den Unfall bezahlt haben soll. Kurz darauf flüchtet Michael aus dem Krankenhaus und Helen ahnt, dass die Vergangenheit sie nun endgültig eingeholt hat … »Verderben. Einer stirbt. Wer lügt?"« ist der zweite psychologische Spannungsroman der irischen Autorin C J Cooke, der sich eindrucksvoll mit der Frage beschäftigt, wie Schuld ein Leben bestimmen und schließlich aus dem Ruder laufen lassen kann. Ebenfalls auf Deutsch erschienen ist C. J. Cookes Psycho-Thriller »Broken Memory«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
C. J.Cooke
Verderben. Einer stirbt. Wer lügt?
Thriller
Aus dem Englischen von Susanne Wallbaum
Knaur e-books
Über dieses Buch
Vier Freunde.
Ein Toter.
Wie lebst du mit der Schuld?
Vier Freunde – drei Männer und eine Frau – brechen im Juni 1995 zu einer anspruchsvollen Klettertour auf den Mont Blanc auf. Bald kommt es zu Reibereien und Rivalitäten unter den Männern. Am Ende kehren nur drei der Freunde vom Berg zurück.
20 Jahre später ist Helen mit ihrem Mann Michael und den Kindern auf dem Heimweg aus dem Urlaub, als ihr Auto von einem weißen Van gerammt wird. Helen erwacht im Krankenhaus, Michael und die Kinder sind schwer verletzt. Doch das ist nicht der größte Schock für Helen: Die Polizei eröffnet ihr, dass ihr Mann den Fahrer des Vans für den Unfall bezahlt haben soll. Kurz darauf flüchtet Michael aus dem Krankenhaus und Helen ahnt, dass die Vergangenheit sie nun endgültig eingeholt hat …
Inhaltsübersicht
Für Willow
»Ich aber kenne die menschliche Natur, mein Freund, und ich sage Ihnen, dass auch der Unschuldigste, der sich plötzlich in Gefahr sieht, wegen Mordes vor Gericht gestellt zu werden, den Kopf verliert und die aberwitzigsten Dinge tut.«
Agatha Christie, Mord im Orientexpress
K. Haden
Haden, Morris Laurence Law Practice
4 Martin Place
London, EN9 1AS
25. Juni 2006
Michael King
101 Oxford Lane
Cardiff
CF10 1FY
Sehr geehrter Herr,
wir wenden uns erneut in der Angelegenheit des Todes von Luke Aucoin an Sie. Es hätte längst zu einer Aussprache über diese Tragödie kommen sollen. Bitte schieben Sie eine Antwort nicht noch länger hinaus, sondern melden sich unter der o.g. Adresse, damit ein Treffen arrangiert werden kann.
Mit freundlichen Grüßen
K. Haden
K. Haden
Haden, Morris Laurence Law Practice
4 Martin Place
London, EN9 1AS
25. Juni 2010
Michael King
101 Oxford Lane
Cardiff
CF10 1FY
Sehr geehrter Herr,
im Namen unserer Mandanten wenden wir uns erneut wegen des Todes von Luke Aucoin an Sie.
Um zu vermeiden, dass die Angelegenheit Konsequenzen nach sich zieht, bitten wir Sie, umgehend mit uns in Kontakt zu treten.
Mit freundlichen Grüßen
K. Haden
28. Januar 2017
MÖRDER
Erster Teil
1
Helen
30. August 2017
Vielleicht bin ich tot.
Das vor mir sieht aus wie eine Nebelwand, die vom Meer herkommt und über Ödnis auf mich zukriecht. Sie nähert sich wie eine Faust. Ich rieche etwas – Abwasser und Schweiß. Und ich sehe ein flackerndes Licht, als käme jemand mit einer Taschenlampe durch den Nebel; immer heller wird der Schein, bis ich schließlich begreife, dass meine Lider sich öffnen, mühsam, als müssten zwei Segmente einer Betonplatte auseinanderbrechen. Wach auf!, rufe ich stumm. Wach auf!
Schmerzhaft grelles Licht. Über mir eine gelbfleckige Decke aus kaputtem Gipskarton und ein Ventilator, der sich lahm dreht. Ich versuche, den Kopf zu heben. Es auch nur einen Zentimeter weit zu schaffen kostet schon unendlich viel Kraft; es fühlt sich an, als hinge ein Amboss daran. Wo bin ich? Meine Jeansshorts und das T-Shirt sind zerrissen und von Schlamm bedeckt. Ich liege auf einem Bett. Habe noch eine Sandale an. Der andere Fuß ist auf die doppelte Größe angeschwollen; zwischen Resten getrockneten Bluts blitzt der blaue Nagellack durch, den Saskia mir draufgepinselt hat. Ich wackele mit den Zehen, dann bewege ich die Finger.
Meine Glieder spüre ich. Gut.
Am Fußende des Bettes ist eine Schwester damit beschäftigt, etwas auszuwechseln. Einen Urinbeutel. Ein Ziehen seitlich im Rücken bringt mich darauf, dass der Beutel zu mir gehört.
»Hallo?«, sage ich heiser. Es ist kaum mehr als ein Krächzen.
Irgendwo im Raum wird in einer anderen Sprache geredet, also spricht die Schwester vielleicht kein Englisch.
»Entschuldigung, aber … Hallo? Können Sie mir sagen, warum ich hier bin?«
Selbst jetzt, da ich keine Ahnung habe, wo ich bin und warum ich hier bin, entschuldige ich mich. Michael sagt immer, dass ich mich zu oft entschuldige. Durch zwei komplette Geburten hindurch habe ich mich dafür entschuldigt, dass ich den Laden zusammenschreie.
Ein Mann kommt herein und spricht mit der Schwester; als ich versuche, mich aufzusetzen, werfen mir beide besorgte Blicke zu. Er ist ein Arzt ohne weißen Kittel; stattdessen trägt er ein schwarzes Polohemd und Jeans; das Stethoskop um seinen Hals und ein Schlüsselband weisen ihn aus. Zu meiner Linken sehe ich ein Fenster mit Fliegengitter, und aus irgendeinem Grund will ich dort unbedingt hin. Ich muss etwas finden. Oder jemanden.
»Seien Sie vorsichtig«, sagt der Arzt mit starkem Belize-Akzent. »Sie haben eine Kopfverletzung.«
Ich führe eine Hand zum Kopf und ertaste an der linken Schläfe einen dick gepolsterten Verband. Die Haut rund um das Auge spannt und reagiert empfindlich auf die Berührung. Jetzt weiß ich es wieder. Ich weiß, wonach ich suche.
»Können Sie mir sagen, wo meine Kinder sind?« Die Erkenntnis, dass ich sie nirgends sehe, versetzt mein Herz in einen wilden Galopp.
Der Raum krängt, als wären wir bei schwerer See auf einem Schiff. Der Arzt besteht darauf, dass ich mich hinlege, aber mir ist schlecht vor Angst. Wo sind Saskia und Reuben? Warum sind sie nicht hier?
»Sind Sie das?« Der Arzt hält mir etwas hin. Meinen Pass. Durch Tränen hindurch starre ich ihn an. Ausdruckslos starrt mein Gesicht zurück. Und da steht mein Name. Helen Rachel Pengilly.
»Ja. Hören Sie, ich habe zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Wo sind die?«
Statt mir zu antworten, sieht der Arzt nur wieder mit ernster Miene die Schwester an. Sagen Sie nicht, dass die beiden tot sind! Sagen Sie das nicht!
Ich fange an zu hyperventilieren, wie ein Alarmsignal dröhnt mir mein Herzschlag in den Ohren. Als mir schwarz vor Augen wird, holt ein scharfer Geruch mich in den Raum zurück. Riechsalz. Vor mir erscheint ein Becher Wasser. In dem Wasser schwimmen kleine Krümel Schmutz. Jemand sagt, ich solle das trinken, und das tue ich, weil eine innere Stimme mir sagt, wenn du gehorchst, werden sie dir mitteilen, dass Saskia und Reuben am Leben sind. Gebt mir Arsen. Gebt mir einen Krug Öl. Ich trinke es, nur sagt, dass es ihnen gut geht.
Eine weitere Schwester bringt einen klapprigen Rollstuhl. Der Arzt und sie helfen mir aus dem Bett und achten, während ich mich mit zitternden Muskeln auf dem rostigen Ding mit dem heißen Sitzpolster niederlasse, auf den Ständer mit der Infusion. Dann geht es quietschend durch die Station, auf einen schmalen, schwach beleuchteten Korridor zu.
2
Helen
16. August 2017
Es ist das Paradies. Ein geschwungener Streifen weißer Sand, der sich ins funkelnde Karibische Meer wölbt. Daran entlang in angenehm großzügigen Abständen sechs Strandhütten auf Pfählen, jede mit einem eigenen Abschnitt elfenbeinweißen Sandes und knallblauen Wassers. Im Umkreis von zwanzig Meilen keine Menschenseele, abgesehen von den beiden anderen Gruppen, die sich hier einquartiert haben. In einer Hütte fünf Leute aus Mexiko – ich bin nicht sicher, ob es sich um eine Familie oder einfach Freunde handelt; sie sprechen kaum Englisch, und mein Spanisch beschränkt sich auf »Hallo« und »Danke« –, und in der Hütte ganz am Ende Familie MacAdam aus Alabama. Als wir hier neu waren und der Mann uns einen Haufen Fragen stellte, wurde Michael misstrauisch, und in mir regte sich die vertraute Panik; in meinem Kopf erhoben sich wild streitende Stimmen. »Wir bleiben für uns«, sagte Michael leichthin, als wir zu unserer Hütte zurückgingen, aber ich wusste, was er meinte, und für einen schrecklichen Augenblick fühlte ich mich um mehr als zwei Jahrzehnte zurückversetzt. In ein anderes Jahrhundert und eine andere Haut.
Ich mache Kaffee und räume die Schüsseln weg, die auf dem Küchentisch stehen geblieben sind. Saskia und Reuben spielen am Strand; ihr Lachen dringt durch die warme Luft an mein Ohr. Ich fische die beiden Schachteln aus meiner Handtasche, Cilest und Citalopram, drücke je eine Tablette aus den Blisterstreifen und nehme sie, an der Spüle stehend, mit einem Schluck Wasser ein. Normalerweise genügt ein Sonnenstrahl, um mich in einen Krebs zu verwandeln, doch jetzt zeigt mein Spiegelbild, dass ich zum ersten Mal seit ich weiß nicht wann richtig Farbe bekommen habe, einen satten Bronzeton, der mein Gesicht um Jahre jünger macht. Hellblonde Strähnen haben sich in mein Naturblond gemischt und verdecken das Grau, das hier und da schon zu sehen war. Der traurige Zug um die Augen aber – der ist immer da.
Seit zweiundzwanzig Jahren sind wir auf der Flucht, und ich bin müde. Ich wünschte, das würde aufhören, ich möchte Wurzeln schlagen. Für ein Nomadenleben bin ich nicht gemacht, und trotzdem hatten wir in diesen Jahren acht verschiedene Adressen. In Schottland, England, Wales und sogar Nordirland. Wir haben versucht, nach Australien zu ziehen, aber am Ende war es zu kompliziert, die entsprechenden Visa zu bekommen. Wir wählen nicht und haben keine Social-Media-Accounts. Meistens sind wir eine ganz normale Familie. Wir sind zufrieden. Vor vier Jahren haben wir die gewichtige Entscheidung getroffen, nicht mehr zur Miete zu wohnen, und uns zum ersten Mal ein Haus gekauft, ein hübsches Cottage in Northumberland. Wir haben einen Hund und ein Meerschweinchen, und Saskia und Reuben geht es an ihren Schulen prächtig. Und trotzdem denke ich manchmal an Luke. Meine erste Liebe. Gerade in Augenblicken wie jetzt, wenn ich glücklich bin, fällt mir ein, dass ich kein Recht habe, überhaupt da zu sein.
Meinetwegen ist Luke tot.
Während ich mir den Sarong umbinde, stürmt Saskia in die Hütte und schreit: »Mama, das musst du dir ansehen! Komm!«
Sie streckt beide Hände von sich wie ein Pantomime, der eine unsichtbare Wand abtastet. Als ich mich nicht rühre, umfasst sie meinen Arm mit beiden Händen und zieht mich mit erstaunlicher Kraft mit sich.
»Seesterne!«, ruft sie und hüpft die paar Stufen zum Strand hinunter.
»Vorsicht«, sagt Michael, als wir uns in den Sand knien, um sie zu betrachten. Ein Dutzend Tiere, orangefarben, von filigranen Mustern überzogen, jedes einzelne größer als Michaels Hand. Er nimmt eins hoch, doch statt flach auf der Handfläche liegen zu bleiben, beginnt es sich zu winden.
Saskia wippt auf den Zehenspitzen und zeigt hinaus aufs Wasser. »Guckt mal! Da!«
Reuben und ich stehen auf und spähen über die seidige jadegrüne Fläche. Vielleicht sechs, sieben Meter voraus tummeln sich Delfine; blitzend reflektiert ihre silbrige Haut das Sonnenlicht. Wir halten die Luft an. Keiner von uns hat je zuvor einen echten Delfin gesehen.
Saskia ist außer sich. »Ich muss dahin und mit ihnen schwimmen, Mama! Bitte, bitte, bitte!«
»Komm«, sagt Michael und hockt sich vor sie. »Kletter rauf.«
Sie springt auf seinen Rücken, und er watet mit ihr ins Wasser. Ich halte die Luft an. Michael ist trainiert, ein guter Schwimmer. Die Delfine sind zauberhaft, aber das Wasser ist tief, dort draußen lauern tausend Gefahren.
Es wird alles gut gehen. Verdirb es ihnen nicht.
Ich kann nicht hinsehen. Um mich abzulenken, helfe ich Reuben mit seiner Sandskulptur, bis Michael und Saskia lachend aus dem Wasser kommen und die Delfine weitergezogen sind.
Seit zwei Wochen sind wir jetzt hier, und »hier« heißt an der Küste von Belize. Ursprünglich hatten wir vor, in den Ferien eine Mexiko-Rundreise zu machen. In Mexiko City sind wir in einen Bus nach Yucatán gestiegen; die Route führte an einigen atemberaubenden (und kniezermürbenden) Sehenswürdigkeiten vorbei, zum Beispiel den Pyramiden in Teotihuacán, wo Reuben Saskia genüsslich von massenhaften Menschenopfern erzählt hat. Wir haben die steil aufragende Spitze des Popocatépetl gesehen, den Tempel der Inschriften in Palenque, die hübschen bunten Straßen von Campeche und am Ende Cancún.
Reuben hat sich leichter an all das Fremde gewöhnt, als ich es mir hatte vorstellen können. Die Reisegruppe bestand überwiegend aus älteren Paaren, daher war es im Bus ruhig, und dank der Aircondition konnte er die langen Fahrten gut aushalten. Anfangs hatten wir das Problem, dass es keine Pizza gab – das ist normalerweise das Einzige, was er isst –, doch dann haben wir gelernt, mit Tortillas zu improvisieren; flach ausgebreitet und mit Soße und Käse belegt hat er sie akzeptiert.
Wir sind Reuben zuliebe nach Mexiko geflogen. Das haben wir jedenfalls allen erzählt, uns selbst eingeschlossen. Reuben hat in der neunten Klasse eine beeindruckende Projektarbeit über die Mayas abgeliefert, unter anderem ein maßstabgerechtes Modell eines Mayatempels, umgeben von schwarzem Karton, auf den er eine digitale 3-D-Zeichnung projizierte. Wir hatten keine Ahnung, dass er zu so etwas imstande ist, und Michael meinte, wir sollten ihn belohnen. Eine Reise zu den echten Chichén-Itzá-Ruinen schien dafür genau passend, und da wir lange keinen richtigen Familienurlaub gemacht hatten, fanden wir, eine kleine Prasserei sei überfällig. Zugleich habe ich gespürt, dass Michael unruhig wurde, dass er wieder wegwollte. Seit vier Jahren leben wir jetzt in Northumberland. Länger als irgendwo sonst bisher.
Als wir in Chichén Itzá ankamen, blieb Reuben, den Kopf zum Fenster gedreht, lange im Bus sitzen und schaute hinüber zu der grauen Pyramide, die zwischen den Bäumen auszumachen war. Michael, Saskia und ich hielten die Luft an, wussten nicht, ob er gleich losschreien oder den Kopf gegen die Scheibe schlagen würde.
»Soll ich seine Füße machen?«, fragte Michael.
»Die Füße machen« – damit beruhigen wir ihn, wenn er sich wirklich aufregt. Das habe ich zufällig herausgefunden, als er noch ein Baby war; es hat sich an den Abenden entwickelt, wenn ich ihn gebadet und dann auf die Wickelunterlage verfrachtet hatte, um ihn abzutrocknen. Er hob die Beinchen, sodass seine Füße meine Lippen berührten, und ich habe seine Knöchel umfasst und gegen die Fußsohlen geprustet. Das hat gekitzelt, er musste lachen. Als er größer wurde und zunehmend empfindlich auf Geräusche und Unordnung reagierte, haben wir alles Mögliche versucht, um ihn zu beruhigen. Und eines Nachts, als er, vollkommen erschöpft vom Schreien, auf meinen Beinen lag, habe ich seine Schienbeine gestreichelt, immer auf und ab. Allmählich beruhigte er sich, und dann streckte er mir die nackten Füße entgegen. Ich prustete gegen die Sohlen. Er hörte auf zu weinen.
Seitdem »machen« wir, sobald sich ein Wutanfall anbahnt, »die Füße« – die müffelnden Größe-44-Exemplare und behaarten Schienbeine eines Teenagers zu küssen hat nicht ganz den Appeal, den die Babyfüßchen hatten, aber wenn es hilft …
»Ich glaube, es ist alles okay«, sagte ich, nachdem ich Reuben genau beobachtet und die Atmosphäre erspürt hatte. Der Trick ist, sich ihm zu nähern, wie man es bei einem wilden Pferd tun würde. Keine Fragen, kein Theater, selbst wenn er sich in der Öffentlichkeit vollständig auszieht. Obwohl er Michael zu dem Zeitpunkt noch komplett ignoriert hat, konnten wir ihn irgendwie dazu bringen, in Mexiko Shorts anzuziehen (natürlich haben wir dafür gesorgt, dass es blaue Shorts waren). Ich habe versucht, mir einzureden, dass das ein Fortschritt sei. Nach der Sache mit Michael und Joshs Vater war Reuben ausgerastet, hatte geweint und geschrien und sein Zimmer auseinandergenommen. Es war mir gelungen, ihn etwas zu besänftigen, doch er hatte sich zurückgezogen und kein Wort gesprochen. Stattdessen hatte er angefangen, »Papa« auf sein iPad zu schreiben und dann kreuz und quer durchzustreichen, wie um anzuzeigen, dass Michael für ihn gestorben war.
In Chichén Itzá dachte ich tatsächlich, wir könnten all das hinter uns lassen. Reuben schaute erst zu mir, dann zur Pyramide, El Castillo, als könne er nicht glauben, dass das alles real sei, dass er wirklich da war. Ich warf Michael einen Blick zu, um ihm zu bedeuten, dass dies der Augenblick für seine Wiedergutmachung sei. Er drehte sich um und grinste Reuben an.
»Wir sind da, mein Junge. Wir sind wirklich in Chichén Itzá.«
Reuben rührte sich nicht. Null Anzeichen dafür, dass er gern seine Füße hätte streicheln lassen.
»Möchtest du mit mir da hochsteigen?«, fragte Michael sanft.
Er wollte nach Reubens Hand greifen, doch Reuben sprang auf, stürmte mit seinen langen Gräten durch den Gang nach vorn und verließ den Bus.
»Ich gehe«, sagte ich, griff meine Tasche und lief ihm hinterher. Sobald ich ihn eingeholt hatte, legte ich ihm den Arm um die Taille, und wir fielen in Gleichschritt. Er ist erst vierzehn, aber schon über eins achtzig. Ich wünschte, er wäre nicht so groß. Dann würden, wenn er auf meinen Schoß krabbelt, um sich drücken zu lassen, oder irgendwo in der Öffentlichkeit in Tränen ausbricht, nicht so viele Leute glotzen.
»Alles in Ordnung, mein Schatz?«
Er nickte, blickte aber nicht auf. Ich gab ihm sein iPad und ging in bequemem Abstand hinter ihm her, während er losrannte und die gesamte Anlage filmte. Den Rest des Tages verbrachten wir mit den anderen aus unserer Reisegruppe, gingen herum, sahen uns alles an, sagten Reuben wie versprochen jedes Mal Bescheid, wenn wieder eine Stunde um war, sodass er sich auf den Abschied einstellen und mit seiner Trauer darüber etwas besser zurechtkommen konnte. Trotzdem sah ich, als wir in der Abenddämmerung wieder in den Bus stiegen, dass seine Unterlippe zitterte, was mir fast das Herz brach.
Wir fuhren zu dem Hotel in Cancún, und dort fing das Unheil an. Es war einfach zu viel Betrieb. Normalerweise schirmen die Noise-Cancelling-Kopfhörer Reuben ab, sodass er ruhig bleibt, aber die Menschenmassen und die Hitze waren zu viel für ihn. Saskia und ich waren k.o. von der sengenden Hitze und dem Gezänk einiger Ehepaare in unserer Gruppe, und der Guide schien wild entschlossen, mit uns eher Touristen-Nepp-Buden abzuklappern, als uns zu weiteren Ruinen zu führen. In irgendeinem Markt verlor Saskia ihren Teddy, Jack-Jack, und wir mussten einen ganzen Tag lang Souvenirläden danach durchkämmen. Sie hatte Jack-Jack von Geburt an gehabt – ein Geschenk meiner Schwester, Jeannie – und war untröstlich.
Zum Glück haben wir ihn gefunden, aber wir waren uns einig: Der Lärm und die Menschenmengen waren nichts für uns. Also ging Michael online, fand ein kleines Resort in Belize, nicht allzu weit von einer Mayastätte, die sogar noch größer ist als Chichén Itzá, und buchte um. Reuben war begeistert. Wir haben einen Leihwagen genommen, uns von der Gruppe befreit und sind hierhergekommen.
Ich gehe nach drinnen, hole Wäsche aus der Maschine und nehme sie mit in den Garten, um sie aufzuhängen. Michael, noch klatschnass vom Schwimmen, taucht ebenfalls im Garten auf. Er ist in Form wie noch nie, die Arme kräftig und definiert vom Gewichtheben, die Beine muskulös von den Radtouren, die er zum Ausgleich für lange Tage in der Buchhandlung fast jeden Abend unternimmt. Die Sonnenbräune steht ihm, dagegen bin ich mir bei dem Bart, den er sich hat wachsen lassen, noch nicht sicher. Er nennt sich gern einen »alten Sack« (er ist einundvierzig), aber meiner Meinung nach hat er noch nie so gut ausgesehen.
»Wo ist Saskia?« Ich spähe an ihm vorbei zum Wasser, das jetzt aufläuft und Reubens Sandskulptur zunichtemacht.
Er streicht sich das nasse Haar aus dem Gesicht. »Die hab ich allein draußen beim Schwimmen gelassen.«
»Du hast was?« Ich mache einen Schritt nach vorn und suche den Strandabschnitt weiter links ab. Da kommt sie sofort ins Bild; sie ist damit beschäftigt, sich einen Strang Seegras um die Taille zu schlingen, ein Meerjungfrauen-Tutu.
»Ehrlich, Helen«, sagt Michael und grinst. »Du glaubst doch nicht wirklich, dass ich sie da draußen allein lasse?«
Ich gebe ihm einen Klaps auf den Arm. »Dir traue ich alles zu!«
»Au«, sagt er und hält sich den Arm. »Übrigens, ich habe hier in dem Schuppen etwas gefunden. Komm, sieh’s dir an.«
Er geht auf den Plastikverschlag zu, den ich zunächst für die Zisterne gehalten hatte, und öffnet die Türen. Zum Vorschein kommt ein Schrank, bis obenhin vollgestopft mit Beach Boards, Keschern und Surfbrettern. Michael holt ein Bündel aus dickem Baumwollstoff heraus und untersucht es.
»Sieht nicht gerade wasserfest aus. Was schätzt du, was das ist?«
Wir rollen es auseinander, fassen jeder ein Ende und erkennen eine Hängematte. Michael nickt in Richtung der Palmen hinter mir und sagt, ich soll das eine Ende am dicksten der Stämme befestigen, während er die andere Seite an einem Baum in der entgegengesetzten Richtung vertäut. Praktischerweise finden wir an zwei Stämmen Metallhaken, an denen offenbar schon frühere Gäste die Hängematte fixiert haben.
»Kletter rein«, sagt er, als wir fertig sind.
Ich schüttele den Kopf. Meine Sorge ist, dass ich zu schwer sein könnte. Ich habe mich seit fast einem Jahr nicht mehr gewogen, aber als ich es – unter Protest – das letzte Mal getan habe, waren es über achtzig Kilo, eine unglückliche Nebenwirkung der langfristigen Einnahme von Antidepressiva. Ich bin eins achtzig groß, sodass es sich verteilt, wobei das, was ich zugenommen habe, vor allem auf der Gürtellinie zu sitzen scheint.
»So geht gutes Leben«, sagt Michael und klettert in die Hängematte. Dann, als er sieht, dass ich den Plastikschrank aufräume, ruft er: »Helen. Komm. Hier. Rein.«
Die Hängematte gibt nach, als ich mich neben ihn lege, fast schleift sie auf dem Boden, aber sie hält.
»Siehst du?« Michael schiebt einen Arm unter meinen Nacken und zieht mich an sich. Seine Haut ist immer noch nass.
Einen Augenblick lang hört man nichts als das Rascheln der Palmwedel im Wind und Saskias leises Singen. Ich unterdrücke den Impuls, aufzustehen und nachzusehen, ob mit ihr alles in Ordnung ist und ob Reuben noch mit dem iPad auf der Terrasse sitzt.
»So ist’s gut«, sagt Michael und drückt mir einen Kuss auf den Kopf. Er hat die Arme um mich geschlungen und die Hände verschränkt, und seine Brust hebt und senkt sich mit den Atemzügen, die langsam gleichmäßiger und tiefer werden. Wie lange haben wir schon nicht mehr so dagelegen? Es fühlt sich gut an.
»Vielleicht sollten wir hierherziehen«, sagt er.
»Na klar.«
»Im Ernst. Du könntest die Kinder zu Hause unterrichten.«
»Hm. Davon müsstest du mich erst mal überzeugen. Und was würdest du machen? Eine Bücherhütte bauen?«
»Keine schlechte Idee. Ich könnte unser Jäger und Sammler sein. Ich würde bestimmt einen guten karibischen Survival-Helden abgeben, so à la Bear Grylls. Den Bart hab ich ja schon.«
»Bear Grylls hat keinen Bart, Dummkopf.«
»Dann eben Robinson Crusoe.«
Ich fahre mit der großen Zehe seinen Fuß entlang. »Ach, wenn das ginge.«
»Warum soll es denn nicht gehen?«
»Mein Gott, wenn wir das Geld hätten, würde ich sofort hierherziehen.«
»Hier ist es billiger als in England. Wir könnten Touristen Bootstouren anbieten und damit Geld verdienen.«
»Erzähl nicht solchen Quatsch.«
»Das ist kein Quatsch …«
»Wir sprechen beide kein Wort Spanisch, Michael.«
»Buenos días. Adiós. Por favor. Siehst du? Im Grunde fließend.«
»Idiot.«
»Außerdem sprechen sie hier sowieso Belize-Kriol.«
»Das können wir genauso wenig …«
»Belize war britische Kolonie und gehört zum Commonwealth. Wir würden wahrscheinlich noch nicht mal ein Visum brauchen.«
»Und was wird aus unserem Haus? Und, na ja, meiner Arbeit?«
»Du beklagst dich doch immer, wie sehr das Unterrichten dich nervt.«
Das trifft mich. Ich unterrichte gern, und die Schüler liegen mir wirklich am Herzen … aber ja, es ist nicht das, wovon ich geträumt habe. Eher bin ich da irgendwie reingerutscht, und als mir aufging, dass die Arbeitszeiten sehr familienkompatibel sind, musste ich nicht länger darüber nachdenken. Ich könnte jetzt anführen, dass es mit seiner Buchhandlung das Gleiche ist – er hat nicht davon geträumt, aber sie füllt ihn einigermaßen aus, hilft uns die Rechnungen zu bezahlen und lässt sich mit unserem Leben mit den Kindern ganz gut vereinbaren.
»Ein Urlaub ist das eine, hier zu leben wäre etwas ganz anderes«, sage ich und erinnere ihn an das Gespräch, das wir mit der Frau im Reisebüro zu der Tour durch Zentralamerika hatten. Da heißt es vorsichtig sein. Im Regenwald lauern viele Gefahren. Jaguare, Schlangen, Pumas.
»Was meinst du denn, wozu ich da bin?«, fragt er. »Ich bin euer Beschützer.«
Ich verdrehe die Augen. »Das möchte ich sehen: wie du deine Buchhandlung im Stich lässt. Das bringst du nicht fertig, und wenn sie zehnmal abgebrannt und zu Asche zerfallen ist.«
Das ist mir herausgerutscht, bevor ich mich bremsen und den Mund halten und es in der Kiste mit den unaussprechlichen Dingen verschließen konnte. Die Buchhandlung. Den ganzen Urlaub über haben wir noch kein einziges Mal darüber gesprochen. Kein Wort über das Feuer, das Michaels schöne Buchhandlung verschlungen hat. Eigenhändig hatte er sie aus dem Nichts erschaffen, und sie war schnell zu einer der besten unabhängigen in der Region avanciert. Ein drei Etagen umfassendes Mekka für Bücherwürmer, das Schmuckstück unserer Stadt – nun eine Ruine, schwarz verkohlt. Für einen schlimmen Augenblick bin ich zurückversetzt in jene Nacht, in der wir die Flammen in den schwarzen Himmel steigen sahen.
Das Telefon holte uns aus dem Schlaf. Mr Dickinson, der Inhaber der Tierhandlung ein paar Türen weiter. Er hatte Rauch über der Straße gesehen und war hingefahren, um nach seinem Laden zu schauen. Nun wollte er die Feuerwehr rufen, aber auch uns verständigen. Wir sind sofort losgefahren, beide in dem Glauben, dass wir das Feuer in den Griff kriegen würden, dass wir es mit den Feuerlöschern, die Michael in den Kofferraum geworfen hatte, selbst würden löschen können. Als wir ankamen, kroch bereits Rauch unter der Ladentür hervor, und hinter den Fenstern im ersten Stock tanzten orangerote Flammen. Michael machte sich daran, die Tür aufzuschließen, doch ich packte ihn am Arm.
»Geh nicht da rein«, sagte ich. Er ignorierte mich. Wild entschlossen, die Flammen zu ersticken, stieß er die Tür auf. Hilflos sah ich zu, wie er mit den Feuerlöschern ins Innere und die Treppe hinaufstürmte. Dicker schwarzer Qualm drängte sich ihm entgegen bis ins Erdgeschoss, und ich hörte das Knacken und Knistern von oben, wo das Feuer das Café zerstörte, die schönen Sofas und Tische fraß, die wir gerade erst hingestellt hatten. Von fern tönten die Sirenen der Feuerwehr. Ich bedeckte meinen Mund mit der Hand, um keinen Rauch einzuatmen, doch es wurde mit jeder Sekunde mehr, und meine Lunge gierte nach frischer Luft. Ich konnte Michael nicht rufen. Er war immer noch im ersten Stock, und zu meinem Entsetzen sah ich oben an der Treppe Flammen.
Gerade als ich dachte, ich müsse hochlaufen und ihn dort wegholen, tauchte er auf. Ein paar Bücher an die Brust gepresst und nach Atem ringend, taumelte er die Stufen herunter. Unten angelangt, ließ er die Bücher fallen und sank in meine Arme.
Der Laden war zerstört, unsere Lebensgrundlage vernichtet. Irgendein freundlicher Fremder richtete einen Spendenfonds ein, und innerhalb weniger Wochen hatten wir elftausend Pfund zusammen. Möglicherweise genug, um wieder eine Grundlage zu schaffen und einige Gläubiger zu bedienen, aber es bleiben die Raten für den Kredit, der Einkommensverlust … Die Versicherung ist noch damit beschäftigt, festzustellen, wie das Feuer entstehen konnte.
Die Stimmung ist verdorben. Ich versuche mir etwas einfallen zu lassen, das sie wieder umschlagen lässt in jene herrliche Leichtigkeit, die wir hatten, seit wir hier angekommen sind. Mir wird klar, warum wir hier nie über das Feuer geredet haben: Der Gegensatz zwischen diesem himmlischen Ort und dem tristen, eisigen Northumberland ist so krass, dass man das Gefühl hat, in einer anderen Welt zu sein. Hier gibt es nichts, das einen an alles erinnert. Aber das Schweigen ändert nichts. Wir wissen beide, dass wir zurückfliegen und uns den Dingen stellen müssen.
»Ich hätte Überwachungskameras anbringen sollen«, sagt er leise. »Alle haben das gesagt, aber ich war zu faul.«
»Es gibt keine Garantie dafür, dass die irgendwas eingefangen hätten«, gebe ich zurück und denke daran, wie wir, von Kopf bis Fuß mit Ruß beschmiert wie Schornsteinfeger, schockstarr auf der Feuerwache saßen. Schroff klärte der stellvertretende Leiter der Wache uns über mögliche Brandursachen auf: Sonnenstrahlen, die von einem Spiegel reflektiert wurden und auf Zeitungspapier trafen, hatten ein schottisches Schloss aus dem 16. Jahrhundert zu Asche gemacht. Einem Haarglätteisen, das auf dem Schminktisch eines Teenagers zu nahe beim Laptop gelegen hatte, waren gleich mehrere Reihenhäuser zum Opfer gefallen. Unser Feuer konnte auf einen defekten Nachtspeicherofen oder ein loses Kabel zurückzuführen sein.
»Die Kameras hätten festgehalten, wer das Feuer gelegt hat«, sagt Michael, schwingt die Beine über den Rand der Hängematte und bleibt aufrecht sitzen.
Ich strecke die Hand aus und fahre ihm über den Rücken. Schaudernd denke ich daran, wie die Polizei uns zu getrennten Vernehmungen bestellt hatte. Sie wollten wissen, ob jemand etwas gegen uns haben könnte. Ob wir einen Kunden verärgert oder eine Angestellte rausgeworfen hätten. Ein paar Wochen vorher hatte ich Michael dazu gebracht, eine von unseren Teilzeitkräften zu feuern, Matilda. Sie tut gar nichts, hatte ich gemeckert. Dir selbst zahlst du schließlich so gut wie kein Gehalt. Die Buchhandlung ist kein Wohltätigkeitsverein für faule Achtzehnjährige, die den ganzen Tag nur herumsitzen und Tolkien lesen.
Michael hatte darauf hingewiesen, dass sie Arnolds Tochter ist, und Arnold war der Erste, der ihm geholfen hat, als er mit der Buchhandlung anfing, aber am Ende hatte ich gewonnen. Matilda hat sich nur vage dazu geäußert, wo sie war, als das Feuer ausbrach – ihre Eltern bestätigten, dass sie nicht zu Hause war, und am Ende kam heraus, dass sie bei einem Jungen war. Aber ein paar schreckliche Tage lang sah es so aus, als könnte Matilda für das Feuer verantwortlich sein.
»Brandstiftung ist nie ausgeschlossen worden«, sagt Michael, als ich ihn daran erinnere, dass Matilda sich als unschuldig erwiesen hat. »Solange die Untersuchung nicht abgeschlossen ist, liegt noch alles im Bereich des Möglichen.«
»Vielleicht waren es Kinder, die irgendwelchen Unfug gemacht haben«, sage ich zu seinem Rücken. Ich möchte so sehr, dass er sich wieder zu mir legt, dass es wieder so paradiesisch ist wie vorhin.
»Wir wissen beide, dass nicht Kinder das Feuer gelegt haben«, brummt er und steht auf.
»Michael?«
Sein Ton erschreckt mich. Er kehrt in die Hütte zurück. Ich schaue ihm hinterher und spüre seine Erschöpfung. Die Sorgen machen ihn dünnhäutig. Wenn wir doch darüber reden könnten! Aber es ist immer das Gleiche: Sobald wir im Gespräch etwas tiefer schürfen, geht er einfach weg.
3
Michael
28. August 2017
Wir haben eine Meuterei.
»Können wir bitte hierbleiben, Papa?«, jammert Saskia in der Küche, während ich Frühstück mache. Früh am Morgen hat der Butler (ja, ein echter Butler – ich komme mir vor wie ein Kardashian) unser Lebensmittelpaket vorbeigebracht: Waffeln (rund, damit wir Reuben erzählen können, dass es Pizzas sind), Ahornsirup, Kokosnüsse, Drachenfrüchte, frisches Brot, Eier, Salat, Blaubeerpfannkuchen, eine Ananas, den leckersten Bacon, den ich je im Leben gegessen habe, und eine Flasche Wein.
»Tut mir leid, Süße«, sage ich, lege ein paar Waffeln zum Aufbacken auf ein Kochfeld und nehme Saskia in den Arm. Sie duftet nach Sonne und Meer. »Den Flug werden wir nicht umbuchen können, fürchte ich. Wir haben noch heute und morgen, und dann fahren wir nach Mexiko City. Von dort fliegen wir nach Hause.«
»Aber Papaaa, ich will nicht nach Hause. Und Jack-Jack auch nicht.«
»Hm.« Ich gebe die Waffeln auf einen Teller. »Es will also niemand nach Hause? Was meinst du denn, was wir stattdessen machen sollen?«
Wenn sie nachdenkt, sieht sie genau aus wie Helen. Sie zieht genauso die Nase kraus, als würde es komisch riechen. Überhaupt ist sie ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten. Die gleichen blitzenden blauen Augen, die alles offenbaren und jedes kleine Detail erfassen. Das gleiche Grübchen in der linken Wange und schulterlange blonde Locken.
»Können wir nicht einfach hier ein Haus kaufen?«
»Da würdest du ja niemanden mehr treffen können. Und Jack-Jack auch nicht.«
Sie gibt einen theatralischen Seufzer von sich, ganz der genervte Teenie. »Und wen genau würde ich nicht treffen können?«
»Na ja, Amber und Holly. Sie würden dich vermissen. Und ich wette, Oreo kann es gar nicht erwarten, dich wiederzusehen …«
»Aber sie können doch herkommen …«
»Und was ist mit deinen Ballettstunden?« Darauf hat sie keine Antwort parat, und ich weiß, wie wichtig ihr das Ballett ist. Ich stelle ihr den Teller mit den Waffeln auf den Tisch und hocke mich hin, um mit ihr auf Augenhöhe zu sein, während sie ein paar Ballettpositionen durchgeht.
»Ehrlich gesagt, meine Süße, ich möchte auch nicht nach Hause.«
Sie reißt die Augen auf. »Nicht?«
Ich presse die Lippen aufeinander und schüttele den Kopf. »Aber verrat es nicht Mama.«
»Weil du das Haus hier magst und das Meer und weil du für immer hierbleiben willst?«
»Genau. Ich bin lieber den ganzen Tag am Strand, als arbeiten zu gehen. Von mir aus könnte es immer so sein. Findest du nicht auch?«
Sie nickt eifrig. Ihre Miene hat sich aufgehellt; sie strahlt vor Hoffnung. Ich möchte ihr die Welt zu Füßen legen. Eine perfekte Welt, wie sie sie verdient.
»So, und jetzt hilf mir mal, die ganzen Lebensmittel wegzuräumen.«
Sie dreht eine kleine Pirouette, die Arme zu einem Bogen geformt, als halte sie einen großen Wasserball, und wirft einen Blick in die Kiste, die ich nach und nach leere.
»Bacon?« Sie hält die Packung hoch wie eine tote Ratte.
»Nicht für dich, Süße. Der wird Reuben und mir schmecken.«
»Bacon ist noch nicht mal lecker, Papa«, sagt sie. Sie hat sich entschieden, Vegetarierin zu sein, wie Helen, und so höre ich seit einem Vierteljahr immer nur Sprüche in der Art, dass Fleisch Teufelszeug sei. »Ich habe mal welchen gekostet, und er hat nicht geschmeckt. Außerdem ist er von Schweinen, und die sind viel klüger als Hunde, und unseren Hund würdest du ja auch nicht essen, oder?«
»Hm. Ach, weißt du, wenn er wie Bacon schmecken würde, würde ich mir das überlegen.«
»Papa!«
Ich beuge mich vor und gebe ihr einen Kuss. Noch küsst sie mich auf den Mund, gibt mir einen kleinen Schmatz mit einem lauten »Muah« hintendran, wie sie es als Kleinkind gemacht hat. An dem Tag, an dem sie erklärt, sie sei zu alt, um mir noch einen Kuss zu geben, wird mir das Herz brechen.
»Mach mal das«, sagt sie, als ich eine Pfanne mit einem Blaubeerpfannkuchen auf den Herd stelle. »Wirf ihn hoch, Papa! Na los!«
Als die Pfanne heiß genug ist, stelle ich mich schön breitbeinig hin, packe den Pfannenstiel und lasse den Pfannkuchen fliegen, so hoch es nur geht. Er klatscht gegen die Decke, dreht sich in der Luft und landet wieder in der Pfanne.
»Du hast’s geschafft!«, jubelt sie und gibt mir High five. »Fünf Punkte für Gryffindor!«
Reuben kommt herein, sein dunkles Haar und die Shorts sind tropfnass. Wenn er in der Nähe ist, verhalte ich mich ruhig. Kein Blickkontakt. Noch bin ich bei ihm schlecht angeschrieben. Er lässt einen Plastikeimer auf den Boden plumpsen.
»Wir können nicht nach Hause«, verkündet er ungerührt.
»Papa hat den Pfannkuchen an die Decke geworfen!«, erzählt Saskia.
»Fünf Punkte für Gryffindor«, sagt Reuben todernst. »Guckt mal, was ich gefunden habe.«
Saskia späht in den Eimer und kreischt auf. Ich sage, sie soll still sein und Reuben nicht durcheinanderbringen, aber seine ganze Aufmerksamkeit ist bei dem Schildkrötenbaby. Der Kopf ist so groß wie meine Daumenkuppe, der Panzer von Zickzackmustern bedeckt. Es bewegt die kleinen Paddelbeine vor und zurück, als wolle es davonschwimmen.
»Wir müssen es wieder ins Wasser bringen«, sage ich, als Saskia das Tier aus dem Eimer holt und an ihre Brust drückt. »Seine Mama sucht bestimmt schon nach ihm.«
»Wie in Findet Nemo?«
»Das war ein Clownfisch«, wirft Reuben ein.
»Dude«, sage ich wie die große Meeresschildkröte in Findet Nemo, »was ist los?«
Reuben verfällt in Schweigen, und ich erstarre. Zwei Reaktionen sind möglich: Entweder stürmt er nach draußen, oder er verpasst mir eine Ohrfeige. Er wird nicht oft grob, aber wenn, dann richtig, denn er hat die Maße und verfügt über die Kräfte eines Erwachsenen. Er schaut drein, als denke er sehr ernsthaft nach. Vielleicht versucht er seine Wut in den Griff zu kriegen.
»Los, los, los!«, ruft er plötzlich, und ein breites Grinsen hellt seine Züge auf.
»Fische sind Freunde«, sage ich, froh, dass ich Findet Nemo zehntausendmal gesehen habe.
Dann schaue ich zu Helen, die mit offenem Mund und weit aufgerissenen Augen dasteht, fassungslos, dass Reuben tatsächlich mit mir gesprochen hat, und hebe Schultern und Brauen. Er kann verzeihen, er liebt mich, aber nach dem, was vor Joshs Geburtstagsfeier vorgefallen ist, war seine Reaktion wenig überraschend.
Ich wollte ihn nur beschützen. Das ist meine Aufgabe. Mein einziger Lebenszweck.
Als ich erwache, sitzt Helen, in ein gelbes Badetuch gewickelt, auf der Bettkante. Sie befindet sich außerhalb des Moskitonetzes, aber ich sehe ihr goldblondes Haar, den Zopf, der ihr über den Rücken hängt, das Tattoo auf ihrer Schulter, ein filigranes keltisches Muster, in dem schwachen Licht gerade so zu erkennen. Überrascht, dass ich tatsächlich geschlafen habe, setze ich mich auf, und sie sagt, ich soll mich beruhigen, alles ist okay, aber ich bin schweißgebadet, und mein Herz rast. Ich habe geträumt. Grelle Bilder schwappen mir durch den Kopf wie eine bunte Suppe. Als ich Helen genauer anschaue, sehe ich ihre besorgte Miene.
»Alles in Ordnung?«, fragt sie. »Wieder schlecht geträumt?«
Ich presse mir Daumen und Zeigefinger gegen die Augen, versuche, die verstörenden Bilder auszulöschen. Seit Jahren der immer gleiche Traum. Eine Tür aus Feuer. Ich stehe davor und weiß, dass ich sie öffnen muss, denn dahinter ist das Paradies, ein Land reiner, endloser Glückseligkeit. Manchmal bin ich allein. Manchmal sind Helen und die Kinder bei mir, und ich muss sie durch diese Tür bringen, habe aber Angst, dass sie sich verletzen könnten. Jedes Mal wache ich schweißgebadet auf. Schlaftabletten hatten das alles weggespült, aber nun ist es wieder da. So plastisch wie eh und je.
»Ich war schwimmen«, flüstert sie.
Ich nehme ihre Hand. Was ist los? Sie wirkt aufgewühlt. »Alles okay?«
»Ich hab was Komisches gesehen. Wahrscheinlich war es ja gar nichts. Ich weiß nicht.«
»Du hast was Komisches gesehen. Wo? Im Wasser?«
Sie nickt und hält den Finger an die Lippen. »In der Hütte nebenan. Da steht ein Teleskop. So eins, wie wir im Wohnzimmer haben.«
Ein Teleskop? Ach ja, das Teil auf dem Dreifuß, das wir in die Ecke geschoben haben, damit die Kinder es nicht umstoßen. Wir haben angenommen, dass man damit Haie oder Rochen beobachten kann.
»Und?«
»Es war auf unsere Hütte gerichtet.«
»Was?«
»Das Teleskop.« Sie schüttelt sich kurz. »Unheimlich …«
»Aber … hat der Butler nicht gestern noch gesagt, die anderen Hütten sind alle leer?«
Sie kaut auf der Unterlippe. »Das ist es ja. Ich habe noch auf der anderen Seite zum Fenster reingeschaut. Das Bett war nicht gemacht, und auf dem Boden lagen Klamotten. Es sah sehr wohl so aus, als würde da jemand wohnen.«
»Vielleicht hat eine Gruppe verlängert? Oder eine Last-minute-Buchung?«
»Aber warum richten die ihr Teleskop auf unsere Hütte?« Sie ist den Tränen nahe, sie hat Angst. »Als ob uns jemand beobachtet.«
Ich verspreche, nachsehen zu gehen, und wenn ich ehrlich bin, beunruhigt mich, was sie erzählt. Das Feuer war kein Unfall, das weiß ich, aber ich will es Helen gegenüber nicht so deutlich sagen. Wir sind vor unserer Abreise beobachtet worden. Kurz vor dem Brand habe ich einen Typen gesehen, der die Buchhandlung im Visier hatte. Eine Woche lang immer dasselbe Auto vor der Tür. Und dann ist er mir bis nach Hause gefolgt. Das konnte ich der Polizei natürlich nicht sagen. Sie hätten zu viele Fragen gestellt. Warum sollte jemand Sie beobachten? Deshalb habe ich darauf gedrängt, dass wir weit wegfliegen und ausgiebig Urlaub machen. Um Zeit zum Nachdenken zu gewinnen.
Ich kann nicht rückgängig machen, was mit Luke geschehen ist. Ich kann sie nicht daran hindern, unsere Familie zu verfolgen. Aber ich kann mir eine Möglichkeit überlegen, uns zu schützen.
Schlafen geht nicht mehr. Nicht weiter ungewöhnlich, nur bin ich heute besonders aufgedreht, alle meine Sinne sind hellwach. Ich habe gelernt, mit vier Stunden pro Nacht auszukommen; wenn ich hin und wieder noch tagsüber ein Nickerchen mache, halte ich durch. Viermal die Woche stelle ich mir den Wecker auf drei und stehe auf, um mich in Form zu halten. Montags und donnerstags Arme und Bauchmuskeln, dienstags und freitags fünfzehn Kilometer laufen. Danach lese ich, bearbeite Mails, räume vielleicht ein bisschen auf oder mache einen Spaziergang. Nicht weit von unserem Haus gibt es einen schönen Leinpfad, von dem aus man bei Sonnenaufgang jede Menge Wildtiere beobachten kann: Otter, Füchse, Igel. Ich habe wiederholt versucht, die Kinder zu überreden, dass sie einmal mitkommen, aber sie sind beide keine Morgenmenschen.
Hier ist es mit den Wildtieren natürlich etwas ganz anderes. Obwohl wir über einen Kilometer vom Regenwald entfernt sind, entdecke ich in einem der Bäume neben unserer Hütte einen Affen. Er bedient sich an der Kokosnuss, und dann findet er eine halb leere Tüte Chips, die eins der Kinder auf der Terrasse hat liegen lassen. Ich filme die Szene mit dem Handy. Er ist direkt vor mir, so nahe, dass ich ihn berühren kann. Kein bisschen ängstlich. Ich stelle meine Cola-Dose ab, um ihn zu streicheln. Erstaunlicherweise lässt er das zu, dann schnellt sein Arm vor, er schnappt sich die Cola und rennt weg. Kleiner Mistkerl.
Ich schiebe die Hände in die Taschen und unternehme einen Spaziergang, folge der Böschung bis hinauf zu der Straße, die alle Hütten miteinander verbindet. Die Familie aus Alabama ist abgereist – die sind wir los. Zu viele Fragen nach unserem Woher und Wohin und weshalb wir hier sind. Eins ihrer Kinder, ein Mädchen, hat das Gesicht verzogen, als es Reuben sah, und gefragt: »Warum bist du so verrückt?« Ja, sicher, sie ist ein Kind, aber die Eltern haben sie nicht gebremst, haben ihr nicht sanft zu verstehen gegeben, dass sie nicht so unhöflich sein soll. Stattdessen haben sie gelacht.
An der Straße steht kein Auto, was bedeutet, dass in den Hütten keine anderen Gäste sind. Wieso hat Helen dann in einem Schlafzimmer Klamotten auf dem Boden liegen sehen? Hier ist im Umkreis von dreißig Kilometern nichts als Regenwald. Vielleicht hat jemand sich absetzen lassen. Vielleicht sind die Leute aus der Hütte auch zu einem Tagesausflug unterwegs. Die Ferienzeit ist allerdings so gut wie zu Ende. Das hat jedenfalls Kyle gesagt.
Ich gehe auf dem Sand weiter, meine Augen gewöhnen sich an die Dunkelheit. Der Mond ist heute besonders hell, eine lange silbrige Bahn aus Licht auf dem glatten, schieferschwarzen Meer. Vorsichtig umrunde ich die Hütte, bis ich am Wohnzimmerfenster stehe; dort drinnen mache ich die Umrisse des Teleskops aus, das nicht zur See gerichtet ist, sondern auf unsere Hütte, wie Helen gesagt hat. Natürlich könnte es auch einfach auf das nördliche Ende der Bucht gerichtet sein. Schwer zu sagen. Die Delfine mögen diesen Teil der Bucht, also ist es gut möglich, dass die Leute hier sie beobachtet haben … Die anderen Fenster befinden sich auf der Rückseite, aber es ist zu dunkel, um im Innern etwas erkennen zu können. Nirgends ist Licht. Die Wedel der Palmen bewegen sich sanft im Wind, das Wasser kommt und geht mit dem immer gleichen leisen Keuchen. Keine Bewegung, kein Hinweis darauf, dass hier jemand wäre.
Nach zehn Minuten gehe ich wieder rein.
Der Butler kommt in der Morgendämmerung. Helen und die Kinder schlafen noch tief, daher presse ich den Finger an die Lippen, als er die Kiste für heute bringt.
»Ich habe Pizza gefunden«, flüstert er. »Für Ihren Sohn. Ich kann nicht versprechen, dass sie nicht ein bisschen anders schmeckt, aber es ist Pizza.«
»Das ist sehr nett.« Ich fische eine Zehndollarnote aus der Hosentasche und stecke sie ihm zu. »Reuben wird begeistert sein.«
Er grinst, steckt das Geld ein und wendet sich zum Gehen, aber ich stelle rasch die Kiste ab und laufe ihm nach.
»Sie können mir nicht zufällig sagen, ob da jemand eingecheckt hat?« Ich nicke in Richtung der Hütte nebenan.
Er überlegt und schüttelt den Kopf. »Im Moment sind nur Sie und die andere Familie da.«
»Eine andere Familie? In welcher Hütte?«
Er dreht sich um und zeigt ans andere Ende der Bucht. »In der allerletzten, kurz bevor der Strand endet. Hat es Ärger gegeben?«
»Nein, nein, überhaupt nicht. Trotzdem danke.«
Gegen acht finde ich Helen im Bad, wo sie gerade ihren Zopf flicht, und präsentiere ihr mit einem Kuss das Frühstückstablett. Dann wecke ich die Kinder. »Zieht euch an«, sage ich. »Heute machen wir unsere Meeressafari.«
»Meeressafari?«, fragt Sas, der die Haare zu Berge stehen, als hätte sie die Finger in der Steckdose. Sie springt aus dem Bett und schält sich aus dem Schlafanzug.
»Du musst dein Cape mitnehmen«, sage ich.
»Wird es denn regnen?«
»Nein, aber es könnte sein, dass die Delfine Wasser ins Boot spritzen. Wenn sie springen, du weißt schon.«
Sie stößt einen Jubelschrei aus und schlingt mir die Arme um die Taille. »Ich bin soo aufgeregt, Papa!«
Die Fahrt auf dem etwa sechs Meter langen Segler dauert eine Stunde. Reuben und Saskia habe ich gesagt, sie sollen unten in der Kajüte bleiben, wo sie gemütlich sitzen und einen Snack knabbern können, aber ich musste versprechen, dass ich sie rufe, sobald ich auch nur die kleinste Flosse entdecke.
Nach einer halben Stunde kommt Helen und stellt sich zu mir, fährt mir ein paarmal über den Rücken und lehnt den Kopf an meine Schulter.
»Du warst wieder die ganze Nacht auf, oder?« Sie seufzt.
»Nein.«
»Lüg nicht …«
»Ich dachte nur, ich hätte was gehört, weiter nichts.«
Sie lehnt sich zurück und mustert mich besorgt. »Du brauchst dir keine Gedanken zu machen. Ich hätte das mit dem Teleskop gar nicht erwähnen sollen. Wahrscheinlich war ich ein bisschen paranoid nach …«
Sie verstummt.
»Nach was?«
Jetzt senkt sie den Blick. Als sie ihn wieder hebt und mich anschaut, liegt um ihre Augen ein harter Zug. Und noch etwas anderes. Frustration. »Ich muss dich etwas fragen«, sagt sie und verschränkt die Arme, »und wenigstens dieses eine Mal sollst du der Frage nicht ausweichen.«
»Okay.«
Mit einem tiefen Atemzug wappnet sie sich. »Als du Joshs Vater angegriffen hast …«
»Ich habe ihn nicht angegriffen. Es war eine Meinungsverschiedenheit …«
Sie hebt eine Hand, um mich zum Schweigen zu bringen. »Als du ihn angegriffen hast. Du hast gesagt, es sei dir nur um Reuben gegangen. Ich weiß bis heute nicht, was du damit gemeint hast.«
Darüber will ich nicht reden. Ich schaue mich um, suche nach einem Ausweg. Den gibt es nicht, es sei denn, ich entschließe mich, zurück an Land zu schwimmen. Wir sind mindestens fünfzehn Meilen weit draußen. Dafür reicht auch meine Kraft nicht.
»Ich habe Reuben beschützt«, sage ich schließlich.
»Vor was denn beschützt?«
»Die Feier sollte nicht in einer Kletterhalle stattfinden«, erkläre ich und hoffe, ein für alle Mal damit abschließen zu können. »Joshs Vater wollte mit den Jungs in die Simonside Hills …«
»Und?«
Langsam werde ich sauer. Warum müssen wir jetzt und hier über diese Geburtstagsfeier reden? »Ich habe gesehen, dass Reuben deswegen unruhig war. Hör zu, ich hab dir das schon mal gesagt: Es war nicht in Ordnung von Joshs Vater, dass er …«
»Dass er was?«
Unsere Blicke begegnen sich. Sie fordert mich heraus.
»Dass er … dass er Reuben in eine Situation gebracht hat, in der er sich entscheiden musste, ob er bei seinem Freund bleiben oder sich sicher fühlen wollte.«
Sie runzelt die Stirn. »Aber warum …?«
»… und glaub mir, ich habe alles versucht, damit es kein Drama gibt. Du warst nicht dabei. Reuben war kurz vorm Durchdrehen, ich hab’s an seinem Blick gesehen. Und der Typ hat ständig über seinen Kopf hinweggeredet. Das hat ihn erst recht aufgeregt.«
Sie schweigt.
»Joshs Vater hat einfach kein Nein akzeptiert. Okay, ihm eine reinzuhauen war vielleicht ein bisschen drüber, aber ich konnte nicht anders …«
Stirnrunzelnd sieht sie mich an. »Ein bisschen drüber? Du hast ihn bewusstlos geschlagen.«
»Der Schlag ist etwas verunglückt«, sage ich und spüre ein Brennen im Magen. Es lässt sich nicht hinunterschlucken. »Ich habe gesagt, dass es mir leidtut. Was willst du noch?«
Jetzt ist sie beleidigt. Das wollte ich nicht, also strecke ich die Hand aus und greife nach ihrer.
Eine Weile stehen wir einfach nur da, schweigend und jeder auf seine Weise verletzt. Wir wollen beide das Gleiche, beschreiten aber unterschiedliche Wege. Ich gebe oft eher den Bad Cop. Helen ist immer noch sauer, weil die Sache zur Folge hatte, dass Reuben seinen einzigen Freund verloren hat, Josh. Netter Kerl. Autist wie er. Jahrelang haben wir darauf gewartet, dass Reuben einen Freund findet. Jahre ohne eine einzige Einladung zu einer Geburtstagsfeier, ohne eine Spielverabredung. Und dann findet er endlich jemanden, und ich mache alles kaputt, indem ich dem Vater des Jungen einen Fausthieb verpasse.
Aber ich konnte nicht anders, es musste sein. Am Ende hat doch alles seinen Preis.
Und dann sind sie plötzlich da, keine zehn Meter vom Boot entfernt. Wale so groß wie Busse. Helen entdeckt sie zuerst und rennt los zur Kajüte, um den Kindern Bescheid zu sagen. Als sie an Deck auftauchen, hat der Kapitän schon den Motor ausgemacht. Sas quiekt bei ihrem Anblick und hüpft wild auf und ab, während Reuben in die Hände klatscht und immer wieder ruft: »Magie! Magie!« Zu mir sagt der Kapitän mit sorgenvoller Miene, dass es ein schlechtes Zeichen sei, wenn es hier Buckelwale gebe, noch dazu in dieser Jahreszeit. Die Tiere könnten krank sein, vielleicht auch sterben. Natürlich verliere ich darüber den Kindern gegenüber kein Wort. Wir sind so nahe dran, dass wir die Seepocken auf ihrem Rücken erkennen können, lange Linien weißlicher Punkte den ganzen Leib entlang. Ihr Maul pflügt durchs Wasser. Weiter draußen durchbricht einer die Wasseroberfläche, schießt ein Stück hoch, klatscht unter gewaltigem Spritzen wieder auf und taucht unter, wobei seine Schwanzflosse noch wie ein Peace-Zeichen in die Höhe gereckt bleibt.
»Guck, wie fröhlich sie sind, Papa!«, ruft Saskia, und ich stimme ihr zu, weil lieben manchmal auch heißt zu lügen.
»Michael. Michael! Wach auf!«
»Was? Was ist los?«
Ich setze mich auf, mir dreht sich der Kopf. Kaum zu glauben, dass ich geschlafen habe. Das Fenster zeigt ein Viereck lapislazuliblauen Himmels mit unzähligen Sternen und einem silbrigen Mond. Helen steht neben dem Bett und beugt sich über mich. Ich schlage das Laken zurück.
»Ich glaube, draußen ist jemand«, sagt sie. »Ich habe hinten im Garten Schritte gehört, und als ich …«
Schon bin ich auf den Beinen und steige in meine Shorts.
»Erst dachte ich, es sei ein Tier«, fährt Helen fort. »Aber dann habe ich einen Mann gesehen.«
»Bist du sicher?«
Sie beißt sich auf die Lippe. »Ja, ziemlich.«
»Bleib hier«, flüstere ich. »Schließ hinter mir ab, mach alles zu.«
In der Küche halte ich Ausschau nach etwas Waffenartigem, einem Baseballschläger idealerweise, aber in den Schränken finden sich nur ein Nudelholz und ein Fleischmesser. Ich entscheide mich für Letzteres und gehe zur Seitentür. Plötzlich steht Helen neben mir und greift nach meinem Arm. Sie hat Tränen in den Augen.
»Wir könnten doch Kyle anrufen«, sagt sie. »Oder ich versuche den Reiseveranstalter zu erreichen …«
»Und was sollen die machen? Es ist zwei Uhr nachts …« Ich gebe ihr einen Kuss auf die Stirn. »Bleib du hier. Ich bin nicht lange weg.«
Damit trete ich ins Freie und warte, bis ich hinter mir das Türschloss höre. Es herrscht eine undurchdringliche Dunkelheit, Licht kommt nur von Mond und Sternen. Die Nacht hat den Garten verschluckt. Kein Cola klauender Affe weit und breit.
Von rechts kommt ein Geräusch. Schnelle, verhuschte Schritte in Richtung Straße. Ich folge ihnen, kneife die Augen zusammen, sehe trotzdem nichts. Die Schritte stoppen, und ich halte die Luft an.
Dann eine Bewegung auf der Böschung hinauf zu der Straße, an der unser Leihwagen geparkt ist. Es ist kaum etwas zu sehen, aber am Ende mache ich doch jemanden, oder etwas, aus, der oder das die Anhöhe hochjagt.
»He!«, rufe ich, und die Gestalt wird noch schneller. Mein Herz rast. Das Messer im Anschlag, laufe ich hinterher.
4
Helen
30. August 2017
Nach den Eskapaden der vergangenen Nacht ist mein Kopf wie in Watte gepackt. Bei Weitem nicht so sexy, wie es klingt. Gegen zwei bin ich aufgewacht, weil ich zur Toilette musste. Da habe ich draußen Geräusche gehört. Ich ging nachsehen, und tatsächlich, im Garten war ein Mann. Zumindest glaube ich, dass ich ihn gesehen habe. In der Nacht war ich mir ganz sicher, jetzt bin ich es nicht. Ich habe ein schlechtes Gewissen. Ich habe Michael geweckt, und er ist ihm hinterhergelaufen. Über eine Stunde war er weg. Die längste Stunde meines Lebens. Als er zur Tür hereinkam, wäre ich vor Erleichterung fast kollabiert. Er war verschwitzt und außer Atem, aber nicht verletzt.
»Hast du ihn gefunden?« Meine Stimme zitterte, und ich ertappte mich dabei, wie ich ihn nach Blutspuren absuchte.
Er stellte die Taschenlampe zurück in die Halterung auf der Küchenbank. »Nein, es war zu dunkel.«
»Hattest du nicht ein Messer mitgenommen? Wo ist es?«
Er sackte auf einen der Stühle am Tisch und fuhr sich übers Gesicht. »Hab’s fallen lassen.«
Ich wartete auf mehr, auf Einzelheiten – wo genau er gewesen war, eine Begegnung mit dem Eindringling, einen Kampf. Irgendeine Geschichte, die mir helfen würde, die Fragen, die mir durch den Kopf schwirrten, zur Ruhe zu bringen. Michael wich meinem Blick aus.
»Aber … du warst ewig weg. Ich bin fast durchgedreht, ich stand total neben mir, Michael. Hast du ihn eingeholt?«
Er rieb sich die Augen und unterdrückte ein Gähnen. »Bis in den Wald bin ich ihm gefolgt, dann bin ich umgekehrt. Aber ich hab mich etwas verlaufen. Zum Glück habe ich hier und da zwischen den Bäumen Lichter aus der Bucht gesehen.«
»Du warst im Regenwald?«, rief ich.
Eigentlich wollte er die Erinnerung nur abschütteln; er war müde. »Es war stockfinster. Ich habe überhaupt nichts gesehen. Eben war ich noch auf der Straße, und dann stand ich plötzlich inmitten von Bäumen und verdammten Affen.«
Ich versuchte, in seinem Gesicht zu lesen. Eher schien er sich darüber zu amüsieren, dass er plötzlich von Affen umringt worden war, als dass er genervt gewesen wäre, weil er einem vermeintlichen Eindringling hatte nachjagen müssen.
»Es tut mir leid«, sagte ich in dem Gefühl, mich vielleicht doch getäuscht zu haben. Ich hatte es der Paranoia leicht gemacht. »Aber … hast du nicht gesehen, wer es war?«
Er leerte ein Glas Wasser mit einem Zug. »Wie gesagt.«
»Wer könnte es denn gewesen sein?«, insistierte ich. »Warum geistert hier überhaupt jemand herum?«
»Bist du denn sicher, dass jemand da war?«, fragte er, und ich dachte noch einmal nach.
»Du hast ihn auch gesehen, Michael. Du bist ihm hinterhergelaufen.«
»Ich habe noch halb geschlafen. Eine Stunde lang bin ich in diesem Scheißdschungel im Kreis gelaufen.«
Und da war es wieder, das Schuldgefühl, wie eine Klinge, die mir ins Fleisch schnitt. Beschämt senkte ich den Blick. »Tut mir leid. Wahrscheinlich waren wir beide paranoid.«
»Wir beide?«, knurrte er.
Ich sagte nichts mehr. Ich war mir ganz sicher gewesen, dass ich eine dunkle Gestalt hatte herumschleichen sehen, einen Mann, in unserem Garten und auf der Böschung, aber nun schlich sich Zweifel ein, wie eine Lüge, die in eine Wahrheit vordringt.
»Lass uns schlafen gehen«, sagte er und fuhr sich noch einmal übers Gesicht. »Die Fahrt zum Flughafen morgen ist lang.«
Keiner ist froh, als wir die Tür der Strandhütte zum letzten Mal schließen. Reuben hat seine Kopfhörer auf, aber er trommelt mit den Fingern und stampft mit den Füßen auf, wie er es tut, wenn er sehr unter Stress steht. Saskia macht ein langes Gesicht und drückt Jack-Jack besonders fest an sich.
»Vielleicht kommen wir nächstes Jahr wieder«, sagt Michael leichthin, doch ich schüttele den Kopf, um ihm zu sagen: Wir sollten kein Versprechen abgeben, das wir nicht halten können. Ich habe schon keine Ahnung, wie wir uns diese Reise leisten konnten, von einer zweiten Runde nach nur einem Jahr ganz zu schweigen. Wir zahlen ja sogar Reubens iPad in Raten ab, mein Gott.
Die erste Stunde Fahrt vergeht in düsterem Schweigen. Passend zu unserer Stimmung fallen die ersten Tropfen, und bald darauf regnet es dicke graue Schnüre. Es kühlt sich ab, was nicht das Schlechteste ist. Graue Wolken machen sich am Himmel breit. Sechs Wochen am Stück hatten wir einen knallblauen Himmel und sengende Hitze. Saskia hat beschlossen, dass sie alle fünf Minuten pinkeln muss, also halten wir ein gutes Dutzend Mal an und lassen sie raus an den Straßenrand.
Als Michael nach einer dieser Pausen wieder den Fahrersitz ansteuert, sage ich: »Jetzt fahre ich mal. Und du schläfst eine Runde.« Ganz wohl ist mir nicht dabei, auf der falschen Straßenseite zu fahren, aber wenn ich die schwarzen Ringe unter seinen Augen sehe, regt sich mein Gewissen.
Die Kinder klettern auf die Rückbank, Saskia hält Jack-Jack fest im Arm und schaut mit finsterer Miene nach draußen, Reuben ist in sein iPad vertieft. Michael verschränkt die Arme und lehnt den Kopf ans Fenster. Ich finde einen britischen Radiosender und drehe die Lautstärke gerade so hoch, dass ich etwas verstehen kann. Sei froh, dass so wenig Verkehr herrscht, sage ich mir und versuche, optimistisch zu sein. Wenn ihr erst zu Hause seid, geht es wieder Stoßstange an Stoßstange.