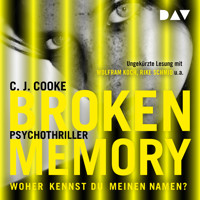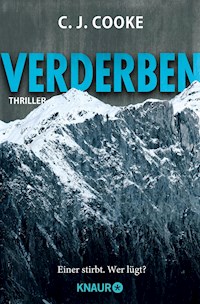5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Das Heim von Geistern, von Hexen und einem Kind, das kein richtiges Kind ist. 1965 wird die junge Pearl zur Entbindung nach Lichen Hall geschickt, einem gotischen Herrenhaus, das in Schottland inmitten eines Waldes steht. Unverheiratete Frauen kommen hierher, um heimlich ihre Kinder zur Welt zu bringen. Doch in Lichen Hall lauert Gefahr. Seltsame Schimmelpilze überwuchern die Wände und gespenstische Geheimnisse kriechen aus dem dunklen Wald heran … Ein Gothic-Thriller, der die gruseligsten schottischen Legenden aufgreift. Woman Home: »Cooke hat die düstere Realität mit einem magischen Realismus vermischt.« Candis: »Mit einer großartigen Handlung erzählt diese spannende und fesselnde Story von der schwierigen Geschichte der Frauen im Schottland Mitte des 20. Jahrhunderts.« Katherine May: »C. J. Cooke ist eine Meisterin der feministischen Gothic!« Carly Reagon: »Herrlich beunruhigend, seltsam überzeugend.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 525
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Aus dem Englischen von Manfred Sanders
Impressum
Die englische Originalausgabe The Ghost Woods
erschien 2022 im Verlag HarperCollins.
Copyright © 2022 by Jess-Cooke Ltd
Copyright © dieser Ausgabe 2025 by
Festa Verlag GmbH
Justus-von-Liebig-Straße 10
04451 Borsdorf
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung:
Titelbild: Andrew Davis © by HarperCollins Publishers LTD 2022
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-98676-227-8
www.Festa-Verlag.de
Für meine Töchter
Melody,
Summer
und Willow
und für all die Frauen und Kinder,
die in Schottlands Mutter-Kind-Heimen waren
Nach ein oder zwei Minuten […] kroch die Raupe ins Gras davon und bemerkte im Fortgehen nur: »Die eine Seite macht dich größer und die andere Seite macht dich kleiner.«
»Eine Seite von WAS? Die andere Seite von WAS?«, dachte Alice.
»Vom Pilz«, sagte die Raupe.
Lewis Carroll, Alice im Wunderland (1865)
He wha tills the fairies’ green
Nah luck again shal hae;
And he wha spills the fairies’ ring
Betide him want and wae.
(Der, der das Grün der Feen bestellt,
Wird stets vom Glück gemieden;
Dem, der den Feenring zerstört,
Wird Not und Leid beschieden.)
Traditioneller schottischer Reim
Es wird erzählt, die Tochter des reichsten Hauses in Scottish Borders sei zum Lesen gern in den uralten Wald gegangen, wo die Bäume so alt waren, dass ihre Stämme ganz weiß und die Äste knorrig und krumm waren.
Eines Tages sank das Mädchen auf dem Waldboden in einen tiefen Schlaf und träumte, es werde von einer bösartigen und abscheulichen Kreatur besucht, so alt wie die Zeit selbst, so verschlungen wie eine Ranke und von dickem, schwarzem Schleim triefend.
Dies war die Hexe Nicnevin, Schottlands Hekate, in einer ihrer vielen Gestalten.
Als das Mädchen erwachte, rannte es nach Hause und wagte viele Monate lang nicht, den Wald zu betreten.
Neun Monate später brachte das Mädchen ein Kind zur Welt, obwohl es schwor, nie bei einem Mann gelegen zu haben.
Der Arzt, der die Entbindung vornahm, warf einen Blick auf den Säugling und ergriff die Flucht.
Das Kind hatte ein engelsgleiches Menschengesicht, aber von seinen Fingern, seinen Zehen und seinem Nabel erstreckten sich lange, faserige Wurzeln, seine Ohren waren knospende Zweige und statt einer Schädeldecke hatte es den schwammartigen Schirm eines Pilzes.
Die Eltern des Mädchens konnten eine solche Kreatur nicht am Leben lassen, und man erzählt sich, dass Nicnevin sie alle verfluchte und Besitz von ihrem Verstand ergriff, bis sie einander hassten oder sich aus Verwirrung und Elend das Leben nahmen. Die Familie wurde auf immer für ihre grausame Tat verflucht.
Aber die Hexe wollte das Haus nicht ungenutzt lassen. Nicnevin beschloss, es als ihr Reich zu beanspruchen, als einen Ort der Fäulnis und des Verfalls.
Und so bekam es den Namen Lichen Hall – das Haus der Flechten.
»Die Geschichte von Lichen Hall«
Aus: Die magische Welt der Fungi,
A. E. Llewellyn (1937)
Damals
Mabel
Dundee, Schottland, Mai 1959
Einer der Geister wohnt in meinem Knie. Direkt hinter der Kniescheibe ist eine kleine Vertiefung, und dort versteckt er sich – oder besser gesagt, sie sich –, eingemummelt im weichen Bett des Knorpelgewebes. Sie ist sehr klein und verängstigt, deshalb strecke ich beim Sitzen das Bein immer ein bisschen aus, um sie nicht zu stören. Ich habe niemandem ein Wort davon erzählt. Man würde mich für verrückt halten.
»Mabel? Hörst du zu?«
Die Augen meiner Ma sind weit aufgerissen, als würde sie verzweifelt gegen den Schlaf ankämpfen, aber ihre Hände erzählen eine andere Geschichte. Mit weißen Fingerknöcheln klammert sie sich am Riemen ihrer Handtasche fest, als säßen wir in der Achterbahn.
»Hast du gehört, was Dr. McCann gesagt hat?«
Ich nicke, aber in Wirklichkeit habe ich nicht zugehört. Das passiert mir ständig – dass ich in einen Tagtraum abgleite. Mein Blick wandert zur Akte auf dem Schreibtisch neben uns. Ich lese meinen Namen: Mabel Anne Haggith. Geburtsdatum 12. März 1942, 44 Kilogramm, 1,57 Meter. Dr. McCann sieht mich durch seine Brille an, seine dicken roten Finger sind ineinander verschlungen wie eine Meereskreatur. Der ganze Raum strahlt das Gefühl aus, dass ich irgendetwas falsch gemacht habe.
»Wann hatten Sie Ihre letzte Periode, Miss Haggith?«, fragt er.
»Bin mir nicht sicher.« Ich möchte vor Scham im Boden versinken. So was hat mich noch nie jemand gefragt. Das ist privat.
»Versuchen Sie, sich zu erinnern«, sagt er müde. Ma stößt mich mit dem Ellbogen an, als wäre ich unhöflich gewesen.
»Meine … Meine Regel war schon immer unregelmäßig«, stammle ich.
»Mich interessiert nur eine Menstruation, Miss Haggith.« Dr. McCann seufzt. »Die letzte.«
»Kurz vor Weihnachten.«
Ich erinnere mich, wie sich an dem Morgen der Boden zu neigen schien, als ich gerade die erste Ladung Weihnachtsgebäck in den Backofen schob. Ein heftiges Ziehen in meinem Unterleib, und ich wusste, was los war. Anders als jetzt.
Dr. McCann kritzelt etwas auf seinen Notizblock, dann blättert er in dem Kalender auf seinem Schreibtisch. Wieder kritzelt er, murmelt etwas. Der Geist in meinem Knie hustet.
»Fünf Monate«, verkündet Dr. McCann plötzlich. »Damit dürfte der Termin Ende September sein.« Er leckt Zeigefinger und Daumen an und nimmt eine Broschüre von einem Stapel auf seinem Schreibtisch. »Hier«, sagt er und gibt sie Ma. »Ich nehme an, dass Sie so früh wie möglich Erkundigungen einholen wollen.«
Seufzend nimmt Ma die Broschüre. Der Geist ist ruhelos und kann nicht schlafen. Ich reibe heftig meine Kniescheibe, bis Ma verärgert meine Hand wegzieht.
»Wer war es?«, fährt sie mich an. Ihre Augen blitzen. »War es dieser schreckliche Junge? Dieser Jack?«
»Jack?« Ich runzle die Stirn. »Ich verstehe nicht, was du meinst. Was ist denn mit mir? Muss ich sterben?«
»Sterben?« Dr. McCann lacht. »Kommen Sie, Mabel! Sie sind 17! Sie sind kein kleines Kind mehr.«
»… hätte nie gedacht, dass du die Beine breit machst«, zischt Ma. In ihren Augen zittern Tränen der Wut. »Und dann auch noch für diesen widerlichen ungewaschenen Kerl. Ich wusste, dass es so weit kommen würde. Ich wusste es!«
Erst als ich den Titel der Broschüre sehe, dämmert es mir – ein langsames Begreifen, als würden Finger über meinen Nacken krabbeln. Mutter-Kind-Heim St. Lukas. Das Deckblatt zeigt das Bild einer jungen Frau, die im Bett sitzt, neben ihr ein Mann und eine Frau. Alle lächeln und sie reicht dem Ehepaar ein Baby. Der Untertitel lautet: Eine Adoption ist die beste Option für unverheiratete Mütter.
Sie glauben, dass ich ein Baby bekomme! Darum geht es also.
»Ich kriege kein Kind!«, protestiere ich laut und erzähle ihnen fast von den Geistern, die manchmal in meiner Lunge schlafen oder sich in meinem Zahnfleisch verstecken, und dass vielleicht ein Geist in meiner Gebärmutter ist und sie ihn mit einem Baby verwechseln. Aber stattdessen sage ich »Ich bin noch Jungfrau«, was Dr. McCann dazu veranlasst, laut loszuprusten. Aber es stimmt – ich bin Jungfrau. Ich hatte noch nie Sex, nicht mal die Sorte, die man nur mit den Händen macht.
Dr. McCann sieht Ma an. Ihr Gesicht ist verkniffen, ihre Lippen gespitzt. Eine interessante Tatsache, die ich einmal gehört habe, fällt mir ein: Der durchschnittliche Mensch lügt ein- bis zweimal am Tag, wird aber bis zu 200 Mal pro Tag belogen. Ich weiß, dass ich die Wahrheit gesagt habe. Lügt also Dr. McCann?
Mein Stiefvater Richard wartet im Wagen auf uns, als wir die Praxis verlassen. »Alles okay?«, fragt er Ma, und sie drückt ihr Gesicht an seine Brust, als wären wir gerade aus einem Kriegsgebiet geflohen.
Er kneift die Augen zusammen und blickt von ihr zu mir. »Was hast du angestellt?«, fragt er.
Ich halte mein Knie für den Geist gestreckt, aber sie ist schon weitergezogen. Ich kann sie jetzt in meinem Bauch spüren. Sie tanzt.
»Es ist dieser Jack«, flüstert Ma. »Er hat Mabel geschwängert.«
Jack ist mein Freund, der zwei Türen weiter wohnt. Wir gehen miteinander, haben aber nie mehr gemacht, als uns zu küssen. »Es ist nicht Jack!«, sage ich aus Sorge, dass sie ihm die Schuld gibt, obwohl er unschuldig ist.
»Heilige Muttergottes!«, zischt sie und bekreuzigt sich. »Es gibt ein ganzes Geschwader potenzieller Väter!«
Mit finsterem Gesicht starrt Richard mich an. Mein Herz galoppiert. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe.
Wir machen uns auf den Heimweg. Unser Haus ist ein vierstöckiges Reihenhaus an der Rotten Row. Es hat neun Zimmer, von denen sieben für gewöhnlich von Fremden bewohnt werden. Wir wohnen schon mein ganzes Leben dort, aber ein Gästehaus ist es erst, seit Dad vor zehn Jahren starb. So hat Ma Richard kennengelernt. Er ist vor sechs Jahren eingezogen und nicht wieder gegangen.
Unterwegs halten wir vor Mr. McGregors Metzgerei. Als Richard das Fenster herunterkurbelt, weht der Geruch von der Ladentür herüber wie aus einer offenen Gruft. Ich kralle mich am Türgriff fest und bin mir sicher, dass ich mich gleich übergeben muss.
Eine Adoption ist die beste Option für unverheiratete Mütter.
»Hol das Hackfleisch, Mabel«, sagt Ma und gibt mir ein paar Münzen. »Ein Viertelpfund und nicht ein halbes Gramm mehr, hast du gehört? Na, geh schon.«
Ich halte mir den Jackenaufschlag vor die Nase und betrete die Metzgerei. Eine zentimeterdicke Schicht Sägemehl bedeckt den Boden, gerupfte Hühner baumeln an ihren Hälsen von der Decke und eine Reihe toter Schweine hängt kopfüber an der hinteren Wand.
Mr. McGregors Sohn Rory steht heute hinter der Ladentheke. Er ist etwas älter als ich und taub. Wenn Rory arbeitet, benutzen sie im Laden einen Notizblock und einen Stift, damit die Kunden aufschreiben können, was sie haben wollen. Manchmal schreibt Rory kleine Botschaften zurück, etwa »Gutes Wetter zum Grillen!« oder »Gut sehen Sie heute aus, Mrs. Haggith!«.
Was war das noch mal, was ich kaufen sollte? Ein totes Huhn?
Als ich an die Reihe komme, ist Rory von einem älteren Mann abgelöst worden, den ich noch nie gesehen habe. Er muss für Mr. McGregor arbeiten, denn er trägt eine blutige, gestreifte Schürze und wischt sich gerade die Hände an einem Handtuch ab und starrt mich an. Er hat eine Tätowierung über die ganze Seite seines Gesichts. Ein Spinnennetz.
»Was darf’s sein?«, fragt er. »Heute sind Schweinewürste im Angebot. Das Pfund für zehn Pence.«
Ich bin noch zu tief in meinem Körper, um mit ihm zu sprechen, deshalb nehme ich den Notizblock und den Stift.
Hühnchen, oder?
Ich schlage eine neue Seite im Notizblock auf und schreibe, aber die Worte ergeben keinen Sinn. Sie lauten:
Im Wagen ist ein Mann, der meiner Ma ein Messer an den Hals hält. Er wird sie töten, wenn Sie mir nicht alles geben, was in der Kasse ist.
Ich reiche dem Mann mit der Spinnennetztätowierung den Block. Mit einem Ausdruck tiefster Verwirrung blickt er zu mir auf, und plötzlich bin ich erleichtert, denn er ist genauso grün im Gesicht, wie ich mich nach dem, was in Dr. McCanns Büro geschehen ist, fühle. Warum habe ich das geschrieben? Es muss einer der Geister gewesen sein. Ich spüre, wie einer von ihnen sich unruhig entlang meines Zeigefingerknochens ausstreckt.
Der Laden ist leer. Der Mann schaut wieder zu Richards Wagen hinaus, und was auch immer er sieht, muss ihn wohl überzeugen, denn er springt zur Kasse und stopft haufenweise Geld in eine Plastiktüte. Mit einem grimmigen Nicken reicht er mir die Tüte, sie baumelt voller Münzen und Geldscheine im widerlichen Gestank der toten Tiere. Mein Arm hebt sich, meine Finger strecken sich, die Tüte schwingt in meiner Hand, meine Beine machen kehrt und meine Füße bahnen einen frischen Pfad durch das Sägemehl. Und dann bin ich draußen und steige mit der Tüte voller Geld in den Wagen. Ich bin mir nicht sicher, was hier gerade passiert.
»Gib mir das Hackfleisch«, sagt Ma und schnippt mit den Fingern. »Und den Bon. Ich will doch hoffen, dass er dir nicht zu viel berechnet hat. Packt immer ein paar Gramm mehr ein, als ich bestellt habe, dieser McGregor!«
Ich reiche ihr die Tüte. Sie öffnet sie und starrt auf das Geld. Es gibt einen Augenblick absoluter Stille, als alle Geister in mir erstarren und Ma zu verdutzt ist, um irgendetwas zu sagen. Aber das ist nicht von Dauer. Sie fährt herum und starrt mich erschrocken an.
»Mabel?«
I
6 Jahre später
Heute
Pearl
Scottish Borders, Schottland, September 1965
1
Wir sind mitten im gottverlassenen Nirgendwo. Es wird dunkel, und ich schwöre, dass meine Blase gleich explodiert, wenn ich nicht in den nächsten zwei Minuten pinkeln kann.
»Könnten Sie wohl kurz ranfahren?«, frage ich Mr. Peterson. Er ist Seelsorger der Kirche von England.
»O nein, ist es so weit?« Er reißt die Augen von der Straße los, um mich entsetzt anzustarren. »Müssen wir ein Krankenhaus suchen?«
»Was? Nein! Es sind nicht die Wehen. Ich muss nur meine Blase entleeren!«
Der Wagen schaukelt leicht, während Mr. Peterson entscheidet, was er mit dieser Information anfangen soll. Er schaltet den Blinker ein – absolut unnötig, da wir meilenweit das einzige Auto sind – und tritt auf die Bremse. In einer Staubwolke aufgewirbelten Schotters hält er am Straßenrand.
Ich stürme aus dem Wagen, schlage mich in die Büsche und balanciere meinen hochschwangeren Körper aus, bevor ich mich erleichtert hinhocke. Erst als ich fertig bin, merke ich, dass ich knöcheltief im Morast stecke, und bei meinen Versuchen, meine Füße aus dem saugenden Matsch zu befreien, spritze ich so sehr herum, dass ich das teure Kleid ruiniere, das meine Mutter für mich gekauft hat, um die Whitlocks zu beeindrucken. Jetzt werden sie wohl nur die Nase rümpfen.
»Oje! Sind Sie hingefallen?«, fragt Mr. Peterson, als ich zum Wagen zurückkehre. Ich musste in den Morast greifen, um einen meiner Schuhe zu befreien, deshalb trage ich jetzt Handschuhe und Socken aus schwarzem Matsch. Er zaubert ein Taschentuch aus seiner Brusttasche, und damit wische ich den schlimmsten Dreck ab, aber von dem Geruch wird mir übel.
»Lassen Sie uns weiterfahren, okay?«, sage ich.
»Gut.« Er räuspert sich und schaltet das Radio ein, bevor er wieder auf die Straße fährt. Gerade läuft ›I Want To Hold Your Hand‹ von den Beatles, und er nimmt eine Hand vom Lenkrad, um den Sender zu wechseln.
»Oh, können Sie das laufen lassen?«, bitte ich ihn. »Ich liebe die Beatles!«
Er ist etwas verstimmt, lässt das Radio aber in Ruhe.
»Ich habe sie gesehen«, sage ich. »Letzten April. Als sie in Edinburgh waren.«
»Die waren in Edinburgh?«, fragt er, und ich muss lachen. Als ob das nicht jeder auf dem Planeten wüsste.
»Ich war eine der Unterzeichnerinnen der Petition, die sie nach Schottland geholt hat.«
»Sie müssen ein ziemlicher Fan sein.«
Ich erzähle ihm, dass Lucy, Sebastian und ich zwei Nächte auf der Bread Street gecampt haben, um die Karten zu bekommen. Es war eisig kalt und auf dem Bürgersteig lagen die Schlafsäcke dicht an dicht in einer langen Reihe, aber ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viel gelacht. Und dann der Abend des Konzerts – der Anblick der vier auf der kleinen Bühne im ABC Cinema, alle in grauen Anzügen. Als sie ›I Want To Hold Your Hand‹ spielten, konnte man es in der allgemeinen Hysterie kaum hören. Alle um uns herum brachen augenblicklich in Tränen aus, sogar Sebastian. Mittlerweile fühlt es sich an, als wäre es schon hundert Jahre her.
»Ich habe es ja mehr mit Glenn Miller«, sagt Mr. Peterson und lässt es sich nicht nehmen, auf die Acht-Uhr-Nachrichten der BBC umzuschalten.
Ich frage mich, wie oft er wohl diese Fahrt macht und schwangere Mädchen zu Mutter-Kind-Heimen bringt – obwohl unser Ziel nicht direkt ein Mutter-Kind-Heim ist. Es ist ein privates Wohnheim. Lichen Hall – ein riesiges Herrenhaus aus dem 16. Jahrhundert im Besitz der Familie Whitlock, die liebevoll Mädchen wie mich aufnimmt, um ihnen die Demütigung zu ersparen, sich an eine staatliche Institution wenden zu müssen. Dafür bin ich dankbar, wirklich. Aber ich bin so nervös, dass ich Ausschlag bekommen habe. Lichen Hall liegt in Scottish Borders, eine halbe Stunde von dem kleinen Fischerdorf St. Abbs entfernt – oder wie ich schon sagte: mitten im gottverlassenen Nirgendwo. Was soll ich da den ganzen Tag machen? Ich hätte fragen sollen, ob sie einen Plattenspieler haben oder wenigstens ein Fernsehgerät. Normalerweise bin ich den ganzen Tag beschäftigt – morgens um fünf aus dem Bett, um meine Schicht im Krankenhaus anzutreten, hinterher gleich essen gehen oder mit Freunden in einen Nachtclub.
»Sie wissen nicht zufällig, ob es dort einen Fernseher gibt?«, frage ich Mr. Peterson.
»Leider nicht.«
»Aber ein Telefon werden sie wohl haben, oder? Ich werde doch sicher meine Familie anrufen können?«
»Haben Sie sich denn nicht danach erkundigt, bevor Sie dem Aufenthalt zugestimmt haben?«
Um die Wahrheit zu sagen, habe ich mich zu sehr geschämt, um irgendetwas anderes zu tun, als mich in das Schicksal zu fügen, das meine Eltern für mich arrangiert haben. Mit 22 schwanger und unverheiratet – ich bin ja so eine Enttäuschung.
»Es ist noch nicht zu spät, sich für einen Platz in einem öffentlichen Mutter-Kind-Heim zu bewerben«, sagt Mr. Peterson, der wohl die Furcht in meiner Stimme hört. »Die sind nicht mehr so wie früher. Nicht mehr so Dickens-mäßig.«
Das glaube ich keine Sekunde lang. Letzten Monat habe ich ein Mutter-Kind-Heim besucht. Es war eines der kleineren, in einem Reihenhaus an der Corstorphine Road, betrieben von der Heilsarmee. Die Atmosphäre in dem Haus bereitete mir eine Gänsehaut. Die Hausmutter war sehr freundlich, aber die Wände waren kahl und kalt, und die blassen, verängstigten Gesichter der Mädchen weckten in mir den Verdacht, dass sie das Haus mit eiserner Hand regierte.
»Mum sagt, sie kennt die Besitzer von Lichen Hall«, erkläre ich ihm. »Sie meint, ich würde mich gut mit ihnen verstehen. Mr. Whitlock ist im Ruhestand. Er war Wissenschaftler. Ein bahnbrechender Mikrobiologe, wenn ich mich nicht irre.«
»Ein Mikrobiologe? Und sie besitzen ein Herrenhaus?«
»Er war Professor an der Universität Edinburgh und in Yale. Mrs. Whitlocks Vater hat damals Lichen Hall gekauft. Ich bin mir sicher, dass es da ein Telefon gibt.« Das Letzte sage ich mehr zu mir als zu Mr. Peterson. »Und außerdem, wie würde es denn aussehen, wenn ich so spät noch absage?«
Er zieht eine Augenbraue hoch. »Ihre Mutter ist mit den Whitlocks befreundet?«
»Na ja, befreundet ist zu viel gesagt.« Ich versuche, seinen Gesichtsausdruck zu entschlüsseln. »Warum? Und denken Sie nicht einmal daran, mir zu erzählen, in dem Haus würde es spuken. Das hat mein Bruder schon versucht!«
Charlie hat sich gestern Abend freundlicherweise ein hübsches Schauermärchen aus den Fingern gesogen, mit dem er mich unbedingt beglücken musste, während ich packte. Irgendwas von einer Feenkönigin, die auf die ursprünglichen Besitzer sauer war, weil sie ein Feenbaby getötet hatten. Laut meinem Bruder spukt sie in dem Anwesen und verflucht jeden, der es betritt. Charlie ist so ein Mistkerl. Er wusste ganz genau, wie nervös ich wegen der ganzen Sache bin.
Wir biegen nach rechts ab und halten vor einem hohen schwarzen Tor mit einem goldenen ›W‹ auf jedem Flügel. Das muss es sein, obwohl es eine ziemlich versteckte Einfahrt ist für so ein großes Anwesen, wie ich es mir vorstelle – nur eine winzige Lücke zwischen den Bäumen neben der Straße.
Mr. Peterson schaltet den Motor aus und nimmt ein gefaltetes Blatt Papier aus seiner Jackentasche. »Anweisungen für den Schlüssel«, sagt er. Ich blicke ihm nach, als er aussteigt und eine Weile im trüben Licht herumsucht, sich dann über einen Busch beugt und mit dem vermutlich gefundenen Schlüssel zum Tor geht. Er zieht die beiden Flügel des Tors auf und setzt sich wieder in den Wagen, um uns hindurchzufahren.
»Ich glaube, Sie wollten mir gerade erzählen, dass es in Lichen Hall spukt«, erinnere ich ihn. »Oder dass die Whitlocks blutrünstige Mörder sind.«
»Es steht mir eigentlich nicht frei, darüber zu reden …«
»Um Gottes willen, jetzt spucken Sie es schon aus!« Ich lache. »Sie können mich nicht so auf die Folter spannen und dann die Klappe halten!«
»Es ist nur ein Gerücht.« Er bremst etwas zu scharf in einer Kurve und wir werden beide auf unseren Sitzen nach vorn gerissen.
»Was ist nur ein Gerücht?«
Er kratzt die kahle Stelle auf seinem Kopf. »Nun, es ist schon eine Weile her. ’57 oder ’58, ich weiß es nicht mehr genau … Ein schrecklicher Autounfall gleich hinter Berwick. Den Qualm konnte man meilenweit sehen. Das Ehepaar Whitlock war nicht in den Unfall verwickelt, aber ihr Sohn.«
»Mein Gott … ihr Sohn?«
»Ihr einziger Sohn, ihr einziges Kind. Angeblich sollen die Whitlocks, als sie von dem Unfall gehört haben, sofort zur Leichenhalle gefahren sein und darauf bestanden haben, dass man ihnen die Leiche aushändigt.«
Ich warte darauf, dass er mir sagt, er scherze nur, aber das tut er nicht. »Das ist … ungewöhnlich.«
»Na ja, das ist noch nicht das Schlimmste. Ungefähr eine Woche später wurde der Sohn – den Namen habe ich vergessen – im Dorf gesehen, offenbar quietschfidel. Keine Spur von Verletzungen.«
Ich verdaue das für einen Moment und schüttele es dann ab. Lichen Hall ist eines der größten Güter in Scottish Borders. Es klingt, als wären die Bewohner Opfer wilder Gerüchte geworden.
»Das ist alles, was ich weiß«, sagt Mr. Peterson sehr ernst.
»Ich behalte es im Hinterkopf.«
Ich werde mich von ihm nicht umstimmen lassen. Nicht einmal in die Nähe einer staatlichen Einrichtung werde ich gehen, vielen Dank auch.
Die Auffahrt nach Lichen Hall ist eine einspurige asphaltierte Straße mit einem Mäuerchen auf der einen Seite und hohen Bäumen auf der anderen, und ich verrenke mir den Hals beim Versuch, das Haus am Ende des Weges zu sehen. O Gott, da ist es, beleuchtet von den Scheinwerfern des Wagens. Vier spitze Türme und dunkle Steinmauern, bewachsen mit rotem Efeu. Es sieht aus wie Draculas Ferienhaus.
Wir fahren zum Haupteingang, erkennbar an den Säulen, einer breiten Steintreppe und einer abweisenden Haustür. Mr. Peterson wirkt plötzlich nervös.
»Ich stelle Ihr Gepäck an die Treppe.« Er schaltet den Motor ab und steigt aus dem Wagen. Ich folge ihm, während er die Taschen aus dem Kofferraum hievt und auf den Boden stellt.
»Können Sie mir wenigstens helfen, sie reinzutragen?«, frage ich ein bisschen verärgert darüber, wie achtlos er meine Habseligkeiten auf dem feuchten Kopfsteinpflaster ablädt. Er geht bereits wieder zur Fahrerseite, und ich vermute, er holt irgendwelche Papiere, irgendwelche letzten Formalitäten, bevor er mich meinen Gastgebern überlässt.
Aber dann erwacht der Motor zum Leben, und mit quietschenden Reifen fährt er davon. Das Heck des Wagens schleudert leicht, als er in der Auffahrt verschwindet.
2
Es beginnt zu regnen. Ich sehe mich um, viel zu verdutzt von Mr. Petersons übereilter Abfahrt, um mich ernsthaft darüber zu ärgern. Die Sturmtüren sind geschlossen, es ist niemand zu sehen. Ich lasse mein Gepäck stehen und watschle zur Seite des Hauses, wo ich zu meiner großen Erleichterung in einer Tür eine Frau sehe, die gerade Brotkrumen in den Hof wirft. Ein Dutzend Krähen tummelt sich dort und streitet um das Futter.
»Hallo«, sage ich. »Ich bin Pearl. Pearl Gorham. Ich glaube, Sie erwarten mich …«
»Oh, willkommen!«, erwidert die Frau und tritt mit ausgestreckter Hand auf mich zu. Das muss Mrs. Whitlock sein. Sie hat kurz geschnittene Haare mit grauen Strähnen, graue Augen mit Schlupflidern und schiefe Zähne. Bekleidet ist sie mit einer dunklen Hose und einem Rollkragenpullover. Ihre Haut ist übersät mit Aknenarben und sie hat breite, kräftige Hände mit kurzen, sauberen Nägeln.
»Ja, wir haben Sie erwartet. Wo ist Ihr Fahrer?« Sie ist Schottin, hat aber nur einen schwachen Akzent, als hätte sie den größten Teil ihres Lebens in London verbracht oder Sprechunterricht erhalten.
»Er hatte noch einen anderen Termin«, sage ich eilig.
Sie ruft ins Haus: »Aretta? Rahmi? Kommt und helft Miss Gorham mit ihrem Gepäck!«
Zwei junge Frauen tauchen aus der Dunkelheit auf, und ich führe sie zu der Stelle, an der ich meine Sachen stehen gelassen habe. Die beiden sind ungefähr in meinem Alter. Aretta ist groß und schlank, mit brauner Haut, hohen Wangenknochen und vollen Lippen. Sie ist beeindruckend stark und hebt die schwerste Tasche an, als wäre es ein Karton Federn. Rahmi ist klein, mit ockerfarbenen, katzenhaften Augen und langen schwarzen Haaren, die sie zu einem losen Knoten gebunden hat. Sie hat ein Nasenpiercing und einen selbstbewussten Blick. Zuerst denke ich, dass die zwei aus den gleichen Gründen hier sind wie ich, aber keine von ihnen ist sichtbar schwanger. Vielleicht arbeiten sie hier.
Der Regen wird kräftiger, deshalb nehmen wir schnell das Gepäck – obwohl Mrs. Whitlock mir verbietet, mit anzufassen, da ich im achten Monat bin – und eilen ins Haus.
Wir betreten eine altmodische Küche mit Schachbrettfliesen, Mahagonischränken, einer riesigen, mit einer Marmorplatte bedeckten Kücheninsel und einer unglaublich hohen Decke mit dicken Holzbalken, an der ein Trapezkünstler seine reine Freude hätte.
Mrs. Whitlock mustert mich von oben bis unten. »Sind Sie gestürzt?«
Erst jetzt erinnere ich mich an den eingetrockneten Matsch an meinem Kleid und meinen Händen. Ich sehe schlimm aus. »Ah, tut mir leid. Nein, es war kein Sturz. Wir mussten einen kleinen Boxenstopp einlegen …«
»Sehen wir mal zu, dass wir Sie sauber bekommen.«
Sie führt mich mit schnellen Schritten durch einen langen Korridor zu einer Treppe. Ich hasse Treppen – seit ungefähr zwei Monaten. Treppen und das dritte Trimester sind keine gute Kombination. Aber ich versuche, mit ihr Schritt zu halten.
»Der Ostflügel ist leider abgesperrt«, sagt Mrs. Whitlock ein paar Stufen vor mir. »Mein Mann und ich schaffen diese Art von Arbeit einfach nicht mehr … Aber es ist noch genug vom Haus übrig, um einigermaßen bequem darin zu leben. Wir haben heißes Wasser, aber nur morgens, deshalb würde ich Ihnen raten, früh aufzustehen. Rahmi macht das Frühstück um sieben, das Mittagessen um zwölf und das Abendessen um fünf.«
»Warum ist er abgesperrt?«, frage ich.
Sie legt den Kopf auf die Seite. »Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht folgen.«
»Sie sagten, der Ostflügel sei abgesperrt. Und dass Sie und Ihr Mann es nicht schaffen …«
»Ah, ich verstehe. Soll ich Ihnen das Haus zeigen?«
Ich nicke erleichtert. »Ja, bitte.«
Ihr Blick fällt auf den getrockneten Matsch auf meinen Händen und Beinen. »Wollen Sie sich nicht erst waschen und umziehen? Ich kann Ihnen später …«
»Jetzt wäre perfekt«, sage ich schnell, weil ich nicht erklären will, dass mir die Angst in sämtlichen Knochen sitzt und ich heute Nacht kein Auge zubekommen werde, wenn ich mich nicht schnellstens mit meiner neuen Umgebung vertraut mache. Um zu überleben, brauche ich Vertrautheit.
Sie neigt leicht den Kopf. »Folgen Sie mir.«
Am Ende des Korridors führt die Treppe zu einem weiteren Stockwerk hinauf, und ich bemerke einen Treppenlift, der an der Wand angebracht ist. Er sieht aus, als wäre er erst vor Kurzem eingebaut worden.
Mrs. Whitlock wendet sich nach links, und wir betreten einen riesigen Raum von der Größe eines Ballsaals mit einer Reihe von Buntglasfenstern, die Regenbogenkleckse auf den dicken Teppich malen. »Dies ist das Mikrarium meines Mannes«, sagt sie, und ich nicke, als wüsste ich, was ein gottverdammtes Mikrarium ist. »Als wir hier eingezogen sind, hat er sich einen Metalldetektor gekauft, um das Grundstück nach alten Münzen abzusuchen.«
»Alte Münzen?«
Sie wirkt überrascht. »Oh, ich dachte, Sie hätten vielleicht von unseren Funden hier auf dem Gelände gehört. Es scheint ein sehr geschichtsträchtiger Boden zu sein – der alte Wald einen halben Kilometer östlich von hier gehört zu dem uralten kaledonischen Waldgebiet. Ihnen wird auffallen, dass die Bäume sehr bleiche Stämme haben, sehr geisterhaft. Wir nennen ihn den Geisterwald. Eine Woche nachdem meine Eltern hierhergezogen waren, hat mein Vater ein Pferdegeschirr gefunden. Aus der Bronzezeit, wie sich herausstellte. 3000 Jahre alt.«
»Wow«, staune ich. »Das ist unglaublich.«
»In der Tat. Seither haben wir nichts so Bedeutsames mehr gefunden. Eine Handvoll jakobitischer Kugeln, den Knopf von einem Rotrock. Haufenweise Knochen, von denen sich nicht wenige als menschlich herausgestellt haben.« Sie zieht eine Grimasse. »In dieser Gegend scheinen eine Menge Kämpfe stattgefunden zu haben. Aber mein Mann interessiert sich mehr für Natur als für Geschichte.«
»Natur ist Geschichte, nicht wahr?«
»Sicher. Mit seiner Gesundheit ist es nicht mehr so gut bestellt. Sie haben bestimmt den Treppenlift gesehen, den wir eingebaut haben.«
Ich nicke und sie lächelt traurig.
»Wir lassen das Mikrarium, wie es ist. So, wie er es verlassen hat.«
Sie führt mich an den Tischen entlang, die an den Seiten des Raumes aufgestellt und auf denen in Glasvitrinen Muscheln und rostige Schlüssel zu sehen sind. An den Wänden hängen weitere Vitrinen, aber mit kleinen quadratischen Kästchen voller Baumrinde oder toter Insekten. Ich wäre gern stehen geblieben und hätte mir alles genauer angesehen, doch Mrs. Whitlock schreitet flott und unbeirrt weiter – beides Eigenschaften, die ich sehr schätze, aber dieser Raum ist so seltsam, so voller Fragen, dass ich für einen Moment vergesse, weshalb ich hier bin.
Am Ende des Saals zweigen Korridore nach links und nach rechts ab. Mrs. Whitlock geht nach rechts und ich folge ihr.
»Es gibt eine Bibliothek, falls Sie gern lesen«, sagt sie und öffnet eine Tür zu einem spektakulären Raum mit Bücherregalen an allen Wänden. Ich schnappe nach Luft und sie lacht. »Mein Vater hat sie eingerichtet. Er war ein großer Leser. Ich fürchte, wir anderen sind Banausen.«
»Ich habe mich gefragt …«, beginne ich. Und dann, in der Hoffnung, sie nicht zu beleidigen: »Ich meine … ich bin ein großer Fan von Büchern, aber ich sehe auch gern fern …«
Sie wischt mit der Hand etwas Staub von einem Regal. »Kein Fernseher, tut mir leid.«
Mir wird schwer ums Herz, aber ich bemühe mich, mir meine Enttäuschung nicht anmerken zu lassen. Ich lasse den Blick über die Regale wandern, die bis hinauf zur Holzdecke reichen, und über die beiden Lehnstühle am Kamin. Die Bibliothek der Whitlocks könnte meine Rettung sein. Ich werde mindestens drei Monate lang hier sein, vielleicht vier. Hoffentlich gibt es mehr als nur Wörterbücher und Enzyklopädien in diesen Regalen.
Wir gehen weiter durch den Korridor. Der Gang endet an einer Tür, die offenbar verschlossen ist. Mrs. Whitlock klopft ihre Taschen nach dem Schlüssel ab. Als sie ihn im Schloss dreht, sagt sie: »Das ist der Ostflügel.«
Ich bin gespannt, was mich erwartet. Wir treten durch die Tür und stehen am oberen Ende einer wunderschönen Eichenholztreppe, die in weitem Schwung nach unten führt wie etwas aus Vom Winde verweht. Ein Kristallleuchter von der Größe einer mittleren Badewanne hängt genau im Zentrum einer gewölbten Decke.
»Sind Sie gern an der frischen Luft?«, fragt Mrs. Whitlock.
»Wenn ich die Gelegenheit bekomme«, antworte ich, während ich die Halle unter mir betrachte.
»200 Hektar«, sagt sie. »So groß ist das Grundstück. Das umfasst die Felder und einen Teil des Strandes am Fuß der Klippen. Viele unserer Gäste stellen fest, dass ein täglicher Spaziergang auf dem Anwesen gut für das Gemüt ist.«
Ich nicke. »Ich werde es mir zu Herzen nehmen.«
Die Haupthalle erstreckt sich mit ihrem Boden aus prachtvollen Schachbrettfliesen vor mir. An einer Wand hängt ein Hirschkopf, in einer Ecke steht die griechische Statue einer nackten Frau. In Marmor erstarrte Gesichter blicken von den Ecken der bogenförmigen Türrahmen herunter wie engelsgesichtige Wasserspeier. Als ich die Treppe hinabgehen will, berührt Mrs. Whitlock meinen Arm.
»Besser nicht in Ihrem Zustand«, sagt sie. »Wenn Sie genau hinsehen, erkennen Sie den Grund, weshalb wir diesen Teil des Hauses momentan nicht nutzen können.«
Ich folge ihrem Blick zu einer gewaltigen Masse gelber Pilze, die an einer Wand in die Höhe wachsen. Etwas, das aussieht wie riesige Ohren, wuchert aus dem Spalt im Türrahmen bis hinab zum Boden. Als ich meinen Blick durch die Halle schweifen lasse, erblicke ich weitere Pilzgewächse, die aus Rissen in den Fliesen und den Fensterrahmen sprießen. Die gewölbte Decke ist mit großen schwarzen Schimmelflächen überzogen. Schwarze Schimmelrüschen blühen aus den Holzstufen unter meinen Füßen. Und am unteren Ende der Treppe quillt eine Wolke perfekt ausgeformter honiggelber Pilze aus dem Treppenpfosten. Der Anblick bereitet mir körperliches Unbehagen.
»Was ist passiert?«, frage ich und halte mir die Armbeuge vor den Mund.
Mrs. Whitlock seufzt leise. »Ein massiver Pilzbefall. Ich kann es immer noch nicht richtig glauben. Dieses Haus steht seit 400 Jahren. Es hat Bomben, Überschwemmungen und einen Blitzeinschlag überstanden.« Sie verschränkt die Arme vor der Brust und sagt empört: »Pilze können sich sogar durch Felsen fressen, ist das zu glauben?«
»Großer Gott!«
»Schlimmer als Mäuse, wie es aussieht. Der Pilz steckt sogar im Fundament, was es so schwierig macht, das Problem zu beseitigen. Und natürlich sind da die Sporen.« Sie wirft mir einen Blick zu. »Es ist für Menschen nicht gut, Pilzsporen einzuatmen, wie Sie sicher wissen.«
»Überhaupt nicht gut.«
»Nun, uns kann nichts geschehen«, sagt sie. »Solange wir diesen Teil des Hauses nicht benutzen.«
Ich trete einen Schritt zurück. Man hätte ja auch erwähnen können, dass das Haus von Pilzen befallen ist, als man anbot, schwangere Frauen aufzunehmen. »Kennt man die Ursache?«, frage ich und schaffe es nicht ganz, die Furcht aus meiner Stimme herauszuhalten.
»Offenbar ist der Grundwasserspiegel gestiegen und hat jahrzehntelang ohne unser Wissen die Fundamente des Hauses durchnässt. Und wo Feuchtigkeit ist, ist leider auch Schimmel.«
»Kann man was dagegen machen?«
Sie schüttelt den Kopf, und wir gehen zurück durch die Tür, die sie sofort hinter uns schließt. Mit einer dicken Wand zwischen mir und dem Ostflügel habe ich das Gefühl, freier atmen zu können. »Es gibt keine einfache Lösung, wie Sie sich vorstellen können.«
»Den Rest des Hauses hat der Pilz nicht befallen?«
Sie schüttelt den Kopf, was mich erleichtert.
»Allerdings spürt man schon ein paar Auswirkungen«, gibt sie zu. »Das Telefon funktioniert die meiste Zeit, aber manchmal eben nicht. Das Licht ist gleichermaßen launisch, deshalb halten wir immer Petroleumlampen bereit.«
Ich nicke. »Meine Eltern verwenden sie auch noch. Sie erinnern sich noch gut an die Stromausfälle im Krieg und wollen nicht, dass mein Bruder und ich zu sehr von Elektrizität abhängig sind.«
»Sehr gut.«
Sie geht zurück, und ich folge ihr durch den westlichen Teil des Hauses, der moderner zu sein scheint. Ich vermute, dass er ungefähr in den letzten zehn Jahren ausgebaut wurde. Der Ostflügel wirkt altmodischer, mit höheren Decken und überhängenden Obergeschossen. Vielleicht ist das der Grund, warum er so schlimm befallen ist. Er ist älter, also möglicherweise weniger resistent gegen diese Art von Schaden.
»Wie weit ist es zum Dorf?«, frage ich.
»Zu weit, fürchte ich. Aber ich glaube, Sie werden hier alles haben, was Sie brauchen. Der Postbote kommt donnerstags; wenn Sie Briefe haben, legen Sie sie einfach in die Halle.«
Ich bemühe mich, meine Enttäuschung nicht zu zeigen. Keine Glotze, kein Telefon und nur einmal die Woche Post. Sonny und Cher sind morgen Abend bei Top of the Pops!
»Wie dem auch sei«, seufzt sie. »Ich zeige Ihnen jetzt Ihr Zimmer, ja? Und dann können Sie sich waschen.«
Sie geht mit mir die Treppe hinauf zum oberen Teil des Hauses.
»Wie ich gehört habe, sind Sie Krankenschwester?«, fragt sie.
»Ja.«
Ich sage das voller Zuversicht, obwohl ich gar nicht weiß, ob ich je wieder Krankenschwester sein werde. Ich hatte gedacht, Schwester Clark würde eine Ausnahme für mich machen, wenn ich niemandem etwas von meiner Schwangerschaft sage, aber sie schien von der Idee nicht sonderlich begeistert zu sein. »Alle waren dagegen, dass ich Krankenschwester werde«, erzähle ich Mrs. Whitlock und verrate damit mehr, als ich vielleicht sollte. »Meine Eltern sind ziemlich altmodisch. Sie finden, ich hätte Ehe und Kinder einer beruflichen Karriere vorziehen sollen.«
Mrs. Whitlock mustert mich genauer; dieses kleine Eingeständnis scheint ihr Interesse zu wecken. »Ich verstehe. Sie sind wohl eine kleine Rebellin, Miss Gorham.«
»O bitte«, sage ich mit brennenden Wangen. »Nennen Sie mich Pearl. Selbst meine Patienten duzen mich.«
»Also warum …?«, beginnt sie, und ich weiß schon, was sie fragen will.
Wir erreichen den ersten Stock, und ich versuche zu verbergen, wie sehr ich außer Atem bin. Aber sie bemerkt es und bleibt kurz stehen, bevor wir die nächste Etage in Angriff nehmen.
»Ich lag ein Jahr lang im Krankenhaus«, erkläre ich. »Ich war sieben. Hirnhautentzündung.«
»Ach du meine Güte«, sagt sie und hält sich die Fingerspitzen vor den Mund. »Ein ganzes Jahr? Da muss es Ihnen … dir sehr schlecht gegangen sein.«
»Das stimmt.«
Ich denke zurück an die langen Tage im Krankenhaus und daran, wie ich mich nach dem Geruch meiner Mutter gesehnt habe. Ich war völlig verzweifelt, weil meine Eltern mich nicht besuchen durften. Eine der Krankenschwestern, Schwester Haddon, nahm mich oft in den Arm, wenn ich weinte, und damals schwor ich mir, dass ich, wenn ich jemals dort herauskommen würde, selbst Krankenschwester werden und allen, die so elendig und von Heimweh geplagt sind wie ich, das Leben ein kleines bisschen leichter machen würde. Mit 16 begann ich als Aushilfsschwester und verdiente vier Pfund die Woche, indem ich die Krankenzimmer putzte und für die Patienten kochte, bevor ich mit der eigentlichen Schwesternausbildung anfing. Ich habe hart gearbeitet, um meinen Job zu bekommen.
»Nun, deine Eltern müssen dich auf eine gute Schule geschickt haben«, sagt Mrs. Whitlock.
Ich nicke. »Das würde ich auch sagen.«
»Ich frage deshalb, weil ich dir sehr dankbar wäre, wenn du Wulfric etwas Unterricht geben könntest.«
»Wulfric?«
»Mein Enkel.« Sie seufzt traurig. »Er ist 14. Er geht nicht mehr zur Schule. Mein Mann hat ihn unterrichtet, bis er krank wurde, und jetzt versuche ich, so gut ich kann, in seine Fußstapfen zu treten. Aber ich fürchte, dass es nicht immer ganz reibungslos läuft, wenn man Familie und Erziehung vermischt.«
Ich muss an das denken, was Mr. Peterson mir während der Fahrt erzählt hat – dass die Whitlocks ihren einzigen Sohn verloren haben. Wulfric muss das Kind dieses Sohnes sein. Vermutlich lebt er seit dem Tod seines Vaters hier bei den Großeltern. Was für eine Tragödie.
»Ich helfe gern.«
Sie lächelt gütig. »Jetzt musst du dich erst einmal eingewöhnen. Aber vielleicht können wir in einer oder zwei Wochen mit dem Unterricht beginnen?«
Wir gehen die nächste Treppe hinauf. Unsere kleine Unterhaltung hat mich zuversichtlicher gestimmt. Es mag hier keinen Fernseher geben und das ganze Haus ist so still wie ein Grab, aber die Aussicht, Mrs. Whitlocks Enkel zu helfen und meine Fähigkeiten zum Einsatz zu bringen, erfüllt mich mit Hoffnung. So habe ich wenigstens etwas zu tun.
»Da sind wir«, sagt sie und führt mich in ein rundes Zimmer am Ende der letzten Treppe, das offensichtlich in einem der Türme liegt. Die Vorhänge sind zu einem samtenen Halbmond gerafft und eine Lampe erfüllt den Raum mit einem honiggelben Licht. Alles ist wunderschön – ein Einzelbett mit Messinggestell, bedeckt mit frischer weißer Leinenbettwäsche, ein gusseiserner Kamin mit einer Vase rosafarbener Rosen auf dem Sims, ein Kleiderschrank und eine Kommode. Und eine Wiege. Ich versuche, sie zu ignorieren. Fast war es mir gelungen, den Grund meines Aufenthalts zu vergessen.
»Es ist perfekt«, sage ich und klappe einen der Koffer auf, die bereits auf dem Fußende des Bettes liegen. Mrs. Whitlock legt den Kopf auf die Seite, um den Inhalt zu inspizieren.
»Gute Güte!«, sagt sie. »Meine Liebe, du hast genug Schuhe, um eine ganze Armee auszurüsten.«
»Ich habe eine Schwäche für Schuhe«, gestehe ich seufzend.
»Ein Mädchen ganz nach meinem Herzen«, vertraut sie mir schmunzelnd an. Als ich das Paar roter Mary Janes aus dem Koffer nehme, grinst uns darunter das Foto von Sebastian entgegen, und mein Magen zieht sich zusammen. Zu spät. Sie hat das Foto schon gesehen.
»Oh«, meint sie, nimmt das Foto heraus und hält es ins Licht. »Was für ein gut aussehender junger Mann.«
»Ja, das ist er«, sage ich wehmütig.
Sie sieht mich an und kneift ihre grauen Augen zusammen. »Ich vermute, das ist kein Familienmitglied …«
Ich schüttele den Kopf. »Nein, das ist … Sein Name ist Sebastian.«
»Ah«, sagt sie mit einem wissenden Nicken. »Der Vater des Babys, nehme ich an?«
Ich schlucke schwer und beobachte, wie sie Sebastians schönes Gesicht betrachtet. »Ja.«
Es ist eine Lüge – Sebastian ist nicht der Vater. Aber ich bringe es nicht über mich, das einzugestehen, nicht vor ihr. Plötzlich fühle ich mich von ihrer Anwesenheit im Zimmer bedrängt.
»Ich glaube, ich werde jetzt ein Bad nehmen«, sage ich leise, und sie tritt zurück und legt das Foto wieder in den Koffer, als würde sie aus einem Zauberbann erwachen.
»Natürlich. Eine Etage tiefer findest du dein eigenes privates Badezimmer. Frische Handtücher sind im Schrank.« Sie lächelt freundlich. Mir fällt auf, dass die Brosche, die sie an ihrem Rollkragenpullover trägt, keine Mohnblume darstellt, wie ich zuerst dachte, sondern einen Fliegenpilz.
»Schön, dass du bei uns in Lichen Hall bist«, sagt sie. »Leistest du meinem Mann und mir morgen zum Frühstück Gesellschaft?«
Ich erwidere das Lächeln und spüre nichts mehr von meiner vorherigen Unbeholfenheit. »Sehr gern.«
3
Mein eigenes Badezimmer und ein Klo, das nicht auf dem Hof ist! Eine Badewanne mit Löwenfüßen, bis zum Rand mit warmem, schaumigem Wasser gefüllt. Ich ziehe mein schmutziges Kleid aus, steige hinein und seufze vor Wonne, als das heiße Wasser all die schmerzenden Stellen benetzt. Meine Kugel ragt über das Wasser, ein massiver Berg, der leicht zittert, als das Baby sich bewegt. Hin und wieder hebt ein winziger Fuß die Haut ein Stückchen an, und ich tätschle ihn, um dem Baby näher zu sein.
Ich lege meinen Kopf auf den Rand der Wanne und zwinge mich, nicht zu weinen. Es ist gut, alles ist gut – wirklich! Ich bin in einem wunderschönen Anwesen und nicht in einem schrecklichen Heim. Bis Weihnachten wird das Baby adoptiert sein, und ich kann wieder nach Hause und so tun, als wäre nichts von alledem je geschehen.
In dem Moment höre ich etwas im Flur, das Knarren eines Dielenbrettes. Ich öffne die Augen und schaue in die Richtung des Geräusches. Ich habe die Tür offen gelassen; vielleicht hätte ich sie schließen sollen, aber ich hasse geschlossene Türen.
Wieder knarrt es.
»Ist da jemand?«, rufe ich. »Wer ist da?«
Irgendwer bewegt sich dort draußen. Ich höre das Schlurfen von Füßen.
»Wer ist da?«, wiederhole ich nachdrücklich. Wenn es Mrs. Whitlock ist oder eine der Hausangestellten von vorhin, dann würde sie doch sicher antworten, oder?
Ich steige aus der Wanne und wickle mich in ein Handtuch, bevor ich auf den Flur trete. Er ist leer. In alten Häusern wie diesem knarrt und quietscht immer irgendwas.
Als ich ins Badezimmer zurückgehen will, sehe ich etwas aus den Augenwinkeln. Am Ende des Flurs greifen ein paar Finger um die Ecke der Wand, direkt darüber lugen eine Stirn und ein Paar Augen hervor.
Ich zucke vor Schreck zusammen und der, dem die Finger und Augen gehören, flitzt in Richtung Treppe davon. Es ist ein Kind, ein kleiner Junge mit buschigen Locken. Mrs. Whitlocks Enkel, denke ich, bis mir einfällt, dass sie gesagt hat, Wulfric sei 14. Der Junge, der die Treppe hinabrennt, ist viel jünger, vielleicht fünf oder sechs.
Ich rufe ihm nach und gehe ein paar Schritte zur Treppe, um ihm zu sagen, dass er nichts zu befürchten hat. Aber er ist schon spurlos verschwunden, wie ein Dieb in der Nacht.
4
Am nächsten Morgen werde ich um kurz nach sieben wach, spät für meine Verhältnisse. Draußen ist es sonnig, helles Licht fällt durch die runden Fenster herein. Was für eine Aussicht! Meilenweit dichter Wald, dahinter erstrecken sich lindgrüne Felder mit Ginster und Hochäckern. Ich packe ein paar Sachen aus, stelle meine Matroschkapuppen auf das Fensterbrett. Sie sind ein Geschenk meiner Großmutter, ein Erbstück aus Schweden, in Rot und Gold bemalt von den Ahnen der Familie. Sie geben mir ein Gefühl der Sicherheit.
Ich nehme meine Lockenwickler heraus und fahre mir mit der Bürste durch die weißblonden Haare. Ich mag es, wenn sie wie Butter glänzen. Die aktuelle Mode verlangt ein aufwendiges Make-up mit falschen Wimpern und kräftigem Lidstrich, aber für so etwas habe ich nie Zeit. Mein Gesicht ist blass und ich habe hohe Wangenknochen, deshalb benutze ich den rosa Lippenstift nicht nur für die Lippen, sondern auch, um meinen Wangen etwas Farbe zu geben. Dazu etwas Wimperntusche, sonst sehe ich wie eine Leiche aus – der Fluch heller Wimpern. Dann ziehe ich das blaue Umstandskleid an, das Tante Fenella mir genäht hat, und gehe nach unten, um die Toilette zu benutzen und mir etwas zu essen zu suchen.
Ich bin ein wenig desorientiert und das Haus ist so verdammt riesig, aber ich schaffe es, den Weg zurückzugehen, den ich gekommen bin, und finde die Küche mit dem benachbarten Esszimmer. Auf der Arbeitsplatte steht ein Korb mit einigen Brötchen; hungrig verschlinge ich eins davon, dann fülle ich mir an der Spüle ein Glas mit Wasser und trinke es aus. Ich komme mir ein bisschen unhöflich vor, weil ich mich selbst bediene, aber Mrs. Whitlock hat gesagt, eines der Mädchen würde um sieben Frühstück machen, also ist es vielleicht okay.
Ich finde den Teekessel und etwas Tee. Während ich darauf warte, dass das Wasser kocht, sehe ich mir das Esszimmer nebenan an: ein Kamin mit Holzsims und ein ovaler Tisch mit unbequem aussehenden Stühlen. Am Fenster stehen Säulen mit Marmorbüsten ernster, maskuliner Gesichter.
Das ganze Haus fühlt sich viel zu formell an, um irgendjemandem als Zuhause zu dienen – es ist seelenlos, die Sorte Haus, in der man sich leicht sehr einsam fühlen kann. Ich muss an den kleinen Jungen denken, der gestern Abend die Treppe hinuntergerannt ist, und an Mrs. Whitlocks Enkel Wulfric. Was halten die beiden von diesem Ort? Es ist definitiv kein Haus für Kinder.
Ich betrachte die Gemälde an der Wand und die paar Antiquitäten auf dem Kaminsims und suche alle Ecken und Winkel nach irgendwelchen Anzeichen von Pilzen ab. Zum Glück finde ich nichts. Seit Mrs. Whitlock mir den Schaden am Ostflügel gezeigt hat, überprüfe ich unentwegt die Wände und die Ritzen zwischen den Bodendielen auf Spuren dieses grässlichen schwarzen Pilzes. Von dem Geruch ist mir übel geworden. Ich weiß über die Gefahren von Pilzsporen Bescheid – die Hirnhautentzündung, die ich mit sieben bekam, war eine Kryptokokkenmeningitis, die von Pilzen hervorgerufen wird.
Ich gehe hinaus in die Eingangshalle und sehe mich um – hohe Decken mit Stuckverzierungen und Engelsköpfen in den Ecken; ein Fliesenboden, der schon bessere Zeiten gesehen hat; Holzvertäfelungen an den Wänden, die alles sehr düster machen. Es ist kalt, obwohl die Fenster geschlossen und überall Heizkörper angebracht sind. Die Außenwand der Küche hängt voll mit Fotografien, die ich mir genauer ansehe.
Mein Gott, die Whitlocks sind wirklich herumgekommen. Alle berühmten Sehenswürdigkeiten sind auf diesen Fotos: der Eiffelturm, die Pyramiden, die Niagarafälle. Die Bilder zeigen immer das gleiche Ehepaar, mal jung, mal älter, Arm in Arm posierend, später mit einem Baby. Vermutlich die Whitlocks und ihr Sohn. Ich muss wieder daran denken, was Mr. Peterson mir erzählt hat – dass ihr Sohn ums Leben kam und diese Tragödie sie so sehr erschüttert hat, dass sie seinen Leichnam aus der Leichenhalle holten. Ich frage mich, ob an dem Gerücht etwas dran ist. Es erscheint mir sehr bizarr. Aber mittlerweile ist mir schon klar, dass die Whitlocks keine normale Familie sind.
Neben den Fotografien hängt ein Gemälde von einer Fee, die ein Baby im Arm hält. Es ist ein merkwürdiges Bild, dem Aussehen nach sehr alt, mit einer Messingplakette am unteren Rand. Die Fee ist grotesk dargestellt, mit Klauen als Händen und einem lang gestreckten Körper. Der Gesichtsausdruck ist verschlagen. Das Bild passt überhaupt nicht zu den anderen. Vielleicht ein Erbstück.
Es ist ein klarer, frischer Morgen, deshalb hole ich meine Jacke und gehe nach draußen, denn ich möchte gern den alten Wald sehen, den Mrs. Whitlock erwähnt hat. Eine Seite des Hauses grenzt an einen langen Streifen Gras mit einigen Bäumen, aber auf der anderen Seite gibt es Gärten, die durch lange Rosengänge und Mauern abgetrennt sind. Ich entdecke Steinstatuen von Tieren unter den überwucherten Rändern, und ein bezaubernder Schotterweg führt durch etwas, das wohl einmal ein üppiger Rosengarten war. Ein Bächlein fließt durch die Gärten, überspannt von einer kleinen Steinbrücke. Ich bleibe auf der Brücke stehen und lasse meinen Blick über die Bäume und Sträucher schweifen. Genau geradeaus ragt eine große Weide auf, deren dicke Äste sich wie grüne Wasserfälle auf das Gras ergießen.
Etwas bewegt sich im Schatten ihres Stammes, etwas Kleines, Schnelles. Ein Kaninchen. Als ich einen Schritt nach vorn gehe, um besser zu sehen, wird das Kaninchen von etwas geschnappt und das Weiß seines Schwanzes schnellt nach oben zwischen die Äste. Eine Falle.
Das Kaninchen zappelt einige Sekunden kopfüber, dann rührt es sich nicht mehr.
Erschrocken schlage ich die Hände vor den Mund. Als ich auf das Kaninchen zugehe, sehe ich jemanden aus der anderen Richtung kommen. Es ist eins der Mädchen, die mir gestern Abend mit dem Gepäck geholfen haben, das mit dem ernsten und etwas schiefen Gesicht – schwarzer Pferdeschwanz, der gleiche selbstbewusste Blick wie gestern, eine Haut wie Gold. Sie trägt ein altes weißes Hemd und einen schwarzen Rock über Gummistiefeln. Als sie näher kommt, sieht sie mich nicht an, sondern zieht ein scharfes Messer aus dem Gürtel und schneidet das Seil durch, an dem das Kaninchen hängt.
Ich bin zu geschockt, um sie zu begrüßen. Und so starren wir uns nur über das Gras an, ich mit großen Augen und offenem Mund, sie mit grimmiger Entschlossenheit. Und dann wirft sie sich das tote Kaninchen wie ein Geschirrtuch über die Schulter und stapft davon.
»Sie fressen das Gemüse«, sagt eine Stimme. Ich drehe mich um und sehe das andere Mädchen, Aretta, hinter mir. Ein Strohhut sitzt auf ihrem Kopf, unter dem sich ein schwarzer Haarzopf über ihre Schulter hervorschlängelt. Sie trägt die gleiche maskuline und etwas zu große Kleidung wie Rahmi und ihr Gesicht glänzt vor Schweiß. »Wir müssen sie fangen, damit sie nicht unsere Ernte vernichten. Soll ich es dir zeigen?«
»Ja, gern«, antworte ich, obwohl ich noch zu schockiert bin vom Anblick des getöteten Kaninchens, um wirklich zu hören, was sie gefragt hat.
Ich folge ihr zur hintersten Ecke des Gartens, vorbei an der Weide und durch ein Tor, an dem ein rostiges Schild mit der Aufschrift WINTERGARTEN hängt. Es ist eine ausgedehnte Parzelle, begrenzt von hohen Steinmauern. Lauch, Karotten, Kohl und Kartoffeln wachsen in langen Reihen in der schwarzen Erde, in einem Glashaus sind Erbsen und Tomaten zu sehen. In der Mitte steht eine Vogelscheuche und ganz in der Ecke ein Gewächshaus voller Pflanzen.
»Ich bin Pearl«, sage ich. »Ich bin gestern Abend angekommen.«
»Aretta.« Sie richtet sich auf. »Gärtnerst du?«
Ich schüttele den Kopf und lache nervös. »Ich habe niemals auch nur einen Rasen gemäht. Ist das nicht furchtbar? Kümmerst du dich um diesen Garten oder …?«
Aretta ignoriert meine Frage und bückt sich, um etwas Unkraut auszurupfen. »Wann ist dein Termin?«
»Oktober.«
»Hat Mrs. Whitlock gesagt, was deine Aufgabe ist?«
»Meine Aufgabe?«
»Sie lässt alle hier arbeiten.«
Das macht mich nachdenklich. Sind die beiden Hausangestellte oder sind sie aus dem gleichen Grund hier wie ich? Aber keine von ihnen scheint schwanger zu sein. »Sie hat irgendwas davon gesagt, dass ich ihren Enkel Wulfric unterrichten soll.«
Aretta zieht eine Augenbraue hoch. »Na, viel Glück dabei.« Sie geht zu einer Reihe Tomatenpflanzen, und ich bleibe stehen und denke über diese Bemerkung nach. Wahrscheinlich mag sie Mrs. Whitlocks Enkel nicht besonders. Ich sehe ihr zu, wie sie die Pflanzen gießt und die Pflanzstöcke gerade rückt.
»Gestern Abend habe ich einen kleinen Jungen gesehen«, sage ich etwas lauter. »Weißt du, wer das sein könnte? Ich glaube, ich habe ihn erschreckt.«
Sie sieht mich misstrauisch an. »Ein kleiner Junge?«
»Ja. Er hatte einen Schlafanzug an und war ungefähr fünf oder sechs Jahre alt.«
Sie zuckt mit den Schultern. »Gibt hier keine Fünf- oder Sechsjährigen, von denen ich wüsste.«
»Bist du sicher?«
»Absolut sicher«, antwortet sie entschieden.
Ich spüre, dass ich hier einen Nerv getroffen habe. »Na, das ist seltsam. Vielleicht war er ein Geist.«
»Vielleicht.«
Ich bin mir nicht sicher, was ich von diesem Kommentar halten soll – oder überhaupt von Aretta. Sie zeigt mir die kalte Schulter und benimmt sich, als hätte sie keine Zeit für mich. Ich warte noch ein paar Minuten, bevor ich den Wink verstehe und den Garten verlasse.
Ernüchtert gehe ich zu Lichen Hall zurück. Mit einer gewissen Eingewöhnungszeit muss ich wohl rechnen.
Als ich wieder im Haus bin, entdecke ich das Telefon auf dem Tischchen vor der Küche. Ich schaue mich nach jemandem um, den ich fragen kann, ob ich telefonieren darf, aber dann fällt mir ein, dass Mrs. Whitlock gesagt hat, das Telefon funktioniere nur gelegentlich. Vorsichtig nehme ich den Hörer ab und halte ihn ans Ohr. Ich höre ein Freizeichen. Gott sei Dank. Schnell wähle ich die Nummer meiner Eltern, während ich mit einem Auge die Treppe beobachte, ob jemand kommt.
Mrs. McQuade, unsere Haushälterin, meldet sich. Meine Mutter ist einkaufen, sagt sie. Sie wird bald zurück sein, und Mrs. McQuade verspricht mir, sie zu bitten, mich zurückzurufen. Die Verbindung bricht ab, bevor ich mich verabschieden kann.
Ich setze mich auf den Stuhl neben dem Telefon, um auf den Rückruf zu warten, nehme sogar hin und wieder den Hörer ab, um zu überprüfen, ob die Leitung wieder funktioniert. Sie ist immer noch tot, aber ich will nicht fortgehen, falls meine Mutter sich meldet.
Unvermittelt sehne ich mich danach, ihre Stimme zu hören.
Ich muss eingenickt sein, denn als ich wieder aufblicke, ist es dunkel. Ich höre ein Geräusch, Räder auf Holz. Der dunkle Flur ist mir plötzlich unheimlich, und ich spüre, wie mein Herz rast.
»Wer ist da?«, frage ich mit bebender Stimme.
Das Geräusch wird lauter, ein schrilles Quietschen. Ich stehe auf und stelle mich auf Kampf oder Flucht ein. Plötzlich schält sich ein Bild aus der Finsternis: Mrs. Whitlock, die jemanden in einem Rollstuhl schiebt. Das Quietschen kommt von den Rädern. Ich zittere vor Erleichterung.
»Meine Liebe«, sagt Mrs. Whitlock lächelnd. »Geht es dir gut?«
»Alles in Ordnung«, antworte ich und muss darüber grinsen, wie verschreckt ich gerade noch gewesen bin. »Ich warte darauf, dass meine Mutter zurückruft.« Ich nicke dem Mann zu und strecke ihm die Hand entgegen. »Hi. Ich bin Pearl.«
Der Mann hebt den Kopf ein wenig, scheint aber nicht in der Lage zu sein, meine Hand zu schütteln. Er trägt einen Bademantel und Pantoffeln. Seine Haare sind schneeweiß, sein Bart ist grau und sein Gesicht sieht schlaff aus. Ich bin mir nicht sicher, ob er vollständig zurechnungsfähig ist.
»Das ist mein Mann Joseph«, sagt Mrs. Whitlock. »Er pflegt tagsüber zu schlafen, deshalb bringe ich ihn abends raus an die frische Luft.«
»Mir war nicht klar …«, sage ich und verstumme dann. Ich wusste nicht, dass er im Rollstuhl sitzt.
Sie beugt sich über ihn und sagt laut: »Miss Gorham ist Krankenschwester, Liebling. Und sie wird Wulfie beim Lernen helfen.«
Er hebt den Kopf etwas weiter und sieht mich an – oder durch mich hindurch, ich bin mir nicht sicher. Aber dann hält er mir in einer seltsam verstohlenen Bewegung den Arm entgegen, als wollte er meine Hand nehmen. Ich trete vor und ergreife seine. Sein Händedruck ist kräftig und er murmelt etwas.
»Wie bitte, mein Lieber?«, fragt Mrs. Whitlock. Sie beugt den Kopf zu ihm hinab, kann ihn aber nicht richtig verstehen.
»Mein Auge«, murmelt er. »Da ist was in meinem Auge.«
Ich sehe Mrs. Whitlock fragend an.
»In deinem Auge ist nichts, Liebling«, sagt sie.
»Ich kann mal nachsehen«, biete ich an. Trotz Mrs. Whitlocks Protesten beuge ich mich vor und versuche, etwas zu sehen. Er reißt seine blauen Augen weit auf und dreht sein Gesicht zu mir. Fauliger Atem weht mir entgegen. Aber ich kann nichts Besorgniserregendes entdecken. »Vielleicht ein Haar?«
»Hinter meinem Auge«, sagt er und zeigt mit einer adrigen Hand auf sein rechtes Auge. Ich sehe noch einmal nach, aber das Licht ist schlecht und ich kann keine sichtbare Verletzung oder Entzündung entdecken.
»Ich werde nachsehen, wenn ich ihn wieder in sein Zimmer bringe«, versichert mir Mrs. Whitlock. »Dort ist besseres Licht. Wahrscheinlich eine Reaktion auf seine Medikamente. Hast du etwas gegessen?«
»Nicht seit dem Frühstück.«
Sie macht ein langes Gesicht. »Aretta? Aretta!«
Schritte erklingen auf der Treppe und Aretta taucht auf. Sie hat sich umgezogen, trägt jetzt ein altmodisches schwarzes Kleid und hat ihre Haare glatt nach hinten gebunden. In der Hand hält sie ein gebügeltes Bettlaken, als wäre sie gerade dabei gewesen, die Betten zu machen.
»Bring unserem Gast etwas zu essen, sei so gut, ja?«, sagt Mrs. Whitlock.
Aretta nickt. »Ja, Ma’am.«
Sie macht kehrt und verschwindet in der Dunkelheit der Eingangshalle. Wir folgen ihr in Richtung Küche. Mr. Whitlock ist mittlerweile eingeschlafen, und Mrs. Whitlock nimmt ein Handtuch vom Griff des Rollstuhls, faltet es zusammen und stopft es ihm zwischen Schulter und Kopf.
»Ich muss mich entschuldigen, dass ich heute Morgen nicht mit dir gefrühstückt habe«, sagt sie. »Wie du sehen kannst, geht es meinem Mann nicht gut. Ich muss mich immer noch daran gewöhnen, ihn zu pflegen.«
»Darf ich fragen, was ihm fehlt?«
»Es ist Demenz«, sagt sie traurig. »Im vergangenen Jahr hat sich sein Zustand sehr verschlechtert.«
»Kann ich irgendwie helfen?«
Sie nickt höflich – die Reaktion einer Frau, die es nicht gewohnt ist, Hilfe anzunehmen. »Vielleicht. Aber zuerst musst du etwas essen.«
Damals
Mabel
Dundee, Schottland, Mai – Juli 1959
1
Die Straßen von Dundee sind finster und nass vom Regen. Es ist weit nach Mitternacht, alle Häuser sind dunkel.
Ich gehe schnell, damit ich nicht schwach werde und umkehre. Es ist kalt, aber vielleicht bin ich auch nur nervös – meine Hände wollen einfach nicht warm werden. Ich schiebe sie tief in meine Taschen und versuche, mein Kinn fest an meine Brust zu drücken, um keinen Blickkontakt mit den Leuten aufzunehmen, die in den Schatten lauern. Prostituierte spähen aus dunklen Gassen, nur dünne Qualmfäden bleiben von ihnen, wenn sie sich wieder in ihre Schlupfwinkel zurückziehen. Obdachlose liegen in Schlafsäcken und Pappkartons und der ferne Lärm einer Diskothek hallt über das Kopfsteinpflaster. Je weiter ich gehe, desto mehr Furcht ergreift mich.
Hinter mir höre ich Schritte, die stoppen, wenn ich stehen bleibe, und weitergehen, wenn ich weitergehe. Ich wage es nicht, zurückzuschauen.
Ich gehe den steilen Hügel neben dem Bingosaal hinauf zur Brücke, die über die Bahngleise führt. Hier, denke ich. Hier. Und ich bleibe stehen und blicke nach unten, und in einem plötzlichen machtvollen Augenblick erkenne ich den Wunsch, der schon seit Jahren in mir schlummert: Ich will mich vor einen Zug werfen. Ich will, dass das alles vorbei ist. Nicht nur weil ich ein Geisterbaby in mir habe.
Schon seit Dad gestorben ist, wollte ich, dass alles endet. Ich habe nur nicht gewusst, wie ich es ohne großes Trara anstellen soll. Ein Zug allerdings – das geht schnell.
Also warte ich. Und warte.
Weit und breit kein Zug in Sicht. Aus den Augenwinkeln sehe ich jemanden an einer Straßenecke, der mich beobachtet. Meine Angst hat sich verflüchtigt. Ich will nur, dass alles vorbei ist.
Ich blicke auf die regennassen Gleise hinab. Ratten huschen von einer Seite zur anderen. Zwei Männer streiten betrunken unter der Brücke und rufen sich gegenseitig Beschuldigungen zu.
Ich will springen, aber schweren Herzens gestehe ich mir ein: Die Brücke ist nicht hoch genug.
Wenn ich jetzt springe, überlebe ich.
2
Das Rasseln meines Weckers reißt mich aus dem Schlaf. Ich bin wieder zu Hause, in meinem Bett. Noch am Leben – und untröstlich deswegen. Ich rolle mich unter der Decke zusammen und weine. Noch immer kann ich nicht glauben, dass das, was in Dr. McCanns Praxis geschehen ist, wirklich real ist. Ich fühle mich widerlich, als müsste ich bestraft werden. Aber ich weiß, dass ich nichts getan habe.
Es ist fünf Uhr, draußen ist es noch dunkel. Ich stehe auf, ziehe mich an und bürste mir die Haare aus dem Gesicht. Die Bäckerei ist nicht weit von hier, aber dienstags muss ich die Öfen anheizen, damit Ginny ihre Tochter zur Schule bringen kann.
Auf leisen Sohlen gehe ich die drei Etagen zur Küche hinab. Alle Zimmertüren sind geschlossen, was bedeutet, dass wir ein volles Haus haben. Auch im Erdgeschoss drehe ich kein Licht an, um die Gäste nicht zu wecken.
»Morgen, Prinzessin.«
Ich zucke erschrocken zusammen. Langsam nimmt der Schatten am Tisch menschliche Gestalt an. Richard. Was sitzt er hier im Dunkeln?
»Wo warst du letzte Nacht?«, fragt er.
Ich starre auf den Boden. »Nirgends.«
Er schnalzt leise mit der Zunge. »Lüg mich nicht an, Mabel. Du hast das Haus verlassen. Wo warst du?«
»Spazieren.«
»Um drei Uhr morgens?«
Ich antworte nicht.
»Warst ziemlich lange bei der Brücke, was?«
Er lächelt, aber Richard lächelt immer, ein seltsames kleines Grinsen, das niemals seine Augen erreicht. Er lacht nie oder sagt irgendwas Freundliches, deshalb denke ich bei dem Lächeln manchmal, dass er sich finstere Dinge vorstellt und sich daran erfreut.