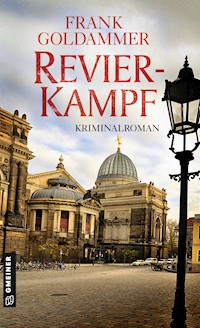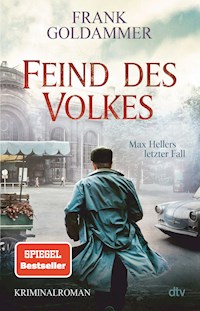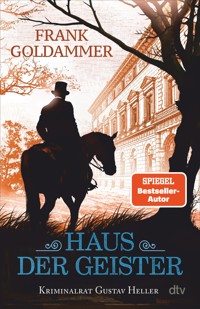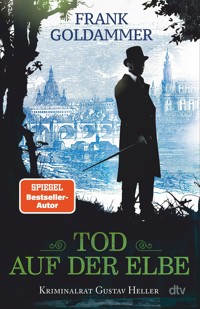9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Serie: Felix Bruch
- Sprache: Deutsch
Während Felix Bruch im Krankenhaus liegt, wird Nicole Schauer Augenzeugin eines dramatischen Vorfalls nahe des Dresdner Altmarkts: Ein Auto rast in eine Menschenmenge, der Fahrer entkommt unerkannt. Schnell verbreitet sich in den sozialen Medien das Gerücht, es handle sich um einen islamistischen Anschlag. Die Stimmung in der Stadt wird spürbar stündlich angespannter. Zur gleichen Zeit verschwindet Bruch unter mysteriösen Umständen von der Station. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Schmidtke sucht Schauer nach dem Attentäter – und nach Bruch. Sie befällt eine Ahnung, dass Bruch in den aktuellen Fall verwickelt sein könnte. Und sie ahnt, dass sie ihn nur finden kann, wenn sie endlich die Rätsel seiner Vergangenheit aufdeckt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 483
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Frank Goldammer
Bruch: Am Abgrund
Kriminalroman
Über dieses Buch
Alles gerät aus den Fugen.
In der Dresdner Innenstadt rast ein Auto in eine Menschenmenge, der Fahrer entkommt unerkannt. Nicole Schauer ist Augenzeugin dieses dramatischen Vorfalls und leistet Erste Hilfe. Zur gleichen Zeit verschwindet Felix Bruch unter mysteriösen Umständen aus dem Krankenhaus. Schauer sucht nach dem Attentäter des Anschlags – und nach Bruch. Sie versteht, dass sie ihn nur finden kann, wenn sie endlich die Rätsel seiner Vergangenheit aufdeckt. Mit ihren Nachforschungen bringt sie nicht nur sich in Lebensgefahr …
Erschütternd und unvorhersehbar. Der finale Fall für Bruch und Schauer.
Vita
Frank Goldammer, 1975 in Dresden geboren, ist Handwerksmeister und kam, neben seinem Beruf, schon früh zum Schreiben. Mit seinen Büchern landet er regelmäßig auf den Bestsellerlisten. Der Autor lebt mit seiner Familie in seiner Heimatstadt.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juli 2025
Copyright © 2025 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung Hafen Werbeagentur, Hamburg
Coverabbildung Silas Manhood/Trevillion Images; Shutterstock
ISBN 978-3-644-01915-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
1
«Lass es uns heute tun», flüsterte sie.
Er roch sie, ihren Körper, ihre Haare. Er konnte noch riechen, was sie zum Abend gegessen hatten, roch, dass es ihr heute Morgen gelungen war, sich vor der eisigen Dusche zu drücken. Er konnte ihre Angst riechen. Gierig saugte er alles auf, das Wispern ihrer Stimme, das wilde Flackern in ihren Augen. Glanz, der um sie herum entstand wie ein Elmsfeuer.
Seit drei Wochen war sie hier. Drei Wochen, in denen es ihnen nicht gelungen war, sie zu brechen, ihren unbändigen Willen zu zähmen. Eine ganze Woche saß sie im Loch. Hatte gelacht, als sie sie wieder herausholten. Ihm war das Herz gehüpft, als er sie wiedersah, hatte schon geglaubt, sie hätten sie fortgeschafft.
«Heute?», fragte er.
«Jetzt!», flüsterte sie.
Die anderen waren schon im Schlafsaal, und es war noch nicht aufgefallen, dass sie und er fehlten.
Ein paarmal war er im Loch gewesen. Nie hatte er gelacht, als man ihn wieder herausholte. Noch nie hatte er gelacht. Klick.
Etwas hatte ihr Erscheinen hier bei ihm ausgelöst. Zu alt schien sie schon, kein kleines Kind wie die allermeisten, die man herbrachte. So alt wie er, wenigstens.
Sie wäre begabt, müsste nur lernen, ihr Talent zu nutzen, hatte Großvater ihm erklärt. Er wäre gar nicht sein Großvater, hatte sie ihm zugeraunt. Ein Gedanke, der sich in seinem Hirn festgefressen hatte, der sich ausbreitete wie die Wurzeln einer Pflanze, die sich vorantasteten, scheinbar zart und fragil, sich jedoch in die kleinste Vertiefung bohrten, wuchsen, sprengten, was sich ihnen als Widerstand bot. Warum sollte er behaupten, sein Großvater zu sein, wenn es nicht so war? War er doch nur eines unter diesen vielen Kindern hier? Eines von denen, die am längsten hier waren. Zehn Jahre, wenn man dem Weg der Sonne und dem Rhythmus der Jahreszeiten trauen konnte. Klick.
«Warum noch einen Tag warten?», flüsterte sie, hatte sein Zögern gespürt, seine Zweifel. «Was ist morgen anders als heute?»
Licht hatte sie in sein Leben gebracht. Farbe. Geschmack. Gefühle. Wie sie ihn ansah, schon bei der ersten Begegnung angesehen hatte. Da war ein Leuchten durch den Saal gegangen, das von ihr ausging. Nur er hatte es gesehen. Ihre erste Berührung, streng verboten, dass man andere berührte. Sie war wie ein elektrischer Schlag gewesen, wie ein Schmerz, der jedoch nie enden sollte.
«Du musst dich entscheiden», flüsterte sie. Er wusste, er müsste sich jetzt entscheiden. In diesem Moment wahrscheinlich wurde durchgezählt, oder jemand meldete die beiden leeren Betten.
So viel hatte sie ihm gezeigt, hatte sie ihm erzählt von draußen vor den Mauern, hinter dem Wald. Berührt hatte sie ihn, ihm die Augen geöffnet. Das war schön und grausam zugleich, denn jetzt sah er. Wie sie hier lebten. Abgeschottet von allem. Von Wärme. Licht. Leben. Keinen Tag länger wollte er hierbleiben. Er wollte, was sie ihm versprach.
«Alles hier ist falsch», flüsterte sie, nahm seine Hand.
«Aber wie?», fragte er.
«Feuer!», wusste sie sofort Antwort. «Dann müssen sie die Türen öffnen und alle hinauslassen.»
«Und dann?», flüsterte er und hatte sich schon entschieden.
«Es wird sich zeigen.» Klick.
Nicole Schauer wandte sich ab vom Fenster ihrer Wohnung im dritten Stock im schönen Stadtteil Dresden-Striesen. Eine hübsche Dreizimmerwohnung, die sie sich noch gemeinsam mit ihrem Verlobten gemietet hatte, im Glauben, endlich das gefunden zu haben, wonach sie wohl zwanzig Jahre gesucht hatte. Ein Zimmer mehr als nötig, falls noch was kommt. Eine ausgestandene Krebserkrankung, eine unerwartete Trennung und einen Faustschlag später, der einen Trümmerbruch seines Nasenbeins nach sich zog, wohnte sie allein hier. Weil sie darauf bestanden hatte. Weil Sebastian wohl die Lust vergangen war zu widersprechen. Doch es war ein Fehler gewesen. Weil die Wohnung nun mit schlechten Erinnerungen behaftet war. An die gescheiterte Beziehung, an die Illusion, der sie sich einige Monate lang hingegeben hatte, an viele Nächte der Einsamkeit, in denen sie den Umhang aus Härte und Unnahbarkeit abgelegt und hemmungslos geheult hatte. Oder Wein gesoffen. Oder beides.
Sie sah zur Couch, wo die Katze lag, die sie aus Felix Bruchs Wohnung zu sich geholt hatte. Diese blickte sie mit halb geschlossenen, jedoch irgendwie interessierten Augen an.
«Na, du», meinte Schauer und setzte sich zu dem Tier. Sofort war wieder der Drang da, sich zu erheben, zur Tür zu gehen. Zu sehen, ob sie abgeschlossen war. Ans Fenster zu treten, zu sehen, ob sich auf der Straße etwas Seltsames tat.
Sie begann der Katze den Nacken zu kraulen, was diese sich gern gefallen ließ, dabei die Augen schloss, schnurrte. Sie hatte keinen Namen für sie gefunden, obwohl sie es Felix angekündigt hatte, ihr einen zu geben, der dann für immer gelten sollte. Zwei Wochen war das her. Nichts wollte ihr passend erscheinen. Minka, Mathilda, Alli, nicht einmal Miez. Katze. Die Katze. Vier Jahre war sie schon ohne Namen ausgekommen. Ihr jetzt einen Namen zu geben, war, als spräche man Mutter oder Vater plötzlich mit ihren Vornamen an.
Sie hielt es nicht mehr aus, erhob sich, lief in den Flur, sah den Schlüssel im Schloss stecken, wusste, wenn sie ihn drehte, würde er schon auf Anschlag sein. Wusste, wenn sie klinkte, würde die Tür sich nicht öffnen lassen. Sie lauschte, wohl wissend, dass jemand, der hinter der Tür lauern mochte, all ihre Bewegungen und Handlungen mitbekommen und kein Geräusch machen würde. Dann lief sie ins Wohnzimmer, an der Couch vorbei, die Katze nicht beachtend zum Fenster, näherte sich vorsichtig der Scheibe, sah nach dem Wagen, der vorhin eingeparkt war und dessen Fahrer noch im Auto sitzen geblieben war. Nun fuhr ein anderer Wagen viel zu langsam die Straße entlang. Ein leises Geräusch kündigte die Katze an, sie war von der Couch gesprungen. Gleich würde sie an ihr vorbei auf das Fensterbrett springen. Schon geschah es. Und wie immer sah die Katze nicht zum Fenster hinaus, sondern sie an. Direkt in die Augen.
Sie musste raus, wusste Schauer schon länger. Nicht nur raus aus der Wohnung, Bruch in der Klinik besuchen, wie sie es jeden Tag getan hatte. Ihm war ein Bart gewachsen, weil keiner wagte, ihn zu rasieren. Er starrte meist nur. Nein, sie musste zurück in den Job. Man hatte sie freigestellt. Bezahlt. Wegen der starken psychischen und physischen Belastung der letzten Ermittlungen. Es war gerade zwei Wochen her, dass jemand einen Anschlag auf sie verübt hatte, sie mit Abgasen von einem Dieselgenerator hatte vergiften wollen. Zwar schien der Schuldige ausgemacht, war schwerstverletzt noch auf dem Weg ins Krankenhaus verstorben, aber wusste man es mit Sicherheit?
Aber sie musste zurück, es hatte keinen Zweck, in der Wohnung zu hocken. Immer verrückter zu werden, in eine Paranoia zu rutschen. Sie musste raus, musste gegen ihre Angst ankämpfen, jemand könnte ihr nach dem Leben trachten. Obwohl es gerade zwei Wochen her war, dass ein ganzes Magazin aus einer Maschinenpistole auf ihren Dienstwagen abgefeuert wurde, in dem sie eigentlich hätte sitzen sollen. Und auch gesessen hätte, wäre Bruch nicht ausgestiegen und sie ihm gefolgt.
Allein der Weg zum Krankenhaus jeden Tag war eine Tortur für sie. Sie sah öfter in die Rückspiegel als nach vorn, sie vermutete hinter jedem Fahrzeug, das sich näherte, hinter jeder hektischen Bewegung rechts und links ein neues Attentat. Nachts schlief sie kaum, weil jedes Geräusch sie weckte, und Bruch war auch keine Hilfe. Konnte keine sein, mit gebrochenen Armen und Rippen, mit durchbohrter Lunge und Prellungen am ganzen Leib. Aber auch psychisch konnte er nicht helfen. Lag apathisch in seinem Bett, ein seltsames Grinsen im Gesicht, das nur sie sah, weil sie in den letzten Monaten seine Gesichtszüge studiert hatte. Dabei flackerten seine Augen, als folgten sie einem hektischen Cartoon.
Der lag da, nahm sie zwar wahr, aber sagte nichts. Starrte nur, als wäre er in seinen Gedanken ganz woanders. Schönen Dank auch, dachte sie. Nein, korrigierte sie sich, ohne ihn wäre ich tot.
Die Katze war ihr Trost. An ihr hatte sie ihr Dasein der letzten Tage festgemacht. Nachdem die Angst, jemand könnte einbrechen und vollenden, was zwei Mal nicht gelungen war, zu übermächtig wurde. Solang das Tier nicht den Kopf hob, solang sie auf der Couch schnurrte, durch die Wohnung strich, ihr immer auf den Fersen, so lange würde nichts geschehen.
Schauer spürte eine Berührung an ihrem Arm. Die Katze schmiegte ihren Kopf an. Wollte gekrault werden. Es war fast, als hätte sie ihre Gedanken gelesen. Schauer stricht ihr mit der flachen Hand über die ganze Länge des Rückens. Nichts stimmte hier. Nichts war normal. So viel schräges Zeug hatte sie in den letzten sechs Monaten bei der Dresdner Kripo erlebt. Hier ging was vor. Etwas, das schon jahrzehntealt war, etwas, das schon begonnen hatte, ehe Bruch überhaupt geboren worden war. Vielleicht sogar noch irgendein alter DDR-Irrsinn. Irgendetwas auf jeden Fall, das von ganz oben gedeckt und vertuscht wurde. Oder auch nicht. Denn warum lebte sie dann noch? Warum lebte dann Bruch noch, dem man im Krankenhaus ganz leicht eine Sepsis, einen Milzbrand, einen Infekt unterjubeln könnte.
Sie sah runter, sah, dass die Katze ihr wieder in die Augen blickte, als versuchte sie ihr ins Gehirn einzudringen. Als wäre sie hier, um sie zu betrachten.
«Oh Mann», flüsterte Schauer, «ich werde hier noch ganz irre.»
Es war nicht nur die Paranoia, die sie langsam wahnsinnig machte. Es war auch die Langeweile. Sie wusste mit sich nichts anzufangen, brauchte eigentlich etwas, um sich zu beschäftigen. Ein Hobby, doch ihr fiel nichts ein, was ihr Spaß machen könnte. Was sie interessierte, nämlich nach der Klinik im Wald zu forschen, nach diesem Professor Hirte und dessen Frau, von denen Bruch glaubte, es wären seine Großeltern, das wagte sie nicht. Weil sie glaubte, dass es jemanden gab, der Zugriff auf ihren Computer hatte. Der sah, wonach sie suchte, und dem sicher nicht gefiel, wenn sie weiter nach der Klinik forschte. Das war paranoid, aber Fakt war, dass die Klinik noch in tiefsten DDR-Zeiten gegründet worden war, getarnt als Waisenhaus, oder ursprünglich ein Waisenhaus, und dass man dort offensichtlich nicht nur sehr streng und lieblos mit den Kindern umgegangen war, wie man es von den Jugendwerkhöfen schon kannte. Nein, hier schien noch mehr vor sich gegangen zu sein. Irgendeine Art von Forschung, die in einem demokratischen Rechtsstaat niemals möglich gewesen wäre. Möglich sein sollte, korrigierte sie sich. Denn was auch immer mit Bruch gemacht wurde, das musste ja nach dem Mauerfall und der Wiedervereinigung weitergeführt worden sein, bis weit in die Neunzigerjahre und danach. Und das war auch der Grund, warum sie jetzt in Gefahr schwebte, weil es noch Menschen gab, die Interesse daran hatten, all dies zu vertuschen. Ihr kam es absurd vor, dass sie über etwas Derartiges nachdachte, denn das war ja genau diese Art von Spekulation, wie sie diese Aluhüte und Verschwörungstheoretiker betrieben. Sie musste wirklich aufpassen, nicht in diesen Gedankenstrudel zu geraten. Sie musste sich an Fakten halten. Um an diese zu gelangen, müsste sie aus der Deckung kommen. Sie müsste allein zu der Klinikruine fahren. Noch einmal. Müsste sich Zeit nehmen, noch genauer nach Informationen suchen. Über Bartko zum Beispiel, dessen Namen sie dort auf einem Türschild gefunden hatte. Bruchs Freund und Kollege, der angeblich bei einem Autounfall verbrannte, von dessen Leiche jedoch keine Überreste gefunden worden waren. Er schien da gewesen zu sein, als Pfleger vielleicht oder als privilegierter Patient, da er einige Jahre älter als Bruch war. Aber wenn dieser Bartko gar nicht tot war, wo war er dann, welche Funktion hatte er ausgeübt? War er Bruchs Beschützer gewesen? Sein Leidensgenosse, sein Bewacher?
Schauer nahm ihren Laptop vom Couchtisch, klappte ihn auf, zögerte. Schon einmal hatte jemand Nachforschungen zur Klinik angestellt und starb daraufhin. Suizid. Ein junger Historiker, Christian Kleiber war sein Name.
Konnte es nicht eigentlich egal sein, fragte sich Schauer, hatte sie nicht sowieso nichts zu verlieren? Kaum Kontakt zu ihren Eltern, der Kontakt ihrer Schwester kaum erträglich, wegen all der Idylle, den kleinen Kindern, dem Häuschen im Grünen. Und sie selbst: keine Freunde, keinen Mann, keine Kinder. Beim Chef auf der schwarzen Liste. Sie streckte die Arme aus, öffnete die Suchmaschine. Christian Kl… schrieb sie, da sprang die Katze auf den Couchtisch und warf sich spielerisch gegen ihren Arm. Schauer erstarrte und kniff kurz die Augen zusammen. Sie musste lachen, so absurd war das. Doch zu lange sollte sie nicht lachen, denn das würde der Hysterie nur den Weg frei machen, die gerade in ihr nach oben kroch. Sie klappte den Laptop zu, kraulte der Katze den Bauch.
«Du hast ja recht», sagte sie, «es ist mir nicht egal.»
Dann klappte sie den Laptop erneut auf, öffnete das E-Mail-Programm. Sie suchte die Adresse ihres Chefs und schrieb: «Komme morgen zum Dienst.»
Er müsste Angst empfinden, das wusste er, denn früher hatte er Angst empfunden. Sie schlichen die Treppe hinab in den Keller, und noch hatte man ihr Fehlen nicht entdeckt im Schlafsaal, oder der Aufseher glaubte, sie müssten mit speziellem Auftrag versehen etwas erledigen. Würde man sie ertappen, wie sie in den Keller eindrangen, dorthin, wo sonst keiner freiwillig ging, die Strafe würde unaussprechlich sein. Ein Monat im Loch, vielleicht auch zwei. In völliger Isolation, ohne Licht, ohne jeden Reiz der Sinne. Nur mit sich selbst. Selbst die Nahrung völlig geschmacklos. Der Schlaf traumlos. So lang, bis die anderen glauben mussten, man wäre tot, um dann eines Tages eines Besseren belehrt zu werden. Um dann zu sehen, es gab noch etwas Schlimmeres, als tot zu sein. Klick.
Doch Angst zu haben, hatten sie ihm ausgetrieben. Sie hatten ihm beigebracht, gar nichts zu fühlen. Er hatte gelernt, so zu leben: war am Morgen wunschlos aufgewacht. Hatte geduscht, ohne die eisige Kälte des Wassers wahrzunehmen. Hatte sein immer gleiches fades Frühstück zu sich genommen, ohne jede Freude. Hatte am Unterricht teilgenommen, hatte Wissen gespeichert, so gut es ging. Dann das fade spärliche Mittagessen. Dann die Stunden Stillstehen. Dann die sportliche Betätigung. Die Tabletten. Das Abendessen. Das Abendwaschen. Zu Bett gehen ohne jede Aussicht, dass der nächste Tag eine Veränderung bringen würde. So kannte er es, so hatte er gelebt, Tag für Tag für Tag. Nichts denken, nichts fühlen, nichts hoffen, jeglicher Impulse beraubt.
Bis sie kam. Bis sie mit ihrem Schreien, ihrem Widerstand, mit ihren Ausbrüchen Unruhe in die Reihen der stummen Kinder brachte. Bis man sie ins Loch steckte und sie lachend wieder herauskam. Bis sie ihn berührte. Zuerst seine Hand, dann seinen Arm, dann sein Gesicht. Das war kein Schmerz, was er fühlte. Das dachte er nur, weil fast jede Berührung bisher nur Schmerz verursacht hatte, den er zu ignorieren lernen sollte.
Sie wusste, was zu tun war. Er folgte ihr nur. Durch den finsteren Kellergang, bis hinten zur Küche. Nichts war verschlossen, denn niemand hätte es je gewagt, auch nur einen unerlaubten Schritt zu gehen. Bis sie kam. Klick.
Vor der Küchentür blieb sie unvermittelt stehen, drehte sich zu ihm um. Fast prallte er auf sie, ihr Gesicht war seinem ganz nahe. «Erst wenn es brennt, laufen wir zur Treppe. Wenn Alarm gegeben wird, warten wir, bis alle aus dem Schlafsaal rennen. Wir mischen uns unter, draußen folgst du mir. Ich weiß einen Weg.»
«Und wenn sie die Türen nicht öffnen?», fragte er. Und allein schon zu sprechen um diese Uhrzeit war ein unglaubliches Vergehen.
«Sie müssen. Sie können nicht alle verbrennen lassen!», sagte sie.
Er war sich da nicht sicher. Ganz und gar nicht. Und noch könnten sie zurück. Noch wusste niemand, wo sie waren.
«Ich habe etwas für dich», sagte sie und griff sich unter das Sweatshirt, holte etwas hervor.
Es war fast ganz finster, doch er erkannte, was es war. Etwas ebenso Ungeheuerliches. Etwas Verbotenes. Ein Plüschteddy.
«Erkennst du ihn nicht?», fragte sie.
«Nein», sagte er, und dann traf ihn die Erkenntnis mit einer Wucht, die ihn taumeln ließ. Seiner war das. Sein Teddy, den er bei sich trug, als man ihn hier aufnahm. Das Einzige, das er bei sich hatte, nachdem ihm in einer einzigen Nacht alles genommen worden war.
«Woher?», konnte er nur fragen, wagte es nicht einmal mehr, Luft zu holen, denn er konnte den Geruch wahrnehmen, den der Teddy verströmte. Er roch nach dem Haus, in dem er einst gelebt hatte, nach seinen Eltern.
«Frag nicht. Komm», sagte sie, und er folgte ihr. Klick.
2
Schauer saß in ihrem Büro, starrte den dunklen Bildschirm an, betrachtete den Schreibtisch. Lauschte. Es war absurd. Was auch immer sie erwartet hatte. Dass man sie bestürmte. Dass man Unverständnis zeigte, weil sie zum Dienst erschien, obwohl sie hätte daheimbleiben können. Dass man Beifall klatschte, weil immerhin sie und Bruch es gewesen waren, die den letzten Fall gelöst hatten, und zwar unter Einsatz ihres Lebens. Dass man sie mit Fragen löcherte, aus demselben Grund. Sicher lief die Nachbereitung. Die Staatsanwaltschaft forderte Material, lückenlose Protokolle. Doch was war jetzt? Man hatte ihr zugenickt auf dem Flur. Der sonst immer zum Schwatzen aufgelegte Buchholz hatte es bei einem Moin belassen. Er glaubte so grüßen zu müssen, weil sie aus Hamburg kam. Wenzel in seinem Büro hatte sie willkommen geheißen und sie gebeten, mal ein paar alte Fälle zu sichten, sich zur Verfügung zu halten, falls man mit Fragen auf sie zukäme. Wie es ihr gehe, hatte er gefragt, doch nicht aus Interesse, sondern aus Höflichkeit. Wie es Bruch ging, wollte er nicht wissen. Hatte es nicht vor vierzehn Tagen erst Tote gegeben? Einen regelrechten Aufruhr im Internet und in der Realität. War nicht erst vor wenigen Monaten der Chef der Mordkommission erschossen worden, hier im Haus. In dem Büro, in dem Wenzel nun residierte. Lief das Leben hier einfach so weiter? War Wenzel schon instruiert, nicht zu viel zu fragen, keinen Wind zu machen?
Schauer schaltete ihren Computer an, war versucht, im Intranet nach Meldungen über den Tod von Christian Kleiber zu suchen, fragte sich, wie lang es wohl dauern würde, bis es jemandem auffiel, dass sie in dem ad acta gelegten Fall recherchierte, die Daten gelöscht wurden oder jemand ins Zimmer kam, um sie abzulenken.
Nein, sie hätte daheimbleiben sollen. Hier so allein in dem Büro, gemieden von allen anderen, das hielt sie noch weniger aus. Wie oft hatte sie Bruch als einen Idioten verflucht, weil er nichts sagte, weil er ins Leere starrte und sie das Gefühl hatte, alles allein machen zu müssen. Doch jetzt vermisste sie diesen Idioten, fühlte sich irgendwie wehrlos, nicht vollständig.
Sie müsste in Wenzels Büro gehen und ihn bitten, den Tod von Michael Bartko noch einmal untersuchen zu dürfen, offiziell Einsicht in die Akten verlangen. Nur um zu sehen, wie ihm das Gesicht einschlief.
Es klopfte kurz und Kollegin Schmidtke steckte den Kopf durch die Tür.
«Wie geht’s?», fragte sie, war nur einen Schritt ins Büro getreten, schloss die Tür nicht hinter sich, machte deutlich, dass sie nicht zum Bleiben gekommen war.
«Geht so», sagte Schauer. Dabei freute sie sich, dass wenigstens die Oberkommissarin Interesse zeigte.
«Ich wollte fragen, das Wetter ist ja schön, ich wollte mal in die Stadt zur Mittagspause, kommst du mit?»
«In die Stadt?», fragte Schauer, denn mehr in der Stadt konnte man nicht sein, als sie bereits waren.
«Na ich mein, in Richtung Altmarkt, ins Zentrum eben. Sagt man doch so: In die Stadt.» Erwartungsvoll sah sie Schauer an.
«Klar, gern.» Schauer freute sich und war zugleich verwundert über dieses Angebot.
«Cool, ich komm dann und hol dich ab.» Schmidtke wollte schon wieder raus aus der Tür, da hielt sie noch mal inne. «Wie, äh, geht’s Felix denn? Wir, äh, wussten nicht, also wir waren uns sicher, er will keinen Besuch.»
«Nee, will er auch nicht. Ihm geht’s ganz gut.» Wenn man im Bett liegen und an die Decke starren als gut bezeichnen kann.
«Gut», Schmidtke nickte verlegen und etwas war noch, womit sie nicht rausrücken wollte.
«Was ist denn?», fragte Schauer.
«Na, ich weiß nicht. Geht mich ja nichts an. Also Wenzel meint, du hast den Unfallhergang und die Notwehrsituation falsch wiedergegeben. Sicherlich nicht absichtlich, sondern weil du selbst verletzt warst oder eine Gehirnerschütterung hattest.»
Schauer sah Schmidtke nur an, spürte, wie leise Wut in ihr aufkeimte. Gerade noch hatte sie sich über Schmidtke gefreut, nur um jetzt zu erfahren, dass die auch nur hier war, um ihre Neugier zu befriedigen. Ging sie nichts an, hatte sie selbst gerade gesagt.
«Na ja, ich meine, wir wissen alle, dass Felix …»
«Was wisst ihr alle?», fragte Schauer. Wurde es jetzt plötzlich doch interessant?
«Ich meine, er war zwar immer so abwesend, aber manchmal hat der ja was blicken lassen.»
«Was denn?», fragte Schauer.
Jetzt hob Schmidtke die Schultern, sah aus, als bereute sie, mit dem Thema angefangen zu haben. «Du weißt schon. Der hat immer mal so Ideen.»
«Ich weiß nichts. Ich bin hierhergekommen, alle haben gesagt: Ui, viel Spaß mit dem. Ich wusste nichts und bin noch keinen Schritt weiter. Ich hätte viele Fragen, hab aber Angst, sie zu stellen.»
Schmidtke nickte beschwichtigend und drückte nun doch schnell die Tür zu. «Vielleicht können wir ja dann drüber reden, okay? Wenn wir draußen sind.»
Schauer verstummte. Vielleicht war sie schon wieder zu impulsiv gewesen. Schmidtke schien es ja gut zu meinen und konnte sicherlich für den ganzen Mist hier am wenigsten.
Die hatte die Türklinke losgelassen und stand jetzt ein wenig hilflos herum. «Ich wollte eigentlich sagen, ich zweifle deinen Bericht nicht an.»
«Okay», sagte Schauer, wusste nicht, ob das genügte, ob sie noch Danke sagen müsste. Schmidtke jedenfalls wandte sich wieder zur Tür, öffnete sie.
Schauer überkam das Gefühl, als wäre sie ein bisschen zu hart mit ihr umgesprungen. «Bis, dann», sagte sie deshalb, «ich freu mich.»
Was auch immer sie da verschüttet hatte, es hatte sogleich begonnen zu verdunsten. Es war regelrecht explodiert, kaum dass sie an dem Rädchen des Feuerzeugs gedreht hatte, das sie einem der Pfleger gestohlen haben musste. Bruch hatte gewusst, was geschehen würde, hatte sie zu Boden gerissen. Jetzt erhob er sich, sah sie liegen, sich langsam bewegen. Aus der Küche loderten heftige Flammen, hinter ihnen lag der Kellerflur noch in völliger Finsternis. Hier war nichts Brennbares, doch das Feuer würde sich nach oben fressen, durch den Essensaufzug, so heiß brannte es schon, dass es den Lack von den Heizrohren schmorte, sich in die uralten Strohmatten fraß, die man, wie vor hundert Jahren üblich, an das Deckengebälk genagelt hatte, um Putz anzuwerfen. Zuletzt würde das Gebälk selbst zu brennen beginnen, dann war das Gebäude verloren.
Felix kniete sich hin, sah, wie ihr die Feuerwalze das ohnehin kurz geschnittene Haar abgesengt hatte, wie sie sich in der Hitze wand, ohne ganz bei Sinnen zu sein. Er hob sie auf. Sie mussten zur Treppe. Ein Gedanke kam ihm und noch einmal sah er sich um. Er entdeckte den Teddy, hob ihn auf, sein Fell war angeschmolzen und roch verbrannt.
Er lief los, den ganzen langen Flur entlang, in die Dunkelheit hinein, die hier noch herrschte. Die schwarze Eichentäfelung schluckte noch das letzte Licht. Alba kam zu sich, hob den Kopf, öffnete die Augen und tastete nach ihrem Haar.
«Ich kann laufen», sagte sie leise und er setzte sie ab. Sie nahm seine Hand, zog ihn zur Treppe hin, lautlos stiegen sie hinauf, warteten unterhalb der letzten Stufen, geduckt, lauernd.
«Du musst mir folgen», flüsterte sie. Unten vom Keller her wurde der Lichtschein heller und es wurde wärmer. Bald musste es jemand riechen. Etwas platzte, etwas klirrte und riss ab, etwas sprang auf. Putz fiel, von der Hitze gesprengt, von Decken und Wänden, Rohre begannen sich zu verbiegen. Alter Fußbodenbelag wellte sich, schmorte, fing nun auch Feuer. Wenn es nicht bald bemerkt wurde, würden Menschen sterben, wusste Felix. Er suchte nach einer Meinung dazu. Er hatte keine. Er wusste nur, dass es nicht sein durfte.
«Wir müssen sie warnen», sagte er.
«Da!», flüsterte sie, doch er hatte es schon vor ihr gesehen. Die Tür zum Schlafsaal öffnete sich. Der Nachtdienst trat heraus. Ein Mann, den er schon vom ersten Tag an kannte und dessen Namen er trotzdem nicht wusste. Er schloss die Tür hinter sich, verharrte kurz. Er nahm Witterung auf, wie ein Reh, setzte sich dann in Bewegung, auf sie zu, dem rollenden Geräusch der Flammen entgegen. Das hatte sie nicht bedacht, dass zuerst gar nichts geschehen könnte. War davon ausgegangen, dass man gleich Alarm schlug. Brannte es länger unbemerkt, waren die anderen in Gefahr.
«Felix Bruch?», fragte der Pfleger. Felix duckte sich. Als der Mann über der letzten Stufe erschien, sprang er hoch. Im Flug ballte er die Faust, schlug sie dem Mann vor die Brust, dass es ihm die Luft aus der Lunge trieb und ihn rücklings mehrere Meter durch den Vorsaal schlittern ließ. Mit ihm musste man konsequent sein, wusste Felix, diesem Mann war noch nie etwas durchgegangen. Schon war er über ihm, sah ihm in die vor Entsetzen weit geöffneten Augen.
«Du wirst nicht weit kommen», würgte der Mann hervor und krallte sich in Felix’ Hemd, während es im Schlafsaal still blieb und Albas Schrei scheinbar ungehört verhallt war, «sie werden dich jagen.» Klick.
Jetzt kam von oben jemand herab. Alba war zum Schlafsaal gelaufen, hat die schwere Tür geöffnet. «Feuer!», schrie sie hinein, doch die Kinder in diesem Heim liefen nicht los, wenn man ihnen die Erlaubnis nicht erteilte.
Sie kam zurück, ehe Felix sich klar darüber werden konnte, ob das, was der Pfleger sagte, eine Drohung war oder eine Warnung. «Die Tür!», keuchte Alba. Ihr Plan war nicht durchdacht gewesen. Es war keine Panik ausgebrochen. Sie war nicht lang genug hier, um zu verstehen, was hier vor sich ging. Er wusste das von Anfang an, wusste, dass es zum Scheitern verurteilt war. Doch was sonst hätte sein Leben noch zu bieten gehabt, wenn nicht das.
«Du musst sie aufbrechen.»
Die Tür war aus massiver Eiche. Hundert Jahre alt oder älter. Hart wie Stein. Felix ließ von dem Mann ab, erhob sich, sah, wie Pfleger die Treppe hinabkamen, sah, wie sie stehen blieben, zuerst nicht verstanden, was geschah.
«Feuer!», schrie Alba, stiftete noch mehr Verwirrung. «Es brennt im Keller!»
Die Pfleger standen, wussten für einen Moment nichts zu tun. Dann jedoch hörten sie etwas bersten, ein Grollen ging durch das Gebäude, es zitterte unter den Erschütterungen herabfallender Träger.
Felix lief los, während endlich jemand den Feueralarm auslöste und ein schrilles Klingeln ertönte.
«Die Kinder!», schrie Alba panisch.
Da war er bei der Tür angelangt und trat mit aller Kraft neben das Schloss. Etwas brach und die Tür schwang ein Stück auf.
«Felix Bruch, bleib stehen!», rief jemand und die Stimme ließ ihn innehalten. Er blieb stehen, doch durch den schmalen Türspalt war ein Luftsog entstanden, der das Feuer hinter ihm noch weiter anfachte, sodass es brüllend durchs Treppenhaus emporstieg. Jetzt begannen die ersten Kinder im Schlafsaal panisch zu schreien, steckten schließlich weitere an. Alles verlor sich unter dem ohrenbetäubenden Lärm. Schon kamen sie gerannt, strömten an ihm vorbei ins Freie in die dunkle kalte Nacht, auf den Vorplatz, der von einem riesigen Scheinwerfer beleuchtet war.
Felix stand auf der Stelle und konnte sich nicht bewegen, bis jemand nach seiner Hand griff und ihn mit sich zog.
Es war Alba und sie liefen zuerst inmitten der fliehenden Kinder, dann aber zog sie ihn nach links, wo nach etwa hundert Metern Finsternis begann. Die hohe Mauer ist aus Beton, mit Stacheldraht obendrauf. Jetzt sah er, dass ein umgestürzter Baum an einer Stelle den Stacheldraht niedergedrückt und abgerissen hatte.
Alba musste nichts sagen. Er wusste, was zu tun ist. Er beschleunigte, ließ ihre Hand los. Sprang hinauf, hielt sich an der oberen Betonplatte fest, griff in die Borke des gestürzten Baumes, zog sich hoch. Dann drehte er sich um, beugte sich tief hinab. Alba sprang, so hoch sie konnte, ihre Hände bekamen sich zu fassen. Er zog sie hoch, ließ sie auf der anderen Seite sogleich hinab.
«Felix, komm!», rief sie. Denn er stand oben, einen Fuß auf dem Stamm, und sah zurück zum Heim. Die rechte Seite des Hauses stand inzwischen völlig in Flammen, fast schon bis zum Dach waren sie vorgedrungen. Dass es so brennen kann, dachte er sich.
Er sah Kinder rennen, die letzten stürzten durch die Tür, sah den Mann, der sich sein Großvater nannte, als Letztes das Gebäude verlassen, sah ihn sich umdrehen und sehen, dass in Flammen aufgeht, was wohl sein Lebenswerk gewesen sein mochte.
«Felix!», rief Alba.
Sie werden dich jagen, hatte der Nachtdienst gesagt. Zwar wusste Felix nicht, warum. Aber er wusste, dass es so sein würde.
«Ich komme», sagte er und sprang hinab in die Dunkelheit. Klick.
Im Krankenhaus blinzelte Bruch und richtete sich in seinem Bett auf. Er sah zum Fenster. Draußen war das Wetter schön. Zumindest wusste er, dass Menschen so empfanden. Eine Tür hatte sich geöffnet. Nicht nur einen Spalt, sondern ganz weit. Nun musste er nur noch hindurchtreten.
3
Das Wetter war schön. Das registrierte sie aber erst, als Schmidtke sie darauf hinwies.
«Wird Frühling», sagte diese jetzt, und Schauer wusste augenblicklich nicht mehr, ob ihr Gedanke zuerst da gewesen war oder Schmidtkes Worte.
«Hm», kommentierte sie nur, wollte erst einmal sehen, worauf das jetzt hinauslief. Einer ihrer Fehler war wohl, zu hohe Erwartungen zu haben, um dann umso mehr enttäuscht zu werden.
«Gehst du noch zu diesem Kurs?», fragte Schmidtke.
Schauer blieb sofort stehen. Zuerst suchte sie nach Worten, doch dann beschloss sie, dass die Zeit für Umschreibungen, Ausflüchte, Diplomatie und Political Correctness vorbei war. «Ist das ein Versuch, mich auszuhorchen?», fragte sie geradeheraus.
«Nein, sorry, das war blöd. Ich wollte eigentlich nur ein Gespräch anfangen.»
«Warum machen wir das hier?», fragte Schauer.
«Ich fand es schade, dass wir uns nicht besser kennenlernen konnten. Und ich habe auch schon Dinge gesagt, die bestimmt verletzend für dich waren. Mir ist jetzt erst aufgegangen, dass du und Bruch zwei verschiedene Dinge sind. Also Menschen. Zwei verschiedene Menschen, meine ich. Also keine Einheit.»
Schauer winkte ab, hatte es schon verstanden. Doch Schmidtke hatte Bedürfnis, sich weiter zu erklären. «Du weißt, alle zerreißen sich immer das Maul, was da läuft und so.»
«Was da läuft? Mit Felix?» Schauer verzog ungläubig die Mundwinkel.
Schmidtke griff sich an die Stirn. «Können wir weitergehen, weg vom Präsidium? Ich bin es völlig falsch angegangen und würde gern noch einmal von vorn beginnen.»
«Nee, lass mal nicht von vorn beginnen, sondern einfach weitermachen», meinte Schauer, die von solchem Kitsch nichts hielt. Sie setzte sich in Bewegung. «Diesen dämlichen Kurs übrigens habe ich sausen lassen ab dem Tag, als Simon umgebracht wurde.»
«Die sagen, du hättest einem jungen Polizisten, der dich angegrapscht hat, so dermaßen die Fresse poliert, dass er zwei Mal operiert werden musste.»
Schauer verlangsamte ihren Schritt, sah Schmidtke von der Seite an. Ihr war immer noch nicht richtig klar, was sie von ihr halten sollte. Und sie wusste kaum etwas über Schmidtke: War sie lesbisch, hatte sie einen Mann? Wollte sie einen und fand nicht den richtigen? Dann wären sie schon mal zwei. Und angegrapscht war ja nun wirklich maßlos untertrieben. Vergewaltigen wollte er sie, hatte es fast geschafft. «Ich weiß nicht, wovon du redest», sagte Schauer bestimmt.
Schmidtke winkte nun ihrerseits ab. «Will nur sagen, wenn es so gewesen wäre, geschieht ihm recht. Frag nicht, was ich mir hab alles gefallen lassen müssen.»
Jetzt wurde es still und sie überquerten die Landhausstraße.
Mit einem Mal tat es Schauer wieder leid, dass sie so abweisend erscheinen musste. «Meinem Verlobten habe ich die Nase gebrochen.» Das wusste ja sicher jeder.
«Echt?», fragte Schmidtke.
«Jupp, ich war krank. Breast cancer», sie mochte es gar nicht Deutsch aussprechen. Sarkastisch hob sie die Faust an. «Survivor. Alles durchgemacht, OP, Chemo, abgemagert, aufgequollen, Haare verloren, nächtelang geheult. Das ging eine Weile. Er war immer besorgt, hat sich echt gekümmert, hat mir auch Kontakt zu einem richtig guten Onkologen vermittelt, weltbekannt. Ich bin arbeiten gegangen, so gut es ging, da war ich noch in Hamburg. Also habe ich einen Antrag gestellt, um nach Dresden zu wechseln. Ewig passiert nichts. Dann kommt der Bescheid, stattgegeben. Das war Bartkos Stelle, die frei geworden war. Ich: inzwischen beste Ergebnisse, Blutwerte, alles super, nichts gestreut, besser keine Kinder bekommen, hieß es, ich, okay, damit kann ich leben. Meine Schwester hat für genug Nachkommen gesorgt. Eine letzte Untersuchung, Gratulation, Frau Schauer, Sie sind eine Überlebende, sagte der Arzt. Ich fahr heim, und frag nicht, was ich alles im Kopf hatte. Reisen, feiern, saufen, fressen, vögeln, alles und am besten gleichzeitig. Und was macht der Typ? Anstatt eine Überraschungsparty zu organisieren, das hätte nämlich gut zu ihm gepasst, sagt der zu mir, setz dich mal hin, und referiert mir, was er alles ausgestanden hätte die zwei Jahre und dass er das nicht noch mal aushält und sich deshalb von mir trennt. Er will ehrlich sein und nicht lange um den heißen Brei reden und er würde es verstehen, wenn ich es nicht verstehe. Und beim Wort Freund – wir könnten ja Freunde bleiben – da sind mir alle Sicherungen durchgebrannt. Na ja, da habe ich mich schlecht unter Kontrolle.»
«Ach du Heiland», sagte Schmidtke.
«Und weißte, dass er Schluss gemacht hat, war nicht einmal das Schlimmste. Dass er meinte, er könnte das nicht noch einmal durchmachen, das hat das ausgelöst. Das impliziert ja, dass der mehr gelitten hat als ich, und vor allem, dass die Wahrscheinlichkeit, der Krebs kommt zurück, hoch ist. Das wollte ich in dem Moment nicht hören.»
«Das will niemand hören», sagte Schmidtke. «Kannst nicht gut drüber reden, oder?»
«Hört man mir das an?»
«Ja, alles im Telegrammstil. Verständlicherweise. Aber für die Angehörigen ist es tatsächlich auch nicht leicht.»
«Du willst den jetzt nicht in Schutz nehmen, oder?» Sie hatten das Landhaus umlaufen, gingen nun den breiten Fußweg an der Wilsdruffer Straße entlang, in Richtung Altmarkt. Links neben ihnen bewegten sich die Autos im Schneckentempo. Hier durfte nur zwanzig gefahren werden, ständig schalteten die Fußgängerampeln auf Grün, und vorn am Postplatz hatte alle paar Sekunden die Straßenbahn Vorrang.
«Nein, ich meine nur, hatte das auch in der Familie, klar ist es für die Betroffenen am schwersten. Na ja, aber immerhin war er ehrlich und hat dir nicht noch ein paar Monate lang was vorgemacht.»
Schauer schloss für einen Moment die Augen. Wenigstens in dieser Sache hatte sie bisher geglaubt, im Recht gewesen zu sein, und jetzt kam Schmidtke und machte die letzte Gewissheit mit nur einem Satz zum i-Tüpfelchen der ganzen Lebenslüge.
Sie spürte Schmidtkes Hand an ihrem Arm und viel hätte nicht gefehlt, da hätte sie auch ihr eine geballert. «Es tut mir leid, es tut mir wirklich leid. Das ist anmaßend, das geht mich gar nichts an. Du hattest sicher alles Recht, das zu tun, oder vielleicht nicht das Recht, aber mein vollstes Verständnis. Wenn man nicht in diesem Moment ausrasten darf, in welchem denn dann?»
«Ist okay», sagte Schauer, aber nichts war okay. Hier war überhaupt nichts okay, stellte sie fest. Das alles war absurd. Und wahrscheinlich war der Grund dafür, dass sie mit niemandem wirklich warm wurde, dass sie wusste, sie allein war für dieses Leben verantwortlich und niemand anderes hatte Schuld an ihrer Misere. Sicher konnte sie für den Krebs nichts, aber alle anderen Entscheidungen, dieses Beleidigtsein, weil Mutter und Vater sich scheinbar mehr um die Schwester kümmerten, dieses Alle-sind-gegen-mich, das war ja ihre Entscheidung. Dass sie ihre Impulse nicht unter Kontrolle bekam, dass sie ständig unter Strom stand und immer gleich das Schlechteste vermutete. Wieso hatte ausgerechnet sie Zugang zu Bruch gefunden, der für alle anderen ein Buch mit sieben Siegeln gewesen war? Weil sie selbst nicht besser dran war als er! Weil sie auf einer Wellenlänge lagen.
«Nicole», versuchte Schmidtke Zugang zu bekommen, «das war falsch von mir. Und ich wollte das alles gar nicht, ich wollte nur mal ein bisschen bummeln und dabei quatschen. Wir haben ja noch nie richtig miteinander gesprochen.»
«Ist schon gut», sagte Schauer und dass die Sonne ihr ins Gesicht schien, dass es ihr richtig warm wurde dadurch, obwohl der Wind noch frisch war, das setzte dem Ganzen die Krone auf.
«Wolltest du eigentlich zu McDoof?», fragte sie, deutete nach links, wo auf der anderen Straßenseite am Rande des Altmarkts eine Filiale war.
«Nee, ach was, aber weiter hinten, da gibt’s Currywurst, habe ich ewig nicht mehr gegessen.»
«Dann Currywurst», willigte Schauer ein, und sie liefen die Wilsdruffer Straße weiter entlang. Der Kulturpalast kam ins Blickfeld, hinter dem die Touristen vom Schloss in Richtung Altmarkt oder andersherum strömten, und sie passierten die Fußgängerampel am vorderen Ende des Altmarktes.
Sie waren noch nicht ganz auf halber Höhe des Kulturpalastes, die Fußgängerampel am anderen Ende hatte auf Grün geschaltet und eine Traube von Menschen überquerte gemächlich die einspurige Fahrbahn, da heulte hinter ihnen ein Motor auf, Reifen quietschten. Schauer fuhr herum, sah ein silbernes Fahrzeug, ein BMW, von der Fahrbahn auf den Radweg ausweichen. Er war schon schnell, viel zu schnell, und beschleunigte noch weiter. Ein Radfahrer warf sich von seinem Rad auf den Fußweg, der BMW erfasste das Fahrrad, schleuderte es hoch in die Luft, war schon an Schauer vorbei, steuerte auf die Passanten zu, die die Straße überquerten, und ehe sie irgendwie reagieren konnte, raste das Fahrzeug in die Menge.
Als würde jemand gegen einen Boxsack schlagen, so hörte es sich an, als der BMW auf die Körper derer traf, die ihm im Weg waren. Dumpfe, fast unspektakuläre Aufschläge. Schauer sah Menschen durch die Luft fliegen. Es schien, als würden sie ewig schweben, als wollten sie nicht mehr zur Erde zurückkehren. Wie in Zeitlupe sah Schauer, wie sich die Körper in der Luft drehten, hilflos, wehrlos, willenlos. Wie in einem Albtraum war es und für einige dankbare Momente verharrte sie in dem Gedanken, dass sie nun gleich erwachen würde. Dann aber schlug das Fahrrad rechts neben ihr scheppernd auf, so hoch war es geflogen, so schnell war alles gegangen. Das vertrieb die Stille in ihrem Kopf und als hätte jemand den Regler eines Lautsprechers von null auf Anschlag gedreht, schlug der Lärm um Schauer zusammen. Kreischen, Panik. Rennende Menschen, Fahrzeuge, die versuchten, über die Straßenbahngleise zu wenden, klingelnde Straßenbahnen, Hupen, schrille Schreie. Bewegung überall, die einen wollten weg, andere hin, die einen riefen Namen, andere waren erstarrt, Schauer sah eine Frau, die auf die Knie fiel und zu beten begann. Als ob das jetzt noch irgendetwas ändern konnte, dachte Schauer, doch der Gedanke machte sie mobil. Ließ sie von Schreckstarre auf Automatik umschalten.
«Ruf die Zentrale an!», befahl sie Schmidtke, die zwar nicht erstarrt war, aber sich hilflos umsah.
Die nickte jetzt, schaltete selbst in den Arbeitsmodus um, hatte ihr Handy schon in der Hand, dann am Ohr, als sie losrannte.
«Wer ist verletzt?», rief Schauer, lief dahin, wo das Auto auf die Leute getroffen war. «Polizei! Wer ist verletzt?»
Eine Frau schrie etwas, auf Russisch oder vielleicht auch Ukrainisch. Eine andere rannte panisch herum, schrie etwas, italienisch wohl, vermisste jemand.
Zwei Männer sah Schauer, die bei einem dritten eine Herzdruckmassage durchführten.
«Sie sind von der Polizei?», fragte jemand hinter ihr.
Schauer nickte, ließ sich mitziehen, zu einer leblosen Frau, der Passanten versuchten zu helfen. Schauer ging auf die Knie, stieß die anderen weg, beugte sich hinab, legte ihren Kopf auf die Brust der Frau, vernahm keinen Herzschlag, konnte keinen Puls fühlen. Die Schreie um sie herum, das Gebrüll schwoll an und ab. Schauer begann selbst eine Herzdruckmassage und fühlte schon beim ersten Stoß, wie weich der Leib war, ihr Brustkorb zerstört, keine Chance.
«Sie ist tot», sagte sie zu der Frau neben ihr. «Ich muss sehen, wo ich noch helfen kann. Versuchen Sie es weiter, aber ich denke, es ist zu spät.»
«Ist gut», sagte die Frau, doch ob die Botschaft wirklich angekommen war, war fraglich. Schauer erhob sich, sah sich um. Erst jetzt kam ihr der Gedanke an den Fahrer des BMW. Der Wagen stand nur ein paar Meter von ihr entfernt. Schauer griff instinktiv zur Pistole, rannte zu dem Wagen hin, die Fahrertür stand offen, der Wagen war leer.
«Dahin ist der gerannt!» Jemand zerrte an ihr, drehte sie in Richtung Altmarkt, doch so viele Menschen waren hier, es war ganz zwecklos, erkennen zu wollen, ob jemand weglief, der der Fahrer gewesen sein könnte.
«Wie sah er aus?»
«Araber!», wusste der Mann, untersetzt, Rentner, von hier, dem Dialekt nach.
«Wirklich? Wirklich jetzt?»
«Hatte schwarzen Vollbart und schwarze Haare!»
Schauer fluchte, nahm ihr Handy heraus, rief die Zentrale an.
«Wir wissen schon Bescheid, alle verfügbaren Kräfte rücken aus», hörte sie.
«Dunkle Haare, Vollbart», keuchte Schauer. «Warten Sie!» Sie packte den Mann, der den Anschein machte, als wollte er sich entfernen. «Vollbart, ja?»
«Ja!»
«Wie groß, wie alt? Kleidung?»
«Mittelgroß, vielleicht Mitte vierzig. Kleidung weiß ich nicht, Jeans, graue Jacke vielleicht.»
«Haben Sie mitgehört?», fragte Schauer ins Telefon. «Ist Richtung Altmarkt gerannt. Verletzt? Haben Sie das gesehen?»
«Nicht verletzt, hat zumindest nicht geblutet oder gehumpelt.»
«Haben Sie gehört? Scheinbar unverletzt», rief Schauer ins Telefon. Schon vernahm sie Sirenengeheul.
«Hier ist eine Hand!», rief jemand. «Eine Hand!»
«Gottverflucht», stöhnte Schauer. Ihr blieb nichts erspart. Nichts. Gerade hatte sie geglaubt, schlimmer könnte es nicht werden, da stand sie mitten in einer Katastrophe. «Polizei», hörte sie sich rufen. «Wo ist die Hand?»
«Hier!» Mehrere Leute gaben eine Gasse frei. Schauer steckte die Pistole weg, lief zu der Stelle, die ihr gezeigt wurde. Dort lag eine Hand, am Handgelenk abgerissen, schmal wie die einer jungen Frau. Schauer zögerte nur kurz, so kurz, dass keiner es bemerkt haben konnte. Dann griff sie zu. Sie nahm die Hand mit ihrer Rechten, nahm sie nicht an einem der Finger, sondern legte sie sich auf die flache Linke.
«Wo ist die Verletzte, man muss ihr den Arm abbinden.»
Um sie blieben alle stumm. Keiner wusste, wo die Verletzte war.
«Weg!», befahl Schauer. «Alle, die nicht helfen, weg. Wem fehlt eine Hand?»
Das war so absurd. Das war so unwirklich. Das konnte kein Mensch verarbeiten. Damit würde sie nicht klarkommen, wusste sie jetzt schon. Unmöglich.
«Hier!», rief jemand, aber die Stimme ging im allgemeinen Lärm und der Panik unter. Jetzt kamen die ersten Rettungswagen heran und Schauer lief auf den ersten zu.
«Schauer, Kripo», sagte sie zum Rettungsassistenten, «wurde gefunden, aber ich weiß nicht, wo die Person dazu ist.» Schauer hielt ihm die Hand hin.
«Wo müssen wir hin?», fragte der junge Mann heiser und stand selbst schon unter Schock. Sein Kollege kam, etwas älter, nahm die Hand, zog die Schiebetür des Rettungswagens auf, um sie da irgendwo abzulegen.
«Überall. Hier liegen überall Leute, auch weiter hinten. Ein paar sind bestimmt zehn Meter weit geflogen. Fangen Sie da hinten an», sie zeigte in die Richtung, wo die beiden Männer die Herzdruckmassagen machten.
Der nächste Rettungswagen fuhr heran und Schutzpolizisten kamen angelaufen. Schauer befahl abzusperren, alle wegzudrängen, die nicht direkt involviert waren, und schon näherten sich weitere Rettungskräfte, die sie zur Unterstützung der anderen schickte. Andere wies sie an, sich um ein weinendes Kind zu kümmern, das scheinbar alleine auf dem Gehweg stand. Dann trafen Mannschaftswagen ein. Weitere Rettungswagen, Feuerwehren. Das Wort Hubschrauber vernahm sie und schickte Uniformierte los, auf dem Altmarkt eine Landefläche freizumachen. Schlecht war ihr, schwindelig. Sie fühlte etwas wie eine Ohnmacht herankommen, zwang sich, nicht über das Geschehene nachzudenken, sondern sich auf das zu konzentrieren, was auf sie einstürmte. Doch es war ihr, als sank sie langsam in den Boden, als bog sich die Erde unter ihr, ein Abgrund öffnete sich.
4
«Ganz zu Beginn», sagte Wenzel, nachdem der große Besprechungsraum erneut zur Einsatzzentrale erkoren worden war, «will ich die wirklich herausragende Leistung von Hauptkommissarin Schauer und Oberkommissarin Schmidtke hervorheben. Zwar nur zufällig am Ereignisort anwesend, haben beide – und ich spreche auch in Oberkommissarin Schmidtkes Namen, wenn ich sage – ganz besonders Hauptkommissarin Schauer – mit kühlem Kopf agiert, ja, sie haben Rettungsmaßnahmen eingeleitet, eintreffende Rettungskräfte organisiert und geleitet, Sicherungsmaßnahmen veranlasst, in einem außergewöhnlichen Maß an Voraussicht sogar eine erste Täterbeschreibung, die Fluchtrichtung beschrieben, erste Zeugenaussagen aufgenommen, dabei noch Erste Hilfe geleistet. Wer die Szenen vor Ort gesehen hat, kann sich ausmalen, welche fast übermenschliche Leistung beider Kolleginnen es war, die sie dort angesichts des Ausmaßes der Katastrophe geleistet haben.»
Schauer bekam Kopfschmerzen von den Schachtelsätzen, in denen der erste Hauptkommissar sprach. Er meinte es gut, genderte brav, doch wenn sie noch einmal sein deutlich betontes KommissarIN hören würde, oder KollegINNEN, müsste sie sich übergeben. Wenzel war selbst vor Ort gewesen, war sichtlich erschüttert und sie sollte anerkennen, dass er es gut meinte, wenn er sie hier lobte, doch gerade wollte sie nur die Augen zumachen und alles vergessen. Sie hätte die Augen vorher zumachen sollen, in dem Moment, als sie wusste, was passieren würde. Sie hätte nicht zusehen dürfen, wie der Wagen in die Menge fuhr, wie die Leute hochflogen, sich überschlugen, wie sie zur Seite geschleudert wurden, wie Stoffpuppen, an Ampelmasten prallten, andere Leute umrissen.
«Geht’s dir gut?», fragte jemand hinter ihr besorgt und legte seine Hand auf ihre Schulter, sie hatte keine Ahnung, wer, konnte sich nicht umdrehen, hörte die Stimme nur gedämpft.
Natürlich, wollte sie schreien, klar, hab grad bloß ein paar Leute sterben sehen, und nimm deine Pfote weg, wollte sie ihn anfahren, doch er meinte es ja auch gut. Ihr war übel.
«Geht schon», flüsterte sie und beim letzten Wort musste sie den Mageninhalt schnell wieder herunterschlucken, ein ekelhafter saurer Geschmack blieb zurück.
«Hat mal einer Wasser!», rief der Kollege halblaut.
Halt doch dein Maul, wollte sie fluchen, doch Wasser wäre wirklich gut. Jemand reichte ihr eine Wasserflasche.
«Wenn wir Ihnen einen Arzt holen sollen …», deutete Wenzel an.
«Fahren Sie einfach fort», erwiderte Schauer. Sie wollte hier nicht sein, doch fühlte sich verpflichtet. Vor allem weil Schmidtke ja auch hier saß, obwohl sie weiß wie eine Kalkwand war. Sie weinte nicht, schien aber innerlich zu schluchzen, sie zuckte rhythmisch.
«Bisher bestätigt uns die Leitung der Rettungskräfte vor Ort drei Tote, wobei es angesichts der Situation vor Ort fast wie ein Wunder erscheint, dass es nicht viel mehr sind. Wir haben sechs Schwerverletzte, davon zwei in sehr kritischer Kondition, und eine Unzahl weniger Schwer- und Leichtverletzter.»
Was ist ein Wunder daran, fragte sich Schauer, reichten drei Tote nicht und zwei Schwerstverletzte, die es vielleicht nicht schaffen werden? Was hätte noch schlimmer kommen können? Zehn Tote? Zwanzig? Doch sie sagte nichts, verkniff sich jegliches sarkastisches Geräusch. Wenzel musste selbst erst mal sehen, wie er damit klarkam. Dass er sie gelobt, ihre Leistung hervorgehoben hatte, das war nur seine Art, sich der Sache zu nähern. Sie hatte gar nichts getan. Nichts Bewusstes. Es war gewesen, als hätte jemand sie gesteuert. Jetzt ahnte sie, was es bedeutete, wenn andere sagten, sie hätten nur funktioniert. Als hätte es die ganze Gefühlsebene abgeschaltet, als wären die Sicherungen durchgebrannt und sämtliche Lichter erloschen. Dafür waren im Keller die Maschinen angesprungen. Seltsam. Jemand anderem müsste das Lob gelten, jemandem, der in ihr wohnte, aber nicht sie war. Oh Gott, dachte sie, nicht allein, dass ich paranoid werde, jetzt bin ich auf dem besten Weg zur Schizophrenie.
«… Fahrzeughalter ist bereits ermittelt. Die Diebstahlanzeige ging just in dem Moment ein, als der Anschlag geschah», führte Wenzel aus. «Das Fahrzeug wurde in Dresden Gruna gestohlen, nur wenige Minuten vom Ort des Anschlags entfernt. Wann genau das Fahrzeug entwendet wurde, ist noch nicht klar, der Besitzer hatte es am Morgen noch bewegt, es gegen acht Uhr dreißig abgestellt und hatte dessen Fehlen erst kurz nach elf festgestellt.»
«Es wurde also aufgebrochen? Kein Raubüberfall?», fragte jemand.
«Der Besitzer ist sich sicher, abgeschlossen zu haben, im Fahrzeug befand sich kein Zündschlüssel.»
«Und es wird als Anschlag gewertet, Unfall ist ausgeschlossen?»
«Dazu können Ihnen die Kolleginnen vielleicht etwas sagen, wenn sie sich in der Lage fühlen. Es wird jedoch als Terroranschlag gewertet. BKA, LKA und Verfassungsschutz sind eingeschaltet und alle sonstigen Behörden, die in diesem Falle eingreifen.»
«Ich würde sagen, es war ein eindeutiger Anschlag, der darauf abzielte, möglichst viele Menschen zu verletzen», sagte Schmidtke. «Der BMW stand in einer langen Reihe von Fahrzeugen an der roten Ampel. Der Fahrer scherte rechts aus, nutzte den Radweg, um zu beschleunigen, nahm keine Rücksicht auf einen Radfahrer, der sich in letzter Sekunde selbst retten konnte, und raste ungebremst in die Menge. Ganz eindeutig.»
«Sehen Sie das auch so, Hauptkommissarin?», fragte Wenzel.
«Ich habe es genauso erlebt», sagte Schauer, «aber ganz so sicher bin ich mir nicht, wegen des Motivs. Wenn der Wagen gestohlen war, könnte es sein, der Fahrer fühlte sich kompromittiert. Vielleicht sah er eine Streife.»
«Sie meinen, es könnte sein, er wollte sich nur selbst aus der Situation befreien?», fragte Wenzel und seine Skepsis war unüberhörbar.
«Denkbar – wenn er vorbestraft ist, sich vor einer Verhaftung fürchtet. Er sieht sich eingekeilt, nicht absehbar, wann er weiterfahren kann. Er handelt panisch, schert aus, will einfach weg.»
«Warum steigt er dann aus und rennt davon, das Auto scheint noch funktionstüchtig?», fragte Wenzel.
«Das können wir uns auch fragen, wenn wir von einem Anschlag ausgehen. Es wäre sogar noch logischer, dass er davonläuft, wenn es sozusagen ein Unfall war.»
«Es nützt ja nichts zu spekulieren», meinte Schmidtke.
«Wir spekulieren doch nicht, wir sind Ermittler», widersprach Schauer.
«Wir ermitteln in alle Richtungen», wollte Wenzel moderieren.
«Draußen wird schon überall von einem islamistischen Anschlag geredet.» So viel hatte sie schon mitbekommen, nachdem sie sich in ihrem Büro ganz kurz hatte ausruhen können. Inzwischen war es vier Uhr am Nachmittag und die Medien berichteten umfassend von dem Anschlag. Zahlreiche Experten hatten sich zur Art und Weise schon geäußert und die Tendenz war eindeutig. Es standen sogar schon wieder die ersten besorgten Bürger an den Absperrungen und hielten Mahnwachen. Diverse Parteien hatten sich schnell wieder zu Statements zur Migrationspolitik hinreißen lassen, da waren die Toten noch nicht mal kalt.
«Der Tathergang, die erste Täterbeschreibung lassen zumindest eine hohe Wahrscheinlichkeit zu.»
Lassen eine Wahrscheinlichkeit zu, wiederholte Schauer in Gedanken. Ihr fehlte Bruch. Er müsste hier sein. Wahrscheinlich würde er nichts sagen, oder nur zwei Worte, irgendwas, um das hier alles zu relativieren. Und sicher würde ihm etwas aufgefallen sein, das allen anderen und auch ihr bisher entgangen war. Wahrscheinlich würden sich alle zu ihm umdrehen, sich fragen, wie er wohl darauf kam. Wie hoch mochte das Fahrrad geflogen sein, sodass es erst einschlug, als das Auto in die Menge gerast war?
«Die Täterbeschreibung lautete unauffällige Kleidung, dunkle Haare, Vollbart», sagte sie, «allein hier im Raum sitzen drei Männer, auf die das zutrifft.»
Diese Bemerkung wurde so verstanden, wie sie gemeint war, niemand entrüstete sich, manche nickten sogar bestätigend. Doch Schauer selbst wurde schwindlig von ihren Gedanken: Sie war den ersten Tag im Dienst. Noch keine fünf Stunden. Da passiert dieser Anschlag. Direkt neben ihr. Das Auto war kaum drei Meter links an ihr vorbeigerast. Schmidtke hatte sie gefragt, ob sie mit in die Stadt kommen wollte, hatte sie zum Currywurstladen lotsen wollen, der die Straße entlang weiter hinten lag. Dann kam das Auto angerast. Eine halbe Minute später wäre sie von ihm erwischt worden.
Nein, bleib cool, mahnte sie sich, dreh nicht durch, das ist paranoid. Er hatte es nicht auf sie abgesehen. Der Fahrer hätte nur auf den Gehweg fahren müssen, um sie zu erwischen. Die opfern nicht ein paar Menschenleben, um sie auszuschalten. Das hätten sie daheim bei ihr machen können. In der Badewanne ersäufen. Die Treppe hinunterstoßen. Suizid vortäuschen. Jeder Psychologe hätte ihr nachträglich eine Selbstmordgefährdung bescheinigt. Pulle Wein, Packung Schlaftabletten, fertig.
«Ist das Fahrrad wirklich erst runtergekommen, als das Auto in die Leute fuhr?», wandte sie sich an Schmidtke.
«Welches Fahrrad?»
«Der BMW traf doch das Rad. Der Typ sprang runter, das Fahrrad flog hoch. Ich habe in Erinnerung, dass es hinter uns aufschlug, da war der schon in die Passanten reingefahren.»
«Ist das wichtig?»
«Alles ist wichtig, jedes Detail», kam Wenzel unerwartet zu Hilfe. «Soweit ich die ersten Zeugenaussagen gesehen habe, wurde der Radfahrer noch nicht befragt.»
«Ist er überhaupt als Zeuge aufgenommen?», fragte jemand.
«Hat es sich angehört, als ob der Fahrer mit dem Fahrzeug ungeübt war?», fragte ein anderer, «zu hohe Drehzahlen, Motorenheulen?»
Wenzel hob die Hände. «Das wird unsere wichtigste Aufgabe sein: Zeugenaussagen sammeln, sichten, sortieren. Soweit ich weiß, wird das BKA die Angelegenheit übernehmen, das LKA und wir werden nur zur Zuarbeit herangezogen. Die Kolleginnen Schmidtke und Schauer stelle ich als unsere wichtigsten Zeugen, also Zeuginnen, den Kollegen vom BKA zur Verfügung. Außerdem habe ich veranlasst, dass zwei Psychologen vom Polizeiärztlichen Dienst für sie abgestellt sind, falls sie das Bedürfnis haben, über die Sache zu reden. Bis dahin gilt für alle: absolute Informationssperre. Niemand spricht mit der Presse oder irgendjemandem, bis wir gesicherte Kenntnisse haben.»
Schon als sie die Station im Krankenhaus betrat, spürte sie, dass etwas anders war. Man kannte sie inzwischen, sie war ja seit zwei Wochen jeden Tag hier, hatte inzwischen jeden, der hier arbeitete, wenigstens einmal gesehen. Als sie am Schwesternzimmer vorbeilief, sahen die Krankenschwestern auf und ehe Schauer registrierte, dass sie vielleicht hätte fragen sollen, was los sei, kam ihr schon eine nachgelaufen. Es war eine der älteren, sehr resolut. Hatte es sich schon bis hierhin durchgesprochen? Nicht der Anschlag, von dem wusste schon jeder, aber dass sie unmittelbar involviert gewesen war?
«Wir haben ein Problem», sagte sie.
«Geht es ihm nicht gut?» Das fehlte noch, dachte Schauer und Hitze stieg ihr in Sekundenschnelle aus dem Bauch in den Kopf. Das fehlte noch, dass der jetzt abschmierte.
«Er ist weg.»
«Weg?»
Die Schwester nickte, nahm Schauer am Arm, zog sie zu Bruchs Zimmer. Die Tür stand offen. Sein Bett stand da, die Decke zurückgeschlagen. Alles, was an ihm gesteckt hatte, war abgerissen. Venenzugang und Katheter lagen auf dem Bett. Sämtliche Orthesen lagen geöffnet am Boden.
«Warum …», begann Schauer, doch dann bremste sie sich, nahm ihr Handy heraus und sah zwischen den unzähligen Anrufen der letzten Stunden drei Anrufe von unbekannten Nummern. Da sie keine Angehörige war, hätte man sie gar nicht informieren dürfen. Jedoch hatten die Schwestern es wohl mit ihren privaten Telefonen bei ihr versucht.
«Seit wann?» Die Anrufe hatten alle um die Zeit des Anschlags stattgefunden, kurz danach, genau genommen.
«Zum Frühstück war er noch da. Die Kollegin, die zuerst bemerkte, dass er weg war, dachte, er wäre zu einer Untersuchung abgeholt. Röntgen stand an. Die nächste dachte dasselbe. Bis wir kurz vor dem Mittagessen registrierten, dass er wirklich weg war.»
«Jemand Fremden haben Sie nicht bemerkt?»
«Wir haben uns schon besprochen, Personal und Patienten, niemand hat jemand Fremdes bemerkt.»
«Aber es hat auch niemand bemerkt, dass er ging.»
«Frau Schauer, das ist nicht möglich. Er hätte niemals schon alleine gehen können.»
«Aber er ist ja weg. Sonst hätte er ja getragen werden müssen. Haben Sie hier alle Räume durchsucht?»
«Alles, das ganze Haus.»
«Also niemand war da, hat ihn geholt, allein gegangen kann er nicht sein?»
«Nein, niemand hat irgendetwas Verdächtiges bemerkt und allein kann er unmöglich gegangen sein.»
Ein Gedanke schoss ihr in den Kopf: Man hat also versucht, sie mit einem Anschlag zu beseitigen, und gleichzeitig dringt hier jemand ein, entführt Bruch, lässt ihn ebenso verschwinden. Schauer streckte den Arm aus, musste sich am Schrank festhalten. Die Schwester reagierte schnell, zog einen Stuhl heran.
«Wenn Sie wüssten, was ich gerade erlebt hab», sagte Schauer, als müsste sie sich für ihre Schwäche entschuldigen.
«Ich weiß, wir wissen das. Wir haben es gesehen und hier in der Klinik sind auch einige Verletzte aufgenommen worden.»
«Ich war mittendrin, wissen Sie? Die sind …» Schauer konnte es nicht aussprechen, deutete nur mit der Hand an, wie die Leute in die Luft geschleudert wurden.
«Es gibt Bilder im Fernsehen», sagte die Schwester leise.
«Was?»
«Jemand hat sein Handy draufgehalten. Der hat den Anschlag aufgenommen.»
Schauer war mit einem Mal elektrisiert, denn diese Aufnahmen mussten konfisziert werden. Zugleich mahnte sie sich, andere würden sich kümmern. Das war nicht ihr Job.
«Und das blöde Schwein hat nichts Besseres zu tun, als es direkt zu veröffentlichen, wo denn, Instagram, X?», fragte sie resigniert.
«Überall.»
«Und Felix kann nicht gelaufen sein? Sie müssen wissen, Felix …» Ja, was? Vor zwei Wochen hatte er mit gebrochenen Beinen und Armen ein Auto in die Luft gehoben, ein Wrack, in dem sie eingeklemmt war. Es musste so gewesen sein. Aber sie konnte ja selbst nicht mehr wissen, was stimmte. Ihr Kopf war angeschlagen, sie hatte Todesangst, Panik zu verbrennen. Doch auch die Zeugenaussagen sprachen für ihre Variante.
«Nicht mit seinen Verletzungen, nicht nach vierzehn Tagen.»
Es gab Fußballer, die nach schlimmsten Verletzungen nach sechs Wochen wieder spielten, während der Normalbürger sechs Monate im Gips lief. Es gab Mittel, die Heilung zu beschleunigen. «Sonst war niemand da außer mir? Hat ihn besucht?»
«Niemand!», sagte die Schwester bestimmt.