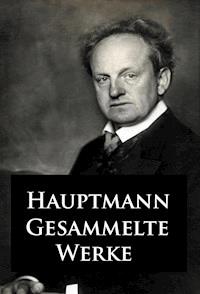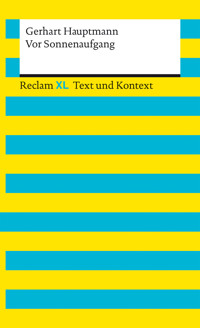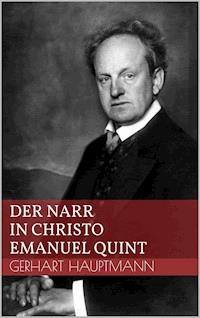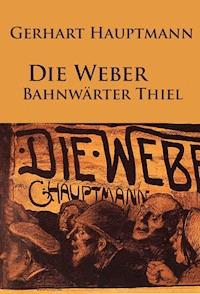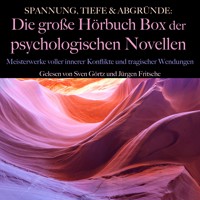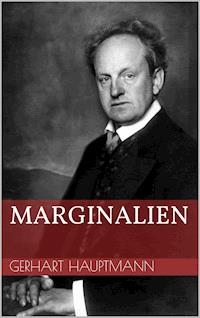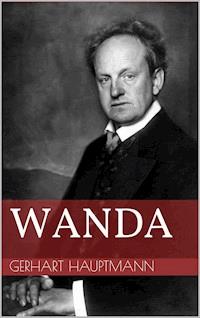Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gerhart Johann Robert Hauptmann (geboren 15. November 1862 in Ober Salzbrunn (Szczawno-Zdrój) in Schlesien; gestorben 6. Juni 1946 in Agnetendorf (Agnieszków) in Schlesien) war ein deutscher Dramatiker und Schriftsteller. Er gilt als der bedeutendste deutsche Vertreter des Naturalismus, hat aber auch andere Stilrichtungen in sein Schaffen integriert. 1912 erhielt er den Nobelpreis für Literatur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 501
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Buch der Leidenschaft
VorwortErster TeilZweiter TeilImpressumVorwort
Fratelli, a un tempo stesso, Amore e Morte Ingenerò la sorte. Cose quaggiù sì belle Altre il mondo non ha, non han le stelle.
Leopardi
Der Bewahrer dieses Tagebuches stammt aus einer französischen Flüchtlingsfamilie. Seinen Namen verrate ich nicht, da er ihn mit dem versiegelten Manuskript, das sein Nachlaß enthielt, nicht in Verbindung gebracht sehen will. Deutlich gesprochen: er verleugnet das hier zum erstenmal der Öffentlichkeit unterbreitete Tagebuch. Mit welchem Recht, entscheide ich nicht. Über die Gründe ließe sich streiten. Ich würde im gleichen Falle nicht so handeln. Leben, Lieben, Leiden ist allgemeines Menschenlos, und indem man dem Leben, Lieben und Leiden Worte verleiht, spricht man im Persönlichen doch nur das Allgemeine aus. Gewisse Dinge mit Schleiern verhüllen? Warum nicht, wenn es reiche und farbige Schleier sind! Aber dann nicht dort, wo es Wahrheit zu entschleiern gilt. Und dies, nämlich der Zwang dazu, das Bestreben, der Wahrheit ins Auge zu sehen, sich mit Wahrheit zu beruhigen, ist in den Selbstgesprächen dieses Tagebuches nicht zu verkennen.
Der Urgroßvater des Mannes, der diese Aufzeichnungen hinterließ, hat bereits eine Deutsche geheiratet, der Großvater, ein geschätzter Architekt, ebenfalls, der Vater eine Holländerin. Dies führe ich an, weil die so bedingte Blutmischung zu einer gewissen Schwere der Lebensauffassung, wie sie in den Meditationen zum Ausdruck kommt, recht wohl stimmen würde. Überhaupt: der Verewigte möge mir verzeihen, wenn ich ihn schließlich doch nicht für den Verwalter, sondern für den Verfasser des Tagebuches halten muß und seiner Blutmischung auch das wunderliche Versteckenspiel im Verhältnis zu seinem postumen Lebensdokument zuschreibe. Denn wollte er, wie während des Schreibens, Selbstgespräche zu Papier bringen, die das ewige Schweigen bedecken sollte, so liegt schon darin ein Widerspruch. Sie konnten freilich ein Atmen seiner Seele sein, das ihn vor dem Ersticken bewahrte. So mochte er sie immerhin dem Feuer überantworten, wenn sie ihren Dienst getan hatten. Statt dessen siegelte er sie ein.
Wer etwas einsiegelt und verwahrt, wünscht es natürlich zu erhalten. Erhalten aber sind diese Selbstgespräche nur dann, wenn sie eines Tages, von Siegel, Schnur und Umschlag befreit, lebendig hervortreten. Es verstößt also keinesfalls gegen die Pietät, das scheinbare Nein des Erblassers zu übergehen und, indem man seinen einsamen Seelenmanifestationen den Resonanzboden schicksalsverwandter Allgemeinheit gibt, seinen uneingestandenen wirklichen Letzten Willen zu erfüllen.
Das Manuskript ist nicht vollständig abgedruckt. Es lag mir daran, das Haupterlebnis herauszuschälen: ein Schwanken zwischen zwei Frauen, das sich seltsamerweise über zehn Jahre erstreckt, obgleich auf dem ersten Blatt scheinbar der Sieg einer von beiden entschieden ist. Dieser Fall ist verwickelt genug und darf nicht, wie es im Original geschieht, vom Gestrüpp des Lebens überwuchert werden, wenn man ihn in seinem organischen Verlauf begreifen soll.
Ich möchte übrigens glauben, der Verfasser des Tagebuches würde in ebendieselbe Krisis verfallen sein, falls die beiden Frauen, hier Melitta und Anja genannt, zwei ganz andere gewesen wären. Er unterlag vielleicht einem Wachstumsprozeß seiner sich im Umbau erneuernden und ewig steigernden Natur und hätte, um nicht dabei zu scheitern, Anja erfinden müssen, wenn sie nicht glücklicherweise vorhanden gewesen wäre. Jedenfalls wird, wer bis zum Schlusse des Buches gelangt, unschwer erkennen, daß die Lebensbasis des Autors eine andere als die am Anfang ist. Sie ist höher, breiter und fester geworden. Auch die Welt um ihn her hat ein anderes Gesicht: das konnte nur ein Jahrzehnt harter innerer Kämpfe bewirken.
Agnetendorf, Oktober 1929.
Der Herausgeber
Erster Teil
Grünthal, am 10. Dezember 1894.
Merkwürdig: die letzten acht Jahre meines Lebens erscheinen mir wie ein Tag, dagegen die Zeit von gestern zu heut durch Jahrzehnte getrennt auseinanderliegt. Mir ist, als wäre mein Reisewagen bei klarem Wetter allmählich hügelan gerollt, so daß die zurückgelegte Strecke von ihrem Ausgangspunkte an immer unter meinen Augen blieb, und plötzlich habe der Weg eine Biegung gemacht auf eine Art chinesischer Mauer zu, die Kutsche sei durch ein Tor gerollt und dieses habe sich, sobald sie hindurch war, für immer geschlossen und alles hinter mir versperrt.
Das hochverschneite Landhaus, darin ich dies schreibe, wird von mir, meiner Frau und den Kindern bewohnt, nicht zu vergessen mein Bruder Julius und seine Frau, die den östlichen Flügel für sich benützen. Gestern um die Dämmerung kam ich auf dem Bahnhof an, der tiefer im Tale liegt. Meine Frau, meine Kinder empfingen mich, und die ausgeruhten vierjährigen Litauer, die ich erst vor sechs Wochen gekauft habe, zogen den Schlitten, darin wir, in Pelzwerk wohl eingemummt, beieinandersaßen, mit Schellengeläute das Gebirge hinan. Weihnachten steht vor der Tür. Die Kinder lachten, forschten mich nach Geschenken aus, neckten und streichelten mich, indes meine Frau, im Gefühle mich wiederzuhaben, ein gesichertes Glück genoß.
Was bist denn du für ein Mensch? sprach ich zu mir. Äußerlich doch derselbe, denn die Gattin und die Kinder erkennen dich ganz für den, der du gewesen bist. Sie sind erfüllt von dem Jubel des Wiedersehens – und dir sitzt der Schmerz des Abschiedes wie ein unbeweglicher Stachel tief in der Brust! Warum erwärmt dich das volle und ahnungslose Vertrauen dieser hingegebenen Herzen nicht, sondern erzeugt einen ratlosen Schrecken in dir, wie etwas Furchtbares? Kannst du nicht, gewaltsam, ganz der Mann, ganz Gatte und Vater von ehedem wieder sein und in die vollkommene Harmonie dieser Seelen einstimmen?
Nein! – Es war, als habe irgendwo gegen die leichentuchartigen Schneeflächen der Talabhänge oder vor dem klaren und funkelnden Nachthimmel ein riesiges Haupt seine schweren Locken verneinend geschüttelt, kurz ehe mein Blick es treffen konnte. Es geht nicht an, du bist für sie tot!
Ich kam aus Berlin. Ich hatte eine berufliche Angelegenheit zu einem überraschend glücklichen Ende geführt. Nun auf einmal waren wir hinsichtlich unseres Durchkommens sorgenfrei. Für mich bedeutet das nicht allzuviel, für meine Frau, die von Natur geneigt ist, sich Sorgen zu machen, desto mehr. Die Freude über den Vermögenszuwachs steigerte ihr für gewöhnlich ernstes Wesen schon während der Fahrt zu einer Art Ausgelassenheit. Sie sagte mir, zu Hause angelangt, unter der freundlichen Lampe im warmen Zimmer, ich solle fortan keinen Anlaß haben, sie wegen Niedergeschlagenheit und Trübsinns zu schelten, denn nun sehe sie meine Zukunft und die der Kinder gesichert nach Menschenmöglichkeit. Plötzlich stutzte sie aber und fragte mich, ob ich unpäßlich sei. Ich verneinte das. Allein soviel ich mir nun auch Mühe gab, wenigstens diesen Abend noch der alte zu scheinen, bemerkte ich doch, daß sie beunruhigt blieb und wie in uneingestandener Angst vor irgendeinem drohenden Unheil ihre häuslichen Obliegenheiten verrichtete.
Ich habe unter anderen Schwächen auch die, nichts Wesentliches verbergen zu können. Außerdem hatten meine Frau und ich uns in dem Versprechen geeinigt, unsere Herzen sollten einander jederzeit und ohne alle Hinterhältigkeit offen sein. Als ich daher, mit der Lüge im Herzen, nach einer ziemlich peinvollen Nacht mich erhoben hatte und meine Frau mit schmerzlicher Dringlichkeit mich geradezu nach der Ursache meines veränderten Wesens fragte, bekannte ich ihr, wie in der Tat ein Ereignis in mein Leben getreten sei, unerwartet und unabweisbar, von dem ich nicht wissen könne, ob es zugunsten unseres gemeinsamen Lebens auszuschalten sein werde oder nicht. Und nun ergriff ich entschlossen und wie unter einem Zwang das Messer des Operateurs und trennte mit einem grausamen Schnitt zum größten Teile die Vernetzungen unserer Seelen, indem ich erzählte, daß ich einer neuen, leidenschaftlichen Liebe verfallen sei.
Sie glaubte mir nicht. Und jetzt, wo die Wunde gerissen war und blutete, verband ich sie, und um die Frau, die ich fast so sehr liebte wie mich selbst, am Leben zu halten, gab ich ihr allerhand Stärkungsmittel und behandelte sie in jeder Beziehung wie ein verantwortungsvoller Arzt. Ich gab mir den Anschein, als nähme ich nun plötzlich die Sache leicht, als habe ich wirklich nur einen Scherz gemacht, schnitt aber doch, mit »wenn« und »vielleicht« das Unheil ins Bereich des Möglichen ziehend, verstohlen weiter Fäden entzwei, bis die arme Patientin im Fieber lag und alsbald mit ihrem Fieber mich ansteckte.
Ich habe ihr nun zum zwanzigstenmal gesagt, es sei, um uns nicht in der ersten Verwirrung unserer Seelen zugrunde zu richten, nötig, den ganzen Konflikt auf einige Stunden wenigstens als nicht vorhanden zu betrachten, und bin dann heraufgeeilt, um schreibend für einige Zeit die Sachen kühl und als fremde zu sehen und so, wenn auch vorübergehend nur, ihrer Herr zu sein.
Nachmittags.
Es will ihr nicht in den Kopf. Und wie sollte sie auch nach dem, was wir einander gewesen sind und miteinander durchlebt haben, glauben, daß ich ihr unwiderruflich und unwiederbringlich verloren sei?! Sie wollte den Namen des Mädchens wissen oder der Frau, die es mir angetan habe, und als sie ihn, hin- und herratend, endlich erfuhr, fiel sie erst recht aus allen Himmeln, denn sie begriff es nicht, daß ein so unbedeutendes, oberflächliches Menschenkind mich fesseln könne. Sie meinte, es würde sie nicht gewundert haben, wenn irgendeine reife und bedeutende Frau – sie nannte Namen – mir Eindruck gemacht hätte. Aber dieses unbeschriebene Blatt, dieses halbe Kind ohne jede Erfahrung und ohne Charakter, wie sie es kannte, als Rivalin zu denken, verletzte im Innersten ihren Stolz. Es ist nicht unedel, sondern durchaus nur natürlich, daß sie mit starker Geringschätzung und entrüstet von dem Mädchen sprach und ihr alle erdenklichen Fehler andichtete: Leichtsinn, Verliebtheit, Vergnügungssucht, und daß sie für ganz unmöglich erklärte, ein so nichtssagendes, leeres Ding könne Sinn und Verständnis für meine Art und Bedeutung haben.
Seltsam, mir wird sofort um einige Grade leichter zumut, wenn von der Geliebten, sei's auch im Bösen, überhaupt nur die Rede ist. Ich verteidige sie wenig, denn es liegt mir gar nichts daran, wenn andere sie für etwas Besonderes halten. Im Gegenteil, so habe ich sie desto mehr und ausschließlich für mich.
Ich sehe übrigens ein, daß ich als Mann und Familienvater alles Erdenkliche aufzuwenden schuldig bin, um mich von dieser Raserei zu befreien. Aber die Stärke, mit der sie von meinem Wesen Besitz ergriffen hat, läßt wenig Hoffnung nach dieser Seite. Andre Hoffnungen leuchten in mir auf, erneuern die Welt mit der Kraft eines unerhörten Feuerwerks und entschleiern Gegenden voll unbekannter, himmlischer Lockungen.
Ich bin über dreißig Jahre alt. Von meinen Kindern ist das älteste ein Junge von acht, das zweite ein Junge von sechs, das dritte ein Mädchen von kaum zwei Jahren. Vier Jahre war ich verlobt, woraus hervorgeht, daß ich zu denen gehörte, die warten können, und daß ich jung in die Ehe kam. Ich glaubte bisher durchaus nichts anderes, als daß nun mein ganzes Leben, und zwar bis zum letzten Atemzuge, in dieser Liebe gebunden sei. Außerhalb dieses festgefügten Familienweltsystems, darin meine Gattin für mich die Sonne, die Kinder und ich Planeten darstellten, lag für meine Begriffe nichts, was sein Bewegungsgesetz auch nur von fern zu ändern in der Lage war.
Es ist eigentlich gar nichts Festes in mir. Der entschiedene und gewisse Bau meiner Seele scheint von reißenden Wassern unterwühlt und hinweggespült, so daß ich statt fester Türme, Mauern, Gemächer und Stockwerke nichts als schwimmende Trümmer erblicke. Was soll ich tun? Ich sehe zu. Ich stehe in der Gewalt eines Naturereignisses, das um so furchtbarer ist, weil es äußerlich niemand bemerken kann. Ich sehe zu und hoffe und warte auf ein Wunder.
Mein ganzes Wesen unterliegt einer Umbildung. Worauf soll ich fußen?
Mitunter kommt mir das verwegene Spiel, das ich zu spielen gezwungen bin, in seiner Unerhörtheit zum Bewußtsein, und dann, muß ich sagen, schaudert es mich. Ich frage: wie wird der Ausgang sein? und finde darauf durchaus keine Antwort. Bringt mir den Arzt! Ihr solltet doch wissen, daß der Zustand, dem ich verfallen bin, ganz unabhängig von meinem Willen ist. Wenn ich ein Gift auf die Zunge nehme, so kann ich nicht hindern, daß es mein Blut zersetzt und meine Maschine zum Stillstand bringt. Man flöße mir Wein durch die Gurgel, und ich werde betrunken, mein Wille leiste auch einen noch so entschlossenen Widerstand. Ebenso ist es vergeblich, mit dem Willen gegen den Typhus zu kämpfen, sobald er, und zwar in starker Form, uns einmal ergriffen hat. Wir müssen uns seinem Verlauf unterwerfen und anheimstellen, ob wir davonkommen oder nicht.
Grünthal, am 11. Dezember 1894, vormittags.
Soeben sprach mein Bruder Julius mit mir. Es konnte ihm nicht verborgen bleiben, daß etwas zwischen uns ist, was den Geist, den Frieden, das Glück unseres ganzen Hauses in Frage stellt. Was ich ihm aufklärend sage, nimmt er nicht ernst. Er betont immer wieder, es sei ja vielleicht nicht so unerhört, daß ein Mann in meinen Jahren und Verhältnissen sich nochmals verliebe, aber es gebe doch nur eine ganz bestimmte Art, den daraus erwachsenden Konflikt zu lösen. Ich bin anderer Meinung. Er widerspricht, und wir reden stundenlang hin und her, ohne am Schlusse einig zu sein. Er fragt auch, was ich beginnen wolle, und bezeichnet es als Wahnsinn – wie es mir denn auch beinahe erscheint –, mein gegründetes Hauswesen, Frau und Kinder zu verlassen und planlos davonzuziehen. Allein noch während mir davor graut, vor der Unzuverlässigkeit und Wandelbarkeit der eigenen Natur und ihrer Härte, jubelt es in mir auf, so daß ich plötzlich nicht anders kann und von meinem neuen Glücke zu reden beginne. Ich reiße, selbst hingerissen, den Bruder fort und merke ihm an, daß die trunkenen Schilderungen schon genossener und noch bevorstehender Freuden der jungen Liebe ihn völlig einnehmen, bis er mit mir zu schwärmen beginnt und seine Absicht, mich umzustimmen, vorübergehend gänzlich vergißt.
Nachmittags.
Ich habe ein unbestimmtes Gefühl davon, daß ich meiner Umgebung wie ein Kranker erscheinen muß, vor allem meiner geliebten Frau, der ich kaum von der Seite weiche. Das unsichtbare Ereignis bildet ein neues Band zwischen uns, und indem wir darüber reden, verschränken sich unsere Seelen mit einer seit Jahren abhanden gekommenen Innigkeit. Oftmals graust mir vor dem, was ich ausspreche, zeigt es doch meist die Verblendung durch Leidenschaft mit allergrausamster Offenheit, während es gleichzeitig auch verwirrend ist und nach Irrsinn duftet. Es ist ja nur Wahrheit, wenn ich sage, daß gleichsam ein Quell der Liebe, der meine ganze Welt übernetzt, in mir zum Durchbruch gekommen ist. Es ist ja nur wahr, daß in mir das »Seid umschlungen, Millionen!« singt und klingt und dabei meine Frau für Hunderttausende gilt. Es zieht mich zu ihr, ich liebe sie. Wenn das Innerste zweier Seelen sich berührt, so gibt es eine physisch deutlich empfundene letzte Einigkeit, und ich glaube nicht, daß ich während der ganzen Dauer unseres Verhältnisses sie je mit gleicher Stärke empfand. Und doch! wie soll sie es mit der unausbleiblichen Trennung in Übereinstimmung bringen, von der im gleichen Atem die Rede ist? Während ich spreche, raunt es in mir: Gewiß, du liebst sie wie eine Sterbende. Ich erschrecke und hüte mich, diese nüchterne Stimme laut werden zu lassen.
Meine Frau und ich, wir tanzen in diesen Winterstunden einen gefährlichen Tanz. Wir laufen treppauf, treppab hintereinander her, umeinander herum, suchen einander im Reden und umschlingen einander schweigend in qualvoller Innigkeit. Was um uns vorgeht, beachten wir nicht. Es ist kein Winter um uns, kein Sommer um uns. Wir haben kein eigenes Dach über uns, keinen eigenen Grund unter unseren Füßen. Keine Freunde haben wir, keine Geschwister, keine Kinder. Die unerledigten Korrespondenzen häufen sich. Nicht ein Brief wird beantwortet. Wir haben keine Geschäfte, keine Interessen, keine Pflichten. Wir klammern uns nur aneinander wie Menschen, die über Bord gefallen sind und sich retten wollen. Meinethalben, sie wollen einander retten. Aber der eine kann schwimmen, der andre nicht. Und während der Schwimmer den anderen packt, befällt diesen die Todesangst, er klammert sich verzweiflungsvoll um den Retter, und jählings beginnt jener letzte Kampf, der alle Menschen zu Feinden macht.
Grünthal, am 12. Dezember 1894, vormittags.
Immer wieder gerate ich in Staunen über die vollkommen veränderte Art und Weise, mit der ich meine nächste Umgebung auffasse. Eines Tages erblickte ich bei einer Gebirgspartie von oben her dieses Tal und dachte, hier wäre gut Hütten bauen. Entzückt und begeistert stieg ich mit diesem Gedanken durch Wälder und über Wiesenpfade hinab und hatte binnen weniger Stunden das Bauernhaus mit dazugehörigen Ländereien, Grasflächen, Buchenhainen und Quellen käuflich an mich gebracht. Noch erinnere ich mich der unendlichen Freude von Frau und Kindern, als wir den schönen Grund unser eigen nannten und angefangen hatten mit dem Umbau der alten, zerfallenen Kate, die dann, aufs beste verwandelt, unser behagliches Heimwesen werden sollte. Ich dachte nicht anders, als daß keine Macht der Welt mich vor meinem Ende von diesem Asyl und Grund trennen sollte. Ich hatte dies ganze Haus Jahre vorher aus wünschlichen Träumereien in meiner Seele liebevoll aufgebaut und, während es, jedermann sichtbar, wirklich erstand, wochen- und monatelang dem Maurer auf seine Kelle, dem Zimmermann auf die Axt, dem Tischler auf seinen Hobel gesehen. Jedes Möbelstück in der freundlichen Zimmerflucht hatte ich selbst gekauft und gestellt, und es hing kein Bild an den Wänden, wozu ich nicht eigenhändig die Fuge für den Nagel gesucht und einige Nägel mit ungeduldigem Hammer gekrümmt hätte. – Wie sieht mir nun alles auf einmal fremd und gespenstisch aus!
Ich habe mein Buch, in das ich dies schreibe, auf ein altes Stehpult am Fenster gelegt. Mich umgibt ringsum meine liebevoll aufgestapelte Bücherei, die den Weg meines suchenden Geistes kennzeichnet. Stiche, Abgüsse griechischer Büsten, Photographien, allerhand Reiseerinnerungen liegen und stehen umher, und alles das bedeutet auf einmal für mich nur Plunder.
Grünthal, am 13. Dezember 1894, nachmittags.
Der heutige Tag hat mir den furchtbaren Ernst meiner Lage gezeigt, die ganze Zerrüttung meines bisherigen häuslichen Seins. Der Kampf zwischen mir und meiner Frau, Melitta, nimmt Formen an, die an Wahnsinn streifen. Ich höre von ihr bittere, schiefe und ungerechte Worte, die ich vergebens zu widerlegen suche. Ich stoße selbst bittere und ungerechte Worte aus, die sichtlich eine marternde Wirkung ausüben. Es kommt so weit, daß meine Frau einem hysterischen Anfall unterliegt und in schrecklicher, grotesker Weise zu tanzen beginnt. Das ist die Gefahr! Ein Zug der Schwermut war ihr bereits als Mädchen eigen. Damals erhöhte er ihren Reiz. Hernach kamen Monate, Jahre, wo dieser Gemütsausdruck sich auf mich übertrug und mein an sich heiteres Wesen in steter Abhängigkeit erhielt. Unsere Kinder waren einander schnell gefolgt, und das Abnorme der Zustände vor der Geburt und nach der Geburt hat die Mutter sehr angegriffen und sie gegen allerlei Einwirkungen, die das Gemüt berührten, wehrlos gemacht. Ich bin zu einer Zeit in den sogenannten Stand der heiligen Ehe getreten, wo junge Menschen gewöhnlich ihr Leben in Freiheit zu genießen beginnen. Aber was geht mich das alles in diesem Augenblick an, und was soll es damit? Will ich mich vor mir selbst entschuldigen? Es bedarf dessen nicht. Ich fühle in jedem Augenblick, daß ich einer Macht verfalle, also schuldlos bin. Melitta aber kann sich nicht mitteilen, sie kann ihr Herz nicht durch Schreiben erleichtern. Weshalb soll ich unedel sein und Anklagen in ein Buch setzen, ohne daß die Angegriffene Gelegenheit findet, sich zu verteidigen? Sie litt mehr als ich ... leidet mehr als ich! – Wer leidet wohl mehr als derjenige, der sein Leiden in sich verschließen muß? Ich sah dieses Leiden, wenn sie in wortloser Grübelei unruhigen Schrittes hin und her lief, von einer Zimmerecke zur anderen, wie eine Gefangene im Kerker, die dem Verhängnis nicht entrinnen kann. Sie sagt, ich hätte nur immer für die Mängel ihrer Natur Sinn gehabt, etwas Gutes in ihr niemals gesehen, ihr Wesen klein gemacht und erdrückt. Vergeblich beweise ich ihr in der Hitze des Streites das Gegenteil. Du hast mich, sage ich ihr, als einen nichtsbedeutenden, armen Jungen mit Entschlossenheit aufgegriffen. Dein Charakter war so, daß du der leidenschaftlichen Einreden deiner Verwandten nicht geachtet hast. Sie hielten mich alle für ein Geschöpf ohne Aussichten. Du glaubtest an mich! Du eröffnetest mir mit deiner Liebe und deiner Freigebigkeit die Welt, trotzdem du deswegen Spott genug zu erdulden hattest. Ich ging einen Weg, der im Sinne der Anschauung unserer Väter keiner war: denn was ist ein Mensch in den Augen eines guten Bürgers, der keinen bürgerlichen Beruf ergreift und sich mit Idealen befaßt, statt nach Rang, Gold und Titeln zu streben?! Wenn ich dieses und Ähnliches zu ihr gesagt hatte, wiederholte sie doch ganz unentwegt, ich wisse das Gute in ihr nicht zu würdigen.
Grünthal, am 14. Dezember 1894, vormittags.
Die Nacht war unruhig und zum Teil schlaflos. Ich fürchte, es wird überhaupt mit dem Schlaf des Gerechten auf Jahre hinaus vorüber sein. Der Kopf summt mir von allerhand süßen und zärtlichen Melodien, trotzdem die Wolke des Schicksals in mein Haus hereinlastet und etwas Drohendes überall mich berührt. Ich habe heut eine Aufgabe. Die Aufgabe ist, in das Postamt des nächsten Dorfes zu gehen und nachzufragen, ob ein bestimmter Brief für mich dort lagert. Ich bin sehr unruhig und gespannt. Das frische, geliebte Kind hat sich zwar mit so unzweideutiger Neigung für mich erklärt, daß irgendein Zweifel an seiner Festigkeit vernünftigerweise nicht zulässig ist. Allein wann wäre der Liebende wohl vernünftig! Seine Zweifel steigern sich, selbst wo er sieht, ins Absurde hinein, wieviel mehr, wenn der Gegenstand seiner Leidenschaft seinen Augen entzogen ist. Es kommt ihm in diesem Falle mitunter so vor, als habe er nur geträumt. Die vergangenen glücklichen Augenblicke erscheinen ihm unwirklich, und er wartet krampfhaft auf einen Liebesbrief als feste Bestätigung. So geht es mir. Was kann sich übrigens alles ereignen in einem Falle, wie unserer ist, der sie, wenn etwas ruchbar würde, sogleich in die bittersten Kämpfe mit den Ihren verwickeln müßte: Kämpfe, in denen ihr fester Wille vielleicht unterliegt. Geduld!
Das ganze Haus ist von einem eigentümlichen, schmerzlichfestlichen Licht erfüllt. In einem persönlich tieferen Sinne liegt etwas von Karfreitagszauber darin. Die Fähigkeit, die mir innewohnt, zugleich der Darsteller in der rätselhaften Dichtung des Lebens und der Zuschauer dieses Dramas zu sein, ermöglicht mir, nüchternen Auges eine Art Weihe über uns allen zu erkennen. Ringsum keine Spur von Banalität. Es gibt kein Familienheim, wo nicht Banalität, wie Weinstein das Innere eines Weinfasses, unmerklich die Wände, Dielen und Decken, Möbel und Menschen überzieht, so daß mit der Zeit die Seele darin, wie der Wein im Faß, keinen Platz mehr hat. Nun sind aber unsere Seelen ausgedehnt und lodern wie qualvoll selige Feuer.
Es ist seltsam, wie weit mein Wahnsinn geht. Aller Augenblicke nehme ich den »Westöstlichen Divan« oder den zweiten Teil »Faust« zur Hand und finde überall Worte, die mich in meiner entschlossenen Liebe bestätigen. Das wäre an sich nicht wunderlich, aber ich tue noch mehr. Ich beweise mit diesen Bestätigungen meiner gequälten Frau, die doch nur immer aus allem Totenglocken des eigenen Glückes klingen hört, daß ich auf rechtem Wege bin. Ich spreche von einem Früh-Frühling, der mir wieder beschieden sei, und gehe so weit, ihr anzuraten, auch einem solchen neuen Frühling entgegenzuwarten. Wir weinen dabei zuweilen in seligem Schmerz und küssen uns. Vor unseren Seelen tauchen die ersten Tage, Monate und Jahre unserer Liebe auf. Wir leben in diesen vergangenen Zeiten zärtlich, als stünden wir mitten darin: Weißt du noch, wie du dich über die Gartenmauer herunterlehntest, mit dem schwarzen, seidigen Haar und dem bleichen Gesicht und in jenem Jäckchen, das wir Zebra nannten, weil es weich und gestreift wie das Fell eines Zebras war? Weißt du noch, wie lange ich winkte, sooft ich Abschied nahm? und aus dem Schnellzug heraus, gegen die Talabhänge hin, wo euer Landsitz sich stolz und behäbig erhob? Weißt du noch, wie ich dir an die Gebüsche im Garten allerhand Zettel mit Liebesworten befestigt hatte, die du finden solltest, nachdem ich bereits aus eurem Kreise wiederum in die Fremde entwichen sein würde? Weißt du noch? Erinnerst du dich an den Frühlingsmorgen, den Heidenturm und den ersten Kuß? Weißt du noch? Ja weißt du noch? – Und wir gedachten an tausenderlei entzückende Einzelheiten unseres wahrhaft romantischen Liebesglücks.
Nachmittags.
Ich besitze den ersten Brief. Ich glaube, ich war ziemlich unsicher, als ich am Schalter stand, und wie ich aus dem ländlichen Postamt auf die Straße gelangt bin, weiß ich nicht. Die Schriftzüge wirken nüchtern, bestimmt und männlich, durchaus nicht wie von der Hand einer Siebzehnjährigen. Der Inhalt des Briefes dagegen ist von einer entzückenden Frische und hinreißend, wie aus der Pistole geschossen, wenn dieses Bild in Dingen der Liebe erlaubt sein kann. Und was kann süßer und weiblicher sein als die zwei Worte der übrigens namenlosen Unterschrift: Dein Eigentum!
Es ist natürlich, daß ich mit diesem Text im Kopf entzückt, entrückt und beseligt bin. Denn es gibt keinen Fürsten, Kaiser und Gott, der mit einer so geschenkten, so gearteten Gabe durch gleiche Gnaden wetteifern könnte. Ich kann meine Freude nicht verbergen, und da meine Frau nicht weiß, woher meine überschwengliche Laune stammt, sieht sie darin ein Zeichen veränderter Sinnesart, das sie zu ihren Gunsten deutet, und heitert sich, wenn auch allmählich und schüchtern, mit mir auf.
Den Brief in der Brusttasche, schreite ich mit ihr in den Zimmern umher oder sitze zu ihren Füßen am Fenstertritt, auf dem ihr Nähtischchen steht, und bringe nur eitel rosige Hoffnung zum Ausdruck, die mich erfüllt. Die Hindernisse, die Schwierigkeiten, die schweren Gefahren aller Art, mit denen unsere nächste Zukunft auf uns lauert, erkenne ich nicht an, überfliege ich. Ich sage einfach: Es wird alles gut werden! Dabei denke ich immer: Dein Eigentum ...
Ich habe ein tolles Gefühl in mir: vor Menschen sicherlich närrisch, schwerlich vor Gott. Mein Glück ist so groß, daß ich alles in seinem Gefühl vereinigen möchte. Ich möchte jedermann, aber vor allem denjenigen, die ich lieb habe, davon mitteilen. Ich glaube an arkadische Zustände, wo mein Glück wie eine leichte, bezauberte Luft alles zu ein und derselben göttlichen Trunkenheit in Liebe vereinigen kann. Indem ich dergleichen Ideen ausspreche, blickt meine Frau mich andächtig lauschend an, um schließlich, auf ihre Arbeit gebeugt, immer wieder leise, kaum merklich, den Kopf zu schütteln. – Dein Eigentum! Dein Eigentum!
Grünthal, am 15. Dezember 1894.
Besinne dich, komm zu dir selbst! Hat sich nicht eine betäubende Wolke auf dieses verschneite Haus gesenkt, die nicht nur meine Vernunft, sondern mich selbst ersticken will? Melitta schläft. Es ist gegen Mitternacht. Sie hat ein Schlafmittel eingenommen. Ich habe mein Lager oben unter dem Dach. Es ist mir mit vieler Mühe gelungen, mich für die Nacht zu isolieren. Wir dürften durch unsere Unruhe die Wirkung des Schlafmittels nicht in Frage stellen, behauptete ich.
Furchtbar zerrüttende Nächte liegen hinter uns. Mit ruhigem Vorbedacht nenne ich sie Höllen. Die Tage sind schlimm: noch eine kleine Anzahl solcher Nächte aber, das wäre der Tod! – auch dies geschrieben nach ruhigem Vorbedacht.
Wir wüteten heute gegen uns selbst. Ein Grimm, eine Wut gegen uns, gegen unsere Vergangenheit, gegen die ganze Nasführung durch das Schicksal war in uns aufgekommen, eine Zerstörungswut gegen alles, was darin glücklich war. Wir wollten das Gestern nicht mehr wahrhaben, nachdem es uns zum Heute geführt hatte, diesem schrecklichen Heut, das doch wohl auf dem Grunde allen Glückes tückisch gelauert hatte. Der Gedanke, dieses ganze Leben war ein gemeiner Betrug, einigte uns.
Wir verfielen darauf, ein großes Autodafé anzurichten. Stöße von Liebesbriefen mußten her. Es war ein Fieber, wir waren irrsinnig. Alle steckten noch in den Umschlägen. Schübe und Kassetten wurden mit einem sinnlosen Eifer um- und umgekehrt, unsere Hände fuhren wie Wiesel in ihre Schlupflöcher. Alles mußte vernichtet sein. Das kleinste Zettelchen, das von unserer Liebe hätte zeugen können, wurde dem Feuer überliefert.
Gut eine halbe Stunde lang und länger brannte der Papierberg hinterm Haus. Den Schnee zerschmelzend, hatte er sich bis zur nackten Wiesenkrume niedergesenkt. Wir standen dabei, die Kinder schürten das Feuer. So sündigten wir an den seligsten Jahren unseres Lebens, so vernichteten wir alle Wonnen, Sehnsüchte, Liebesbeteuerungen, alle diese heiligen Zeichen, bei denen der Gott der Götter uns die Hand geführt hatte.
Wie grausig doch das Lachen der ahnungslosen Kinder anmutete! Ich habe gesehen, wie sie unter Schmerzen von ihrer Mutter geboren wurden, habe sie gebadet, auf dem Arm getragen, trockengelegt, habe sie betreut, wenn sie krank waren – und morgen will ich mich nun von ihrer Mutter und somit auch von ihnen abwenden! Meiner Wege will ich gehen und sie allein lassen in der Welt! Ist dies eine Sache, die man ausführen, ja, auch nur ein Gedanke, den man denken kann?
Während das Feuer über dem Leichnam unserer Liebe zusammenschlug, der Wind hineinfuhr und die einzelnen papierenen Fetische der Vergangenheit auseinandertrieb, trug ich einen Fetisch verwandter Art heimlich auf der Brust, meinen Anja-Brief mit der Unterschrift »Dein Eigentum«, jenen, den ich verstohlen von der Post einer benachbarten Ortschaft geholt hatte. Und während die Kinder den einzelnen papierenen Flüchtlingen nachliefen und sie der Glut überlieferten, sprang dieser mit meinem Herzen, in dessen nächster Nähe er lag, wie der Reiter mit einem Füllen um. Heiß, heißer als irgendein im Feuer brennender war dieser Brief. Und wenn ich mir dessen bewußt werde, frage ich mich, wie es möglich ist, in einem Raum der Seele neben unendlichem Schmerz unendliches Glück zu beherbergen, wie es von diesem Zettelchen Anjas in jede Fiber meines Wesens schlug. Waren wir eigentlich und war ich eigentlich für das heute Geschehene noch verantwortlich? Ich fürchte nein, da ich nirgend einen Ausweg, nirgend ein Entrinnen sah. Ich hatte schreckliche Visionen. Sie bezogen sich auf mich selbst. Ich war der Henker, höllisch angeglüht, der in dem Feuer, darin er düster stocherte, nicht nur ein abstraktes, gewesenes Glück, sondern Weib, Kinder, Haus und Hof zu Asche werden sah. Und manchmal – es fehlte nicht viel – wollte er selbst in die Flamme hineinspringen.
Ich erschrak, als Melitta ihr Schlafmittel nahm. Mir kam der Gedanke: wenn es Gift wäre?! Wer weiß es, zu welcher Lösung ich einmal greife ...
Grünthal, am 16. Dezember 1894, morgens.
Eines ist ganz unabänderlich: ich muß fort. Mich graust es fast auszusprechen, aber weshalb sollte man sich selbst immer und immer schönfärberisch verfälschen: die Leute, mit denen ich hier zusammenlebe, sind mir ganz fremd. Sie verstehen mich nicht. Sie quälen mich. Sie verlangen Dinge von mir, die darauf hinauslaufen, ich solle eigenhändig meinem Dasein ein Ende machen. Vielleicht wissen sie nicht, was sie von mir verlangen, daß mein Leben ohne mein »Eigentum« so wenig im Bereich des Möglichen liegt wie das Atmen in einer Luft ohne Sauerstoff. Was geht mich das an? Warum sind sie in Dingen des Lebens so töricht und unerfahren? Nein, ich muß fort! Ich halte es nicht mehr aus im Bereiche der flehenden, rotgeweinten Augen meines Weibes. Das glückliche Lachen meiner ahnungslosen Kinder foltert mich. Das endlose Diskutieren mit Gattin und Bruder über das Unabänderliche macht mich mürbe bis zum Umsinken. Und wäre das alles nicht – ich muß zu ihr! Ich bin wie in einem unterirdischen Kerker hier, in den weder Sonne noch Mond dringen kann. Die Tage sind wie riesige Quadern, durch die ich mich mit den bloßen Nägeln ins Freie zu wühlen habe, und ich fühle, wie schon an Stunden, ja an Minuten mein Mut erliegt, meine Kraft versagt. Ich will zu ihr! Was geht mich das alles an: ob meine Frau sich abhärmt, ob meinem Bruder Unbequemlichkeiten und Sorgen erwachsen, ob meine Schwägerin sich mit Haß gegen mich erfüllt, ob meine Verwandten mich für wahnsinnig halten oder verbrecherisch! Ist doch die Frage für mich – und es genügt, wenn nur ich das weiß –: hie Leben, hie Sterben! Ich weiß gewiß, daß ich dem langsamen, martervollen Hinsterben der alten Existenz das schnelle durch einen Schuß unbedingt vorziehen würde. Wären die Meinen dann besser dran? Aber nein: ich will leben! ich will nicht sterben! Und ich habe überhaupt keine Wahl. Es gibt kein Zurück. Ich fühle, daß über mich und über mein ferneres Leben im ewigen Rate entschieden ist. Die Mächte haben für mich die Entscheidung getroffen – ich fühle das. Ich fühle, daß kein Entrinnen ist.
In mir ist keinerlei Leichtsinn, wahrhaftig nicht. Ich kann behaupten, daß ich in einer Art tiefer Entschlossenheit die unentrinnbare Nähe des Schicksals empfinde und daß ich von klaren Befehlen starker Stimmen durch Tage und Nächte begleitet bin. Alle weisen mich vorwärts, keine zurück! Allein indem sie mich vorwärts weisen, versprechen sie nichts, sondern sie senden mich in eine wildzerklüftete, durch Gewölke und Sturm verdüsterte, undurchdringliche Welt hinaus, wo Kämpfe und Mühsale meiner warten.
Berlin, am 18. Dezember 1894.
Seit gestern bewohne ich ein möbliertes Zimmer in Berlin. Es ist frostig, wie diese Räumlichkeiten zu sein pflegen. Ich gelange zu meinem Tuskulum durch einen engen, nach Mänteln und Schuhwerk riechenden Korridor, den meistens fettige Dünste schwängern. Auf diese Weise fängt ein besonderes Martyrium für mich an.
Ich bin sehr verwöhnt, und indem ich um diese Jahreszeit ein behagliches Heimwesen aufgebe, wo alles meinen Gewohnheiten, Wünschen und Neigungen schmeichelte, mache ich mich eigentlich obdachlos. Ich weiß nicht, was für einen entsetzlichen Stil diese schwarzlackierten, mit gepreßtem rotbraunem Plüsch überzogenen Möbel darstellen wollen. Ich weiß überhaupt nicht, warum sie da sind und die Öldrucke an den Wänden, in protzigen Goldleisten, die Papierblumen und dickverstaubten Makartbuketts und das schreckliche Bric-à-brac an Nippes, kleinen Vasen, japanischen Fächern, gestickten Deckchen und so fort; denn ich würde lieber in der gut gescheuerten Stube eines Kätners wohnen als in dieser Räumlichkeit.
Nun, was habe ich weiter damit zu schaffen! Wenn ich die Feder absetze, mit der ich in dieses Buch schreibe, nehme ich meinen Mantel um, stülpe den Hut auf den Kopf und begebe mich in die Winternatur, hinaus vor die Stadt, an die weitgedehnten, zugefrorenen Havelseen, und zwar nicht allein. Ich werde dabei die Stimme meiner Geliebten hören, das lustige Geläut ihres Lachens, werde ihren energischen Gang, ihre aufrechte Haltung bewundern und im Bewußtsein ihrer Gegenwart geborgen sein. Am Rande der Seen werde ich Schlittschuhe an ihre kleinen Füße legen, die meinigen auf Schlittschuhe stellen, und wir werden meilenweit über das Eis davonschweben, losgelöst von der ganzen, überflüssigen Welt.
Als ich sie gestern traf, verabredetermaßen auf einem großen, belebten Platz, war ich im ersten Augenblick beinahe enttäuscht. Meine erhitzte Einbildungskraft hat ihr Bild dermaßen ins Außerirdische gesteigert, daß keine Wirklichkeit es erreichen kann. Kaum aber waren wir eine Viertelstunde nebeneinander hingewandelt, so trat ihr ganzer Zauber wieder in Kraft und riß mich hin von einem zum andern überschwenglichen Augenblick.
Sie ist eher groß als klein. Sie beugt das kindliche Haupt nicht nach vorn, wenn sie grüßt, sondern wirft es zurück, so daß ihre großen, trotzigen Augen kühn hervorstrahlen mit einem graden, entschlossenen Blick. Ihr Händedruck ist bieder und fest. Man fühlt den Freund, nicht, wie bei manchen Frauen, nur das Weib in der molluskenhaft weichen Hand. Ein Geist des Vertrauens geht von ihr aus, der von mir als eine neue Schönheit empfunden wird.
Ihr Bruder, wie Anja erzählt, hat sie zuweilen, als sie noch ein Kind war, auf hohe Schränke gestellt und ihr befohlen, herunterzuspringen: sie hat das immer sofort getan. Er fing sie mit den Händen auf, wodurch ihr vertrauender Sinn bestärkt wurde.
Ich weiß nicht, wie ich in meinem Alter plötzlich das Glück einer so wundersamen Verjüngung empfinden kann. Es ist, als befinde sich die ganze Natur um mich her im Stande der Erneuerung. Mit einemmal ist das rastlos Suchende aus meinem Wesen verschwunden, eingenommen und aufgesaugt von einer Erfüllung über Erwarten. Ich lese nichts mehr. Die hypochondrischen Grübeleien sozialistischer, ethischer, religiöser und philosophischer Essayisten erscheinen mir überflüssig oder gar wie häßliche, krankhafte Prozesse zur Vermehrung der Makulatur. Zuzeiten erscheint mir die geistige Produktion dieser Art einem Niagarafalle von Abwässern nicht unähnlich, und ich habe den Wunsch, daß irgendein bodenloser Abgrund sie verschluckt. Dies alles beschäftigt uns viel zu sehr in müßiger Weise und lenkt uns von dem einzigen Sinn des Lebens, von der Liebe, ab. Entzieht euch der Liebe nicht, das heißt: ergreift das Glück und verleugnet dagegen ebensowenig den Schmerz! In diesen Dingen geschieht das Aufblitzen der großen Mächte des Lichts und der Finsternis. Da kommt es vor, daß ein schnelles Leuchten dem Auge nachtbedeckte Paradiese enthüllt und jäher Schmerz die brennenden Höllen der Unterwelt. Ein anderes Dasein ist kein Leben!
Berlin, am 19. Dezember 1894.
Ich habe heute einen Brief von daheim. Jedes Wort darin hat Marter aus der Seele gepreßt, jedes ist aus einer unerhörten Bestürzung geboren. Es sind wenige, gleichsam weinende Zeilen einer verlassenen Frau. Ich sehe den Brief, der neben mir liegt, immer wieder an und greife mir nach dem Kopf, als müsse ich mich aus dem Schlafe erwecken.
Wie das doch nur alles gekommen ist!?
Melitta und ich waren gemeinsam hier in Berlin. Eines Tages ergriff sie die Flucht, da ihr der Trubel unerträglich geworden war. Sie reiste heim und ließ mich zurück. Wenn sie das nicht getan hätte, würden wir vielleicht dem Verhängnis entgangen sein.
Denn nun stand sie nicht mehr zwischen Anja und mir. Wir konnten uns sehen, sooft wir wollten, in Konzerten nebeneinandersitzen und in einer Kette von gefährlichen Gelegenheiten unsere Neigung anfachen, bis es schließlich zur entscheidenden Aussprache kam. Als wir eines Abends bei milder Luft das Kronprinzenufer hinuntergingen, erhielten unsere Worte einen verwickelten Sinn, der uns beiden schließlich den Irrtum völlig benahm, wir seien einander gleichgültig.
Melittas Brief verlangt von mir eine Probezeit.
Geh nach der Schweiz, schreibt sie mir. Du brauchst nicht zu mir zu kommen, aber ich muß wissen, daß Du auch nicht bei Anja bist. Nach sechs oder acht Wochen entscheide Dich. Kehrst Du zurück, so wird alles vergeben und vergessen sein. Gehst Du zu Anja, habe ich mich damit abzufinden. – Wenn ich Dir je im Leben etwas gewesen bin, wirst Du mir diese Bitte nicht abschlagen.
Nein, gewiß nicht, das werde ich nicht. Ich werde sogar schon morgen nach Zürich abreisen. Anja freilich weiß es noch nicht.
Ich promenierte heute mit ihr unter den Säulen der Nationalgalerie, nachdem wir vorher Bilder betrachtet hatten. Erfüllt von den Eindrücken großer Kunst, empfanden wir eine beinahe unwiderstehliche Sehnsucht nach dem Lande ihrer herrlichsten Emanationen. In jeder Fiber zuckte uns unbändige Reiselust: »Kennst du das Land ...? Dahin, dahin möcht' ich mit dir ...«, und so fort und so fort.
Nun habe ich Anja mitzuteilen, daß ich ohne sie eine Reise antreten werde, daß ich mich von ihr trennen muß.
Es scheint mir ein Ding der Unmöglichkeit. Hierzubleiben jedoch ist ebensowohl ein Ding der Unmöglichkeit, oder ich habe etwas unwiderruflich Schweres im Zustand Melittas zu gewärtigen.
Ich bin in Netze verwickelt, die unzerreißlich sind. Ich bin in eiserne Netze verwickelt. Ich kann nichts tun, wenn es mich morgen in eine öde und leere Ferne reißen wird. Es wird mich von der Geliebten losreißen, was, in einem gewissen Sinne genommen, tödlich für mich ist. Es ist der Tod, den ich auf mich zu nehmen habe in dieser Probezeit. Die Stunden werden wie Grabsteine sein. Ich bin nicht frei, ich werde hart eingeschnürt. Ich bin ein Gefangener.
Und welches Los, daß ich Anja nun auch Schmerz bereiten, ihr wehtun muß!
Und wird sie verstehen, daß ich es muß?
Ja, ja, sie wird es verstehen!
In diesem Augenblick hat Melitta bereits mein Telegramm, das ihr meine Abreise meldet: nun brauche ich wenigstens nicht mehr zu erschrecken, wenn der Depeschenbote kommt.
Morgen also beginnt mein Leidensweg, dessen Ende ich nicht absehe. Das flüchtig blickende Auge, gute Melitta, mag dich in dieser Sache übermäßig und unbarmherzig belastet sehen. Es wird mir genügen müssen, meine sicherlich ebenso große Last stumm zu schleppen.
Zürich, am 24. Dezember 1894, abends 10½ Uhr.
Halte fest diese Stunde, halte fest! Morgen ist sie Vergangenheit. Ein ängstliches Flattern ist in mir, Ausgestoßenheit, eine neue, große Einsamkeit.
Ich bin allein gewesen den ganzen Weihnachtstag. Worte, nur die allernotwendigsten, sind über meine Lippen gekommen im Verkehr mit dem Hotelportier und den Kellnern, die in Restaurants und Cafés mich bedient haben. Draußen ist Schlackerwetter. Es fällt Regen mit Schnee untermischt, man friert in der Nässe, Kälte und grauen Finsternis, so sehr man auch den Mantel um sich zusammenzieht.
Ich bin vormittags durch die Straßen geschlendert, ich bin nachmittags durch die Straßen geschlendert, immer einsam und ruhelos. Der See ist grau, seine Ufer von Nebeln verschlungen. Schon gegen vier sah ich hinter den Fenstern die ersten Christbäume aufleuchten.
Ich schreibe in einem engen, überheizten Hotelzimmer. Drei Wochen früher in meinem Leben und heut – welcher Unterschied! Bedrückt mich der Alp einer Morgenstunde, und werde ich etwa in einigen Augenblicken erwachen, vom Jubel meiner Kinder geweckt? Durchaus nicht, nein, ich bin wirklich wach, in jenem Zustand jedenfalls, den man nach Übereinkunft Wachen nennt.
Als das unwiderrufliche Wort in Berlin zu Anja gesprochen worden war, konnte ich da wohl den heutigen Abend mit seinem schrecklichen Ernst voraussehen? Ahnte ich, was dieser Schritt für Aufgaben, für Entsagungen – und wie bald! – nach sich ziehen würde? Verbannung, Heimat-, ja Obdachlosigkeit. Und als ich mit schmerzenden Beinen immer noch durch den Schlick der Straßen schritt, steigerte sich, je leerer sie von Menschen wurden, in mir das Gefühl von Verlassenheit.
Überall leuchteten nun die Christbäume, huschten hinter den Scheiben die Schatten derer, die sich aus der naßkalten Nacht in ihr Licht und ihre Wärme geflüchtet hatten. Und ich mußte der traurigen Stunde gedenken, die eine Mutter in den fernen schlesischen Bergen unter dem qualvollen Glanz dieser Weihnacht zu bestehen hatte.
Die Zähne knirschten mir aufeinander. Aber ich freute mich, daß ich litt. Es klingt paradox, dennoch ist es wahr: durch den fast unerträglichen Grad meines Leidens wurde mein Leiden gelindert.
Ich wollte das Leiden, ich sah eine Legitimation meines Tuns darin.
Leichten Kaufes werde ich aus diesem Handel ganz gewiß nicht herauskommen. Schon die unmittelbaren ersten Folgen beweisen das. Was daran Gewinn ist, muß sich gegen einen Verlust behaupten, der unübersehbar ist. Es gibt keinen Freund und keinen Verwandten, weder Vater, Mutter noch Bruder, der mich verstehen wird. Sie werden mich aufgeben, weil sie mich für verrückt halten. Um Gewonnenes wahrhaft zu genießen, bedarf es einer glücklich durchgeführten schweren Amputation, einer Art Selbstverstümmelung. Verblendung, zu hoffen, ich könne lebend davonkommen! Tritt das beinahe Unmögliche dennoch ein, was muß die arme kleine Anja zu geben haben, wenn sie mir den Verlust ersetzen soll!
Wie unwahrscheinlich, wie seltsam dies alles ist! Warum habe ich mich eigentlich aus der Gemeinschaft der Menschen ausgeschlossen, statt in Grünthal zu sein?! Vor mir steht das verschneite Haus, stehen verwaiste Kinder, deren Weihnachtsfreude ihrer verlassenen Mutter das Herz brechen muß.
Und doch, und doch: es gibt kein Zurück! Jetzt die Farce in Grünthal mitzumachen würde mir unerträglich sein.
Diese besondere Mischung von Leiden und Liebe, in die ich geworfen bin, erzeugt in mir eine vielleicht gefährliche, aber doch köstliche Illumination. Sollte man glauben, daß ich mit einem Gefühl von Gehobenheit weniger durch die Menschen als über die Menschen hinschreite!? »Lasciate ogni speranza« ging mir durch den Sinn. Waren sie doch von dem Wunder der Wunde, die ich in mir trug, ausgeschlossen. Dieses bürgerliche Dahinleben sah ich als etwas Totes, Apparathaftes an. Ich allein stand in der Wiedergeburt. Mich hatte die harte, aber schöpferische Hand des Gottes berührt. Mein Wesen erklang davon in den Grundfesten. Wenn ich den dicken Rauch eines Cafés durchschritt, war mir, als müßten die Leute aufstehen, als müßten alle Wichtigtuer und Schwätzer ihren Beruf für erbärmlich erklären und ihm abschwören, angesichts der Perle des Erwählten und Erleuchteten, die ich auf der Stirne trug.
Soll ich erschrecken über meine so gesteigerten Zustände? Sind sie nicht eine große, neue, vielleicht die schwerste Gefahr? Und falls es mir nicht gelingt, sie einzudämmen, könnten sie nicht die Meinen oder Anjas Vormund auf den Gedanken bringen, mich mit Hilfe eines Psychiaters zu entmündigen? Diese Sorge ist eine der unzähligen, die meine Nächte schlaflos machen. Beruht sie jedoch auf Verfolgungswahn, so ist dadurch wiederum meine geistige Gesundheit in Frage gestellt.
Nein! Dies sind alles nur lästige Fliegen, die ich hinausjage. Ängste und Einbildungen dieser Art nenne ich jämmerlich und des großen Erlebens, das ich zu bewältigen habe, unwürdig. Ich stehe vielmehr in der Weihe einer tiefen Leidenschaft, der ich mich wert zu machen habe. Das ist ein irrationales Phänomen. Es hat immer die Menschen wie Zauberei, Verhexung oder Krankheit berührt, wo es aufgetreten ist. Junge Anjas sind auf Betreiben bestürzter und empörter Verwandter mit Hilfe törichter Pfaffen und Richter in Menge als Hexen verbrannt worden. Der Glaube an den Liebestrank mußte durch Jahrtausende herhalten, weil man die natürliche Macht einer großen Leidenschaft nicht begriff.
Sie hat mich gepackt. Sie verfährt ohne Rücksicht gegen irgend etwas in mir. Ich bin ihr Gefäß, bin ihr Haus, sie erfüllt mich und waltet in mir, wie der Gott Israels in der Stiftshütte. Ich kann nur staunen und über sie nachgrübeln. Fast kommt es mir unverhältnismäßig vor, in Anja, der kleinen Anja, die Ursache von dem allem zu sehen. Aber schließlich vermag ja ein Kind, dem ein Schwefelholz in die Finger fällt, eine Scheune in Brand zu stecken und Dörfer in Asche zu legen. Anja kann die Ursache, kann aber vielleicht auch nur der Anstoß sein.
Gute Nacht, Melitta! gute Nacht, meine Kinder! Gute Nacht auch, Anja, am Weihnachtsabend des Jahres achtzehnhundertvierundneunzig, der, solange ich Leben habe, nicht aus meinem Gedächtnis schwinden kann.
Zürich, am 25. Dezember 1894.
Ich habe heut in der Familie eines Freundes zu Mittag gespeist, der seit seiner Studentenzeit in Zürich lebt. Er ist Arzt und Dozent an der hiesigen Hochschule. Er hat es seit jeher vereinigen können, zugleich ein Frauenrechtler und Frauenverächter zu sein. Vor einigen Jahren hat er geheiratet, und zwar unternahm er den kühnen Schritt ziemlich unvermittelt zu einer Zeit, wo sein Hagestolzentum sich fast überschlug. Jetzt ist er der folgsamste Ehemann und nach wie vor ein rastloser Arbeiter.
Da es mir wohltut, meine einigermaßen kritische Lage einmal vor anderen auszubreiten und durchzusprechen, wie ich denn leider zu denen gehöre, denen ein volles Herz zu tragen, ohne daß der Mund davon überläuft, Mühe macht, habe ich ihn ins Vertrauen gezogen, und auf einsamen Gängen zu zweien am Seeufer oder die Hügel hinauf tauschen wir Rede und Gegenrede. Er hütet sich wohl, zu moralisieren oder mein Tun als verwerflich zu brandmarken. Die Überfülle von Gründen dafür, mit denen ich ihn überschwemme, bewirkt wohl auch, daß er nicht zu Atem kommt.
Er kennt meine Frau. Das Verhältnis, in dem wir zueinander gestanden haben, hat sich ihm als das glücklichste eingeprägt. Er unterdrückt, wie mir vorkommt, ein Kopfschütteln, wenn ich es ihm in anderem Lichte darstelle.
Wir nehmen die Diskussionen unserer Züricher Jugendzeit wieder auf, an denen sich damals noch mein Bruder Julius leidenschaftlich beteiligte. Mich erlöst eine solche Unterhaltung einigermaßen durch ihre unpersönliche Oberflächlichkeit. Die Frage der Polygamie wird durchgesprochen. Ich finde die Einehe unzulänglich, und zwar von jedem Gesichtspunkt aus, dem materiellen sowohl als dem ethischen. Mündige Menschen mit dem Recht auf Persönlichkeit müssen die Freiheit haben, sage ich, zu zweien, zu dreien, zu vieren zusammenzutreten. In dem Bestreben, unerbittlich Geschiedenes zu vereinen, stelle ich Eheformen auf, die dem Wesen höhergearteter Menschen entsprechen sollen. Warum sollte Anja nicht in den Kreis meines Heimwesens als dritte eintreten können, frage ich. Würde nicht Anjas Lachen, Anjas Musik – sie ist Geigerin – das Haus mit neuem, frischem Leben erfüllt haben?! Ihr verständiger, heiterer, oftmals übermütiger Geist würde vielleicht sogar die Wolken des eigentümlichen Tiefsinns zerstreut haben, der Melitta auch in guten Zeiten zuweilen umfängt.
Er habe mit solchen Luftschlössern, sagt mein Freund, ein für allemal aufgeräumt. Mensch sei Mensch, und Weib sei Weib. Mit Engeln – mein Freund ist Atheist – sei weder hier noch im Jenseits zu rechnen.
Ich brause auf, da Anja in meinen Augen weit mehr als ein Engel ist. Ich fange an, sie begeistert zu schildern, ihre Schönheit, Anmut und Festigkeit. Ich schwöre, sie würde mir überallhin nachfolgen. Es bedarf nur des Rufes, sage ich, und sie tritt auf Gedeih und Verderb an meine Seite, würde selbst durch Not und Schmach von mir nicht loszureißen sein.
Ein überlegenes Lächeln des Freundes reizt mich auf das heftigste.
»Du glaubst mir nicht?«
»Nein, ich glaube dir nicht!« – Und er macht den Versuch, das Bild der Geliebten zu zerpflücken. Er tut das derb und rücksichtslos. Und nun ist das überlegene Lächeln auf meiner Seite. – »Ich wette, daß sie nicht kommt, wenn du rufst. Und wenn sie selbst käme, würde das höchstens ein Zeichen kindlicher Dummheit, sträflichen Leichtsinns oder gar von Verderbnis sein.«
Das war eine starke Lektion, die mir freilich gar keinen Eindruck machte.
»Entkleidet man die Welt, wie du«, sagte ich, »jeden Glaubens an eine höhere Menschlichkeit, so mag man ihr gleicherzeit Lebewohl sagen.«
»Julius und du, und du und Julius«, sagte er, »ihr wart leider immer von einer unbegreiflichen Gutgläubigkeit. Illusionisten wie ihr beide gibt es auf dieser Erde nicht mehr. Man könnte euch ausstellen und Entree nehmen!« – So war seine Art, er bewahrte noch die alte, derbe, studentische Offenheit.
Es war wohl zu merken, worauf er hinauswollte. So mußte er sprechen, wenn er jemand, was er verschwieg, seiner Meinung nach vor dem Sturz in den Abgrund retten wollte.
Diese Bemühungen danke ich ihm. Andererseits aber sehe ich, daß er mir ein Fremder geworden ist. Darum besteht zwar die alte Neigung zwischen uns, aber nicht mehr das alte Verstehen. Irgendeinen Zugang zu dem wahren Ereignis meines augenblicklichen Lebens hat er nicht.
Zürich, am 27. Dezember 1894.
Und solang du das nicht hast, dieses: Stirb und werde! bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde.
Ich habe eben einen Freund in Enge, dem so geheißenen Stadtteil, besucht, dessen Anwesenheit ich erst am heutigen Morgen erfahren hatte. Ich war überrascht, ihn hier zu finden, denn er lebte bisher mit seiner Frau in einem Landhaus bei Berlin am Müggelsee. Ich konnte mir denken und fragte ihn deshalb nicht, warum er diese Gegend verlassen hat, um hier allein mit seinen Naturalien, ausgestopften Paradiesvögeln, Gürteltieren und Schmetterlingskästen, zu leben, darin Exoten in allen Farben schillern.
Also sind die Gerüchte wahr, die besagen, er habe seine Frau an einen seiner nächsten Freunde abtreten müssen. Auch er, dessen Gemütsverfassung, wie mir vorkam, eine heiter gelassene war, konnte sich nicht entschließen, auf diese Sache zurückzukommen, die ihn aus Deutschland vertrieben hatte. Aber die Themen, denen sich unsere Gespräche zuwandten, bewegten sich doch um das Trauma unserer Seelen herum.
Seltsam, er ist in der Lage Melittas und nicht in der meinen. Es wäre begreiflich, wenn er bei mir Halt und Hoffnung gesucht hätte, statt dessen suchte ich beides bei ihm: der Missetäter, der Sünder bei ihm, an dem man gesündigt, den man mißhandelt hatte. Er, der weise, menschenfreundliche, naturnahe Mann, hat mich mit Halt und Hoffnung ausgestattet.
Man empfand es bald, daß er Handlungen wie die seiner Frau und die meine, Geschicke wie das seine und Melittas als naturgegebene, sich immer wiederholende Erscheinungen sah, die man einfach hinnehmen müsse. Das ganze Zeughaus moralischer Waffen, zum Strafvollzuge bereit, von drohenden Paragraphen geschriebener und ungeschriebener Gesetzesvorschriften strotzend, die jederzeit tödlich gehandhabt werden konnten, war für meinen Freund nicht in der Welt. Er wäre nicht hier, wenn ihm die Abtrünnigkeit seiner Frau keinen Schmerz bereitet hätte. Man hat ihn, wie erzählt wurde, als ihm die nackte Wahrheit in Form einer groben Untreue zum Bewußtsein kam, kaum vor einem gewaltsamen Ende durch eigene Hand zu bewahren vermocht. Er unterlag beinah seinem Schmerz. Es war sein Schmerz, den er wie einen Bergsturz, ein Eisenbahnunglück, einen Schiffbruch, eine Verwundung durch Feuersbrunst oder dergleichen zu bewältigen hatte. Er starb daran oder kam davon. Niemandem aber, ich bin überzeugt, und also auch nicht seiner Frau, machte er, weder in Gedanken noch in Worten, Vorwürfe.
Das war es, weshalb einem in seiner Nähe wohl wurde. Wir tauschten anfangs allgemeine Gedanken aus, durch die, wie in manchen früheren Fällen, die Verwandtschaft unserer Denk- und Gefühlsweise klarwurde. Dann legte ich eine umfassende Beichte ab, die ihn in meine Lage einweihte. Er hatte ein schmunzelndes Lächeln wiedergewonnen, das ihm früher eigen war. Sein Auge hat dann gleichsam etwas ewig Lächelndes. Es spricht von gütig stillem, belustigtem Verstehen menschlicher Zustände und von verzeihender Ironie, bis es plötzlich der Ernst überkommt. In solchem Ernst ist es wahrhaft teilnehmend, wenngleich es dann vor sich nieder oder in die Ferne, nicht aber auf den gerichtet ist, dem die Teilnahme gilt. Vor diesem Ernste also habe ich mein ganzes Erlebnis ausgeschüttet.
Mir wäre zumut, als sei ich vorher nie mit Bewußtsein jung gewesen, sagte ich. Wie mich diese neue, so überraschende Lebensphase habe überkommen können, wisse ich nicht. Das Hinwegräumen einer letzten Fremdheit zwischen Anja und mir habe sie eingeleitet. Ein neuer Lebensraum habe sich aufgeschlossen, aus dem ich zwar in den alten zurückblicken, aber nicht zurücktreten könnte. Meinethalben gliche das einer Verzauberung, und ich könne von mir aus die Ratlosigkeit von Außenstehenden wohl begreifen, die sich im Mittelalter durch den Gedanken an Hexerei halfen und in meinem Falle Anja als Hexe verbrannt hätten. Ich könne auch den Gedanken an die Giftmischerei der sogenannten Liebestränke verstehen, erklärte ich.
Das Lächeln meines Freundes belebte sich. Er ließ sich eine Weile herzlich belustigt, wie mir schien, über Hexenwesen und Liebestränke des Mittelalters aus, Gebiete, auf denen er Bescheid wußte. Später kamen wir dann überein, daß man über das Wesen der Liebe im allgemeinen noch wenig wisse. In der Menge habe man davon eine rohe, im Bürgertum eine enge, in der Welt wissenschaftlicher Psychologie eine platte Vorstellung. Das Phänomen in seiner wahren und höchsten Entfaltung aber sei eine Seltenheit. Die großen Liebesgedichte der Weltgeschichte könne man an den Fingern herzählen. Aber – und nun kamen wir auf die vier Verse, die ich an die Spitze dieses Tagebuchblattes gesetzt habe:
Und solang du das nicht hast, dieses: Stirb und werde! bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde.
Mein lächelnd wissender Freund zitierte sie.
Seitdem bin ich damit beschenkt. Sie sind die Bestätigung dessen, was mir als Erlebnis beschieden ist. Sie gehen mir immer durch den Sinn und werden mir fortan immer durch den Sinn gehen, mir, in dessen Dasein nun zum ersten Male dieses »Stirb und werde!« getreten ist. Kein Zweifel, ich fühlte mich, eh dies neue Sterben und Werden über mich gekommen war, als ein trüber Gast auf der dunklen Erde: nein, ich fühlte mich kaum als das, aber ich war es, wie ich nun im Rückblick erkenne.
Freilich, ein solcher Umsturz, ein solches Sterben und ein solches Neu-Werden ist nicht nur eine große und heilige, sondern auch eine gefahrvolle Aufgabe. Sie auf sich zu nehmen erfordert eine harte Entschlossenheit. Dennoch darf man sie nicht abweisen. »Merke auf den Sabbat deines Herzens, daß du ihn feierst«, sagt Schleiermacher, »und wenn sie dich halten, so mache dich frei oder gehe zugrunde!«
Das Sterben kann schnell oder langsam vor sich gehen. Langsames Sterben bedeutet einen langen, qualvollen Todeskampf. Wenn nicht irgendein Wunder geschieht, ist das, was in mir zum Tode verurteilt ist, in einem kurzen Kampfe nicht abzutun. Da ist Melitta, da sind die Kinder, mit tausend Fasern verwurzelt in mir, verwurzelt in meiner ganzen Familie. Denn die vater- und mutterlose Melitta hat mit einer rührend kindlichen Hingabe sich an meinen Vater und meine Mutter, als wären es ihre leiblichen Eltern, angeschlossen. Eine solche alles durchsetzende, tausendfältige Verschlungenheit und Verbundenheit spottet jeder Operation: wenn man sie trotzdem versucht, wie ich, so heißt das soviel, als die eigenen Lebensfundamente angreifen, an ihnen rütteln, auf die Gefahr hin, daß der ganze Bau über einem zusammenstürzt.
Alles dieses kam zwischen mir und meinem Freunde zur Erörterung. Der mögliche schlimme, der mögliche gute Ausgang meiner Sache wurde erwogen, wobei ich natürlich nur diesen im Auge hatte. In dem Bestreben, ihn als gesichert erscheinen zu lassen, ging ich schließlich dazu über, auf sophistische Weise für den Fall der Scheidung einen Vorteil für die Meinen herauszurechnen. Ich sei für die Erziehung von Kindern nicht geeignet, sagte ich. Meine Heftigkeit würde wahrscheinlich auf die Dauer eine Entfremdung zwischen mir und meinen Kindern hervorbringen. Mein Einfluß würde schädlich für sie sein. Sähe ich sie aber nur gelegentlich, so würde das eine Bewachung ohne Reibung ermöglichen, und unser Verhältnis könne sich bei einiger Umsicht und Vorsicht zu einer wahren und dauernden Freundschaft entwickeln. Auch die Beziehung zu Melitta könne recht wohl in eine solche Freundschaft übergehen. Der Versuch dagegen, ein Leben in enger Gemeinschaft aufrechtzuerhalten, müsse nervenzerrüttend und binnen kurzem zerstörend für uns beide sein.
Lächelnd gab mein Freund mir recht und folgte mir bis zuletzt in die Höhen meiner Verstiegenheit. Anja war jung, sie wußte nichts von der Welt. Was für Gebiete des Geistes, was für reiche Lebensgenüsse, was für Schönheiten in Kunst und Natur konnte man ihr aufschließen und dadurch doppelt und dreifach sich selbst, denn es ist ja, wie ich weiß, in dem, wozu es uns drängt, was wir suchen und lieben, wonach wir hungern und dürsten und was wir begehren, keine Verschiedenheit. Sie ist arm, oder sagen wir mittellos. Zwar bin ich nicht reich, aber bemittelt genug, um ihr die Wunder Europas, die Wunder der Erde aufzuschließen. Nein, nein, es gibt kein Zurück.
Mein lieber philosophischer Freund, ich danke dir! Danke dir auch für dein Geleitwort, das mich fortan auf meiner gefährlichen Straße nicht mehr verlassen wird:
Und solang du das nicht hast, dieses: Stirb und werde! bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde.
Berlin, am 30. Dezember 1894, nachts.
Ich bin wieder hier. Ein Vorfall, zugleich schrecklich und lächerlich, hat mich nach Berlin zurückgeführt. Am 27. abends war ich mit einem beinahe entscheidenden Abschiedsbrief an meine Frau drei- oder viermal an den Bahnhofsbriefkasten in Zürich getreten und hatte ihn endlich mit Entschluß, unter gewaltigem Herzklopfen, in seiner Öffnung verschwinden lassen. Es war darin gesagt, wie ich mich zunächst außerstande fühle, von Anja zu lassen und zurückzukehren. Unmittelbar darauf wurde mir im Hotel ein Brief Anjas überreicht, für den ich Strafporto zahlen mußte. Ich öffnete ihn, ich las und las, und die Wirkung war eine verheerende.
Sie, die Geliebte, teilte Erwägungen ihres jungen Vormunds mit, die sie sich, wie mir vorkam, zu eigen machte. Der Vormund, in berechtigter Sorge um sie, hatte gefragt, was aus unserer Verbindung werden solle. Es gäbe nur zwei Möglichkeiten ihrer Entwicklung, Konkubinat oder Ehe nämlich, von denen nur die zweite gangbar sei. Anja wäre nicht majorenn, und er, der Vormund, dürfe Dinge nicht zulassen, die ihren Ruf vernichten könnten. Übrigens müsse Duldung von seiner Seite auch den seinen aufs schwerste schädigen.
Ich sah in diesem Brief eine Absage. Wenn er jedoch keine Absage war und Anja durch ihn die Heirat erzwingen wollte, so war die Wirkung nicht minder fürchterlich. Damit hätte mein zynischer Freund, der an die volle und reine Hingabe eines Weibes nicht glauben wollte und hinter allem, was danach aussah, Berechnung witterte, einen Triumph zu verzeichnen gehabt. So war denn, wie mir schien, auf eine am allerwenigsten vorauszusehende Art die Katastrophe vorzeitig eingetreten.
Das Bild der Geliebten war gestürzt. Heut, wenn ich den Züricher Brief in Ruhe durchlese, sehe ich, Gott sei Dank, als Grund dafür nur noch krankhafte Kopflosigkeit. Die Erwägungen über Ehe und Konkubinat trafen mich in einem wehrlosen Augenblick. Übrigens waren wir ja nur erst etwas wie korrekte Brautleute. Eben hatte ich lange und schwer gekämpft und mir den beinahe grausamen Brief an Melitta abgerungen. Mit einem ehrlichen Willensakt, der mir fast einen physischen Schwindel erregte, hatte ich mich, indem ich ihn dem Postkasten übergab, davon losgemacht. Ich wußte, was für ein Opfer es war, das ich meiner neuen Liebe gebracht hatte, welche ernste, verhängnisvolle, ja, welche an Wahnsinn grenzende Handlung damit unter voller Verantwortung geschehen war. Da kamen diese Blätter, die, wie es sich mir nun einmal darstellte, von einem vulgären Mißtrauen imprägniert waren und durch Banalität der Gesinnung beleidigten. Sie rissen eine unüberbrückbare Ferne zwischen mir und Anja auf, ließen mich aber trotzdem erkennen, daß ich auf diese Weise zwar ernüchtert, nicht aber geheilt, sondern höchstens tiefer verwundet war.
Ich habe das Vorstehende wieder und wieder durchgelesen. Was ist geschehen, seit mir im Hotel der verhängnisvolle Brief überreicht wurde? Ich habe die ganze furchtbar verblendende Macht und Gefahr der Liebe kennengelernt. Das Bild der Geliebten war gestürzt, aber ich mußte es ja wieder aufrichten, falls ich mich wieder aufrichten wollte nach einem lebensgefährlichen Schlag.
Kaum fünfzehn Minuten, nachdem ich den Brief erbrochen hatte, saß ich im ersten besten Bummelzug, der nach Deutschland führte. Wenn zwei oder drei Stunden später ein Schnellzug abgegangen wäre, der mich einen halben Tag früher nach Berlin gebracht hätte: auf ihn zu warten würde ich nicht fähig gewesen sein.
Die qualvolle Spannung meiner Brust wurde erträglicher, als mein Zug ins Rollen kam. Es war ein gewöhnlicher Zug, wie gesagt, er hielt überall. Aber gerade darum hatte ich ein Coupé für mich allein.
Es sah einen Menschen, der nicht bei Sinnen war. Er unterhielt sich durchaus mit weiter nichts, als Fragen an das Schicksal zu stellen.
Er zählte auf Ja und Nein die Knöpfe seiner Weste ab. Er zählte die Plüschknöpfe auf den Sitzen. Er nahm Geldstücke aufs Geratewohl in die Hand und zählte sie ab. Er zählte eine Schachtel Streichhölzer ab. Er zählte ab und zählte ab und hörte nicht auf, sich an diesen Stumpfsinn wie an die letzte Planke eines Schiffbruchs anzuklammern. Die hauptsächlichste Frage aber war: Wird Anja auf dem Bahnhof sein?
Er fuhr die Nacht, er fuhr den Tag, ohne ein Auge zuzutun und in oftmals hörbarem Selbstgespräch. Sein Zustand während der zweiten Nachtfahrt verschlimmerte sich, und dann wieder, je mehr der Morgen und somit das Ziel sich annäherten.
Nun, ich begriff sehr wohl, daß die Krise, in der ich stand, keine gewöhnliche war. Mein kleiner Revolver, den mir vor Jahren seltsamerweise Melitta geschenkt hatte, war geladen. Ich wußte, sollte Anja mich nicht auf dem Lehrter Bahnhof erwarten – ich hatte ihr die Zeit meiner Ankunft telegraphisch mitgeteilt –, so war das eine deutliche Absage, und dann hätte ich den Lauf meiner Waffe nicht von meiner Schläfe, den Finger nicht von ihrem Drücker zurückzuhalten vermocht. Nie hatte die Stunde so unzweideutig mit mir gesprochen.
Nun, Anja erwartete mich.
Anja bringt den ganzen Tag und Abend bis in die Nacht hinein mit mir zu. Alle meine Befürchtungen sind von ihrem ersten Händedruck und Kuß in alle Winde geweht worden. Kein Wort von Ehe, kein Wort von Heiraten, kein Wort von einer Bedingung irgendwelcher Art. Sie gehört mir wieder bedingungslos als mein Eigentum, alles andre ist Diktat ihres Vormunds gewesen.
Berlin, am 5. Januar 1895.
Ich bin also wieder in Berlin, und meine Frau, an die ich fast jeden Tag schreibe, von der ich fast jeden Tag einen Brief erhalte, weiß, daß ich wieder mit Anja vereinigt bin. Wieviel Wochen, Monate, Jahre wird nun jeder Tag die zwei überaus schweren, finsteren Stunden haben: die eine, in der ich den neuen Brief der Verlassenen empfange, und die, in der ich ihn beantworte.
Aber es steigen große, kühne Pläne in mir auf. Warum soll es denn nicht wirklich möglich sein, statt zu trennen, zu vereinen? Oh, ich ahne, wie schwer dergleichen Versuche sind und wieviel moralischen Mut sie erfordern. Aber ich habe moralischen Mut. Warum soll ich nicht an die alles versöhnende, alles einende Kraft der Liebe glauben? »Das nußbraune Mädchen« von Herder fällt mir ein, jenes Volkslied »vom Mädchen braun, die fest und traun! liebt, wie man lieben kann«. Der Geliebte setzt sie den schwersten Prüfungen aus. Er spricht ihr schließlich von seiner »Buhle«. Ohne Bedenken ist sie bereit, sowohl ihm als seiner Buhle zu dienen. Ohne Zweifel war so etwas einmal Wirklichkeit. Ich hörte, als wir jung verlobt waren, gemeinsam mit Melitta in Hamburg eine Geigerin. Das hübsche Kind hatte mich bezaubert. »Was würdest du tun«, fragte ich meine Braut, »wenn ich ohne dieses Mädchen nicht mehr sein könnte?« – »Ich würde sie um deinetwillen ebenso lieben wie du«, sagte sie. – War das nicht gesprochen wie »vom Mädchen braun, die fest und traun! liebt, wie man lieben kann«?
Ich habe nie in meinem Leben tiefer als damals und mit größerem Staunen, mit größerer Ergriffenheit in das Wunder der Liebe hineingeschaut.
War es also nicht möglich, eine Ehe zu dreien aufzubauen?
Die jüdisch-christlichen Erzväter hatten viele Frauen. Streng gesinnte Prediger im Zeitalter der Reformation vermochten in der Heiligen Schrift keinen Ausspruch zu finden, durch welchen die Ehegatten auf einen Mann und eine Frau beschränkt wurden.
Die Moslemin leben noch heut in Polygamie. Ich denke daran, ein Moslem zu werden. Es wäre ja nicht zum erstenmal, daß ein Mann in meinem Falle diesen Ausweg beschritten hat.
Auch Goethe hat sich mit dem Problem des Grafen von Gleichen beschäftigen müssen. Dieser kam aus dem Orient. Als er auf seine deutsche Stammburg zurückkehrte, brachte er seine orientalische Geliebte mit, der er Freiheit, Leben und Heimkehr zu verdanken hatte.
Was hätte mit dieser Frau, nach den Moral Vorschriften der Kirche in Ehedingen, geschehen müssen? Die Auskunft des Scheiterhaufens war wohl die nächstliegende.
Nein! das Leben ist nie mit dem starren Schema, und zwar in keinem seiner unzähligen Zweige, ausgekommen.
Charlottenburg, am 7. Januar 1895.
Sind wir am Ende doch Geächtete? Unsere Wirtin bedient Anja und mich mit Freundlichkeit. Sie ist eine hübsche, sympathische Frau, die zurückgezogen in einem Raume der kleinen Wohnung lebt. Ihr Mann mag Oberkellner, Portier oder etwas dergleichen sein. Die Frau besorgt mir das Frühstück, besorgt uns gelegentlich das Abendbrot. Man merkt ihr an, daß sie für unsere Lage Verständnis hat und sie nach Kräften berücksichtigt.
Anja und ich sind viel unterwegs. Ich leide dabei unter einer Art Verfolgungswahn. Die Furcht, Bekannten zu begegnen oder auch nur gesehen zu werden, treibt uns in die dunklen Hinterzimmer entlegener Konditoreien und in kleine, versteckte Weinstuben. Manchmal sitzen wir in solchen Lokalen viele Stunden lang, ganz unserer Liebe, unseren Plänen, unseren Sorgen hingegeben, und hüten uns wohl, den außer uns einzig Gegenwärtigen, nämlich den Kellner, aufzuwecken, wenn er entschlummert ist.
Leidenschaftlich Liebende sind meist ruhelos. Eigentlich wären wir ja in meinem möblierten Zimmer am ungestörtesten und am sichersten. Es tritt aber, wenn man eine Weile darin vereinigt ist, eine unerträgliche, maukige Schwüle ein. Um ihr zu entgehen, muß man durchaus und bei jedem Wetter ins Freie.
Es gibt noch anderes, dem man entgehen will. Jene endlosen, unfruchtbaren Erörterungen nämlich, welche die beste Lösung des schicksalsschweren Konfliktes zum Zwecke haben. Sie drehen sich bis zur letzten seelischen Ermattung endlos im Kreise herum, so daß man im Augenblick, wo man das Ziel erreicht zu haben glaubt, von vorne beginnen muß. Ein solcher Konflikt kann nur durch Zeit, Geduld und wieder Geduld gelöst werden.
Charlottenburg, am 8. Januar 1895.
Es ist Mitternacht. Ich habe soeben Anja nach Hause gebracht. Der heutige Tag war ein überaus köstlicher. Er führte uns schon am frühen Morgen nach Spandau hinaus, wo wir die Schlittschuhe anlegten, um bei klarem Sonnenschein eine Fahrt über die weite Fläche des Tegeler Sees anzutreten. Die Bahn war gut, wir sind sichere Läufer, und so durchlebten wir wieder Stunden einer befreiten Zeit.
»Sorgen können nicht Schlittschuh laufen«, sagte ich. Wir hatten in der Tat alle unsere Sorgen und Kümmernisse, hatten das Einstige und Künftige zurückgelassen und genossen ausschließlich die Gegenwart.