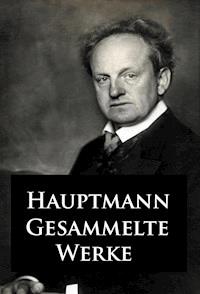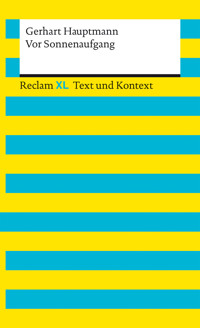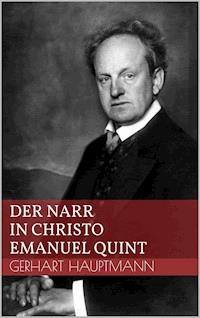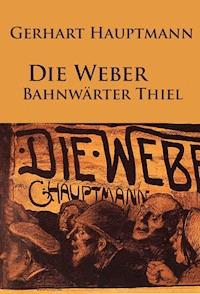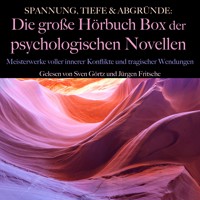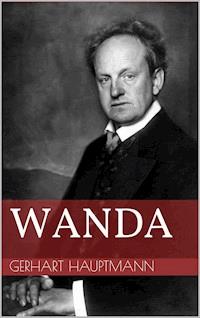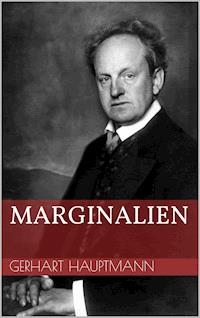
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gerhart Johann Robert Hauptmann (geboren 15. November 1862 in Ober Salzbrunn (Szczawno-Zdrój) in Schlesien; gestorben 6. Juni 1946 in Agnetendorf (Agnieszków) in Schlesien) war ein deutscher Dramatiker und Schriftsteller. Er gilt als der bedeutendste deutsche Vertreter des Naturalismus, hat aber auch andere Stilrichtungen in sein Schaffen integriert. 1912 erhielt er den Nobelpreis für Literatur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 97
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marginalien
»Lieder eines Sünders« von Hermann ConradiGedanken über das Bemalen der StatuenTagebuchblätterEiniges über KunstDas MediceergrabÜber ein VolksbuchHenry IrvingGeleitwort für die erste GesamtausgabeWeihnachtenTolstoiRichard WagnerStrindbergDas Problem des DramatischenDuldsamkeitHermann Stehr zum fünfzigsten GeburtstagDer Bogen des OdysseusDeutschland und Shakespeare I II III IV V HumorOskar SauerShakespeare-VisionenGottfried KellerGeleitwortArthur Nikisch zum GedächtnisGruß an Hermann Stehr zum sechzigsten GeburtstagGeleitwortDas heilige LeidKäthe Kollwitz zum sechzigsten GeburtstagAgnes SormaHamletImpressum»Lieder eines Sünders« von Hermann Conradi
Über eine Originalität ist nicht zu rechten: sie mag uns sympathisch oder antipathisch sein, gleichviel, sie muß hingenommen werden, wenn anders man sich nicht etwa mit dem Versuche trägt, die Lebensadern eines Dichters zu unterbinden. Die vorliegenden Lieder werden wohl schwerlich eine große Gemeinde finden, denn sie mitzufühlen, beziehungsweise zu verstehen, wird nur dem kleinen Teil solcher Menschen möglich sein, welche mit dem Dichter den heißen Drang nach Licht und Wahrheit teilen. Diese aber werden gewiß, zumal da der Inhalt der Sünder-Lieder eine fortlaufende Entwicklung darstellt, welche durch die Titel ihrer einzelnen Abschnitte genügend charakterisiert wird – Inferno, Im Strudel, Liebe und Staubverwandtes, Revolution, Emporstieg, Zwischenstille, Gipfelgesänge, Triumphgesang der Lebendigen –, Erhebung, Stärkung und Begeisterung zu neuem Ringen daraus schöpfen. Es kann nicht meine Absicht sein, auch nur annähernd eine Kritik vorliegenden Buches im Rahmen einer kurzen Besprechung geben zu wollen; deshalb muß ich mich begnügen, die triviale Tatsache festzustellen, daß auch hier, wie überall, sich Gutes und Schlechtes vereint vorfindet. Das Gute allerdings ist außergewöhnlich gut, das Schlechte außergewöhnlich schlecht. Letzteres aber hat seinen Ursprung nicht in der Unfähigkeit des Dichters, sondern vielmehr in einer gewissen Überkraft desselben, einer wüsten Zügellosigkeit seiner Phantasie, die sich mitunter in Roheiten verliert, deren oft nicht einmal witzige Brutalität eine künstlerische Wirkung nicht aufkommen läßt. In der Vorrede seines Buches nennt Conradi dasselbe ein gutes, markiges, saftgeschwollenes Stück Seelenlebens, und so wenig sympathisch mich dieses »saftgeschwollen« auch berührt, so ist es doch ein Beiwort, welches sich mit dem Inhalt des Buches deckt. Verhält es sich aber so, und spiegelt das Buch dabei eine weit über das Gewöhnliche hinausgehende leidenschaftdurchglühte Seele, so ist sein Verfasser ein wirklicher Dichter. Demnach fasse ich Hermann Conradi als einen Dichter auf, der mit diesen seinen Sünder-Liedern dem Sturm und Drang seinen Tribut bezahlt hat und dessen Weiterentwicklung man mit Interesse entgegensehen muß.
1887.
Gedanken über das Bemalen der Statuen
Die Ausstellung bemalter Statuen, welche vor zwei Jahren in Berlin stattfand, regte in mir damals die folgenden Gedanken über die Chromoplastik an. Ich glaube, daß dieselben von allgemeinerer Bedeutung sein dürften, und stelle sie deshalb heute noch zur Besprechung.
Meiner festen Überzeugung nach ist das Bemalen der Statuen dem Wesen der Kunst, insonderheit dem der Bildhauerkunst, zuwider. Diese Behauptung will ich in dem Folgenden beweisen.
Der Zweck aller Kunst ist nicht die absolute Nachahmung der Natur, weil diese letztere eine Unmöglichkeit ist. Wäre sie möglich, so fiele sie mit der Natur zusammen, und die Kunst wäre ausgeschaltet. Denn es leuchtet ein, daß, wenn wir einen Menschen mit all seinen Eigenschaften auf technischem Wege herstellen könnten, dieser kein Kunstwerk sein könnte, sondern eben ein Mensch. Dies wäre also nicht ein Triumph der Kunst, sondern der Kunstfertigkeit, der aber auch ihr natürlich versagt ist. Die Kunstfertigkeit ist nun freilich ein integrierender Bestandteil der Kunst. Da sie jedoch die Natur nie erreicht, so muß sie ewig eine Täuschung bleiben.
Zweck der Kunst ist vielmehr der Ausdruck der innersten, zum Typus erhobenen Wesenheit des dargestellten Gegenstandes.
So ist das Produkt der Kunstfertigkeit in einem Kunstwerk seine Naturähnlichkeit, das Produkt der Kunst, das Künstlerische dagegen das durch seine Naturähnlichkeit zum Ausdruck gebrachte innere, typische Leben. Das Produkt der Kunstfertigkeit ist also die Täuschung, das Produkt der Kunst die Wahrheit. Im Kunstfertigen wird die äußere Natur bedingt nachgeahmt, das Künstlerische zeigt sich in der treffenden Auswahl derjenigen äußeren Züge, welche das innere Wesen des dargestellten Gegenstandes zum Typus verallgemeinert offenbaren.
So sehen wir also zwei verschiedene Elemente sich zur Kunstwirkung vereinen. Jedes derselben kann für sich bestehen, ohne jedoch allein je zum künstlerischen Eindrucke sich zu erheben. Die innere Wahrheit eines Gegenstandes wird ohne Kunstfertigkeit nur stammelnd und unharmonisch zum Ausdruck gebracht, was eine Kunstwirkung ausschließt. Ich erinnere hierbei an die Dilettanten in allen Künsten: wie voll Wahrheit ist oft das kindliche Lallen eines dilettantischen Dichterlings! Die Kunstfertigkeit, beziehungsweise die bloße Nachahmung der äußeren Natur, die das innere Wesen mit tausend Zufälligkeiten beladen und daher unentwirrbar zur Darstellung bringt, wird Lüge, weil sie die Wirklichkeit doch nie erreicht. Man denke dabei an die Wachsfiguren, welche wir zuerst für Menschen halten, vor denen wir dann ihrer Starrheit wegen erschrecken und über die wir, wenn wir den Betrug merken, uns ärgern oder lachen.
Hier drängt sich nun die Frage auf: in welchem Verhältnis steht die Kunstfertigkeit zum Kunstwerk? Wir antworten kurz: im Verhältnis vom Mittel zum Zweck; die Kunstfertigkeit darf nie Wirklichkeit sein wollen und so die wahre Kunstabsicht verrücken, sie muß ausschließlich im Dienste der Kunstwirkung stehen, das heißt nur gerade so weit wirken, als sie das innere Leben existenzwahr zum Ausdruck bringt. Und hierin liegt das Geheimnis des Maßes in der Kunst.
Ich glaube, daß dies der Gesichtspunkt ist, der wohl unbewußt auch zur Trennung der beiden Schwesterkünste, Malerei und Bildhauerei, beigetragen hat. Die Malern bedarf, um die das innere Wesen eines Gegenstandes charakterisierenden Züge zur überzeugenden Darstellung zu bringen, der Farben- und Lichtabstufungen, weil ihr kein anderes Mittel zu Gebote steht, auf der Fläche den Eindruck der Körperlichkeit hervorzubringen. Denn gerade dies – die körperliche Form und deren Bewegtheit mindern dies – bringt allein eine wahre Ansicht des inneren Lebens hervor. Die Bildhauerei bedarf zum Ausdruck des inneren Lebens des Stoffes, der stofflichen, körperlichen Form. Aber diese erfüllt auch die Kunstabsicht vollkommen, und wohl nie ist jemand, an dem inneren Lebenshauche eines Apollo vom Belvedere oder einer Venus von Capua irre geworden. Ist aber das innere Leben in der farblosen oder gleichfarbigen Form typisch zum Ausdruck gebracht, was soll dann noch die Farbe? Sie drängt sich vor als ein Moment der Kunstfertigkeit, verrät eine Verkennung der wahren Kunstabsicht, die nicht mehr in der Offenbarung eines inneren Gesetzes, sondern in der Naturnachahmung gesucht wird, und zerstört auf diese Weise, als auf plumpe Täuschung berechnet, die Kunstwirkung.
Deshalb widerstrebt die Bemalung der Statuen dem Wesen der Kunst.
1887.
Tagebuchblätter
Sebaldusgrab. Wie grazil es ist! wie die Apostel gleich göttlichen Flammen auf Leuchtern stehen! wie alles auf eine unsägliche Kostbarkeit im Innern des Sarges deutet!
Man muß die Art, wie der Meister sein Kunstwerk genoß, wiederfinden: dann werden es die Schnecken, auf denen es ruht, langsam und feierlich um sich selbst bewegen und um das Kind, das die zentrale Erneuerung der Welt bedeutet, die es zugleich als höchste Spitze und Blüte trägt.
*
Im Stephansdom, den ich morgens besuchte, empfing ich einen tiefen Eindruck von dem Grabmal Kaiser Friedrichs des Dritten (begonnen von Niclas Lerch aus Leyden 1467, vollendet 1513 durch Michael Dichter). Es ist aus rotem Marmor und steht im sogenannten Passionschor. Es ist ein gewaltiger Ernst mit diesen Monumenten in den Chor gebracht, der in der Kirche sonst nirgend noch erreicht wird. Hier ist kalte, finstere Kraft ausgesprochen, und die Nische hat eine drohende Weihe. Merkwürdig sind Gestalten von Dämonen, in Form von Hunden und Affen: sie füllen, einer an den anderen geschlungen, eine Art Rinne oder Graben aus, der um das ganze Monument geht. Die Kette ist unterbrochen durch einen Menschenschädel, zwischen dessen Kinnladen eine dicke Schlange hineinkriecht. Die Hunde nehmen allerhand natürliche beobachtende Stellungen ein, kratzen sich und so weiter, desgleichen die Affen. Dieser ganze Kranz um den altarähnlichen Bau herum ist von grausiger Kälte und Bizarrerie.
25. Januar 1897.
*
Ich sah gestern im Stephansdom mit großer Ruhe ein kleines Marienbildchen, das mit einem silbernen Gitter überzogen ist und dem man göttliche Ehren erweist. Etwa hundert Menschen standen und knieten immer gleichzeitig und Gebete lispelnd davor. Der Türsteher sagte mir, Kaiser Franz Joseph habe es von Tetschen hierherbringen lassen, weil es ein wundertätiges Bild sei und aus den gemalten Augen Tränen vergossen habe. Am Fundort sei es nicht genügend verehrt worden und stünde deshalb nun hier. In der Tat: es brannten auf eisernem Ständer davor dicke und dünne, lange und kurze Opferkerzen, deren Flammen der kalte und düstere Steinhauch des riesigen Kirchenraumes hin und her bog. In der flackernden Beleuchtung gab es ein unaufhörliches Neigen, Beugen, Sichniederlassen, Sicherheben, Kommen und Davongehen. Die Andächtigsten und Gläubigsten küßten das silberne Gitter.
26. Januar 1897.
*
Die Orientpracht der Kirche von San Marco erschließt Venedig. In dieses goldene Haus gehören die Purpur- und Goldgewänder der Dogenzeit. Ein messelesender Priester ordnet sich in den Prunk durch sein feuerfarbenes Meßgewand.
Von San Marco zu Tizian ist ein kleiner Schritt. Hier mußte der Meister von Pieve di Cadore gewandelt haben.
Die Priester sind zufällige Besiedler dieser Prachtschale wie die Larve eines gewissen Insekts des Raumes im Inneren einer Haselnuß. In gewisser Weise sind Priester mehr.
Tätiger Wahn, zeugender Wahn! Ist nicht dies alles, was wir wünschen können? Diese Schale ist da, um eine religiöse Hauptempfindung teils zu zeugen, teils zu verherrlichen, teils durch Umhüllung zu behüten. Nicht so die Natur. Kunst gebiert dem Menschen das Göttliche. Kunst aber ist menschlichen Ursprungs durchaus. Marmor, Porphyr, Gold, Eisen, Silber, dem menschlichen Handwerk unterworfen, das wieder der Geist zur Einheit fügt, hat die Hülse geschaffen für etwas Ungreifbares, Unmeßbares, Unwägbares, Unsichtbares.
1. Februar 1897.
*
Ich träumte von Lohnig. Ich besah mir die Scheune, wo ich als Vogt neben den Arbeitern gestanden habe. Der Hof machte einen öden Eindruck. Ich ging dann ins Herrenhaus, wo Tante Julie noch wohnte, aber gänzlich vereinsamt. Die Räume und Wände enthielten für sie und mich noch die Schatten der Vergangenheit. Es herrschte ein fremder Verwalter. Wir schritten gemeinsam durch eine ungeheure Allee von Kastanien: Tante Julie und ich. Auf einmal fühlte ich, sah in ihrem Gesicht die Veränderung zum liebenden Weibe. Um die Lippen spielte Zärtlichkeit, Humor und kindliches Leben. Da sah ich und weiß nun auch im Wachen, was ihr das Leben genommen hatte. Unter den Seitenfenstern war ein stehendes Wasser, ein Teich: düster von Pappeln und Weiden umgeben. Gelbe Blätter bedeckten überall die Ufer.
Mai 1898.
*
Mir ist, als hätte ich den Grat eines Gebirges erstiegen, auf dem ich nun gehe. Der Gang ist sicherer, ruhiger, leichter, indessen der innere Auftrieb, der zwecklos geworden ist, fehlt. Jetzt blicke ich gradeaus, nicht mehr in die Höhe. Ich blicke nach unten, wohin ich, wie ich fühle, wieder hinabsteigen muß, wenn ich eine Strecke in der Höhe werde gewandelt sein. Früher baute ich Utopien und bildete im Ringen nach ihrer Verwirklichung. Jetzt schwebt mir ein plastisches Werk vor, ein großes Denkmal vieler Freuden, Menschen und Dinge. Ein solcher Tempel des Todes müßte resignierend und veredelnd, scheint mir, in das noch übrige Leben hereinwirken.
14. Juni 1898.
*
Warum bin ich nicht Musiker, der ich doch vor allem Musiker bin? Ich habe gestern von Sonnenuntergang bis tief in die Mondnacht mit allen Sinnen Musik gehört. Es gibt in der Musik das Konkrete und das Abstrakte wie in jeder Sprache. Die Musik des Sonnenuntergangs, die Musik der Meeresunendlichkeit, die mystische Musik der lebenzeugenden Meerestiefe, die konkrete Musik der Brandung, die machtvolle der zerklüfteten, wilden Felsküste mit ihren Faltungen und Verwerfungen. Der Kirchhof auf der Spitze mit seiner Musik. Die Musik der fortschreitenden Dämmerung, der hereinbrechenden Nacht. Das Aufgehen der Lyra des Himmels mit dem Gesang der Sterne. Luna, die Trägerin so zahlloser menschlicher Irrtümer der Sehnsucht, mit ihrer rätselvollen Urmusik. Gegen diese duldende steht die gewaltig aktive des Sol. – Die Musik der Straßen. Das aufdringende Geschrei der Menschen. Die Hähne mit ihrer Musik. Der große Karren mit riesigen Rädern, diese sich bewegend in Ton und Rhythmus. Die Schlittenschellen der vier Gäule: diese selbst von unten beleuchtet und ihre Musik. Das schwankende Licht der unterm Wagen baumelnden Laterne und die seine. Der singende Fuhrmann dazu und so weiter, und so weiter.