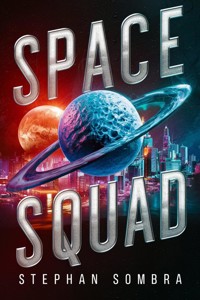Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Eulenspiegel Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Stephan Schulz sagt über sich: "Ich verbrachte meine Kindheit in einer Otto-Normalverbraucher-Familie, in der es weder überzeugte Sozialisten noch überzeugte Dissidenten gab. Ich wuchs somit in ganz normalen DDR-Verhältnissen auf." Die Geschichten, die er über diese Zeit erzählt, handeln von Timurhilfe, Jungen Philatelisten, einer froschgrünen Simson Suhl, dem Deutschen Soldatensender und anderen Dingen, die in weite Ferne gerückt sind. Dass es Geschichten voller rabenschwarzen Humors sind, liegt an den Leuten, die auf ihre ganz eigene Art in diesem Land lebten. "Zwanzig Jahre waren seit der Gründung des Arbeiter-und-Bauern-Staates vergangen. Für den Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht ergab sich daraus die Verpflichtung, ein buntes Jubiläumsprogramm für die Werktätigen vorzubereiten. Meine Eltern beteiligten sich an den Feierlichkeiten auf ihre Weise. Sie füllten einen Tippschein aus, weil sie glaubten, dass man gegen die Diktatur des Proletariats am ehesten im Lotto gewinnen könne."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 205
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ISBN eBook 978-3-359-50064-3
ISBN Print 978-3-359-01717-2
© 2016 Eulenspiegel Verlag, Berlin
Umschlaggestaltung: Buchgut Berlin, unter Verwendung eines Fotos von Manja Liebrucks
Die Bücher des Eulenspiegel Verlags erscheinen in der Eulenspiegel Verlagsgruppe.
www.eulenspiegel.com
Über das Buch
Seltsame Dinge geschehen: Lila Kühe werden gebügelt, ein Soldat geht mit Handgranaten fischen, in einem Lehrlingswohnheim erwachen Tote zum Leben. Das ist doch alles absurd? Na sicher! Und wenn es nicht so gewesen wäre, dann hätte es so sein müssen! Die Geschichten von Stephan Schulz stecken voller Überraschungen und funkeln vor rabenschwarzem Witz. Er erzählt über seine Kindheit und Jugend in der DDR aus der einzigen ihm möglichen Perspektive – der Kleinstadtperspektive.
Über den Autor
Stephan Schulz, Jahrgang 1972, wuchs in Burg bei Magdeburg auf. Er studierte Germanistik, Soziologie und Politikwissenschaften und musste feststellen, dass das Hörsaalwissen nicht weit führt, weil sich die Politik selten an die Wissenschaft hält. Deswegen schreibt er so gern darüber – als Redakteur beim Mitteldeutschen Rundfunk und auch als Buchautor. Sein erstes Buch, »What a Wonderful World. Als Louis Armstrong durch den Osten tourte«, erschienen 2010, wurde mit dem Swinging Hamburg Jazz Award ausgezeichnet. Stephan Schulz ist Vater von zwei Kindern und lebt mit seiner Familie in Magdeburg.
Für M. & M.
»Die Wahrheit ist biegsam!«
Ähnlichkeiten mit lebenden Personen oder toten Tieren sind rein zufällig oder gewollt.
Inhalt
Ein Albtraum
Der endlose Winter
Knäckeburger
Das Beutelschaf
Wildschwein ehrenhalber
Boney M.
Mojko Gitić
Timur und sein Trupp
Druschba, Towarischtsch!
Agnieszka Kołakowski
Rosa Elefanten
Der Funkturm
Eine vergeigte Fußballkarriere
Milka-Lila-Kuh
Flughelden
Kaffeemix
Krieg im Äther
Bück dich, Genosse!
Ratten
Männergrippe
Hans Dampf
Impulse Incognito
Helmphobie
Kampfreserve der Partei
Die Autobahn
Gläserrücken
Bandsalat
Waldmenschen
Plattenfieber
Butterblümchen
Herr Meier
Strahlende Zukunft
Beate Uhse
Eine Ostergeschichte
Versuchungen
Charmante Betrüger
Tüten-Paula
Bockwürste
Piss off!
Das Werther’s-Echte-Gefühl
Mama, Busst!
VW-Popo
Die Wiederkehr der Stoffbeutel
Kopfgelenkblockaden
Autogrammjäger
Rotmilan und Adler
Das Eurokondom
Lass alles hinter dir!
Ein Albtraum
Alles begann mit einem Albtraum. Damals, vor einem Jahr, verwandelte ich mich im Schlaf in einen Metzger, der nach toten Tieren stank; nach Kuh, Katze, Pferd und Schwein. Um den Schlachthausgeruch loszuwerden, ließ ich mir eine Badewanne mit Lavendel ein. Lavendel vertreibt nicht nur Motten, dachte ich, sondern auch schlechte Gerüche.
Als ich in der Badewanne lag und vor mich hin döste, spürte ich plötzlich einen stechenden Schmerz in der Unterlippe. Ich schrie auf wie ein kleiner Hund, dem der Schwanz plattgetreten wird. Dann sah ich, wie aus den Tiefen des Lavendel-Schaums ein Piratenschiff auftauchte, ein Viermaster mit gusseisernen Kanonen und finsteren Gesellen an Bord.
Das wird doch nicht die Black Pearl sein, dachte ich, das Schiff der Untoten, die als lebende Skelette dazu verdammt sind, auf ewig durch die Nacht zu ziehen.
Düstere Rufe drangen an mein Ohr. Mit jedem dieser Rufe hatte ich das Gefühl, dass meine Unterlippe ein Stück länger wurde. Ich senkte den Kopf, schielte auf meinen Mund und entdeckte einen Enterhaken, der tief im Fleisch steckte. An dem Enterhaken war ein Tau befestigt, das direkt auf das Vorderdeck des Schiffes führte. Dort standen an die zwanzig Piraten und riefen: »Hau ruck, hau ruck!«
»Auf-Föhren!«, nuschelte ich, so gut das eben mit einem Enterhaken in der Unterlippe geht. »Auf-Föhren!« Aber die Piraten ließen sich nicht aufhalten. Sie zogen so lange an dem Tau, bis meine Unterlippe dem Beuteschnabel eines Pelikans verblüffend ähnlich sah. Anschließend verknoteten sie das Tau an der Reling des Schiffes. Ich sah, wie ein kleiner, hagerer Mann mit ausgebreiteten Armen auf mich zu balancierte. Das kann nur Jack Sparrow sein, dachte ich, der Kapitän der Black Pearl. Warum aber trug Jack Sparrow keine Augenklappe, sondern eine panzerglasdicke Brille?
Als der Pirat meine blutende Unterlippe erreicht hatte, grüßte er mit geschichtsträchtigen Worten: »Den Sozialismus in seinem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf.«
Ach du Scheiße, dachte ich, war das wirklich …?
Er war es, Erich Honecker, der Staatsratsvorsitzende der DDR. Ich wunderte mich darüber, dass er sich in meiner Badewanne auf einem Piratenschiff aufhielt. Ich hätte ihn eher im Jenseits vermutet oder auf dem Urlauberschiff MS Völkerfreundschaft.
»Erüsch«, rief ich, »du bischt doch tot!«
»Bin ich ja auch«, entgegnete der Staatsratsvorsitzende.
»Aber wasch machschte tenn in meinem Lavendelwascher?«
»Ich ankere tief in deiner Seele«, sagte Honecker.
»Dasch isch ja ein scheener Mischt«, entgegnete ich und verdrehte die Augen. Ich wollte mit diesem Untoten nichts zu tun haben. Als ich noch mitten in der Pubertät steckte, hätte ich gern mal eine Italienerin, eine Französin oder eine Spanierin geküsst, aber Erich Honecker ließ mich nicht einmal nach Buxtehude reisen. Das nehme ich ihm übel – bis heute.
»Nun sei mal nicht so nachtragend«, sagte Honecker, der als verkleideter Pirat offenbar Gedanken lesen konnte. »Ich bin gekommen, damit du deinen Frieden mit mir machen kannst.«
»Escht? Was musch isch dafür tun?«
»Nicht viel. Du musst nur über deine Kindheit und Jugend in der DDR schreiben, dann werde ich aus den Tiefen deiner Seele verschwinden.«
»Dasch isch allesch?«, fragte ich.
»Das ist alles«, versicherte Honecker.
Ich wollte den Staatsratsvorsitzenden noch darauf hinweisen, dass sich mein schriftstellerisches Talent als Metzger vermutlich in Grenzen halten würde, aber ich kam nicht mehr dazu, weil der Wecker klingelte. Noch am selben Tag begann ich, über mein Leben im Sozialismus aus der einzigen mir vertrauten Perspektive zu schreiben – der Kleinstadtperspektive.
Der endlose Winter
Ein gebrochenes Bein schützt nicht vor Schwangerschaft. Diese Erfahrung haben meine Eltern im vorigen Jahrhundert gemacht. Damals, im Jahr 1969, feierte ihr kleines Land, die DDR, ein großes Fest. Zwanzig Jahre waren seit der Gründung des Arbeiter-und-Bauern-Staates vergangen. Für den Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht und sein Zentralkomitee ergab sich daraus die Verpflichtung, ein buntes Jubiläumsprogramm für die Werktätigen vorzubereiten. Sie organisierten Festreden, Militärparaden und kollektive Massenbesäufnisse. Meine Eltern beteiligten sich an den Feierlichkeiten auf ihre Weise. Sie füllten einen Tippschein aus, weil sie glaubten, dass man gegen die Diktatur des Proletariats am ehesten im Lotto gewinnen könne.
Die Sonderziehung zum Republikgeburtstag hieß »Toto-Trümpfe zum Fest«. Auf der Gewinnliste standen jede Menge attraktiver Preise, darunter 10 Pkw Wartburg, 100 Pkw Trabant, 550 Luxusschiffsreisen mit der Völkerfreundschaft und 500 Sachgewinne im Wert von je 4000 Mark. Meine Eltern gewannen einen der Sachpreise, einen Color 20, den ersten Farbfernseher der DDR, mit Holzgehäuse. Die Fernsehgerätehersteller des VEBRFT Staßfurt hatten diese neueste Errungenschaft des Sozialismus in weniger als fünf Jahren zur Marktreife gebracht. So ein Apparat kostete 3740 Mark. Das war etwa das Vierfache von dem, was meine Eltern im Monat verdienten. Mein Vater baute Getränkemaschinen, meine Mutter besamte Kühe. In ihrer Kosmonautengasse waren sie nun die Ersten, die einen Farbfernseher besaßen. Das musste gefeiert werden.
Sie luden alle Nachbarn, Verwandten und Kollegen zu sich nach Hause ein, um mit ihnen am 7. Oktober 1969 fernzusehen. Die einzige Sendung, die an diesem Tag live und in Farbe übertragen wurde, war der Festakt zum 20. Jahrestag der DDR. Mein Vater trat mit stolzgeschwellter Brust vor das geladene Kollektiv und schaltete den Color 20 ein. Für den Bruchteil einer Sekunde blitzten rote, grüne und blaue Phosphorpunkte auf, dann platzte die russische Bildröhre und der Farbfernseher war kaputt. Meinen Eltern und ihren Gästen blieb nichts anderes übrig, als sich mit Kristall-Wodka, dem berühmt-berüchtigten »Blauen Würger«, zu betrinken.
Zwei Monate später lag das Land unter einer dicken Schneedecke. Aus der befreundeten Sowjetunion war sibirische Kälte herübergezogen, die für Temperaturen unter minus zwanzig Grad sorgte. Für die real existierenden Funktionäre, Arbeiter und Bauern ergaben sich daraus einige Probleme. Zum Beispiel sprangen ihre flinken Trabis nicht an, auch die sonst so robusten Busse und Bahnen kamen nicht mehr vom Fleck. Die Menschen froren in ihren Wohnungen und machten die Kumpel in den Braunkohletagebauen dafür verantwortlich. Die armen Kerle schufteten rund um die Uhr und schafften es trotzdem nicht, den Bedarf der Bevölkerung an Kohle zu decken.
Das bekamen im endlosen Winter 1969 auch meine Eltern zu spüren, die in einem kleinen Haus mit Plumpsklo auf dem Hof wohnten.
In der ersten Dezemberwoche waren ihnen die fossilen Brennstoffe ausgegangen. Mutter befürchtete bereits den Kältetod, während Vater mutig zur Tat schritt. Er warf sich einen Jutesack über die Schulter und machte sich auf die Suche nach den letzten Kohlevorräten des Winters. Auf allen Kohleplätzen, die er aufsuchte, lag aber nur noch schmutziger Schnee. In seiner Verzweiflung versuchte er, die Kohlenmänner zu bestechen, aber die schüttelten nur den Kopf. »Zisch ab, Genosse!«, maulten sie. »Kohle ist aus!« Daraufhin kehrte Vater in die »Scharfe Ecke« ein. So hieß seine Lieblingskneipe. Dort bekämpfte er seinen Frust mit Bier und Schnaps. Anschließend torkelte er nach Hause. Dabei kreierte er einen Spruch, der sich schon bald großer Beliebtheit in der DDR erfreute. Er rief: »Keine Kartoffeln im Keller, keine Kohlen im Sack, es lebe der 20. Jahrestag!« Für diese defätistische Dichtkunst wurde mein Vater auf der Stelle bestraft. Er rutschte auf einer Schneewehe aus und brach sich das linke Bein. Nach einer Woche holte ihn meine Mutter aus dem Krankenhaus ab und schob ihn in einem Bollerwagen nach Hause. Sein schneeweißes Gipsbein ragte zum Himmel, steif wie ein Fahnenmast.
Den Jahreswechsel verbrachten meine Eltern im Betrieb meiner Mutter, in der Rinderzuchtanlage VEB Frohe Zukunft. Die komplette Belegschaft sang und tanzte im großen Kantinensaal. Sogar Vater legte mit Gipsbein und Krücken eine flotte Sohle aufs Parkett. Mutter wich ihm nicht von der Seite.
Um Mitternacht gingen überall die Lichter aus. Das Stromnetz war wegen der anhaltenden Kälte zusammengebrochen. Die feiernden Werktätigen ließen sich davon aber nicht die Laune verderben. Sie strömten ins Freie, um das neue Jahrzehnt mit Knallern und Raketen zu begrüßen. Nur meine Eltern blieben im großen, dunklen Festsaal zurück. Neun Monate später wurde ich geboren.
Es gibt noch ein Schwarz-Weiß-Foto von jener Silvesterfeier. Es zeigt tanzende Frauen und Männer mit ulkigen Hüten und Konfetti im Haar. An der Wand hinter ihnen hängt ein Spruchband mit der Aufschrift: »20 Jahre DDR, 20 Jahre Besamung.«
Knäckeburger
Ich bin in Burg bei Magdeburg aufgewachsen, 46 Meter über dem Meeresspiegel, flaches Land, so weit das Auge reicht. Vor langer, langer Zeit, als in Deutschland noch die Pest wütete, lebten in der kleinen Stadt am Fuße des Flämings Bierbrauer, Schneider, Tuchmacher und Schuster. Sie werden in den Geschichtsbüchern gern als polternd, eigenbrötlerisch, hinterlistig, durchtrieben und geldgierig beschrieben. Vor allem die Stadtväter sollen immer wieder Gemeinheiten ausgeheckt haben. Einmal, das ist verbrieft, verkauften sie ihre berühmte Rolandfigur an einen Steinmetz, der sie in Stücke zerschlug und daraus Treppenstufen und einen Futtertrog herstellte. Nur der kolossale Kopf des Rolands blieb unversehrt und überlebte den Wandel der Zeiten in einem Hühnerstall.
Als der Roland durch die Derbheit der Stadtväter zerstört wurde, lebte ein junger Apothekengehilfe namens Theodor Fontane in Burg. Er rührte in der kopfsteinbepflasterten Altstadt fleißig Wundsalben an und presste die stärksten Wunderpillen. Doch schon nach einem halben Jahr Aufenthalt verließ er die Stadt wieder und hinterließ der Nachwelt zur Warnung das Epos: »Burg an der Ihle«. Mit spitzer Feder schrieb der Dichter: »Eine Roma unsrer Zeit, liegt auf sieben Hügeln Burg / Wie ein mäß’ger Rinnstein schlängelt sich der Ihlestrom hindurch / Seine beiden Kirchen strecken je zwei Türme hoch empor / Gleich den Scheren eines Krebses; – jeder hüte sich davor.« Und an anderer Stelle heißt es: »Hört und staunt! Die Burger Bürger fühlen schmählich sich verletzt / Daß die gute Voß’sche Zeitung schon ein Fragezeichen setzt / Daß sie kühn es wagt, zu denken und zu hegen einen Zweifel / Geht nicht zu mit rechten Dingen und gebührt allein dem Teufel / Darum haben sie jetztunder jede Zeitung streng verpönt / Aber durch zwei Tuchfabriken wunderbar die Stadt verschönt / Und zu sprechen streng befohlen nur von Wolle und von Schafen / Bei Vermeidung von zehn Taler oder gar von Leibesstrafen.«
Heute sprechen die Burger Bürger natürlich nicht mehr von Wolle und von Schafen. Und Fontanes Schmähkritik ist längst in Vergessenheit geraten. Das Land ist auch nicht so flach, wie ich es anfangs beschrieben habe. Es ist eher so halb und halb. Halb flach, halb hügelig.
Auf den Hügeln stehen die Wahrzeichen der Stadt: die Oberkirche Unser Lieben Frauen, der Bismarckturm, der Wasserturm, der Kuhturm und der Hexenturm, in dem im Mittelalter die »lüderlichen Mädgens« eingesperrt wurden, bevor sie auf dem Scheiterhaufen brannten. All diese Bauwerke verleihen der 23.874 Einwohner zählenden Kreisstadt des Jerichower Landes nicht nur eine gewisse Größe, sondern auch eine gewisse Schönheit. Zwei Menschengruppen fühlen sich von dieser Schönheit besonders angezogen: Straftäter und Japaner.
Während die Straftäter vor den Toren der Stadt in einem Hochsicherheitsgefängnis leben, tummeln sich die Japaner mit Vorliebe auf dem Ostfriedhof von Burg. Sie flitzen mit ihren Digitalkameras um das Grab von Carl von Clausewitz, der das Buch »Vom Kriege« geschrieben hat, und führen japanische Kriegstänze auf, ähnlich wie die Indianer, nur dass die Japaner keine Tomahawks durch die Luft schwingen, sondern Samuraischwerter.
Einmal warf ein japanischer Offizier bei diesen rituellen Tänzen sein Schwert versehentlich über eine Lorbeerhecke, hinter der sich gerade eine Trauergesellschaft von einem Verstorbenen verabschiedete. Der Verstorbene lag friedlich aufgebahrt in seinem Sarg und lächelte, als plötzlich das Samuraischwert angeflogen kam und ihm das Herz durchbohrte. Er starb dadurch zum zweiten Mal, was dazu führte, dass seine trauernden Angehörigen reihenweise in Ohnmacht fielen.
Seit diesem Vorfall sind Japaner in Burg nicht mehr so gut angesehen. Auch andere Ausländer haben es schwer in der Stadt. Die Einheimischen fürchten sich vor den fliegenden Schwertern der Fremden, und sie haben Angst, dass sie mit einem Voodoozauber belegt werden, sollten sie sich der großen weiten Welt öffnen. Einige Burger hat diese zurückgezogene Lebensweise völlig um den Verstand gebracht. Neulich drohten mehrere Jugendliche mit einem starken Drall nach rechts damit, dass sie einen drei Meter hohen Maschendrahtzaun um Burg ziehen werden, um sich vor »weiteren Invasoren« zu schützen. Ich frage mich, wen sie damit meinten. Wölfe aus dem Osten? Pilzsucher aus Brandenburg, Sachsen und Thüringen, die ihnen die Pfifferlinge klauen? Oder wollten die braungebrutzelten Jugendlichen eigentlich Investoren statt Invasoren sagen? Aber auch das ergibt keinen Sinn, weil Burg Arbeitsplätze gut gebrauchen kann. Deswegen glaube ich, dass die strammen Kameraden nur einen Scherz machen wollten, um den Japanern zu sagen, tanzt, lacht, seid fröhlich, aber steckt eure Schwerter bitte nicht in unsere Toten.
Die Japaner lassen sich von solchen Scherzen nicht weiter beeindrucken. Sie fuchteln weiterhin mit ihren Samuraischwertern am Grab von Clausewitz herum, weil sie von ihm jede Menge wertvolle Tipps über Taktik, Strategie und Psychologie der modernen Kriegsführung bekommen haben. Sein Buch »Vom Kriege« gehört bis heute zur Pflichtlektüre japanischer Soldaten. Das erklärt auch, warum Japaner den in Burg geborenen preußischen General wie einen Kriegsgott verehren.
Sobald die Japaner ihre Tänze auf dem Ostfriedhof beendet haben, steigen sie in ihre Reisebusse und fahren zum beliebtesten Einkaufstempel der Stadt, zum Marktkauf. Dort erwerben sie Souvenirs und machen die Verkäuferinnen mit ihrem Kriegsgeschrei verrückt.
Marktkauf ist überhaupt das Beste in Burg. Jeder Einheimische, der etwas auf sich hält, geht in dem Supermarkt einkaufen und trinkt anschließend einen Latte Macchiato im Marktkauf-Café. Es gibt für einen Burger keinen gemütlicheren Ort als Marktkauf.
Ganz in der Nähe des Supermarkts befindet sich die Spielwiese meiner Kindheit und Jugend, die Kosmonautengasse. Dabei handelt es sich um einen asphaltierten Feldweg, an dessen Rändern kleine geduckte Doppelhaushälften aus den dreißiger Jahren stehen.
In einer dieser Doppelhaushälften wohnte ich neunzehn Jahre meines Lebens gemeinsam mit meinem Vater, dem Bohrwerksdreher, meiner Mutter, der Rinderzüchterin, meiner Oma, der Kriegswitwe und meiner Schwester, der Nervensäge. Zeitweise gehörten auch Katzen, Kaninchen, Goldfische und Wellensittiche zu unserer Familie.
Zu DDR-Zeiten lebte in Burg auch eine bekannte Schriftstellerin. Sie hieß Brigitte Reimann und war gewissermaßen eine Femme fatale des Sozialismus. Sie liebte die Männer und die Männer liebten sie. An ihrem Hauptwerk Franziska Linkerhand schrieb Brigitte Reimann zehn Jahre. Das Buch erzählt die Geschichte einer jungen Architektin, die auf einer Großbaustelle in Hoyerswerda arbeitet. Sie will dort ihre Vorstellung von einem Sozialismus mit menschlichem Antlitz in Beton gießen. Doch sie scheitert an ihrem Vorgesetzten, der keine architektonischen Experimente duldet. Damit frustriert er seine junge Kollegin so sehr, dass sie sich zahllosen Liebhabern hingibt.
Als Brigitte Reimann 1973 in Ostberlin starb, war ihre Geburtsstadt Burg noch in aller Munde. Das lag an einer roten Backsteinfabrik, die an einem alten Kanal steht. Sie versorgte alle 16 Millionen Einwohner der DDR mit knackigem Knäckebrot. Deshalb werden wir Burggeborenen auch Knäckeburger genannt.
Aber die Stadt lebte nicht nur vom Knäckebrot allein. Die Einheimischen walzten auch Bleche, bauten Getränkemaschinen, dienten in der NVA-Kaserne »Waldfrieden« und schusterten in der Schuhfabrik »Roter Stern« robuste Pantoffeln und Hackenschuhe für die westdeutsche Unternehmerfamilie »Salamander« zusammen. Die halbe Stadt, einschließlich meiner halben Verwandtschaft, arbeitete in der Schuhfabrik zum Wohle des Sozialismus und zum Wohle des Kapitalismus. Es war eine schizophrene Welt, in die ich da hineingeboren worden war. Nun, da ich schon mal da war, wollte ich auch bleiben.
Ich verbrachte meine Kindheit in einer Otto-Normalverbraucher-Familie, in der es weder überzeugte Sozialisten noch überzeugte Dissidenten gab. Ich wuchs somit in ganz normalen DDR-Verhältnissen auf. Trotzdem ging die sozialistische Erziehung nicht spurlos an mir vorbei. Ich malte bereits im Kindergarten bis zu den Zähnen bewaffnete Soldaten der Nationalen Volksarmee, die mich vor den gemeinen Imperialisten beschützen sollten. Überhaupt lebte ich in meinen ersten zwölf Lebensjahren permanent im Schützengraben. Nachts quälte ich mich regelmäßig durch kriegerische Albträume. Mal wurde ich in meinem Bett von Bundeswehrpanzern überrollt, mal schoss mich eine amerikanische Pershing-II-Rakete mit Atomsprengkopf ins Weltall, wo ich schließlich in einem Sternenmeer aus radioaktiver Strahlung verglühte. Ich lebte in der festen Überzeugung, dass das Gute aus dem Osten und das Böse aus dem Westen kommt.
In der Schule durchlief ich alle Stationen, die eine allseitig gebildete sozialistische Persönlichkeit durchlaufen sollte. Ich war Gruppenratsvorsitzender bei den Pionieren, Milchgeldkassierer, Klassensprecher und Agitator bei der FDJ. Irgendwann ging mir jedoch ein Licht auf, und ich wandte mich konspirativ vom Sozialismus ab. Ich toupierte mir meine Haare wie Messer empor und lief mit einem Kassettenrekorder auf der Schulter durch meine kleine Arbeiterstadt. Ich interessierte mich jetzt für düstere Musik, für Gitarren statt Knarren und für Mädchen. Für eines aber interessierte ich mich nicht – für Politik!
Irgendwann fiel die Bauruine DDR in sich zusammen. Alles, was gestern noch gut und richtig erschien, galt nun nicht mehr. Die Erwachsenen kauften jubelnd Bananen, um wenig später in einer tiefen Depression zu versinken. Ihre Arbeitsplätze waren wegrationalisiert, ihre Fabriken versiegelt worden. Nur die Burger Knäckebrot-Fabrik überlebte den Übergang in die neue Zeit ohne größere Blessuren. Die Einwohner meiner Heimatstadt sind dafür noch heute dankbar. Dies drückt sich im alljährlich stattfindenden Burger Knäckebrot-Karneval aus. Immer am zweiten Februarwochenende des Jahres rennen die Burger Bürger verkleidet durch ihre Stadt, zerbröseln Knäckebrot und werfen es in freudiger oder melancholischer Erinnerung an ein zu Staub verfallenes Land in die Luft.
Das Beutelschaf
Hast du schon gehört, sagte Heinz, die alte Frau Beutel darf ihr Schaf nicht mit in den Westen nehmen. Ist das nicht traurig?
Wie? Beutel? Schaf? Westen?, fragte Hanne, seine Frau, und biss in ihren Negerkuss.
Na, die alte Frau Beutel eben, die aus der Rosa-Luxemburg-Straße, die kennst du doch.
Ach die, entgegnete Hanne, die kenne ich natürlich. Hatte die nicht einen Ausreiseantrag gestellt?
Ja, die will zu ihrer Tochter nach Helmstedt ziehen, ins Zonenrandgebiet, sagte Heinz und tat wichtig. Ihr Ausreiseantrag ist gestern genehmigt worden, hat sie mir vorhin erst erzählt, als wir in der Stadt nach Bananen anstanden.
Das ist ja schön für die alte Frau Beutel, sagte Hanne und wischte sich die Reste ihres Negerkusses aus dem Gesicht.
So schön ist das nun auch wieder nicht, entgegnete Heinz, sie darf ihr Schaf nicht mitnehmen. Es muss in der DDR bleiben. Nun ist die alte Frau Beutel ganz niedergeschlagen.
Das ist traurig, sagte Hanne.
Sag ich doch, grummelte Heinz.
Hanne überlegte.
Ist die Tochter der alten Frau Beutel nicht kurz nach dem Mauerbau mit einem Heißluftballon nach Westberlin geflogen?, fragte sie.
Ja, rief Heinz, und sie ist mit ihrem Ballon an der Siegessäule hängengeblieben. Sagen jedenfalls die Leute.
Ich möchte zu gern wissen, wie die da wieder runtergekommen ist, sagte Hanne.
Vermutlich mit Hilfe der Feuerwehr, orakelte Heinz, die sollen ja da drüben besonders lange Leitern haben.
Mag sein, entgegnete Hanne, aber weißt du, was mich wundert?
Nein, was wundert dich denn?
Mich wundert, dass sie die alte Frau Beutel ziehen lassen, obwohl ihre Tochter abgehauen ist. Illegaler Grenzübertritt, Republikflucht, du verstehst?
Vielleicht dachten sie, dass die alte Frau Beutel ohnehin keinen wertvollen Beitrag mehr zum Wohle unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates leisten kann, sagte Heinz. Die Alte ist ja schon über achtzig.
Wollen wir ihr beim Packen helfen?, fragte Hanne. Vielleicht vermacht sie uns ihr kleines Häuschen. Das braucht sie doch jetzt nicht mehr.
Das wäre ja wie ein Sechser im Lotto, rief Heinz. Ich fahre schnell den Trabi vor, dann können wir los.
Na dann, sagte Hanne, dawai, dawai!
Die alte Frau Beutel saß in ihrem Ohrensessel und jammerte. Was soll nur werden? Mein armes Schaf! Mein armes Schaf!
Aber Frau Beutel, Sie müssen nicht traurig sein, sagte Heinz. Wir werden uns gut um Ihr Schaf kümmern.
Ist Ihre Wohnung nicht zu klein für ein Schaf?, fragte die alte Frau Beutel. Sie wirkte leicht verwirrt.
Ja, das stimmt, sagte Hanne, deshalb wollten wir Sie fragen, ob Sie uns Ihr kleines Häuschen verkaufen wollen. Das hätte den Vorteil, dass Ihr Schaf in seiner gewohnten Umgebung bleiben könnte. Wir würden es jeden Tag mit frischen Zuckerrüben füttern. Ihr Schaf hätte es gut bei uns!
Die alte Frau Beutel hatte keine Einwände. Sie verkaufte Heinz und Hanne ihr kleines Häuschen für 10.000 DDR-Mark und freute sich, dass es ihrem Schaf auch weiterhin gutgehen würde.
Wir schicken Ihnen auch immer Fotos von Ihrem Schaf, rief Hanne der alten Frau Beutel hinterher, als sie zwei Wochen später in den Westen ausreiste.
Noch am selben Tag ging Heinz in ein Fotogeschäft und kaufte zehn ORWO-Filme, schwarz-weiß, à 36 Bilder. Anschließend holte er seine Praktika aus dem Schrank und ging in den Garten, das Beutelschaf der alten Frau Beutel fotografieren.
Er stellte es vor seinen gletscherblauen Trabant und drückte auf den Auslöser. Das Schaf schaute in die Kamera und lächelte fröhlich. Es hatte sichtlich Spaß daran, fotografiert zu werden. Heinz lichtete es in allen möglichen und unmöglichen Positionen ab. Sitzend auf dem Plumpsklo, liegend auf der Hollywoodschaukel, stehend auf dem Sofa, pinkelnd vor dem Kastanienbaum, grasend vor dem Holunderbusch, der Fuchsie und den Stachelbeersträuchern. Er verknipste alle 360 Bilder. Anschließend legte er dem Schaf ein Seil um den Hals und begleitete es ins Schlachthaus.
Als Hanne davon erfuhr, war sie außer sich vor Wut. Das ist jetzt nicht dein Ernst, Heinz, brüllte sie, wir haben der alten Frau Beutel versprochen, ihr regelmäßig Fotos von ihrem Schaf zu schicken. Wenn die jetzt Wind davon bekommt, dass du das Schaf durch den Fleischwolf gedreht hast, dann gibt’s keine Westpakete!
Reg dich ab, sagte Heinz, sie wird nicht einmal ahnen, dass ihr Schaf nicht mehr lebt. Er wedelte mit den Fotos. Die kannst du der alten Frau Beutel nach und nach schicken. Sie wird denken, dass ihr Schaf glücklich und zufrieden ist.
Das beruhigte Hanne. Sie ging einkaufen.
Vier Wochen später traf ein Päckchen nebst Brief von der alten Frau Beutel ein. Mein Schaf sieht aber glücklich und zufrieden aus, schrieb sie. Vielen Dank, dass Sie sich so gut um das Tier kümmern. Ich lege Ihnen vier Tafeln Schokolade mit dem Sarotti-Mohr bei, mit besten Grüßen an die Kinder. Hochachtungsvoll, Ihre alte Frau Beutel.
Guck mal, rief Hanne ihrem Mann zu. Westschokolade für die Kinder.
Das ist ja lieb von der alten Frau Beutel, sagte Heinz und schmierte sich eine Stulle mit Schafswurst.
Wildschwein ehrenhalber
Früher gab es massenhaft Wildschweine. Sie hatten meine Arbeiterstadt Burg regelrecht umzingelt. Am liebsten hielten sich die Borstentiere auf den weitläufigen Truppenübungsplätzen der Roten Armee auf, von denen es in unserer Gegend fast so viele wie Patronenhülsen gab. Dort suhlten sich die Wildschweine entweder in den Schlammlöchern, die die sowjetischen Panzer hinterlassen hatten, oder sie schubberten sich ihre gewaltigen Hinterteile an den vielen zerschossenen Kiefern, Fichten, Kastanien und Eichen rund um Burg. Kein Baumstamm war vor ihnen sicher.
Wenn sich die Wildschweine massierten und dabei vor Freude grunzten, stand oft ihr Freund Heinz Meynhardt neben ihnen und filmte das Spektakel aus nächster Nähe. Manchmal stellte er sich auch selbst an einen Baum, um sich wie die Tiere seinen Bauch oder seinen Rücken zu schubbern. Damit signalisierte er den Wildschweinen, dass er zu ihnen gehörte und keine Gefahr bedeutete.