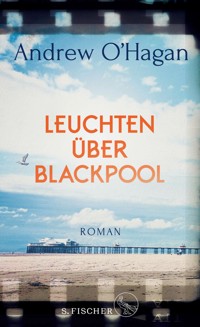24,99 €
13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 24,99 €
13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
London, Donnerstag, 20. Mai 2021, die Temperatur beträgt 16 Grad, es ist heiter, später gibt es Schauer. Als Campbell Flynn, 52 Jahre alt und auf der Höhe seines Ruhms als öffentlicher Intellektueller, an diesem Tag aus dem Taxi steigt, trägt er sich noch mit Gedanken an ein neues publizistisches Projekt. Aus ärmlichen Verhältnissen stammend zählt er heute zur Elite des Vereinigten Königreichs: seine Frau, die Tochter einer Gräfin, sein bester Freund, ein Industrieller, sein Schwager, ein Politiker mit Einfluss, sein Leben getaktet von Vorträgen, Vernissagen und Society-Events. Seine Schwäche, seine Eitelkeit und der Umgang mit dem lieben Geld. Sein Widersacher: sein liebster Schüler. Im Laufe eines aufsehenerregenden Jahres wird ein Netz von Verbrechen, Geheimnissen und Skandalen aufgedeckt; und Campbell Flynn, das Drehkreuz dieses monumentalen Gesellschaftsromans, der seine Fühler ebenso in zwielichtige Fabriken wie in vornehme Gemächer, ebenso in die Köpfe illegaler Immigranten wie in die Häupter ausbeuterischer Kapitalisten und korrupter Parlamentarier ausstreckt, Campell Flynn, dieser Inbegriff des liberalen, gebildeten weißen Mannes, wird fallen wie die Ära, die er verkörpert. »Ein Meisterwerk … außergewöhnlich … der beste und größte Roman, den irgendwer in diesem Land seit langer Zeit geschrieben hat.« John Lanchester »Sein Opus magnum, mehr als nur ein großartiges Buch« Joshua Cohen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Caledonian Road
ANDREW O’HAGAN wurde in Glasgow geboren. Er war mehrfach für den Booker Prize nominiert, wurde von Granta 2003 zu einem der besten jungen britischen Schriftsteller gewählt und gewann den E.M. Forster Prize der American Academy of Arts and Letters. Er ist Editor-at-Large bei der London Review of Books und Fellow der Royal Society of Literature.MANFRED ALLIÉ, geboren 1955 in Marburg, übersetzt seit über dreißig Jahren Literatur, vieles davon zusammen mit seiner Frau GABRIELE KEMPF-ALLIÉ. Gemeinsam haben sie u.a. Jane Austen, Ralph Ellison, Joseph O‘Connor, Richard Powers und Yann Martel übersetzt. Die beiden leben in der Eifel.
London, Donnerstag, 20. Mai 2021, die Temperatur beträgt 16 Grad, es ist heiter, später gibt es Schauer.Als Campbell Flynn, 52 Jahre alt und auf der Höhe seines Ruhms als öffentlicher Intellektueller, an diesem Tag aus dem Taxi steigt, trägt er noch ein neues publizistisches Projekt in seinem Aktenkoffer und mit ihm die Hoffnung, seine Sorgen könnten sich dadurch auflösen. Aus ärmlichen Verhältnissen stammend, zählt er heute zur Elite des Vereinigten Königreichs: Seine Frau ist die Tochter einer Gräfin, sein bester Freund ein Industrieller, sein Schwager ein Politiker mit Einfluss. Sein Leben wird getaktet von Vorträgen, Vernissagen und Society-Events. Doch er hat Schwächen: seine Eitelkeit zum einen und der Umgang mit dem lieben Geld. Und er merkt nicht, dass er sich mit seinem liebsten Schüler zugleich seinen größten Widersacher ins Haus holt.Im Laufe eines aufsehenerregenden Jahres wird ein Netz von Verbrechen, Geheimnissen und Skandalen aufgedeckt, und Campbell Flynn, das Drehkreuz dieses monumentalen Gesellschaftsromans, der seine Fühler ebenso in zwielichtige Fabriken wie in vornehme Gemächer, ebenso in die Köpfe illegaler Immigranten wie in die Häupter ausbeuterischer Kapitalisten und korrupter Parlamentarier ausstreckt, Campbell Flynn wird fallen wie die Ära, die er verkörpert.
Andrew O'Hagan
Caledonian Road
Roman
Aus dem Englischen von Manfred Allié und Gabriele Kempf-Allié
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2024Umschlaggestaltung: zero-media.net, München, nach einer Vorlage von © FaberAlle Rechte vorbehaltenDie automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.Autorenfoto: © Jon TonksE-Book Konvertierung powered by pepyrusISBN978-3-8437-3245-1
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Titelei
Das Buch
Titelseite
Impressum
Personen der Handlung
Buch I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Buch II
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Buch III
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Buch IV
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Buch V
46
47
48
49
50
51
52
Anhang
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Personen der Handlung
Widmung
fürLindsey
Motto
»Sind wir in unserem Leben erst einmal eine gewisse Strecke gegangen, dann merken wir, wie mit jedem Schritt das Eis unter unseren Füßen dünner wird, und ringsum sehen wir, wie unsere Zeitgenossen einbrechen.«
– Robert Louis Stevenson
Personen der Handlung
Campbell Flynn
– 52, Kunsthistoriker und bekannter Akademiker
Elizabeth Flynn
– 54, Psychotherapeutin, Campbells Frau
Angus Flynn
– ihr Sohn, ein DJ
Kenzie Flynn
– ihre Tochter, früher Model
Jake Hart-Davis
– ein 24-jähriger Schauspieler
Atticus Tew
– Literaturagent von Campbell Flynn
Mirna Ivoš
– Campbells Londoner Verlegerin
Moira Flynn
– Campbells Schwester, 50, Kronanwältin und Parlamentarierin
Sir William Byre
– Campbells bester Freund, Kaufhauskönig
Lady Antonia Byre
– Williams Frau, eine berüchtigte Kolumnistin
Zak Byre
– Sohn von William und Antonia, Umweltaktivist
Milo Mangasha
– ein Student, wohnt an der Caledonian Road
Ray Kennedy
– Milos Vater, 50, Taxifahrer
Zemi Mangasha
– Milos verstorbene Mutter, vormals Lehrerin
Mrs Voyles
– 70, unkündbare Mieterin im Haus der Flynns
Candy, Herzogin von Kendal
– Elizabeths Schwester, Spitzname Nighty
Anthony, Herzog von Kendal
– Candys Gatte, Spitzname Snaffles
Emily, Gräfin von Paxford
– Mutter von Elizabeth und Candy, 86
Travis Babb
– Milos bester Freund, Drill-Rapper, auch bekannt als Ghost 24
Vicky Gowans
– William Byres Freundin, 23
Ashley-Jo Abbot
– mit Kenzie Flynn liiert, im Modegeschäft, auch bekannt als AJ
Izzy Pick
– Leiterin des Modehauses Monastic
Liang
– ihr Assistent
Aleksandr Bykov
– ein russischer Oligarch, geht auf die 60 zu
Yuri Bykov
– Aleksandrs 24-jähriger Sohn
Heidi Mae Adkins
– Campbells amerikanische Verlegerin
Devan Swaby
– auch bekannt als
Big Pharma
, 22, Freund von Milo und Travis
Lloyds
– echter Name
Jeremiah Beckford
, Freund von Milo und Travis
Gosia Krupa
– Milos Freundin, 25
Bozydar Krupa
(auch bekannt als Boz und Bozy) – Gosias Bruder, 35
Mrs Krupa (Cecylia)
– die polnische Mutter von Gosia und Bozydar, 62
Andrzej Krupa
– Cecylias Gatte, 2001 verstorben
Feng
– Deckname des Drahtziehers einer Menschenhändlerbande
Stefan Popa
– ein Rumäne, Handlanger und Sicherheitschef bei Yuri Bykov
Jakub Padanowski
– 28, aus Bialystok
Robert
– 22, Jakubs Boyfriend
Mr Hazari (Babar)
– Jakubs Vermieter in Leicester
Rupert Chadley
– Chefredakteur beim
Commentator
Nicolas Lantier
– belgischer Kunsthändler, 30, tätig für Yuri Bykov
Lord Scullion of Wrayton
(Paul) – Labour-Peer, 65
Lord Haxby of Howden
(Colin) – Tory-Peer, 43
Carl Friis –
dänischer Künstler, verheiratet mit Lord Haxby
Tara Hastings
– Reporterin beim
Commentator
Sluggz
– Rapper, lebt in Deptford, wahrer Name
Sebastian Legland
Astrid
– Freundin von Angus Flynn, Chutney-Erbin
Mr Skene
– Anwalt des Herzogs von Kendal
Professor Jennifer Mearns
– Leiterin des Englischen Seminars am UCL (University College of London)
Professor Gwenith Parry
– Dozentin für Biografisches Schreiben am UCL
Mrs Frisby
– Housemistress im Franlingham College
Bischof Cree
– aus Diss in Norfolk
Fergus
– Wellnesskraft in Hinderclay House
Fatos
– Menschenhändler
Gerry O’Dade
– Lastwagenfahrer, Mitte 20
Charlo Sullivan
– Lastwagenfahrer, Mitte 20
Aasim
– Leiter einer Näherei in Leicester
Shah
– Aasims Sohn
Sun Zetao
– Architekt aus Peking
0044
– Bandenmitglied, wahrer Name
Damon Taylor
Cassie Tom
– englisches Supermodel
Buch I
Frühling
1
Piccadilly
Campbell Flynn, groß und elegant und zweiundfünfzig, war eine Sprengladung im Savile-Row-Anzug, ein Mann, der glaubte, seine Kindheit läge längst hinter ihm und er habe von ihr nichts mehr zu befürchten. Er hatte Geheimnisse, Sorgen, doch wenn er nun auf seiner Taxifahrt zum Fenster hinausschaute, sah er St Paul’s im strahlenden Sonnenlicht oben auf Ludgate Hill, und die Engel von London standen an seiner Seite. Die Fahrt führte über die Shaftesbury Avenue, er schwelgte in seinem eigenen Parfümduft, den überreifen Pfirsichen von Mitsouko, und ließ den Blick an den Fassaden emporwandern. »Ein wiedergeborener Traum« hieß es auf dem Portal zu Les Misérables, und die angenehme Vorstellung von Applaus stellte sich ein. Was hatten die Schuldgefühle und die Eitelkeit des gewöhnlichen weißen Liberalen heute doch für Ausmaße angenommen! Campbell nahm die Menschen nicht halb so ernst, wie sie selbst sich nahmen, und das war der erste seiner großen Fehler; der zweite war das Buch, dessen Korrekturabzug er an diesem Tag in seinem Aktenköfferchen bei sich trug.
Am Piccadilly Circus kamen sie an einer riesigen Videoreklame vorbei, koreanische Jungs mit rosa Haaren, die in der Sonne tanzten, und die wechselte zu einer zweiten, »Own the Streets«, Werbung für Laufschuhe. Die Straße gehört dir. Campbell starrte durch das gläserne Dach des Taxis, er dachte an Elizabeth, die jetzt glücklich in ihrem Haus auf dem Lande saß, während er sich den Herausforderungen des Stadtlebens stellen musste. Aber auf seine Selbstbeherrschung, aus Erfahrung gewonnen, konnte er sich verlassen, davon war er überzeugt. Das GPS-Display am Armaturenbrett verkündete »Donnerstag 20. Mai 2021. Temperatur 16 °C. Sonnig, später Schauer.«
Das Taxi hielt bei Hatchards, dem Buchladen. Seine Biografie von Vermeer, ein Buch, das neue Wege beschritt, war während des Lockdowns erschienen und hatte ihm ein Maß an Bekanntheit eingebracht, das weit über sein eigentliches Tätigkeitsfeld hinausging. Manche Passagen aus den Besprechungen konnte er auswendig. »Selten in der Geschichte der Künstlerbiografie ist ein Rätsel, das so durch und durch im Dunkel lag, mit solcher Lebendigkeit ans Licht gebracht worden«, hieß es in der Times. »Ein Werk von betörender Empathie«, schrieb die Financial Times, »das sich auf die Seele der Kunst selbst einlässt.« Das Buch, so verstanden seine vielen Leser es, schien zu sagen, dass Unergründlichkeit das Wesen jedes wahren Künstlertums war, ja jedes Menschenlebens überhaupt. Unter den Jüngeren hatte er es mit einem regelmäßigen BBC-Podcast, der oft riesige Klickzahlen erreichte, ebenfalls zu einer gewissen Berühmtheit gebracht, Kultur und ihre Unzulänglichkeiten, einem Programm, mit dem er tief in die Untiefen der Zeit eintauchte – und doch, trotz alledem, war und blieb seine Hauptsorge, die ihn fast ständig umtrieb, die Frage nach dem Geld, danach, wie es kam, dass er nicht so wohlhabend war, wie er eigentlich hätte sein sollen.
Er signierte einen ganzen Berg seines Opus magnum, das so vieles den Umständen, der Improvisation und Vermutung verdankte, dann verließ er Hatchards wieder und näherte sich eben der Ecke von Fortnum’s, da sah er Yuri Bykov auf sich zukommen, den Sohn des zwielichtigen russischen Geschäftsmanns Aleksandr Bykov. Er hatte ihn etliche Male auf Gesellschaften getroffen, und jetzt war er in Begleitung des Schauspielers Jake Hart-Davies, eines gut aussehenden jungen Mannes, den er von Zeitschriftenfotos und aus dem Fernsehen kannte. Der Schauspieler beanspruchte auf der Straße eine Menge Platz für sich, jedenfalls kam es ihm so vor, ein Eindruck, der sich häufig bei Menschen einstellt, die mit der eigenen Privatsphäre beschäftigt sind.
»Hallo, Professor Flynn«, begrüßte ihn der junge Bykov – elegant, modisch, mit kurzem, wasserstoffblondem Haar. Er stellte ihm den Schauspieler vor, und alle gaben sich die Hand. Die beiden kamen eben aus der London Library, mit Büchern über Shakespeare unter dem Arm. »Wir haben große Pläne«, erklärte der Schauspieler. »Die Erfahrungen des Menschenlebens in all ihren Facetten.«
»Das ist schön«, erwiderte Campbell. Er sah Bykov an. »Ich staune ja, dass Sie noch Zeit für Theaterstücke haben, so beschäftigt, wie Sie damit sind, für Ihren alten Herrn Villen aufzukaufen.«
»Sie sind ja zum Pie-pen«, antwortete Yuri, mit großer Geste. Harrow hatte ihn mit einem schnarrenden englischen Tonfall ausstaffiert, aber im Geist blieb er Russe.
Anscheinend bemerkte keiner von beiden den Regen, am wenigsten der Schauspieler, der ein T-Shirt mit der Aufschrift »Redundant« trug und sich die eigenen Armmuskeln tätschelte. Das prägte sich Campbell ein, diese Selbstsicherheit, das Selbstvertrauen, die Art, wie er von sich selbst eingenommen war. Der Russe kannte Campbells Sohn von der Uni, und daran wurde er auch sogleich erinnert. »Angus, o mein Gott«, rief er. »Eine Legende, der Mann. Und Ihre Tochter, was für eine Schönheit!«
»Da sollte ich wohl Danke sagen.«
Campbell wusste, was erzählt wurde – wie der Junge immer wieder versucht hatte, mit seinem korrupten, putintreuen Vater zu brechen und sich seinen eigenen Zirkel aufzubauen. Zu Campbells ältesten Freunden gehörte William Byre, der Geschäftsmann, der gerade in einen zunehmend schlimmeren Finanzskandal verwickelt war. Dessen Sohn Zak war zusammen mit einigen aus dieser Clique in Oxford gewesen. Es war eine kleine Welt, sämtliche Klatschgeschichten kamen über die A40 schon am nächsten Tag in London an, die Partys, die Experimente, die sturzbesoffenen Nächte. Nicht dass Zak mitgemacht hätte; der war mittlerweile ein intelligenter, aufmerksamer Aktivist bei Extinction Rebellion, jemand, für den seine Eltern nur Spott übrighatten. Er hatte erzählt, Yuri sei nur deswegen in St John’s aufgenommen worden, weil sein Vater einen Lehrstuhl zur Erforschung des Klimawandels gestiftet habe. »Wenn Umweltverschmutzung eine olympische Disziplin wäre« – Campbell hatte noch im Ohr, wie der junge Zak das gesagt hatte –, »dann wäre Aleksandr Bykov Usain Bolt, der größte Sprinter aller Zeiten. Schneller als jeder andere heizt Bykov unseren Planeten zu Tode.«
Yuri lächelte, als kenne er ein paar Geheimnisse. »Ich war auf einer Party in São Paulo, da stand Ihr Sohn an den Decks. Fantastique«, sagte er.
»Das ist schön. Er kommt viel in der Welt herum, so viel steht fest.«
Campbell schaute auf die Uhr.
Der Schauspieler erzählte, sie seien auf dem Weg zu Yuris Wohnung im Albany, dort würden sie die Bücher lassen, und dann gehe es zum Lunch im Oswald’s in der Albemarle Street.
»Hat mich gefreut, Sie kennenzulernen«, sagte Campbell.
»Lassen Sie uns mal zusammen was trinken gehen«, schlug Jake vor.
»Warum nicht«, antwortete Campbell und musterte ihn noch einmal.
Der Regen wurde plötzlich heftiger. Er machte sich wieder auf den Weg zu seinem Ziel, und aus der abgasgeschwängerten Luft flog ihm ein Gedanke zu. Er blickte noch einmal über die Schulter zu den beiden jungen Männern zurück, und der Schauspieler hatte sich ebenfalls umgedreht. Es lag etwas von glücklichem Zufall in dieser Begegnung, und in Campbells Vorstellung nahm eine Idee Gestalt an.
Für Atticus, Campbells Agenten, war es eine Frage des Prinzips, dass er immer an dem Ecktisch rechts saß, Lucian Freuds altem Tisch, und Campbell sah ihn gleich, als er das Wolseley betrat.
Atticus begrüßte ihn mit einem Lächeln und legte den New Statesman beiseite. Campbell setzte sich, stellte seinen Aktenkoffer in die Ecke. »Ich würde Ihnen die Hand geben«, sagte Atticus, »aber meine Frau hat immer noch Angst. Sie ist Amerikanerin.«
»Ich weiß«, antwortete Campbell. Bei Atticus konnte er jederzeit offen reden, für ihn ein Bonus ihrer beruflichen Freundschaft. »Sie hat in dem Bloomsbury-Cottage in Sussex, für das Sie viel zu viel Geld bezahlt haben, überall goldene Wasserhähne anbringen lassen.«
»Das ist nicht wahr«, protestierte Atticus. »Nicky Haslam war das.«
»Und das soll ich glauben? Nicky beglückt uns mit Hundekörben in der Art von Beduinenzelten, aber Katar-Stil, das nun doch nicht. Haben Sie schon bestellt?«
Atticus Tew war einundsechzig, und seine äußere Erscheinung veränderte sich nie. Campbell wusste verlässlich, dass er sich seine Strähnchen regelmäßig bei Jo Hansford in der South Audley Street nachfärben ließ. Einmal hatte er ihn dort gesehen, eine muntere Flotille Alustreifen über den Kopf verteilt. Campbell gefiel der gehobene Bücherwurm-Look, in dem Atticus sich kleidete – hellbeige Cordhosen und karierte Hemden von Harvie & Hudson, Strickkrawatte und Tweedjacke, als käme er frisch von der Rebhuhnjagd. Wie üblich las der Agent die Speisekarte vor, Campbell hörte zu, schlürfte süßen Champagner und antwortete, wenn ihm von hie und da im Saal zugenickt oder gewunken wurde. Der Digitalkünstler Carl Friis und dessen Ehepartner, Lord Haxby, drehten sich nach ihm um.
»Wie geht es der schönen Elizabeth?«, erkundigte sich Atticus.
»Leidet am Leere-Couch-Syndrom«, antwortete Campbell. »Ihre Patienten fehlen ihr; sie sagt, auf Zoom ist es alles nur Schau.«
Erst der dritte Tag, den das Lokal wieder geöffnet war. Die Belegschaft trug noch Masken. Campbell und Atticus bestellten immer beide dasselbe, ein Mittel, mit dem sie ihre Ebenbürtigkeit demonstrierten, diesmal Escargots à la bourguignonne au pastis, Steak tartare mit Pommes frites, eine Flasche Pauillac de Lynch Bages, 2016. Atticus tunkte ein Stück Brot in seinen Wein, manchmal tat er so etwas, ohne darüber nachzudenken, und fragte, was Campbell mitgebracht habe. »Sie sagen, Sie haben etwas für mich. Oder etwas für die Welt, alter Sportsfreund.«
»Lassen Sie uns erst essen.«
»Aber eins muss ich sagen – der Aufsatz, den Sie für den Atlantic geschrieben haben, ist schon sechsmal um die Welt gegangen. ›Die Kunst der Zerknirschung‹. Liberale wissen nicht mehr, wie sie Reue zeigen sollen – sie wollen authentisch sein, aber mit ein wenig Schuldgefühl. Und dann kommen Sie und führen uns vor Augen, wie selbstgefällig das alles ist.« Atticus holte einen Zeitungsausschnitt aus der Tasche. Ein Kommentar aus der New York Times vom Vortag. »›Der Verfasser ist ein Held der Humanwissenschaften‹, heißt es hier, ›ein Podcast-Krieger, der in der Kunstkritik die Tradition des großen Matthew Arnold aufrechterhält – die Auseinandersetzung mit dem Leben. Mit seinem Wissen stellt er schlichtweg alles infrage, von Adam Smith bis zum Vampirroman. Teenager lassen bei TikTok Katzen und Kängurus seine Worte sprechen.‹ Dann ein Zitat von Ihnen: ›Wir sind Teil der Systeme, die Menschen unterdrücken, wir profitieren davon, und dann glauben wir, wir müssten nur auf ein paar Schönwetterdemos gehen, Slogans für Freunde tweeten, die ohnehin unserer Meinung sind, und schon sei alles gut. Willkommen bei der Orgie der Zerknirschung des weißen Mannes.‹ Der weißen Frau natürlich auch.«
Campbell war sehr erfreut, seine eigenen unverblümten Worte aus dem Mund seines hochgeschätzten Agenten zu hören. »Starker Tobak«, sagte er.
»Da spitzen die Leute die Lauscher.«
»Meine Studenten auf alle Fälle.« Campbell überlegte. »Und zwar schon seit einer ganzen Weile. Die bringen mir das ja bei.«
»Interessant.«
»Die Feigheit der Liberalen ist nicht weniger schlimm als die aller anderen.«
»Das versteht sich, Sportsfreund.«
»Und ich will ja mein Gewissen nicht nach der Mode des Tages schneidern, wie die Dame so schön sagte.«
»Aber gehen Sie es ruhig an«, erwiderte der Agent. »Sie sind längst nicht so unangreifbar, wie Sie denken, wenn ich mir erlauben darf, das zu sagen.«
Campbell hob sein Glas an die Lippen.
Manchmal musste er Atticus einfach ignorieren.
»Ich brauche mehr Einkünfte«, sagte er. »Lizzie sagt, ich schmeiße mit Geld um mich wie ein versoffener Seemann …«
»Das einzige Laster, das Ihre Frau hat. Sie verzeiht Ihnen zu schnell.«
Geld: ein Mysterium unter den Engländern, das kaum ein Mensch durchschaute. Im Grunde sprachen Campbell und seine Frau nie über Finanzen; sie taten, als sei es albernes Zeug. Frisch verheiratet hatten sie ein kleines Haus in Belsize Park gekauft, dessen Wert sich im Laufe der Zeit verfünffacht hatte. Dann hatte Elizabeth das Cottage von ihrem Vater geerbt. Sie und Campbell hatten getrennte Bankkonten, dazu ein gemeinsames für Rechnungen und Schulgeld. Das funktionierte recht gut. Als sie beschlossen, in das vornehmere Haus am Thornhill Square zu ziehen, steckten sie alles Geld aus Belsize Park hinein, dazu ein Privatdarlehen, das Campbell aufgenommen hatte. Sie war beeindruckt gewesen, als er von Buch- und Rundfunkverträgen sprach, und so kam es, dass er ihr nie gestanden hatte, dass das Geld von William Byre stammte (sie hatte ihn nie gemocht) und er es ihm in Raten und mit Zinsen unter der Hand im Club zurückzahlte, eine Klammheimlichkeit, die ihn quälte. Das war die Lage. Das und die Tatsache, dass er seine Steuern nicht mehr bezahlte. Elizabeth besaß ein kleines Vermögen, und sie hatte ihre Einkünfte als Psychotherapeutin, Campbells Arbeit brachte etwas ein, doch es war eine seltsame, stillschweigende Übereinkunft in ihrer Ehe, etwas geradezu Intimes, dass über Geld nicht gesprochen wurde. Die Vorstellung, dass er Elizabeth nun alles beichten müsste, versetzte ihn in Schrecken. Es war peinlich, und dazu passte auch eine Art Verschämtheit, die Elizabeth noch aus der Kindheit hatte. Sie war umgeben von unsichtbarem Geld aufgewachsen. Ihr lag nichts am Reichtum ihrer Mutter, und es amüsierte sie, dass Campbell die Gräfin so umwarb – doch die Wahrheit war: Es war seine Schwiegermutter, von der er sich eine sichere und sorgenfreie Zukunft erhoffte.
Seinen Klienten gegenüber tat Atticus immer, als stünden herrliche Zeiten bevor. Er sprach von neu hereingekommenen Angeboten. Campbell hörte nur halb zu; er spähte über die Schulter des Agenten und sah sich um, wer alles im Saal war. Carl Friis dort drüben, überlegte er, musste doch in puncto künstlerischer Schaumschlägerei zur internationalen Spitzenklasse gehören. Der junge Däne redete eindringlich. Eine schwer beringte Hand ließ er über der Tischkante baumeln. »Kennen Sie den Mann da drüben?«, unterbrach er Atticus.
»Wen?«
»Carl Friis. Sogenannter Digitalkünstler.«
Atticus zupfte ein Stückchen Brot ab. »Ja«, antwortete er, »auch wenn ich nicht die leiseste Ahnung habe, was Digitalkunst ist.«
»Es ist Kryptokunst. Die Werke sind non-fungibel. Nichts, was man sich an die Wand hängen kann. Man bekommt ein Token, und das wird Teil einer Blockchain.«
»Einer was?«
»Ist ja auch egal.«
»Hört sich nach Gaunerei an«, fand Atticus.
Campbell senkte den Blick. »In einem Artikel für das Tate-Magazin schreibt er, die Zerstörung von Charles Rennie Mackintoshs School of Art in Glasgow sei selbst ein Kunstwerk gewesen. Die Zerstörung.«
»Schrecklich, so etwas zu sagen.«
Es war seltsam: Friis gehörte zu den Leuten, die Campbell näher kennengelernt hatte, weil seine Kinder den Mann interessant fanden. Eine Regel fürs Leben: Streite nie mit deinen Kindern darüber, was wertvoll ist und was nicht. Für Artforum war Campbell einmal mit Friis in eine schweizerische Berggegend gereist, wo ein Künstler namens Not Vital ein Haus gebaut hatte, das sich im Boden versenken ließ. Das Bild war Campbell im Gedächtnis geblieben, wie es da im Dunkeln gestanden hatte – wie es im Boden versank, wie Not Vital gelächelt hatte, und Carl Friis’ Augen hatten geleuchtet.
»Ach je. Er kommt rüber.«
Solche Leute bewegen sich immer, als stolzierten sie über einen Laufsteg, dachte Campbell. Er befahl seinen Gesichtsmuskeln ein Lächeln. »Ich will nicht stören«, begrüßte Friis sie, »aber Ihr Atlantic-Artikel, mein Freund, hat mich umgehauen.«
»Nun ja, danke.«
»Wir suchen alle nach einem Ausweg aus diesem Grauen. Der Gesellschaft, meine ich.« Eine Millisekunde verwandte Campbell auf den Gedanken, dass der Ausdruck »Gesellschaft« immer nur von Leuten gebraucht wurde, die nie jemandem begegneten, der einer anderen angehörte als sie. »Ich muss Ihnen unbedingt von einer Show erzählen, die ich dieses Jahr organisiere«, fuhr Friis fort. »In der Gagosian. Ich werde eine Bombe unter die Idee der Schönheit legen. Darum geht es. Schönheit ist tot. Vorbei. Zum Teufel mit der Schönheit. Ist das nicht himmlisch?«
Campbell fühlte sich ungewöhnlich beschwingt. Das ist die Wirkung, die Empörung bei einem Kritiker tut.
»Es wird sie also wirklich geben, Ihre Show?«, fragte Atticus.
Friis’ Hände flogen nur so. »Es wird, na ja, die größte Ausstellung zerstörter Kunst, die es je gegeben hat. Angekohlte Impressionisten, verstehen Sie, Landschaftsbilder, die im Wasser lagen. Wirklich sagenhaft! Ich würde mir wünschen, dass Sie etwas für den Katalog schreiben, Professor Flynn. Wenn es so weit ist. Oktober.«
»Wir werden sehen.«
Der Künstler trug offenbar Glitter auf den Augenlidern. Er klatschte in die Hände, dann ging er wieder zurück zu seinem Mann, der eben telefonierte. In Nordengland galt Lord Haxby als Held der konservativen Partei.
Campbell fand nicht so recht den Ausgleich zwischen seinen Gefühlen – himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. »Ich habe einen Studenten«, wandte er sich wieder Atticus zu, »der hat ein Händchen dafür, unsere Moral infrage zu stellen.«
»Das ist doch das Einzige, was Studenten heutzutage tun.«
»Ich finde ihn interessant.«
Der Agent hustete. »Wir waren beim Geld.«
»Ja, stimmt. Rechnungen.«
»Harper’s wünscht sich eine regelmäßige Kolumne. Und Stanford hat mich wegen einer Vorlesungsreihe kontaktiert, im nächsten Jahr.«
»Vielleicht. Aber eher nicht. Ich brauche etwas Neues.«
Atticus zog ein weiteres Blatt aus der Tasche. »New YorkMagazine bietet einen Vertrag für weitere Artikel zum Thema Mode.«
»Sie wissen ja, ich habe morgen diesen Termin. Den hat Kenzie mir eingebrockt.«
»Das Modehaus, ja. Der Mann vom T Magazine und diese neue Person bei Vogue sagen, die ganze Modewelt ist verrückt nach den Geschichten, die Sie für sie schreiben.«
»Atticus, das ist kein Kompliment. Diese Modedesigner haben nie mit jemandem zu tun, der nicht den ganzen Tag über Rocklängen oder Accessoires oder Beyoncé redet.«
»Sicher, sicher«, antwortete Atticus. »Es ist ja auch ungewöhnlich, Ihr Interesse an Modethemen.«
Ein kurzes Aufflackern von Trauer. »Meine Mutter mochte Kleider«, entgegnete er. »Sie hat sich ihr Geld mit Nähen verdient.«
»Mit der Muttermilch eingesogen«, brummte Atticus.
Campbell war unruhig.
»Moderedakteure denken, jeder, der etwas schreibt, das länger als ein Tweet ist, verdient dafür den Nobelpreis.«
»Ich leite nur die Anfragen weiter, Sportsfreund. Sie hatten mir gesagt, es gehe Ihnen darum, Ihr Einkommen zu mehren –«
»Das muss ich. Ich betreibe einen Großbetrieb mit dem Einkommen eines Freiberuflers.«
»Und zwar keinem schlechten.«
»Zwei Häuser, Attu.«
»Sicher, sicher.«
»Islington, Suffolk. Was das kostet! Die Darlehen! Wissen Sie, dass Angus Zehntausende pro Abend bekommt, einfach nur dafür, dass er auf einer Party ist?«
»Er ist DJ. Das ist deren Arbeit.«
Er war froh, dass seine Kinder ihr eigenes Leben hatten und Geld ausgaben, das nicht seines war. Wobei dieser letzte Punkt auch seine Tücken hatte. Anders als er waren sie schon in jungen Jahren zu Wohlstand gekommen, der Erfolg trieb sie voran, und nun waren sie ihrem Vater um Meilen voraus. In solchen Augenblicken, wenn die Rede auf Geld kam, dachte er oft an den Mann der Schwester seiner Frau, ein Geldsack und grässlicher Kerl. Campbell setzte sich aufrechter hin und schaute Atticus mit der Sympathie all ihrer gemeinsamen Jahre an. »Sie haben diesen Schwager von mir mal kennengelernt, oder?«
»Ja, natürlich. Seine Gnaden.«
»Der Herzog von Kendal. Ein krummer Hund durch und durch.«
»Da will ich nicht widersprechen.«
»Meine Schwester war in einen Untersuchungsausschuss des Parlaments berufen, zu russischer Korruption.«
»Moira. Wie geht es ihr?«
»Stahlhart wie immer. Sie hatte ein paar Fragen ans Plenum vorbereitet. Dann musste sie sich von der ganzen Geschichte zurückziehen, wegen Befangenheit, weil sein Name fiel.«
»Jee-sus. Der Herzog?«
»Nichts bewiesen. Nur Gerüchte.«
Atticus antwortete nicht gleich, er nahm einen Schluck. »An den erinnere ich mich. Karierte Hosen. Ein schrecklicher Stoffel. Schlechte Zähne. Seine Frau betreibt einen Biohof.«
»Genau.«
Atticus kehrte zu den Offerten zurück. Ein Dokumentarfilm für HBO. Eine Reihe von After-Dinner-Talks auf der Queen Mary 2 von Southampton nach New York. »Da wären beträchtliche Honorare zu erwarten, ein schönes Extra bei den Einkünften.«
»Das ist es ja – ich will nicht dauernd von Einkünften reden.«
Campbell blickte in Richtung Eingang und sah einen blauen Touristenbus, und ihm fiel, wenn er sich auch nichts davon anmerken ließ, ein Kippen der Perspektive auf, der Raum wirkte plötzlich größer, eine gähnende Tiefe. Diese gelegentlichen Probleme mit der Raumwahrnehmung, dieser Schwindel, ein Gefühl, dass die Dinge keine Substanz mehr hatten: Das waren neue Empfindungen, neue Eindrücke hier und jetzt bei einem Mann in den besten Jahren. »Nun, Sie wissen ja, dass ich mich schon lange nach einem völlig neuen Projekt sehne.«
»Neu ist immer gut«, meinte sein Agent.
»Dieser Auftritt morgen, den muss ich machen, bei Monastic, dem Modehaus. Ich soll ihnen Stichworte für ihre neue Kampagne liefern. Shetlandwolle, Handweberei, Bohrinseln, was weiß ich. Dann das Meeting mit den Parfümleuten. Die erwarten von mir, dass ich mir den Namen ausdenke, den sie auf ihre Flaschen schreiben.«
»Genau, den Namen für den Duft. Dafür gibt es das Geld.«
»Und dann bin ich damit fertig, oder?«
»Fast. Nächsten Februar, zur Produktvorstellung, sollen Sie für die amerikanische Vogue noch ein Interview mit einem englischen Supermodel machen.«
»Cassie Tom.«
»Genau der.«
»Und danach ist Schluss, Atticus? Vorbei. Finito. Sie hat Spaß gemacht, diese Arbeit, sie war gut für den Kontakt mit den jungen Leuten, aber jetzt habe ich genug.«
Campbell strich mit der Hand über seinen Aktenkoffer. Er bestellte zwei Gläser Calvados. Er wusste, welcher es sein sollte: Dupont 1988. Ein wenig Hemmungen, die Fahnen hervorzuholen, hatte er. »Eigentlich sollte ich über Rembrandt schreiben. Über Spiegel.«
»Sie sind sicher, dass Ihr Name nicht draufstehen soll?«, fragte Atticus. Er zeigte auf den Koffer. »Ein Buch von Anonymus?«
Campbell zögerte. »Was halten Sie davon?«, fragte er. »Als Genre?«
»Lebenshilfe ist keine Literatur, es ist Medizin. Oder Publicity. Und es bringt verdammt viel ein. Die New York Times musste eine eigene Bestsellerliste für diese Art Bücher einrichten. Ich lese selbst gerade eines. Der heroische Stoiker. Tolles Ding. Macht ein zehnaktiges Drama daraus, dass einer aufs Klo geht.«
»Darum geht es mir im Augenblick. Wenn so ein Buch sich erst einmal verkauft, dann läuft es immer weiter. Aber es interessiert mich auch als Experiment. Als eine Art Kunstprojekt.«
»Verstehe«, erwiderte Atticus. »Sie bekommen einen fetten Scheck. Sie machen es um des Geldes willen« – er zählte es an den Fingern auf –, »und es ist ein Kunstexperiment« – ein zweiter Finger –, »und Ihnen macht die Heimlichtuerei Spaß.« Er senkte die Stimme. »Sie wollen alles, Campbell. Wie alle Autoren. Kann man auch verstehen.«
Campbell holte die Fahnen aus dem Koffer. Er strich die Ecken glatt, blätterte kurz darin, dann reichte er sie weiter.
»Die Amerikaner machen den Vorreiter«, sagte Atticus und nahm sie. »Sie entwerfen ein Cover und sagen, es ist fertig, wenn der Lektor durch ist. Also in zehn Tagen. So geht das.«
»Na ja, ich habe es in sechs Tagen geschrieben.«
Atticus warf einen Blick auf die erste Seite und las den neuen Titel vor.
»Männer, die in Autos weinen.«
»So ist es«, sagte Campbell.
Atticus hatte etwas von einem englischen Armeeoffizier alten Schlags. Ihm lag nichts daran, Macht über die Realität zu gewinnen, er wollte sich nicht an ihr messen, sie nicht bezwingen, er wollte einfach nur seinen Auftrag zu Ende führen. »Die Krise der männlichen Identität im 21. Jahrhundert«, las er.
»Mirna sagt, der Untertitel ist gut«, erklärte Campbell, »aber die Amerikaner wollen ihn nicht. Nicht genug ›Lebenshilfe‹ drin. Sie denken sich noch was Besseres aus.«
»Klar.«
Campbell war ein wenig unschlüssig. »Meinen Sie, es ist in Ordnung?«
Er erwartete von Atticus keine Antwort darauf. Atticus ließ Campbell nie wissen, ob er seine Unternehmungen gut fand oder nicht.
»Tja, ich habe gezögert, ob ich es Mirna anbieten soll«, fuhr er fort. »Eigentlich ist es ja nichts für sie. Ich meine – der Verlag ist zu edel für so etwas. Das soll keine Kritik sein.«
»Habe ich auch nicht so verstanden. Aber die Wahrheit ist, sie brauchen mal was, das Geld bringt.«
»Genau.«
Atticus ließ den Calvados kreisen, als wäre er eine Mundspülung. Aber dass kein Verfassername auf das Cover solle, da habe er seine Bedenken. Er habe nicht viel Erfahrung mit so etwas, aber wäre es nicht besser, ein Pseudonym zu nehmen oder etwas in der Art?
Campbell legte beide Hände auf den Tisch. »Also, ich habe da eine Idee. Tatsächlich ist sie mir erst heute gekommen. Ich weiß, uns bleibt nicht viel Zeit, aber wie wäre es, wenn wir einen gut aussehenden Schauspieler als Aushängeschild für das Buch hätten, jemand Bekannten, der den Verfasser spielen könnte?«
»Jemand, der Lesereisen macht, Fernsehauftritte?«
»Genau. Wir könnten es mit ihm einstudieren. Dafür sorgen, dass er plausibel wirkt. Text für ihn schreiben. Er wäre der Inbegriff des empfindsamen Kerls, und seinen Namen würden wir auf das Cover setzen.«
»Finde den richtigen Mann«, entgegnete Atticus, »und wir werden Millionen verkaufen.«
2
Sprechstunde
Er machte einen Abstecher zur Piccadilly Arcade. Zeit genug hatte er, aber er verkniff es sich, bei Budd hineinzugehen und sich zu maßgeschneiderten Hemden beraten zu lassen, er ging weiter und blieb beim Schaufenster von T. M. Lewin in der Jermyn Street stehen, als sei das Ganze ein Experiment in Genügsamkeit, passend zu seinen Gedanken. Allerdings sah er dort dann doch die Krawatten durch, und während er das tat, ging ihm auf, wie es in Wirklichkeit aussah. Campbell würde sich auch weiterhin einreden, dass sein heimlich geschriebenes Buch eine längst überfällige, hochwitzige Antwort auf die Zeiten war, in denen sie lebten – aber die Wahrheit war: Er hatte einfach nur das Geld gebraucht. Mit diesem Selbstbetrug lebte er, als schöpfe er Energie daraus, und welche Gefahren es barg, sah er nicht. Er hatte mit Männer, die in Autos weinen ein albernes und ziemlich aktuelles Thema gefunden, eines, das er sich sofort zu eigen und zunutze gemacht hatte, in der Hoffnung auf einen großen Bestseller, der ihn von all seinen Sorgen befreien würde.
»Haben Sie die auch mit schmaleren Streifen?«, fragte er den Verkäufer bei Lewin, entschied sich aber dann doch für etwas Getupftes.
Die Beschäftigung mit dem Buch hatte seine Gedanken auf die jüngere Generation gelenkt, und jetzt fragte er sich, ob dieser Schauspieler Jake Hart-Davis ihm womöglich von Nutzen sein konnte. Unterwegs war er schon halb entschlossen, geradewegs zu Oswald’s zu gehen und ihm den Vorschlag gleich dort im Club zu machen, aber dann überlegte er es sich doch anders und ging weiter in Richtung Haymarket.
Es war drei Uhr. Er setzte sich auf eine Bank am Soho Square und rauchte eine Zigarette, mit Blick auf die skurrile Statue Karls II. von Caius Cibber. Schmetterlinge umflatterten den Kopf des Denkmals, zwei Bläulinge. Er liebte London im Mai, wenn der lange, kalte Winter ganz plötzlich vorüber war. Er holte sein Telefon aus der Tasche: dreiunddreißig Mails. Alle langweilig. Er steckte sich die Stöpsel ins Ohr und tippte eine von seinen Achtbarkeits-Apps an. Er hatte vier davon: Calm, Headspace, Buddhify und ThinkUp. Allesamt Unsinn, aber er mochte Unsinn und hatte nicht vor, ihm abzuschwören, gerade jetzt, wo er doch nun bald selbst mit Lebenshilfe seinem Leben helfen würde.
Männer, die in Autos weinen. Drei Monate, dann war es in den Läden.
Es war ein guter Titel: einer, der nach Geld roch, da hatte Atticus recht.
Er nahm ThinkUp – »dein ganz persönliches positives Feedback, Motivationen für jeden Tag« – und hörte sich zehnmal hintereinander eine Aufnahme seiner eigenen Stimme an, die »Ich bin dankbar für das Gute in meinem Leben« sagte. Man konnte es mit Klaviermusik unterlegen, und es war ein schönes Gefühl, so friedlich in einem Park zu sitzen, auf einer Bank an einer Eibe schon spät im Frühling. Vor seinem geistigen Auge erschien das Idealbild einer Vase mit gelben Tulpen, und dabei verweilte er, so einfach und so frisch. Aber Campbell spürte, dass diese Blumen unerreichbar für ihn blieben, und allmählich verstand er auch, warum das so war. Etwas stimmte nicht an seinem Leben, und er spürte, wie er Schritt für Schritt auf einen Abgrund zusteuerte. Atticus hatte von dem Atlantic-Artikel als einer cause célèbre gesprochen, einem großen Erfolg, aber Campbell war klar, weswegen er ihn geschrieben hatte: weil er wusste, dass er ein Denker war, der Gefahr lief, dass ihm die Gedanken ausgingen. Jetzt mit zweiundfünfzig kam er sich als Verräter seiner Klasse vor, derjenigen, der er entstammte; als einer, der seine eigenen moralischen Prinzipien mit Füßen trat. Man kann sein Leben nicht darauf gründen, für schöne Predigten gefeiert zu werden, an die man sich selbst nie halten wird, und diese Erkenntnis war es, mit der Campbells Zweifel begonnen hatten. Er hatte immer recht unbekümmert über das Gute geschrieben, über Wahrheit und Harmonie, aber hatte er sich von diesen Dingen nicht in Wirklichkeit weit entfernt, und hatte er jetzt noch eine andere Wahl, als einen Weg zurück zu finden? Heuchler leben davon, dass sie ihre Position gegen die äußere Realität verteidigen, das wusste er, aber in diesem Jahr, in diesem Frühling, war es Campbell klar geworden, dass er das mit seinem Gewissen nicht mehr vereinbaren konnte.
Eine SMS von seiner Schwester erschien auf dem Display; er hielt die App an und setzte sich aufrechter. Es war ein Link zu einer Nachrichtenseite. »Einflussreicher Parlamentsausschuss warnt die Regierung, sie setze die Sicherheit unseres Landes aufs Spiel, wenn sie zulasse, dass Kleptokraten und Verächter der Menschenrechte die Londoner City missbrauchten, um Geld zu waschen, das sie dem Zugriff des Kremls entziehen wollen.«
Er rief seine Schwester zurück. »Ich habe nicht viel Zeit«, meldete sich Moira. »Ich bin auf dem Weg ins Parlament, zur Abstimmung. Das neue Polizeigesetz.«
»Worum geht es da?«
»Der Polizei Möglichkeiten geben, mehr Leute zu verhaften. Ein Tory-Albtraum.«
»Wo bist du gerade?«
»Portcullis House. Zu Fuß. Und du?«
»Ich bin unterwegs zum Institut. Sprechstunde.«
Moiras Standfestigkeit in moralischen Belangen beeindruckte ihn immer. So war sie schon seit ihrem zehnten Lebensjahr, zwei Jahre jünger als er; von einem Hochhaus in Glasgow aus hatte sie sich in die Kommunalpolitik eingemischt, dann war sie unter Neil Kinnock in die Labour Party eingetreten. Jetzt war sie Rechtsanwältin, focht nach wie vor den einen oder anderen Kampf um Wohnrechte, vor allem aber war sie in Westminster für ihren Wahlkreis in Ayrshire aktiv, den sie mit knapper Mehrheit hielt. Sie war »außer sich«, wie sie oft sagte, wegen der Korruption in der Londoner City, und nach ihren Begriffen waren die Kreise, in denen Campbell jetzt verkehrte, die hochrangige Gesellschaft, in die er durch Elizabeths Aristokratenfamilie gekommen war, ein bedauerlicher Begleitumstand seiner ansonsten so großartigen Ehe. Aber Campbell wusste, dass sie es ihm verzieh – sie mochte seine schriftstellerischen Arbeiten und seine Scherze, auch wenn sie an seiner Politik ihre Zweifel hegte. Er war ein liberaler Bohemien, und sie hatte den Versuch aufgegeben, ihn für ihre Sache zu gewinnen; sie wusste, dass nur ein Adelstitel ihren Bruder in den Westminster Palace locken würde. Es waren die Glasgower Sprüche, die sie beide verbanden, Erinnerungen, die in die Tiefe gingen, »zu tief für Tränen«, wie sie manchmal sagte. Im Grunde verstand das keiner, seine Schwester und dann und wann Elizabeth ausgenommen, aber Campbell hatte schlicht und einfach eine Heidenangst davor, jemals wieder in ärmliche Umstände zu geraten. Und das vertrug sich schlecht mit dem amateur de luxe in ihm, der so groß war wie die Place des Vosges.
»Hast du das gesehen? Dein Schwager muss sich auf einiges gefasst machen, wenn er nicht sehr aufpasst«, sagte Moiras Telefonstimme. »Da wartet eine Menge Ärger auf ihn.«
»Immer ran, immer ran, immer ran«, sang Campbell. »Elizabeth sagt, er hatte vermutlich schon im Mutterleib eine narzisstische Persönlichkeitsstörung.«
»Wenn sie das sagt. Jedenfalls steht er auf der Abschussliste. Halb London – die ganzen Clubs für die alten Knaben, in die du so gern gehst, die, in denen sie keine Frauen wollen – sollte besser die Ohren anlegen, für die ist die Party vorbei.«
»Dein Engagement in allen Ehren«, antwortete Campbell. »Aber du weißt es doch besser als ich, Moira. Sie verlegen die Party einfach in einen anderen Club.«
»Na, das wollen wir mal sehen«, antwortete sie.
Sie klang, als wäre sie von Neuem zehn Jahre alt.
Er genoss die Art, wie sie miteinander umgingen, das Vertrauen, das daraus sprach.
»Ich kann von Glück sagen, dass ich da raus bin«, meinte sie. »Ein Posten in dem Ausschuss wäre ein Albtraum gewesen. Es heißt auch, russisches Geld sei in Krediten an britische Einzelhändler versteckt.«
Sein Magen machte einen Hüpfer. »Und William?«
»Byre? Der Name fällt«, antwortete Moira.
Er machte sich Sorgen. Wie tief mochte sein alter Freund in diese Finanzgeschichten verstrickt sein? Und wie weit ging die Sache noch? Er brachte es nicht über sich, das zu sagen, aber alles, was mit William zu tun hatte, traf einen empfindlichen Nerv bei Campbell. Er fühlte sich in diese Finanzgeschichte verstrickt, weil er Geld von ihm geborgt hatte, und er hatte ihn gern, seinen Kumpel aus Studienzeiten und alten Saufkumpan. Und allmählich überlegte Campbell, ob es nicht auch ein schlechtes Licht auf ihn selbst, seine Einstellungen warf.
Er wechselte das Thema, griff zu etwas, das ihm das Gefühl gab, dass er wieder über den Dingen stand. »Ich habe mich zum Lunch mit meinem Agenten getroffen. Es ging um dieses neue Buch von mir, ganz auf die Schnelle geschrieben. Mirna hat mir einen Korrekturabzug geschickt, wir werfen es als Schnellschuss auf den Markt.«
»Das Rembrandt-Buch?«
»Nein, das noch nicht«, antwortete er. »Etwas anderes. Mirna ist nicht gerade begeistert. Etwas ganz Verrücktes – über die Befindlichkeiten der Männerwelt.«
»Heilige Einfalt«, staunte sie. »Ein Buch über Männer? Also … kein Kunstbuch?«
»Nur zum Spaß«, beteuerte er. »Aber trotzdem ist es vielleicht das Wahrhaftigste, was ich je geschrieben habe.«
Moira summte etwas vor sich hin, die typische Art, wie sie Zweifel anmeldete.
»Du hast ja selbst was von einem Künstler«, meinte sie dann. »Künstler überlegen immer, welchen Teil ihrer selbst sie noch vermarkten können.«
Er erzählte ihr, dass er auf der Piccadilly den Schauspieler Jake Hart-Davis getroffen hatte. »Er war mit dem jungen Bykov unterwegs, mit dem Angus und Kenzie bekannt sind.«
»Grässlich«, sagte sie. »In was für Gesellschaft sich deine Kinder rumtreiben!«
Campbell blieb einen Moment still.
»Ein gut aussehender Mann, dieser Hart-Davis, fast schon ein bisschen zu gut. Hat nicht Augustus John seine Familie gemalt?«
»Ich kenne sein Gesicht aus der Presse.«
»Er hat in Aithons Fluch mitgespielt. Dieser Serie.«
»Jetzt muss ich wirklich weiter, Campbell.«
»Okay, Moy.«
»Angus hat angerufen, es ging um deinen Geburtstag. Da sehen wir uns.«
Sie sagte immer mehrere Male »Bye«, bevor sie auflegte.
Der Frühlingsregen hatte wieder eingesetzt, ein Niesel aus fossilen Zeiten.
Er machte sich wieder auf den Weg, zur Englischen Fakultät des University College. Viele Aufgaben hatte er dort nicht, jedenfalls nicht nach normalen Maßstäben. Sein Seminar »Kultur und Identität« hatte Studenten von überallher angelockt, aber er hielt es als Vortragsreihe, keine Arbeiten zu korrigieren. Selbst an guten Tagen war das Institut wie ausgestorben, eine Art Geisterdorf; die hauptsächlichen Bewohner blieben immer in ihren Büros, in ständiger Furcht, jemand könne sie auffordern zu unterrichten, oder vielleicht waren sie auch damit beschäftigt, Anträge auszufüllen in der Hoffnung auf ein Sabbatjahr, oder sie schärften ihre Mistgabeln für den nächsten Marsch in die Stadt, vielleicht saßen sie auch an der sechsundvierzigsten Revision ihres Aufsatzes über »Immobilienhandel bei George Eliot« für das Cambridge Quarterly. Campbell hatte die Stelle in dem Glauben angenommen, er werde auf lebhafte, freimütige Kollegen treffen, und weil er sehen wollte, ob sein Realitätssinn sich gegen die Ansichten von Zwanzigjährigen noch halten konnte. Und das Geld tat ja auch nicht weh. Aber hier stand er nun in einem leeren Korridor. »Sieh dich vor«, hatte ein Freund ihm gesagt, einer, der sich in der Welt auskannte. »Professor für Gesamtausgaben oder was du da bist. König der Podcasts. Die Akademiker, die werfen einen einzigen Blick auf dich, und dann bist du ihr Feind, Mr New York Review of Books. Mr Bestseller-über-Vermeer. Die haben ihre ganz besonderen Flinten, mit denen sie Flamingos, die zu hoch fliegen, vom Himmel holen.«
Campbell nahm seine Post aus dem Fach und holte den Schlüssel hervor. Ein Plakat kündigte eine Konferenz über Christopher Marlowe an. Er näherte sich einem Grüppchen, das aussah wie Leute auf einer Party, und tatsächlich war es auch eine Art Party: Sie diskutierten über Virginia Woolf. Er hörte das Wort »posttraumatisch« und musste sich an der Wand abstützen; plötzlich waren ihm die Ohren zugeflogen. »Hallo, meine lieben Kollegen«, sagte er und drückte sich ganz an die Wand. »Lassen Sie mich nur eben durch.«
»Ah, ein Campbell Flynn. Selten zu sehen in freier Wildbahn.«
Es gibt Menschen, die fordern Satire geradezu heraus, und auf niemanden in Campbells Leben traf das mehr zu als auf Jennifer Mearns. Karminroter Bubikopf, eine Vorliebe für viktorianische Schuhe, Männerverächterin, Leiterin der Fakultät; zu sagen, dass Jennifer correctness in Person war, wäre an der Sache vorbeigegangen, an der Hauptstoßrichtung ihres Propagandistenlebens. Sie durchforstete das ganze Universum (und Archive weltweit) nach Belegen dafür, dass berühmte Schriftsteller, im Jahr 1888 und um 1888 herum, sexistische Dinge gesagt hatten. Kürzlich hatte sie sich ein weiteres Forschungsgebiet erschlossen und wandte Tage, Nächte, Wochenenden und gewaltige Mengen Forschungsgelder für die Fertigstellung eines Buches mit dem Titel Fremde Kinder auf, welches ganz der Überzeugung gewidmet war, dass James Barrie, der Verfasser von Peter Pan, ein blutrünstiger Rassist und Päderast war. Jennifer war nicht bekannt für ihren Humor. Gerüchteweise hieß es, um 1986 habe sie einmal einen Gin Tonic getrunken. Jetzt leitete sie die Arbeitsgruppe Papierkörbe, die gab es wirklich. Sie wachte darüber, dass es in keinem Büroraum mehr ein derartiges Behältnis gab. Wegwerfen war verboten (Verschwendung). »Ich hätte ja gedacht, Wegwerfen sei der Sinn und Zweck eines Papierkorbs«, hatte Campbell gesagt.
»Das schadet der Umwelt«, hatte sie geantwortet und keine Miene verzogen.
Campbell klemmte sich seine Post unter den Arm und wartete, dass das Messer gezückt wurde. »Sie werden nicht überrascht sein zu hören«, legte sie auch sofort los, »dass ich Ihren Atlantic-Aufsatz, über den alle Welt redet, empörend fand.«
»Versteht sich.«
»Mehr noch, er polarisiert, Professor Flynn.«
Es tat weh, ein Lächeln zu unterdrücken. Hinter Jennifer lag, die Tür immer offen, ihr kaltes, blitzblankes Büro, ein stahlglänzender Raum voller rechter Winkel, bar jeglichen Zierrats, insbesondere aller Textilien oder Farben.
»Ihre Kolleg:innen stecken viel ernsthafte Arbeit in ihr Bemühen, die Stereotype herauszuarbeiten, mit denen People of Colour gedemütigt werden, und dann kommen Sie daher und verspotten in Ihrer dummdreisten Manier uns, die wir uns schuldig dafür fühlen, wie unsere Institutionen diese Menschen jahrhundertelang beschämt und unterdrückt haben. Und da frage ich: Wer sind Sie, dass Sie glauben, Sie könnten Intellektuelle in den Schmutz ziehen, die himmelschreiende historische Verfehlungen anprangern?« Ihre Stimme hatte eine beachtliche Höhe erreicht. »Wenn Sie mich fragen, Ihre Diatribe ist schlecht geschrieben, ungenügend recherchiert, es fehlt jegliche Evidenz für Ihre Behauptungen, womit ich einen wissenschaftlichen Apparat meine, eine Dokumentation. Es gibt bei uns Experten für diese Fragen, Professor Flynn, und doch ziehen Sie es vor, einen Sermon zu schreiben, der aus nichts als Meinungsmache besteht, aus empörenden Ansichten, die als verantwortungsvolle Fakten posieren.«
»Verantwortungsvolle Fakten?«
»So ist es. Schämen Sie sich eigentlich nicht?«
»Doch, ich schäme mich, Jennifer. Ich darf Sie doch Jennifer nennen? Ich bin zutiefst beschämt, ja zerknirscht darüber, dass ich auf so durch und durch eigenständige Weise Gebrauch von meinem Verstand gemacht habe.«
Er ging weiter. Der junge Mitarbeiter neben ihr hatte nur kurz den kaum merklichen Anflug eines Lächelns gezeigt, das war enttäuschend. Campbell hatte intuitiv eine Zuneigung zu ihm gefasst, hauptsächlich dank eines recht gewitzten Aufsatzes: »Lappen, Ticker, Polente und Gauner: Straßenslang in Dickens’ Oliver Twist«. Aber wie alle modernen Akademiker hatte der junge Mann ein untrügliches Gespür dafür entwickelt, wo die Macht lag. Wie Ms Mearns wusste er allgemeine Gesetze so anzuwenden, als wären sie ein persönliches Anliegen – was nicht zuletzt auch dazu beitrug, dass solche Leute so gute Wachhunde waren. »Ich warne Sie zu Ihrem eigenen Guten«, schrie sie ihm noch hinterher, als Campbell schon um die Ecke zu seinem Büro bog. »Glauben Sie nicht, die Fakultät würde Sie schützen!«
Campbells Büro wirkte wie ein Zimmer in einem Club, eingerichtet von Matisse. Es gab edwardianische Wandteppiche, Bloomsbury-Lampen auf Tischen von Heal’s. Den roten Malakkateppich hatte er bei der Versteigerung der Besitztümer von Bunny Roger erworben, die grüne Teekanne in den Neunzigerjahren als Geschenk von Anne Yeats bekommen, der Tochter des berühmten Dichters. Neben dem Fenster hatte Campbell eine eigentümliche Sammlung von Teetassen aufgebaut, zierlich und blau oder mit Blumenmuster, daneben ein Stoß roter Dessertteller von Liberty. Die Wände waren bedeckt mit den Werken schottischer Kupferstecher und mit Fotografien aus dem neunzehnten Jahrhundert, dazu ein kleines Ölbild von David Wilkie. Studenten, die die freudlose Festung von Ms Mearns kannten, staunten, dass Campbells Bücherregale gelb waren, und über seinen Barwagen, von dem er ihnen – die Idee hatte er schlichtweg bei Anthony Blunt gestohlen – oft Whisky in Kristall-Tumblern anbot.
Ihm blieben noch zwanzig Minuten. Er schlitzte Briefe auf, durchweg von Verlagen, Leuten, die Festivals organisierten, oder Hassern. Was beruflich interessant war, legte er in ein Körbchen, die anderen landeten in seinem illegalen Papierkorb, dann öffnete er die Päckchen. Zwei enthielten Vorabexemplare, für die Kunstbuchverlage sich Reklamezeilen erhofften, zwei kamen von AbeBooks: ein gebrauchtes Exemplar von Ralph Ellisons Shadow and Act und eine Anthologie afrikanischer Dichtung. Die Kunstbücher stellte er ins Regal, mit den anderen beiden ließ er sich nieder. Er kam bei dem Ellison nicht viel weiter als bis zur Widmung, dann legte er die Bücher in den Schoß und blickte auf zu einem gerahmten Foto. Es zeigte seine Mutter und seinen Vater, Ende der Fünfzigerjahre, in leichten Sommerkleidern, lachend, den Kopf in den Nacken geworfen. Sie waren mit Freunden auf der Insel Man, und Campbell faszinierte an dem Bild seit jeher das ungekannte Glück, das sie in jenem Augenblick ausstrahlten.
Er holte sein Handy hervor und tippte auf eine App: Ancestry. Vor ein paar Tagen hatte er einen Link zu Gefängnisakten eines Vorfahren aus Glasgow gefunden, Francis Flynn, der vor Gericht stand, weil er auf dem Saltmarket jemanden mit einem Schüreisen erschlagen hatte. Er drehte sein Telefon, um die Aufzeichnungen von 1875 besser lesen zu können, mühte sich, die verblasste Schrift zu entziffern. Er hörte Schlüssel klimpern, schaute hinaus und sah seine Nachbarin von gegenüber, Gwenith Parry, Professorin für Biografisches Schreiben. Sie war seine Verbündete, gemeinsam lästerten sie über die Kollegenschaft.
»Und was schreibst du gerade, Gwen?«, fragte er.
»Etwas, woran ich schon seit Monaten arbeite. Ein größerer und vermutlich durch und durch nutzloser Aufsatz über Zola und Henry James.«
»Sei nicht so schrecklich produktiv.«
»Und du?«
Die Wahrheit würde er ihr erzählen, wenn die Zeit reif war. »Ich tauche wieder einmal tief in die Absurditäten des Alltags ein«, antwortete er. »Das wird noch mein Untergang.«
Er schloss die Tür und zählte bis zehn. »Die Gesellschaft sollte man an vier Ecken packen wie ein Tischtuch und in die Luft werfen«, stand auf einer Karte im Bücherregal.
Es klopfte an der Tür, und als er öffnete, sah er, dass es Milo Mangasha war, sein liebstes Ärgernis. Als Student war er unsicherer, als er wirkte, aber er verstand es, Selbstsicherheit zu spielen. Er starrte einen an, mit seinen irischen Augen und der braunen Haut, meldete schon vorab Widerspruch gegen alles an, was man über ihn denken mochte. Er besuchte nebenher Campbells Veranstaltungen, eigentlich war er Masterstudent der Informatik, und er schrieb fiebrige, ehrgeizige Aufsätze.
»Bald ist mein Geburtstag. Am Tag, an dem sie George Floyd umgebracht haben«, sagte er zur Begrüßung. Campbell bot ihm einen Stuhl an.
Seine Kopfhörer waren um den Kragen der roten Steppjacke gelegt, und Campbell fragte, was er höre. »Manche Sachen sollten Sie meiden«, antwortete der junge Mann. »Sagen Sie Nein zu algorithmisch erstellten Playlists.«
»Ich habe nie eine persönlich kennengelernt.«
»Spotify sagt Ihnen, was Sie hören sollen.«
»Verstehe.«
Er zog seine Jacke aus. »Hören Sie Musik, irgendwas in der Art? Sie müssen Ihre eigene finden, Professor. Es geht nicht nur um die Worte – Texte und so weiter –, es geht um den Versuch, den musikalischen Raum zu transformieren, zu dekolonisieren.«
»Und wenn jemand einfach nur tanzen will?«
»Klar können Sie tanzen. Sind Sie verheiratet?«
Ganz schön frech, dachte Campbell. Er hob eine Augenbraue.
In dem Mai wusste der junge Mann noch nicht viel über ihn. Deshalb fragte er so direkt, versuchte offenbar, etwas aus ihm herauszukitzeln.
Milo machte einen Kusslaut, dann senkte er den Blick. Rasend schnell bewegten sich seine Daumen über das Display seines iPhones.
»Ein Mensch wird durch das definiert, was er ablehnt, verstehen Sie?«
Alles war eine Frage.
»Dieser Kenianer, KMRU. Irrer Typ. Eigene Welt, könnte man sagen. Er macht Aufnahmen von Steinen, die in einen Brunnenschacht fallen, Drohnen über einem Blechdach, solche Sachen. Steckt das in einen Computer, und heraus kommen die coolsten Sounds, die kriegt man nicht mehr aus dem Kopf.«
Genau wie sich manches von seinen hingeworfenen Bemerkungen, die unglaublichsten Sachen, allmählich in Campbells Verstand festsetzte. Zum Beispiel: Die zwanghafte Beschäftigung mit der Frage falscher Begriffe ist eine zynische Ablenkung von der Auseinandersetzung mit dem System von Ungerechtigkeiten, das die eigentliche Macht über unser Leben hat. Oder: Virtuelle Persönlichkeit ist die Freiheit, die Sie nie gefunden haben. Etwas an diesem Ausdruck, »virtuelle Persönlichkeit«, dockte an Campbells eigene Überlegungen an, und schon seit Wochen dachte er nun darüber nach.
Campbell setzte Teewasser auf. Aus dem Aktenkoffer holte er seine Zeitung und legte sie auf den Couchtisch zwischen ihnen.
»Sobald irgendwas Schreckliches geschieht«, nahm der junge Mann nun wieder seinen Predigerton an, »wollen die Linke und die Rechte sich sofort reinwaschen, verurteilen die Schuldigen, die immer diejenigen sind, von denen sie erwarten und sich wünschen, dass sie schuldig sind. Aber die Systemfrage stellen sie nie. Die Leute würden jederzeit einen Politiker stürzen, dann spüren sie, dass sie am Leben sind, aber das System der Unterdrückung, von dem sie selbst ein Teil sind, das rühren sie nicht an – verstehen Sie, was ich meine?«
»Ich glaube schon«, antwortete Campbell.
Er war sich nicht sicher, ob Milo wirklich die Dinge so gut durchschaute oder ob er nur so tat.
»Wäre doch schön«, sagte er, »wenn die Leute in der Politik ein wenig praktischer dächten.«
Die Vorstellung gefiel Campbell. »Ja. Statt uns in Theorien zu verstricken, könnten wir die echten Probleme angehen, die Ungleichheiten. Die Pandemie zum Beispiel. Die hat auf den Punkt gebracht, wie ungerecht die Gesellschaft in diesem Land ist, und uns vor Augen geführt, wie diese Ungerechtigkeit funktioniert.«
»Das stimmt«, sagte Milo. Er stockte. »Mehr, als Sie wissen.«
Campbell hatte den Eindruck, es brachte ihn ein wenig aus der Fassung. Die zufällige Erwähnung von Corona hatte Milo in voller Fahrt gestoppt, an etwas in ihm gerührt.
»Alles in Ordnung?«
»Ja, klar, Mann, mir geht’s gut«, sagte er. »Aber ich habe Sachen gesehen.«
Manchmal kann ein junger Mensch dem jungen Menschen, der in einem selbst noch lebendig ist, eine neue Chance geben. Ein Junge aus der Arbeiterklasse, wie Campbell selbst einer gewesen war; der junge Mann wollte etwas tun, und Campbell spürte es deutlich in dieser Sprechstunde, wie der Umgang mit Jüngeren ihm neuen Mut geben könnte, ihn dazu zwingen, die Auseinandersetzung mit den Veränderungen, die ihn schreckten, in Angriff zu nehmen.
»Wie kann es sein, dass wir jetzt mit einer der höchsten Sterberaten weltweit dastehen, und keiner schämt sich dafür?«, fragte Milo. »Der Premierminister ist ein Clown, oder? Hält es für witzig, wenn er sich mit dem Bürgermeister im Weißen Hai vergleicht, der für freien Zugang zu den Stränden sorgt. Es sind schwarze Menschen, die da draußen sterben.«
»Ich glaube, die Regierung kennt ihre eigene Bevölkerung überhaupt nicht.«
»Von den Leuten, die heute in London leben, sind ungefähr vierzig Prozent nicht hier geboren. Und trotzdem heißt es Rule Britannia, als wäre alles noch wie früher.«
»Das habe ich vor Kurzem im Atlantic zu sagen versucht.«
Der Student lächelte, ein gefährliches, wissendes Lächeln, wie er es in früheren Sprechstunden schon ein- oder zweimal gezeigt hatte. »Ich merke schon, Sie sind mächtig stolz auf sich. Ich habe den Artikel gelesen. Sie gehen nicht weit genug.«
Er wurde abgekanzelt.
»Ihre akademischen Freunde denken, es gehe um die Begriffe. Sie glauben, sie müssten nur die Sprache zensieren, dann käme die ganze Welt in Ordnung.«
»Schriftsteller müssen sich entschuldigen, weil sie ein falsches Wort wählen.«
»Mir ist nie ein Mensch begegnet, der auch nur einen Scheißdreck auf so was gibt. Was die Leute merken, das ist die Korruptheit der Polizei, die Ungerechtigkeit, die materielle Not. Hier geht es um echte Veränderungen.«
Milo stand auf und musterte die Bücher im Regal und eine Reihe DVD-Boxsets. Seine raumgreifende Art wirkte immer ein wenig prahlerisch. Campbells Blick fiel auf den Ringordner, den der junge Mann auf dem Boden abgelegt hatte, und er sah, dass er mit Reitern unterteilt war. »Cybersecurity«, »Mustererkennung und neurale Netzwerke«, »Kryptowährungen«. Nichts, was mit ihm zu tun hatte, es waren Themen aus Milos eigentlichem Studium – die Abschlussprüfung stand kurz bevor –, aber Campbell fand, er sollte mehr darüber wissen. Er wollte diese fremdartigen, faszinierenden Dinge besser verstehen. Das konnte ihm bei einem Aufsatz von Nutzen sein, vielleicht später sogar bei etwas Persönlicherem.
»Irgendwie merkwürdig«, überlegte Milo. »Meine Zeit an der Uni ist jetzt fast zu Ende, und dabei komme ich mir vor, als ob … ich erst jetzt wirklich was lernen könnte. Ich will die Regeln über Bord schmeißen, ich will wissen, wie es sich in den Schuhen anderer Leute läuft.« Er senkte den Blick zum Teppich, verlegen. »Anderer Leute«, sagte er mit Nachdruck. Vielleicht war er doch furchtsamer, als er wirkte, aber er redete, ohne zu stocken, weiter, versuchte zu erklären, worum es ihm ging. »Wenn wir von Geschichten reden, gibt es keine kulturelle Aneignung«, sagte er. »Kunst existiert, schlechte Kunst existiert auch, und neues Denken existiert, genau wie altes. Ob es ein schwarzer Autor ist, der einen Weißen betrachtet, oder ein weißer Stückeschreiber, der schwarze Stimmen hört – es kommt allein darauf an, wie gut sie sind, wie frisch es ist.«
»Das ist ein sehr geistreicher Standpunkt.«
Kurz blitzte ein Lächeln auf. »Wir sind doch hier in den Geisteswissenschaften, oder?«
Aus dem könnte ein guter Lehrer werden, dachte Campbell.
»Ich habe eine Idee«, sagte Milo.
Er wollte Campbell für Suppose interviewen, die Literaturzeitschrift der Universität.
»Sicher«, stimmte er zu und schlug vor, sich am nächsten Tag in der National Gallery am Trafalgar Square zu treffen. Er schrieb Uhrzeit und Saalnummer auf einen Zettel, den er Milo im Aufstehen reichte.
»Cool«, sagte der junge Mann und griff nach seinem Ordner.
3
Thornhill Square
Mrs Voyles sehnte sich nach ein wenig Sommerwärme. Nicht, dass man sich darauf in England je hätte verlassen können, aber hoffen konnte sie doch, und wer hofft, hat noch nicht alles verloren. Der Ginkgo stand in vollem Laub. Grün und geheimnisvoll, dachte sie, wie vierzehn Tage Chinareise; sie saß auf der Bank und studierte ihn, überlegte, in wie vielen verschiedenen Gestalten sie diesen Baum schon gesehen hatte, in den vierundvierzig Jahren, die sie nun bereits an diesem kleinen Park lebte. Im Herbst glänzte er golden, die Blätter schimmerten als Lichtflecken im Dunkeln. Am liebsten mochte sie den Garten am Ende des Tages, wenn er war wie jetzt, die Büsche schwer vom Sonnenschein. Sie erinnerte sich an die Zeit, die sie als junges Mädchen in diesem Park zugebracht hatte, zusammen mit den anderen Tänzern. Damals hatten die Leute noch gewusst, wie sich aus gutem Wetter das Beste machen ließ – aber das war, bevor alles anders geworden war. Sie sah die Mädchen noch vor sich in ihren rosa Strumpfhosen, die Jungs, die sie hochgehoben und über das Gras hatten schweben lassen.
Sie kannte ihre Rechte. Das war der Satz, der Mrs Voyles am häufigsten durch den Sinn ging, und sie wiederholte ihn viele Male am Tag, meist wenn sie die Treppe von ihrer Souterrainwohnung am Thornhill Square 68 heraufkam, wo sie unkündbare Mieterin war. Sie sagte ihn noch einmal, als sie an diesem Abend auf dem Rückweg vom Park die schmale Straße überquerte und die Kette löste, aus eigener Tasche bezahlt und mehrfach um das schmiedeeiserne Tor geschlungen. Früher hatte es liebenswerte Menschen hier gegeben. Islington war damals ein ganz anderer Ort gewesen.
Sie stand noch auf ihrer Treppe, schaute zur Kirche am Nordende des Parks, da kam ein Taxi angerumpelt, hielt, und ihr Vermieter stieg aus. Hielt sich für was Besonderes, Professor Flynn. Von der Mickymaus-Akademie. Sie hätte ihm noch ein paar Dinge über Malerei und gute Bücher beibringen können. Sie hatte Stapel davon in ihrer Wohnung.
»Guten Abend, Mrs Voyles«, begrüßte er sie. »Ich sehe, Sie mühen sich immer noch mit dieser monströsen Kette ab. Ein grässliches Ding. Tausendmal habe ich Ihnen schon angeboten, ein richtiges Schloss an Ihrem Tor anbringen zu lassen.«
»Es ist nicht mein Tor, das wissen Sie genau.«
»Nun, da will ich Ihnen nicht widersprechen, Mrs Voyles.«
»Hier unten stinkt es.«
»Das würde mich nicht wundern. Sie lassen ja niemanden zum Saubermachen hinein.«
»Es sind Ihre Abflussrohre, daran liegt es. Und es gibt Ungeziefer! Das Gescharre hält mich die halbe Nacht wach, das verstößt gegen die Bestimmungen.«
»Diese Häuser sind alt, Mrs Voyles, das wissen Sie. Ich habe schon ein Dutzend Mal angeboten, die Souterrainwohnung zu renovieren, aber Sie beschweren sich ja lieber bei der Stadt. Wenn ich Handwerker schicke, jagen Sie sie weg.«
»Ich kenne meine Rechte.«
»Und ich kenne meine Pflichten.«
Mrs Voyles streckte ein Bein nach hinten aus. Jawohl, in ihrer Jugend war sie Tänzerin gewesen. Inzwischen war sie siebzig, aber sie war stolz darauf, dass sie noch immer die Treppe hinauf- und hinuntersprintete wie eine junge Gazelle. Flynn bildete sich ein, er sei anders als andere Vermieter, aber sie hatte so viele von ihnen kommen und gehen sehen, und sie waren alle gleich, mit ihren großen Fenstern, ihren »Haushaltshilfen«. »Es war ein wunderbarer Ort hier«, sagte sie, »bevor Leute wie Sie kamen, mit Ihren Landrovern.«