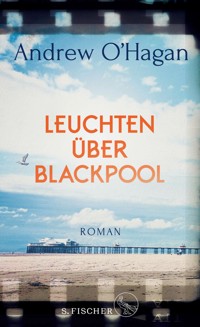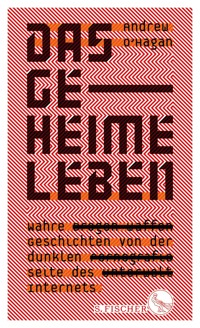
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In »Das geheime Leben« berichtet der preisgekrönte Autor und Insider Andrew O'Hagan von drei wahren wie brisanten Fällen am Rande der verschwimmenden Grenze zwischen dem Internet und der 'realen' Welt - eine spannende Reise, die in die virtuellen Abgründe und bis ins Darknet führt, beleuchtet von einem der »besten Essayisten unserer Zeit« (New York Times). Eine der Geschichten handelt vom polarisierenden WikiLeaks-Gründer Julian Assange, für dessen Autobiographie O'Hagan als Ghostwriter engagiert wurde – mit unvorhergesehenen Konsequenzen. Die Erfahrung bewegte ihn zu einem riskanten Selbstversuch, bei dem er die tatsächliche Identität eines verstorbenen Mannes benutzte, um sich selbst eine völlig neue zu erschaffen – und damit eine waghalsige Reise ins Darknet unternahm, wo alles – Sex, Drogen, Waffen – zu haben ist. Bis der Autor in die Aufdeckung von Satoshi Nakamoto, dem berühmt-berüchtigten Erfinder von Bitcoin, hineingezogen wird. O'Hagan führt uns dabei in die abgründige Welt des Webs, einer verlockenden wie gefährlichen Rutschbahn, in der eine Lüge zur Wahrheit und schützende Geheimhaltung schnell zu vorsätzlichem Betrug werden kann. »Das geheime Leben« ist furchtlose, investigative Berichterstattung und ein Meisterwerk des literarischen Journalismus. »Im Darknet stellt dir keiner Fragen. Außer wieviel Gramm Heroin du willst, und ob lieber eine M24 mit Schalldämpfer oder eine AK-47 mit verstellbarer Stahlkimme.« Andrew O'Hagan
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Andrew O'Hagan
Das geheime Leben
Wahre Geschichten von der dunklen Seite des Internets
Über dieses Buch
In »Das geheime Leben« berichtet der preisgekrönte Autor und Insider Andrew O’Hagan von drei wahren wie brisanten Fällen am Rande der verschwimmenden Grenze zwischen dem Internet und der ‚realen' Welt - eine spannende Reise, die in die virtuellen Abgründe und bis ins Darknet führt, beleuchtet von einem der »besten Essayisten unserer Zeit« (New York Times).
Eine der Geschichten handelt vom polarisierenden WikiLeaks-Gründer Julian Assange, für dessen Autobiographie O'Hagan als Ghostwriter engagiert wurde – mit unvorhergesehenen Konsequenzen. Die Erfahrung bewegte ihn zu einem riskanten Selbstversuch, bei dem er die tatsächliche Identität eines verstorbenen Mannes benutzte, um sich selbst eine völlig neue zu erschaffen – und damit eine waghalsige Reise ins Darknet unternahm, wo alles – Sex, Drogen, Waffen – zu haben ist. Bis der Autor in die Aufdeckung von Satoshi Nakamoto, dem berühmt-berüchtigten Erfinder von Bitcoin, hineingezogen wird.
O’Hagan führt uns dabei in die abgründige Welt des Webs, einer verlockenden wie gefährlichen Rutschbahn, in der eine Lüge zur Wahrheit und schützende Geheimhaltung schnell zu vorsätzlichem Betrug werden kann. »Das geheime Leben« ist furchtlose, investigative Berichterstattung und ein Meisterwerk des literarischen Journalismus.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Andrew O’Hagan, 1968 in Glasgow geboren, lebt in London. Gleich mit seinem Debüt ›Dunkles Herz‹ schaffte er es auf die Shortlist des Man Booker Prize. Seine Romane werden seitdem als Meisterwerke der Empathie gefeiert, in denen der Schotte wie kaum ein anderer mit elegantem Humor und leisem Pathos die Konturen unserer Gegenwart einfängt. Darüber hinaus hat sich der Assange-Ghostwriter und Internet-Insider mit faszinierenden Essays und spannenden Reportagen, die u.a. in »Granta«, »The Guardian« oder »The New Yorker« erschienen, einen Namen gemacht. Kein Weg ist ihm zu abseitig, kein Mittel zu unkonventionell, um mit geradezu forensischem wie unbestechlichem Blick den Dingen auf den Grund zu gehen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2017 bei Faber & Faber Ltd, London.
Copyright © Andrew O'Hagan 2017
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2017 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Das Zitat auf S. 17 stammt aus John Banvilles ›Der Unberührbare‹ und wurde übersetzt von Christa Schuenke, Kiepenheuer & Witsch.
Das Zitat auf S. 168 stammt aus Frank Herberts ›Der Wüstenplanet‹ und wurde übersetzt von Jakob von Schmidt, Heyne.
Die Zitate auf S. 279 stammen aus Allan Sillitoes ›Die Einsamkeit des Langstreckenläufers‹ und wurden übersetzt von Günther Klotz, Diogenes.
Covergestaltung: Jörg Steinmetz
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490552-5
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung/Motto
Vorwort
Geistern
Die Satoshi-Affäre
Die Razzia
Mayfair
Ninjutsu
Kleiman
Das Büro in London
Der Beweis
Die Enthüllung
Lebensrechte
Schlusssatz
Die Erfindung des Ronald Pinn
Danksagung
Für Jane Swan
Es gibt eine andere Welt, aber sie ist in dieser.
Paul Éluard
Vorwort
Wenn Sie mich fragen würden, was einen Romanautor ausmacht, würde ich antworten: Das Talent eines Romanciers ist die Fähigkeit, sich im Leben anderer Menschen auszubreiten, ohne sich darin zu verlieren. Ob in der Romanliteratur, im Essay oder im Journalismus – jeder Autor ist, mal mehr und mal weniger, ein Hersteller von Identitäten, und jede Erzählung bedeutet für ihn, eine Rolle zu spielen. Nach meiner Erfahrung haben reale Wesen kein Monopol auf Realität. In Wahrheit zeugen manche von ihnen von einem hohen Grad an Künstlichkeit, und es ist die Konvention einer jeweiligen Zeit, die Ironien, die in dieser Tatsache verborgen liegen, zu organisieren und dem Ganzen den Namen »Kultur« zu geben. Der Romancier hat unterdessen einen Vorsprung und tut gut daran, sein Notizbuch aufzuschlagen.
Als ich Norman Mailer einmal fragte, welche der Künste dem Schreiben am nächsten käme, antwortete er: »Die Schauspielerei.« Er sprach von einem grundlegenden Verlust des Egos, einem Umstand, den die meisten Leute nicht mit Mailer in Verbindung bringen würden. Doch den meisten Autoren von fiktionalen oder auch nicht-fiktionalen Texten wird der Grundsatz bekannt vorkommen. Ständig halten sie Ausschau nach einem zweiten Leben, denn sie sind überzeugt, die Aufgabe eines Schriftstellers müsse sein, sich freimütig Momenten von Selbstüberschreitung hinzugeben. Ich glaube, das ist es, worauf Scott Fitzgerald aus war, als er sagte, es könne niemals eine gute Biographie eines Autors geben, denn »wenn er etwas taugt, ist ein Schriftsteller zu viele verschiedene Personen«.
Das Internet versucht, dich kennenzulernen, es versucht, dir Dinge zu verkaufen und herauszufinden, welchen Göttern du huldigst. Aber es scheint sich nicht sonderlich dafür zu interessieren, ob du eine authentische Person bist oder nicht. Die gesamte Kultur ist sich plötzlich gewiss, dass niemand nur eine einzige Sache ist. Es mag einem erscheinen, als hätten die sozialen Medien den Geist der Zeit auf einen einzigen Werbespruch heruntergebrochen – »Sei alles, was du sein kannst« –, und die Welt wurde verwandelt in einen Markplatz der Selbstheit, einen Umschlagplatz der Identitäten.
In der Neuen Welt aus Passwörtern und Datenverschlüsselung, Profilen und Status-Updates erzählt jede Taste, die man drückt, eine Geschichte, und diese Geschichte kann die Geschichte über den sein, der du bist, aber auch einfach nur die Geschichte über den, der du gerne wärst. Sie kann von jemandem handeln, der du in deinem geheimen Leben immer schon warst, oder von jemandem, den du dir ausdenkst. Tastendruck um Tastendruck, Suchanfrage um Suchanfrage, bis er schließlich existiert. Diese Existenz ist nicht weniger überzeugend als jene von Sherlock Holmes zu seiner Zeit oder jene auf dem Gemälde »Der Christus des Heiligen Johannes vom Kreuz« von Salvador Dalí, ein Phantasiegebilde aus Licht und Schatten, das seinen Erschaffer gleichzeitig offenbart und versteckt.
Wir litten bereits an den Krankheiten des Webs, lange bevor wir verstanden, wie die Technologie unser Leben verändern würde. In gewisser Weise verteilte es unter allen Menschen die Instrumente zur Erschaffung von Fiktionen, solange sie nur Zugang zu einem Computer und Lust hatten, im tiefen Brunnen des Andersseins zu schwimmen, den das Internet für sie darbot.
J.G. Ballard prophezeite, dass der Schriftsteller keine Rolle mehr in der Gesellschaft spielen würde – bald wäre er ein überflüssiges Wesen, wie jene Figuren in russischen Romanen des 19. Jahrhunderts. »Weil die externe Wirklichkeit selbst eine Fiktion ist«, schrieb Ballard, »muss der Schriftsteller die Fiktion nicht erfinden, denn sie ist bereits überall präsent.« Und mit jedem Tag, den man im Internet verbringt, erkennt man, wie Ballards Gedanke unterstrichen wird. Durch E-Mail ist es jedem möglich, sowohl unverzüglich als auch ungesehen zu kommunizieren, entweder als man selbst oder als jemand anderes.
Es gibt 68 Millionen »erfundene« Namen auf Facebook, und viele von ihnen leben offensichtlich ein anderes, weniger gewöhnliches Leben oder zumindest ein weniger überprüfbares. Niemand weiß, wer sie wirklich sind. Die Datenverschlüsselung hat aus dem durchschnittlichen User einen Geist gemacht – ein Alias, ein Scheinbild, eine Spiegelung. Gleichzeitig ist jeder Mensch geschult in »seiner« oder »ihrer« Verbesserbarkeit, und Marketingfirmen wie Telekommunikationsunternehmen geben unsere Daten an Regierungen weiter, deren Ziel es ist, uns im Dienste der nationalen Sicherheit wieder vollständig sichtbar zu machen.
In W.H. Audens Gedicht »Das Weltalter der Angst« treffen wir auf Quant, einen Mann, der seine Reflexion im Spiegel einer New Yorker Bar betrachtet, in der er sich umgeben fühlt von einer »spaßigen Kultur«, womit er sagen will, einer »künstlichen«. Für Auden war es ein Aspekt des modernen Lebens, dass ein Mensch womöglich keinerlei Verbindungen zwischen seiner sozialen oder ökonomischen Stellung und seinem persönlichen psychischen Seelenleben erkennen könnte. Er sieht sich im Spiegel an. »Mein Doppel, mein liebes Ebenbild«, sagt er zu sich selbst, »ist es lebhaft dort in dem Land aus Glas? Schmeckt dein Selbst, wie meines, nach Lüge?« Ich muss an Audens Gedicht denken, wenn ich über die zwei Generationen nachsinne, die bisher ihre Zeit damit verbracht haben, auf das Glas ihrer Computer-Bildschirme zu schauen. Nach welchem Ort haben wir gesucht? Ist es lebhaft dort? Und sind wir süchtig geworden nach dem Geschmack, den die Lüge hat? Das Internet bietet jedem die Chance auf ein geheimes Leben, doch wie dies geschieht und wer es steuert, das war es, was mich bewog, diese Geschichten zu schreiben. Auf jedem saftigen Feld des Webs werden deine persönlichen Daten geerntet, um damit ein neurales Netzwerk zu versorgen, einen globalen Geist, und dein Lohn ist das Gefühl, dass in dir Menschen leben wie Sand am Meer.
Im Jahr 1964, 13 Jahre bevor Apple seinen ersten Heimcomputer verkaufte, begann Joseph Mitchell im New Yorker ein Profil mit dem folgenden Satz: »Joe Gould war ein seltsamer, mittelloser und arbeitsloser kleiner Mann, der 1916 in die Stadt kam, sich herumdrückte und sich über 35 Jahre lang abmühte, so gut er konnte.« Mitchell hatte für das Magazin schon 22 Jahre zuvor über Gould geschrieben, aber seine neue Story mit dem Titel »Joe Goulds Geheimnis« rief einen Nebel der Ungewissheit hervor, der das große Meisterwerk dieses Mannes umflorte: »Eine mündliche Geschichte unserer Zeit« – das Werk, an dem Gould nach eigener Aussage jahrzehntelang gearbeitet hatte. Es stellte sich heraus, dass Gould niemals wirklich mit dem Buch begonnen hatte, und es bestand ausschließlich aus leeren Seiten.
Joseph Mitchell, der all das in seinen Geschichten über Joe Gould enthüllte, hatte auch ein Geheimnis: Er hatte nie ein Wort des joyceanischen Romans über New York geschrieben, den er vorgab zu verfassen. Mitchell lebte noch mehr als dreißig Jahre, nachdem sein Joe-Gould-Text erschienen war, doch er veröffentlichte nicht ein einziges weiteres Wort. Die Konversation zwischen einem Autor und seinem Subjekt liegt manchmal, frei nach Wordsworth, zu tief für Tränen, und sie kann bedeuten, dass man auf Sätze über Wirklichkeiten und Verbindungen stößt, die für das bloße Auge unsichtbar sind.
Die Geschichten in diesem Buch wurden aus dem Wilden Westen des Internets herausgeschrieben, lange vor einer Rechtsordnung und einem Ehrenkodex, sogar lange vor grundlegend guten Manieren und lange bevor wir uns an die neuen ontologischen Strukturen gewöhnt haben. Ich nahm mir vor, Geschichten zu schreiben, die in der Lage wären, im ethischen Morast von alledem zu schwimmen, und hier sind diese Geschichten nun gesammelt.
Die klügeren Köpfe des Internets glauben, die Debatte kreise um Macht und Freiheit, und sie liegen damit nicht falsch, doch diese Freiheitskämpfe sind nicht frei von eigenen Komplikationen. Alles in allem habe ich mehrere Jahre in ihrer Gesellschaft verbracht; sie mögen es, anonym zu sein, so sehr, wie sie sich nach Berühmtheit sehnen. Sie mögen Macht. Sie mögen es, vorzutäuschen. Und die mathematischen Formeln, die sie besitzen, werden von ihnen eingesetzt, um alles zu erklären – außer sich selbst. Diese Männer befanden sich am Scheitelpunkt der Veränderung, sie waren auf dynamische Weise modern, doch sie kämpften mit Begierden und Makeln, die beständig sind – und beständig vertraut.
Eine der Freuden für einen Schriftsteller ist es, sich in der Detailfülle einer seiner Geschichten lebendig zu fühlen, und das Internetzeitalter hält einen ganz neuen Rummelplatz an existentiellen Reizen bereit. In meiner Kindheit hieß der Wanderrummel »The Shows«, und so denke ich auch von diesen Geschichten, als öffentliche Bekanntmachungen vom Rand der modernen Identität, wo eine Gruppe karnevalesker Männer im großen Zelt des Internets verbogen wird – verzerrt durch ihre Vergangenheiten, durch ihre Illusionen oder durch mich. In einer Welt, wo jeder jeder sein kann, wo echt zu sein nichts Besonderes ist, wollte ich mich an die Wurzeln der wahrhaftig menschlichen Probleme zurückarbeiten, und das ist es, was diese Geschichten antreibt, das Gefühl, dass unsere Computer noch nicht mit uns selbst identisch sind.
In einem Spiegelkabinett ist der Andere, der wir dort sind, nichts weiter als eine Sinnestäuschung.
Geistern
Am 5. Januar 2011 um 8.30 Uhr in der Früh – ich trödelte gerade etwas zu Hause herum – vibrierte mein Smartphone auf dem Sofa. Der Grund war eine SMS von Jamie Byng, dem Verleger von Canongate, der mir schrieb: »Bist du in der Nähe? Ich hab eine etwas seltsame Idee. Potentiell sehr aufregend. Aber ich möchte dringend darüber sprechen.«
Canongate hatte einen Vertrag über 600000 Pfund für ein Memoir mit dem Gründer von WikiLeaks, Julian Assange, abgeschlossen. Die amerikanischen Rechte daran wurden für eine ähnlich hohe Summe von Sonny Mehta vom Knopf-Verlag in New York gekauft, und Jamie hatte weitere Lizenzen an andere große Verlagshäuser im Ausland verkauft. Er sagte, er gehe davon aus, das Buch werde in vierzig Sprachen übersetzt.
Assange wollte sein Memoir nicht selbst schreiben. Gleichzeitig wollte er nicht mit einem Ghostwriter zusammenarbeiten, der schon eine Menge über ihn wusste. Ich erzählte Jamie, dass ich Assange im Jahr zuvor im Frontline Club gesehen hätte, als die Ersten WikiLeaks-Berichte aufgetaucht waren, und dass er mir wie ein sehr interessanter Typ vorgekommen sei, doch auch irgendwie seltsam, vielleicht sogar etwas autistisch. Jamie hatte einen ähnlichen Eindruck, aber meinte, Assanges Geschichte sei erstaunlich.
»Er wünscht sich eine Art Manifest, ein Buch, das diese große und großartige Generationsverschiebung darstellt.« Er war in Norfolk gewesen, um sich mit Assange zu treffen, und hatte vor, ihn am nächsten Tag erneut zu besuchen. Er informierte mich darüber, dass er und die Agentin Caroline Michel mich für den Job vorgeschlagen hatten und dass Assange mich gerne kennenlernen wollte. Ich wusste, dass sie auch mit anderen Autoren in Kontakt standen, und war anfangs etwas skeptisch. Es ist nicht unüblich, dass Schriftsteller Anfragen bekommen, etwas anonym zu schreiben. Inwieweit hatte Alex Haley Malcolm X geschützt, als er als dessen Ghostwriter auftrat und seine Autobiographie schrieb? In welchem Umfang war Ted Sorensen für die rhetorische Haltung von John F. Kennedy verantwortlich, als er dessen Zivilcourage schrieb, jenes Buch, für das der zukünftige Präsident den Pulitzer-Preis gewann? Und sind die Science-Fiction-Stories, die H.P. Lovecraft für Harry Houdini ergeistert hat, nicht das Beste, was er je schrieb? Eine Duftnote von alledem läge auch über dem seltsamen Fall des Julian Assange. Doch es schwelt noch etwas anderes über diesem Genre, nämlich ein Gefühl, dass die heutige Welt, mehr als zu irgendeinem anderen Zeitpunkt der Geschichte, so wirken mag, als ob sie vollkommen durchspukt wäre von Ghostwritern. Ist Wikipedia nicht ausschließlich das Werk von Geisterschreibern? Trifft auf die Hälfte von Facebook nicht dasselbe zu? Ist das World Wide Web ein neuer Äther, in dem wir alle verfolgt sind von Ghostwritern?
In der Vergangenheit hatte ich über vermisste Personen und über das Phänomen der Berühmtheit geschrieben, über Geheimnisse und Konflikte, und mir war von Beginn an klar, dass diese Story ein Insiderjob sein könnte. Wie auch immer es dazu kommen würde und wie auch immer ich die Assange-Story ans Licht locken oder modulieren würde, sie würde gut passen zu meiner Neigung, an der brüchigen Grenze zwischen Fakt und Fiktion zu wandeln, um auszuloten, wie porös die Parameter zwischen Person und Persona wirklich sind. Ich erinnerte mich an Victor Maskell, den Kunsthistoriker und Spion in John Banvilles Der Unberührbare, der gerne Diderot zitiert: »Im Grunde errichten wir nur eine Statue nach unserem eigenen Bild in uns – idealisiert, verstehen Sie, aber doch erkennbar –, und dann bemühen wir uns ein ganzes Leben lang verzweifelt, ihr ähnlich zu werden.«
Die Tatsache, dass die WikiLeaks-Story sich vor dem Hintergrund einer globalen Diskussion über Privatheit, Geheimnis und den Missbrauch militärischer Macht entfaltete, ließ mich glauben, dass, wenn jemand seltsam genug sein sollte, sich dieser Geschichte anzunehmen, ich dies sei.
Am nächsten Abend um halb sechs besuchte mich Jamie in meiner Wohnung, zusammen mit einem Kollegen aus dem Lektorat namens Nick Davies. (Warnung für die geistige Gesundheit: In dieser Geschichte gibt es zwei Männer namens Nick Davies. Dieser hier arbeitete für Canongate; der Zweite ist ein bekannter Reporter des Guardian.) Sie waren gerade mit dem Zug aus Norfolk zurückgekommen. Jamie erzählte, dass Assange sich mit einem Baumstamm oder etwas Ähnlichem am Auge verletzt und deshalb während der dreistündigen Besprechung mit geschlossenen Augen vor den beiden gesessen habe.
Sie würden das Buch für April ankündigen, das den Titel tragen sollte: WikiLeaks versus the World: My Story von Julian Assange. Sie teilten mir mit, ich bekäme einen gewissen Prozentsatz der Tantiemen aus allen Lizenzländern und Assange sei damit einverstanden. Wir sprachen zunächst über den Vertrag, und im Anschluss ging Jamie detaillierter auf Sicherheitsprobleme ein. »Bist du darauf gefasst, dass dein Telefon von der CIA abgehört wird?«, fragte er und fügte dann hinzu, dass Assange darauf bestehe, dass das Buch auf einem Laptop ohne Internetverbindung geschrieben würde.
Als ich in Ellingham Hall ankam, schlief Assange fest. Seit gegen ihn ein internationaler Haftbefehl aus Schweden wegen Verdachts auf Vergewaltigung vorlag, lebte der WikiLeaks-Gründer dort im Haus von Vaughan Smith, einem seiner Bürgen und Gründer des Frontline Clubs. Er stand gewissermaßen unter Hausarrest und trug eine elektronische Fußfessel am Knöchel. Jeden Nachmittag musste er auf der Polizeiwache in Beccles vorstellig werden, um zu beweisen, dass er in der Nacht nicht abgehauen war. Assange und seine Mitarbeiter schoben Hacker-Schichten: Die ganze Nacht wach bleiben und den halben Tag lang schlafen – ein kleiner Einblick in das Durcheinander, das bald den Zirkus charakterisieren würde, den ich gerade betrat. Ellingham Hall war ein zugiges Country House mit ausgestopften Hirschköpfen, die die Wand der Eingangshalle zierten. Das Esszimmer war übersät mit Laptops. Sarah Harrison, Assanges persönliche Assistentin und Partnerin, trug einen Wollpullover und zupfte sich ständig ihre Löckchen aus dem Gesicht. Eine andere junge Frau, vielleicht eine Spanierin oder Südamerikanerin, kam ins Wohnzimmer, wo ein Feuer brannte. Ich stand am Fenster und schaute nach draußen auf die hohen Bäume.
Sarah machte mir eine Tasse Tee, die mir von der anderen jungen Frau zusammen mit einem Teller Schokoladenkekse gebracht wurde. »Ich versuche ständig, mir neue Tricks einfallen zu lassen, um ihn aufzuwecken«, sagte sie. »Die Putzhilfe kommt immer rein, ohne anzuklopfen. Das ist das Einzige, was ihn aufweckt.« Kurz darauf kam Assange in einem Anzug und Socken durch die Tür getappt.
»Tut mir leid, dass ich zu spät bin.« Er schien amüsiert und skeptisch zugleich – eine angenehme Kombination, dachte ich, und es fanden sich schon einige Anzeichen der verrückten Unprofessionalität, die noch kommen würde. Er sagte, die Sache, die ihm Sorgen bereite, sei, wie schnell das Buch fertiggestellt werden müsste. Es würde nicht einfach werden, eine geeignete Struktur zu finden. Er fügte hinzu, dass er vielleicht bald im Gefängnis sein könnte, aber dass sich dieser Umstand durchaus eignen würde, das Buch zu schreiben. »Meine Gedanken sind etwas abstrakt. Und dazu habe ich eine Meinung über Zivilisation und Geheimhaltung, die dokumentiert werden muss.«
Er hoffte, es käme etwas dabei heraus, das sich so läse wie Hemingway. »Wenn Leute ins Gefängnis kommen, die sonst vielleicht nie irgendwas geschrieben hätten, und dann anfangen zu schreiben – was sie dann schreiben, kann spannend und grandios sein. Ich würde das niemals öffentlich sagen, aber Hitler hat Mein Kampf auch im Gefängnis geschrieben.« Er gestand zu, dass es sich dabei nicht um ein gutes Buch handelte, aber es wäre nicht geschrieben worden, wenn man Hitler nicht eingesperrt hätte. Dann sprach er von Tim Geithner. Der Finanzminister der USA sei beauftragt worden, Firmen daran zu hindern, durch subversive Organisationen zu profitieren. Das bedeute, dass Knopf für die Publikation des Buches unter Beschuss geraten würde.
Ich fragte ihn, ob er schon einen vorläufigen Titel habe, und er sagte mit einem Lachen: »Ban This Book: From Swedish Whores to Pentagon Bores«. Es war interessant zu sehen, wie er mit einer Vorstellung von sich selbst als öffentlicher Figur oder sogar als Rock-Star parierte, während all die Aktivisten, die ich je gekannt hatte, immer dazu neigten, sich selbst als marginalisierte und möglicherweise exzentrische Figuren zu betrachten. Mehrere Male deutete er an, dass Leute verrückt nach ihm waren. Mir jedoch gelang es nicht, die Coolness und das Charisma, die er für selbstverständlich hielt, an ihm auszumachen. Er sprach ausschweifend über seine »Feinde«, hauptsächlich der Guardian und die New York Times.
Assanges Verhältnis zum Guardian, von dem er scheinbar besessen war, ging zurück zu seiner ursprünglichen Bereitschaft, der Zeitung die Militärdokumente des Afghanistankrieges zur Veröffentlichung zu überlassen. Sehr schnell zerstritt er sich mit den Journalisten und Herausgebern der Zeitung – im Wesentlichen wegen Fragen von Macht und Besitzansprüchen –, und zu der Zeit, als ich ihn traf, fühlte er sich von ihnen »betrogen«. Es war ein frühes Anzeichen dafür, was er unter »Zusammenarbeit« verstand: Die Leute des Guardian waren Feinde, weil Assange ihnen etwas »gegeben« hatte und sie nicht nach seiner Pfeife tanzten, während die Daily Mail beinahe noch dafür respektiert wurde, obwohl man ihn dort vollkommen verabscheute. Der Guardian versuchte, ihn zu besänftigen: Alan Rusbridger, der Herausgeber der Zeitung, zeigte Verständnis für Assanges Position, wie es auch der damalige stellvertretende Herausgeber Ian Katz und andere taten. Dennoch, Assange sprach von den Journalisten der Zeitung in den abfälligsten Tönen. Der Guardian beharrte auf der Ansicht, dass die Geheimdokumente editiert werden müssten, um Informanten und Unbeteiligte zu schützen, die darin genannt wurden. Julians persönliche Haltung dazu war widersprüchlich. Ich war nie der Meinung, dass er andere in Gefahr bringen wollte, aber dennoch stempelte er die Besorgnis des Guardian als »Feigheit« ab.
Sein Verhältnis zur New York Times war nicht minder vergiftet. Er war der Meinung, ihr Herausgeber Bill Keller sei fest entschlossen, ihn als »Quelle« und nicht als Mitarbeiter zu betrachten – was auch die Wahrheit war –, und dass Keller ihn am langen Arm verhungern lassen wollte – was nicht die Wahrheit war. Keller verfasste einen langen Artikel in seinem Blatt, in dem er Assange einen schmutzigen, paranoiden, unzuverlässigen Kontrollfreak nannte, der nicht ganz bei Verstand war, was Julian natürlich das Gefühl gab, sein früherer Mitstreiter sei nun ein Widersacher. Doch beide Zeitungen hatten in Übereinstimmung mit anderen ungeheuer viele Seiten ausschließlich den Leaks gewidmet und WikiLeaks als Quelle des Materials auf die Titelseiten gebracht. Ich hatte immer geglaubt, die Beteiligung der New York Times würde Assange vor dem Gefängnis bewahren, und das glaube ich bis heute. Selbst die US-Behörden erkennen an, dass es unmöglich wäre, Assange zu verurteilen, ohne auch Keller und Rusbridger für schuldig zu erklären. Aber anstatt das anzuerkennen, betrachtete Julian, die beiden Männer auf persönlicher Ebene als Heuchler oder etwas noch Schlimmeres.
Er besaß eine seltsame, am Ende des psychotischen Spektrums angesiedelte Unfähigkeit, zu erkennen, ob er sein Gegenüber langweilte oder überforderte. Er sprach, als ob die Welt ihm unbedingt zuhören müsste und als ob sie hoffte, er würde niemals aufhören zu reden. Was für einen Dissidenten seltsam war: Er hatte keinerlei Fragen. Die Linken, die ich gekannt hatte, platzten immer vor Fragen, doch Assange wirkte vom ersten Moment an wie ein zu Fleisch gewordener hyperventilierender Chatroom. Mir wurde deutlich: Wenn ich in dieser ganzen Sache zu einem Geist werden würde, wäre ich letztlich vielleicht der am wenigsten geistergleiche.
Er ging »unserem Buch« aus dem Weg. Er wollte von des anderen Büchern über ihn sprechen, die kurz vor ihrer Veröffentlichung standen.
»Es gibt dieses Buch von zwei Typen vom Spiegel«, sagte er. »Die sind mir gegenüber freundlich, aber das Buch wird neue Anschuldigungen beinhalten. Es wird aufgeblasener sein als die andern.« Er sprach über ein weiteres Buch, das David Leigh und Nick Davies, zwei Journalisten des Guardian, herausbringen würden. Er schien wie besessen von den beiden. »Der Guardian hat die Organisation eigentlich auf die übelste Weise hintergangen. [Der Guardian bestreitet dies.] Wir haben ihnen eine ganze Reihe diplomatischer Berichte als Pfand hinterlassen – als Sicherheit für den Fall, dass einer von uns einen Kopf kürzer gemacht wird –, und sie haben von den Daten Kopien angefertigt. Sie waren dagegen, dass ich andere Medienhäuser einbeziehe, und stattdessen haben sie die Daten selbst an die New York Times und andere geleaked. Sie haben sich einfach widerwärtig verhalten. Davies ist bekannt dafür, dass er einen persönlichen Groll gegen mich hat.«
»Warum?«
»Weil er ein alter Mann ist, der letztlich am Ende seiner Karriere steht. Er kann es nicht ertragen, dass eine frühere Quelle, die er zu seinem Vorteil genutzt hat, nicht mehr für ihn zur Verfügung steht. Er hat einen Schmähtext über mich geschrieben, und niemand aus der Chefetage des Guardian wäre auch nur auf die Idee gekommen, ihm dabei ein Bein zu stellen.« Assange nannte Ian Katz jemanden, der in dieser Hinsicht versagt habe, und erwähnte, dass das Verhalten des Guardian vermutlich in dem Spiegel-Buch aufgedeckt werden würde und dass die Reporter des Guardian deshalb Interesse daran hätten, ihre eigene Version darzulegen. »Sie haben ein Buch geplant, das zum Zeitpunkt meiner gerichtlichen Anhörung veröffentlicht werden soll, um mir aufs Schlimmste zu schaden.«
»Das ist doch unmöglich«, sagte ich mit Unverständnis. »Würden sie die Anhörung nicht abwarten? Der alten Zeiten wegen?«
»Sie machen Witze!«
Er sagte, das dritte Buch stamme von seinem früheren Kollegen und ehemaligen Sprecher von WikiLeaks, Daniel Domscheit-Berg. »Das wird eine völlige Verunglimpfung. Der Typ ist motiviert durch seinen Hass auf uns, und er wird alles dafür tun, dass das Buch so schädigend wie möglich daherkommt.«
»Peinlich oder schädigend?«
»Wahrscheinlich beides. Er hat Zeug aus Chatrooms … Unterhaltungen.«
»Zwischen Ihnen allen?«
»Ja«, sagte er. »Er hat früher schon einmal eine Unterhaltung veröffentlicht, darüber, dass er suspendiert worden ist. Er hat von der Unterhaltung alles veröffentlicht, außer die Teile über seine Suspendierung. Es ist auch ein Buch von den Journalisten der New York Times in Arbeit und weitere kleinere Sachen. Aber auch die werden Schaden anrichten, weil sie einfach die schlimmsten Anschuldigen nachbeten.«
Ich hatte nie eine Person gekannt, die so sehr für eine gute Sache stand und dabei einen so schlechten Ruf hatte; auch hatte ich noch nie den Leiter einer Organisation kennengelernt, der eine so unerschöpfliche Fähigkeit besaß, sich über seine Feinde den Kopf zu zerbrechen und einem dabei ins Gesicht zu gähnen. Ich fragte ihn, was er glaube, wie der Gerichtsprozess für ihn ausgehen würde. »Ich habe, würde ich sagen, eine 40-Prozent-Chance, freizukommen«, sagte er. »Wenn sie mich am 6. Februar freisprechen, verlasse ich sofort das Land, weil ich hier gleich wieder festgenommen werden würde und weil die US-Regierung entschlossen sein wird, auf meine Auslieferung zu drängen. Ich würde lieber in einem Land leben, das kein Auslieferungsabkommen mit den USA hat, wie zum Beispiel Kuba oder die Schweiz. Viele Leute in den USA würden mich gerne mit einem Loch im Kopf sehen. Es gab einen Bericht in der Washington Times mit einem Foto von mir, wo mein Gesicht im Fadenkreuz ist und Blut aus meinem Hinterkopf fließt.«
Julian schlug vor, ich könne ihn doch zur Polizeistation in Beccles begleiten. Wir gingen nach draußen und warteten, bis Sarah den Wagen geholt hatte. Als ich neben ihm stand, dachte ich, dass sich seine Widersprüche vielleicht als Vorteil für das Buch herausstellen könnten. Ich verstand, dass er Probleme hatte, aber er konnte auch witzig sein, und ich mochte ihn. »Ich würde gern aus einem dieser Ställe ein Büro machen«, sagte er plötzlich lächelnd und deutete auf eine der Scheunen des Hofes. »Und ein Buch wurde geboren im Stall.«
»Keine Chance, irgendwo in Norfolk drei Weisen und eine Jungfrau zu finden«, sagte ich. Er machte einen weiteren Witz über Norfolk, wie ortsansässige Sozialarbeiter Akten abstempelten mit »N.F.N.« – »Normal für Norfolk«. Er rief die Polizeistelle an und informierte sie, dass er auf dem Weg sei. Er hatte zwei Telefone auf seinem Schoß liegen, aber er beantwortete keines der beiden selbst.
Ein französischer Journalist war uns in seinem Wagen gefolgt, doch wir konnten ihn auf dem Weg abhängen. Vor der Polizeistation hielt Sarah den Wagen an und sagte: »Soll ich mir die Ehre geben?« Ich schaute zu, wie sie ausstieg und die Büsche durchsuchte.
»Guckt sie nach Paparazzi?«, fragte ich.
»Schön wär’s«, sagte Julian.
»Was denn dann?«
»Attentäter.«
Ich sagte, meine Motivation das Buch zu schreiben, beruhte auf auf reinem Interesse, eben nur weil es mich reizte, eine Geschichte richtig auszufeilen und im Verlauf der Arbeit etwas dazuzulernen. Ich glaubte, ich hätte eine Form von künstlerischer Freiheit, da ich nicht der Künstler war, dessen Name auf dem Cover stand. Ich teilte Jamie mit, dass mein Name nirgends im Buch auftauchen sollte und dass ich keine Interviews geben oder auch sonst auf irgendeine Weise über das Projekt sprechen würde. Ich würde nicht zum WikiLeaks-Sprecher werden oder mich in Newsnight vor die Kamera setzen oder für die Zeitungen irgendein Gerücht bestätigen. Ich wollte, dass die Arbeit für sich selbst spräche. Mir wurde versichert, dass diese Abmachung in Ordnung gehe, und Julian war einverstanden.
Am Montag, dem 17. Januar 2011, fuhr ich nach Norfolk. Es war dunkel und nieselig, als ich in Ellingham Hall ankam. Ich hielt den Wagen an und zog mich mitten auf einer Landstraße um, streifte einen Kapuzenpullover über, während Hasen durchs Scheinwerferlicht hoppelten. Ich wurde gewarnt, dass überall Journalisten wären, und tatsächlich waren überall in den Feldern Lichter zu sehen, und manchmal hörte man Helikopter. Ich betrachtete die Auffahrt, wie sie ins Vollmondlicht getaucht war, und es fühlte sich beinahe ulkig filmisch an – eine seltsame, technologische Verzerrung von Jane-Austen-Romanen, Charakter wie Macht kurz vor der Entzündung. Schemenhaft ruhte das Haus im Nebel, und ich schickte Sarah eine SMS, um ihr mitzuteilen, dass ich in zwei Minuten da sei.
Die Küche war nicht ungewöhnlich: ein blauer Aga-Herd, Doppelspüle, ein Landhaustisch, überall Teller. Auf dem Aga-Herd stand ein warmes Knoblauchbrot und auf dem Tisch eine kleine Schüssel Tomatensalat. Durch die Tür, die zum Wohnzimmer führte, konnte ich Stimmen mit amerikanischem Akzent hören und dazwischen eine australische Stimme, die von Assange. An den Wänden des Esszimmers hingen viele Gemälde, aufgehängt an Messingschienen. Auf einem der Gemälde war ein Gentleman aus dem 19. Jahrhundert zu sehen. Später fand ich heraus, dass es sich um einen Vorfahren von Vaughan Smith handelte, der das Anwesen vergrößerte, nachdem er in den Besitz eingeheiratet hatte. Vaughans Vater war rotwangig und steckte in Uniform. Julian erzählte mir später, dass das weiße Objekt, das er in der Hand hielt, eine Diplomatentasche war.
Es wurde gerade etwas gefilmt. Es wurde zu jeder Zeit irgendetwas gefilmt oder darüber geredet, dass gedreht werden würde, was äußerst seltsam war für Menschen, die sich als Leute in einem Versteck betrachteten.
»Wollen Sie etwas lesen?«, fragte Sarah. »Ich hab’ viele Ihrer Bücher oben.«
Die Fernsehcrew arbeitete fürs amerikanische Fernsehen und drehte für die Sendung 60 Minutes eine Dokumentation über WikiLeaks. Ich hörte Assange sagen, das hier sei sein goldener Käfig – dasselbe hatte er einige Tage zuvor auch zu mir gesagt. Während er sich weiter mit dem Interviewer im Wohnzimmer beschäftigte, nahmen Sarah und ich in der Küche zusammen einen Drink. Sie erzählte mir, sie käme aus South London und arbeite seit letztem Juli für die Organisation. Sie sprach die Vergewaltigungsvorwürfe an und verwarf sie als das »allerdickste Klischee«: »Wir haben mit Angriffen vom Pentagon gerechnet, aber nicht mit diesen Diffamierungen, die auf zwei Wochen in Schweden aufbauen.« Sie meinte, es sei bizarr, was die Schweden als Vergewaltigung ansähen, aber dass manche ihrer Freunde nicht verstünden, wie sie nur für WikiLeaks arbeiten könnte, eben wegen dieser Anschuldigungen, die sie selbst für verrückt hielt. Sie fragte mich nach meinem Job, und wir sprachen über den Autorenberuf.
»Ich hatte gedacht, ich käme viel rum durch diesen Job«, sagte sie mit einem Lachen. »Stattdessen sitze ich seit letztem Oktober in einem Haus in der englischen Einöde fest.«
Um zehn nahmen wir am Tisch Platz, um zu Abend zu essen. Vaughan leistete uns Gesellschaft, holte gebackene Kartoffeln und Lasagne aus dem Ofen, die von einer Haushälterin vorbereitet worden waren. Wir führten eine ausgelassene Unterhaltung über Filmrechte, und sie alberten alle herum, wer sie in einer Verfilmung spielen sollte. Vaughan war am meisten mit der Frage beschäftigt, ob die Produktionsfirma das Haus zum Filmen mieten würde. Ich erzählte ihnen von Battle Bridge Road, dem Haus in King’s Cross, wo ich in meinen Zwanzigern gelebt hatte und das andauernd als Filmset verwendet worden war. Ich erzählte von dem Tag, als ein Film über Oswald Mosley gedreht wurde und sie die Schlacht in der Cable Street in unserer Straße filmten. Die Hippies, die in der Nähe Häuser besetzt hatten, dachten, die Revolution hätte begonnen, und stürmten auf die Straße, um sich der Meute anzuschließen.
»Wer ist Mosley?«, fragte Julian.
Als wir anfingen, über das Buch zu sprechen, war ich bemüht, ein Gespür für die verschiedenen Elemente zu entwickeln, aus denen die Geschichte bestand, um darüber nachdenken zu können, wie sie am besten zu einem Gesamtbild zusammengesetzt werden könnten. Ich sagte, vielleicht könnte man an eine Erzählsituation denken, in der zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart gewechselt würde.
»Was halten Sie von Anna Karenina?«, fragte Assange. »Mir hat es einfach zu viel Lebenszeit geraubt. Aber dann gibt es da diese eine Szene, wo der Hund anfängt zu sprechen, und da dachte ich, ja, jetzt ergibt es langsam etwas Sinn.«
Ich war der Auffassung, dass wohl die größte Überraschung für Leser sei, herauszufinden, dass das Buch weder auf eine reißerische noch auf eine verteidigende Art geschrieben worden war, sondern auf eine völlig aufrichtige.
»Vielleicht sollte es experimentell sein«, entgegnete er. »Also vielleicht hätte Kapitel eins nur ein Wort, Kapitel zwei dann zwei Wörter …«
»Das wirklich Innovative«, sagte ich, »wäre darin, die Beziehung zwischen Individuum und Staat zusammenzufassen, so wie sie Ihnen in Ihrer heutigen Position erscheint.«
»Aber ich bin noch keine abgeschlossene Person«, sagte er.
»Es ist das Buch, das Sie heute schreiben können.«
Assange wollte, dass das Buch so wäre wie Thomas Paines Die Rechte des Menschen.
Mir fiel auf, dass er ziemlich häufig mit seinen Fingern aß. In Magazinen liest man oft, dass er nichts esse, aber er genehmigte sich drei Portionen Lasagne und aß sowohl die Ofenkartoffel als auch die Crème caramel mit seinen Händen. Nachdem er zunächst äußerst offen und ausgelassen war, wurde er nun abweisend und auf eine gewisse Weise abgestoßen. Etwa um Mitternacht, während Sarah und er sich noch weiter unterhielten, nahmen die beiden ihre MacBooks hervor, öffneten sie und fingen an zu tippen. Ihre Gesichter waren auf eine gespenstische Weise angeleuchtet. Nach einem Moment schrie Sarah auf.
»Was ist los?«, fragte ich.
»Verdammte Scheiße.« Sie sah zu Assange rüber.
»Was?«, fragte er.
»Der Guardian hat das hier aus dem Kommuniqué über Tunesien gestrichen«, sagte sie.
»Lies vor, was sie gestrichen haben«, sagte er.
Sie las zwei Sätze über einen abgesetzten Präsidenten vor, der außerhalb des Landes eine Krebstherapie über sich ergehen ließ.
»Sie nehmen sie raus«, sagte sie.
Julian zog ein Gesicht. »Die sind widerwärtig.«
»Warum machen sie das?«, fragte Sarah. Julian meinte, sie hätten offensichtlich Angst, verklagt zu werden.
»Das kann doch nicht sein«, entgegnete Sarah. »Britische Gerichte«, sagte er.
Assange verhielt sich immer so, als wäre er durch »Nachbearbeitungen« in die Defensive geraten.
Die Lage war folgende: Am 28. Juli 2010 ließ Major General Campbell, ein US-Commander in Afghanistan, verlauten: »Wann immer irgendein Leak von Geheimmaterial besteht, ergibt sich daraus eine potentielle Bedrohung des militärischen Personals, das hier draußen jeden Tag seine Arbeit macht.« Dieser Gedanke bereitete einer Menge von Leuten Unbehagen, auch vielen Journalisten, die zu den Leaks arbeiteten, und es machte sich ein Gefühl breit, dass WikiLeaks vermeiden müsse, »über Leichen zu gehen«. Assange hatte eine Reihe von Antworten auf die Frage, wie das geleakte Material »nachbearbeitet« werden sollte. Manchmal schien er anzudeuten, dass jede Art von Eingriff in die Dokumente falsch wäre, auch wenn er eingestand, dass für WikiLeaks noch einiges zu tun wäre, was die Frage von Nachbearbeitungen anging. Er bestritt, jemals gesagt zu haben – so wie von anderer Seite berichtet worden war –, dass die Namen von Informanten nicht geschwärzt werden dürften und dass sie es verdient hätten »zu sterben«. Wieder und wieder kam er auf diese Ansichten zu sprechen, doch die Interviews, die ich mit ihm geführt habe, stecken voller Widersprüche. Und entsetzlichen Wüsten der Langeweile.
Eines Abends fuhr ich gegen zehn Uhr zum Haus, und Julian redete etwa drei Stunden ohne Pause. In einem Moment wirkte er beinahe ergriffen, als er von »Verrätern« sprach. Sein Monolog war bei Domscheit-Berg angelangt. Auf eine gewisse Weise war es ihm unmöglich, sich vorzustellen, dass eine andere Person eine Ansicht über ihn oder über sich selbst haben könnte, die nicht im Einklang war mit der von Julian Assange.
»Jede gute Geschichte braucht einen Judas«, sagte er und: »Fast jeder ist ein verdammter Wichser.« Er sprach von anderen Leuten, mit denen er zusammengearbeitet hatte, und war der Meinung, es würde anders werden, was seine Zusammenarbeit mit mir anginge. (Ich war mir nie ganz sicher, dass das so war, wenngleich ich es hoffte.)
»Sie haben die künstlerische Kontrolle über dieses Buch«, sagte er. Ich antwortete, dass ich der Meinung sei, das Buch könnte eine Ergründung des Phänomens ›Enthüllung‹ werden, eine Reflexion über den Unterschied zwischen Geheimnissen politischer Art einerseits und der Jagd nach obszönen Details über das Privatleben von Leuten andererseits.
Das Buch, sagte ich, sollte in jeder Hinsicht enthüllend sein, aber auch aufrichtig, was Enthüllung selbst angehe. Wenn er sich zu einem wichtigen Thema nicht äußern könnte – zum Beispiel zu seinem Sohn oder dem Sorgerechtsstreit oder was immer im Bett mit den beiden Schwedinnen geschehen war –, dann sollten wir in einer Aussage über Anrüchigkeit erklären, warum er schweigen musste. Ich sagte, wir sollten nicht unsere Augen verschließen und hoffen, die Leute würden es nicht bemerken. Die losen Enden in einem moralischen Sinne zusammenzuführen – das war die große Rätselaufgabe dieses Projekts, und er war damit einverstanden, dass ich sagen könnte, was geschehen war.
Am Mittwoch, dem 19. Januar, regnete es den ganzen Tag. Ich machte mir langsam Gedanken über die Zeitverschwendung. Ich konnte nicht verstehen, warum sie alles so langsam und träge angingen. Sie sprachen ständig über den Druck der Arbeit, darüber, wie beschäftigt sie seien, doch im Vergleich zu den meisten Journalisten saßen sie die Hälfte des Tages auf ihren Ärschen. Julians Lieblingsbeschäftigung war es zu verfolgen, was Leute – besonders seine »Feinde« – im Internet über ihn schrieben. Als ich ihm sagte, ich würde mir eher die Eier abschneiden, als mich zu googeln, präsentierte er einen edelgesinnten Grund, der mir erklären sollte, warum es für ihn so wichtig war zu wissen, was andere Leute über ihn sagten.
Am selben Abend sprach ein Mitarbeiter von Al Jazeera mit der Gruppe von WikiLeaks. Die Gruppe bestand meistens nur aus Sarah, die im Haus lebte, und einem freundlichen Wunderkind Mitte zwanzig namens Joseph Farrell, der ein und aus ging. Ein anderer Typ, ein Aktivist und Wissenschaftler der Canberra University, trank Wein und sprach darüber, wie man die Welt mobilisieren könnte. Es stellte sich heraus, dass der Mitarbeiter von Al Jazeera die Hoffnung hatte, mit WikiLeaks ein Geschäft abzuschließen – das heißt mit Assange. Er bot ihm 1,3 Millionen Dollar an, um mittels Verschlüsselungscodes Zugang zu den Daten zu bekommen. Auch plante er, in Katar eine Konferenz zum Thema Pressefreiheit zu organisieren.
Auf dem Tisch standen russische Zigaretten, und jeder ging abwechselnd zum Rauchen nach draußen. Julian bevorzugte Zigarren. Sarah übernahm während der Verhandlungen des Al Jazeera-Deals meistens das Ruder – einmal wurde es recht hitzig –, aber Julian ging dazwischen, und schließlich wurde alles unterzeichnet, auch wenn wir nicht wussten, ob das Geld tatsächlich geflossen war oder ob irgendein Teil des Materials von Al Jazeera verwendet wurde. Der Mann aus Canberra riet jedem, sie sollten Verbindungen mit den neuen Anarchisten in Paris aufbauen, die ganz genau Bescheid wüssten, wie schlecht sich die französische Regierung in Bezug auf ihre ehemaligen Kolonien verhalten hätte.
»Es wäre gut, mehr Erfolg in Frankreich zu haben«, sagte Julian.
Kristinn Hrafnsson, ein investigativer Reporter aus Island und ein Sprecher für WikiLeaks – er schien die weitreichende Auslese von Assanges alten Freunden überlebt zu haben –, saß neben mir und hatte seinen Laptop geöffnet vor sich stehen. Er drehte ihn zu mir und zeigte mir eine E-Mail von David Leigh vom Guardian. Leigh war gerade in der Vanity Fair mit der Aussage zitiert worden, Assange habe »kein Geld und keine Leaks mehr«. In der E-Mail wollte Leigh zwei Punkte für sein Buch klarstellen. Zum einen ging es um ein Dating-Portal im Internet, dessen Mitglied Assange einst gewesen war. Zum anderen fragte er nach der Identität von Assanges Vater. Zum Abschluss seiner E-Mail schrieb Leigh, er wolle »gerecht« sein und dass er das wirklich ernst meine.
»Was für ein mieser Schwanzlutscher«, sagte Julian. »Was denkt der denn, mit wem er’s zu tun hat?«
Es war nicht das erste Mal, dass ich feststellen musste, wie ungeheuer feindselig WikiLeaks seinen Freunden gegenüber eingestellt war. Julian betrachtete seine Unterstützer als Gegenstände, und er lernte nichts daraus, wenn sie sich von ihm abwandten. Er sprach kaum von der konservativen Presse, die ihn als Verbrecher und Verräter bezeichnete: Er konzentrierte all seine Energie auf jene Journalisten, die versucht hatten, mit ihm zusammenzuarbeiten, und die eine grundlegende Sympathie für seine politische Position hatten. In einem Bankschließfach habe ich dutzende Stunden von aufgezeichneten Interviews mit Assange, in denen er auf manische Weise gegen den Guardian und die New York Times herzieht. Nach vielen dieser langen Nächte stellte ich mir manchmal die Frage, ob das Projekt nicht näher an die Fiktion heranreiche, als ich gedacht hätte. Vor meinen Augen zerbrach er den Olivenzweig, welchen diejenigen ihm gereicht hatten, die er verachtete.
Ich sammelte meine Papiere zusammen und ging mit Assange ins Esszimmer. Nach einer kurzen Weile kam Sarah hinzu. Ich wollte die Struktur des Buches besprechen. Julian meinte, wir sollten darüber nachdenken, ein Kapitel mit dem Titel »Frauen« einzufügen.
»Ich dachte, das Ganze wäre wie ein Manifest«, sagte Sarah.
Julian schnaubte ganz leicht. Sie waren ein richtiges Pärchen: Sie flirteten und stritten sich und hatten Geheimnisse. »Ist es auch«, sagte er, »aber dazwischen sind immer auch persönliche Dinge eingewoben.«
»Ich finde nur …«
»Mach dir keine Sorgen darüber.«
»Aber …«
»Mach dir keine Sorgen.«
Sie wandte sich zu mir. »Er hat derartig entsetzliche und obszöne Frauengeschichten gehabt, das würden Sie nicht glauben. Ich hab’ keine Lust, das alles zu hören.«
»Moment mal«, sagte er.
»Nein. Sorry. Ich finde, das ist es nicht, worum es in dem Buch geht – deine Geschichten, wie du mit Frauen geschlafen hast.«
Er wollte wieder über Nick Davies reden, den Reporter des Guardian, der mit ihm an dem ersten Zeitschriften-Deal gearbeitet hatte, um die Leaks zu veröffentlichen. »Das Problem war, dass er sich in mich verliebt hatte«, behauptete Julian. »Nichts Sexuelles. Einfach nur verliebt. Als wär’ ich dieser junge Kerl, der er gerne sein würde.« Dasselbe sagte er von der isländischen Politikerin und Aktivistin Birgitta Jónsdóttir: »Sie war in mich verliebt.«
Von dem Moment an war mir klar, dass jede Betrachtung seiner Person seinen Narzissmus mit einbeziehen müsste. »Ich bin in ein Pub im Dorf gegangen«, sagte er, »und während ich da war, haben sich die Leute dort das Maul über mich zerrissen. Einer von ihnen sagte: ›Die Mädels im Dorf werden sich freuen.‹«
»Hast du mich vermisst?«, fragte Julian, als ich von einem kurzen Trip nach London zurückkam. Er aß zwei Riegel Violet Crumble (die australische Antwort auf Crunchie). Ich sagte, es habe Spekulationen in den Medien über meine Beteiligung gegeben, dass alles ziemlich kompliziert für mich sei und dass es mir schwerfalle, E-Mails von Freunden oder Leuten, die ich seit Jahren kannte, nicht zu beantworten und Gerüchte nicht klarstellen zu können.
»Na ja, du kannst ja einfach mich vorschieben«, sagte Julian.
»Das war nicht die Abmachung«, entgegnete ich. »Ich arbeite anonym. Es macht keinen Sinn, wenn es anders läuft.«
Sarah klickte auf ihrem Laptop herum. »Das ist ziemlich gut«, sagte sie. »Ich hab’ dir grade 20000 Pfund für eine Stunde Interview per Skype beschafft.« Das Interview war für eine Gruppe von Firmenchefs.
»Das ist nicht viel«, meinte Julian.
»Wie undankbar.«
»Na ja, wenn Tony Blair – ein Kriegsverbrecher – 120000 Pfund nachgeschmissen kriegt, sollte ich mindestens ein Pfund mehr bekommen als er.«
»Willst du, dass ich ihnen noch mal schreibe und sage, dass du mehr Geld willst?«
»Ja«, sagte Julian.
Später war er am Telefon und versuchte Alan Dershowitz – »der ultra-zionistische Anwalt aus Amerika« – davon zu überzeugen, WikiLeaks in einem Rechtstreit mit der US-Regierung zu unterstützen. Es ging um den Versuch der amerikanischen Regierung, den Twitter-Kanal der Organisation zu beschlagnahmen.
»Es ist ein guter politischer Schachzug, wenn wir Dershowitz bekommen«, sagte Julian. »Auch, wenn wir ihn später wieder verlieren. Die Mitte-rechts-Fraktion in den USA wird darauf reagieren, dass er für uns kämpft.«
Ich betrachtete mir derweil das Gästebuch von Ellingham Hall. Am 29. November 2010 hatte Assange darin eine unterzeichnete Nachricht hinterlassen:
»Meine Freunde und ich haben heute versucht, der Welt die moderne Geschichte zu schenken.«
Dies war einen Tag nachdem WikiLeaks damit begonnen hatte, 251287 geleakte diplomatische Geheimdokumente der US-Botschaften zu veröffentlichen – die größte Menge geheimer Dokumente, die jemals an die Öffentlichkeit drang. Ich wollte eine Menge Dinge über seine Kindheit besprechen und verschriftlichen, aber er verbrachte die Nacht damit, wegen der neuen Ausgabe von Panorama überzuschnappen. Es war so, als hätte der Reporter John Sweeney eine »Prügelattacke« ausgearbeitet. Wenn Assange mit etwas Derartigem konfrontiert wurde, rastete er aus.