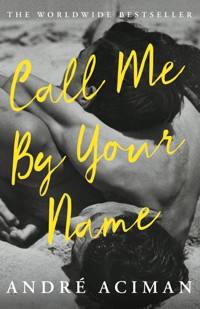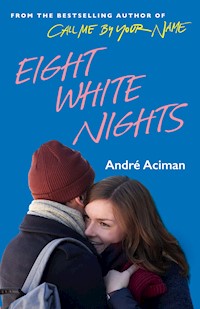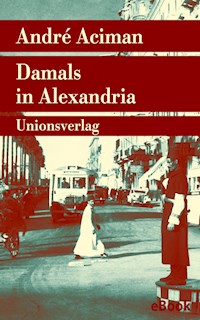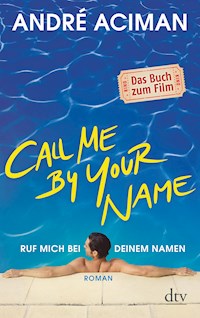
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: dtv Literatur
- Sprache: Deutsch
Das Buch zum OSCAR-prämierten Film Völlig überraschend trifft Elio seine erste große Liebe: Der Harvard-Absolvent Oliver ist für sechs Wochen bei Elios Familie an der italienischen Riviera zu Gast. Oliver ist weltgewandt, intelligent und schön. Er ist alles, was Elio will, vom ersten Moment an. Die Zuneigung ist gegenseitig, doch Schüchternheit und Unsicherheit veranlassen beide zur Zurückhaltung. Ein fast unerträgliches Spiel von Verführung und Zurückweisung beginnt. »Ein wunderschönes und kluges Buch … ein Wunder.« Colm Tóibín
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 365
Veröffentlichungsjahr: 2018
Sammlungen
Ähnliche
André Aciman
Call Me by Your Name
Ruf mich bei deinem Namen
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Renate Orth-Guttmann
Völlig überraschend trifft Elio seine erste große Liebe: Der Harvard-Absolvent Oliver ist für sechs Wochen bei Elios Familie an der italienischen Riviera zu Gast, wo er an einem Buch über Heraklit arbeitet. Oliver ist weltgewandt, intelligent und schön – er ist alles, was Elio will, vom ersten Moment an. Die Zuneigung ist gegenseitig, doch Schüchternheit und Unsicherheit veranlassen beide zur Zurückhaltung. Ein fast unerträgliches Spiel von Verführung und Zurückweisung beginnt. In einem kurzen Sommer zwischen Begehren und Verzweiflung, Obsession und Angst suchen zwei Menschen nach dem Augenblick der absoluten Erfüllung.
Für Albio, alma de mi vida
ERSTER TEILWenn nicht später, wann dann?
Später!« Das Wort, die Stimme, die Attitüde.
Ich hatte noch nie erlebt, dass sich jemand mit einem »Später!« verabschiedete – kurz, schroff, wegwerfend, als könnte er nur mit Mühe verbergen, wie wenig ihm daran lag, den anderen je wieder zu sehen oder zu sprechen.
Es ist das erste, was mir einfällt, wenn ich an ihn denke, und ich habe es bis heute im Ohr: »Später!«
Ich schließe die Augen, spreche das Wort und bin nach so vielen Jahren wieder in Italien, gehe die baumbestandene Auffahrt hinunter, sehe ihn aus dem Taxi steigen, bauschiges, flatterndes Hemd, weit geöffneter Kragen, Sonnenbrille, Strohhut, viel, viel Haut. Mit einem Mal schüttelt er mir die Hand, übergibt mir seinen Rucksack, holt das übrige Gepäck aus dem Kofferraum, fragt, ob mein Vater zu Hause ist.
Vielleicht begann es schon in diesem Augenblick: Das Hemd, die aufgekrempelten Ärmel, die gerundeten Fersen, die sich immer wieder aus den abgetragenen Espadrilles heben, neugierig auf den warmen Kiesweg zu unserem Haus, und mit jedem Schritt schon fragen: Wo geht’s hier zum Strand?
Der diesjährige Sommergast. Wieder einer dieser Langweiler.
Dann winkt er, fast ohne nachzudenken und mit dem Rücken schon zum Taxi, mit der freien Hand und wirft einem Fahrgast, mit dem er sich vermutlich den Fahrpreis vom Bahnhof geteilt hat, ein nachlässiges »Später!« zu. Ohne einen Namen anzufügen, ohne die rüde Verabschiedung mit einem Scherzwort zu mildern. Entlassen mit einem einzigen Wort, frech, forsch, ungeschminkt – fass es auf, wie du willst, ist mir egal.
Genau so, dachte ich, wird er sich von uns verabschieden, wenn die Zeit gekommen ist. Mit einem harsch hingeworfenen »Später!«
Bis dahin würden wir es sechs lange Wochen mit ihm aushalten müssen.
Ich war gründlich eingeschüchtert. Einer von der unnahbaren Sorte.
Aber einer, an dem ich durchaus Gefallen finden konnte – von dem gerundeten Kinn bis zur gerundeten Ferse. Nach nur wenigen Tagen sollte ich ihn hassen lernen.
Und das war der Mann, der mir aus dem Foto seines Bewerbungsschreibens förmlich entgegengesprungen war und augenblickliche Übereinstimmungen verheißen hatte!
Meine Eltern nahmen junge Akademiker als Sommergäste auf und gaben ihnen damit die Möglichkeit, in Muße ihre Manuskripte für eine Veröffentlichung vorzubereiten. Ich musste deshalb im Sommer regelmäßig für sechs Wochen mein Schlafzimmer räumen und in einen wesentlich kleineren Raum umziehen, in dem früher mein Großvater gewohnt hatte. Wenn wir im Winter in der Stadt waren, wurde er vorübergehend zum Werkzeugschuppen und Lagerraum umfunktioniert, zu einer Rumpelkammer, in der, wie man munkelte, mein Großvater und Namenspatron noch im ewigen Schlaf mit den Zähnen knirschte. Aufenthaltskosten entstanden den Sommergästen nicht, sie konnten sich frei im ganzen Haus bewegen und im Grunde tun und lassen, was sie wollten – unter der Bedingung, dass sie täglich eine Stunde meinem Vater bei seiner Korrespondenz und anderem Papierkram halfen. Früher oder später gehörten sie zur Familie, und nach fünfzehn Jahren Erfahrung auf diesem Gebiet hatten wir uns an die Flut von Postkarten und Geschenksendungen gewöhnt, die uns nicht nur zur Weihnachtszeit, sondern das ganze Jahr über von Menschen zugeschickt wurden, die unserer Familie innig zugetan waren und keinen Umweg scheuten, um für ein, zwei Tage, wenn sie in Europa waren, mit Frau und Kindern in B. Station zu machen und eine nostalgische Besichtigung ihrer alten Bude vorzunehmen.
Beim Essen saßen häufig zwei oder drei weitere Gäste mit am Tisch, Nachbarn oder Verwandte oder auch Kollegen, Anwälte, Ärzte, die Reichen und Berühmten, die auf dem Weg zu ihren Sommerhäusern meinem Vater einen kurzen Besuch abstatteten. Hin und wieder öffneten wir unser Esszimmer sogar einem Touristenpärchen, das von der alten Villa gehört hatte, nur mal einen Blick hineinwerfen wollte und überwältigt war, wenn es eingeladen wurde, mit uns zu speisen und ausgiebig von sich zu erzählen, während Mafalda trotz denkbar kurzer Vorwarnung das Essen in gewohnter Güte auftischte. Mein Vater, der selbst zurückhaltend, ja schüchtern war, kannte nichts Schöneres, als einen jungen, aufstrebenden Experten auf dem einen oder anderen Gebiet in mehreren Sprachen das große Wort führen zu lassen, während sich in der heißen Sommersonne nach ein paar Glas rosatello die unvermeidliche Nachmittagsträgheit über die Zuhörer senkte. Wir nannten dieses lästige Ritual die Mittagsplage – und es dauerte nicht lange, bis die meisten unserer Sommergäste den Ausdruck übernommen hatten.
Vielleicht begann es bald nach seiner Ankunft, bei einer jener strapaziösen Mahlzeiten, als er neben mir saß und ich sah, dass seine Handflächen – trotz der leichten Bräune von einem kurzen Aufenthalt in Sizilien im Frühsommer – die gleiche Farbe hatten wie die helle weiche Haut seiner Sohlen, der Hals, die Unterarme an den Stellen, an die nicht viel Sonne kam. Fast ein helles Pink, glatt und glänzend wie ein Eidechsenbauch. Intim, züchtig, unberührt, wie verlegene Röte auf dem Gesicht eines Athleten oder ein Sonnenuntergang nach einem Gewitter. Es verriet mir Dinge über ihn, nach denen ich nie zu fragen gewagt hätte.
Vielleicht begann es in jenen endlosen Stunden nach dem Lunch, wenn alle nur in Badesachen im Haus und draußen faul herumlagen und die Zeit totschlugen, bis jemand den Vorschlag machte, zum Schwimmen an die Klippen herunterzugehen. Verwandte, Vettern, Nachbarn, Freunde, Freunde von Freunden, Kollegen, praktisch alle, denen es einfiel, bei uns anzuklopfen und zu fragen, ob sie unseren Tennisplatz benutzen könnten – alle waren herzlich bei uns willkommen, um zu faulenzen, zu schwimmen, zu essen, und wenn sie lange genug blieben, das Gästehaus zu nutzen.
Oder vielleicht begann es am Strand. Oder auf dem Tennisplatz. Oder auf jenem ersten Spaziergang an seinem ersten Tag, als man mich gebeten hatte, ihm das Haus und die Umgebung zu zeigen und ich ihn durch das alte schmiedeeiserne Tor über das große unbebaute Gelände im Hinterland bis zur stillgelegten Bahnstrecke führte, die einmal B. und N. verbunden hatte. »Gibt es irgendwo auch einen stillgelegten Bahnhof?«, fragte er, in der sengenden Sonne durch die Bäume spähend und offenbar bemüht, dem Sohn des Hausherrn die passende Frage zu stellen. »Nein, einen Bahnhof hat es nie gegeben. Die Bahn hielt auf Zuruf.« Der Zug interessierte ihn. Die Spur sei erstaunlich schmal, fand er. Es sei ein Zug mit zwei Waggons gewesen, erklärte ich, die das königliche Wappen trugen. Jetzt wohnten seit langem Zigeuner darin. Als meine Mutter hier als junges Mädchen den Sommer verbracht hatte, waren sie schon da. Die Zigeuner hatten die beiden Waggons von den Gleisen weg weiter ins Land hinein gezogen. Wenn er sie sehen wollte …? »Später. Vielleicht.« Höfliches Desinteresse, als hätte er meinen unangebrachten Eifer, sich bei ihm einzuschmeicheln, durchschaut und mich kurzerhand abblitzen lassen.
Aber es traf mich.
Stattdessen sagte er, dass er in einer Bank in B. ein Konto eröffnen und dann die Übersetzerin aufsuchen wolle, die sein italienischer Verlag engagiert hatte.
Ich beschloss, ihn mit dem Fahrrad hinzubringen.
Das Gespräch gedieh im Fahren nicht besser als im Gehen. Zwischendurch machten wir Halt, um etwas zu trinken. Die bar-tabaccheria war stockfinster und leer. Der Besitzer war dabei, mit einer starken Ammoniaklösung den Boden zu wischen. Wir flüchteten schleunigst wieder an die frische Luft.
Eine einsame Amsel auf einer Pinie sang ein paar Töne, die sofort vom Lärmen der Zikaden übertönt wurden. Ich nahm einen tiefen Schluck aus einer großen Flasche Mineralwasser, reichte sie ihm und trank dann abermals. Ein wenig Wasser schüttete ich mir in die Hand, benetzte mir das Gesicht und fuhr mir mit den nassen Fingern durchs Haar. Das Wasser war nicht kalt genug, nicht prickelnd genug und hinterließ eine Ahnung von Durst.
Was man hier so mache, wollte er wissen.
Nichts. Man wartet darauf, dass der Sommer zu Ende geht.
Und im Winter?
Ich musste über die Antwort lächeln, die mir auf der Zunge lag. Er erriet, worauf ich hinauswollte. »Sag nichts. Man wartet darauf, dass es wieder Sommer wird.«
Wie schön, dass jemand meine Gedanken lesen konnte. Er würde das mit der Mittagsplage schneller durchschauen als seine Vorgänger.
»Im Winter wird es hier sehr grau und dunkel. Wir kommen nur über Weihnachten her, die übrige Zeit ist es eine Geisterstadt.«
»Und was macht ihr zu Weihnachten außer Kastanienrösten und Eierpunschtrinken?«, frotzelte er.
Wieder lächelte ich. Er begriff, sagte aber nichts. Wir lachten.
Womit ich mich beschäftige, wollte er wissen. Mit Tennisspielen. Schwimmen. Ausgehen. Joggen. Musik transkribieren. Lesen.
Ich jogge auch, sagte er. Morgens in aller Frühe. Wo man hier laufen könne. Hauptsächlich über die Promenade. Ich sei gern bereit, es ihm zu zeigen.
Es war ein Schlag ins Gesicht, gerade jetzt, wo ich anfing, ihn wieder zu mögen. »Später vielleicht.«
Ich hatte das Lesen zuletzt genannt, weil ich mir sagte, dass es, so launenhaft und eigenwillig, wie er sich gab, für ihn bestimmt am Schluss der Liste stehen würde. Nach ein paar Stunden fiel mir ein, dass er gerade ein Buch über Heraklit geschrieben hatte und Lesen vermutlich einen nicht unwesentlichen Teil seines Lebens ausmachte. Ich würde einen geschickten Rückzieher machen müssen, um ihm zu signalisieren, dass meine Interessen sich mit seinen deckten. Doch was mich gründlich aus dem Takt brachte, waren nicht die kunstreichen Klimmzüge, die nötig gewesen wären, um mich in ein besseres Licht zu rücken, sondern die unbehagliche Erkenntnis, dass ich die ganze Zeit vergeblich versucht hatte, ihn für mich einzunehmen.
Als ich ihm dann anbot – weil alle Gäste bisher begeistert darauf eingegangen waren –, in San Giacomo mit ihm auf den Campanile zu steigen, der bei uns nur Zum-Sterben-schön hieß, erwies es sich als Fehler, dass ich mich nicht mit einer passenden Antwort gewappnet hatte. Mit diesem Blick auf die Stadt, auf das Meer, auf die Ewigkeit werde ich ihn rumkriegen, dachte ich, aber was ich mir einhandelte, war nur ein weiteres »Später!«
Vielleicht begann es aber auch irgendwann danach und von mir unbemerkt. Du siehst einen Menschen und siehst ihn doch nicht wirklich, weil er in den Kulissen steht. Oder du nimmst ihn zur Kenntnis, aber nichts funkt, nichts knistert, und ehe du gewahr wirst, dass da jemand ist oder etwas dir die Ruhe raubt, sind die sechs Wochen vorbei, die dir geboten wurden, und er ist entweder schon fort oder im Aufbruch – und du mühst dich, mit etwas zu Rande zu kommen, was sich unter deinen Augen seit Wochen zusammenbraut und alle Symptome dessen aufweist, was du dir wohl oder übel als ein Ich will dich! eingestehen musst. Warum habe ich das nicht erkannt, fragst du dich. Ich weiß sehr wohl, was Begehren ist, aber diesmal war es mir entgangen. Ich hatte mich auf das vieldeutige Lächeln kapriziert, das unvermittelt sein Gesicht erhellte, wenn er meine Gedanken las, dabei sehnte ich mich die ganze Zeit nach Haut, nur nach Haut.
An seinem dritten Abend bemerkte ich beim Essen, wie er mich fixierte, während ich Erläuterungen zu den Sieben letzten Worten unseres Erlösers am Kreuz von Haydn gab, dem Werk, das ich gerade transkribierte. Ich war siebzehn und hatte mir angewöhnt, als der Jüngste am Tisch und somit derjenige, dem man am wenigsten zuhörte, in ein Mindestmaß an Sätzen möglichst viele Informationen zu packen, die ich in einem nervösen, gehetzten Wortschwall von mir gab. Als ich meine Erklärung beendet hatte, spürte ich, dass der aufmerksamste Blick mich von links traf, was ich schmeichelhaft fand. Das Thema interessierte ihn offensichtlich – er mochte mich. Es war also gar nicht so schwierig gewesen. Aber als ich mich nach einer angemessenen Pause schließlich zu ihm umwandte, begegnete ich einem eiskalten Funkeln, das fast etwas Grausames hatte.
Es machte mich völlig fertig. Womit hatte ich das verdient? Ich wollte, dass er wieder nett zu mir war, mit mir lachte wie noch vor wenigen Tagen an der stillgelegten Bahnstrecke – oder als ich ihm am gleichen Nachmittag erzählt hatte, B. sei die einzige italienische Stadt, in der die corriera, die regionale Buslinie, die Christus befördert hatte, ohne Aufenthalt durchfuhr. Er hatte gelacht und die verdeckte Anspielung auf den Roman von Carlo Levi sofort erkannt. Mir gefiel, dass unsere Gedanken parallel zu laufen schienen, dass einer sofort erfasste, mit welchem Wort der andere spielte, sich aber im letzten Augenblick zurückhielt.
Er würde ein schwieriger Hausgenosse werden. Am besten hältst du Abstand, sagte ich mir. Beinahe wäre ich schon der Haut seiner Hände verfallen, seiner Brust, den Füßen, die noch nie eine raue Oberfläche berührt hatten – und seinem Blick, der einem, wenn er freundlicher auf einem ruhte, wie das Wunder der Auferstehung vorkam. Nicht sattsehen konnte man sich an diesem Blick und musste doch immer wieder hinschauen, um herauszubekommen, warum man es nicht schaffte, von ihm zu lassen.
Ich muss seinen Blick ähnlich böse erwidert haben.
Zwei Tage lang kamen unsere Gespräche fast völlig zum Erliegen.
Auf dem langen Balkon vor unseren Zimmern mieden wir uns geflissentlich, beschränkten uns auf ein Hallo, guten Morgen, schönes Wetter – seichtes Geplapper.
Dann kamen ohne eine Erklärung die Dinge wieder in Gang.
Ob ich heute früh mit ihm joggen wolle? Nein, eigentlich nicht. Na schön, dann vielleicht schwimmen?
Der Schmerz, den ich heute empfinde, das Anschleichen, der Kitzel bei der Begegnung mit einem neuen Menschen, die Verheißung einer zum Greifen nahen Glückseligkeit, das ungeschickte Bemühen um Personen, die ich womöglich falsch verstanden habe, nicht verlieren will und auf Schritt und Tritt neu deuten muss, die verzweifelten Listen, die ich anwende, wenn ich jemanden begehre und von ihm leidenschaftlich begehrt werden will, die Trennwände, die ich aufstelle, als seien die Schiebetüren zwischen mir und der Welt nicht mit einem einzigen Blatt Reispapier, sondern mit ganzen Schichten bespannt, der Drang, zu verschlüsseln und zu entschlüsseln, was eigentlich von Anfang an unkodiert war – all das begann in dem Sommer, als Oliver zu uns ins Haus kam. Es ist jedem Song aufgeprägt, der in jenem Sommer ein Hit war, jedem Roman, den ich während seines Besuchs und danach las, allem, allem – vom Duft des Rosmarins an heißen Tagen bis zu dem hektischen Lärmen der Zikaden am Nachmittag, Gerüchen und Geräuschen, mit denen ich aufgewachsen war, die ich von klein auf kannte, die sich jetzt aber gegen mich wandten.
Oder vielleicht begann es nach der ersten Woche, als ich beglückt erkannte, dass er noch wusste, wer ich war, dass er mich nicht ignorierte und ich mir deshalb den Luxus erlauben durfte, auf dem Weg in den Garten an ihm vorbeizugehen, ohne so tun zu müssen, als bemerkte ich ihn nicht. Wir joggten an jenem ersten Morgen bis B. und zurück. Am nächsten Morgen gingen wir schwimmen. Am Tag darauf joggten wir wieder. Ich lief gern an dem Milchwagen vorbei, der um diese Zeit seine Runde noch lange nicht beendet hatte, an Lebensmittelgeschäft oder Bäckerei, die gerade erst aufmachten, ich lief gern am Strand entlang und über die Promenade, wenn dort alles noch menschenleer war und unser Haus wie eine ferne Fata Morgana wirkte. Ich liebte den Gleichtakt unserer Sohlen, die gleichzeitig den Boden berührten und Abdrücke im Sand hinterließen, zu denen ich am liebsten zurückgekehrt wäre, um heimlich meinen Fuß in seine Spur zu setzen.
Diesen Wechsel von Laufen und Schwimmen hatte er sich in seiner Studienzeit angewöhnt. Ob er auch am Sabbat joggen gehe, fragte ich im Scherz. Er trainiere immer, sagte er, auch wenn er krank sei, notfalls im Bett. Selbst wenn er nachts mit jemandem geschlafen habe, sei am nächsten Morgen Joggen angesagt. Mit einer Ausnahme: Nach seiner Operation. Als ich ihn fragte, weshalb er sich operieren lassen musste, traf mich die Antwort, die ich nie mehr hatte provozieren wollen, wie der Hieb eines boshaft grinsenden Schachtelteufels. »Später.«
Vielleicht war er außer Atem und mochte nicht viele Worte machen oder wollte sich einfach aufs Schwimmen oder Laufen konzentrieren. Vielleicht war es nur seine Art, auch mich dazu anzuhalten, also etwas völlig Harmloses.
Trotzdem – die jähe Distanz, die sich manchmal völlig unerwartet zwischen uns auftat, hatte etwas Erschreckendes, ja Entmutigendes. Es war fast so, als ließe er absichtlich die Leine locker und immer lockerer, nur um sie dann mit einem Ruck zu straffen und damit jeden Schein von Gemeinsamkeit zunichtezumachen.
Immer wieder war da dieser harte Blick wie an jenem Nachmittag, als ich an »meinem« Tisch im Garten Gitarre übte und er daneben im Gras lag. Ich hatte mich auf das Griffbrett konzentriert, und als ich unvermittelt den Kopf hob, weil ich wissen wollte, ob ihm gefiel, was ich spielte, war er da: Schneidend, grausam, wie ein funkelndes Messer, das in dem Moment zurückgezogen wird, da sein Opfer es erblickt. Er lächelte mir vage zu, als wollte er sagen: Sinnlos, es jetzt noch zu verstecken.
Bleib ihm vom Leibe.
Er muss mein Erschrecken bemerkt haben, und um mich zu versöhnen, stellte er mir Fragen nach der Gitarre. Ich war zu verklemmt, um unbefangen zu antworten, und als er mein Gestotter hörte, vermutete er wohl, dass mehr dahintersteckte, als ich sagen wollte. »Schenk dir die Erklärung. Spiel’s einfach noch mal.« »Ich dachte, du kannst es nicht leiden.« »Wie kommst du denn darauf ?« Wir stritten hin und her. »Komm, jetzt spiel endlich.« »Dasselbe?« »Dasselbe.«
Ich stand auf, ging ins Wohnzimmer und ließ die Terrassentüren offen, damit er hören konnte, wie ich das Stück auf dem Klavier spielte. Er ging mir ein Stück weit nach und blieb dann, an den hölzernen Türrahmen gelehnt, lauschend stehen.
»Du hast es verändert. Es ist nicht dasselbe. Was hast du gemacht?«
»Ich habe es nur so gespielt, wie Liszt es gespielt hätte, wenn er sich einen Jux damit hätte machen wollen.«
»Also jetzt spiel es bitte noch mal, sei so gut.«
Seine geheuchelte Ungeduld machte mir Spaß. Ich fing noch einmal an.
Nach einer Weile: »Nicht zu fassen – das klingt ja wieder anders!«
»Nicht sehr. So hätte Busoni es gespielt, wenn er Liszts Version verändert hätte.«
»Kannst du nicht einfach den Bach so spielen, wie Bach ihn geschrieben hat?«
»Aber Bach hat nie für die Gitarre geschrieben und dieses Stück vielleicht nicht mal fürs Cembalo. Streng genommen wissen wir noch nicht mal genau, ob es von Bach ist.«
»Schon gut, vergiss es.«
»Okay okay, reg dich nicht auf«, sagte ich, meinerseits widerstrebende Zustimmung mimend. »Hier kommt der Bach, transkribiert von mir, ohne Busoni und Liszt. Ein sehr früher Bach, seinem Bruder gewidmet.«
Ich wusste genau, welche Passage ihn so angerührt hatte, und schickte sie ihm nun jedes Mal als kleines Geschenk, eine lange Kadenz nur für ihn.
Wir hatten uns – und er muss die Zeichen lange vor mir erkannt haben – auf einen ausgewachsenen Flirt eingelassen.
Abends schrieb ich in mein Tagebuch: Ich dachte, du kannst es nicht leiden, habe ich gesagt und gemeint: Ich dachte, du kannst mich nicht leiden. Ich hoffte, du würdest mich vom Gegenteil überzeugen, und vorübergehend hast du das ja auch geschafft. Warum werde ich dir das morgen früh nicht mehr glauben?
Auch so kann er also sein, sagte ich mir, nachdem ich erlebt hatte, wie er von Eiszeit auf Sonnenglut umgeschaltet hatte.
Genauso gut hätte ich fragen können: Schalte ich ebenso hin und her?
P. S. Wir sind nicht für ein einziges Instrument komponiert – ich bin es nicht, und du bist es auch nicht.
Ich war bereit gewesen, mich damit abzufinden, dass er schwierig und unnahbar war und ich ihn ein für allemal würde abschreiben müssen. Zwei Worte von ihm – und mein apathisches Schmollen hatte sich gewandelt in ein Ich spiele alles für dich, bis du sagst, ich soll aufhören, bis es Zeit zum Mittagessen ist, bis meine Finger bluten, weil ich so gern etwas tun möchte, weil ich alles für dich tun würde, sag nur ein Wort, ich mochte dich von Anfang an, und auch wenn ich mir mit neuerlichen Annäherungsversuchen nur eisige Kälte einhandle, werde ich nie vergessen, dass wir dieses Gespräch hatten und dass es gar nicht so schwer ist, im Schneesturm den Sommer zurückzuholen.
Dabei vergaß ich allerdings zu vermerken, dass klirrende Kälte und Apathie die unangenehme Eigenschaft haben, auf der Stelle alle in sonnigeren Momenten abgeschlossenen Waffenstillstandsverträge und guten Vorsätze zunichte zu machen.
Dann kam jener Sonntagnachmittag im Juli, als unser Haus sich unvermittelt leerte und wir allein zurückblieben, jener Nachmittag, an dem mir Feuer durch den Leib schoss – denn »Feuer« war der erste und unkomplizierteste Begriff, der mir einfiel, als ich am gleichen Abend beim Tagebuchschreiben versuchte, mir über den Vorfall Klarheit zu verschaffen. Ich hatte in meinem Zimmer gewartet, in einem trancegleichen Zustand von Schrecken und Vorfreude an mein Bett gefesselt. Das war kein Feuer der Leidenschaft, kein Verheerungen anrichtender Brand, sondern lähmend wie das Feuer von Streubomben, die den Sauerstoff um sich herum ansaugen, so dass du nur noch nach Luft schnappst, denn du hast einen Tritt in den Bauch bekommen, ein Vakuum hat dein Lungengewebe zerfetzt und deinen Mund ausgetrocknet – und du kannst nur hoffen, dass niemand dich anspricht, weil du kein Wort herausbringen könntest, und du kannst nur beten, dass niemand sagt, du sollst dich bewegen, weil dein Herz verstopft ist und so rasend schnell schlägt, dass es eher zerspringen als Blut durch seine verengten Kammern pumpen würde. Feuer im Sinne von Angst, von Panik, noch eine Minute, und ich sterbe, wenn er nicht bei mir klopft, aber besser, er klopft nie als gerade jetzt. Ich hatte mir angewöhnt, meine Balkontür angelehnt zu lassen und mich nur in der Badehose aufs Bett zu legen, mein ganzer Körper eine einzige Flamme, ein Flehen, bitte, bitte sag mir, dass ich mich irre, sag mir, dass ich mir alles eingebildet habe, denn es kann unmöglich auch für dich wahr sein, und wenn es für dich doch wahr ist, bist du der unbarmherzigste Mensch auf Erden. Und dann der Nachmittag, als er endlich mein Zimmer betrat, ohne zu klopfen, als hätte ihn mein Flehen hergeholt, und wissen wollte, wieso ich nicht mit den anderen am Strand war, und mir nur eine Antwort einfiel, die ich dann doch nicht herausbrachte: Um bei dir zu sein. Bei dir, Oliver. Mit oder ohne Badehose. Mach mit mir, was du willst. Frag, ob ich will, und du wirst sehen, welche Antwort du bekommst.
Und sag mir, dass ich in jener Nacht nicht geträumt habe, als ich auf dem Gang vor meiner Tür ein Geräusch hörte und plötzlich wusste, dass jemand bei mir war, jemand am Fußende meines Bettes saß und grübelte und immer höher rückte und unversehens nicht neben mir lag, sondern auf mir und ich das so schön fand, dass ich, um nicht zu verraten, dass ich wach war oder zu riskieren, dass er es sich anders überlegte, tiefen Schlaf vortäuschte und dachte: Das ist kein Traum, es kann, es darf kein Traum sein, denn während ich die Augen fest zudrückte, war da plötzlich der Gedanke: Das ist wie Heimkehr nach Jahren unter den Trojanern und Lestrygoniern, wie Heimkehr an einen Ort, wo alle sind wie du selbst, wo alle Bescheid wissen, wo alles zusammenpasst und du plötzlich begreifst, dass du dich siebzehn Jahre mit der falschen Kombination gemüht hast.
Und da wollte ich dich, ohne auch nur einen Muskel zu rühren, spüren lassen, dass ich bereit war, mich dir hinzugeben, nur warst du plötzlich fort, und obgleich es für einen Traum zu wirklich schien, hatte ich von diesem Tag an nur den einen Wunsch, dass du mit mir das machen würdest, was du mit mir im Schlaf gemacht hattest.
Am nächsten Tag spielten wir Doppel, und während wir in einer Pause Mafaldas Limonade tranken, legte er den freien Arm um mich und drückte mir sanft Daumen und Zeigefinger in die Schulter. Es war eine fast kumpelhafte Berührung, aber mir ging sie durch und durch. Ich entwand mich rasch seinem Griff. Noch eine Sekunde, und ich wäre in mich zusammengefallen wie eins dieser kleinen Zappelspielzeuge, deren krummbeinige Körper einknicken, sobald man die Hauptfeder berührt. Erschrocken entschuldigte er sich, fragte, ob er etwa »einen Nerv erwischt« hätte, er habe mir nicht weh tun wollen. Dass er mir womöglich ernstlich wehgetan hatte, muss ihm ebenso peinlich gewesen sein wie die Vorstellung, er hätte sich vielleicht im Wortsinn an mir »vergriffen«. Ich wollte ihn auf keinen Fall abschrecken, stammelte deshalb etwas wie »Macht fast gar nichts« und hätte wohl die Sache auf sich beruhen lassen – nur wäre meine schroffe Reaktion für meine Freunde wenig überzeugend gewesen, wenn es tatsächlich nicht weh getan hatte, und ich tat so, als versuchte ich tapfer, mir den Schmerz zu verbeißen.
Ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, dass das, worauf ich bei seiner Berührung fast panikartig reagiert hatte, nichts anderes war als das, was noch unschuldige junge Mädchen aus der Fassung bringt, wenn sie zum ersten Mal die Berührung eines Menschen spüren, den sie begehren: Er bringt bei ihnen Nerven zum Schwingen, von deren Existenz sie nichts ahnten und die sehr viel verstörendere Lüste wecken als die, mit denen sie bisher allein gelassen wurden.
Er wunderte sich scheinbar immer noch über meine Reaktion, spielte aber den Glauben an meine schmerzende Schulter ebenso überzeugend wie ich den angeblichen Versuch, ihn meine Schmerzen nicht merken zu lassen. Damit hatte er mir aus der Bredouille geholfen und tat seinerseits so, als seien ihm gewisse Nuancen in meinem Verhalten nicht aufgefallen. Später sollte ich erkennen, wie trefflich er sich darauf verstand, widersprüchliche Signale einzuordnen und glaube deshalb bestimmt, dass er damals schon etwas vermutete. »Komm, ich mache es wieder gut«, sagte er, und massierte weiter. Es war ein Test. »Entspann dich.« »Aber ich bin entspannt.« »Du bist steif wie ein Brett. Fühl mal«, sagte er zu Marzia, einem Mädchen aus der Gruppe um uns herum. Ich spürte ihre Hände auf meinem Rücken. »Hier.« Er drückte ihre Handfläche fest an. »Merkst du das? Höchste Zeit, dass er lockerer wird.« »Höchste Zeit, dass du lockerer wirst«, wiederholte sie.
Weil ich mich nicht darauf verstand, durch die Blume zu sprechen, hielt ich wie gewöhnlich den Mund und kam mir vor wie ein Taubstummer, der nicht mal die Zeichensprache beherrscht. Ich stotterte alles Mögliche, um nicht sagen zu müssen, was mich in Wahrheit beschäftigte. So lange ich Luft genug hatte, um Worte herauszubringen, kam ich damit einigermaßen durch. Schweigen hätte mich vermutlich verraten – und deshalb war dem selbst der blühendste Unsinn vorzuziehen. Mehr noch als mein Schweigen aber hätte mich wohl der verzweifelte Versuch entlarvt, mich vor den anderen zum Sprechen zu überwinden.
Der hilflose Zorn auf mich selbst spiegelte sich als Unduldsamkeit, ja stumme Wut auf meinen Zügen. Dass Oliver diese heftige Gefühlsregung auch auf sich beziehen konnte, kam mir gar nicht in den Sinn.
Vielleicht aus ähnlichen Gründen wandte ich regelmäßig den Blick ab, wenn er mich ansah – um zu verbergen, wie sehr mich das, schüchtern wie ich war, belastete. Auch auf den Gedanken, dass er diese Vermeidungsstrategie womöglich als kränkend empfunden und deshalb hin und wieder mit einem feindseligen Blick geantwortet hatte, wäre ich nie gekommen.
Aber meine Überreaktion auf seinen Griff enthielt noch etwas, von dem ich nur hoffen konnte, dass er es nicht bemerkt hatte. Ehe ich seinen Arm abschüttelte, überließ ich mich kurz seiner Hand, als wollte ich sagen – wie ich es so oft Erwachsene hatte sagen hören, wenn jemand ihnen im Vorübergehen die Schulter massiert – Bitte mach weiter! Hatte er gespürt, dass ich bereit war, mich nicht nur seiner Hand zu überlassen?
Auch diese Empfindung hielt ich abends in meinem Tagebuch fest. Ich nannte sie die »Ohnmacht«. Warum hatte mich diese Ohnmacht erfasst? Nur weil ich durch seine Berührung sofort schlaff und willenlos geworden war? Ob es das war, was die Leute unter Dahinschmelzen verstanden?
Und warum wollte ich ihm nicht zeigen, wie leicht er mich zum Schmelzen bringen konnte? Weil ich Angst vor den Folgen hatte? Oder weil ich fürchtete, er würde mich auslachen, es herumerzählen oder den Vorfall einfach übergehen mit der beiläufigen Bemerkung, ich sei zu jung, um zu wissen, was ich tat? Oder weil er mehr oder weniger ahnte – und damit zwangsläufig auf derselben Wellenlänge wie ich war –, dass er versucht sein könnte, selbst aktiv zu werden? Wollte ich das denn? Oder wäre mir lebenslanges Sehnen lieber, vorausgesetzt, wir hielten beide das kleine Pingpong-Spiel in Gang: Nicht wissen, nicht nicht wissen, nicht nichtnicht wissen? Sei ruhig, sag nichts, und wenn du nicht ja sagen kannst, sag nicht nein, sag »später«. Gibt es deshalb Leute, die »vielleicht« sagen, wenn sie »ja« meinen, aber hoffen, dass du glaubst, es sei »nein« und in Wirklichkeit hören wollen: Bitte frag mich noch einmal, und danach immer wieder?
Wenn ich auf jenen Sommer zurückblicke, kann ich kaum glauben, dass mir das Leben trotz meiner Mühe, es mit dem »Feuer« und der »Ohnmacht« auszuhalten, wunderbare Momente schenkte. Italien. Sommer. Das Geräusch der Zikaden am frühen Nachmittag. Mein Zimmer. Sein Zimmer. Unser Balkon, der uns völlig von der Welt abschirmte. Der sanfte Wind, der Düfte aus dem Garten zu meinem Zimmer hochtrug. Der Sommer, in dem ich meine Liebe zum Fischen entdeckte. Weil er es tat. Meine Liebe zum Joggen. Weil er es tat. Meine Liebe zu Tintenfisch, Heraklit, Tristan. Der Sommer, in dem meine hellwachen Sinne, wenn ich einen Vogel singen hörte, eine Pflanze roch oder den Dunst spürte, der an warmen sonnigen Tagen unter meinen Sohlen aufstieg, automatisch zu ihm eilten.
Ich hätte so vieles abstreiten können: Dass es mich drängte, seine Knie und Handgelenke zu berühren, wenn sie mit jenem viskosen Schimmer, den ich nur ganz selten an einem Menschen gesehen habe, in der Sonne glänzten; dass ich die rötlich-lehmigen Flecken auf seinen Tennisshorts liebte, weil seine Haut im Lauf der Wochen die gleiche Farbe angenommen hatte; dass sein flatterndes blaues Hemd, das sich noch mehr bauschte, wenn er es an windigen Tagen am Pool trug, einen Geruch nach Haut und Schweiß verhieß. All das hätte ich abstreiten können. Und hätte mir selbst sogar geglaubt.
Aber es war seine goldene Halskette mit dem Davidsstern und der goldenen Mesusa, die mich begreifen ließ, dass da noch etwas Zwingenderes war als das, was ich mir von ihm wünschte, denn es verband uns und zeigte mir, dass zumindest dies, so unterschiedlich wir auch sonst sein mochten, alle Unterschiede überwand. Schon sehr früh an seinem ersten Tag hatte ich den Stern bemerkt. Und von Stund an wusste ich, dass das, was mir Rätsel aufgab und mich drängte, seine Freundschaft zu suchen, größer war als alles, was wir uns voneinander wünschen mochten, größer und deshalb besser als seine Seele, mein Körper oder die Erde selbst. Seinen Hals mit dem Stern und dem verräterischen Amulett zu sehen, bedeutete, etwas Zeitloses, Angestammtes, Unsterbliches in mir, in ihm, in uns beiden zu sehen, das darum flehte, neu entfacht und aus jahrtausendealtem Schlaf erweckt zu werden.
Zu meiner Überraschung schien er nicht zu merken oder nicht wichtig zu nehmen, dass auch ich einen Davidsstern trug. So wie er es nicht zu merken oder nicht wichtig zu nehmen schien, wenn mein Blick zu seiner Badehose wanderte und versuchte, den Umriss dessen zu erkennen, was uns zu Brüdern in der Wüste machte.
Abgesehen von meiner Familie dürfte er der einzige Jude gewesen sein, der je nach B. gefunden hat. Anders als wir aber ging er von Anfang an damit ganz offen um. Wir waren keine auffälligen Juden. Wir trugen unser Judentum, wie Juden fast überall in der Welt, unter dem Hemd, nicht verborgen, aber weggesteckt. »Diskretes Judentum« nannte das meine Mutter. Zu sehen, wie jemand sein Judesein am Hals zur Schau trug wie Oliver, wenn er sich eins unserer Fahrräder schnappte und mit weit geöffnetem Hemd in die Stadt fuhr, war ein Schock für uns, zeigte uns aber auch, dass wir es machen könnten wie er und nichts zu befürchten hätten. Ich versuchte es ein paar Mal, hatte aber zu viele Hemmungen – wie ein Junge, der scheinbar ungezwungen nackt im Umkleideraum herumläuft, nur um festzustellen, dass die eigene Nacktheit ihn aufgeilt. In der Stadt bemühte ich mich, mein Judentum mit jener stummen Anmaßung zur Schau zu stellen, die nicht so sehr Arroganz als unterdrücktes Schamgefühl ist. Er war da anders. Nicht, dass er sich nie Gedanken darüber gemacht hätte, was es bedeutet, Jude zu sein oder als Jude in einem katholischen Land zu leben. An den langen Nachmittagen legten wir manchmal die Arbeit beiseite und sprachen, während Familie und Gäste sich auf die einzelnen Zimmer verteilt hatten, um ein paar Stunden zu ruhen, unter anderem auch über dieses Thema. Er hatte lange genug in Kleinstädten Neuenglands gelebt, um zu wissen, wie einem als jüdischem Abseitssteher und Außenseiter zumute ist. Aber der Judaismus war für ihn, anders als für mich, nie ein großes Problem und auch nicht Gegenstand eines permanenten metaphysischen Missbehagens an sich und der Welt, ja nicht einmal die mystische, unausgesprochene Verheißung erlösender Bruderschaft. Vielleicht litt er deshalb nicht an seinem Judesein und hatte es nicht nötig, ständig daran herumzuzupfen wie Kinder an einem Schorf, den sie loswerden wollen. Er fand das Judesein okay, so wie er sich selbst okay fand, seinen Körper, sein Aussehen, seine lächerliche Rückhand, seine Entscheidung für gewisse Bücher, Filme, Freunde, für eine bestimmte Musik. Der Verlust seines geliebten Mont-Blanc-Füllers war okay. »So einen kann ich mir jederzeit wieder kaufen.« Auch Kritik fand er okay. Er hatte ein paar Seiten geschrieben, auf die er stolz war, und zeigte sie meinem Vater, der ihm erklärte, seine Erkenntnisse in Sachen Heraklit seien hervorragend, bedürften aber noch der Festigung, er müsse das Paradoxe in der Denkweise des Philosophen akzeptieren und nicht einfach wegerklären wollen. Das Festigen fand er okay, das Paradoxe fand er okay. Sich wieder an den Schreibtisch zu setzen – auch das fand er okay. Er lud meine junge Tante zu einer mitternächtlichen gita – einer Spritztour – zu zweit auf unserem Motorboot ein. Sie lehnte ab. Das war okay für ihn. Ein paar Tage später versuchte er es noch einmal, bekam erneut einen Korb, was er wieder auf die leichte Schulter nahm. Auch sie fand das okay, und wäre sie noch eine Woche länger geblieben, hätte sie es vermutlich okay gefunden, zu einer mitternächtlichen gita in See zu stechen, die ohne weiteres bis Sonnenaufgang hätte dauern können.
Nur einmal in jenen ersten Tagen ahnte ich, dass dieser eigenwillige, aber entgegenkommende, lässige, unerschütterliche Vierundzwanzigjährige, an dem alles abzuprallen schien, der so vieles im Leben mit einem sorglosen Okay abtat, einen wachen, kalten, durchdringenden Blick für Charaktere und Situationen hatte. Nichts, was er tat oder sagte, geschah ohne Bedacht. Er durchschaute alle, aber er durchschaute sie deshalb, weil das, wonach er in erster Linie bei ihnen Ausschau hielt, eben das war, was er bei sich selbst entdeckt hatte und vielleicht andere nicht entdecken lassen wollte. Er war, wie meine empörte Mutter eines Tages erfuhr, ein gewiefter Pokerspieler, der zweimal in der Woche in die Stadt entwischte, um »ein paar Runden« zu zocken. Das war der Grund dafür, dass er zu unserer großen Verwunderung unbedingt am Tag nach seiner Ankunft ein Konto hatte eröffnen wollen. Ein Bankkonto hatte bisher keiner unserer Sommergäste gehabt, die meisten besaßen keinen roten Heller.
Es geschah beim Lunch, zu dem mein Vater einen Journalisten eingeladen hatte, der sich in seiner Jugend nebenbei mit Philosophie beschäftigt hatte und zeigen wollte, dass er sich zutraute, auch wenn er nie über Heraklit geschrieben hatte, jederzeit über jedes beliebige Thema zu diskutieren. Er und Oliver waren von Anfang an über Kreuz gewesen. Hinterher sagte mein Vater: »Ein sehr geistreicher Mann und blitzgescheit.« »Finden Sie wirklich, Prof?«, fragte Oliver, dem nicht bewusst war, dass mein Vater, so locker er sich gab, nicht immer erfreut über Widerspruch war und die Anrede »Prof« nicht schätzte, auch wenn er sich beides gefallen ließ. »Allerdings«, bekräftigte mein Vater. »Da bin ich anderer Ansicht. Ich finde ihn arrogant, langweilig, grobschlächtig, ordinär. Er beharkt seine Zuhörer mit Witzen, viel Stimme und ausladenden Gebärden …« – Oliver imitierte die gravitätische Art des Mannes – »weil er nicht fähig ist, einen Fall vernünftig zu vertreten. Die Masche mit der Stimme ist doch total überzogen, Prof! Die Leute lachen nicht über ihn, weil er witzig ist, sondern weil er so deutlich signalisiert, dass er witzig sein will. Sein Humor ist nur ein Versuch, Menschen für sich zu gewinnen, die er nicht mit Argumenten überzeugen kann.
Wenn man ihn im Gespräch anschaut, sieht er immer weg, er hört nicht zu, er fiebert danach, das loszuwerden, was er sich zurechtgelegt hat, während man mit ihm spricht, damit er es nur ja nicht wieder vergisst.«
Wie konnte jemand sich so in die Denkweise eines anderen hineinversetzen, wenn er nicht selbst mit diesem Denkschema vertraut war? Wie konnte er so viele verschlungene Wege bei anderen erkennen, wenn er sie nicht selbst schon gegangen war?
Besonders beeindruckte mich nicht nur seine erstaunliche Gabe, Menschen zu deuten, in ihnen zu graben und die genaue Konfiguration ihrer Persönlichkeit zu Tage zu fördern, sondern seine Fähigkeit, Dinge intuitiv in der gleichen Art und Weise zu erfassen, wie ich es getan hätte. Letztlich war es das, was mich mit einer Macht zu ihm hinzog, die weit über Begehren oder Freundschaft oder die Anziehungskraft der gemeinsamen Religion hinausging. »Wie wär’s, wollen wir heute ins Kino gehen?«, platzte er einmal im Familienkreis heraus, als sei ihm spontan die Erlösung von einem womöglich langweiligen Abend eingefallen. Bei Tisch hatte mein Vater mir, wie so häufig, zugeredet, besonders abends öfter mit Freunden auszugehen. Es klang fast wie eine Strafpredigt. Oliver war noch neu bei uns, er kannte niemanden in der Stadt, deshalb war ich ihm als Begleiter sicher nicht unwillkommen, aber er hatte seine Frage so lässig und scheinbar spontan gestellt, dass allen klar sein musste, wie wenig ihm an dem Kinobesuch gelegen war und dass er ebenso gern daheim geblieben wäre, um an seinem Manuskript zu arbeiten. Der lässige Ton war aber auch als eine Art verbales Augenzwinkern für meinen Vater gedacht: Ich tue nur so, als sei mir die Idee gerade erst gekommen, in Wirklichkeit, verehrter Prof, komme ich auf das zurück, was Sie beim Essen gesagt haben, und mache den Vorschlag eigentlich nur Ihrem Sohn zuliebe.
Ich musste schmunzeln – nicht über seinen Vorschlag, sondern über das zweischneidige Manöver. Er merkte es und erwiderte mein Lächeln fast selbstironisch, denn natürlich ahnte er, dass ich seine List durchschaut hatte, aber gäbe er das zu erkennen, käme das einem Schuldeingeständnis gleich, weigerte er sich aber, das zuzugeben, nachdem ich deutlich gemacht hatte, dass ich ihm auf die Schliche gekommen war, würde ihn das noch mehr belasten. Mit seinem Lächeln räumte er ein, dass er sich hatte erwischen lassen, sich aber als guter Verlierer dazu bekannte und trotzdem gern bereit war, mit mir ins Kino zu gehen. Ich fand das sehr aufregend.
Vielleicht hatte er mit seinem Lächeln aber auch meine Lesart mit der unausgesprochenen Andeutung kontern wollen, dass es bei mir ebenfalls etwas zum Belächeln gab, nämlich meine schlau-verschmitzte, schuldbewusste Freude daran, so viele kaum wahrnehmbare Affinitäten zwischen uns zu entdecken. Oder hatte ich mir das Ganze nur eingebildet? Einerlei – wir wussten beide, was der andere gesehen hatte. Als wir dann abends ins Kino radelten, war ich selig und gab mir keine Mühe, das zu verbergen.
Weshalb aber hatte er bei so viel Scharfblick nicht erkannt, was mein jähes Zurückweichen vor seiner Hand bedeutete? Nicht erkannt, dass ich mich in seinen Griff geschmiegt hatte? Nicht begriffen, dass ich alles getan hätte, damit er mich nicht losließ? Nicht gespürt, dass meine Unfähigkeit, mich zu entspannen, meine letzte Zuflucht, meine letzte Rettung, mein letzter Vorwand gewesen war, dass ich ihm nicht würde widerstehen können, widerstehen wollen, was immer er tat oder mich zu tun bat? Nicht erkannt, dass ich, als ich an jenem Sonntagnachmittag auf meinem Bett saß und wir beide allein im Haus waren und er in mein Zimmer gekommen war und gefragt hatte, warum ich nicht mit den anderen am Strand sei, statt einer Antwort nur deshalb die Schultern gezuckt hatte, um nicht zu verraten, dass ich nicht genug Luft bekam, um etwas zu sagen, weil bei dem Versuch einer Antwort nur ein tollkühnes Geständnis oder ein Schluchzer herausgekommen wäre? Seit meiner Kindheit hatte niemand mich in so einen Zustand versetzt. Eine üble Allergie, hatte ich herausgebracht. Bei mir auch, hatte er geantwortet, wahrscheinlich haben wir die gleiche. Er griff sich meinen alten Teddy und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Dann drehte er den Teddykopf in meine Richtung und fragte mit veränderter Stimme: »Was ist los? Du bist ja ganz durcheinander.« Inzwischen musste er gesehen haben, dass ich nur eine Badehose anhatte. Saß sie tiefer als der Anstand gebot? »Kommst du schwimmen?«, fragte er. »Später vielleicht«, antwortete ich mit seinem Lieblingsspruch. »Ach was, komm jetzt.« Er streckte eine Hand aus, um mir hochzuhelfen. Ich nahm sie und drehte mich zur Wand, er sollte mein Gesicht nicht sehen. »Muss das sein?«, fragte ich, aber was ich eigentlich hätte sagen wollen war: Bleib. Bleib bei mir. Lass deine Hand wandern, wohin sie will, zieh mir die Badehose aus, ich werde keinen Laut von mir geben, werde es keiner Seele erzählen. Ich bin steif und du weißt es, und wenn du nicht willst, nehme ich deine Hand und schiebe sie selbst in meine Hose.
Und das alles sollte er nicht gemerkt haben?
Er wollte sich nur noch umziehen. »Wir treffen uns unten«, sagte er und ging. Als ich an mir herunter sah, stellte ich entsetzt fest, dass mein Schritt nass war. Hatte er es gesehen? Dumme Frage. Deshalb wollte er mich zum Strand scheuchen. Deshalb war er gegangen. Ich schlug mir mit der Faust an den Kopf. Wie hatte ich so vernagelt, so gedankenlos sein können? Natürlich hatte er es gesehen.
Ich hätte mir ein Beispiel an ihm nehmen sollen. Er hätte die Schultern gezuckt. Ein Lusttropfen? Ist doch okay. Aber das war nicht meine Art. Ich hätte nie sagen können: Schön, er hat’s gesehen, na und? Jetzt weiß er Bescheid.
Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass jemand, der unter unserem Dach lebte, der mit meiner Mutter Karten spielte, an unserem Tisch frühstückte und zu Mittag aß, freitags nur so aus Spaß den hebräischen Segen sprach, in einem unserer Betten schlief, unsere Handtücher benutzte, unsere Freunde zu seinen Freunden machte, an Regentagen mit uns Fernsehen guckte, wenn wir im Wohnzimmer alle miteinander unter einer Decke saßen, der Kälte wegen, und es so gemütlich war, dem Regen zu lauschen, der an die Fenster schlug – dass jemand in meiner unmittelbaren Umgebung genau das mochte, was ich mochte, das begehrte, was ich begehrte, das war, was ich war. Ich hätte es mir niemals vorstellen können, weil ich mich trotz allem, was ich in Büchern gelesen, Gerüchten entnommen und aus schlüpfrigen Reden aufgeschnappt hatte, noch der Illusion hingab, es sei wohl undenkbar, dass jemand in meinem Alter den Wunsch haben könnte, zugleich Mann und Frau – bei Männern und Frauen – zu sein. Ich hatte schon früher Männer meines Alters begehrt, hatte mit Frauen geschlafen. Aber ehe er aus dem Taxi gestiegen war und unser Haus betreten hatte, wäre ich nie auch nur im Entferntesten auf die Idee gekommen, dass jemand, der sich so durch und durch okay fand, mir ebenso bereitwillig seinen Körper zur Verfügung stellen könnte wie ich ihm den meinen.
Und doch wünschte ich mir zwei Wochen nach seiner Ankunft nur das eine, sah und hörte es Abend für Abend: Seine Tür geht auf – nicht die zum Flur, sondern die zum Balkon –, die Espadrilles tappen über den Holzboden, meine Balkontür, die nie verriegelt ist, wird aufgestoßen, er kommt ins Zimmer – im Haus schläft schon alles –, schlüpft unter meine Decke, zieht mich wortlos aus, bis ich nach ihm verlange, wie ich noch nie nach jemandem verlangt habe, und sucht sich schonungsvoll, mit der Behutsamkeit eines Juden für den anderen, den Weg in meinen Körper, den Satz beherzigend, den ich seit Tagen vor mich hinsage: Bitte tu mir nicht weh – im Klartext aber: Es darf so weh tun, wie du nur willst.