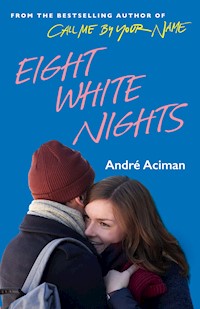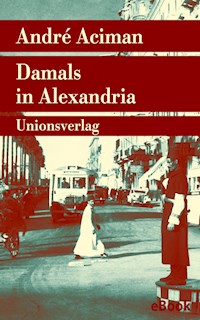9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Eine Meisterklasse des Sinnlichen. Fesselnd, intelligent, unvergesslich.« The Times Literary Supplement Im Alter von zwölf Jahren kennt Paul die Liebe schon. Doch in der Mitte seines Lebens weiß er weniger denn je, wie er sie leben soll. Ein halbes Leben lang erkundet Paul die Liebe, mit Giovanni, Maud und Chloé, im Sommerurlaub in Italien und in New York City. Er liebt bedingungslos und ohne Kompromisse, gibt sich seinem Gegenüber vollkommen hin. Der neue Roman des Bestsellerautors von ›Call Me By Your Name‹ ist ein sinnliches und intimes Porträt eines unerschrocken Begehrenden, der anderen Menschen außergewöhnlich nahekommt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 411
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über das Buch
Im Alter von zwölf Jahren kennt Paul die Liebe schon. Doch in der Mitte seines Lebens weiß er weniger denn je, wie er sie leben soll. – Ein Leben lang erkundet Paul die Liebe, mit Giovanni, Maud, Manfred und Chloe, im Sommerurlaub in Italien und in New York City. Er liebt bedingungslos und ohne Kompromisse, gibt sich seinem Gegenüber vollkommen hin. André Acimans Roman ist das sinnliche und intime Porträt eines unerschrocken Begehrenden, der anderen Menschen außergewöhnlich nahekommt.
Für Susan.Amor che nella mente mi ragiona.
Erste Liebe
Seinetwegen bin ich wiedergekommen.
Diesen Satz hatte ich mir gerade aufgeschrieben, als ich vom Deck der Fähre aus endlich San Giustiniano auftauchen sah. Nur seinetwegen. Nicht unser Haus war der Grund oder die Insel oder mein Vater oder der Blick aufs Festland von der verlassenen normannischen Kapelle aus, wo ich in den letzten Wochen unseres letzten Sommers auf der Insel allein gesessen und mich als unglücklichster Mensch auf der Welt gefühlt hatte.
Die Reise hatte schon lange auf meiner Wunschliste gestanden, und nun, nach meinem Examen, war der ideale Zeitpunkt, um der Insel einen kurzen Besuch abzustatten. Unser Haus war Jahre zuvor abgebrannt, und nachdem wir in den Norden gezogen waren, hatte niemand in der Familie größere Lust zurückzukehren, das Grundstück zu verkaufen oder nachzuforschen, was eigentlich genau passiert war. Wir überließen den Ort einfach sich selbst, erst recht als wir erfuhren, dass die Einheimischen die Brandstelle nach Strich und Faden geplündert und alles Übrige verwüstet hatten. Das Feuer sei kein Zufall gewesen, wurde sogar gemunkelt, doch das sei reine Spekulation, meinte mein Vater, wenn man Genaueres wissen wolle, müsse man schon hinfahren. Ich hatte ihm versprochen, von der Fähre aus unmittelbar nach rechts zu gehen, über die vertraute Promenade, vorbei am imposanten Grandhotel und den Pensionen am Ufer, und dann ohne Umwege zu unserem Haus weiterzulaufen, um mir ein Bild von dem Schaden zu machen. So hatten wir das verabredet. Mein Vater selbst verspürte nicht das geringste Bedürfnis, je wieder einen Fuß auf die Insel zu setzen. Ich sei jetzt ein Mann und durchaus in der Lage zu beurteilen, was zu tun sei.
Vielleicht kam ich nicht ausschließlich wegen Nanni wieder. Sondern auch wegen des Zwölfjährigen, der ich zehn Jahre zuvor gewesen war – obwohl ich wusste, dass ich weder den einen noch den anderen antreffen würde. Der Zwölfjährige war erheblich größer geworden und hatte einen buschigen rötlichen Bart, und Nanni, tja, der war auf Nimmerwiedersehen verschwunden, und niemand hatte je wieder von ihm gehört.
Ich hatte die Insel noch genau in Erinnerung. Ich wusste noch, wie sie an unserem letzten gemeinsamen Tag hier ausgesehen hatte, eine knappe Woche vor Schulbeginn, als mein Vater uns zur Fähre gebracht und dann vom Kai aus gewinkt hatte, während die Ankerkette lärmte und das Schiff kreischend zurücksetzte. Reglos stand er da und wurde immer kleiner, bis er aus unserem Blickfeld verschwand. Wie jeden Herbst wollte er noch eine Woche oder zehn Tage bleiben und sich darum kümmern, dass das Haus ordentlich abgeschlossen würde, dass Strom, Gas und Wasser abgestellt, die Möbel abgedeckt und alle einheimischen Dienstboten bezahlt würden. Dass auch seine Schwiegermutter und deren Schwester auf der Fähre gen Festland entschwanden, kam ihm bestimmt nicht ungelegen.
Doch was ich dann tat, als ich ein Jahrzehnt später festen Boden unter den Füßen hatte und das alte traghetto scheppernd und ächzendvon der Mole ablegte: Ich ging nach links statt nach rechts, den kopfsteingepflasterten Weg direkt hinauf ins uralte San Giustiniano Alta. Ich liebte die engen Gassen dort, die tiefen Rinnsteine und verwitterten Wege, liebte den kühlenden Kaffeeduft aus der Rösterei, der mir noch genauso freundlich entgegenschlug wie damals, als ich mit meiner Mutter für unsere üblichen Besorgungen herkam oder mir, wie in unserem letzten Sommer, nach der täglichen Nachhilfestunde in Latein und Griechisch auf dem Heimweg etwas Zeit ließ. Anders als das modernere San Giustiniano Bassa lag San Giustiniano Alta selbst dann noch im Schatten, wenn unten im Hafen die Sonne längst erbarmungslos brannte. Abends, wenn die feuchte Hitze am Ufer nicht mehr auszuhalten war, ging ich mit meinem Vater oft hinauf, auf ein Eis im Caffè dell’Ulivo, und er setzte sich mit einem Glas Wein mir gegenüber und unterhielt sich mit den Leuten aus dem Städtchen. Jeder kannte und schätzte meinen Vater als un uomo molto colto, einen sehr gebildeten Mann. Sein holpriges Italienisch war mit spanischen Wörtern durchsetzt, denen er einen möglichst italienischen Klang gab. Aber es verstand ihn jeder, und wenn sie ihn doch einmal korrigieren oder wider Willen über seine eigenwillig makkaronischen Wortschöpfungen lachen mussten, lachte er herzlich mit. Sie nannten ihn Dottore, und obwohl jeder wusste, dass er kein Arzt war, suchte man immer wieder medizinischen Rat bei ihm, da man seinem Urteil in gesundheitlichen Angelegenheiten eher traute als dem des ortsansässigen Apothekers, der sich gern als zuständiger Arzt gerierte. Signor Arnaldo, der Eigentümer des Caffès, hatte chronischen Husten, der Friseur ein Ekzem, Professore Sermoneta, mein Nachhilfelehrer, der seine Abende häufig im Caffè beschloss, befürchtete immerzu, er müsse sich eines Tages die Gallenblase herausnehmen lassen – alle zogen meinen Vater ins Vertrauen, sogar der Bäcker: Der zeigte meinem Vater die blauen Flecken an Armen und Schultern, die ihm von seiner übellaunigen Frau zugefügt worden waren; Gerüchten zufolge hatte sie ihn gleich in der Hochzeitsnacht betrogen. Bisweilen trat mein Vater sogar mit jemandem vor die Tür des Caffès, um in einer vertraulichen Angelegenheit seine Meinung kundzutun. Anschließend schob er den Perlenvorhang beiseite und kam wieder herein, setzte sich an den Tisch, das leere Weinglas zwischen den aufgestützten Ellbogen, und blickte mich an: Ich müsse mich nicht beeilen mit meinem Eis, wir hätten wahrscheinlich sogar noch Zeit, zum verlassenen Kastell hinaufzugehen, wenn ich wollte. Das nächtliche Kastell, von dem aus man in der Ferne die Lichter auf dem Festland glitzern sah, war unser Lieblingsplatz; oft saßen wir dort zwischen den verfallenen Mauern schweigend nebeneinander und schauten hinauf zu den Sternen. Erinnerungen sammeln, nannte er das, für später. Wann später?, fragte ich dann, um ihn aufzuziehen. Einfach für später. Meine Mutter sagte immer, wir seien aus demselben Holz geschnitzt, seine Gedanken seien meine Gedanken und meine Gedanken seine Gedanken. Manchmal befürchtete ich, er könnte tatsächlich meine Gedanken lesen, wenn er mich nur an der Schulter berührte. Für meine Mutter waren wir ein und derselbe Mensch. Gog und Magog, unsere beiden Dobermänner, liebten nur meinen Vater und mich, nicht meine Mutter und auch nicht meinen älteren Bruder, der damals bereits seit ein paar Jahren nicht mehr den Sommer mit uns verbrachte. Überhaupt zeigten sich die Hunde bei jedem anderen Menschen abweisend und knurrten, sobald man ihnen zu nahe kam. Die Leute aus dem Ort hielten wohlweislich Abstand, wobei die Hunde niemanden belästigten, so gut erzogen waren sie immerhin. Meistens banden wir sie draußen vor dem Caffè an ein Tischbein, und solange sie uns sehen konnten, lagen sie lammfromm da.
Manchmal, zu besonderen Gelegenheiten, gingen mein Vater und ich vom Kastell aus nicht in Richtung Hafen, sondern zurück in den Ort, und da unsere Gedanken sich so glichen, gab es noch ein Eis für mich. »Jetzt heißt es bestimmt wieder, ich verwöhne dich.« »Noch ein Eis, noch ein Glas Wein«, sagte ich dann, und er nickte, da sich das Offensichtliche ohnehin nicht leugnen ließ.
Nur auf diesen Nachtwanderungen, wie wir sie nannten, hatte ich ihn für mich allein. Ansonsten sah ich ihn oft tagelang nicht. Vor dem Frühstück ging er gern schwimmen, später setzte er aufs Festland über, und abends kam er wieder, manchmal erst mit der letzten Fähre. Selbst im Schlaf freute ich mich dann noch über das Knirschen seiner Schritte auf dem Kiesweg vor unserem Haus. Er war zurück, und die Welt war wieder im Lot.
Meine schlechte Gesamtnote in Latein und Griechisch in jenem Frühjahr hatte einen bösen Keil zwischen meine Mutter und mich getrieben. Ende Mai, ganz knapp vor unserer Abreise nach San Giustiniano, hatte mein Zeugnis im Briefkasten gelegen. Die gesamte Überfahrt war eine einzige Schimpfkanonade, die Vorwürfe prasselten nur so auf mich ein, während mein Vater gelassen an der Reling lehnte, als wartete er auf den richtigen Moment, um sich einzuschalten. Meine Mutter war unterdessen in Fahrt geraten, und je mehr sie sich in ihre Wut hineinsteigerte, desto mehr hatte sie an mir auszusetzen, angefangen bei der Art, wie ich mich mit einem Buch auf der Couch fläzte, über meine Handschrift bis hin zu meiner völligen Unfähigkeit, eine eindeutige Antwort zu geben, wenn man mich nach meiner Meinung zu diesem oder jenem fragte – ausweichen, ich würde immer nur ausweichen! –, und überhaupt, wieso ich eigentlich keinen einzigen Freund hätte, weder in der Schule noch hier am Strand noch sonst wo, für nichts und niemanden würde ich mich interessieren – was um Himmels willen bloß nicht stimme mit mir, wollte sie wissen und versuchte dabei hartnäckig, einen eingetrockneten Fleck auf meinem Hemd wegzukratzen, die Hinterlassenschaft einer Schokoeiswaffel, die mir mein Vater vor der Überfahrt noch schnell gekauft hatte. Ich war mir sicher, dass ihre Unzufriedenheit mit mir schon ewig geschmort hatte und meine verpatzte Latein- und Griechischprüfung nur der Auslöser war.
Um sie zu besänftigen, versprach ich, mich im Sommer zu bessern. Bessern? Gründlich umgekrempelt werden müsse ich, und zwar von oben bis unten, von hinten nach vorn. In ihrem Tonfall lag maßloser Zorn, fast schon Verachtung, spätestens als sie meinem Vater dann ironisch entgegengeschleuderte: »Und du hättest ihm fast einen Pelikan-Füller gekauft!«
Meine Großmutter und ihre Schwester, die an jenem Tag mit uns auf der Fähre waren, ergriffen natürlich Partei für meine Mutter. Mein Vater schwieg. Er konnte die beiden Frauen nicht ausstehen – Dragoner und Oberdragoner hießen sie bei ihm. In dem Moment, da er meine Mutter bäte, ihre Stimme zu senken oder sich zu mäßigen, würden sie ihr sofort beispringen, das wusste er genau, und dann verlor er womöglich die Beherrschung und blaffte die beiden oder sogar alle drei an, woraufhin sie ihn gelassen davon in Kenntnis setzen würden, dass sie lieber mit der nächsten Fähre wieder aufs Festland zurückführen, als mit uns den Sommer zu verbringen. Im Laufe der Jahre hatte ich mehrfach miterlebt, wie er heftig geworden war, und ich merkte genau, wie er sich nun um Beherrschung bemühte, um uns die Fahrt nicht zu verderben. Er nickte lediglich ein paarmal in gespielter Übereinstimmung, als sie monierte, ich würde viel zu viel Zeit mit meiner blödsinnigen Briefmarkensammlung vergeuden. Doch als er schließlich mit einer harmlosen Bemerkung das Thema wechseln wollte, um mich ein bisschen aufzuheitern, fuhr sie ihn an, so leicht komme ich ihr nicht davon. »Die anderen Passagiere schauen schon«, sagte er schließlich. »Sollen sie doch, ich höre erst auf, wenn es mir passt!« Ich kann nicht sagen, warum, aber plötzlich kam mir der Gedanke, dass sie zwar mich anschrie, aber eigentlich ihre aufgestaute Wut an ihm ausließ; ich war nur in die Schusslinie geraten. Wie die griechischen Götter, die Sterbliche als Spielfiguren für ihre endlosen Fehden missbrauchten, hielt sie mir eine Strafpredigt, um auf ihm herumzuhacken. Er hatte das wohl auch begriffen, denn als sie kurz wegsah, grinste er mir zu, nach dem Motto: Mach dir nichts draus. Heute Abend holen wir beide uns ein Eis, und dann gehen wir rauf zum Kastell und sammeln Erinnerungen für später.
An Land bemühte meine Mutter sich verzweifelt, alles wiedergutzumachen, und redete so liebevoll und freundschaftlich auf mich ein, dass wir bald Frieden schlossen. Doch der Schaden klebte ja nicht an den bissigen Bemerkungen, die sie am liebsten zurückgenommen hätte und die ich vielleicht nie würde vergessen können. Der Schaden betraf unsere Liebe: Sie hatte ihre Wärme verloren, ihre Unmittelbarkeit, hatte sich in eine gewollte, befangene, verzagte Liebe verwandelt. Meine Mutter war froh, dass ich sie noch lieb hatte; ich war froh, dass sie und ich uns so bereitwillig täuschen ließen. Uns beiden war bewusst, wie froh wir waren, und das besiegelte unseren Waffenstillstand. Gespürt haben wir aber doch, dass sich unsere Liebe durch das übereifrige Wiedergutsein verwässerte. Meine Mutter umarmte mich häufiger als sonst, und ich wollte auch umarmt werden. Nur traute ich meiner Liebe nicht mehr, und an den Blicken, die meine Mutter mir in vermeintlich unbeobachteten Momenten zuwarf, konnte ich ablesen, dass auch sie ihr nicht traute.
Mit meinem Vater verhielt es sich ganz anders. Auf unseren langen Nachtwanderungen sprachen wir über alles. Über die großen Dichter, über Eltern und Kinder und warum Spannungen zwischen ihnen unvermeidlich waren, über seinen Vater, der wenige Wochen vor meiner Geburt bei einem Autounfall ums Leben gekommen war und dessen Namen ich trug, über die Liebe, die einem nur einmal im Leben begegnete und anschließend nie wieder so spontan oder impulsiv sein würde, und schließlich, was an ein Wunder grenzte, weil es nichts mit Latein und Griechisch, meiner Mutter oder dem Dragoner und Oberdragoner zu tun hatte, über Beethovens Diabelli-Variationen, die er im Frühjahr entdeckt und nur mir vorgespielt hatte. Jeden Abend legte er die Schnabel-Aufnahme auf, sodass Schnabels Klavierspiel durchs Haus schallte und zum Soundtrack jenes Jahres wurde. Ich mochte die sechste Variation, er die neunzehnte, die zwanzigste sei dagegen etwas vergeistigt, aber die dreiundzwanzigste, ah, die dreiundzwanzigste gehörte für ihn zum Lebhaftesten und Witzigsten, was Beethoven je geschrieben hatte. Wir spielten die Dreiundzwanzigste so oft, dass meine Mutter uns anflehte, damit aufzuhören. Um sie zu ärgern, summte ich ihr die Variation vor, was meinen Vater und mich amüsierte, sie allerdings weniger. Auf dem Weg ins Caffè nannten wir in jenen Sommernächten aufs Geratewohl eine Zahl zwischen eins und vierunddreißig, und dann musste jeder sagen, was er von der Variation oder dem Diabelli’schen Thema hielt. Und wenn wir weitergingen zum Kastell, sangen wir manchmal auf die zweiundzwanzigste Variation mit dem Thema aus Don Giovanni den Operntext, den er mir schon vor langer Zeit beigebracht hatte. Oben angekommen, verstummten wir, blickten in den Sternenhimmel und waren uns jedes Mal einig, dass die einunddreißigste Variation doch die allerschönste sei.
Auf meinem Weg die Gasse hinauf nach San Giustiniano Alta dachte ich nun an Beethoven und an die Schimpftirade auf der Fähre. Es war alles noch da. Ich erkannte die alte Apotheke sofort wieder, den Schuster, die Schlosserei und den Friseurladen mit den zwei ramponierten Kippstühlen, die weiß Gott wie lange vor meiner Geburt aufgenähten Lederflicken immer noch an Ort und Stelle. Als das verlassene Kastell in Sichtweite kam, war mir plötzlich, als wehte mir ein Harzgeruch entgegen, noch bevor ich an der Ecke zum Vicolo Sant’Eusebio die Werkstatt des Tischlers überhaupt erreichte. Das Gefühl, das mich befiel, würde sich niemals verändern. Seine Werkstatt mit der Wohnung direkt darüber lag ein paar Schritte hinter dem klotzigen Markstein, der aus dem Eckhaus ragte. Die Erinnerung an den Geruch löste einen Anflug von Angst und Unbehagen aus, den ich so prickelnd fand wie damals, auch wenn ich die verwirrende Mischung aus Furcht, Scham und Aufregung immer noch nicht genauer benennen konnte als vor einem Jahrzehnt. Nichts hatte sich verändert. Vielleicht hatte ich mich nicht verändert. Ich konnte nicht genau sagen, ob ich enttäuscht war oder froh, dass ich all dem nicht entwachsen war. Das Rollgitter vor der Tischlerwerkstatt war heruntergelassen und verschlossen, und dann stand ich da und versuchte mich zu besinnen, was mir seit meinem letzten Besuch alles abhandengekommen war, konnte jedoch keinen klaren Gedanken fassen. Stattdessen kamen mir alle möglichen Gerüchte in den Sinn, die seit dem Brand zu uns gedrungen waren.
Ich ging zurück zum Friseurladen, beugte mich durch den Perlenvorhang und fragte die beiden Friseure, was aus dem ebanista nebenan geworden sei.
Der Kahlköpfige der beiden, der auf einem der zwei Kippstühle saß, ließ seine Zeitung sinken und gab ein einziges Wort von sich, bevor er sich wieder der Lektüre widmete: »Sparito.« Verschwunden. Mehr gab es nicht zu sagen.
Ob er wisse, wohin? Oder wie? Oder warum?
Zur Antwort zuckte er nur kurz die Achseln, was wohl besagen sollte, er wisse es nicht, es sei ihm egal, und er habe nicht vor, einem dahergelaufenen Burschen von Anfang zwanzig, der einfach so in seinen Laden geplatzt kam, irgendwelche Auskünfte zu erteilen.
Ich dankte ihm, drehte mich um und stieg weiter bergan. Verblüfft hatte mich, dass Signor Alessi mich weder begrüßt noch erkannt hatte, obwohl er mir damals doch die Haare geschnitten hatte. Vielleicht fand er mein Auftauchen nicht weiter erwähnenswert.
Erst nach einer Weile wurde mir klar, dass mich offenbar kein Mensch auf der Insel wiedererkannte. Ich hatte mich in den letzten zehn Jahren stark verändert, und vermutlich sah ich mit meinem Bart, dem langen Regenmantel und dem dunkelgrünen Rucksack auch ganz anders aus als der adrette Junge, den sie in Erinnerung hatten. Der Kaufmann, die Inhaber der beiden Caffès auf der kleinen Piazza vor der Kirche, der Metzger und allen voran der Bäcker, aus dessen Laden der Duft nach frisch gebackenem Brot wie ein Segen über das Seitengässchen geschwebt war, wenn ich nachmittags völlig ausgehungert von meiner Latein-und-Griechisch-Nachhilfestunde kam – niemand von ihnen erkannte mich oder würdigte mich eines zweiten Blickes. Selbst der alte Bettler, der bei einem Schiffsunglück im Krieg ein Bein verloren hatte und wie früher an seinem Platz am Brunnen auf dem Hauptplatz stand, konnte mich nicht einordnen, als ich ihm ein paar Münzen gab. Bedankte sich nicht einmal, der Kerl, was ihm eigentlich nicht ähnlichsah. Verachtung für San Giustiniano und seine Bewohner stieg in mir auf, während ich andererseits gar nicht so traurig war, dass ich nicht mehr so daran hing. Vielleicht hatte ich doch damit abgeschlossen. Vielleicht ging es mir wie meinen Eltern und meinem Bruder. Der Vergangenheit nachzutrauern war zwecklos.
Auf meinem Weg hinunter beschloss ich, dem – in meiner Vorstellung – ausgehöhlten Rumpf unseres Hauses einen Besuch abzustatten, die Bestandsaufnahme vorzunehmen, mit den Nachbarn zu reden, die mich von klein auf kannten, und dann die Abendfähre zu nehmen. Eigentlich hatte ich vorgehabt, auch bei meinem alten Nachhilfelehrer vorbeizuschauen, konnte mich nun aber nicht recht zu dem Besuch durchringen. Ich hatte ihn als schlecht gelaunten, empfindlichen Kerl in Erinnerung, der selten ein freundliches Wort für jemanden übrig hatte, schon gar nicht für seine Schüler. Mein Vater hatte vorgeschlagen, dass ich in einer Pension am Hafen ein Zimmer reservierte, falls ich über Nacht bleiben wollte. Doch schon bei meinem hastigen Gang durch die Altstadt hatte ich geahnt, dass mein Besuch nicht länger als ein paar Stunden dauern würde. Fragte sich nur, wie ich die Zeit bis zur Abfahrt verbringen sollte.
Dabei hatte ich die Insel immer geliebt, und zwar alles hier, von den stillen Morgen, wenn man bei einem klaren, ruhigen Himmel aufwachte, der noch der gleiche war wie zu der Zeit, als die Griechen sich hier angesiedelt hatten, bis zum Klang der Schritte meines Vaters, wenn er an einem Wochentag unverhofft schon nachmittags vom Festland kam und uns so etwas wie Festtagsstimmung ergriff. Von meinem Bett aus sah man die Hügel, vom Wohnzimmer aus das Meer, und wenn an kühleren Tagen die Läden im Esszimmer aufgestoßen wurden, konnte man auf die Terrasse treten und über das gesamte Tal und das Meer dahinter blicken, bis hin zu den verschwommenen Konturen der Hügel auf dem Festland.
Als ich die Altstadt hinter mir gelassen hatte, wurde ich geblendet von dem gleißenden Licht, das über die Felder flutete. Ich liebte diese Stille. So lange hatte ich davon geträumt, wieder herzukommen. Alles fühlte sich vertraut an, nichts hatte sich verändert. Und doch fühlte sich alles auch fern an, zerfasert, unerreichbar, als könnte etwas in mir nicht glauben, dass all das wirklich war, dass so vieles davon einmal mir gehört hatte. Der Pfad zu unserem Haus, samt der Abkürzung, die ich als Kind »erfunden« hatte und um keinen Preis heute auslassen würde, lag noch genauso da wie damals. Ich erinnerte mich genau: durch den duftenden, verwilderten Limonenhain – lumie hießen die Früchte hier –, dann über eine Klatschmohnwiese bis zur uralten, verfallenen normannischen Kapelle, die mehr von mir in sich barg als jeder andere Ort auf der Welt, eine Kapelle mit massivem Sockel, die man mitten in den stacheligen Wildwuchs gesetzt hatte, der heute so verdorrt war wie damals, und überall Taubendreck und die eingetrockneten Hinterlassenschaften der wilden Hunde.
Was schmerzte, war die Gewissheit, dass unser Haus nicht mehr stand, dass alle seine Bewohner fort waren, dass das frühsommerliche Leben nie mehr zurückkehren würde. Ich kam mir vor wie ein scheues Gespenst, das sich in der Gegend zwar noch auskannte, aber nicht mehr gern gesehen war. Meine Eltern würden nicht auf mich warten, niemand hätte mir ein paar Leckerbissen hingestellt, wenn ich ausgehungert vom Schwimmen heimgerannt kam; all unsere Rituale waren null und nichtig. Der Sommer hier gehörte mir nicht mehr.
Je weiter ich mich unserem Haus näherte, desto mehr graute mir vor dem Anblick. Was hatte man ihm angetan? Der Gedanke an das Feuer und die Plünderung, ganz besonders die Plünderung, ließ ein Gebräu aus Schmerz, Wut und Hass in mir hochkochen, das sich nicht nur gegen jedermann richtete, der hier lebte, sondern auch gegen uns, unsere Familie, als lastete die Unfähigkeit, Vandalismus und Plünderei vonseiten vermeintlicher Freunde und Nachbarn zu verhindern, auf unserem Gewissen schwerer als dem der anderen. »Zieh keine voreiligen Schlüsse«, hatte mein Vater mich ermahnt, »und fang bloß keinen Streit an.« So hatte er es immer gehalten. Mir jedoch war diese Bedachtsamkeit fremd, ich hätte mit Wonne jeden Einzelnen vor Gericht gezerrt, ob reich, ob arm, ob Witwe, Waise, Krüppel, Kriegsversehrter.
Und doch gab es unter allen Menschen hier einen, den ich wirklich sehen wollte, und der war fort, sparito. Das wusste ich bereits. Warum also überhaupt nach ihm fragen? Um zu sehen, wie sie reagierten? Um mir zu beweisen, dass ich ihn mir nicht ausgedacht hatte? Dass er hier gelebt hatte? Dass ich mich nur beim Friseur nach ihm erkundigen musste und er dann – kaum hätte man mein Anliegen kreuz und quer durch die engen Gassen von San Giustiniano Alta getragen – tatsächlich auftauchen würde?
Warum sollte er sich überhaupt an mich erinnern? Er hatte mich als Zwölfjährigen gekannt, jetzt war ich zweiundzwanzig und trug stolz einen Bart. Allerdings hatten die vergangenen Jahre mich nicht den Nervenkitzel vergessen lassen, die wachsende Spannung, wenn ich damals darauf fieberte und zugleich fürchtete, ihm irgendwo im Dorf oder am Strand zu begegnen. Hatte ich mir nicht eigentlich genau dieses Gefühl erhofft, als ich heute Morgen zu seiner Werkstatt hinaufgepilgert war? Die Angst, die Panik, die zugeschnürte Kehle von damals, zu lösen nur durch einen Schluchzer, der unkontrolliert hervorbrechen konnte, falls er mich einen Moment länger ansah, als ich es ertrug. Er sieht dich an, dir klopft das Herz, und dann willst du nur noch einen ruhigen Ort finden, an dem du unbeobachtet heulen kannst, weil nichts, nicht einmal eine vermasselte Latein- und Griechischprüfung oder eine Gardinenpredigt, dich so erschüttern kann. Ich erinnerte mich an alles. An das Bedürfnis zu heulen und an das Warten auf eine Begegnung, weil dieses Warten und Hoffen nicht zu ertragen war, an den Wunsch, alles an ihm zu hassen – ein kurzer Blick von ihm, und schon war man außer sich und brachte kein Lächeln mehr zustande und konnte sich an nichts mehr freuen.
Kennengelernt hatte ich ihn im Beisein meiner Mutter. Er wartete nicht, bis ich ihm vorgestellt wurde, sondern wuschelte mir einfach durchs Haar und sagte: »Du bist Paolo.«
Als ich ihn verblüfft ansah, konterte er mit einem munteren: »Das weiß doch jeder.«
Ich wusste, dass er Giovanni hieß und alle ihn Nanni nannten. Gesehen hatte ich ihn schon am Strand, im Freilichtkino an der Kirche und an vielen Abenden im Caffè dell’Ulivo. Ich musste mich zügeln, um mir die Freude darüber nicht anmerken zu lassen, dass der Mann, der mich doch garantiert nie zur Kenntnis genommen hatte, nicht nur wusste, wie ich hieß, sondern leibhaftig bei uns im Haus stand.
Anders als er tat ich jedoch so, als wären wir uns noch nie begegnet. Meine Mutter stellte ihn mir mit einem ironischen Unterton vor, der besagen sollte: Du kennst Signor Giovanni ja bestimmt.
Ich schüttelte den Kopf und brachte es sogar fertig, so zu tun, als wäre es mir peinlich, seinen Namen nicht zu kennen.
»Aber Signor Giovanni kennt doch jeder«, schob sie hinterher, als wollte sie sagen: Jetzt besinn dich bitte mal auf die allereinfachsten Anstandsregeln. Aber ich blieb standhaft.
Er streckte mir die Hand hin, und ich schüttelte sie. Er sah jünger aus, als ich gedacht hatte, und weniger braun gebrannt. Er war groß und schlank und Ende zwanzig. So aus der Nähe hatte ich ihn noch nie betrachtet – die Augen, die Lippen, die Wangen, das Kinn. Erst Jahre später sollte mir klar werden, was mich an seinen Gesichtszügen so faszinierte.
Mein Vater hatte vorgeschlagen, ihn zu uns zu bitten, damit er einen antiken Sekretär und zwei Bilderrahmen aus dem vorigen Jahrhundert restauriere.
Er kam eines Morgens im Juni, und ganz gegen die örtlichen Gepflogenheiten nahm er die von meiner Mutter angebotene Limonade gern an. Alle anderen, die bei uns zu tun hatten – die Schneiderin, die Laufburschen, der Polsterer –, baten stattdessen um ein Glas Wasser und gaben damit zu verstehen, dass sie uns nichts schuldeten, dass sie um nicht mehr gebeten hatten als um ein einfaches Glas Wasser an einem heißen Sommertag; erst dann nämlich hatten sie sich ihren Lohn samt dem unvermeidlichen Trinkgeld nach ihrem Dafürhalten redlich verdient.
An jenem Morgen in unserem Haus stand er so nahe bei mir, dass mich etwas in seiner Miene, ich konnte nicht sagen was, so aufwühlte und verlegen machte wie damals, als ich vor der gesamten Schule ein Gedicht vortragen sollte, vor sämtlichen Lehrern, Eltern, entfernten Verwandten, Freunden der Familie, durchreisenden Honoratioren, vor der ganzen Welt. Ich konnte ihn nicht einmal ansehen. Musste den Blick abwenden. Seine Augen waren dermaßen klar. Am liebsten hätte ich sie berührt oder wäre in ihnen versunken.
Als er mit meiner Mutter sprach und von Zeit zu Zeit in meine Richtung sah, als hätte er gern meine Meinung gehört, bemühte ich mich, seinem Blick standzuhalten. Doch ihm in die Augen zu schauen war, als blickte man von steilen, zerklüfteten Klippen hinunter auf ein wogendes grünes Meer – es zog einen förmlich in die Tiefe. Man wollte nicht gegen den Sog ankämpfen, aber man durfte auch niemanden allzu deutlich anstarren, man konnte also nie lange genug hinsehen, um herauszufinden, warum man die Augen nicht abwenden wollte. Sein Blick machte mir nicht nur Angst, er verstörte mich, als riskierte ich nicht nur, ihn zu brüskieren, sondern auch, ein dunkles, beschämendes Geheimnis über mich zu offenbaren, das eigentlich nicht ans Licht kommen durfte. Selbst als ich seinen Blick erwidern wollte, um mich zu vergewissern, dass er gar nicht so bedrohlich war wie befürchtet, musste ich sofort wieder wegschauen. Er hatte das schönste Gesicht, das mir je begegnet war, und ich brachte nicht den Mut auf, es anzusehen.
Jedes Mal, wenn er von meiner Mutter zu mir blickte, bedeutete er mir damit, dass er zwar älter sei und in mir lesen könne wie in einem Buch, doch stünden wir uns auf Augenhöhe gegenüber, und er würde kein Urteil über mich fällen, verachtete mich nicht, interessierte sich für das, was ich womöglich über unser Möbelstück zu sagen hätte, auch wenn ich nur stumm dastand und zu verbergen versuchte, wie unwürdig ich mir in seiner Gegenwart vorkam.
Also sah ich weg.
Doch das ging auch nicht.
Ausweichend wollte ich nämlich auf keinen Fall wirken, schon gar nicht in Gegenwart meiner Mutter.
Er sah aus wie das blühende Leben, und sein Gesicht war leicht gerötet, als käme er gerade vom Schwimmen. Aus dem gelassenen, zuvorkommenden Lächeln, mit dem er seine Gedanken oder auch Zweifel hinsichtlich des Sekretärs zum Ausdruck brachte, sprach der Inbegriff des Menschen, der ich einmal werden wollte. Welch ein Genuss, ihn anzusehen und ihm in Gedanken schon nachzueifern. Wenn er doch bloß mein Freund werden und mir etwas beibringen wollte! Weiter reichte meine Vorstellungskraft gar nicht.
Meine Mutter hatte ihn eigentlich ins Wohnzimmer führen wollen, aber er erahnte, wo der Sekretär stand, und war schon dabei, ihn zu öffnen. Ohne sich rückzuversichern, zog er hastig die beiden schmalen, ungewöhnlich langen, quietschenden Schubladen heraus, fasste in die beiden Hohlräume und tastete im bauchigen Aufsatz des Möbels herum, bis er die geheime Nische fand. Mit einiger Anstrengung zog er anschließend ein kleines Kästchen mit abgerundeten Ecken heraus, der zylindrischen Form des Sekretärs nachempfunden. Meine Mutter war sprachlos. Woher er von dem Kästchen gewusst habe? Bedeutende Tischler, oft aus Norditalien oder Frankreich, hätten immer gern demonstriert, dass sie an den unmöglichsten Stellen Verstecke einbauen konnten; je kleiner das Möbel, desto ausgeklügelter das Versteck. Und da gebe es noch etwas, was er ihr zeigen müsse, wovon sie vermutlich ebenfalls nichts wisse. »Was denn, Signor Giovanni?« Er hob den Sekretär leicht an und deutete auf verborgene Angeln.
»Wozu sind die gut?«, fragte sie. Der Sekretär sei vollständig zusammenklappbar, sodass man ihn problemlos transportieren könne. Er wolle die Angeln nur deshalb nicht gleich auf die Probe stellen, da er dem Zustand des Holzes nicht traue. Und damit überreichte er meiner Mutter das Holzkästchen.
»Dieser Sekretär ist seit mindestens hundertfünfzig Jahren im Besitz der Familie meines Mannes«, sagte sie, »aber von diesem Kästchen hat niemand etwas gewusst.«
»Dann wird die Signora entweder verborgenen Schmuck entdecken oder Briefe, die ein Urahn auf ewig vor ihr hätte verstecken wollen.« Er unterdrückte das verschmitzte Lächeln, das an diesem Morgen schon ein paarmal seine Züge überflogen hatte und das ich mir so gern aneignen wollte.
Das Kästchen war verschlossen.
»Ich habe keinen Schlüssel«, sagte meine Mutter.
»Mi lasci fare, Signora«, erwiderte er, »Sie gestatten«, und aus jedem Wort sprach Hochachtung vor der Kundschaft ebenso wie Sachverstand. Er zog einen Ring mit winzigen Werkzeugen aus der Tasche, die weniger nach Ahlen, Sticheln und Schraubenziehern aussahen als vielmehr nach einer Sammlung von Sardinendosenöffnern in allen Größen. Dann nahm er seine Brille aus der Brusttasche, klappte sie auf und streifte sich sorgfältig nacheinander die Bügel hinter die Ohren. Er erinnerte mich an einen Jungen im Kindergarten, der plötzlich eine Brille gebraucht hatte und erst lernen musste, damit umzugehen. Anschließend schob Nanni mit gestrecktem Mittelfinger ganz zart den Steg der Brille zurecht – er hätte eine unschätzbar wertvolle Cremoneser Geige nicht achtsamer behandeln können. Jede Bewegung lief geschickt und fließend ab, was mir nicht nur Vertrauen einflößte, sondern auch Bewunderung abnötigte. Besonders erstaunlich fand ich seine Hände. Sie wiesen weder Schwielen auf noch zeigten sie Farbflecken oder sonstige Spuren des Tischlerhandwerks. Es waren die Hände eines Musikers. Am liebsten hätte ich sie berührt, nicht nur um zu sehen, ob seine rosigen Handflächen sich so zart anfühlten, wie sie das vermuten ließen, sondern weil ich meine eigenen Handflächen mit einem Mal der Fürsorge der seinen anheimgeben wollte. Anders als seine Augen flößten mir seine Hände keine Furcht ein – vielmehr hatten sie etwas Einladendes. Seine schlanken Finger mit den mandelförmigen Nägeln sollten sich zwischen die meinen schieben und auf ihnen liegen bleiben, sollten warmherzige, lang andauernde Kameradschaft versprechen und allein durch diese Geste bekräftigen, dass ich eines Tages, vielleicht schneller, als ich dachte, selbst ein erwachsener Mann sein würde, mit einer Brille wie der seinen und einem verschmitzten Lächeln, das der Welt kundtun würde, ich wäre ein Experte, ein sehr, sehr guter Mann.
Er bemerkte aus den Augenwinkeln, dass wir ihn beim Öffnen des Kästchens beobachteten, und lächelte vor sich hin, ohne meine Mutter oder mich anzublicken; er war sich unserer Spannung bewusst und suchte sie zu zerstreuen, ohne erkennen zu lassen, dass er sie registrierte. Er kenne sich aus, habe so etwas schon oft gemacht, sagte er, ohne den Blick vom Schlüsselloch zu nehmen. »Signor Giovanni«, sagte meine Mutter, während er sich weiter an dem Schloss zu schaffen machte, darum bemüht, ihn nicht abzulenken. »Si, Signora«, erwiderte er, ohne aufzublicken. »Sie haben eine sehr schöne Stimme.« Er war so in das Schloss vertieft, dass er die Bemerkung nicht gehört zu haben schien, doch Sekunden später sagte er: »Lassen Sie sich nicht täuschen, Signora, ich kann die einfachste Melodie nicht halten.« »Bei Ihrer Stimme?« »Wenn ich singe, werde ich grundsätzlich ausgelacht.« »Die anderen sind bloß neidisch.« »Glauben Sie mir, ich kann nicht mal ›Happy Birthday‹ singen.« Wir lachten alle drei. Ein Moment der Stille. Ohne Hast, ohne Gewalt und ohne den Bronzebeschlag an dem alten Schloss zu verkratzen, stocherte er noch ein bisschen, rief dann »Eccoci!«, und schon, als bräuchte es nur ein wenig Geduld und Überredungskunst, um ein solches Zauberstück zu vollführen, öffnete sich das Kästchen. Ich hätte ihm am liebsten die Hände geküsst. Zum Vorschein kamen, als er den Deckel aufklappte, eine goldene Taschenuhr, ein Paar goldener Manschettenknöpfe und ein Füllfederhalter auf einem spangrünen Filzbett. Der Füllfederhalter hatte seitlich den vollen Namen meines Großvaters, und damit auch meinen Namen, in goldenen Lettern eingraviert.
»Das ist ja unglaublich!«, rief meine Mutter. Das seien die heiß geliebten Manschettenknöpfe ihres Schwiegervaters, mit seinen Initialen, sie stammten wohl noch aus seiner Pariser Studienzeit. Auch an die Taschenuhr könne sie sich erinnern, er habe sie öfter getragen, nur sei das schon so lange her. Er habe die drei Gegenstände wohl in das Kästchen gelegt, und als er nach dem Unfall nicht mehr nach Hause kam, habe sie einfach niemand vermisst. »Jetzt sind sie plötzlich wieder da – aber er fehlt.« Meine Mutter war in ihre Erinnerungen versunken. »Ich mochte ihn sehr, und er mich auch.«
Der Tischler biss sich auf die Lippen und nickte.
»Das ist das Schlimme an den Toten. Sie kommen immer so unerwartet zurück, dass es uns kalt erwischt. Stimmt’s, Signor Giovanni?«, sagte meine Mutter.
Er bejahte. »Manchmal, wenn man ihnen etwas erzählen will, das sie interessiert hätte, oder etwas fragen möchte, das nur sie noch wissen können, wird einem wieder bewusst, dass sie uns nicht hören, keine Antwort geben, wir ihnen egal sind. Aber vielleicht ist es für sie ja noch viel schlimmer: Vielleicht wollen sie sich bemerkbar machen, aber wir hören ihnen einfach nicht zu, und sie sind uns allem Anschein nach egal.«
Offenbar hatte Nanni schon so manchen Schicksalsschlag erfahren. Das spürte man daran, wie schnell sein Lächeln einer leisen Feierlichkeit gewichen war. Ich mochte ihn feierlich genauso.
»Sie sind ja ein Philosoph, Signor Giovanni«, sagte meine Mutter mit einem gutmütigen Lächeln, in der Hand das offene Kästchen.
»Kein Philosoph, Signora. Ich habe nur vor ein paar Jahren meine Mutter verloren, sie ist auf der Treppe gestürzt, und ein paar Monate später meinen Vater. Beide waren kerngesund. Über Nacht war ich Vollwaise, plötzlich in der Werkstatt der Chef und für meinen kleinen Bruder der Vater. Dabei gibt es immer noch so viel, was ich meine Eltern fragen müsste, so vieles, was ich von meinem Vater hätte lernen können. Er hat nur wenige Spuren hinterlassen.«
Eine unbehagliche Stille sank auf uns herab. Nanni nahm sich wieder den Sekretär vor. Daran habe schon einmal jemand gearbeitet, meinte er, nachdem er die Angeln untersucht hatte, das erkläre auch, warum das Möbelstück immer noch so glänze. »Wahrscheinlich mein Großvater«, sagte er. Meine Mutter war drauf und dran, die Taschenuhr aufzuziehen, doch der Tischler hinderte sie daran. »Das Federwerk könnte kaputtgehen. Das soll sich lieber jemand anschauen.«
»Der Uhrmacher?«, fragte sie vorschnell.
»Der Uhrmacher ist ein Schwachkopf. Eher jemand auf dem Festland.«
Ob er jemanden kenne?
Ja.
Er könne ihm die Uhr sogar persönlich bringen, wenn er das nächste Mal übersetze.
Sie überlegte kurz und erklärte dann, sie werde meinen Vater bitten, die Uhr hinzubringen.
»Capisco«, sagte er mit der bescheidenen Geste dessen, der zu Unrecht eines Vergehens beschuldigt wird, den stillschweigenden Verdacht aber elegant übersieht.
Ich mochte den Argwohn meiner Mutter nicht, konnte den unausgesprochenen Verdacht aber nicht entkräften, ohne die Aufmerksamkeit erst recht darauf zu lenken.
Allein mit dem einen Wort jedoch hatte der Tischler zu verstehen gegeben, dass er sich freute, behilflich gewesen zu sein. Meine Mutter war in Gedanken weiterhin bei dem Inhalt des Kästchens und schwieg. Signor Giovanni ließ ihr Zeit, blickte sich, wohl weil er nicht wusste, was er noch sagen sollte, im Zimmer um und verkündete schließlich, an den Zweck seines Besuches anknüpfend, er nehme den Sekretär jetzt mit und versetze ihn in seinen ursprünglichen Zustand. Er kenne die künstlerische Handschrift, wolle sich aber noch nicht festlegen, da die Signatur an der Unterseite verwischt sei. Besonders imponiere ihm, und damit lud er sich das Möbelstück auf die Schultern, dass der Erbauer außer bei den Angeln keine Nägel verwendet habe. Doch auch in dieser Hinsicht sei er sich noch nicht sicher, er sage uns Bescheid. Die beiden Bilderrahmen werde er ein anderes Mal holen. Und damit verabschiedete er sich.
»Da, nimm, der gehört jetzt dir«, sagte meine Mutter und gab mir den Füller, der, wie es der Zufall wollte, tatsächlich ein Pelikan war. Er sah genauso aus wie der, den man in dem Schreibwarengeschäft bei meiner Schule kaufen konnte. Doch er machte mir keine Freude. Er war als Nachsatz gekommen, als Zugeständnis, nicht als Geschenk, wobei immerhin mein Name daraufstand, und das beglückte mich. Während wir Signor Giovanni nachblickten, erzählte meine Mutter mir eine merkwürdige Geschichte über ihren Schwiegervater: In seiner Pariser Zeit sei ihm eines Tages beim Schreiben der Füller heruntergefallen, und in seiner Hast, ihn aufzufangen, hatte sich die Feder in seine Haut gebohrt.
»Und?« Mir war nicht klar, worauf sie hinauswollte.
»Sie hat in seiner Handfläche eine kleine Tätowierung hinterlassen, auf die er sehr stolz war. Er erzählte immer gern, wie es dazu kam.«
Warum sie das jetzt erwähne?
»Nur so«, sagte sie. »Vielleicht weil wir uns alle so gewünscht haben, dass er dich noch kennenlernt. Ich glaube, dein Vater hat keinen Menschen so geliebt wie ihn. Jedenfalls hätte er sicher gern gehabt, dass du seinen Füller bekommst. Vielleicht hilft er dir ja bei deiner Prüfung.«
Als ich im Herbst dann in Latein und Griechisch nachgeprüft wurde, half der Füller tatsächlich.
Ein paar Tage später kam Nanni wieder, um die Bilderrahmen abzuholen. Mein Vater hatte eine frühere Fähre genommen und war schon zu Hause.
Als es klingelte, stand er auf und ging zur Tür. Wie üblich, wenn er das Zimmer verließ, folgten Gog und Magog ihm auf dem Fuße.
»Stai bene? Alles klar bei dir?«, fragte mein Vater.
»Benone, e tu? Alles klar, und bei dir?«, fragte Nanni zurück.
Nanni erklärte, er sei wegen der Bilderrahmen gekommen und könne nicht lange bleiben. Er kraulte die Hunde am Kopf.
»Wie geht’s dem Ellbogen?«, fragte mein Vater.
»Viel besser.«
»Hast du gemacht, was ich dir gesagt habe?«
»Das tu ich immer – weißt du doch.«
»Schon, aber hast du wirklich jedes Mal dreißig Sekunden durchgehalten?«
»Natürlich!«
»Zeig’s mir noch mal.«
Nanni wollte schon die Streckbewegung des Armes vorführen, die mein Vater ihm empfohlen hatte, aber dann sah er mich in der Tür stehen, und ein verblüfftes »Ciao Paolo!« brach aus ihm heraus, als hätte er vergessen, dass ich hier wohnte oder dass es mich überhaupt gab.
Er ließ den Arm wieder sinken, steuerte ohne Umschweife aufs Wohnzimmer zu und hob die beiden Bilderrahmen hoch, die an der Wand lehnten. Dann wechselte er noch ein paar höfliche Worte mit meiner Mutter, die auf dem Sofa saß und las. Ob sie wegen der Uhr schon etwas unternommen habe?
Leider nein. Das klang pikiert. Meine Mutter mochte es nicht, wenn man sie auf Versäumnisse hinwies.
Ein peinlicher Moment entstand.
»Wusstest du eigentlich, dass er der schnellste Schwimmer von San Giustiniano ist?«, fragte mein Vater meine Mutter.
»Ma che cosa stai a dire, was redest du da?«, protestierte Nanni.
Ich wusste natürlich, dass mein Vater morgens immer schwimmen ging, aber dass Nanni auch gern schwamm, war mir neu.
»Wir nennen ihn Tarzan.«
»Tarzan, was für ein hübscher Name«, erwiderte meine Mutter ironisch, als hätte sie das Wort noch nie gehört und wäre wild entschlossen, sich aus dem geistlosen Geplänkel zwischen dem Dorftischler und dem weltberühmten Wissenschaftler herauszuhalten. Der vertrauliche Ton zwischen Nanni und meinem Vater verärgerte sie, das spürte ich.
»Du solltest mal hören, wie er den Tarzan-Schrei nachmacht.« Und an Nanni gewandt: »Komm, führ schon vor.«
»Ganz sicher nicht.«
»Er schreit, und dann schwimmt er los. Neulich ist er in viereinhalb Minuten durch die Bucht geschwommen. Ich brauche acht.«
»Falls du nicht vorher aufgibst«, spöttelte Nanni. »Zehn oder elf sind es wohl eher.« Dann schien er die Anspannung im Raum zu spüren, denn er drehte sich um und verabschiedete sich mit einem zwanglosen: »A la prossima.« Bis bald. Mein Vater quittierte fügsam mit einem »Si«.
Mir gefiel ihre kameradschaftliche Art und wie sie miteinander flachsten. So erlebte ich meinen Vater selten, so lebhaft, spitzbübisch, fast kindisch. »Wie findest du ihn?«, fragte er meine Mutter.
»Eigentlich ganz nett.« Sie bemühte sich, gleichgültig zu klingen. Ich hörte sogar einen feindseligen Unterton heraus, der nicht unbedingt von einer ehrlichen Empfindung herrühren musste, sondern eher ihre Art war, alles und jeden, den nicht sie in den Schoß der Familie geholt hatte, schlechtzumachen. Doch als sie das entnervte Achselzucken meines Vaters bemerkte, das besagte, sie hätte ja trotzdem etwas Freundliches über den armen Kerl sagen können, fügte sie hinzu, er habe wunderschöne Wimpern. »Frauen fällt so etwas auf.«
Mir waren seine Wimpern nicht aufgefallen. Aber vielleicht lag es auch an ihnen, dass ich seinem Blick nie standhalten konnte. Er hatte die schönsten Augen, die ich je gesehen hatte, ja, kein anderes Augenpaar war mir zuvor überhaupt derart aufgefallen. »Trotzdem kommt er mir ein bisschen vorlaut vor, ein bisschen dreist. Er ordnet sich nicht gern unter, stimmt’s?«
Was sie eigentlich geärgert hatte und warum ihr die Laune verging, als Nanni unser Haus betreten und so zielsicher die Bilderrahmen angesteuert hatte, war aber, dass er seinen Auftraggeber so vertraulich geduzt hatte, das spürte ich genau.
Eine Woche später beschloss meine Mutter, dem Tischler einen Besuch abzustatten. Ob ich mitkommen wolle? »Klar«, sagte ich und fügte ein lässiges »Meinetwegen« hinzu. Womöglich spürte sie in meinem gespielt beiläufigen Meinetwegen einen Unterton, der sie aufhorchen ließ, denn ein paar Minuten später sagte sie aus heiterem Himmel, sie freue sich, dass ich mich für die alltäglichen, irdischen Dinge interessiere. Was für irdische Dinge?, fragte ich, denn ich wollte lieber genau wissen, was sie aus meiner dahingesagten Antwort für Schlüsse gezogen hatte. »Ach, na ja, Möbel zum Beispiel.« Es wäre ihr auch zuzutrauen gewesen, dass sie »Freunde, Menschen, das Leben« hinzugefügt hätte, da sie stets misstrauisch und etwas spöttisch auf meine Bemerkungen reagierte. Vielleicht war ihr aber auch gar nichts aufgefallen, jedenfalls nicht mehr als mir, wobei ich schon gespürt hatte, und sie vielleicht genauso, dass in meiner saloppen Antwort etwas Bemühtes lag.
Als wir am frühen Nachmittag durch den alten Ortsteil zu Signor Giovannis Werkstatt schlenderten, erinnerte mich ihr vielsagendes Schweigen seltsamerweise an etwas, das sie vielleicht ein Jahr zuvor auf einem ähnlichen Spaziergang zu mir gesagt hatte: dass ich mich nie von einem Erwachsenen oder älteren Jungen da unten anfassen lassen solle. Ihre Bemerkung hatte mich damals völlig aus der Fassung gebracht, weshalb ich gar nicht gefragt hatte, warum um Himmels willen jemand auf die Idee kommen sollte, mich da unten anfassen zu wollen. Doch an jenem Nachmittag kam mir auf unserem Weg den Hügel hinauf nach San Giustiniano Alta ihre Warnung wieder in den Sinn.
In der Werkstatt roch es durchdringend nach Terpentin – ich kannte den Geruch aus dem Kunstunterricht. Hier in der Gasse verband ich ihn sofort mit den stillen Nachmittagen, wenn alle nach dem Mittagessen stundenlang ihre Siesta hielten und nur ein paar Läden offen hatten. Der Friseur, der Kaufmann, die Kaffeerösterei, der Bäcker – alle geschlossen. Signor Giovanni schnitzte in aller Ruhe an einem verschnörkelten Teil herum, die Türen weit offen, damit die Dämpfe abziehen konnten. Er wirkte nicht überrascht über unseren Besuch, stand augenblicklich auf und wischte sich mit dem Schürzenzipfel den Schweiß von der Stirn. Dann bat er um einen Moment Geduld und verschwand in ein Hinterzimmer, um unseren Sekretär zu holen.
So allein gelassen in der Nachmittagsstille dieser Werkstatt fühlten sich meine Mutter und ich völlig fehl am Platz. Ich blickte mich um. Jede Menge Werkzeuge, jede Menge Krempel, überall Sägemehl. An einer Ziegelwand hing an einem Nagel ein grober brauner Pullover. Man sah ihm schon an, dass er kratzte, und als ich hinfasste, fühlte sich das Material überhaupt nicht nach Wolle an, sondern eher wie eine Mischung aus Sackleinen und Stoppelbart. Ein Blick von meiner Mutter bedeutete mir: Finger weg.
Schließlich wurde der Sekretär vor uns abgestellt. Er hatte seinen Glanz eingebüßt und sah matt und stumpf aus, als wäre ihm bei lebendigem Leib die Haut abgezogen worden. »Er ist noch nicht fertig«, sagte Nanni, als er den Blick meiner Mutter bemerkte – Entsetzen, mühsam getarnt als Besorgnis. Er verstand ihre Sorge und versprach, dass sie in ein paar Wochen gar nicht würde fassen können, wie der Sekretär im Kerzenschein schimmere, so leuchtend und durchscheinend wie polierter Marmor. Um von seinen ungelenken und vermutlich fruchtlosen Beschwichtigungsversuchen abzulenken, fragte ich Signor Giovanni noch einmal, woher er von dem Kästchen gewusst habe. »Wenn man das eine Weile gemacht hat, weiß man so etwas einfach«, erwiderte er und wiederholte gleich noch einmal, Man weiß es einfach, als ließen sich harte Arbeit und die in jahrelanger Schufterei gewonnene Erfahrung nur mit einem Seufzer quittieren. Auf einmal wirkte er gealtert, arbeitsmüde, gedämpft, ja traurig. Er führte meiner Mutter vor, was genau er an dem Sekretär restaurierte. Es war ein Meisterwerk aus glatten, fein geschliffenen Kurven, nur die Beine wirkten seltsam grau; er habe sie vorübergehend mit einer Schutzschicht überzogen. Er legte die Hand auf den rundlichen Aufsatz und ließ sie dort ruhen wie auf der Kruppe eines gutmütigen Pferdes. Als ich so tat, als spähte ich in das Loch, in dem das Kästchen meines Großvaters so lange verborgen gewesen war, legte er auch mir eine Hand auf den Rücken. Damit er nur ja nicht das Thema wechselte oder, falls meine Mutter eine Bemerkung machte, die Hand wieder wegnahm, spähte ich immer weiter und stellte eine Frage nach der anderen, zum Holz, zum Stil, zu den Mitteln, mit denen er die Schmutzschichten ablöste, um das schäbige Objekt, das so lange in einer Ecke unseres Hauses sein Dasein gefristet hatte, wieder zum Leben zu erwecken. Woher er wisse, wann er vom groben Schleifpapier zum feineren wechseln müsse? Ob Terpentin nicht schädlich sei für das Holz? Welche Mittel er sonst noch nehme, wo er das alles gelernt habe, wieso es so lange dauere? Ich hörte ihn ungeheuer gern reden, ganz besonders, wenn ich auf etwas deutete und er sich zu mir herunterbeugte, um es mir zu erklären. Meine Mutter hatte recht gehabt. Auch mir gefiel seine Stimme, vor allem wenn er mir so nahe kam, dass ich seinen Atem spürte und er mir ins Ohr zu raunen schien. Er wusste so viel, und dennoch klang sein Seufzen, wenn er zu einer Antwort ansetzte, so verletzlich und unsicher, als würde er dem Schicksal nicht vertrauen. Die Dinge tun nicht immer, was man von ihnen wolle, meinte er. Was für Dinge?, fragte ich. Das belustigte ihn offensichtlich. Und dann, an meine Mutter gewandt: »Manchmal ist es das Leben selbst, manchmal ein Stück Holz, das sich nicht so biegen lässt, wie man es gern hätte.«
Ich musste daran denken, wie er am Ende seines ersten Besuchs die Teile an dem Sekretär, die sich hätten öffnen oder hätten herausfallen können, verzurrt und sich dann das Möbel auf die Schulter geladen hatte und gegangen war. Wie Aeneas, dachte ich, als er bei der Flucht aus Troja seinen betagten Vater auf die Schulter und seinen kleinen Sohn Ascanius an der Hand genommen hatte. Ich wäre am liebsten Ascanius gewesen, hätte am liebsten ihn zum Vater gehabt, wäre am liebsten mit ihm fortgegangen. Seine Werkstatt sollte unser Zuhause sein, mitsamt dem Dreck, dem Sägemehl, dem Staub, dem Terpentin, mit allem Drum und Dran. Der Vater, den ich hatte, war ein wunderbarer Mensch, aber Signor Giovanni würde ihn noch übertreffen, mir noch mehr sein als nur ein Vater.
Als wir die Werkstatt verließen, schaute meine Mutter beim Bäcker vorbei und kaufte mir ein Mandeltörtchen. Und sich gleich eines dazu. Wir aßen sie im Gehen und sprachen beide kein Wort.
Was ich in Signor Giovannis Werkstatt empfunden hatte, war ungewöhnlich, womöglich irgendwie ungesund, das war mir schon bewusst. Noch deutlicher spürte ich es an dem Tag, als ich nach meiner Nachhilfestunde beschloss, den längeren Nachhauseweg zu nehmen und, nachdem ich mindestens zweimal die Altstadt umrundet hatte, schließlich an die Glastür zu seiner Werkstatt zu klopfen. Er gab gerade seinem Gehilfen Anweisungen, einem Jungen, kaum älter als ich, der sich später als sein Bruder Ruggiero entpuppte.
Als er mich sah, nickte er knapp zur Begrüßung und wischte sich dabei mit einem, wie ich später erfahren sollte, in Verdünner getauchten Tuch die Ölflecken von den Händen. »Ich habe deiner Mutter doch gesagt, dass er noch nicht fertig ist«, sagte er, sichtlich verärgert über meinen Spontanbesuch, den er wohl als listigen, aus der Ungeduld meiner Mutter geborenen Übergriff verstand. Ich sei auf dem Nachhauseweg von meiner Nachhilfestunde, erwiderte ich, und habe nur kurz hereinschauen wollen. Ich wagte es kaum, ihn anzusehen.