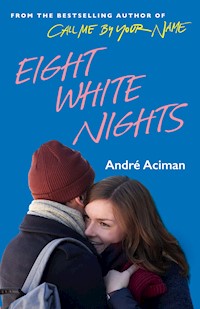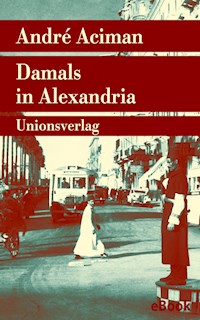9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte von ›Call me by your name‹ geht weiter Samuel ist auf dem Weg nach Rom, um seinen Sohn Elio zu besuchen, der dort als Pianist lebt. Seit der Trennung von seiner großen Jugendliebe Oliver ist Elio keine längere und ernsthafte Beziehung eingegangen. Oliver hingegen hat in New York geheiratet, ein bürgerliches Leben als Collegeprofessor begonnen, eine Familie gegründet. Doch insgeheim wartet er auf die Begegnung mit einem Menschen, die ihn so erschüttert und bewegt wie einst die mit Elio. Und Samuel begegnet auf seiner Reise einem Menschen, der ihm nach dem Ende seiner Ehe zeigt, was es bedeutet zu lieben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2020
Sammlungen
Ähnliche
Über das Buch
Samuel ist auf dem Weg nach Rom, um seinen Sohn Elio zu besuchen, der dort als Pianist lebt. Seit der Trennung von seiner großen Jugendliebe Oliver ist Elio keine längere und ernsthafte Beziehung eingegangen. Oliver hingegen hat in New York geheiratet, ein bürgerliches Leben als Collegeprofessor begonnen, eine Familie gegründet. Doch insgeheim wartet er auf die Begegnung mit einem Menschen, die ihn so erschüttert und bewegt wie einst mit Elio. Und Samuel begegnet auf seiner Reise einem Menschen, der ihm nach dem Ende seiner Ehe zeigt, was es bedeutet zu lieben.
Gefühlvoll und nachdenklich erzählt André Aciman die Geschichte von ›Call Me By Your Name‹ weiter, in einem sinnlichen Roman über die Suche nach der großen Liebe, die ein Leben lang dauert.
Para mis tres hijos
TEMPO
Warum so mürrisch?
Ich sah sie in Florenz am Bahnhof zusteigen. Sie öffnete die gläserne Schiebetür, schaute sich kurz im Wagen um und ließ ihren Rucksack auf den freien Platz neben mir fallen. Dann zog sie die Lederjacke aus, legte ihre Lektüre ab, ein englischsprachiges Taschenbuch, schob eine quadratische weiße Schachtel auf die Gepäckablage und warf sich mit einem grummelnden Schnaufen in den Sitz mir schräg gegenüber. Es sah aus, als hätte sie Sekunden vor dem Einsteigen noch eine heftige Auseinandersetzung gehabt und käme nicht hinweg über die harschen Worte, die sie oder jemand anderes vor dem Auflegen gesprochen hatte. Auch ihr Hund, den sie sich zwischen die Füße klemmte und an einer um die Faust geschlungenen roten Leine hielt, wirkte gereizt. »Buona, gutes Mädchen«, sagte sie, um das Tier zu beruhigen, und noch einmal, »buona«, weil der Hund weiter zappelte und sich aus der Umklammerung zu befreien versuchte. Dass dort jetzt ein Hund hockte, ärgerte mich, und ich machte erst gar keine Anstalten, das übergeschlagene Bein herunterzunehmen oder ihm sonst irgendwie Platz zu machen. Aber die junge Frau schien weder mich noch meine Körpersprache zu bemerken. Sie wühlte in ihrem Rucksack, fand das Gesuchte, eine kleine Plastiktüte, und nahm zwei knochenförmige Leckerlis heraus. Sie legte sie sich auf die Hand und sah zu, wie der Hund sie aufschleckte. »Brava.« Nachdem er fürs Erste ruhiggestellt war, setzte sie sich ein wenig auf und zog ihr Hemd zurecht, ruckte ein paarmal auf ihrem Platz und versank in einer Art dumpfem Ärger, dabei starrte sie, als der Zug den Bahnhof Santa Maria Novella verließ, wie unbeteiligt auf Florenz hinaus. Doch in ihr brodelte es weiter, und sie schüttelte, vielleicht ohne es selber zu merken, den Kopf, einmal, zweimal, offenbar immer noch stinksauer auf die Person, mit der sie vor dem Einsteigen gestritten hatte. Für einen Moment sah sie so verzweifelt aus, dass ich mich dabei ertappte, wie ich über meinem aufgeschlagenen Buch darum rang, irgendein Wort zu sagen, und sei es, um zu entschärfen, was nach einem sich zusammenbrauenden Unwetter roch, einem Sturm, der dort in unserer kleinen Ecke am Ende des Wagens loszubrechen drohte. Ich zögerte. Nein, besser die Frau in Ruhe lassen und weiterlesen. Aber dann sah ich, wie sie zu mir schaute, und ich konnte nicht anders: »Warum so mürrisch?«, fragte ich.
Mir war gar nicht in den Sinn gekommen, wie unangebracht die Frage in den Ohren einer wildfremden Mitreisenden klingen musste, noch dazu, wo sie es darauf anzulegen schien, bei der kleinsten Provokation zu explodieren. Sie sah mich an, mit einem irritierten, grimmigen Funkeln in den Augen, und ich hörte schon die Worte, mit denen sie mich zurechtstutzen würde. Kümmer dich um deinen eigenen Kram, Opi. Oder: Was geht dich das an? Vielleicht würde sie auch ein Gesicht ziehen, und dann, mit einem vernichtenden Blick: Idiot!
»Nein, nicht mürrisch, ich denke nur nach«, sagte sie.
Ich war so perplex über ihren sanften, fast reumütigen Ton, dass ich noch sprachloser war, als wenn sie mir gesagt hätte, ich solle mich verpissen.
»Vielleicht sehe ich vom Nachdenken so aus.«
»Aha, dann sind es schöne Gedanken?«
»Nein, schöne auch nicht«, antwortete sie.
Ich lächelte, sagte aber nichts und bedauerte schon mein dummes Spielchen.
»Eher düstere, vielleicht, ja«, räumte sie mit einem leisen Lachen ein.
Ich entschuldigte mich für meine Taktlosigkeit.
»Nicht nötig«, sagte sie, und ihre Augen flogen über die heranziehende Landschaft vor dem Fenster. War sie Amerikanerin, fragte ich? War sie. »Ich auch«, sagte ich. »Das hört man an Ihrem Akzent«, meinte sie lächelnd. Ich erklärte ihr, dass ich seit fast dreißig Jahren in Italien lebte, nur den Akzent, den bekäme ich nie und nimmer weg. Als ich wissen wollte, was sie in Italien machte, sagte sie, sie sei als Zwölfjährige mit ihren Eltern hergezogen.
Wir waren beide auf dem Weg nach Rom. »Job?«, fragte ich.
»Nein, Job nicht. Mein Vater. Es geht ihm nicht gut.« Sie schaute auf: »Wird wohl der Grund sein für mein Gesicht.«
»Ist es ernst?«
»Sieht so aus, ja.«
»Das tut mir leid.«
Sie zuckte die Achseln. »So ist das Leben!«
Dann änderte sich ihr Tonfall. »Und Sie? Privat oder geschäftlich?«
Ich musste schmunzeln über diese zwinkernde Klischeefrage und sagte, ich sei eingeladen, an der Uni einen Vortrag zu halten. Aber ich würde mich auch mit meinem Sohn treffen, er lebe in Rom und hole mich am Bahnhof ab.
»Bestimmt ein süßer Kerl.«
Das sollte wohl witzig sein. Aber ich mochte ihre forsche, ungezwungene Art, wie sie vom Mürrischen ins Muntere wechselte und einfach annahm, bei mir wäre es nicht anders. Der Tonfall passte zu ihrer lässigen Kleidung: ausgetretene Wanderschuhe, Jeans, kein Make-up und ein halb aufgeknöpftes, verwaschenes, irgendwie rotes Holzfällerhemd, darunter ein schwarzes T-Shirt. Und dennoch, trotz ihres etwas zerknautschten Aussehens waren da ihre grünen Augen und die dunklen Brauen. Sie weiß es, dachte ich. Weiß wahrscheinlich genau, warum ich die dumme Bemerkung über ihre Miene gemacht habe. Ausländer, da war ich mir sicher, fanden immer einen Vorwand, um sie anzusprechen. Ja, das mag diesen gereizten Versuch’s erst gar nicht-Blick erklären, mit dem sie ihre Umwelt auf Distanz hält.
Nach ihrer ironischen Bemerkung über meinen Sohn wunderte es mich nicht, dass dem Gespräch die Luft ausging. Gute Gelegenheit, zu unseren Büchern zu greifen. Aber dann sah sie erneut zu mir und fragte geradeheraus: »Freuen Sie sich, Ihren Sohn zu sehen?« Wieder dachte ich, sie wollte sich über mich lustig machen, aber es klang nicht nur dahingesagt. So wie sie persönlich wurde und alle Schranken niederriss, die es zwischen Fremden in einem Zug gab, hatte es etwas Charmantes und Entwaffnendes. Mir gefiel das. Vielleicht wollte sie ja wirklich wissen, was ein fast doppelt so alter Mann empfand, wenn er zu seinem Sohn fuhr. Oder sie hatte einfach keine Lust zu lesen. Sie wartete auf meine Antwort. »Ich meine, macht es Sie – glücklich? Oder eher – nervös?«
»Nein, nervös nicht, höchstens ein bisschen, schon möglich«, sagte ich. »Eltern haben immer Angst, sich aufzudrängen oder, noch schlimmer, als Langweiler dazustehen.«
»Sie denken, Sie sind ein Langweiler?«
Meine Worte hatten Sie überrascht, das freute mich.
»Vielleicht, ja. Aber mal ehrlich, wer ist das nicht.«
»Mein Vater ist bestimmt kein Langweiler.«
War ich ihr zu nahe getreten? »Dann nehme ich es zurück«, sagte ich.
Sie sah mich an, lächelte. »Nicht so schnell.«
Eine Frau, die ansetzt und einen gleich durchbohrt. Es erinnerte mich an meinen Sohn – sie war ein wenig älter, hatte aber dasselbe Talent, jeden Fauxpas und noch den kleinsten Ausweichschlenker aufzuspießen, und wenn wir dann stritten und uns wieder vertrugen, hatte ich keinen Boden mehr unter den Füßen.
Was für ein Mensch bist du, wenn dich jemand kennenlernt?, hätte ich am liebsten gefragt. Bist du witzig, fröhlich, verspielt, oder ist da ein düsteres, übellauniges Serum, das durch deine Adern fließt und deine Gesichtszüge trübt, dein Lachen verdunkelt, all das, was dein Lächeln und deine grünen Augen versprechen? Das wollte ich wissen – ich selbst hätte es nicht sagen können.
Fast hätte ich sie schon beglückwünscht für ihr Talent, Menschen wie ein offenes Buch zu lesen, aber ihr Handy klingelte. Der Freund, klar. Wer sonst. Ich war so daran gewöhnt, von Handys unterbrochen zu werden, dass ich es kaum noch schaffte, mit meinen Studenten einen Kaffee zu trinken oder mich mit meinen Kollegen oder meinem Sohn zu unterhalten, selbst wenn gar kein Anruf dazwischenkam. Vom Handy gerettet, vom Handy zum Schweigen gebracht, vom Handy ausmanövriert.
»Hi Paps«, sagte sie, kaum dass es klingelte. Ich dachte erst, sie wäre sofort rangegangen, damit der laute Klingelton die anderen Fahrgäste nicht störte. Aber dann war ich überrascht, wie sie in das Ding hineinbrüllte. »Der blöde Zug. Er hat angehalten, keine Ahnung, für wie lange, aber in zwei Stunden sollte ich da sein. Bis gleich.« Ihr Vater fragte etwas. »Natürlich habe ich das, du Dummerchen, wie könnte ich das vergessen.« Er fragte noch etwas. »Ja, das auch.« Schweigen. »Von mir auch. Ein ganz dickes.«
Sie legte auf und warf das Handy in den Rucksack, wie um zu sagen: Bloß nicht noch mal unterbrochen werden. Sie lächelte ein wenig steif. »Eltern«, sagte sie schließlich, was so viel hieß wie, Sind doch alle gleich, oder?
Aber dann erklärte sie es mir. »Ich besuche meinen Vater jedes Wochenende. Ich bin sein Wochenendboy, meine Geschwister und eine Pflegekraft kümmern sich unter der Woche um ihn.« Und bevor ich auch nur ein Wort sagen konnte: »Das heißt, Sie haben sich für die Veranstaltung heute Abend in Schale geworfen?«
Was für eine Beschreibung! »Ich und in Schale?«, nahm ich den Ball zum Scherz auf, nicht, dass sie auf die Idee kam, ich wäre auf Komplimente aus.
»Na ja, das Einstecktuch, das auf Kante gebügelte Hemd, kein Schlips, aber diese Manschettenknöpfe! Ich würde sagen, Sie haben sich Gedanken gemacht. Ein bisschen Old School, aber schick.«
Wir mussten beide schmunzeln.
»Das hier nicht vergessen«, sagte ich, zupfte ein Stück bunte Krawatte aus meiner Jackentasche und steckte es wieder zurück. Sie sollte sehen, dass ich Sinn für Humor hatte und mich selbst auf die Schippe nehmen konnte.
»Das meinte ich ja«, sagte sie. »In Schale geworfen! Nicht wie ein pensionierter Professor im Sonntagsanzug, aber fast. Also, was machen Sie und Ihr Sohn in Rom?«
Sollte das jetzt ewig so weitergehen? Hatte ich mit meiner ersten Frage etwas angestoßen, was sie in dem Glauben wiegte, wir könnten uns so ungezwungen unterhalten? »Wir sehen uns alle fünf oder sechs Wochen. Er lebt in Rom, zieht aber bald nach Paris. Ich vermisse ihn schon jetzt. Ich verbringe gerne den Tag mit ihm. Wir machen nichts Besonderes, gehen meist spazieren, auch wenn es am Ende fast immer derselbe Weg ist: sein Rom, in der Umgebung des Konservatoriums, mein Rom, wo ich als junger Dozent gewohnt habe. Irgendwann essen wir dann bei Armando zu Mittag. Er erträgt meine Gesellschaft, genießt sie vielleicht, das ist mir bis heute nicht klar, vielleicht beides, aber die Besuche sind für uns zu einem Ritual geworden: Via Vittoria, Via Belsiana, Via del Babuino. Manchmal führt uns der Weg bis zum Protestantischen Friedhof. Alles Marksteine unseres Lebens. Wir haben sie scherzhaft unsere Vigilien genannt, nach der Art, wie fromme Menschen an den madonnelle stehen bleiben, diesen Straßentabernakeln, um der örtlichen Madonna zu huldigen. Keiner von uns beiden vergisst das je: Lunch, Spaziergang, Vigilien. Mich macht es glücklich. Schon mit ihm durch Rom zu laufen, ist eine Vigilie. Wo immer du gehst, stolperst du über Erinnerungen – die eigenen, die von jemand anderem, die der Stadt. Ich mag Rom in der Dämmerung, er mag die Stadt am Nachmittag, und es kommt vor, dass wir einfach irgendwo einen Tee trinken, nur um die Sache ein bisschen hinauszuziehen, bis es Abend wird und wir uns ein Glas genehmigen.«
»Das ist alles?«
»Das ist alles. Für mich erst über die Via Margutta, für ihn dann über die Via Belsiana – alte Lieben.«
»Vigilien vergangener Vigilien?«, scherzte die junge Frau im Zug. »Ist er verheiratet?«
»Nein.«
»Aber gibt es jemanden?«
»Das weiß ich nicht. Vermutlich schon. Ich mache mir trotzdem Sorgen. Einmal gab es jemanden, und natürlich habe ich ihn gefragt, ob es jetzt jemanden gibt, aber er hat nur den Kopf geschüttelt und gesagt: ›Frag nicht, Papa, frag mich nicht.‹ Mit anderen Worten: niemand oder die ganze Welt, und ich könnte nicht sagen, was schlimmer ist. Dabei war er immer so offen zu mir.«
»Ich würde sagen, er war ehrlich.«
»In gewisser Weise, ja.«
»Er gefällt mir«, sagte die junge Frau. »Vielleicht weil ich ganz ähnlich bin. Manchmal wirft man mir vor, ich wäre zu offen, zu vorlaut, und dann wieder heißt es, ich sei zu zurückhaltend und zu verschlossen.«
»Ich glaube nicht, dass er anderen gegenüber verschlossen ist. Aber glücklich wohl auch nicht.«
»Ich weiß, wie er sich fühlt.«
»In Ihrem Leben gibt es niemanden?«
»Wenn Sie wüssten.«
»Wie bitte?« Die Frage kam aus mir heraus wie ein trauriger Seufzer. Was sollte das heißen – dass es niemanden gab in ihrem Leben oder dass es zu viele waren? Oder dass der Mann in ihrem Leben sie verlassen hatte, zerstört zurückgelassen mit nichts als dem Verlangen, ihre Wut auf sich selbst zu richten oder auf eine ganze Phalanx von Liebhabern? Oder kamen und gingen die Leute einfach, kamen und gingen, wie so viele, fürchtete ich, bei meinem eigenen Sohn? Wenn sie nicht eine von denen war, die sich ins Leben der Menschen hineinschlichen und wieder hinaus, ohne eine Spur oder irgendein Andenken zu hinterlassen.
»Ich weiß nicht, ob ich der Typ bin, der Menschen überhaupt mag, von Verlieben gar nicht zu reden.«
Ich sah sie beide vor mir: die gleichen verbitterten, stumpfen, wunden Herzen.
»Mögen Sie die Menschen nicht, oder sind Sie die Menschen bloß leid und wissen beim besten Willen nicht mehr, warum Sie sie je interessant gefunden haben?«
Sie war auf einmal still, wie erschrocken, sagte kein Wort. Ihre Augen starrten mich an. War ich ihr wieder zu nahe getreten? »Wie konnten Sie das wissen?«, fragte sie schließlich. Es war das erste Mal, dass sie so ernst wurde, so böse schaute. Ihr war anzusehen, wie sie sich die Worte zurechtschliff, um sich meine anmaßende Einmischung in ihr Privatleben zu verbitten. Hätte ich doch den Mund gehalten. »Wir sind uns erst vor fünfzehn Minuten begegnet, und schon kennen Sie mich! Wie konnten Sie das alles über mich wissen?« Sie hielt kurz inne: »Wie viel nehmen Sie die Stunde?«
»Geht aufs Haus. Aber wenn ich etwas weiß, dann weil wir wohl alle so sind. Außerdem sind Sie jung und hübsch, ich bin sicher, die Männer fühlen sich zu Ihnen hingezogen, es dürfte Ihnen nicht schwerfallen, jemandem zu begegnen.«
Hatte ich wieder etwas Falsches gesagt? War ich zu weit gegangen?
Ich ruderte zurück: »Nur hält der Zauber einer neuen Bekanntschaft nie lange an. Wir wollen immer die Menschen, die wir nicht kriegen können. Und Spuren hinterlassen nur die, die wir verloren haben oder die von unserer Existenz nichts wussten. Von den anderen bleibt kaum ein Echo.«
»Ist das bei der Signorina Margutta so?«, fragte sie.
Die zieht das tatsächlich durch, dachte ich. Mir gefiel der Name, Signorina Margutta. Er tauchte alles, was vor Jahren zwischen uns gewesen war, in ein mildes, geschmeidiges, fast absurdes Licht.
»Das werde ich nie wirklich wissen. Wir waren nur kurz zusammen, und alles ging so schnell.«
»Wie lange ist das her?«
Ich dachte einen Moment nach.
»Das ist mir peinlich.«
»Och, sagen Sie doch einfach!«
»Mindestens zwanzig Jahre. Na ja, fast dreißig.«
»Und?«
»Wir sind uns auf einer Party begegnet, ich war damals Dozent in Rom. Sie war in Begleitung, ich war in Begleitung. Wir kamen ins Gespräch und fanden kein Ende. Irgendwann ging sie dann mit ihrem Freund, und kurz danach gingen wir auch. Wir haben nicht mal unsere Telefonnummern ausgetauscht. Aber ich konnte sie einfach nicht vergessen. Also rief ich den Freund an, der mich zu der Party eingeladen hatte, und fragte ihn nach ihrer Nummer. Und jetzt kommt das Beste. Einen Tag vorher hatte sie ihn ebenfalls angerufen und nach meiner Nummer gefragt. ›Ich habe gehört, du suchst nach mir‹, sagte ich, als ich sie schließlich anrief. Ich hätte wenigstens meinen Namen nennen sollen, aber ich hatte überhaupt nicht daran gedacht, so nervös war ich.
Sie erkannte mich sofort an der Stimme, oder unser Freund hatte sie vorgewarnt. ›Ich wollte dich anrufen‹, sagte sie. ›Hast du aber nicht‹, meinte ich, und sie: ›Nein, habe ich nicht.‹ Und dann sagte sie etwas, was bewies, dass sie mehr Mut hatte als ich, und mein Puls ging durch die Decke, denn das hatte ich nicht erwartet, ich werde es nie vergessen. ›Also, wie machen wir’s?‹, fragte sie. Wie machen wir’s? Dieser eine Satz, das war mir klar, katapultierte mein Leben aus seiner vertrauten Bahn. Niemand hatte je so offen zu mir gesprochen, es hatte etwas Wildes.«
»Sie gefällt mir.«
»Was könnte einem daran nicht gefallen. So unverblümt und forsch und mit der Tür ins Haus. Ich musste auf der Stelle eine Entscheidung treffen: ›Essen wir zusammen zu Mittag‹, sagte ich. ›Weil es abends schwierig ist, richtig?‹, fragte sie. Ich mochte diese unerschrockene Ironie, die in ihren Worten mitschwang. ›Essen wir zusammen zu Mittag – zum Beispiel heute‹, sagte ich. ›Dann zum Beispiel heute.‹ Wir mussten lachen, wie schnell das alles ging. Bis zum Mittag war es kaum noch eine Stunde.«
»Hat es Sie gestört, dass sie ihren Freund betrügen wollte?«
»Nein. Es hat mich auch nicht gestört, dass es bei mir dasselbe war. Unser Lunch zog sich bis in den Nachmittag. Hinterher begleitete ich sie zu ihrem Haus in der Via Margutta, und danach ging sie mit mir wieder zurück zu dem Restaurant, wo wir gegessen hatten, und ich brachte sie ein weiteres Mal zurück zu ihrem Haus.
›Morgen?‹, fragte ich. Ich war mir unsicher, wollte nicht drängen. ›Morgen, klar doch.‹ Es war die Woche vor Weihnachten, und an dem Dienstag haben wir dann etwas völlig Verrücktes gemacht: Wir haben zwei Tickets gekauft und sind nach London geflogen.«
»Wie romantisch!«
»Alles ging so schnell, als wäre es das Natürlichste der Welt. Wir haben es nicht mal für nötig gehalten, die Sache mit unseren Partnern zu besprechen oder auch nur einen Gedanken an sie zu verschwenden. Wir haben einfach alle Hemmungen abgelegt. Damals hatten wir so etwas noch, Hemmungen.«
»Sie meinen, anders als heute?«
»Da bin ich die falsche Adresse.«
»Würde ich auch so sehen.«
Ihre Stichelei machte mir klar, dass ich mich ruhig ein bisschen provoziert fühlen durfte.
Ich kicherte.
Sie kicherte ebenfalls, womit sie mir auf ihre Weise zu verstehen gab, dass sie wusste, dass meine Reaktion unaufrichtig war.
»Wie auch immer, es war gleich wieder vorbei. Sie ging zurück zu ihrem Freund und ich zu meiner Freundin. Befreundet sind wir nicht mehr, aber ich war auf ihrer Hochzeit, und zu unserer habe ich sie auch eingeladen. Sie sind noch verheiratet. Wir nicht. Voilà.«
»Warum haben Sie es hingenommen, dass sie zu ihrem Freund zurückgeht?«
»Warum? Vielleicht weil ich von meinen Gefühlen nie ganz überzeugt war. Ich habe nicht um sie gekämpft, und sie hat gespürt, dass ich das nicht tun würde. Vielleicht wollte ich verliebt sein und fürchtete, ich wäre es nicht, und so schwebte ich lieber in unserem kleinen Zwischenhimmel in London, als mich dem zu stellen, was ich für sie nicht empfand. Vielleicht war mir der Zweifel auch lieber als das Wissen. Also, was nehmen Sie denn die Stunde?«
»Gut gekontert!«
Wann hatte ich zuletzt mit jemandem so gesprochen?
»Erzählen Sie mir von der Person in Ihrem Leben«, sagte ich. »Bestimmt gibt es da gerade jemanden.«
»Jemanden, ja.«
»Schon länger?« Ich biss mir auf die Zunge. »Wenn ich fragen darf.«
»Dürfen Sie. Knapp vier Monate.« Und mit einem Achselzucken: »Nicht der Rede wert.«
»Haben Sie ihn gern?«
»Ich mag ihn, ja. Wir verstehen uns gut. Und es gibt vieles, was wir beide mögen. Aber wir sind nur zwei Mitbewohner, die so tun, als würden sie zusammenleben. Tun wir aber nicht.«
»Was für eine Art, es auszudrücken. Zwei Mitbewohner, die so tun, als würden sie zusammenleben. Traurig, oder?«
»Ja, traurig. Aber traurig ist auch, dass ich in den letzten Minuten wahrscheinlich mehr mit Ihnen gemeinsam hatte als mit ihm in einer ganzen Woche.«
»Vielleicht sind Sie nicht der Typ, der sich anderen Menschen öffnet.«
»Aber ich rede doch mit Ihnen.«
»Ich bin ein Unbekannter, und Fremden gegenüber fällt das leicht.«
»Die Einzigen, mit denen ich offen reden kann, sind mein Vater und Pavlova, meine Hündin, und die werden beide nicht mehr allzu lange da sein. Außerdem hasst mein Vater meinen derzeitigen Freund.«
»Kommt bei Vätern vor.«
»Für meinen vorherigen Freund hat er geschwärmt.«
»Und Sie?«
Ihr Lächeln zeigte schon, dass ihre Antwort mit einer Prise Humor daherkommen würde: »Ich doch nicht.« Sie dachte einen Moment nach. »Mein vorheriger Freund wollte mich heiraten. Ich war dagegen. Als wir uns getrennt haben, war ich mehr als erleichtert, dass es ohne Krach über die Bühne ging. Kaum ein halbes Jahr später hörte ich, dass er heiratet. Ich war stinksauer. Wenn mich jemals etwas verletzt hat, wenn ich jemals der Liebe wegen geweint habe, dann an dem Tag, als ich hörte, dass er eine Frau heiratet, über die wir stundenlang, monatelang gelästert hatten.«
Schweigen.
»Eifersüchtig ohne die kleinste Verliebtheit – Sie sind ganz schön kompliziert«, sagte ich schließlich.
Der Blick, den sie mir zuwarf, war ein verdeckter Vorwurf, dass ich es wagte, so über sie zu reden, aber auch voll flirrender Neugier, mehr zu hören. »Ich kenne Sie seit weniger als einer Stunde. Und trotzdem verstehen Sie mich vollkommen. Das gefällt mir. Dann sollte ich Ihnen auch von einem anderen schrecklichen Makel erzählen.«
»Oha?«
Wir mussten beide lachen.
»Wenn ich mit jemandem eine Beziehung hatte, meide ich seine Nähe. Die meisten Menschen brechen nicht gern Brücken hinter sich ab. Ich jage sie in die Luft – wahrscheinlich, weil es im Grunde gar keine richtige Brücke gegeben hat. Manchmal lasse ich meine Sachen in der Wohnung und haue einfach ab. Ich hasse das Zusammenpacken und den Auszug und die unvermeidlichen Nachbeben, all die tränenreichen Bitten, man möge doch zusammenbleiben. Vor allem hasse ich diese geheuchelte Verbundenheit, nachdem man schon keine Berührung mehr erträgt und sich nicht mal erinnert, wann man zuletzt mit dem Kerl hat schlafen wollen. Sie haben recht: Ich weiß nicht, warum ich etwas mit jemandem anfange. Allein schon das ganze Nervige einer neuen Beziehung. Dazu die fremde Umgebung und die kleinen Gewohnheiten, die ich in Kauf nehmen muss. Der Geruch seines Vogelkäfigs. Die Art, wie er seine CDs stapelt. Das Geräusch eines alten Heizkörpers, das mich mitten in der Nacht weckt, nur mich, niemals ihn. Er will die Fenster geschlossen haben. Ich mag sie offen. Ich lasse meine Klamotten rumliegen, er besteht darauf, dass die Handtücher gefaltet in den Schrank kommen. Er möchte, dass die Zahnpastatube sauber von unten nach oben ausgedrückt wird, ich drücke drauf, wie es kommt, und verliere immer die Kappe, die findet er dann irgendwo auf dem Boden hinterm Klo. Die Fernbedienung hat ihren Platz, die Milch muss nah, aber nicht zu nah am Gefrierfach stehen, Unterwäsche und Socken gehören in die Schublade, nicht in die.
Trotzdem bin ich nicht kompliziert. Eigentlich bin ich recht umgänglich, nur ein bisschen eigensinnig. Aber das ist bloß Fassade. Ich komme mit allem und mit jedem aus. Zumindest eine Weile. Und irgendwann kommt es über mich: Ich will nicht mit dem Typen zusammen sein, will ihn nicht in meiner Nähe haben, muss weg von ihm, kämpfe an gegen dieses Gefühl. Aber sobald ein Mann das spürt, verfolgt er mich mit seinen verzweifelten Hundebabyaugen. Ich erkenne diesen Blick, und pfffft, weg bin ich und habe gleich jemand Neues.«
»Männer«, sagte sie am Ende noch, als fänden in diesem einen Wort alle Unzulänglichkeiten zusammen, über die die meisten Frauen bereitwillig hinwegsehen und die sie zu ertragen lernen und den Männern schließlich verzeihen, Männern, die sie für den Rest ihres Lebens zu lieben hoffen, auch wenn sie genau wissen, dass sie das nicht tun werden. »Ich hasse es, wenn jemand verletzt wird.«
Ein Schatten legte sich über ihre Miene. Ich wünschte, ich hätte ihr Gesicht berühren können, ganz sanft. Sie fing meinen Blick auf, ich schlug die Augen nieder.
Wieder fielen mir ihre Stiefel auf. Wilde, ungebändigte Stiefel, als hätten sie Märsche durch zerklüftetes Gelände hinter sich und so dieses gealterte, verwitterte Aussehen angenommen, was hieß, dass sie ihnen vertraute. Sie mochte getragene Sachen, die Schuhe eingelaufen. Mochte das Bequeme. Ihre dicken, marineblauen Wollsocken waren Herrensocken, wahrscheinlich aus der Schublade des Mannes, für den sie, wie sie sagte, keine Liebe empfand. Dafür sah die Übergangsjacke, die sie trug, eine Bikerjacke, sehr teuer aus. Bestimmt Prada. Ob sie sich die erstbesten Sachen geschnappt und die Wohnung ihres Freundes Hals über Kopf verlassen hatte, mit einem hastigen Ich fahr zu meinem Vater, ruf dich heute Abend an? Sie trug eine Herrenuhr. Auch von ihm? Oder waren ihr Herrenuhren einfach lieber? Alles an ihr hatte etwas Unnachgiebiges, Ungeschliffenes, Unfertiges. Und dann sah ich auf einmal ein Stückchen Haut zwischen ihren Socken und dem Aufschlag ihrer Jeans – was für ebenmäßige, schlanke Fesseln.
»Erzählen Sie von Ihrem Vater«, sagte ich.
»Meinem Vater? Es geht ihm nicht gut, er wird uns verlassen.« Dann unterbrach sie sich selbst: »Nehmen Sie immer noch pro Stunde?«
»Wie gesagt, es fällt leichter, sich Fremden anzuvertrauen, denen man nie wieder begegnet.«
»Denken Sie das?«
»Was, dass es leichter fällt, sich Leuten im Zug anzuvertrauen?«
»Nein, dass wir uns nie wieder begegnen.«
»Wie schätzen Sie die Chancen ein?«
»Wohl wahr.«
Wir lächelten einander zu.
»Dann erzählen Sie weiter von Ihrem Vater.«
»Ich habe darüber nachgedacht. Meine Gefühle für ihn haben sich verändert. Es ist nicht mehr diese spontane, tiefe Zuneigung, sondern eine grüblerische, behutsame, fürsorgliche. Auch nicht das Wahre. Trotzdem sind wir sehr offen zueinander, und es gibt nichts, wofür ich mich schämen würde. Meine Mutter ist vor fast zwanzig Jahren gegangen, und seither gibt es nur noch ihn und mich. Er hatte mal eine Freundin, aber jetzt lebt er allein. Jemand kommt und kümmert sich um ihn, kocht, wäscht, putzt und räumt auf. Heute ist sein Geburtstag, er wird sechsundsiebzig. Deshalb das Gebäck«, sagte sie und deutete auf die weiße Schachtel in der Ablage. Es schien ihr peinlich zu sein, vielleicht brach sie deshalb, als sie hinaufdeutete, in ein leises Kichern aus. »Er sagt, er hat zwei Freunde zum Mittagessen eingeladen, aber er hat noch nichts von ihnen gehört, und ich vermute mal, sie werden sich nicht blicken lassen, das tut heute keiner mehr. Meine Geschwister auch nicht. Er ist verrückt nach Profiteroles aus einem alten Laden in Florenz, ich wohne ganz in der Nähe. Sie erinnern ihn an bessere Zeiten, als er dort gelehrt hat. Natürlich sollte er nichts Süßes essen, aber …«
Sie brauchte den Satz nicht zu beenden.
Für eine Weile war es still zwischen uns. Ich griff wieder zu meinem Buch, bestimmt hatten wir uns fürs Erste alles gesagt. Etwas später sah ich, das Buch noch aufgeschlagen vor mir, in die hügelige Landschaft der Toskana, und meine Gedanken schweiften davon. Bis sich ein seltsames, formloses Bild, wie sie die Plätze wechselte und auf einmal neben mir saß, in meinem Kopf einnistete. Ich wusste, dass ich wegdöste.
»Sie lesen ja gar nicht«, sagte sie. Und als sie sah, dass sie mich vielleicht gestört hatte: »Ich kann auch nicht.«
»Keine Lust mehr«, sagte ich, »kann mich nicht konzentrieren.«
»Interessantes Buch?«, fragte sie mit einem Blick auf das Cover.
»Nicht schlecht. Aber Dostojewski nach so vielen Jahren noch einmal zu lesen, kann auch enttäuschend sein.«
»Warum?«
»Kennen Sie Dostojewski?«
»Ja. Mit fünfzehn habe ich für ihn geschwärmt.«
»Ich auch. Mit seiner Sicht auf das Leben können Jugendliche sofort etwas anfangen: voller Qualen und Widersprüche, Gift und Galle, Scham, Liebe, Mitleid, Kummer, Bösartigkeit, dazu die entwaffnendste Gutherzigkeit und Selbstaufopferung – alles vermischt und vermengt. Für mich als Heranwachsenden war Dostojewski eine Einführung in die komplexe Psychologie. Ich dachte, ich wäre der konfuseste Mensch überhaupt – aber seine Figuren waren nicht weniger konfus. Ich fühlte mich heimisch. Mein Gefühl sagt mir, dass man von Dostojewski mehr über das flattrige Wesen der menschlichen Psyche lernt als von Freud oder von sonst einem Psychiater.«
Sie schwieg.
»Ich gehe zu einem«, sagte sie schließlich, und der anschwellende Protest in ihrer Stimme war kaum zu überhören.
Hatte ich sie wieder vor den Kopf gestoßen?
»Ich auch«, sagte ich, vielleicht um zurückzunehmen, was sich womöglich angehört hatte wie eine unabsichtliche Kränkung.
Wir sahen uns fest an. Ich mochte ihr warmes, vertrauensvolles Lächeln; es hatte etwas Unverstelltes und Zerbrechliches, Verletzliches auch. Kein Wunder, dass die Männer in ihrem Leben so hartnäckig waren. Sie wussten, was ihnen verloren ging, wenn sie die Augen abwandte. Und kein Lächeln mehr, kein verträumtes Sehnen, wenn sie die ehrlichsten Fragen stellte und einen dabei mit diesen durchdringenden grünen Augen ansah, die niemals lockerließen; kein kribbelndes Verlangen nach Nähe, das ihr Blick jedem Mann entlockte, sobald seine Augen sich auf der Straße zufällig auf sie richteten und er genau wusste, dass dort sein Leben vorbeiging. Genau das machte sie jetzt. Sie gab der Nähe Raum, machte alles einfach, als hätte man eine solche Nähe schon immer in sich gespürt, das Bedürfnis, sie mit jemandem zu teilen, und dabei wurde einem klar, dass man diese Nähe niemals in sich selbst finden konnte, nur zusammen mit ihr. Ich wollte sie halten, ihre Hand nehmen, mit dem Finger über ihre Stirn streichen.
»Sie und Therapie?«, fragte sie, als hätte sie darüber nachgedacht und fände allein die Vorstellung abwegig. »Wenn ich fragen darf«, parodierte sie mich mit einem Lächeln. Offenbar war sie es nicht gewohnt, Fremden gegenüber einen milderen Ton anzuschlagen. Ich fragte, warum es sie überraschte, dass ich eine Therapie machte.
»Weil Sie so ausgeglichen wirken, so – in Schale.«
»Schwer zu sagen. Vielleicht weil diese Leere meiner Jugend, als ich Dostojewski entdeckte, nie ausgefüllt wurde. Früher dachte ich, irgendwann würde es passieren, aber inzwischen frage ich mich, ob sich solche leeren Räume überhaupt ausfüllen lassen. Trotzdem will ich sie verstehen. Manche von uns haben den Sprung auf die nächste Stufe nie geschafft. Wir haben aus den Augen verloren, wohin wir unterwegs waren, und wenn wir zurückblicken, sind wir am Ausgangspunkt geblieben.«
»Und deshalb lesen Sie jetzt wieder Dostojewski?«
Ich musste lächeln, die Frage traf es genau. »Vielleicht weil ich immer versuche, die Schritte zurückzugehen zu dem Punkt, an dem ich auf die Fähre hätte springen sollen, hin zu diesem anderen Ufer namens Leben, und am Ende hänge ich doch an der falschen Landestelle herum oder nehme, tja, gleich die falsche Fähre. Aber das ist ein Thema für ältere Männer.«
»Sie klingen eher nicht nach einem Menschen, der die falsche Fähre nimmt. Oder?«
Wollte sie mich aufziehen?
»Noch heute Morgen, beim Einsteigen in Genua, habe ich darüber nachgedacht. Vielleicht hat es tatsächlich ein- oder zweimal eine Fähre gegeben, mit der ich hätte fahren sollen.«
»Und warum haben Sie es nicht getan?«
Ich schüttelte den Kopf, zuckte die Achseln, um anzudeuten, dass ich es selber nicht wusste oder nicht sagen wollte.
»Sind das nicht die schlimmsten Szenarien überhaupt? Wenn etwas sich hätte ergeben können, aber nicht ergeben hat und sich immer noch ergeben kann, obwohl wir alle Hoffnung aufgegeben haben?«
Ich hätte wahrscheinlich kein perplexeres Gesicht machen können. »Wo haben Sie das denn her?«
»Ich lese viel.« Und mit einem verlegenen Blick: »Ich unterhalte mich gerne mit Ihnen.« Sie hielt kurz inne. »Dann war Ihre Ehe die falsche Fähre?«
Diese Frau war wirklich klasse. Und sie war schön. Und ihr Denken nahm dieselben mäandernden Wege, denen auch ich manchmal folgte.
»Zuerst nicht«, sagte ich, »oder zumindest wollte ich es nicht so sehen. Aber dann ging unser Sohn in die USA, und zwischen uns gab es nur noch so wenig, dass es mir vorkam, als wäre seine ganze Kindheit bloß eine Generalprobe gewesen für die unvermeidliche Trennung. Wir sprachen kaum miteinander, und wenn, hätte man meinen können, wir sprächen nicht dieselbe Sprache. Wir waren immer außerordentlich gut zueinander, nie ein böses Wort, aber selbst wenn wir im selben Raum waren, fühlten wir uns allein. Wir saßen am selben Esstisch, aßen aber nicht zusammen, schliefen im selben Bett, aber nicht zusammen, sahen dieselben Sendungen, bereisten dieselben Städte, hatten denselben Yogalehrer, lachten über dieselben Witze, aber nie zusammen, und wenn wir in einem überfüllten Kino nebeneinandersaßen, streiften sich nicht mal unsere Ellenbogen. Das ging so weit, dass ich mir, wenn ich auf der Straße ein Pärchen sah, das sich küsste oder auch nur umarmte, nicht mehr erklären konnte, warum sie das taten. Wir waren zusammen allein – bis eines Tages einer von uns die Picklesschale zerbrach.«
»Picklesschale?«
»Tschuldigung, Edith Wharton, der Roman ist hundert Jahre alt. Meine Frau hat mich für jemanden verlassen, der mein bester Freund war und immer noch mein Freund ist. Die Ironie an der Sache: Ich habe es überhaupt nicht bedauert, dass sie jemanden gefunden hat.«
»Vielleicht weil Sie frei waren, sich nach einer anderen umzusehen.«
»Das habe ich nie. Wir sind gute Freunde geblieben, und ich weiß, dass sie sich Sorgen um mich macht.«
»Sollte sie das?«
»Nein. Also, warum die Therapie?«, fragte ich, ich wollte einfach das Thema wechseln.
»Ich? Einsamkeit. Ich ertrage es nicht, für mich zu sein, und gleichzeitig kann ich das Alleinsein kaum erwarten. Haben Sie gesehen? Ich sitze allein im Zug, glücklich mit meinem Buch, weit weg von einem Mann, den ich niemals lieben werde, und dann unterhalte ich mich einfach so mit einem Fremden. Ich hoffe, Sie nehmen’s nicht persönlich.«
Ich lächelte zurück: Schon okay.
»In letzter Zeit rede ich mit allen Menschen, selbst mit dem Briefträger fange ich ein Gespräch an, bloß um ein bisschen zu quatschen. Nur meinem Freund, dem erzähle ich nie, wie es mir geht, was ich lese, was ich will, was mir gegen den Strich geht. Aber er würde mir sowieso nicht zuhören, mich schon gar nicht verstehen. Er hat keinen Sinn für Humor. Jede Pointe muss ich ihm erklären.«
Wir unterhielten uns weiter, bis der Schaffner kam und nach den Fahrscheinen fragte. Er warf einen Blick auf den Hund und sagte, Hunde seien im Zug nur in einer Transportbox erlaubt.
»Und, was soll ich tun?«, blaffte sie. »Ihn rauswerfen? So tun, als wäre ich blind? Oder gleich aussteigen und den sechsundsiebzigsten Geburtstag meines Vaters verpassen, auch wenn es gar kein richtiges Fest wird, weil es nämlich sein letzter Geburtstag ist und er bald stirbt? Das wüsste ich gern.«
Der Schaffner wünschte ihr noch einen schönen Tag.
»Anche a lei«, brummte sie. Ihnen auch. Und zu ihrem Hund gewandt: »Und du sieh zu, dass nicht alle zu dir hingucken!«
In dem Moment klingelte mein Handy. Ich wollte schon aufstehen und im Durchgang zwischen den Wagen rangehen, beschloss aber, sitzen zu bleiben. Aufgewacht vom Klingelton, starrte der Hund mich mit glotzenden Augen an, als wollte er sagen, Du jetzt auch am Handy?
Mein Sohn, bedeutete ich meiner Sitznachbarin, und sie antwortete mit einem Lächeln. Dann gab sie mir zu verstehen, dass sie die Unterbrechung zum Anlass nehme, auf Toilette zu gehen, gab mir die Leine und flüsterte: »Sie macht schon keinen Ärger.«
Als sie aufstand, sah ich zu ihr hin, und zum ersten Mal während der Fahrt wurde mir klar, dass sie trotz ihres etwas rustikalen Looks gar nicht so lässig gekleidet war, wie ich zunächst gedacht hatte, und dass sie jetzt, wo sie vor mir stand, noch attraktiver war. Hatte ich es vielleicht schon bemerkt und den Gedanken nur nicht zugelassen? Oder war ich wirklich so blind gewesen? Es hätte mich unendlich gefreut, könnte mein Sohn sehen, wie ich mit ihr aus dem Zug stieg. Ich wusste genau, dass wir auf dem Weg zu Armando über sie sprechen würden. Ich hörte ihn schon das Gespräch beginnen: Dann erzähl mir mal von diesem Model, mit dem du am Termini geplaudert hast …
Der Anruf änderte jedoch alles. Er rief an, um mir zu sagen, dass er sich heute unmöglich mit mir treffen könne. Ich bekam nur ein trauriges Wieso? heraus. Er musste für einen erkrankten Pianisten einspringen, der ein Konzert in Neapel hatte. Wann kam er zurück? Morgen, sagte er. Ich war so froh, seine Stimme zu hören. Was spielte er denn? Mozart, ein Mozartkonzert. Inzwischen war meine Begleiterin von der Toilette zurück, sie nahm schweigend ihren Platz mir gegenüber wieder ein und hielt sich vorgebeugt, Zeichen dafür, dass sie, sobald ich aufgelegt hatte, weiterreden wollte. Ich schaute noch angestrengter in ihre Richtung als bisher schon auf der ganzen Fahrt, zum einen, weil ich mit jemandem am Telefon beschäftigt war, was meinem Blick etwas Unaufmerksames, Argloses, Umherschweifendes gab, zum anderen konnte ich so weiter in diese Augen sehen, die es gewohnt waren, angestarrt zu werden, und die es mochten, dass man sie anstarrte, und die vielleicht nicht ahnten, dass die Tatsache, dass ich den Mut fand, ihren Blick ebenso heftig zu erwidern, wie sich der ihre gerade jetzt zeigte, auch dem Umstand geschuldet war, dass ich mich auf diese Weise dem Eindruck hingeben konnte, in ihren Augen seien die meinen genauso schön.
Eindeutig eine Altherrenfantasie.
Das Gespräch mit meinem Sohn stockte kurz. »Aber ich habe fest damit gerechnet, dass wir einen langen Spaziergang machen. Deshalb habe ich auch den früheren Zug genommen. Ich komme wegen dir, nicht wegen dem blöden Vortrag.« Ich war enttäuscht, wusste aber auch, dass meine Begleiterin aufmerksam zuhörte, und vielleicht trug ich extra für sie ein bisschen dick auf. Als ich merkte, dass ich zu weit ging mit meinem Gejammer, fasste ich mich wieder: »Ja, verstehe ich natürlich.« Die junge Frau schräg gegenüber von mir warf einen besorgten Blick in meine Richtung. Dann hob sie die Schultern, nicht um zu zeigen, dass ihr das, was da zwischen mir und meinem Sohn passierte, egal war, sondern um mir zu sagen, so dachte ich zumindest, dass ich den armen Jungen in Ruhe lassen sollte – Er fühlt sich sonst nur schuldig. Zu der Schulterbewegung kam noch ein Schwenk mit der linken Hand, von wegen Ist gut jetzt, Sie werden’s schon verschmerzen. »Morgen also?«, fragte ich. Und ob er mich im Hotel abholte? Am Nachmittag, sagte er – gegen vier? »Gegen vier«, sagte ich. »Vigilien«, sagte er. Und ich: »Vigilien.«
»Sie haben ihn gehört«, sagte ich schließlich zu ihr.
»Ich habe Sie gehört.«
Da war er wieder, dieser leise Spott. Und sie lächelte. Fast wollte es mir scheinen, als hätte sie sich noch weiter vorgebeugt und überlegte nun, aufzustehen, sich auf den Platz neben mir zu setzen und ihre Hände in meine Hände zu legen. War ihr das tatsächlich durch den Kopf gegangen, oder dachte ich mir das nur aus, weil es meinen eigenen Wünschen entsprach?
»Ich habe mich so auf unseren Lunch gefreut. Ich wollte mit ihm zusammen lachen und etwas von seinem Leben erfahren, von seinen Konzerten, seiner Karriere. Ich hatte sogar gehofft, ihn zu sehen, bevor er mich entdeckt, und dass er einen Moment Zeit hätte, Sie kennenzulernen.«
»Ist ja nicht der Weltuntergang. Sie sehen ihn morgen – gegen vier?« Und wieder hörte ich, wie sich der kleine Spott in ihrer Stimme tummelte. Wie ich das mochte.
»Die Ironie an der Sache ist …«, setzte ich an, besann mich aber.
»Die Ironie an der Sache ist?«, fragte sie. Die lässt echt nicht locker, dachte ich.
Ich schwieg einen Moment.
»Die Ironie an der Sache ist, dass ich es gar nicht bedaure, dass er heute nicht kommt. Ich habe noch einiges vorzubereiten für meinen Vortrag, und es täte mir gut, im Hotel ein bisschen auszuruhen. Besser, als durch die Stadt zu laufen wie sonst immer, wenn ich zu Besuch bin.«
»Verwundert Sie das? Sie haben jeder ein eigenes Leben, unabhängig davon, ob sich Ihre Leben kreuzen oder wie viele Vigilien Sie miteinander teilen.«
Mir gefiel, was sie sagte. Es war nichts, was ich nicht schon wusste, verriet aber eine gewisse Nachdenklichkeit und Anteilnahme, die mich überraschte und die nicht zu dieser Person zu passen schien, die beim Einsteigen mit einem grummelnden Schnaufen Platz genommen hatte.
»Und woher kennen Sie sich so gut aus?«, fragte ich, ich hatte wieder Mut gefasst und schaute sie fest an.
Sie lächelte.
»Um jemanden zu zitieren, den ich mal im Zug getroffen habe: ›So sind wir doch alle.‹«
Das konnten wir beide unterschreiben.
Als wir schon fast am Bahnhof in Rom waren, blieb der Zug stehen. Minuten später fuhr er wieder an. »Ich nehme am Bahnhof ein Taxi«, sagte sie.
»Ich auch.«
Ihr Vater wohnte, wie sich herausstellte, fünf Minuten von meinem Hotel entfernt am Lungotevere, und ich übernachtete in der Via Garibaldi, nur ein paar Schritte von dort, wo ich vor Jahren gewohnt hatte.
»Dann teilen wir uns ein Taxi«, sagte sie.
Wir hörten die Ansage, Roma Termini, und als der Zug auf den Bahnhof zuzuckelte, sahen wir, wie sich schäbige Gebäude und Lagerhäuser aneinanderreihten, alle mit ihren alten Werbetafeln und verblichenen, schmutzigen Farben. Nicht das Rom, das ich so mochte. Der Anblick verunsicherte mich, ich hatte gemischte Gefühle bei dem Gedanken an meinen Besuch und den Vortrag und die Aussicht, an einem Ort zu sein, mit dem schon zu viele Erinnerungen verbunden waren, ein paar schöne, die meisten weniger schön. Und von einer Sekunde auf die andere beschloss ich, an diesem Abend meinen Vortrag zu halten, den obligaten Cocktail mit Kollegen zu trinken und dann eine Möglichkeit zu finden, mich vor der üblichen Einladung zum Abendessen zu drücken. Mir würde schon etwas einfallen, was ich allein machen konnte, vielleicht ins Kino gehen, und am nächsten Tag würde ich im Hotel bleiben, bis mein Sohn um vier Uhr vorbeikam. »Zumindest hoffe ich, dass sie für mich das Zimmer mit dem großen Balkon und dem Blick auf die Kuppeln reserviert haben«, sagte ich. Trotz des Anrufs meines Sohns wollte ich zeigen, dass ich sehr wohl wusste, wie man die Dinge von ihrer positiven Seite sieht. »Ich checke ein, wasche mir die Hände, suche mir ein nettes Restaurant und ruhe mich danach aus.«
»Wieso? Mögen Sie nicht was Süßes?«, fragte sie.
»Doch, sehr sogar. Aber können Sie mir einen schönen Ort zum Lunchen empfehlen?«
»Ja.«
»Wo?«
»Bei meinem Vater. Kommen Sie mit. Die Wohnung könnte kaum näher an Ihrem Hotel liegen.«
Ich lächelte, gerührt über ihr spontanes Angebot. Sie hatte Mitleid mit mir.
»Das ist wirklich lieb von Ihnen. Aber das gehört sich wohl nicht. Ihr Vater wird einen kostbaren Moment mit der Person verbringen, die ihm am meisten am Herzen liegt, und da soll ich einfach reinplatzen? Ist ja nicht so, dass wir uns seit Abrahams Zeiten kennen.«
»Aber ich kenne Sie«, sagte sie, als würde mich das umstimmen.
»Sie kennen nicht mal meinen Namen.«
»Sagten Sie nicht was von Abraham?«
Wir mussten beide lachen. »Samuel.«
»Bitte, kommen Sie. Es wird keine große Sache sein, ganz schlicht, versprochen.«
Aber annehmen konnte ich noch nicht.
»Sagen Sie einfach Ja.«
»Ich kann nicht.«
Der Zug war schließlich eingefahren. Sie nahm ihre Jacke und das Buch, setzte den Rucksack auf, wickelte sich die Hundeleine um die Hand und holte die weiße Schachtel von der Gepäckablage herunter. »Das sind die Profiteroles«, sagte sie. »Och bitte, sagen Sie einfach Ja.«
Ich schüttelte den Kopf, ein respektvolles, aber entschiedenes Nein.