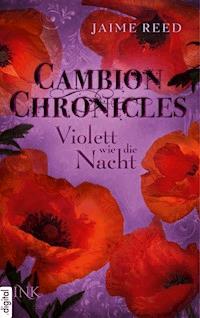
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ink.digital
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Cambion Chronicles
- Sprache: Deutsch
Ein absolut mitreißendes Debüt, herzzerreißend romantisch und voll düsterer Spannung, mit einer sehr authentischen Heldin, die ständig zwischen Coolness und Unsicherheit schwankt - typisch Teenager eben! "Irgendetwas stimmt nicht mit ihm", denkt sich Samara, als sie Caleb während ihres Sommerjobs in der Buchhandlung kennenlernt. Frauen scheinen von ihm magisch angezogen zu werden, denn er ist ständig von ihnen umgeben. Als einige seiner "Verehrerinnen" einen Herzanfall erleiden, ahnt Samara, dass Caleb daran nicht unschuldig ist. Um hinter sein Geheimnis zu kommen, beginnt sie einen intensiven Flirt mit ihm. Doch Caleb ist ein Cambion, in ihm wohnt ein böser Geist, der sich von der Lebensenergie seiner Opfer ernährt. Hat sich Samara schon zu sehr auf ihn eingelassen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhalt
Titel
Widmung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Danksagungen
Über die Autorin
Impressum
Jaime Reed
Aus dem Englischen
von Susanne Schmidt-Wussow
Für Donna und die Familie.
Sie bleiben auf dem Teppich,
sagen, was Sache ist,
und halten mich vom Durchdrehen ab.
1
Liebe ist was für Masochisten.
Das ist die ultimative Wahrheit, wenn ich das selbst mal so sagen darf. Diese Philosophie bewahrt mich vor dem Wahnsinn, seit ich denken kann, und sie half mir dabei, den seltsamsten Sommer meines Lebens zu überstehen. Andererseits ist es sehr amüsant zu beobachten, wozu die Liebe die Menschen bringt. Ein Superprogramm für die Mittagspause.
Ich saß auf der Motorhaube meines Wagens, nuckelte an einer Limonade und sah zu, wie die Liebe vor meinen Augen zur Höchstform auflief. Meine beste Freundin Mia und ihr Immer-mal-wieder-Freund Dougie standen sich mitten auf dem Parkplatz des Outlet-Centers wie zwei Preisboxer gegenüber.
Zur dieswöchigen Vorstellung gehörten auch Requisiten. Dougie machte Ausfallschritte über den Betonboden, duckte sich und entrann nur knapp dem Tod durch die schickste Designerhandtasche, die für Geld zu haben war. Aus dem Geschrei, den Schimpfwörtern und dem Taschengeschleudere schlussfolgerte ich, dass Mia Dougie in Gesellschaft eines anderen Mädchens erwischt hatte. Mia konnte manchmal etwas neurotisch sein, aber wenn es um ihren Kerl ging, schaltete sie um auf vollkommen plemplem. Diesen Eifersuchtsquatsch hatten sie beide drauf, je nach Tagesform, und die Zuschauer erwartete stets ein unterhaltsames Spektakel.
»Gott, was bist du nur für ein Lügner! Wie konntest du mir das antun?«, tobte sie.
»Reg dich ab, Baby! Das war meine Cousine!« Dougie entkam Mias nächstem Handtaschenangriff nur um Haaresbreite.
»Du verlogenes Stück Scheiße! Ich kenne alle deine Verwandten, Douglas. Sie hat dich noch nie besucht.«
Dougie rannte im Kreis um sie herum, das Gesicht krebsrot vor Anstrengung. »Sie ist gerade erst hergezogen! Ich schwöre es, Baby.«
»Und warum hast du sie mir dann nicht vorgestellt, hm?« Mia strich sich das verschwitzte braune Haar aus der Stirn. »Bin ich dir etwa peinlich?«
Er hielt inne, eindeutig gekränkt durch diese Unterstellung. »Nein! Warum sagst du so was?«
»Lügner!« Ihre Handtasche sauste auf seinen Kopf zu, verfehlte ihn jedoch.
Dougie ergriff einen der Riemen, und die beiden lieferten sich mitten auf dem Parkplatz ein astreines Tauziehen. Die Wochenendkäufer begafften sie entsetzt und hielten ihren Kindern wegen der Flüche, die durch die Luft schwirrten, die Ohren zu. Jeden Augenblick würde bestimmt jemand den Sicherheitsdienst rufen, also beschloss ich, die Turteltäubchen sich selbst zu überlassen.
»Hey, Leute!«, rief ich über die Schulter nach hinten. »Ich muss wieder an die Arbeit, bis später, ja?«
»Ist gut, ich ruf dich an!«, schrie Mia zurück, bevor sie Dougie kräftig vor die Brust stieß.
Ich warf meinen Becher in den Mülleimer und betrat Buncha Books durch den Seiteneingang. Die klimatisierte Luft traf mich wie ein Schlag ins Gesicht und drängte die Junihitze nach draußen. Aus den Lautsprechern tönten sanfte Jazzklänge in Endlosschleife. Touristen und Einheimische füllten die Etage in einem langsamen, unentschlossenen Tanz um die Bücherregale.
Ich schlenderte durch die Hauptgänge, vorbei am Stand mit den Neuerscheinungen und Bestsellern in Richtung Informationsschalter in der Mitte des Geschäfts. Da ich schon bei Buncha Books jobbte, seit ich in der zehnten Klasse war, kannte ich inzwischen die wichtigsten Arbeitsregeln; etwa die, sich nie im eigentlichen Buchladen erwischen zu lassen. Außerdem hatte ich festgestellt, dass mich die Kunden nicht ansprachen, wenn ich keinen Augenkontakt zu ihnen herstellte. Diese Strategie hob ich mir auf, bis meine Schicht begann. Ich warf einen wachsamen Blick über die Schulter, suchte mir einen unbesetzten Computer und checkte wieder ein.
Dank Tarnkappenstrategie und schneller Reflexe erreichte ich ohne Zwischenfall das andere Ende des Ladens. Als ich am Zeitschriftengang vorbeiflitzte, sah ich aus dem Augenwinkel etwas Seltsames, etwas so Verstörendes, dass ich aus dem Tritt kam. Ich hielt an, blinzelte ein paarmal und ging zurück zur Abteilung Heim und Garten, um mich zu vergewissern, dass ich mich nicht verguckt hatte.
Caleb Baker, der stellvertretende Chef der Musikabteilung, hatte eine Rothaarige im Arm und knutschte sie in Grund und Boden. Ihr schien diese öffentliche Mandeloperation nichts auszumachen, aber das war nicht gerade der Kundendienst, den unsere Vorgesetzten uns immer nahelegten.
Als ich mich gerade zum Gehen wandte, trafen sich unsere Blicke.
Caleb war nicht unbedingt ein Typ, der den Verkehr zum Erliegen bringt, aber mit seinen tiefen Grübchen und den violettesten Augen, die ich je gesehen habe, war er schon einen zweiten Blick wert. Er behauptete zwar, die Augenfarbe sei echt, aber eigentlich dürften solche Augen in der Natur gar nicht vorkommen – jetzt gerade leuchteten sie im strahlendsten Lilaton des Farbkreises.
Hellbraune Haarsträhnen fielen ihm ins Gesicht, während die beiden sich weiter abschlabberten. Wenn sie nicht bald mal Luft holten, würde ihr Caleb sicher noch die Lebenskraft aussaugen. Soweit ich weiß, gibt es für solche Fälle billige Hotelzimmer, und in dieser Gegend herrschte daran wahrlich kein Mangel.
Schon die ganzen anderthalb Jahre, die ich hier arbeitete, verursachte mir der Typ Gänsehaut. Ganz zu schweigen von der Anzahl der Frauen, die dauernd hinter ihm herjagten. Keiner im Laden schien etwas davon zu merken oder sprach diese Tatsache jemals an, nicht mal die Vorgesetzten, was mich noch mehr anwiderte.
Ich hatte genug gesehen und ging weiter zu meinem Arbeitsplatz, bevor mir das Mittagessen wieder hochkam.
Cuppa-Joe war ein kleines Café im hinteren Teil des Buchladens, wo die Leute ausspannten und über Gott und die Welt ablästerten. Die Jauchegrube des Firmentratsches und des Kunden-Bashings.
Heute hatte ich Spätschicht mit meiner Wochenendkomplizin Nadine Petrovsky, einer polnischen Austauschstudentin am William-&-Mary-College und einem der zynischsten Menschen, die ich jemals kennenlernen durfte. Die Typen kamen extra ins Café, um ihrem exotischen Akzent zu lauschen und ihr bei der Arbeit zuzusehen.
Ein kurzer Blick genügte, um das zu verstehen. Jedem Modelscout würde angesichts dieser europäischen Schönheit das Wasser im Mund zusammenlaufen: Ihr langes, weizenblondes Haar reichte ihr bis zum Po, und sie hatte abgefahrene grüne Katzenaugen. Schade, dass all die Aufmerksamkeit sie nicht im Geringsten interessierte. Sie hatte keine Zeit für diesen Quatsch, was sie mitleidlos und schnippisch gemacht hatte. Sie war einfach zu zielstrebig, um zuzulassen, dass ein Typ oder irgendetwas anderes sie bremste.
Nadine stand vor dem Kaffeeautomaten und reinigte die Dampfdüse, als sie mich aus dem Augenwinkel bemerkte.
»Du kommst zu spät«, stellte sie fest, ohne aufzusehen.
»Tut mir leid. Mia und Dougie haben sich mal wieder auf dem Parkplatz gefetzt.« Ich band mein Haar zu einem Knoten und schnappte mir die Schürze aus der Küche nebenan.
»Ach ja?« Sie reckte den Hals und versuchte, vor den Laden zu spähen. »Die liefern immer eine gute Show ab. Sollten ihre eigene Sitcom kriegen.«
»Hab ich ihnen auch schon gesagt.«
Sie legte die Stirn in Sorgenfalten und schüttelte missbilligend den Kopf. »Das ist keine gesunde Beziehung, Sam.«
»Welche Beziehung ist das schon?« Ich band mir die Schürze um und ging zum Spülbecken, um mir die Hände zu waschen.
»Na, die normalen.«
»Tja, sobald ich mal so eine zu sehen bekomme, sage ich dir, was ich davon halte.«
Während ich mir die Hände abtrocknete, kam ein Grund, warum ich Kunden hasste, auf die Theke zu. Ein ganz in Schwarz gekleideter Typ mit einem Hundehalsband schielte zu mir rüber.
Nadine tat weiter, als sei sie beschäftigt, also ging ich zur Kasse. »Was darf’s sein?«
»Einen Eis-Chai Latte«, sagte er ausdruckslos. Es war schwer zu sagen, ob der Kerl high oder nur halb wach oder ob er überhaupt ein Kerl war. Seine Baggy Pants schleiften über den Boden wie ein Kleid beim Abschlussball, unter den ausgefransten, schmutzigen Aufschlägen lugten Clownstiefel hervor.
Ich tippte seine Bestellung ein und warf Nadine einen Blick zu, den sie mit einem identischen Blick erwiderte.
Als er gegangen war, lehnte ich mich an die Theke und lachte.
Nadine lächelte nie, auch wenn der Witz noch so gut war, was sie an den Wochentagen, an denen sie im Kindergarten auf die Vorschüler aufpasste, ganz bestimmt sehr beliebt machte. Stattdessen wischte sie mit heftigen Bewegungen die Arbeitsfläche sauber.
»Ich hasse diese Elmo-Goth-Typen«, maulte sie. »Welcher Soziopath mit einem Rest von Selbstachtung trinkt denn schon Chai? Was wissen die denn über echte Qualen? Sollen die mal ein Konzentrationslager überleben, dann können sie jammern.«
»Das heißt Emo«, korrigierte ich sie. »Und deine Urgroßeltern kamen nicht mal bis zum Lager, bevor die amerikanischen Truppen einfielen.«
Nadine ging zur hinteren Arbeitsfläche und prüfte die Zeitschalter an den Kaffeemaschinen. »Qualen sind Qualen. Und für mich heißt das trotzdem Elmo, weil die genauso kindisch sind.«
Ich sah sie amüsiert an und schüttelte den Kopf. »Du weißt ja nicht, was bei ihm zu Hause so abgeht.«
»Jeder weiß, was bei ihm zu Hause abgeht. Er kommt nicht mit seinen Eltern klar. Er hockt nur in seinem Zimmer und jammert und schreibt schlechte Gedichte darüber, wie es wäre, ein Vampir zu sein.«
Lachend trat ich an die Espressomaschine und klaute mir eine Tasse.
»Hey, du bist dran mit Tischeabwischen.« Nadine warf mir einen Lappen zu. »Und vergiss nicht, die Zeitschriften zurückzubringen.«
Seufzend schlurfte ich zum Sitzbereich und sammelte die benutzten Becher und Strohhalmpapiere ein. Da gerade niemand anstand, ließ ich mir Zeit mit dem Zurückbringen der Zeitschriften in die Ständer. Als ich fertig war, drehte ich mich um und sah Caleb, immer noch so müßig und unproduktiv wie vorhin.
Er saß auf einer Lesebank am Fenster, den Kopf zwischen den Händen. Die Nachmittagssonne floss über seinen Rücken und verlieh seinem Haar einen goldenen Heiligenschein. Normalerweise hätte ich ihn ignoriert, hätte nicht ein leichtes Zittern seinen Körper erschüttert.
Weinte er? Hatte er sich mit seiner neuen Flamme verkracht? Es war einfach beunruhigend, einen Typen weinen zu sehen, aber es fielen keine Tränen, und er wischte auch keine mit der Hand weg. Sein Körper schwankte vor und zurück, und fast erwartete ich, dass er anfing, um Kleingeld zu betteln. Wie lange hatte der eigentlich Pause?
Ich ging zu ihm hinüber und tippte ihm auf die Schulter. »Hey, Caleb. Alles klar mit dir?«
»Ja«, murmelte er unter seinen Händen hervor. Zum Glück roch er nicht nach Alkohol, aber er sah auf jeden Fall verkatert aus. Andererseits sah er eigentlich immer so aus.
Mit einer Hand griff er nach der Sonnenbrille, die er in seinen Kragen gehakt hatte, mit der anderen schirmte er seine Augen ab – ich war nicht ganz sicher, ob aus Scham oder wegen des gleißenden Lichts. Ich war auch nicht ganz sicher, wo die violetten Strahlen herkamen, die zwischen seinen Fingern hervorschossen.
Für den Bruchteil einer Sekunde durchflutete ein violetter Schimmer seine Augen und glühte fluoreszierend auf. Caleb drehte schnell den Kopf weg und hinterließ eine farbige Schliere in der Luft, die wie ein Kondensstreifen dort hängen blieb. Interessanter Trick für jemanden, der angeblich keine Kontaktlinsen trug.
Er stand auf und hielt inne, als er meinen schockierten Gesichtsausdruck sah. Er scharrte mit den Füßen und fummelte an seinen Haaren herum, versuchte es zu überspielen, als hätte ich ihn mit offenem Hosenschlitz erwischt. Aber das Einzige, was ich bemerkt hatte, waren eine Sehstörung und ein unheimliches Gefühl.
Ich wich zurück. »Ganz sicher alles in Ordnung? Bist du krank?«
Meine Frage brachte ihn zum Lachen, aber es klang trocken und bitter. »Du hast ja keine Ahnung«, sagte er, bevor er an sein Ende des Ladens zurückmarschierte.
Meine Mom hat mir beigebracht, die Leute nicht vorschnell zu verurteilen, aber verdammt noch mal, dieser Typ machte es einem echt nicht leicht. Ich wusste nicht viel über ihn, aber das machte es nur noch schwieriger.
Irgendetwas sagte mir, dass Unwissenheit ein Segen war, wenn es um Caleb Baker ging, also ging ich wieder an die Arbeit in der Hoffnung, sie würde mich ablenken. Aber es war zu spät. Meine Neugier war geweckt, und sie würde mich nicht ruhen lassen, ehe ich ihr Nahrung gab.
2
Nach weiteren vier Stunden Einzelhandelshölle kündigten die Lautsprecher pfeifend den Feierabend an. Kunden kamen zur Theke geschlendert, um in letzter Minute noch Bestellungen aufzugeben. Es gab immer einen, der erst gehen wollte, wenn wir gingen, und von mir aus hätten sie sehr gern die Küche für mich aufräumen können.
Weil niemand Nadine beim Nichts-wie-raus-hier-Spiel schlagen konnte, packte sie das Essen ein, während ich die Stühle zusammenstellte und den Boden wischte. Rockmusik plärrte aus den Lautsprechern, damit jeder wusste, dass die Öffnungszeit offiziell beendet war. Nach vierzig Minuten Aufräumen waren wir endlich fertig.
»Nicht vergessen, heute Abend ist Lesegruppe«, erinnerte mich Nadine.
»Oh, verdammt!« Freude und Enthusiasmus lösten sich in Luft auf. Unbezahlte Überstunden forderten mehr Geduld von mir, als ich übrig hatte.
Ich warf die Schürze hinter mich und machte das Licht in der Küche aus. Nachdem wir unsere Sachen zusammengepackt hatten, stempelten wir aus und gingen in Richtung Toiletten zum Pausenraum hinüber.
Die Hälfte der Angestellten war schon da und trank abgestandenen Kaffee, um wach zu bleiben. Die säuerlichen Mienen und hängenden Schultern machten deutlich, dass niemand an einem Sonntagabend hier sitzen wollte. Ich war also in guter Gesellschaft.
Die monatliche Bücherrunde sollte die Arbeitsmoral stärken, führte aber normalerweise nur zu Streit. Die Vertriebler ganz oben hielten es für eine gute Idee, wenn die Angestellten die Neuerscheinungen lasen und den Kunden Empfehlungen geben konnten.
Eins liebte ich an meinen Kollegen: Sie hassten diese Runde genauso sehr wie ich. Der Hass schweißte uns zusammen und machte diese sinnfreie Stunde erträglich. Wir konnten aus uns herausgehen und schonungslose, unzensierte Kritiken abliefern. Am Ende des Abends wurde dann ein Buch als Empfehlung des Monats gewählt.
Nadine stand am kaputten Getränkeautomaten und redete mit Caleb. Ich konnte zwar nicht hören, was sie sagte, aber an ihren wutverzerrten Gesichtszügen sah ich, dass es nicht um den neuesten Bestseller ging.
Caleb und Nadine sprachen auf der Arbeit kaum miteinander, abgesehen von kurzen Wortwechseln und Geflüster in ruhigen Ecken des Ladens. Ich vermutete, dass die beiden vor meiner Zeit hier mal was miteinander gehabt hatten und dass es schiefgegangen war, aber ich fand es besser, alte Geschichten nicht wieder aufzuwärmen. Wie übel die Trennung auch gewesen sein mochte, Caleb schien der einzige Kerl zu sein, den sie respektierte.
Weil ich auf keinen Fall neugierig wirken wollte, schlich ich rüber zum Stand mit den reduzierten Snacks und verlangte einen Donut vom Vortag.
Als ich ihn auf eine Serviette legte, ließ mich eine tiefe Stimme hinter mir zusammenfahren. »Hey, den mit Puderzucker wollte ich.«
Ich drehte mich um und sah schon wieder in diese abgefahrenen violetten Augen. Ganz ehrlich, das war sein einziger Pluspunkt, zumindest auf meiner Liste. Caleb war käsebleich, selbst für einen Weißen, und er brauchte dringend einen Haarschnitt und eine Rasur. Er hatte die Hände tief in den Taschen seiner braunen Khakihose und sah mich durch seine dichten Wimpern hindurch an.
»Pech gehabt. Das ist der letzte Donut, und er gehört mir.« Ich hielt ihm meine Hand mit dem Gebäck unter die Nase, damit er es sich genau ansehen konnte.
»Und ich kann dich nicht irgendwie umstimmen?« Sein Blick wanderte von oben bis unten über meinen Körper, bevor er mir wieder in die Augen sah.
»Nö. Sorry.« Ich nahm einen großen Bissen von der puderzuckerbestäubten Köstlichkeit und flitzte zum Klappstuhl neben Nadine. Ich konnte spüren, wie er mich beobachtete, zweifellos, weil er mich um meine süße Trophäe beneidete.
Caleb war dünn und gebaut wie ein Schwimmer. Man sah ihm nicht an, dass er im Handumdrehen eine ganze Zuckerrohrplantage leer futtern konnte. Er war fast so eine Naschkatze wie ich, und das wollte wirklich was heißen.
Linda, die Geschäftsführerin und Königin der Klunker, platzte herein und warf ihre Tasche auf den Boden. Ihre Stilettos klapperten auf den Linoleumfliesen und verkündeten, dass die Domina da war.
Die Hände in die Hüften gestemmt, die Autoschlüssel fest in der beringten Hand, wandte sie sich an die Gruppe: »Na schön, bringen wir’s hinter uns. Ich habe eine Stunde Autofahrt vor mir, und ich will nicht den ganzen Abend hier verbringen.« Sie setzte sich und band ihre Dreadlocks auf dem Kopf zusammen. »Okay, beginnen wir mit der Jugendabteilung.« Sie drehte sich zu dem kleinen, gelockten Mädchen links von ihr. »Alicia, welches Buch hast du gelesen?«
Alicia Holloway setzte sich kerzengerade hin und grinste, damit jeder ihre großen Augen und ihre Grübchen sah. Sie ging auf meine Schule, in die neunte Klasse – na ja, ab Herbst in die zehnte – und war die jüngste Mitarbeiterin bei BB. Ihre Arbeitserlaubnis steckte wahrscheinlich noch in ihrem Hello-Kitty-Portemonnaie. Alicia war schon lange nicht mehr das scheue Reh, das immer eine Nachtlampe mitbrachte, wenn sie bei mir übernachtete. Ich hatte oft auf sie aufgepasst, als ich noch in der Junior Highschool war, und schon damals wollte sie immer um jeden Preis älter wirken. Ich durchschaute das natürlich, und als Freundin war es meine Pflicht, sie damit pausenlos aufzuziehen.
»Ich habe Der Geist von Nan Jacobs gelesen«, ergriff Alicia aufgeregt das Wort und hielt das Buch so hoch, dass alle das abgewetzte Cover sehen konnten.
Ein vielstimmiges Stöhnen erfüllte den Pausenraum. Einige rückten ihre Stühle zurecht in Erwartung der Schmähungen, die nun sicher folgen würden.
Jeder Buchverkäufer hasste diese Reihe inbrünstig, und ihre Beliebtheit erschreckte jeden in diesem Raum. Aber niemand konnte leugnen, dass sie sich bei den jungen Mädchen extrem gut verkaufte, und im Laden hatte die Saga ein ganzes Regal für sich allein. Niemand von uns würde so ein Mainstream-Buch lesen wollen. Na ja, fast niemand.
»Also, erst mal muss ich sagen, ich fand das Buch super. Es ist so romantisch und so toll, und die Figuren waren so glaubwürdig, ich hatte das Gefühl, ich war richtig drin in der Geschichte, und, oh Mann, Nicolas Damien ist so scharf!« Alicia hüpfte auf ihrem Stuhl auf und ab und japste regelrecht.
»Bist du ihm begegnet?« Nadine lehnte sich zurück und legte die Fingerspitzen aneinander. »Dieser Nicolas Damien – war er hier im Laden oder wie?«
Alicia zog verwirrt die Stirn kraus. »Äh, nein. Er ist eine Figur in dem Buch.«
»Woher weißt du dann, dass er scharf ist?«
»Weil er im Buch so dargestellt wird, daher!«, blaffte Alicia und wandte sich dann wieder der Gruppe zu. »Jedenfalls geht es um ein Mädchen, das nachsitzen muss und sich dabei in einen umwerfend aussehenden Neuen verliebt. Aber er trägt ein Geheimnis in sich.«
»Lass mich raten, er ist ein Serienmörder?«, flötete Caleb dazwischen. Er saß auf der anderen Seite des Stuhlkreises, einen Fuß auf dem Knie abgelegt und die Arme verschränkt. Ab und zu erwischte ich ihn dabei, wie er mich mit einer unverhohlenen, schamlosen Neugier gründlich musterte. Ich versuchte, ihn weder anzustarren noch mich auf dem Stuhl zu winden, aber sein Starren war geradezu körperlich spürbar.
Ich konnte es kaum erwarten, hier rauszukommen.
»Nein, er ist kein Mörder.« Alicia verdrehte die Augen. »Er ist tot.«
»Wie romantisch«, murmelte ich. »Vergesst die Bravo, geht einfach auf den nächsten Friedhof. Leichen sind der neue Mädchenschwarm.«
»Nein, ich meine, er ist ein Geist«, erklärte Alicia. »Jedenfalls weiß das Mädchen das erst nicht, und das Irre ist, dass sie die Einzige ist, die ihn sehen kann. Nicolas glaubt, das ist ein Zeichen dafür, dass Angelica seelenverwandt mit ihm ist.«
»Angelica?«, echoten Nadine und ich gleichzeitig.
Alicia drehte den Kopf in die Richtung des Spotts. »Na und, warum nicht?«
»Ein bisschen weit hergeholt, oder?«, fragte Nadine. »Lass mich raten, Nicolas nennt sie ›seinen Engel‹?«
Alicia fletschte kurz die Zähne in unsere Richtung und fuhr fort. »Jedenfalls geht es um verbotene Liebe. Sie können nicht zusammen sein, weil Angelica noch lebt und er ein Geist ist, und sie dürfen sich nicht mal anfassen. Sie stellt Nachforschungen darüber an, wie er gestorben ist, und wehrt sich gleichzeitig dagegen, dass sie sich zu ihm hingezogen fühlt.«
»Warum ist sie die Einzige, die ihn sehen kann?«, fragte Linda.
»Weil Angelica eine seltene und einzigartige Schneeflocke ist«, antwortete ich und bohrte in meinem Donut herum.
Röte schoss in Alicias Wangen und verlieh ihrer Haut einen dunklen Mahagoniton. Sie schlug sich mit der Faust aufs Knie. »Halt die Klappe! Du bist ja nur neidisch auf Nicky und Angie.«
»Ui, jetzt geben wir diesen ausgedachten Figuren schon Spitznamen, ja?«, fragte Caleb mit vor Lachen bebendem Brustkorb. »Es ist nur ein Buch, Alicia. Entspann dich.«
Alicia ruckte mit dem Kopf wie ein aufgeregtes Huhn und erwiderte streitlustig: »Weißt du was, schreib du erst mal einen Bestseller, dann kannst du immer noch über die Bücher von anderen herziehen.«
»Würde jetzt bitte jemand anders weitermachen?« Linda massierte sich die Nasenwurzel und kniff die Augen zusammen. Die Ader an ihrer Schläfe sah aus, als würde sie gleich platzen, also sprang ich ins kalte Wasser.
»Okay.« Ich griff hinter meinen Stuhl und zog das Buch aus meiner Tasche. »Sinnestäuschung – den Titel finde ich klasse – von Harriet Coffman-Frost. Es geht um einen Prostituierten namens Ren, der Pech hat und aus seiner Wohnung geworfen wird und schließlich mit einer seiner Kundinnen namens Janice zusammenzieht. Janice hat emotionale Probleme – irgend so ein Heilige-Hure-Komplex, weswegen sie nicht mit jemandem schlafen kann, für den sie Gefühle hegt, also bezahlt sie für männliche Gesellschaft. Als sie sich besser kennenlernen, wendet sich das Blatt langsam. Schließlich verliebt sich Ren in Janice und wirbt um sie, aber sie macht dicht und ignoriert ihn. Also nimmt er sein Strichergeld, um ihre Zuneigung zu kaufen. Ich bin fast durch, ich sage euch dann, wie es ausgeht.«
Alicia schnalzte angewidert mit der Zunge. »Das ist krank.«
Ich grinste. »Schon, oder? Aber die Figuren sind lebensecht, im Gegensatz zu deinem ach-so-perfekten Nicky.«
»So perfekt kann Nicky ja auch wieder nicht sein, wenn er sich nicht mal dran erinnert, wie er gestorben ist«, fügte ein anderer Mitarbeiter hinzu.
»Schon gut, beruhigt euch«, mischte sich Linda ein. Sie wandte sich Caleb zu und lächelte. »Okay, was ist mit dir? Welches Buch hast du gelesen?«
Caleb löste die Arme und hielt ein Taschenbuch hoch. »Schnappschuss von Orlando Hutchins. Es geht um einen dämonischen Fotoautomaten mitten auf der Strandpromenade in Jersey. Als Mark Daniels hineingeht, bekommt er durch den Blitz die unterschwellige Botschaft, dass er Menschen töten muss. Und aus dem Fotoschacht kommen Bilder von fünf Leuten, die er umbringen soll. Also wird Mark zum blindwütigen Serienmörder, aber ihm gehen erst die Augen auf, als ein Freund dann ihn töten will. Der Freund hat ebenfalls einen Fotostreifen mit Marks Gesicht auf dem letzten Foto. Es ist ein verrückter Teufelskreis.«
»Wow, das ist super.« Linda kritzelte etwas auf ihren Notizblock.
»Ja, jede Menge Blut und Gewalt«, stimmte Caleb mit einem Seitenblick auf mich zu. »Unterhaltung für die ganze Familie.«
Nach weiteren zwanzig Minuten Buchvorstellungen einigten wir uns auf Calebs Titel als Buch des Monats. Erleichtert seufzend standen alle auf und strömten zur Tür. Ich schnappte mir meine Tasche und ging hinaus, ohne mich um das prickelnde Gefühl im Nacken, das warme Vibrieren auf meiner Haut und Alicias böse Blicke zu scheren.
Während Linda drinnen abschloss, flankierten draußen eine Ambulanz und zwei Streifenwagen ein Auto auf dem Parkplatz. Bis auf die Wagen der Angestellten war er leer.
Nadine beugte sich zu mir und fragte: »Was ist denn da los?«
»Weiß ich genauso wenig wie du.« Ich trat beiseite, als die restliche Meute sich zu den Schaulustigen gesellte.
Nadines Augen wurden vor Aufregung groß. »Glaubst du, es gab eine Schießerei oder so? Ich würde morden für ein bisschen Action in dieser Stadt.«
Sie hatte nicht ganz unrecht, aber ich war mir nicht sicher, ob das der richtige Ansatz war. Williamsburg war eine der langweiligsten Städte der Welt. Nicht so schlimm wie Mayberry, aber dieses Nest hatte echt Schlaf in den Augen. Es war ein Erholungsort, eine Brutstätte für Sommertouristen, und das meiste Geld kam durch die Hotels und Restaurants in der Gegend herein. Daher sorgte das kleinste Anzeichen von Aufruhr bei den Einwohnern lange für Gesprächsstoff.
Eine Gruppe Skateboarder saß im Gras und beobachtete das Drama auf der gegenüberliegenden Seite des Parkplatzes, während ein stämmiger Polizist ihre Aussagen aufnahm.
Ich sah zu dem dunkelblauen SUV hinüber, der in der Nähe des Ladens parkte, als das Fenster auf der Fahrerseite herunterglitt. Mr Holloway steckte seinen Kopf hinaus. »Alicia, jetzt komm!«
»Komme schon, Daddy!«
Alicia drängelte sich an mir vorbei und rempelte mich dabei an der Schulter an. Offenbar nahm sie die Ablehnung ihres Buchvorschlags persönlich und brauchte einen Sündenbock.
Als ich den Wagen erreichte, drückte ich den Rücken durch und salutierte vor Alicias Vater. »Captain Holloway, Sir!«
Meine Albernheiten brachten ihn immer zum Lächeln, wie sehr er es auch zu unterdrücken versuchte. Der Mann war einfach zu ernst, genau wie sein kurzer Bürstenhaarschnitt. »Stehen Sie bequem, Soldatin«, sagte er. »Ihr kommt aber spät heute.«
Alicia kletterte auf den Beifahrersitz. »Ja, heute war unsere Bücherrunde. Tut mir leid, dass du so lange warten musstest.«
»Hey, was macht denn die Polizei hier?«, fragte Nadine, bevor ich es tun konnte.
Mr Holloway drehte den Kopf in Richtung Blinklichter. »Eine Frau hatte auf dem Parkplatz einen Herzinfarkt. Ein paar Jugendliche fanden sie bewusstlos in ihrem Auto und haben wohl die Polizei gerufen. Gott, für einen Augenblick dachte ich schon, das wäre mein kleines Mädchen.«
»Daddy, mir geht’s gut«, flötete Alicia. »Du machst immer gleich so ein Drama aus allem.«
»Hey, Kleine, ein bisschen mehr Respekt vor der älteren Generation, bitte!« Ich zeigte mit dem Finger auf sie. »Meine Mom hat mich auch auf dem Kieker. Ist so ein Elternding.«
Alicia kicherte. »Lass mich bloß in Ruhe, du Daumenlutscherin.«
Ich breitete die Arme aus und nahm die Herausforderung an. »Jederzeit, Doppel-A-Körbchen.«
»Meine Damen.« Mr Holloway fuhr sich mit der Hand übers Gesicht, hob den Kopf und seufzte. »Ihr werdet wohl nie erwachsen, was?«
»Tja, Ihre Tochter hat eben einen schlechten Einfluss«, verteidigte ich mich.
Er sah mich streng an. »Ach, und du etwa nicht?« Ohne auf meine Antwort zu warten, ließ Mr Holloway den Motor aufheulen. »Kommt gut nach Hause – sind ’ne Menge Spinner unterwegs da draußen.«
»Machen wir.« Mit Nadine an meiner Seite schlenderte ich den Parkplatz entlang. Ich ließ die Autoschlüssel von meinem Finger baumeln und versuchte, einen Blick auf das Drama zu erhaschen, ohne allzu offensichtlich hinzusehen. Die Sanitäter hoben gerade vorsichtig jemanden vom Fahrersitz. Ich erkannte die schlanke Figur und die roten Haare sofort. Das war dieselbe Frau, an der Caleb vorhin die Mund-zu-Mund-Beatmung für Arme durchgeführt hatte. Ihrem bewusstlosen Zustand nach zu urteilen, brauchte sie nun die professionelle Variante.
Linda ging hinüber und redete mit einem Polizisten, der neben seinem Auto stand. Sie nickte ein paarmal und schüttelte den Kopf, brachte aber keine brauchbaren Informationen mit.
»Sie sieht sehr jung aus für einen Herzinfarkt«, sagte ich zu Nadine.
»Man kann jederzeit einen Herzinfarkt bekommen. Kommt auf die Person an«, gab sie zurück, ganz gefesselt von der Szene vor ihren Augen.
Nadine hatte einen Hang zum Makabren, daher war dieser Vorfall ganz nach ihrem Geschmack. Aber unter ihrem normalen undurchschaubaren Gesichtsausdruck war unterdrückter Zorn zu erahnen. »Kanntest du das Mädchen?«, fragte sie.
Ich weiß nicht, warum ich Nein sagte. Vielleicht hatte ich keine Lust auf eine nächtliche polizeiliche Vernehmung. Vielleicht war es nur ein verrückter Zufall. Ich wusste nur, dass ich nach Hause musste.
»Bis morgen.« Ich schmiss meine Tasche auf den Beifahrersitz.
Nadine winkte und tippelte zentimeterweise zu ihrem Auto, während sie versuchte, sich aus dem Bann der Tragödie zu lösen.
Als ich mich umdrehte, um einzusteigen, hatte ich wieder dieses Gefühl, dieses elektrische Kribbeln im Nacken. Ich schluckte schwer, wirbelte herum und fuhr zusammen.
Caleb stand hinter mir und starrte mich an, als wartete er darauf, dass ich ihm den Donut aushändigte, den ich vorhin verschlungen hatte. Ich starrte zurück und ging langsam rückwärts, bis ich zwischen ihm und der Autotür eingekeilt war. Er streckte die Hand nach meinem Gesicht aus. Ein Schrei stieg in meiner Kehle auf, doch er fuhr nur mit dem Daumen über meinen Mundwinkel.
»Du hast da was.« Er zog seine Hand zurück und betrachtete den Puderzucker an seinem Daumen. »Bis morgen dann.« Er schlenderte über den Parkplatz zu seinem Jeep, unbeeindruckt von den Blinklichtern und der Tatsache, dass seine Tussi gerade von den Sanitätern auf einer Rettungsliege weggerollt wurde.
So behandelte man keine Knutschpartnerin, egal, wie schlecht sie küsste. Hätte er nur ein bisschen Anstand gehabt, wäre er wenigstens dem Rettungswagen zum Krankenhaus gefolgt. Schon der Anblick seines lässig-wiegenden Gangs drehte mir den Magen um.
In den achtzehn Monaten, in denen ich hier arbeitete, hatten schon mindestens zwölf Mädchen in seinen Armen gehangen, und es sah nicht so aus, als würde sich daran etwas ändern. Mr Zu-cool-für-die-Schule war ein männliches Flittchen allererster Kajüte.
Ich konnte nicht länger darüber nachdenken. Es war schon spät, und ich wollte nicht die Letzte auf dem Parkplatz sein. Ganz offensichtlich war das kein sicherer Ort für ein Mädchen ohne Begleitung.
3
Zum Glück wohnte ich nur fünf Minuten von der Arbeit entfernt. Ich war todmüde.
Warme Luft blies durchs Fenster herein und brachte den Duft von Hefe mit, der meilenweit zu riechen war. Für die Pendler auf der Interstate 64 gehörte er zu den vielen typischen Merkmalen von Williamsburg.
Die meisten Orte in Williamsburg hatten eine historische Bedeutung. Jedes Kind im ganzen Bundesstaat musste mindestens einmal einen Ausflug hierher unternehmen und sich zeigen lassen, wie Tabak hergestellt wird. Williamsburg war eine ruhige Stadt, wo es wegen der örtlichen Brauerei immer nach Bier roch und nach Schimmel wegen des alten Geldes, das in der Gegend im Umlauf war. Alte Leute, so weit das Auge reichte. Williamsburg war mit seinen Dutzenden von Golfplätzen und Country Clubs das neue Florida. Wer hier aufgewachsen war, kam der Tradition nach erst dann zurück, wenn er einen ruhigen Ort zum Sterben suchte.
Ich lebte in einer recht hübschen Mittelklassegegend direkt an der Hauptstraße von James City County. Niemand hätte uns allerdings wohlhabend nennen können, so viel war klar. Wir wohnten in einem doppelstöckigen Haus im Kolonialstil mit umlaufender Veranda, das schon bessere Tage gesehen hatte. Die weiße Farbe blätterte ab, aber die hohen Pinien um den Garten herum bemühten sich nach Kräften, diese Tatsache vor unseren Nachbarn zu verbergen. Eine unerwartete Bienenplage hatte unserem Beet mit Gardenien, gelben Chrysanthemen und Margeriten den Garaus gemacht.
Kies knirschte und knallte unter meinen Reifen, als ich in die Auffahrt fuhr und einen silbernen Lexus am Straßenrand parken sah.
Wimmernd machte ich den Motor aus und suchte meine Sachen zusammen. Wenn es irgendwie ging, vermied ich so eine Situation aus gutem Grund, aber manche Menschen reagieren einfach nicht auf subtile Andeutungen. Mom hatte die Verandabeleuchtung für mich angelassen. Wie immer machte sie sich Sorgen um ihr Baby.
Als ich ins Haus trat, schlug mir sofort der Duft von gebratenen Zwiebeln und Knoblauch entgegen und zog mich gegen meinen Willen in die Küche. Mom stand an der Kücheninsel und hackte Pilze auf dem Schneidebrett, während Dad auf dem Barhocker saß und Kartoffeln schälte.
Sie waren ein ausgesprochen seltsames Paar, aber meine Familie war nun mal das Gegenteil von normal. Anders als die meisten anderen getrennten Eltern verstanden sich meine tatsächlich gut. Sie stritten sich selten und wenn, dann hatte ich was Dummes angestellt. Dennoch wurde ich das Gefühl nicht los, dass das hier eine abgekartete Sache war.
Moms gelbes Sommerkleid brachte ihre helle, leicht sommersprossige Haut zum Leuchten und zeigte mehr als nur ein züchtiges Dekolleté. Ihre Haare waren zu einem lockeren Knoten gebunden, ihr Gesicht von braunen Löckchen eingerahmt.
Sie hatte zwar im Laufe der Jahre ein wenig an Gewicht zugelegt, aber Julie Marshall war immer noch eine hübsche Frau. Ich hatte ihre Locken, den flachen Hintern und die superempfindliche Haut geerbt, ebenso die Wolfsmensch-Augenbrauen, die ich jede Woche mit Wachs im Zaum halten musste. Aber nicht mal die konnten von ihrem runden, ehrlichen Gesicht und den schönsten Beinen diesseits der Mason-Dixon-Linie ablenken. Hätte ich mit sechzehn ein Kind bekommen, würde ich in ihrem Alter wahrscheinlich auch so scharf aussehen wie sie.
Dad trug heute Abend bequeme Klamotten, ganz im Gegensatz zu den schicken Geschäftsanzügen, die er sonst anhatte. Sein weißes Button-Down-Hemd bildete einen kühnen Kontrast zu seiner schokoladenbraunen Haut. Die Deckenbeleuchtung spiegelte sich auf seinem rasierten Kopf.
Sie arbeiteten in stiller Harmonie und bemerkten mich nicht einmal, als ich meine Tasche auf den Küchentisch fallen ließ. Entgegen seiner eigentlichen Bestimmung quoll der Tisch vor Rabattcoupons und ungeöffneter Post über. Moms Laptop, das Einzige, wofür diese Frau jemals richtig Geld ausgegeben hatte, machte sie piepsend darauf aufmerksam, dass im Cyberspace weitere ungeöffnete Post auf sie wartete.
»Hast du das Reden verlernt?« Beim Klang von Dads tiefer Baritonstimme blieb ich abrupt stehen.
»Hi, Daddy.« Ich beugte mich zu ihm und gab ihm einen Kuss auf die Wange.
»Du kommst aber spät, Schatz«, sagte Mom, während sie eine grüne Paprika zerkleinerte.
»Monatliche Bücherrunde. Tut mir leid.«
Dad strich mir über den Rücken und fragte: »Ist dein Handy kaputt, mein Püppchen? Ich habe den ganzen Tag versucht, dich anzurufen, aber es ging immer nur die Mailbox dran.«
»Ich war arbeiten«, erklärte ich rasch. »Ich darf das Handy auf der Arbeit nicht anmachen.«
»Aha. So was hab ich mir gedacht, deshalb bin ich vorbeigekommen.« Er legte eine geschälte Kartoffel hin und griff nach der nächsten. »Deine Mutter hat gesagt, du bist einverstanden mit unserer Abmachung wegen deines Wagens.«
»Ja.« Der Gedanke zauberte ein Lächeln auf mein Gesicht.
Mein derzeitiges Auto hatte seinen Zweck erfüllt, aber jetzt war es an der Zeit, es zur letzten Ruhe zu betten. Es war ein 1998er Honda Civic mit abblätternder weißer Lackierung und kaputter Klimaanlage. Nur meine Phobie vor öffentlichen Verkehrsmitteln hielt mich davon ab, ihn über die nächste Klippe zu schieben.
Dad runzelte nachdenklich die Stirn. »Das freut mich zu hören, aber sie hat nicht erwähnt, dass du dafür auf Kyle und Kenya aufpasst.«
Mein Lächeln erlosch. »Wer passt auf wen auf?«
»Du hast mich schon verstanden.« Es schien ihn zu amüsieren, dass er gerade meine innere Siegesfeier gesprengt hatte.
»Samara.« Mom seufzte. Sie kannte diese Platte nur allzu gut. »Du bist ihre große Schwester. Du musst ihnen zeigen, dass du für sie da bist.«
Oh ja, hier ging es definitiv um Erpressung. Ich warf einen flüchtigen Blick auf meine abtrünnige Mutter und sagte dann: »Na ja, ich muss ja jetzt mehr arbeiten, um für das Auto zu sparen. Ich glaube nicht, dass ich mir die Zeit nehmen kann, auf die Zwillinge aufzupassen.«
Dad nickte. »Du weißt, dass deine Stiefmutter und ich am nächsten Wochenende Hochzeitstag haben, und es würde uns sehr viel bedeuten, wenn du in deinem vollen Terminplan doch ein bisschen Zeit finden könntest, um uns aus der Klemme zu helfen.«
»Warum kann Nana nicht auf sie aufpassen?«
»Nana ist bis nächsten Dienstag in Atlanta. Außerdem hat der Arzt gesagt, sie soll sich nach ihrer Hüftoperation etwas schonen. Zwei Sechsjährigen ist sie im Moment einfach nicht gewachsen.«
»Tja, Dad, dann habt ihr wohl echt Pech gehabt. Hast du es Rhonda schon gesagt?«
Dad legte den Kartoffelschäler aus der Hand und sah mich unverwandt an. Für jeden anderen hätte dieser Blick den baldigen Tod bedeutet, aber ich hatte Glück und kam mit einer ernsten Verwarnung davon. Zwar hatte er mir seit Jahren nicht mehr den Hintern versohlt, aber der Blick aus seinen dunklen Augen verriet mir, dass der legendäre Gürtel gleich sein Comeback feiern würde.
Stattdessen sagte er sehr ruhig: »Samara, es würde mir viel bedeuten, wenn du uns diesen Gefallen tun könntest. Ich hatte seit Monaten kein freies Wochenende mehr, und die Reservierungen sind nicht erstattungsfähig.«
Meine Sturheit hatte ich wohl von ihm, denn es gelang mir, nicht einzuknicken.
»Wenn du mir nicht hilfst«, fuhr er fort, »könnte ich mich gezwungen sehen, meinen Teil der Abmachung bezüglich deines Wagens zurückzuziehen.«
Der Satz hing drohend in der Luft.
Ich erstarrte. »Was? Das kannst du nicht machen!«
»Ich bin erwachsen, und im Gegensatz zu dir kann ich mit meinem Geld machen, was ich will.«
Ich wollte schreien. Ich wollte etwas zerstören. Ich wollte ihm einen kräftigen Schlag auf seinen kahlen Hinterkopf verpassen. Ich musste cool bleiben, aber wie sollte ich, wenn ich diese ganze Ungerechtigkeit abbekam?
Es war kein Geheimnis, dass ich Rhonda und ihre Brut nicht mochte, und ich hatte gute Gründe dafür. Er wusste, dass ich alles für ihn tun würde, nur das nicht. Ich liebte meinen Dad, aber ich würde nicht zulassen, dass sich etwas zwischen mich und meinen neuen fahrbaren Untersatz stellte.
Ich räusperte mich und kramte mein geschliffenstes Vokabular und meine diplomatischste Stimmlage hervor. »Vater, gerade du solltest doch wissen, wie unklug es ist, eine mündliche Vereinbarung zu brechen.«
»Mündliche Vereinbarungen halten vor Gericht selten stand«, argumentierte er.
»Nicht, wenn jemand die Übereinkunft bezeugen kann.« Ich warf Mom einen Blick zu. »Mom ist Beteiligte und Zeugin der Abmachung. Diese neue Klausel war nicht Bestandteil des Abkommens und ist deshalb dem ursprünglichen Vertrag nicht zugehörig. Darüber hinaus führt dein Rücktritt vom Vertrag zum Bruch mit den Vertragspartnern, was bedeutet, dass das Wort eines Mannes nichts gilt und damit deine persönlichen ethischen Grundsätze in Frage gestellt werden.«
Ich stand da und wartete darauf, dass die Rückhand der Justiz mir den tödlichen Schlag versetzte. Aber es kam nichts.
Mom hörte auf zu rühren und sah über die Schulter. Nur das brutzelnde Gemüse in der Pfanne durchbrach die Stille.
Nachdem wir zwei Minuten versucht hatten, uns gegenseitig niederzustarren, sagte Dad: »Du redest wie eine echte Prozessanwältin.«
»Ich hatte den besten Lehrer.«
Langsam weichte ein Lächeln seine strengen Gesichtszüge auf. »Na schön, was willst du haben?«
Ich zögerte. »Was?«
»Was willst du haben? Ich kann die Reservierung nicht stornieren, also brauche ich dich, um auf die Zwillinge aufzupassen. Da ich dich nicht nötigen kann, versuche ich es eben mit der guten alten Bestechung.« Sein Lächeln wurde breiter.
Ich konnte es nicht glauben. Er gab mir einen Freischein für alles, was ich haben wollte. Ich war trunken vor Machtgefühl. Normalerweise war mein Kopf voll von boshaften Streichen, Plänen zur Ergreifung der Weltherrschaft und zum Umsturz von Hollywood, aber jetzt fiel mir nichts ein.
Schließlich redete Mom. »Darf ich einen Vorschlag machen? Da du den ursprünglichen Vertrag nicht kündigen kannst, erweitere ihn doch. Wenn sie auf die Zwillinge aufpasst, sorgst du dafür, dass sie genug hat, um sich das Auto zu leisten, auch wenn sie ihren Teil nicht ganz zusammenbekommt. Du legst nicht nur die gleiche Summe auf ihre Ersparnisse drauf, sondern zahlst die Differenz.«
Dad rieb sich nachdenklich das Kinn. »Das heißt also im Prinzip, ich bezahle den Wagen.«
»Nein. Wozu sollte das gut sein? Sie wird einen ordentlichen Batzen von ihrem eigenen Geld dazugeben.«
Ich ließ die Schultern fallen.
Sie sah mich aus schmalen blauen Augen an. »Guck nicht so. Ich habe im Fernsehen gesehen, wie diese Gören zum sechzehnten Geburtstag Ferraris und Yachten kriegen und ihren Eltern, die das alles bezahlen, dann auch noch frech kommen. So funktioniert das Leben aber nicht, und das lernst du besser jetzt als später. Dein Vater und ich glauben an den Wert harter Arbeit und dass man sich verdienen muss, was man haben will. Bildung ist wichtiger als der Name, der hinten auf deiner Jeans steht. Ich will auf keinen Fall, dass du so wirst wie Mia.«
Seit Mia und ich befreundet waren, hatte Mom nur wenig Toleranz für Mias protzige Lebensweise aufbringen können. Mom stammte zwar aus einem der reichsten Viertel in Williamsburg, doch ihre frühe Schwangerschaft hatte die schillernde Blase ein für alle Mal zum Platzen gebracht. Seit damals hatte sie sich strikt den Rabattcoupons und Sonderpreisaktionen verschrieben.
»Mom«, wimmerte ich.
»Ich meine es ernst. Die kleine Miss Treuhandkonto vermittelt dir eine falsche Vorstellung von Wohlstand. Wenn ich die schon sehe mit ihren Designerschuhen und Designertaschen, von denen wir ein halbes Jahr lang die Hypothek abzahlen könnten! Ich will nicht, dass du so bist, Samara.«
»Bin ich doch gar nicht.«
»Dann wirst du dich auch nicht gegen die Abmachung wehren, die dein Vater und ich für dich getroffen haben. Was du auf der Arbeit verdienst, legen wir noch mal obendrauf, und bis zum Herbst hast du deinen Wagen.«
Ich stand einen Augenblick regungslos da und kramte meinen inneren Taschenrechner hervor. Zweitausend Dollar auf dem Sparkonto plus zwei Monate Sklavenlohn. Das reichte noch nicht für meinen Anteil.
Ich wusste, dass der Vorschlag keine Chance hatte, aber ich musste es versuchen. »Was ist mit meinem College-Geld? Ich könnte doch einen Teil davon nehmen.«
»Nur über meine Leiche! Du rührst dieses Konto nicht an, bevor du achtzehn bist. Du gehst aufs College, und wenn es zu Fuß ist.« Dad machte sich nicht mal die Mühe, mich anzusehen, womit das Thema durch war.
»Ich frage Linda, ob ich ein paar Doppelschichten übernehmen kann.«
»Mach dich nicht kaputt, Kleines«, warnte Mom. »Du brauchst auch noch Zeit, um deine Jugend zu genießen. Die ist schneller vorbei, als du denkst.«
Ich umrundete die Kücheninsel, nahm die Hand meiner Mutter und legte sie auf mein Herz. Ich versetzte mich in den Theaterclub in der Zehnten zurück und deklamierte: »Alles muss einmal enden. Ihr tragt mir eine große Herausforderung an, doch ich werde mich ihr stellen, Mylady.«
Mom kicherte.
Dad warf uns einen missbilligenden Seitenblick zu. Ihn amüsierte diese ganze Sache überhaupt nicht. »Ich komme aus der Nummer wohl nicht mehr raus, oder?«
»Nee. Akzeptierst du die Bedingungen?« Ich streckte die Hand aus und wartete auf die Urteilsverkündung aus seinem Mund.
Nach gefühlten Tagen schlug er ein und brach mir dabei fast die Finger. Mein Herz machte einen Sprung, und sobald mein Magen aufhörte, Rad zu schlagen, wollte ich Mia anrufen und es ihr unter die Nase reiben. Ja, der Sieg würde mein sein!
»Wenigstens ist es für eine gute Sache. Diese Reise ist Rhonda sehr wichtig.« Er starrte geheimnisvoll lächelnd in die Ferne, voller Vorfreude auf die Zeit allein mit seiner besseren Hälfte. Nur Gott verstand, warum.
»Wo fahrt ihr überhaupt hin?«, fragte ich.
»Washington. Ich habe im Capital Hotel reserviert. Ist alles schon durchgeplant, mit Essengehen und Tanzen, das volle Programm.«
»Klingt gut«, sagte ich, als aus der Spüle ein ohrenbetäubendes Scheppern ertönte.
Dad und ich sahen zu Mom, die über die Arbeitsplatte gebeugt stand. Jeder Muskel in ihrem Körper schien angespannt zu sein. Nachdem sie tief Luft geholt hatte, entschuldigte sie sich und verließ den Raum, die Arme an die Seiten gepresst, die Hände zu Fäusten geballt.
Dad sah ihr nach, als sie um die Ecke verschwand, dann drehte er sich zu mir um. »Was hat sie denn?«
»Sie macht gerade einiges durch.« Ich schaltete den Herd aus und nahm das Essen herunter.
Er betrachtete mich eingehend und lehnte sich zu mir herüber. »Erzähl.«
»Na ja, erwartest du wirklich, dass sie sich über die Beschreibung freut, wie du mit dieser Frau in der Gegend rumfährst?«
Er blickte finster drein. »Du meinst, mit meiner Frau.«
»Haarspaltereien. Du hast praktisch vor ihr mit deiner Beziehung angegeben.«
Dad schüttelte den Kopf. »Das wollte ich nicht.«
»Ich weiß, aber sie ist da trotzdem etwas empfindlich. Sie ist fast 34 und unverheiratet. Sie macht sich nur schick, wenn du hier bist. Wusstest du, dass sie letztens Online-Singlebörsen rausgesucht hat?«
Dad sah mich entgeistert an und sagte eine Weile gar nichts.
»Moment mal, ist das dieselbe Frau, die immer allen in den Ohren gelegen hat, wie gefährlich dieses Online-Dating ist?«
»Verzweifelte Umstände erfordern verzweifelte Maßnahmen. Ich meine ja nur, du solltest ihr keine verwirrenden Signale geben und nicht vor ihr mit deinem neuen Leben prahlen, weil ich diejenige bin, die sie wieder aufbauen muss, wenn sie dann durchdreht, nicht du.«
»Du weißt, dass ich deine Mutter liebe. Es ist nur …«
»Du liebst sie so wie mich«, unterbrach ich ihn. »Das ist nicht dasselbe.«
Mom und Dad waren in der Highschool ein Paar gewesen, und, na ja, es war etwas zu flott zur Sache gegangen mit den beiden. Im Frühling ihres vorletzten Schuljahres kam ich dann. Das war der Startschuss für eine monumentale Familienfehde. Grandpa hätte Mom fast enterbt, weil sie ein Kind von einem »dieser Leute« bekam, also adoptierten Dads Eltern uns praktisch. Ich wusste sehr wenig über die weiße Seite meiner Familie, und was nie da war, kann man auch nicht vermissen. Nach der Highschool verlief die Beziehung dann mehr und mehr im Sand, und Mom und Dad gingen getrennte Wege, aber Dad hatte mehr Glück damit, sich ein neues Leben aufzubauen.
Dad stand auf und ging langsam zur Tür. »Ich gehe jetzt wohl besser. Sag deiner Mom, dass ich wegmusste. Ich rufe dich in ein paar Tagen an.«
»Ist gut.« Ich begleitete ihn hinaus.
Als er die Tür öffnete, zog er mich in eine seiner erstickenden Umarmungen. Obwohl mein Dad ein kräftiger Kerl war und strenger als ein Feldwebel, zeigte seine Kraft sich am ehesten in seinen Umarmungen. Wo ich auch war, sein Rasierwasser mit dem Eichenaroma würde mich immer an zu Hause erinnern.
»Übrigens«, flüsterte er, »es tut mir leid.«
»Ich weiß. Hab dich lieb, Daddy.«
»Hab dich auch lieb, mein Püppchen. Danke noch mal, dass du mir aus der Patsche hilfst.« Seine Lippen strichen über meinen Scheitel.
Ich befreite mich und zwang mich zu einem unechten Lächeln. »Keine Ursache. Fahr vorsichtig.«
Sobald ich die Tür zumachte, dröhnte die Stimme von Joni Mitchell durchs Haus, eine von Moms alten Depri-CDs, mit der sie gern ihre Selbstmitleidorgien einleitete. Ich wusste, dass sie nicht aus ihrer Höhle gekrochen kommen würde, bis sie von selbst dazu bereit war, also blieb das Abendessen heute an mir hängen.
Nachdem ich die Alarmanlage wieder eingeschaltet hatte, ging ich zurück in die Küche, um aufzuräumen. Zwei Stück Pizza von gestern Abend drehten sich in der Mikrowelle, während ich das halb gare Essen einwickelte und Eiscreme aus dem Gefrierschrank nahm. Ich balancierte die ganze Ladung nach oben, wobei ich darauf achtete, nicht auf die nervig knarrende Stelle auf der achten Stufe zu treten. Vor Moms Tür hielt ich an und klopfte in einem bestimmten Rhythmus ans Holz, ohne eine Antwort zu erwarten. Ich setzte Eiscreme und Löffel auf dem Boden ab und ging in mein Zimmer.
Mit dem Klicken des Lichtschalters wurde die Müllhalde sichtbar, die ich mein Zimmer nannte. Es war in Lindgrün gehalten, aber die Unordnung verbarg diese Farbe vor jedem, der hereinkam. Mein Bett stand an der Wand, damit ich genügend Platz hatte, um meine Tae-Bo-Moves zu üben. Die Hälfte meiner Klamotten war achtlos im Raum verteilt, zusammen mit zahllosen Büchern, DVDs und Zeitschriften.
Mir schwirrte immer noch der Kopf von der Aussicht auf ein neues Auto. Zuerst musste ich also Mia anrufen und mein »Siehste, sag ich doch« loswerden. So, wie sie bei unserer letzten Begegnung ausgesehen hatte, konnte sie Aufmunterung gebrauchen. Ich griff nach dem Telefon und ließ mich aufs Bett plumpsen, den warmen Teller voll fleischig-käsiger Köstlichkeiten auf dem Schoß.
Es klingelte dreimal, dann sagte eine dumpfe Stimme am anderen Ende: »Was ist? Lass mich einfach in Ruhe sterben.«
Ich starrte das Telefon an und hob es wieder an mein Ohr. »Mia? Hier ist Sam. Was ist los mit dir?«
»Mein Leben ist vorbei, das ist los.« Nach zwanzig Minuten Heulen, Jammern und Schluchzen hatte ich mir zusammengereimt, dass Doug tatsächlich eine Cousine von außerhalb zu Besuch hatte und jetzt nicht mehr mit Mia sprach, weil sie ihn mit ihrem BMW vors Schienbein gefahren war, als sie vom Parkplatz rauschte.
»Will er Anzeige erstatten?«, fragte ich, während ich das zweite Stück Pizza verdrückte.
»Nein, das würde er nie tun. Er ist nur sauer.«
»Vielleicht ist es besser so. Du solltest einen klaren Schlussstrich ziehen.«
Durch das Telefon trompeteten wieder Schnäuzgeräusche. »Du verstehst das nicht. Ich liebe ihn.«
Ich verdrehte die Augen. »Wenn du das so nennen willst.«
»Was soll das denn heißen? Ich erwarte gar nicht, dass du das verstehst. Du warst ja noch nie verliebt.«
Ich blickte finster drein. »Also, wenn das nur im Entferntesten dem ähnelt, was bei dir und Doug läuft und was meine Mom gerade durchmacht, dann verzichte ich dankend.«
»Was ist denn mit deiner Mom?«
»Sie surft in Online-Singlebörsen rum.«
Das Schniefen am anderen Ende der Leitung hörte auf.
»Hallo?«, sagte ich mit vollem Mund.
»Du machst wohl Witze? Dieselbe Frau hat uns gezwungen, jede einzelne Folge dieser Sendung zu sehen, in der Mädchen im Internet angebaggert werden!«
»Tja, ich glaube, sie fühlt sich einsam. Du weißt schon, das leere Nest und so. Und außerdem ist sie immer noch in meinen Dad verknallt«, erklärte ich.
»Wie geht’s dem schwarzen Meister Proper?«
Ich kicherte. »Ich geb dir zwanzig Dollar, wenn du ihm das ins Gesicht sagst. Das traust du dich nie.«
»Oh Gott, nein. Dein Dad macht mir Angst.«
Als ich Mia erzählte, dass er mich gebeten hatte, auf seine Dämonenbrut aufzupassen, sagte sie: »Oje, wie übel. Plötzlich geht’s mir viel besser. Kommst du morgen nach Virginia Beach?«
»Nee, ich muss vormittags arbeiten.« Beim Wort »arbeiten« fielen mir die aufwühlenden Ereignisse dieses Tages wieder ein. Ich dachte über die junge Frau auf dem Parkplatz nach und über Caleb, der so tat, als gäbe es sie gar nicht.
Als ich auflegte, wühlte ich auf dem Boden nach einem T-Shirt. Ich ließ mich aufs Bett fallen, drehte ein trockenes Stück Pizza zwischen den Fingern und tauchte in die Geisteswelt meines unheimlichen Kollegen ein.
Ich wusste nicht viel über ihn, außer dass er neunzehn war, aus einer Militärfamilie kam, den Großteil seines Lebens in Europa verbracht hatte und eine ungesunde Leidenschaft für Gebäck und schlechten Techno besaß.
Caleb hatte immer einen Schokoriegel oder einen Donut in der Hand, wenn er Pause machte. Außerdem hatte er ein Glas voller Münzen unter der Kasse für jedes Mal, wenn ihn eine Kundin fragte, ob er Kontaktlinsen trug. Eitel wie ein Pfau! Dass er Frauen wie benutzte Taschentücher wegwarf, machte ihn mir auch nicht sympathischer. Aber diese Augen waren schon seltsam, daher verstand ich die Neugier. Meine hatte er auf jeden Fall geweckt. Er hatte mich mit seinem leuchtenden, unheimlichen Blick in den Bann gezogen …
Oh Gott, ich musste aufhören. An ihn zu denken, verursachte mir Kopfschmerzen. Ich musste am nächsten Morgen arbeiten, und dieser Kerl war keinen weiteren Gedanken wert. Das musste ich meinem Gehirn einfach klarmachen.
4
Ach, Montage. Das Hamsterradrennen beginnt, und mit dem freien Willen ist es aus.
Montage waren in Buncha Books recht vorhersehbar. Morgens holten sich die normalen Geschäftsleute ihren Treibstoff, die echten Spinner waren erst nachmittags und an den Wochenenden dran. Einige Versprengte liefen verloren durch die Buchabteilung, einen Eiskaffee von Cuppa-Joe in der Hand. Ich schlenderte zum Informationsschalter und traf auf Linda, auf deren Stirn groß und deutlich »Leg dich nicht mit mir an« stand.
Ich flitzte an ihr vorbei und checkte ein. »Schlechte Nacht gehabt?«
»Ja«, erwiderte sie. »Ich habe gestern Abend mit der Polizei über das Mädchen auf dem Parkplatz gesprochen. Sie wollten wissen, ob jemand sie vor dem Zwischenfall gesehen hat.«
»Warum? Ich dachte, sie hätte einen Herzinfarkt gehabt.«
»Das sagen die Sanitäter auch, aber die Polizei kommt heute vorbei, um den Mitarbeitern ein paar Fragen zu stellen. Das Opfer hatte eine Tüte von uns im Auto, und der Notruf kam aus dem Laden«, sagte sie und bemühte sich dabei, nicht am Computer einzuschlafen.
Ich nickte, während mein Hirn auf Hochtouren lief. Lindas Erklärung ließ bei mir die Alarmglocken schrillen, und der imaginäre Zeigefinger deutete in eine ganz bestimmte Richtung.
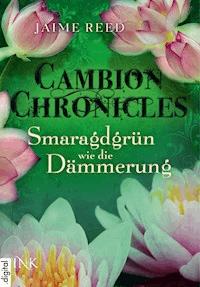











![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)
















